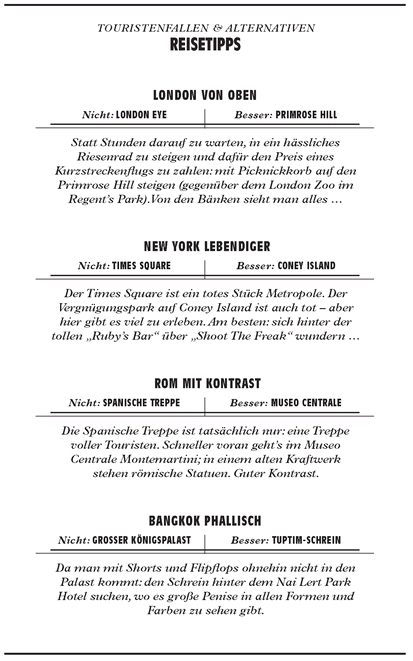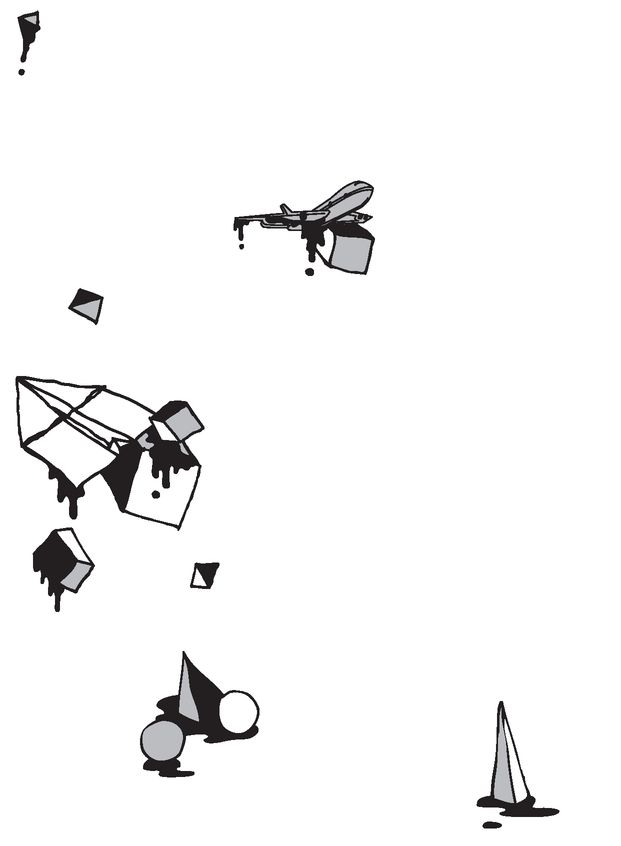02 WEIT REISEN
Soll ich endlich mal eine Weltreise machen - oder darauf vertrauen, dass ich im Leben auch so noch genug herumkommen werde?
Warum jedes Jahr 200 000 Deutsche ihre Heimat verlassen - Gute Frage: Geht’s bei deinen Reiseplänen vor allem darum, weg zu sein … oder darum, nicht mehr hier zu sein? - Warum es für die Karriere oft besser ist, keine Auslandserfahrung zu sammeln - Was zur Hölle ist ein „Lebensarbeitszeitkonto“? - Mit welchen Argumenten man seinen Chef dazu überreden kann, ein Jahr Urlaub zu genehmigen
Zu unseren größten Schwächen gehört nicht nur, immer das zu wollen, was wir nicht haben - sondern leider auch, immer dort sein zu wollen, wo wir gerade nicht sind. „Das ganze Unglück der Menschen rührt aus einem einzigen Umstand her“, schrieb irgendwann im 17. Jahrhundert der französische Philosoph Blaise Pascal, „nämlich, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können.“
Heute ist es noch schwerer geworden, entspannt zu Hause zu sitzen. Schon ein kurzer Blick in die Freundesliste bei Facebook oder studiVZ genügt nämlich, um zu erkennen: Mist, alle anderen sind unterwegs!
Matthias hat gerade noch ein paar Bilder online gestellt, es gab wohl wieder eine Party im Studentenwohnheim. Und wie Partys von Erasmus-Studenten so sind: Auf jedem der Fotos ist Matthias in den Armen entrückt lachender Frauen und Männer zu sehen, deren Namen man nicht kennt (er wahrscheinlich auch nicht), es sind Franzosen, Engländer, Italiener, Mexikaner und natürlich Portugiesen. Matthias hat Spaß in Lissabon, man glaubt es ihm. Olivia dagegen schreibt in ihrem Profil, sie habe „die Schnauze voll“, sie und Tobi sind nämlich in Bangkok gestrandet, die Anhänger von König Bhumibol halten den internationalen Flughafen besetzt, weil sie Ministerpräsident Sundaravej zum Rücktritt zwingen wollen, was wirklich ungünstig ist, weil Olivia und Tobi längst nach Peking weiterfliegen wollten. „Ich kann dieses Hostel nicht mehr sehen“, schreibt Olivia online, „ich bin es nicht mehr gewohnt, so lange an einem Ort zu bleiben! “Immerhin haben Tobi und sie schon acht Länder bereist, seitdem sie vor sieben Monaten im Stadtpark zum Abschied gegrillt hatten. Weltreise. Ein Jahr lang. Die übliche Tour: USA, Mittelamerika, Asien, zum Abschluss noch Australien. So ein Zufall - in Australien, diesem Freiheitstraum jedes Abiturienten, bleibt der gemeinsame Bekannte Simon jetzt „for ever!“, so verkündet es jedenfalls seine Facebook-Statusleiste. Nach der Schule war er auf den fünften Kontinent geflogen, um endlich mal auf sich alleine gestellt zu sein. Simon war so begeistert von der Arbeit auf der Olivenfarm, vom schlechtem Bier, der Wüste und den braungebrannten Körpern, dass er die Behörden überzeugte, sein Visum zu verlängern, er lernte Amy kennen und verlängerte seinen Aufenthalt abermals. Jetzt arbeitet er in einer Grafikagentur in Sydney.
TOLL, WIR SIND DIE FLEXIBELSTE GENERATION ALLER ZEITEN. WAS DAS BEDEUTET? FERNBEZIEHUNG!
Judit wiederum, die Frau mit den 784 Facebook-Freunden, hat das mit dem Ausland und dem Arbeiten gewissenhaft geplant. Für ein Jahr ist sie nun in Singapur, ihr Arbeitgeber hat sie an eine Tochterfirma abgegeben. Große Chance, schreibt Judit in einer Mail, Karriereschritt und so. Der Kulturschock sei zwar groß und die Leute sehr zurückhaltend, aber im Supermarkt gäbe es immerhin Philadelphia-Frischkäse.
Na dann, bis bald!
Wenn soziale Netzwerke im Internet tatsächlich für etwas gut sind, dann wohl dafür, in der ganz persönlichen Globalisierung den Überblick nicht zu verlieren. Seine Freunde nicht irgendwo zwischen dem freiwilligen sozialen Jahr in Mali und dem Praktikum in Brüssel zu verlieren. Um das gute Gefühl zu behalten, man wisse, wie es ihnen da draußen in der weiten Welt geht. Unsere Generation, das ist längst eine Binsenweisheit, ist flexibler und mobiler als alle vor ihr. Wer seine Zeit sonntagabends nicht im Internet verschwenden will, kann sich davon auch am nächstbesten Hauptbahnhof überzeugen. Er wird an Gleis eins und zwei kurz vor Abfahrt des Intercity in irgendeine andere mittelgroße Stadt oder Metropole fast nur eng umschlungene Paare sehen. Fernbeziehungen. Sie oder er hat eine kleine Reisetasche neben sich stehen, und die getauschten Blicke sind verliebt, aber ernst. Die Blicke sagen: Ich vermisse dich jetzt schon. Das schaffen wir. Irgendwann ist das vorbei. Bis nächstes Wochenende. Gute Fahrt, Liebste.
Was bedeutet schon die Entfernung Hannover - München (488 Kilometer) für eine Liebe, wenn man es doch seit dem Auszug von zu Hause gewohnt ist, die Hälfte des spärlichen Budgets für Bahntickets auszugeben, und man die letzten Jahre ohnehin nur aus einem kleinen Rollkoffer gelebt hat.
Ein paar Zahlen: Jedes Jahr verbringen rund 17 000 deutsche Schüler sechs bis zwölf Monate im Ausland. Jährlich erhalten 10 000 junge Deutsche ein Working-Holiday-Visum für Australien. Die Zahl der deutschen Studenten im Ausland hat sich seit 1980 auf über 50 000 nahezu verdreifacht. Dank des neuen Freiwilligendienstes „Weltwärts“können bis zu 10 000 Menschen zwischen 18 und 28 Jahren kostenfrei als Helfer in Entwicklungsländer entsandt werden. Die Star Alliance, der größte Verbund internationaler Fluglinien, verkauft jedes Jahr zahllose sogenannte Around-The-World-Tickets. Jeder dritte Unter-30-Jährige spielt mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen. Und ein attraktiver Job im Ausland ist den Deutschen mittlerweile wichtiger als die große Liebe. Solchen Worten folgen Taten: Pro Jahr verlassen über 200 000 Deutsche die Heimat, um vorübergehend als „Expats“im Ausland zu arbeiten, darunter sind Handwerker, Unternehmer, Akademiker.
Okay, alle mal durchatmen. Wir sind also auf der Flucht. Aber wer jagt uns? Einerseits scheint sich in Deutschland die Ansicht durchgesetzt zu haben, in der Ferne würden sich hiesige Probleme (Arbeitslosigkeit, Nachbarn, Johannes B. Kerner) in Luft auflösen. Unzählige erfolgreiche Fernsehsendungen (die Namen wie Goodbye Deutschland, Mein neues Leben XXL oder Umzug in ein neues Leben tragen) propagieren den Auswanderertraum.
Andererseits, und das betrifft uns wohl mehr, scheint es, als hätten wir verlernt, zwischen der Reise und der Karriere zu unterscheiden. Wir planen unsere Routen nicht mehr nach dem Lonely Planet. Viel schlimmer: Wir planen sie passend für unseren Lebenslauf.
Die Anthropologin Jana Binder hat im Jahr 2007 ihre Doktorarbeit über Backpacker geschrieben. Sie folgte den Rucksacktouristen, traf sie an den Strandbars, in den Schlafsälen und an den Souvenirständen Thailands,Vietnams und Kambodschas. Binder stellte fest: Backpacker sind im Grunde wahnsinnig erfolgsorientiert - und kokettieren nur mit Hippieklischees. Binder spricht von „Qualifizierungstourismus“und „Globalisierungstourismus“, sie sagt: „Uni-Abschluss, Auslandssemester, Praktika - das haben sie alle. Also wollen sie noch eins draufsetzen. Mit Backpacker-Erfahrung erfüllt man für Unternehmen die Kriterien des idealen Mitarbeiters: Man soll flexibel sein, ungebunden, sich schnell auf ungewohnte Situationen einlassen und sprachkompetent sein.“
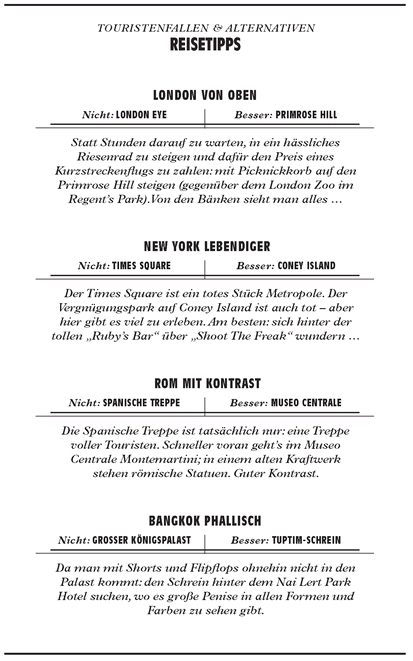
Wer heute auf Weltreise geht, will nicht langfristig aus dem Leben aussteigen, nur etwa zehn Prozent ziehen los, ohne zu wissen, ob sie wiederkehren. Mit dem Hippie-Trail haben Backpacker-Reisen daher nichts mehr zu tun, der Kulturwissenschaftler John Hutnyk schuf den viel treffenderen Begriff vom „banana pancake trail“. Hutnyks Beobachtung: In den meisten Ländern der Erde gibt es eigentlich nichts Süßes zum Frühstück, aber in den gängigen Backpacker-Hostels werden Bananenpfannkuchen angeboten, damit sich die Besucher nicht allzu sehr umstellen müssen. Hutnyks provokante Schlussfolgerung: Backpacker halten sich für bessere Menschen, reisen aber eigentlich nur Pfannkuchen nach und sind beleidigt, wenn sie keine bekommen. Und auch Jana Binder hat schließlich einen großen Widerspruch in der eingeschworenen Globetrottergemeinde festgestellt: Es sieht zwar so aus, als würden die vielen Menschen mit dem Holzschmuck und der betont staubigen Travellerkleidung in Bangkok, auf Ko Phangan oder in Guadalajara bloß abhängen - aber sie handeln in Wirklichkeit berufsorientiert, bewusst oder unbewusst. Die allermeisten von ihnen werden jedenfalls das Jahr Nichtstun später dick in ihren Lebenslauf schreiben. Die Pflichterfüllung kommt so unter dem Deckmantel der Persönlichkeitsentfaltung daher. „Alles zählt, jeder noch so banale Akt gewinnt an Bedeutung, wenn das Leben zur individuellen Erfolgsstory werden soll“, schreibt der Autor Holger Friedrich in seinem Buch Die Herausforderung Zukunft, in dem er einer ganzen Generation vorwirft, zu „Biografiebastlern“geworden zu sein. Beispiel gefällig? Vor einiger Zeit wurde das Bewerbungsschreiben eines Studenten für den Posten des Semestersprechers an einer deutschen Universität zur tausendfach weitergeleiteten Witz-Mail. In seinem Lebenslauf hatte der ehrgeizige junge Mann unter anderem aus einem Trip durch den Dschungel von Malaysia ein „Survivaltraining in einer 21-köpfigen islamischen Familie fernab jeder Zivilisation“gemacht, das seine „Sozialkompetenz“geschult und seine „Teamarbeits- und Integrationsfähigkeit verfeinert“habe.
AUSLANDSAUFENTHALTE SIND OFT KEIN ROMANTISCHER AKT MEHR - SONDERN STREBERTUM.
Was haben wir darüber gelacht. Aber so lustig ist das gar nicht. Auslandsaufenthalte sind kein romantischer Akt mehr - sondern das neue Strebertum. Offenbar gilt für Arbeitgeber: „Soft Skills“, also soziale Kompetenzen, können Jobbewerber am besten weit weg von zu Hause erlernen. Je weiter weg, desto besser.
Das Problem: Es ist schwer geworden, einem Personalchef überhaupt noch aufzufallen. 96,5 Prozent aller deutschen Studenten etwa sprechen Englisch. Perfekte Sprachkenntnisse in Wort und Schrift (und überdurchschnittliche Noten natürlich) sind demnach selbstverständliche Voraussetzung für fast jeden Job. Wer nie im Ausland war, keine weiteren Sprachen spricht und auch nicht mit sozialem Engagement punkten kann, hat schnell das Nachsehen: Bei großen Arbeitgebern landen solche Bewerbungen direkt im Papierkorb. Bei der Unternehmensberatung McKinsey (zugegeben eine der anspruchsvollsten Adressen) heißt es, die „Internationalität“der Kandidaten um freie Jobs stünde ganz oben auf der Anforderungsliste. Jedes Jahr bewerben sich 15 000 Menschen bei McKinsey, nur 300 werden genommen. „Polyglotte Mitarbeiter“bevorzugt man, und das nicht nur bei McKinsey, weil sie im Ausland einsetzbar seien und die Vielfalt weltoffener Persönlichkeiten ein „großer Erfolgsfaktor bei der Teamarbeit“sei.
Die absonderlichste These zum Nutzen der Auslandserfahrung, die man von Karriereberater zu hören bekommt, lautet: Sie bereitet auf eine mögliche Kündigung vor. Treffe den Arbeitnehmer einmal ein erzwungener Ortswechsel, beispielsweise nach einer Werksschließung, komme er damit leichter zurecht. Der Kriterienkatalog von McKinsey und Co. produziert aber leider nicht nur Zynismus, sondern auch genau das, was die Recruiter vorgeblich nicht wollen: immer ähnlichere Bewerberprofile. Es ist gar nicht lange her, da war ein Studienjahr in New York, Oxford oder selbst in Aix-en-Provence ein echtes Distinktionsmerkmal. Doch je mehr Leute ins Ausland gehen, desto aufregender müssen die Ziele sein. Die Generation der Lebenslaufoptimierer muss immer schneller, höher, weiter springen: ein Hilfsprojekt in der Südsahara anleiern, ein Praktikum bei der US-Notenbank machen, ein Tutorium an einer südkoreanischen Uni geben. So toll das Auslandsjahr für jeden einzelnen Studenten sein mag, für alle zusammen wird der Arbeitsmarkt unentspannter. Wirklich wahr: Selbst vermeintlich bodenständige Agrarwissenschaftler müssen sich heute für den globalen Wettbewerb im Ausland wappnen.
Eine Studie der Universität Bern zeigt nun aber, dass Hochschulabsolventen, die während des Studiums ins Ausland gehen, später nur geringfügig mehr verdienen als Graduierte ohne internationale Erfahrung. Und selbst dieser kleine Unterschied, so die Wissenschaftler, sei nicht auf den Auslandsfaktor zurückzuführen. Vielmehr sei es so, dass es sich nur die finanziell besser dastehenden Studenten leisten können, ihr Studium für ein Auslandssemester zu unterbrechen - und die haben im Schnitt auch die besseren Noten und damit bessere Arbeitsmarktchancen. Ein Zusammenhang zwischen Auslandsaufenthalt während des Studiums und Einstiegsgehalt, so die Studie, lasse sich jedenfalls nicht beweisen. Trotzdem preist die Europäische Union auf ihrer Homepage das Erasmus-Programm, das seit 1987 bereits 1,5 Millionen Studenten Semesteraufenthalte in Nachbarländern ermöglicht hat, als „Schlüsselfaktor bei der Arbeitsplatzsuche“. Bundesbildungsministerin Annette Schavan freute sich anlässlich des 20. Erasmus-Jubiläums: „Hier wächst eine Generation Erasmus heran, die fit ist für den globalen Wettbewerb und die ich als zukunftsweisend für die europäische Wissensgesellschaft betrachte.“
Darüber kann jeder ehemalige Erasmus-Student freilich nur lachen. Es sei denn, Annette Schavan spricht von einer Generation, die beim Wodkatrinken die europäische Zukunft plant. Es ist doch so: Eine gute Zeit wird das Auslandssemester bestimmt. Missen will es niemand, der es gemacht hat. Nur: Scheine und Kurse wird man an der fremden Uni nicht besonders viele machen. „Ich kenne Beispiele, bei denen Studenten ihr Studium eigentlich abgeschlossen haben und trotzdem über Erasmus ins Ausland gehen“, empört sich der Bildungsexperte Stefan Wolter von der Universität Bern, „da frage ich mich, was sie dort machen.“Das sei fast so, als ob die EU mit dem Stipendium ein Feriensemester bezahle. Mit dem eigentlichen Erasmus-Ziel, das akademische System eines anderen EU-Landes kennenzulernen und dort zu studieren, habe dies wenig zu tun. In Deutschland wird bereits ein leichter Rückgang bei der Zahl der Erasmus-Studenten verzeichnet. Der Grund: die Bachelor- und Masterstudiengänge. Die Studienzeit ist so knapp bemessen, die Lehrpläne so ambitioniert, dass es immer schwerer wird, ein Auslandsjahr zu nehmen. Man könnte sagen: Die neuen Studiengänge sollen die Studenten so flexibel machen, dass sie gar keine Zeit mehr haben, mobil zu sein.
Eine weitere Studie, diesmal von der Universität Mainz, räumt mit einem anderen Mythos der modernen Arbeitswelt auf; mit dem vom Auslandsjahr im Berufsleben. Sogenannte Expatriates, meist top ausgebildete Fachkräfte, werden von ihrem Arbeitgeber zu Zweigstellen in aller Welt geschickt. Lange galt so eine Entsendung als Karriereturbo. Aber die Mainzer Studie zeigt: Auslandsjahre werden überschätzt. 70 Prozent aller „Expats“erhoffen sich vor ihrem Umzug einen Schub für ihre Karriere. Aber nur für ein Drittel der Auslandsarbeiter erfüllt sich dieser Wunsch nach der Rückkehr. Der Grund: In der Zwischenzeit gibt es vielleicht einen neuen Abteilungsleiter, der einen gar nicht kennt, oder auf dem Platz von früher sitzt eine viel besser eingearbeitete Kollegin. Außerdem, so sagen Experten, machen sich Auslandsentsendete nach ihrer Rückkehr im Büro oft unbeliebt, weil sie missionarisch zeigen wollen, dass die Sitten ihres Gastlandes auch in deutschen Firmen alles verbessern würden. Vielleicht liegt es auch daran, dass die „Expats“falsch ausgewählt werden: Mit Ende 20 wollen fast alle Arbeitnehmer gerne weg, entsendet werden aber meist Leute mit langjähriger Erfahrung aus dem mittleren Management, die dann 35 oder 45 Jahre alt sind, oft Familie haben - und eigentlich sesshaft werden wollen.
„Man sollte Mobilität nicht per se feiern“, sagt der Soziologe Norbert F. Schneider von der Universität Mainz. 67 Prozent aller beruflich mobilen Menschen fühlen sich psychisch und körperlich stark belastet. Bei denen, die fest an einem Standort leben, sind es nur 20 Prozent. „Auch das Gegenteil von Mobilität kann im Berufsleben ein Soft Skill sein“, sagt Schneider, „die Beständigkeit. Kontakte aufrechtzuerhalten, etwas mit aufzubauen, verlässlich zu sein.“Klar: Wer schon in der Nachbarstadt Heimweh bekommt und auf Geschäftsreisen ins Hotelkissen weint, sollte sich nicht zwingen, wegzugehen, solange er nicht - was ja sehr verwunderlich wäre - einen Beruf anstrebt, bei dem man im Ausland einsetzbar sein muss. Und andersherum: Wer am liebsten nur unterwegs wäre, aber im Alter mehr erreicht haben will als eine Bambushütte für den Muschelverkauf gebaut zu haben, kann zum Beispiel in Freiburg den Master-Studiengang „Global Studies“wählen und nach vier Monaten im Breisgau je fünf Monate in Durban oder Buenos Aires und Neu-Delhi oder Bangkok studieren.
Wenn man es sich nun genau überlegt, kann der Auslandswahn in der Arbeitswelt auch ein großes Glück sein. Wenn Personaler meinen, aus jedem beliebigen Spaßurlaub einen wichtigen Lebensschritt machen zu müssen - ihr Problem. Immerhin fanden sie früher auf die Frage „Was ist Ihre größte Schwäche?“auch die Antwort „Schokolade“saukomisch und schlagfertig. Für die Bewerber bedeutet dieser Glauben an die „Internationalität“lediglich: Jede nicht zu ausgedehnte Lücke im Lebenslauf kann irgendwie begründet werden. Eigentlich muss niemand mehr Angst haben, vor lauter Studieren und Arbeiten nichts mehr von der Welt zu sehen. War das nicht immer die Angst junger Berufstätiger: Wegen des Jobdrucks auf eine große Reise zu verzichten - und diese später nie nachzuholen? Heute gibt es in jedem Lebensabschnitt die Möglichkeit, den Schritt ins Ausland zu wagen.
DIE ZEIT IM AUSLAND WIRD NICHT UNBEDINGT DIE KARRIERE BESCHLEUNIGEN. IST DAS SCHLIMM?
Man sollte sich bloß vorher klarmachen: Die Zeit im Ausland wird nicht zwangsläufig die Karriere beschleunigen. Aber das ist egal. Denn sie wird vor allem der persönlichen Entwicklung dienen, und davon werden zunächst wir selbst etwas haben, nicht die Arbeitgeber. Was Personalmenschen als „Soft Skills“bezeichnen, könnte man auch „Herzensbildung“nennen. Wichtiger, als mal „weg“zu sein, ist es vielleicht, mal „nicht da“zu sein, nicht nur die Heimatstadt zu verlassen, sondern gleich das Land. Mit Freunden und Familie nur noch per Skype verbunden zu sein. Der erste Tag im Auslandsjahr wird immer schlimm sein: Das eigene Französisch ist so schlecht, dass die Verkäuferin nicht versteht, dass man ein Vollkornbrot will. In der Wohnheimkammer riecht es nach Mottenkugeln. Auf dem kleinen Stadtplan ist die Universität nicht eingezeichnet. Dann läuft auch noch Coldplay im Radio. Die Weinflasche lässt sich nicht öffnen, der Korkenzieher ist verschwunden, dafür liegt im Koffer die Abschiedskarte der engsten Freunde - „Lass es dir gutgehen“, steht da, sehr lustig: Draußen auf dem Gang schreien irgendwelche Psychopathen unverständliches Zeug, und in der Brust ist ein ganz schweres Stechen zu spüren. Diese Sache geht überhaupt nicht gut los. Bei einem Auslandsaufenthalt wird man vor allem sich selbst neu kennenlernen, nicht unbedingt die Welt. Die sieht zwar überall ein bisschen anders aus, aber sie fühlt sich meist gleich an. Nein, man selber fängt bei null an. Man ist gezwungen, sich etwas aufzubauen. Man wird innerhalb weniger Wochen einen neuen Freundeskreis, einen neuen Alltag, vielleicht eine neue Beziehung begründen. Das bringt Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Ein Auslandsjahr wird uns nicht zu besseren Menschen machen, aber es kann uns ein besseres Gefühl geben: nämlich zu wissen, dass man es auch alleine schaffen kann.
Aber gibt es für den Schritt ins Ausland einen besten Zeitpunkt? Es gibt auf jeden Fall Phasen, die sich anbieten.
1. NACH DER SCHULE - Vorteile: So viel Zeit hat man nie wieder. So viele Angebote (Zivildienst im Ausland,Work & Travel, Au-Pair-Aufenthalte, Sprachreisen) auch nicht. Außerdem: Man weiß noch nicht, was man mal machen will, und findet es unterwegs vielleicht raus. Man lernt früh, selbstständig zu werden. Nachteile: Man ist so jung, dass man vieles noch gar nicht genießen und verstehen kann. Man wird auch nach dem Auslandsaufenthalt nicht wissen, was man mal machen will.
2. WÄHREND DES STUDIUMS - Vorteile: Billiger wird man nie wieder eine so tolle Zeit haben. (Für Erasmus-Studenten gibt es eine Unterstützung in Höhe von etwa 100 Euro pro Semester, eventuell Auslands-BAföG. Für jede Fachrichtung gibt es diverse Stipendien für weltweite Auslandssemester.) So viele Leute aus allen Ländern auf so engem Raum, das gibt es sonst nur bei einer Fußballweltmeisterschaft. Man muss nicht mal viel tun, um sie kennenzulernen; die Uni-Infrastruktur erledigt fast alles, die Erasmus-Partys den Rest. Nachteile: Man merkt rasch, dass deutsche Unis im europäischen Vergleich oft luxuriös sind. Leistungen an der Gast-Uni werden später nicht immer anerkannt. Man bleibt oft unter seinesgleichen (Erasmus-Studenten). Man verlängert wahrscheinlich seine Studienzeit. Und gelegentlich bringt man ein Alkoholproblem mit nach Hause.
3. NACH DEN ERSTEN JAHREN IM BERUF - Vorteile: Man verhindert Langeweile am Arbeitsplatz. Man weiß, was man will. Nachteile: Die Trennungsraten sind unter „Expats“sehr hoch. Und wenn Auslandsarbeiter ihre Kinder mitnehmen (Third Culture Kids), dann werden diese zwar mehrsprachig und weltoffen aufwachsen, aber Befragungen zeigen: Sie werden auch ein Leben lang ein Gefühl der Wurzellosigkeit mit sich tragen. Für die Expats selber wird nach dem Jahr die Rückkehr ins Büro schwierig und frustrierend - wenn nicht schon die Arbeit im Ausland schwierig und frustrierend war.
In dem ziemlich tollen Hollywoodklassiker „Holiday“von 1938 haben Cary Grant und Katharine Hepburn folgenden Dialog:
GRANT: „Ich werde Urlaub nehmen, solang ich brauche.“
HEPBURN: „Nur um Spaß zu haben?“
GRANT: „Nein, ich will herausfinden, warum ich arbeite. Die Antwort kann doch nicht sein, nur Rechnungen zu bezahlen und mehr Geld anzuhäufen. Ich werde es nicht herausfinden, während ich hinter irgendeinem Schreibtisch in einem Büro sitze. Also haue ich für eine Weile ab, sobald ich genug Geld zusammenhabe. Komme zurück und arbeite, wenn ich weiß, wofür ich arbeite. Ergibt das einen Sinn?“
Wer hat eigentlich gesagt, dass es aus dem Berufsleben keinen Ausstieg gibt, wenn man einmal drinsteckt? In Australien gibt es nach zehn Jahren im öffentlichen Dienst einen Anspruch auf drei Monate bezahlten „Long Service Leave“- auf eine Auszeit also. In Dänemark kann man nach drei Jahren Berufstätigkeit für sechs Monate mit einem Arbeitslosen tauschen und bekommt weiterhin 80 Prozent seines Lohnes. Jedem französischen Bürger steht per Gesetz nach sechs Arbeitsjahren - davon drei im selben Betrieb - ein sechs- bis elfmonatiges unbezahltes „congé sabbatique“zu. Die Zeit soll genutzt werden für Weiterbildungen, Umschulungen, Reisen, zur Neuorientierung oder für soziales Engagement. In Deutschland aber hat sich das Prinzip „Sabbatical“noch nicht durchgesetzt. Der Begriff stammt aus den USA, wo die Uni-Professoren sich seit langem für ein Jahr statt dem Lehrbetrieb nur der Forschung widmen, und ist abgeleitet vom Sabbatjahr, das in der Bibel ein Ruhejahr für den Acker bezeichnet. Nach sechs Jahren Bewirtschaftung wird das Feld ein Jahr lang brach liegen gelassen. Orthodoxe Juden beachten das Gebot noch heute. Und auch wenn viele das nicht wissen: Auch in Deutschland gibt es mittlerweile Möglichkeiten, das … äh … Feld mal Feld sein zu lassen.
Beamte können zwei bis sechs Jahre für nur zwei Drittel bis sechs Siebtel des normalen Gehalts arbeiten. Und sich dann dafür anschließend ein Jahr lang freistellen lassen - für zwei Drittel bis sechs Siebtel der Bezüge. Für Nichtbeamte gibt es seit 2001 das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), das eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit vorsieht. Voraussetzung ist allerdings eine Betriebsgröße von mehr als 15 Mitarbeitern und eine bisherige Beschäftigungsdauer von mehr als sechs Monaten. Durch das TzBfG ergibt sich aber kein gesetzlicher Anspruch auf ein Sabbatical. Vorgesetzte können aus betrieblichen Gründen immer die Zustimmung verweigern.
Laut einer Forsa-Umfrage träumen 38 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer von einem Sabbatical - und würden dafür auf Gehalt verzichten. Aber nur etwa drei Prozent der Arbeitnehmer machen ihren Traum wahr. Was vielleicht daran liegt, dass 56 Prozent der Befragten durch ein Sabbatical berufliche Nachteile befürchten. Dabei braucht, wer wirklich eine lange Auszeit nehmen will, bloß gute Gründe - und ein Modell, das er seinem Chef vorschlagen kann, möglichst lange im Voraus.
LEBENSARBEITSZEITKONTO: Überstunden oder gesparte Urlaubstage werden auf einem Arbeitszeitkonto angespart.
TEILZEIT: Es werden zum Beispiel drei Jahre 40 Stunden pro Woche gearbeitet, aber nur 30 Stunden bezahlt. Das vierte Jahr ist dann frei.
KÜNDIGUNG DER ARBEITSSTELLE: Nach einer längeren unbezahlten Pause steigt man in eine neue Anstellung ein. Allerdings zahlt der Arbeitgeber bei Kündigung oder unbezahltem Urlaub nicht die Sozialversicherungsbeiträge weiter - man muss sich selber darum kümmern.
So makaber es klingt: In Krisenzeiten steigt die Chance, ein Sabbatical nehmen zu können. Immerhin haben große Konzerne aus Spargründen bereits auf Kurzarbeit umgestellt. Ein Sabbatical spart Personalkosten. Außerdem kommt bei Vorgesetzten langsam an: Das Arbeitsleben ist dynamischer denn je, also braucht es auch Ruhephasen. Und erholte Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter. Das Beste an einer vorübergehenden Auszeit vom Berufsalltag ist aber: Man hat wirklich Zeit für sich. Man reist nicht zweckmäßig, nicht, weil man irgendwo ankommen will wie in jungen Jahren. Sondern nur, um wegzukommen. Vielleicht kann man nur so zum eigentlichen Sinn einer großen Reise zurückfinden.
Denn die Sehnsucht nach einem Sabbatjahr ist vor allem ein weiterer Beleg dafür, dass die Weltreise der vielleicht kollektivste Traum der Wohlstandsgesellschaft ist. Wer sich vor dem Berufsleben nicht schon auf Rucksacktour gemacht hat, aber immer davon geträumt hat, mal aus seinem Alltag rauszukommen, einen tieferen Sinn zu finden irgendwo zwischen Palmen oder Bergen, der wird es immer bereuen. Das Sabbatical bietet die vielleicht letzte Chance vor dem Ruhestand. Endlich kann man selbst all das erleben, was man aus so vielen Erzählungen der Weltgereisten kennt. Es nervt schließlich, sich von anderen den eigenen Traum berichten zu lassen.
Nun könnte man sagen, eine Reise ist nichts anderes als ein sehr langer Urlaub. Aber: Reisen hat nichts mit Urlaub zu tun. Der Urlaub ist ein sehr langes Wochenende. Strand statt Büro. Sex statt Streit. Buch statt Fernsehen. 71 Prozent der Deutschen sagen, sie fahren in den Urlaub, um sich zu entspannen und sich vom Alltagsstress zu erholen. Nur sieben Prozent wollen Land und Kultur kennenlernen. Klar, der Urlaub soll unseren Akku aufladen, soll uns möglichst schnell wieder auf Vordermann bringen. Das ganze Jahr über freut man sich auf das Postkartenidyll - nur um schon nach fünf Tagen auf dem Balkon des niedlichen Hotels zu sitzen und sich zu fragen: Und jetzt?
Der Schweizer Philosoph Alain de Botton, der in London lebt und sich ausführlich mit der Kunst des Reisens beschäftigt hat, schreibt: „Wir sind offenbar am ehesten irgendwo ganz da, wenn es uns erspart bleibt, außerdem leibhaftig an diesem Ort anwesend zu sein.“Er meint: Wir nehmen leider nicht nur unsere Badehose mit auf die Urlaubsinsel, sondern immer auch uns selbst. Unsere Gedanken, unsere Sorgen, unsere Ängste und Probleme. Ein Urlaub wird nie so ungetrübt sein, wie es die Prospekte versprechen.
Eine Weltreise verspricht erst gar keine Idylle. Stattdessen völlige Unberechenbarkeit - und deswegen verspricht sie auch nichts Falsches. Eine Weltreise wird immer anstrengend werden. Zwar ist sie eine Auszeit vom Leben, wie man es kennt - aber das Leben, das man unterwegs kennenlernen wird, ist auf keinen Fall leichter, gemütlicher, es riecht auch nicht besser und ist nicht immer sauber. Die Weltreise, das darf man verraten, wird erst dann am schönsten sein, wenn sie vorbei ist. Und sie wird schon nerven, bevor sie angefangen hat, denn wer davon träumt, sich ein Jahr lang nur treiben zu lassen, der muss genau das gut planen.
Es fängt mit der größten Hürde an. Was kostet so eine Weltreise? Schnelle Antwort: ziemlich viel Geld. So viel wie ein Kleinwagen vielleicht. Zwischen 12 000 und 25 000 Euro, je nach Dauer und Standard natürlich. Die Lebenshaltungskosten, das lässt sich schon mal sagen, werden auf jeden Fall unter denen bleiben, die im gleichen Zeitraum zu Hause anfallen würden.
Das Weltreisebudget kommt am besten auf ein Tagesgeldkonto, wo es noch ein paar Zinsen bringt, oder man überweist per Dauerauftrag oder Telebanking regelmäßig Geld auf ein Girokonto und hebt dann mit Kredit- oder EC-Karte ab.
VOM LEBEN GELERNT
RISEN
“Man benötigt auf Reigen zwei Hosen. Eine für tagsüber. Und eine für die Nacht.”
JAMES HETFIELD
"Metallica " -Sänger
"Meine erste Reise nach Hollywood begann mit einer Panikattacke. Auf dem Flugticket stand, Los Angeles’! Wei soll ein Mädchen von einer Farm in Südafrika wissen, dass das Zentrum der weltweiten Filmindustrie mur ein Sadtteil ist?"
CHARLIZE THEROM
Schauspielerin
"Hätte ich doch ein Auslandssemester gemacht!"
KLAUS WOWEREIT
Bürgermeister von Berlin
“Das Glück ist da, wo man nicht ist. Daheim träume ich von der Ferne. Unterwegs träme ich von meiner Frau. Das entspricht dem Krankheitsbild des romantischen Menschen.”
REINHOLD MESSNER
Bergsteiger
“Die Ureinwohner Amerikas halten Wolkenkratzer für, negativen Raum’. Himmel und Land dagegen für, positiven Raum’. Ich mag diese Denkweise.“
JIM JARMUSCH
Regisseur
Die goldene Regel: realistisch kalkulieren. Entscheidend ist nicht, was man unmittelbar für die Reise ausgibt, sondern die Summe, die man verfügbar haben muss, um die Reise durchführen zu können. Mit Australien, Neuseeland und Japan hat Deutschland bilaterale Abkommen über „Working Holiday“-Visa abgeschlossen. Diese ermöglichen einen Aufenthalt von bis zu zwölf Monaten und eine Erwerbstätigkeit von 90 Tagen. Wer sich rechtzeitig darum kümmert, kann also unterwegs seine Reise finanzieren. Aber auch dann gilt: Man muss den Überblick behalten, sich ein Tagesbudget setzen, nach jedem Länderwechsel einen Kassensturz machen - und die Ausgaben unterscheiden. Es entstehen:
ENTFERNUNGSABHÄNGIGE KOSTEN: Flugtickets, Überlandtransporte, Taxi- oder Busfahrten vom Flughafen etc.
EINMALIGE KOSTEN: Papiere (in einigen Ländern müssen Pässe maschinenlesbar sein, biometrische Daten enthalten und/ oder bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein), Visakosten (Visa braucht man für rund 100 Länder, für welche steht unter
auswaertiges-amt.de. Wer gute Ner ven hat, kann sich die Visa unterwegs besorgen, wer Geld übrig hat und sich nicht kümmern mag, kann kommerzielle Visadienste wie
visum.de,
visaexpress.de oder
visadienst.com den ganzen Papierkram übernehmen lassen), Reiseausrüstung, Impfungen, Aktivitäten unterwegs (Tauchkurs, Sprachschule, Touren), Abschiedsparty.
LAUFENDE KOSTEN: Unterkunft, Essen und Trinken.
NEGATIVE KOSTEN (JA, WIRKLICH): Steuerjahresausgleich für Jahre, in denen nur teilweise gearbeitet wurde, Untervermietung der Wohnung, Arbeit unterwegs.
Die wichtigste Regel, die echte Reiseprofis aufgestellt haben, kommt jetzt: Die
EIN-VIERTEL-REGEL. In fast allen Ländern geht das Tagesbudget zu gleichen Teilen für vier Dinge drauf:
1. Unterkunft
2. Essen und Trinken
3. Sightseeing und Transport
4. Sonstiges (Wäscherei, Internet, Friseur, Bücher)
Logische Schlussfolgerung: Bei einem Tagesbudget von 30 Euro darf die Unterkunft nicht mehr als 7,50 Euro kosten. Einzige Ausnahme: Strände. Hier sind die Unterkünfte teurer, dafür entfallen Transportkosten. Apropos gute Hotels. Die werden einen auf der Weltreise spätestens dann reizen, wenn man die indischen Linsen nicht mehr bei sich behalten kann - aber gute Hotels sind überall auf der Welt einsam. Am meisten passiert dort, wo es keinen Service gibt, wo die Einheimischen verkehren … und natürlich die Backpacker. Wer alleine reist (was immer teurer ist), wird an diesen Orten schnell Leute kennenlernen, aber auch schneller in unangenehme Situationen kommen als in einem standardisierten Vier-Sterne-Zimmer, in dem Klimaanlage und Satellitenfernsehen vergessen lassen, wo man ist. Sowieso: nicht zu viele Kommunikationsmittel nutzen! Kein Handy mitnehmen!
Laufend aktualisiert finden sich im Internet Preisindizes für alle Länder dieser Welt. So kostet ein Tag in Argentinien etwa 25 Euro, in Australien schon 50 und in Japan gar 70 bis 100 und auf Französisch-Polynesien stolze 100 bis 200 Euro. Das billigste Land der Welt? Wahrscheinlich Indien (10 bis 15 Euro). Ähnlich aussagekräftig ist der „Big-Mac-Index“, der auflistet, wie teuer ein Big Mac im jeweiligen Land ist. Europa liegt da mit 4,54 US-Dollar weit vorne, im Herkunftsland USA kostet der Fleischklops 3,57 US-Dollar - und in der Ukraine zahlt man nur 1,32 US-Dollar. Wem solche Beträge völlig egal sind, weil er viel Geld, aber wenig Zeit hat, der sollte spätestens jetzt aufhören zu lesen und sich gleich eine straff organisierte Luxusweltreise buchen, von der Jules Vernes nicht mal zu träumen gewagt hätte. Es gibt da wirklich sehr schöne Angebote im Bereich zwischen 100 000 und 200 000 Euro …
Alle anderen, also wohl die allermeisten von uns, müssen ihre Route individuell planen. Und sich erstmal fragen: Was will ich mit dieser Reise erreichen? Fremde Kulturen kennenlernen? Sprachen lernen? Sehenswürdigkeiten besuchen? Abstand bekommen? Menschen treffen? Gut, dann der zweite Gedanke: Welche Länder will ich dafür besuchen? Es gibt einfache Länder (USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Singapur, Malaysia) und schwierige Länder (China, Russland, Ägypten, Bangladesh), sehr sichere (Japan, Singapur, Vatikan, Neuseeland, Nordeuropa, Dubai) und sehr gefährliche (Irak, Somalia, Nigeria, Afghanistan, Kolumbien, Haiti, Jemen, Kongo). Ein paar Ziele, die man immer schon sehen wollte, werden einem gleich in den Sinn kommen, das könnten die Eckpfeiler für die Planung sein. Alle Länder wird man nicht besuchen können. Das Reisetempo sollte nie der Anzahl der Länder angepasst werden - nur umgekehrt.
Entscheidend für die Routenplanung ist auch das Klima. Regionen mit klassischem Klima können am besten während der dortigen Sommermonate besucht werden. In der Nähe des Äquators hingegen, wo Trocken- und Regenzeiten herrschen, sind die Sommermonate heiß und feucht, der Winter ist trocken und warm (kein Monsun, keine Hurrikan). Experten empfehlen außerdem, mit der Sonne zu reisen, weil der Jetlag dann weniger schlimm ist. Und sich für eine Erdhalbkugel zu entscheiden, weil ein Wechsel zwischen Nord und Süd zeitfressend und teuer wird.
Wer weiß, wo er hin will auf seiner Reise, sollte überprüfen, ob es überhaupt möglich ist, diese Orte sinnvoll in einen Reiseplan zu packen. Der klassische Weg um die Erde ist das Around-The-World-Ticket. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den flexiblen Tickets, die zum Beispiel Star Alliance, SkyTeam oder One- World anbieten, und Paketen von Einzeltickets, die manche Reisebüros zusammenstellen. Die Pakete sind oft billiger, aber zeitlich starr. Bei den flexiblen Tickets muss man die Route meistens vorher grob bestimmen, doch die Flüge bleiben oft umbuchbar. Je nach Gesamtstrecke kosten solche Tickets 1700 bis 3000 Euro, die Grundregeln sind ähnlich: Man darf maximal ein Jahr unterwegs sein, muss sowohl Atlantik als auch Pazifik überqueren, darf nicht die Richtung ändern und muss am Ende wieder im Ausgangsland ankommen. Around-The-World-Tickets haben aber auch Nachteile: Der Preis hängt neben der Route meistens vom Datum des ersten Flugs ab, was bei vielen typischen Konstellationen mit Abflug im Winter dazu führt, dass man Hochsaisonpreise zahlt. Man ist außerdem auf das Streckennetz der jeweiligen Airline-Allianzen beschränkt. Regionen komplett ohne Allianzpartner sind Indien, Zentralamerika und der größte Teil von Afrika (mit Ausnahme von Südafrika). Auch das Umbuchen kann sich in der Praxis als schwierig erweisen. Routenänderungen scheitern oft an der Inkompetenz der Ansprechpartner vor Ort. Außerdem wird häufiges Umbuchen schnell teuer. Die Around-The-World-Tarife sind zudem einer niedrigen Buchungsklasse zugeordnet. Auf stark nachgefragten Strecken sind manchmal nur wenige Sitze pro Flug für diese Buchungsklasse frei gegeben. Dadurch kann es passieren, dass man nicht zur gewünschten Zeit fliegen kann. Es kann also praktischer und lohnender sein, sich selber Einzelflüge zusammenzustellen (wenn man genau weiß, wann man wo sein will), Gabelflüge zu buchen (wenn man in einer Region viel über Land reisen will) oder vor Ort jedes neue Ticket zu besorgen (wenn man in Bangkok ohnehin schon als Verhandlungsprofi gilt).
GUTER RAT VON WELTREISE-EXPERTEN: LASS AUF JEDEN FALL DEIN HANDY ZU HAUSE!
Nee, es geht leider immer noch nicht los. Bevor es ein Jahr lang gar keine Verpflichtungen mehr gibt, warten vor der Abreise noch einige Dinge:
SICH SCHÜTZEN: Zum Zahnarzt gehen, damit nicht die Beduinen in der Wüste den Weisheitszahn ziehen müssen, Impfungen (unbedingt:Tetanus, Polio, Diphtherie, empfehlenswert: Hepatitis A und B, eventuell wichtig: Gelbfieber, Tollwut, Typhus) und je nach Reisegebiet eine Malariaprophylaxe oder Malariamittel. Eine Prophylaxe, also die vorbeugende Einnahme der recht starken Medikamente, ist zwar ein besserer Schutz, aber die Nebenwirkungen sind nicht zu unterschätzen. Alternative: Die Mitnahme eines Standby-Mittels, das im Fall einer Erkrankung schnellstmöglich eingenommen werden muss. Malariamedikamente sind teuer. In Deutschland jedenfalls. In Asien bekommt man die gleichen Produkte viel billiger - muss aber den Tabletten blind vertrauen, ein Beipackzettel ist meistens nicht dabei.
SICH VERSICHERN: Ohne Versicherung auf Weltreise zu gehen ist grob fahrlässig. Die Kosten einer Krankenhausbehandlung im Ausland für Unversicherte können schnell Hunderttausende Euro betragen. Leider ist aber auch eine Auslandsversicherung nicht billig, die Kosten dafür können bei einer Weltreise bis zu 50 Prozent der Gesamtausgaben erreichen. Gesetzliche Krankenkassen versichern meistens nur im europäischen Ausland, die privaten Zusatzpolicen gelten oft bloß bis zu sechs Wochen. Für gesonderte Auslandsversicherungen empfiehlt der Lonely Planet zum Beispiel den Anbieter „World Nomads“: Der Versicherungsschutz lässt sich auch von unterwegs verlängern und umfasst Extravaganzen wie Bungeejumping und Elefantenritte, die sonst häufig ausgenommen sind. Obendrein bietet sich eine Rechtsschutzversicherung ebenso an wie eine Haftpflichtversicherung. Das Reisegepäck extra zu versichern ist dagegen unverhältnismäßig teuer.
ZU HAUSE ALLES REGELN: Nachsendeantrag? Steuererklärung? Gibt es Freunde, die sich um eventuell wichtige Post kümmern können und ab und an die Kreditkartenrechnung auf Missbrauch kontrollieren? Oder auf Übermut?
Sich vorbereiten: Reiseführer lesen, passende Musik („Around the World“) auf den iPod spielen, um Stress zu vermeiden auch schon mal ein erstes Hotel in der Ankunftsmetropole buchen.
PACKEN (KEIN ZU GROSSER RUCKSACK!): Eine gute Packliste findet man im Internet unter
onebag.com.
LETZTE MASSNAHMEN: Nicht mehr verlieben, Zeitung abbestellen. Und die Notfallnummer des Auswärtigen Amts notieren: + 49 30 50 00 20 00.
Irgendwann wird dann der Tag der Abreise kommen. Die Lust ist einem eigentlich schon vergangen. Es macht keinen Spaß, eine Weltreise zu planen. Außerdem kommt jetzt die Angst vor der Überforderung. Aber: Eine Weltreise ist auch kein Spaß. Es macht keinen Spaß, in El Salvador überfallen zu werden, es macht keinen Spaß zu schwitzen, von Moskitos zerstochen zu werden, thailändische Ladyboys für Frauen zu halten, eine Schlange in der Reisetasche zu entdecken. Man muss sich auf einer Weltreise viele Glücksmomente erarbeiten, man wird den Freunden stolz von all den Abenteuern erzählen. Wie bei einem Fallschirmsprung wird man sich später denken: Gut, dass ich mich dazu gezwungen habe. Und man wird beim Geschichtenerzählen merken: Es gibt ihn wirklich, diesen Ort. Heimat. Das ist nicht das sichere Wohnzimmer. Sondern das Gefühl, im vergangenen Jahr vermisst worden zu sein. Sich auf Anhieb wieder zu verstehen. Nach einer Weltreise kann man das Zuhause wieder lieben. Man wird in ein tiefes Loch fallen, klar, man wird erschreckt sein, wie schnell einen die Hast wieder befällt. Die Routine.
Klar ist: Man kann die Welt heute auch sehen und verstehen, ohne zu reisen. Google Maps und wagemutigen Vorreisern sei Dank. Klar ist auch: Viele Orte unseres Planeten sehen faszinierend aus, überwältigend, schön, ungewohnt, aber man sollte nicht denken, dort den Dingen zu entkommen, vor denen man geflohen ist. Juan Moreno, Autor und Journalist, war ein Jahr lang unterwegs, in 18 Ländern. Er schrieb darüber: „Ich glaube, dass nach diesem Jahr die Qualität meiner Zweifel besser ist.“Was Moreno meint: Er wollte unterwegs das Leben der Menschen kennenlernen, aber er wollte nie versuchen, es nachzuleben. Viele Backpacker halten sich gerade deshalb für Helden, weil sie sich nicht wie Touristen verhalten. Aber man wird unterwegs immer Tourist sein. Andere Touristen werden immer vor einem da gewesen sein. Und man wird immer Zuschauer bleiben, egal wie tief man im Schlamm steht. Man ist keiner von diesen Einwohnern. Und man tut den Leuten keinen Gefallen, wenn man möglichst wenig Geld in ihren Ländern lässt.
Die Backpacker-Forscherin Jana Binder hatte einige Weltreisende gebeten, ihr regelmäßig von unterwegs Bilder zu schicken. Binder wunderte sich. Denn alle Backpacker fotografierten das Gleiche: viele exotische Motive, Altare, traditionell gekleidete Menschen, schmutzige Kinder - und dann ganz viel Strandromantik, lachende Mädchen, braungebrannte Typen, eine feiernde Backpacker-Gemeinde, die sich in der Fremde kennenlernt. Binder erkannte in diesen Gegensätzen: Die Weltreisenden reduzieren die Gastländer meist auf die Exotik, kommen den Menschen dort weniger nah, als sie denken, sich dagegen umso mehr. So bildet sich auf der Welt eine Parallelgesellschaft von Weltreisenden aus, die sich immer besser verstehen, aber die Gastländer kaum.
MAN TUT ÄRMEREN LÄNDERN KEINEN GEFALLEN, WENN MAN MÖGLICHST WENIG GELD AUSGIBT.
Vielleicht ist das aber auch gar nicht schlimm. Vielleicht versteht man auf einer Weltreise gerade deshalb was wahre Armut bedeutet, weil man erkennt, dass man nie davon betroffen sein wird. Juan Moreno schreibt: „Der Unterschied zwischen den armen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und mir ist die Auswahl die ich habe und die sie nicht haben. Ich habe die Wahl, vier Monate jeden Tag Reis mit Bohnen zu essen. Ich habe die Wahl, über meine Zufriedenheit mit meinem Leben nachzudenken. Ich habe die Wahl, den Fahrer zu bitten, den Bus anzuhalten. Die anderen Menschen hatten diese Wahl nicht.“
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis einer Weltreise wird vor allem Menschen beruhigen, die an der Auswahl an Möglichkeiten, für die Karriere ins Ausland zu gehen, verzweifeln. Die Erkenntnis lautet: Es gibt Schlimmeres als die Multi-Options-Gesellschaft.