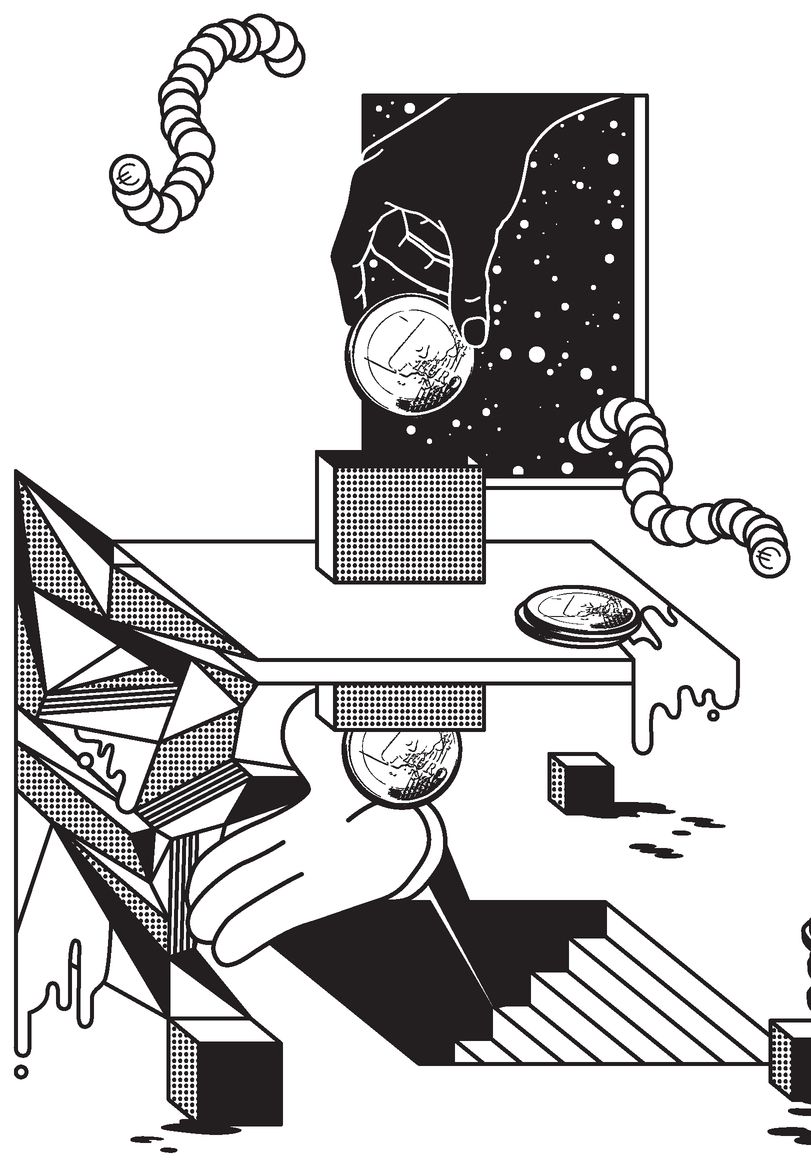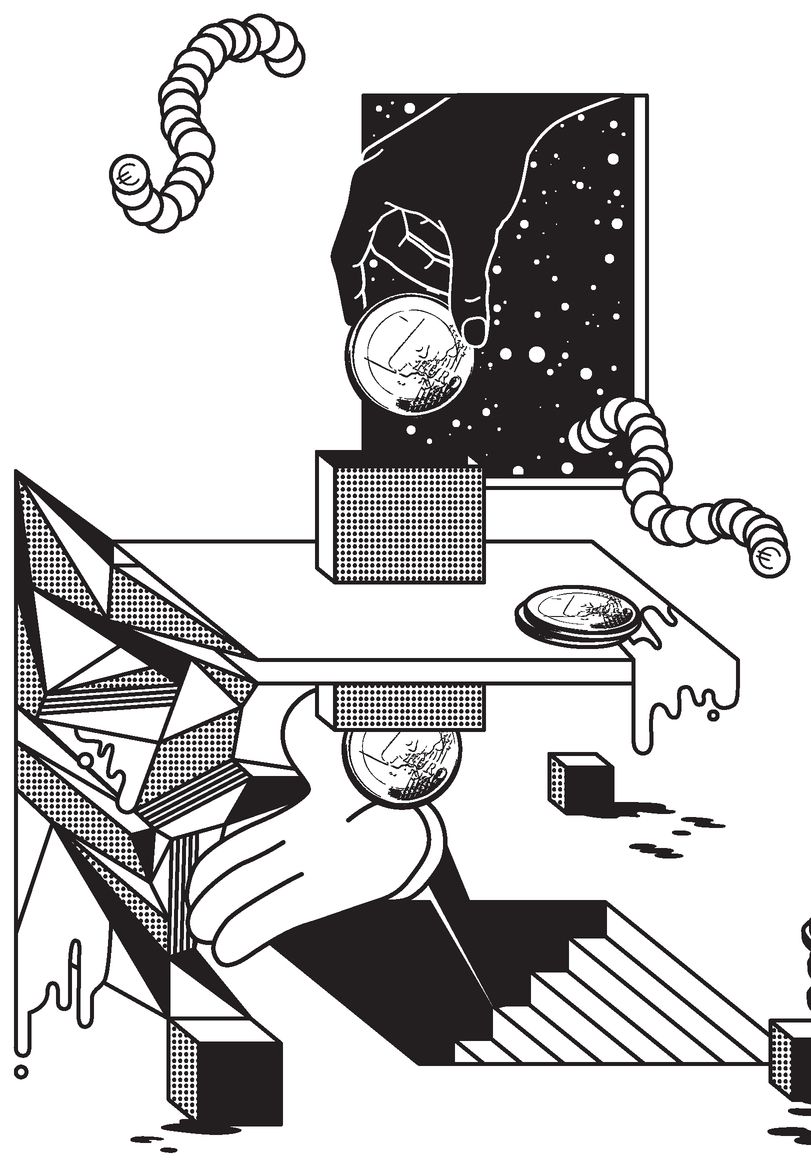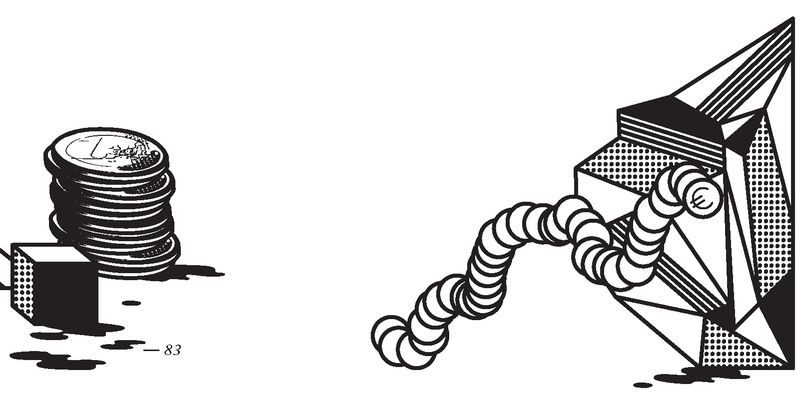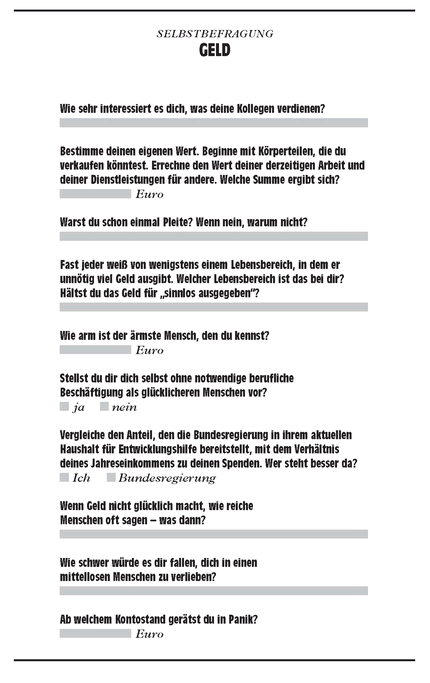04 GELD
Soll ich mein Geld sorgsam zusammenhalten - oder über vernünftige Spar-Appelle ignorieren und erstmal das Leben genießen?
Wieso wir glauben, dass das Glück immer nur einen Einkauf entfernt ist - Der Unterschied zwischen Sparern und Geizhälsen - Der „Plan B“für alle, die über die Runden kommen wollen, ohne viel zu arbeiten (doch, es gibt ihn!) - Und außerdem:Wie gut sind die Gewinnchancen im Lotto jetzt eigentlich wirklich?
Ehe sich die weltweite Finanzkrise im Herbst 2008 abzuzeichnen begann, wirkte Ignoranz in keinem anderen Lebensbereich so grundsätzlich sympathisch wie in Wirtschafts- und Finanzfragen. Es fällt uns schwer, Menschen ernst zu nehmen, die sich nicht für Kultur oder Politik interessieren. Wir finden Menschen suspekt, denen Kino egal ist, Sport gar nichts gibt oder die „zu Hause eigentlich nie Musik hören“. Aber seltsamerweise galt es gerade unter jungen Erwachsenen als gesellschaftlich völlig akzeptabel, den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung ungelesen auszusortieren oder auch nur treudoof zu grinsen und die Schultern zu zucken, wenn irgendwer einen Vortrag hielt über Baisse, Hausse, Derivate, Hedgefonds, Anleihen oder den Dax. Das waren nicht nur Worte, die viele von uns nicht verstanden - es war eine ganz andere Sprache. Und zwar keine, die wir lernen wollten.
GEBEN WIR’S ZU: UNSER VERHÄLTNIS ZUM GELD IST HOFFNUNGSLOS VERKORKST.
56 Prozent aller Deutschen gaben noch im Jahr 2008 nach einer Umfrage des Mannheimer Instituts für praxisorientierte Sozialforschung (Ipos) zu, dass die Aussage: „Vom Börsengeschehen habe ich keine Ahnung“auf sie eher oder voll zutreffe. Besonders gleichgültig standen dem Aktienmarkt laut der Umfrage Frauen zwischen 18 und 34 Jahren gegenüber: 72 Prozent erklärten, von der Börse keine Ahnung zu haben.
Dann begann sich die Finanzkrise wie ein gewaltiger Tsunami einmal quer über die Erde zu schieben, langsam, aber unaufhaltbar, und dabei Hunderttausende Jobs, zahllose Eigenheime und Existenzen, manchmal - wie in Island - auch die Liquidität ganzer Länder zu vernichten. Was die Situation so besonders machte: Diese alles bedrohende Welle gefährdete uns nicht nur alle miteinander. Wir waren alle miteinander auch Teil der Welle. Denn was anderes sollte eine weltweite Wirtschaftskrise sein als die Summe einzelner ökonomischer Handlungen von Milliarden Menschen? Menschen, die sich dafür oder dagegen entscheiden, etwas zu kaufen; die sich Geld borgen oder es sein lassen; die sparen oder prassen; die umziehen oder vor Ort bleiben; die einstellen oder entlassen; die studieren oder sich einen Job suchen; die pessimistisch oder optimistisch sind.
Das Problem kam auf uns zu. Und wir waren zugleich Teil des Problems. Und spätestens jetzt hätte doch eine Art kollektiver Erkenntniswunsch erwachen müssen, spätestens jetzt hätte man sich mal hinsetzen müssen, um diesen ganzen Irrsinn aus zehnfach überzeichnetem Geld und dem Weiterverkauf eines weiterverkauften, wiederum weiterverkauften Schuldscheins zu verstehen. Und tatsächlich berichteten Zeitungen und Zeitschriften in groß angelegten Serien über die Krise und ihre Hintergründe, nicht zuletzt deshalb, weil täglich neue Horrorszenarien gezeichnet werden sollten. Aber was machten wir?
Feierten erstmal Weihnachten. Der Einzelhandel war mit dem Ergebnis vor den Feiertagen zufrieden. Es gibt doch diese lustigen Umfragen, die Stimmungen unter Konsumenten darstellen sollen: „Wie zuversichtlich blicken Sie in die Zukunft?“Die Antwort war ganz einfach: „Ich bin zuversichtlich, wenn es die anderen auch sind. Sind es die anderen auch?“Der Konsument blickt auf die anderen Konsumenten. Die Mehrheit kaufte weniger Autos (ehe die „Abwrackprämie“eingeführt wurde). Aber sie kaufte Geschenke. Also kaufte der Konsument auch Geschenke. Und wenn das Interesse an der Weltwirtschaft überhaupt erwachte, dann erstmal mit Vorwürfen.
Keine Frage, wer Schuld an der Misere trägt: Die geldgeilen Idioten bei Banken und Investmentbanken, die mit unserem Finanzsystem gespielt haben. Und die ahnungslosen oder korrupten Politiker, die das Geschwurbel der sogenannten Finanzexperten geglaubt hatten und vielleicht insgeheim hofften, dafür später einmal einen ähnlich gut bezahlten Job zu erhalten. Dann die Marketinggenies, die uns immer wieder aufs Neue davon überzeugt hatten, dass wir uns nur einen Einkauf entfernt vom Glück unseres Lebens befänden und dass Ratenzahlung selbstverständlich kein Problem sei. Und dann … wir. Weil wir den Marketinggenies geglaubt hatten.
Vermutlich gibt es Millionen Menschen auf der Welt, die guten Gewissens behaupten können: „Meine Schuld ist der ganze Mist nicht.“Die einen Job haben, Steuern und Rechnungen zahlen, nicht mehr ausgeben, als sie verdienen, keine verrückten Zockereien an der Börse veranstalten - und die jetzt trotzdem auf Kurzarbeit wechseln müssen oder deren Arbeitsplatz in Gefahr ist, weil Deutschland zwar vergleichsweise gut dasteht (jedenfalls im Vergleich zu den USA oder Großbritannien), aber eben Dinge produziert, die sich Menschen anderswo leisten können müssen. Der Exportweltmeister Deutschland steht ziemlich blöd da, wenn andere Länder seine Produkte nicht mehr importieren wollen.
Und durch diese Erkenntnis, dass wir - ob wir wollen oder nicht - allesamt Teil des Systems sind, erwacht nun wenigstens das allgemeine Interesse an der Finanzwelt, endlich wächst das Verständnis für die weltweite Wirtschaftssituation, endlich …
Oder?
Nee? Immer noch nicht?
Noch seltsamer: Es ist nicht nur so, dass sich junge Deutsche immer noch kaum für die Welt der Hochfinanz interessieren - auch die alltagsnäheren Themen aus dem Bereich der Wirtschaftswelt kümmern die Mehrzahl einfach nicht. Eine Studie des Deutschen Bankenverbandes meldete, dass nur jeder zweite Befragte erklären konnte, was „soziale Marktwirtschaft“eigentlich genau bedeutet. Und … los, sag mal: Was genau beziffert das Bruttosozialprodukt eines Landes? Warum wurde noch gleich die Eigenheimzulage abgeschafft? Wie hoch ist der Höchststeuersatz in Deutschland? Was versteht man unter einer kapitalbildenden Lebensversicherung? Tja. Eben. Viele von uns sind noch immer ökonomische Analphabeten.
Und fühlen sich offensichtlich okay dabei. Denn das Desinteresse und die Ignoranz für Weltwirtschaftsfragen und für ökonomische Grundlagen unseres Gesellschaftssystems setzen sich auf der ganz persönlichen Ebene fort. Auch wenn wir Deutschen „Spar-Weltmeister“sind, auch wenn der Bundesverband Deutscher Banken ein Geldvermögen der Deutschen in Höhe von unvorstellbaren 4,5 Billionen Euro zählt - Sparsamkeit gilt uns Deutschen nicht als Tugend, zumindest nicht öffentlich. „Über Geld spricht man nicht“ist ein sehr deutsches Sprichwort, das wir scheinbar tief verinnerlicht haben. Warum eigentlich nicht?
VOM LEBEN GELERNT
GELD
„Harald Schmidt hat mir den guten Rat gegeben: Hör zu, was die Banken sagen, und mach das Gegenteil. Denn was die Bank macht, machen alle.“
HERBERT FEUERSTEIN
Fer nsehunterhalter
„Wenn du Geld hast, sorge erst für dich selbst und teile es dann mit anderen. Hilf nur denen, denen du helfen kannst.“GRANDMASTER FLASH
Musiker
„Es ist lohnender, sich mit armen Menschen zu umgeben als mit reichen. Sie sind prinzipiell liebenswerter.“IGGY POP
Musiker
„Nichts, das Geld kostet, hat mich jemals glücklich gemacht.“JANE BIRKIN
Sängerin
„Mit dem Trinkgeldgeben ist es wie mit dem Leben überhaupt: Man muss das richtige Maß finden. Leute, die viel zu viel geben, wollen nur geliebt werden. Knauserern ist eh alles egal.“BERND EICHINGER
Filmproduzent
Hand hoch, wer die Traute hat, sich vor Freunden oder Kollegen als Sparer zu bekennen. Zu sparen ist eher Ausdruck von Unlust und Langweiligkeit als von Vernunft. Zu sparen ist das Gegenteil von Spaß. Und außerdem ist es vom „Sparer“zum „Geizhals“nur ein kleiner Schritt, und das will keiner sein. Abends in der Kneipe kein Geld zu haben ist kein Problem, zahlt eben ein Freund für dich mit. Aber sein Geld nicht ausgeben zu wollen, selbst wenn man es sich leisten könnte, gilt als unsympathischer Charakterzug. Ein kurzer, unmöglicher Dialog:
„Noch ein Bierchen? Nein? Wieso? Knapp bei Kasse?“
„Nö. Ich will nur einfach mein Geld zusammenhalten.“
„Du willst … was?“
Die Weltwirtschaft ist uns suspekt, der Nationalsport „Geldsparen“wird nur heimlich ausgeübt, über unser monatliches Einkommen reden wir nicht mal mit engen Freunden … geben wir’s zu: Unser Verhältnis zum Geld ist hoffnungslos verkorkst. „Wir können heute besser über Sex reden als über Geld. Und weil wir nie über Geld reden, haben wir auch kein Vokabular dafür und sind schrecklich gehemmt“, erklärt die Finanzpsychologin Monika Müller.
Es wird noch absurder. Es ist gar nicht so, dass die nachdrücklichen Hinweise der Finanzpolitiker auf den Zustand der gesetzlichen Rente bei den jungen Erwachsenen in Deutschland nicht ankämen. Neun von zehn Befragten einer repräsentativen Umfrage des Bankenverbandes sind sich sicher, dass die meisten deutschen Rentner in Zukunft nur „schlecht oder sehr schlecht“von ihrer gesetzlichen Rente werden leben können. 67 Prozent der Befragten haben in die eigene Zukunft geschaut und erkannt, dass sie zu denjenigen gehören, auf die da möglicherweise ein Problem wartet - weil sie entweder noch gar keine Ahnung haben, wie sie sich versorgen wollen, oder schon ahnen, dass es ihnen im Alter finanziell nicht gutgehen wird. Und …
HALT! Verlierst du gerade in diesem Moment die Lust, weiterzulesen? Liegt es wirklich an den unverdaulichen Prozentzahlen? Oder doch an der unangenehmen Nachricht? Falls dich dein schlechtes Gewissen gerade überreden wollte, zum nächsten Kapitel weiterzublätter n, dann ist dieses Kapitel wahrscheinlich genau für dich bestimmt. Das nur so nebenbei.
… Wo waren wir? Ah ja: Ziemlich viele Menschen verstehen, dass sie in Zukunft möglicherweise ein Geldproblem haben werden. Und was tun sie?
Sie tun nichts. Oder zumindest zu wenig: Von den Befragten unter 39 Jahren geben 52 Prozent an, in nächster Zeit nichts mehr für ihre Altersvorsorge tun zu wollen.
Das ist ungefähr so, als würde man am Samstagnachmittag in den leeren Kühlschrank schauen und feststellen: „Ich sollte noch was einkaufen, denn morgen haben die Geschäfte zu. Und wenn ich dann nichts zu essen gekauft habe, werde ich Hunger kriegen.“Um daraufhin die Kühlschranktür wieder zu schließen und an was Lustigeres zu denken. Blöderweise ist am nächsten Tag tatsächlich Sonntag.
Es ist ein interessanter Gedankenmechanismus in vielen von uns, dass wir über Geld nicht nachdenken und schon gar nicht reden wollen. Kann sein, dass uns unsere 68er-Eltern das Gefühl eingeimpft haben, dass Geld was Schmuddeliges sei. Kann sein, dass wir uns das selbst beigebracht haben. Dass wir mit den grauen Banker-Typen mit zurückgegelten Haaren nichts zu tun haben wollen (außer einen möglichst weiten Dispokredit). Oder es kann sein, dass wir so ausgefuchst sind, dass wir nur so tun, als würde uns Geld nicht interessieren … und im Geheimen schon an unseren Welteroberungsplänen sitzen. Kann sein, dass wir kleine Träumer sind, die ein wenig naiv darauf vertrauen, dass die Kohle schon irgendwann irgendwie reinkommen wird (schließlich wurde die Generation vor uns ja auch mit Dotcom-Millionen überschüttet; so schlau wie die sind wir doch allemal, oder?). Das müsste man zumindest mal untersuchen. Es ist ja schließlich auch nicht so, dass man diese nervtötenden ökonomischen Zwänge nicht auch umgehen könnte. Eine kleine Auswahl von (legalen) Möglichkeiten samt Vor- und Nachteilen, um sich Geldsorgen im Leben zu sparen:
1. „ES LIEGT IN DER FAMILIE“: REICHE ELTERN
Was muss ich tun? - Nichts! Das ist die gute Nachricht. Außer vielleicht immer mal wieder bei Opa und Oma vorbeischauen. Denn diese angesprochenen 4,5 Billionen Euro Geldvermögen, von denen vorhin die Rede war? Tja, die müssen irgendwo sein. Die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen haben ihr Geld fleißig zusammengehalten und gemehrt, und sie hinterlassen gewaltige Summen: Die Forschungsgruppe „Altern und Lebenslauf“der FU Berlin hat für 2007 eine Erb- und Schenkungssumme von 50 Milliarden Euro berechnet. Bis in drei Jahren sollen es jährlich 200 Milliarden Euro sein. Wer wohlhabende Großeltern hat oder reiche Eltern, kann davon ausgehen, dieses Vermögen irgendwann zu erhalten. Etwa die Hälfte aller Deutschen erbt, im Schnitt derzeit 71 000 Euro im Westen und 16 000 Euro im Osten. Und auch wenn das Durchschnittserbe noch nicht ausreicht, um sich dauerhaft einen Lenz zu machen - gerade Akademikerkinder in Deutschland können so sorgenfrei in die Zukunft schauen wie keine Generation vor ihnen, denn höhere Bildungsschichten erben wesentlich häufiger als niedrige, Hochschulabsolventen fast doppelt so viel wie Hauptschulabgänger.
Wo ist der Haken? - Tja, da gibt es leider einige. Zum einen: Ein Erbe geht in der Regel Hand in Hand mit dem Tod eines nahen Verwandten, und das ist oft ein geliebter Mensch. Mit der Tatsache, dass man von diesem traurigen Ereignis nun profitieren darf, muss man erstmal klarkommen. Dann sind da noch die großen gesellschaftlichen Themen: Ist es gerecht, dass es die Erben reicher Familien leichter haben als die Kinder ärmerer Menschen? Der englische Philosoph John Stuart Mill wollte schon im 19. Jahrhundert mehr soziale Chancengleichheit erreichen, eine von unverhältnismäßig großem Reichtum korrumpierte bürgerliche Jugend in ihre Schranken weisen und einen Idealzustand erreichen, in dem „keiner arm ist, niemand reicher zu sein wünscht und niemand Grund zu der Furcht hat, dass er durch die Anstrengungen anderer, die sich selbst vorwärtsdrängen, zurückgestoßen werde“. Mills Wunsch blieb bis heute eine Utopie.
An welchen Vorbildern kann ich mich orientieren? - Kommt drauf an, über wie viel Geld wir reden. Und was man damit anfangen will. Wer sich mit einem Erbe einfach ein möglichst schönes Leben machen will, sollte zur Inspiration noch mal Nick Hornbys Buch About A Boy lesen. Die Hauptfigur Will hat sich wunderbar eingerichtet in einem Leben aus viel Freizeit, viel Sex und wenig Stress, das er dem Vermögen seines Vaters verdankt. Und als ihm eine Freundin erklärt, dass ihm seine egoistische Haltung ein Leben bescheren wird, in dem er irgendwann „kinderlos und allein“aufwachen wird, antwortet Will: „Tja, genau, drück mir die Daumen!“
Wer anders als der relativ zurückhaltende Will künftig im ganz großen Stil mit Geld angeben will, sollte sich von seinem Butler die Dokumentations-DVD Born Rich besorgen lassen, in der der junge US-amerikanische Regisseur Jamie Johnson (selbst steinreicher Erbe des Johnson-&-Johnson-Imperiums) aus dem Alltagsleben junger Milliardäre erzählt - unter anderem, wie die Millionärstochter Stephanie Ercklentz beim Investmentbroker Merill Lynch schon nach wenigen Tagen wieder ihre Sachen packt, weil „meine Freunde schon bei Cipriani sitzen und Bellinis trinken“.
Wer in Zukunft mit dem geerbten Geld viel Gutes tun will, könnte sich zum Beispiel bei der „Bewegungsstiftung“melden, einem Zusammenschluss junger Erben, die sich im Umfeld von Attac getroffen haben und Globalisierungsprojekte unterstützen. Oder spendet einfach im großen Stil. Der Soziologe Thomas Druyen erklärt in seinem Buch Goldkinder. Die Welt des Vermögens, dass man sich sowieso erst dann als „richtig reich“bezeichnen kann, wenn man ausreichend Mittel zur Verfügung hat, um davon abzugeben.
Ehe man das ganze Erbe vorzeitig verplant, sollte man allerdings prüfen, ob man bei seinen Eltern nicht an Typen wie Andrew Carnegie geraten ist. Der Stahlunternehmer war Ende des 19. Jahrhunderts der reichste Mann der Welt, vermachte aber einen großen Teil seines Vermögens gemeinnützigen Einrichtungen. Seine Begründung: „Die Erfahrung lehrt, dass es für die Kinder nicht gut ist, mit dem Erbe belastet zu werden. Das lähmt ihre Leistungsbereitschaft.“Ungefähr dasselbe hat auch Bill Gates vor, der unfassbar reiche Microsoft-Gründer: Er will seinen Kindern nur je zehn Millionen Dollar hinterlassen. Der Rest seines Milliardenvermögens wird in seine Stiftung fließen (na gut, bleiben zehn Millionen, immerhin).
2. „GAS GEBEN“: SCHNELLES GELD DURCH HARTE ARBEIT
Was muss ich tun? - Dich zusammenreißen. Allein durch Arbeit in einem Angestelltenverhältnis reich zu werden ist nämlich ziemlich schwierig, so der Soziologe und Elitenforscher Michael Hartmann von der Universität Darmstadt. Wenn du es trotzdem probieren willst: Beschränke dein Privatleben auf das, was der Karriere nützlich sein könnte. Also: schnelles, sehr gutes Abitur, Turbo-Studium (BWL, Jura), Auslandsstudium einplanen, Anstellung bei einer Unternehmensberatung und dann … ackern. So könnte es gehen, auch wenn’s sehr mühsam wird. Als „reich“gilt man in Deutschland als Alleinlebender übrigens ab einem monatlichen Nettoeinkommen von 3418 Euro. Aber dein Ziel sollte woanders liegen.
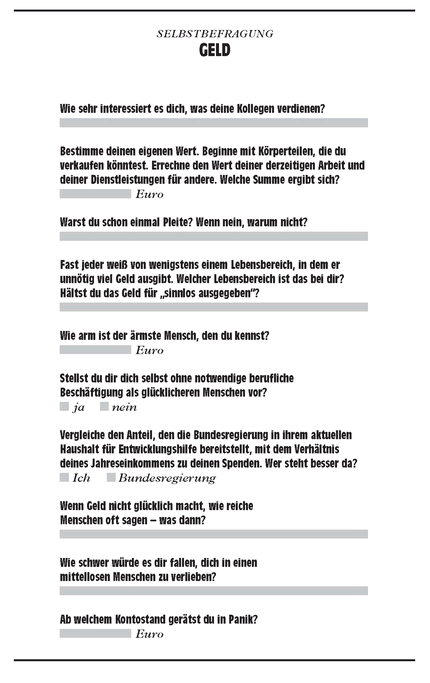
Wo ist der Haken? - Der genervte Seitenblick deines Partners, weil du den gemeinsamen Samstagsspaziergang über den Markt „zeitlich optimieren“willst und vorrechnest, dass „der Spaß hier jetzt immerhin drei Mannstunden“kostet. Dass man sich mit einem Job auch für einen Charakter entscheidet, wird vielen Menschen erst spät klar. Aber damit musst du umgehen können.
An welchen Vorbildern kann ich mich orientieren? - Scarface mit Al Pacino und Wall Street von Oliver Stone sind deine Filme. „Gier ist gut“, sagt Michael Douglas als Gordon Gekko in Wall Street (er sagt dummerweise aber auch den ungemütlichen Satz: „Nur Verlierer essen zu Mittag“).
3. „O MANN, PURES GLÜCK“: DER LOTTOGEWINN
Was muss ich tun? - Wenig. Geh in eine Lottostelle oder mach deine Kreuzchen im Internet. Die größte Gewinnchance hat übrigens die Zahl 32: Sie kam bislang 405-mal vor. Es folgt die Kugel mit der 49 (402 Treffer), dann die 38 (389-mal), 25 (389-mal), 26 (388-mal) und 48 (385-mal). Bezahl ein paar Euro dafür. Verlier den Schein nicht. Warte bis Samstagabend.
Wo ist der Haken? - Weil große Zahlen so abstrakt sind, ist es ein lustiges Spiel geworden, die Chance auf einen maximalen Lottogewinn in Gleichnisse zu verpacken. Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland vom Blitz getroffen zu werden, liegt bei etwa 1 zu 20 Millionen. Nach der sogenannten Drake-Gleichung (des US-amerikanischen Kosmologen Frank Drake) liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit Kontakt mit einer außerirdischen Lebensform aufnimmt, bei 0,00008 Prozent. Und tatsächlich tritt beides eher ein als ein „Jackpot“-Gewinn (sechs Richtige plus richtiger Zusatzzahl), dessen Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 139 836 160 (oder 0,0000007 Prozent). Kurz gesagt: Man kann hoffen. Aber man kann sich nicht drauf verlassen, dass es klappt.
An welchen Vorbildern kann ich mich orientieren? - Gleich noch ein Haken. Die Quote unglücklicher Lottogewinner ist überraschend hoch. Der berühmteste Fall ist natürlich der des Sozialhilfeempfängers Lothar K., der als „Lotto-Lothar“zu kurzem Ruhm in der BILD-Zeitung kam und mit 53 Jahren mittellos verstarb.
4. „ICH LIEBE DICH … UND DEIN GELD“: REICH HEIRATEN
Was muss ich tun? - Für alle Menschen ohne reiche Eltern ist das natürlich der Königsweg, um ein sorgenfreies Leben samt First-Class-Tickets und Reitpferden genießen zu können: einfach das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und sich in einen Partner verlieben, der stinkreich ist. Dann schnell auf einem Landgut in der Toskana heiraten, Hochzeitsreise auf die Seychellen und alle Sorgen los sein.
Wo ist der Haken? - Diesen reichen Heiratskandidaten muss man erstmal finden. Und bei dieser Suche ist man nicht allein: etwa 7 Millionen Bundesbürger suchen zurzeit in Onlinebörsen nach einem Partner, fast alle sind jünger als 40 Jahre. Und selbst wenn man einen Kandidaten oder eine Kandidatin gefunden hat - jetzt muss man sich auch noch in ihn oder sie verlieben können … und umgekehrt. Wenn man selbst nicht besonders wohlhabend ist, stehen die Chancen dafür aber leider schlecht. Denn Deutsche suchen sich ihre Lebenspartner mittlerweile am liebsten in ihrem eigenen sozialen Milieu. Früher war das anders: da hat jeder zweite Mann „nach unten“geheiratet und jede zweite Frau „nach oben“- die dadurch entstehende Durchmischung von Gesellschaftsschichten nennen Wissenschaftler den „Aschenputtel-Effekt“: Der Prinz ehelicht die arme Magd, und gemeinsam werden sie Königin und König. Heute heiratet nur noch jeder fünfte Mann nach unten, hat der Bamberger Soziologe Hans-Peter Blossfeld herausgefunden. Warum? Es gibt immer weniger Aschenputtel - Frauen machen selbst Karriere und suchen sich einen Partner auf Augenhöhe. So blöd es klingt: Wer einen reichen Lebenspartner finden will, sollte besser selbst schon reich sein. Sonst wird’s schwierig.
An welchen Vorbildern kann ich mich orientieren? - An Aschenputtel. Viel Glück!
Wer nicht davon ausgehen kann, als Tennisprofi große Erfolge zu feiern, wer sich nicht ganz sicher ist, beim Poker oder Roulette Millionen zu verdienen, wer nicht des Geldes wegen heiraten will oder ein ausreichend großes Erbe in Aussicht hat, und wer nicht vor lauter Arbeit das Leben vergessen will, der muss sich irgendwann überlegen, wie er an genügend Geld kommt, um möglichst zufrieden zu leben. So nüchtern, so einfach und so traurig ist das. Kein Ausweg? Kein Ausweg. Kein Plan B? Kein Plan B.
Fassen wir mal kurz zusammen: Einerseits besitzt die große Mehrheit von uns nicht genug Vermögen, um sich keine Gedanken um Geld machen zu müssen. Andererseits verdrängen viele von uns wider besseres Wissen die Notwendigkeiten von Vorsorge und Sparplänen. Aufgrund unseres seltsamen Verhältnisses zum Geld sprechen wir dieses Problem nur ungern bei Freunden oder in der Familie an, was die Sache nicht leichter macht. Die Möglichkeiten, um aus diesem Dilemma durch eine glückliche Fügung befreit zu werden, sind da - aber sie sind spärlich.
Was würde ein ökonomischer Musterknabe jetzt unternehmen? Ganz einfach: Er würde auf sein zukünftiges Leben blicken und sich für einen Job in einem vielversprechenden Berufsfeld entscheiden. Dann würde er berechnen, wie viel Geld er in seinem Berufsleben verdienen wird, was er sich davon leisten mag und was er sich davon leisten muss, Eventualitäten und Notfälle einkalkulieren und anschließend bis zur Rente gerade genug sparen, um bis zu seinem Tod sorgenfrei leben zu können.
Diese Theorie klingt großartig, lässt aber zwei große Probleme außer Acht: Zum einen geht sie davon aus, dass Menschen in der Lage sind, komplexe mathematische Berechnungen bezüglich ihrer zukünftigen Einkünfte anzustellen, und außerdem ausreichend hellseherische Fähigkeiten besitzen, um ihr Lebensalter und die Ereignisse der kommenden Jahre vorauszusehen. Und selbst wenn wir in der Lage wären, diesen großen „Masterplan“aufzusetzen, geht die Theorie des ökonomischen Musterknabens davon aus, dass wir ausreichend Willensstärke besitzen, um den einmal gefassten Plan auch umzusetzen. Das ist das zweite Problem - und das größere. Den die Verlockungen unserer Konsumwelt sind unendlich vielfältig und schrecklich reizvoll: ein schicker Sportwagen, eine größere Wohnung in besserer Lage, eine sehnlich gewünschte Reise … all diese Wünsche können jederzeit auftauchen und den sorgsam berechneten Masterplan des ökonomischen Musterknabens ruinieren (genau hier setzen die Marketinggenies an, um uns auszunehmen).
Die Wahrheit ist: Wir sind keine theoretischen Wesen, und das Leben des ökonomischen Musterknabens wäre möglicherweise finanziell abgesichert, aber sehr wahrscheinlich auch todlangweilig.
Aber so wenig man das Leben dieses ökonomischen Musterknabens leben möchte und so krumm die Berechnung eines Gesamtlebenseinkommens und eines Gesamtlebensbedarfs sein würde - zusammen werfen diese Umstände natürlich eine ziemlich spannende Frage auf: Wie viel Geld braucht man eigentlich zum Leben?
Diese Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten. Für die einen ist es klar, dass sie später mal in einem eigenen Haus leben wollen, mit zwei Autos und Garten und Hund und so weiter. Andere schreckt der Gedanke an ein Eigenheim ab, sie wollen die Beweglichkeit des Mieters behalten, sich nicht an einen Ort binden. Der eine geht in seinem Beruf auf und will bis zur Rente in derselben Anstellung bleiben, der andere spart „Fuck-You-Money“(toller Begriff), um die Freiheit zu haben, einem unangenehmen Chef jederzeit kündigen und sich in Ruhe einen neuen Job suchen zu können. Aber wie auch immer, für beide gilt dieselbe Wahrheit, die der Wirtschaftswissenschaftler Richard H. Thaler und der Jurist Cass R. Sunstein in ihrem Buch Nudge ganz nüchtern definieren: Die Konsequenzen, die daraus entstehen können, zu wenig gespart zu haben, sind definitiv unangenehmer als die Konsequenzen, die daraus entstehen können, zu viel gespart zu haben.
SPANNENDE FRAGE, WENN MAN ÜBER GELD NACHDENKT: WIE VIEL BRAUCHE ICH ÜBERHAUPT?
Klingt dir zu unromantisch? Na gut, dann gibt es, nur für dich, doch noch einen Plan B. Man kann auch damit zu leben lernen, wenig zu besitzen. Der englische Schriftsteller Tom Hodgkinson plädiert in seinem Buch Anleitung zum Müßiggang dafür, dass wir uns frei machen von der Notwendigkeit, mehr Geld als unbedingt nötig zu verdienen. „Man braucht nicht viel Geld zum Leben“, erklärt Hodgkinson in einem NEON-Interview. „Aber es wird einem immer suggeriert, man brauche es, um den ganzen unnötigen Krimskrams zu haben. Freunde von mir leben von weniger als 5000 Pfund im Jahr. Sie zahlen nicht einmal Steuern, weil sie unter der Grenze liegen.“
Steckt hinter seiner Lebenseinstellung irgendeine seltsame Hippie-Lebenssicht? „Quatsch. Ich hatte einfach keine Lust mehr zu arbeiten. Wenn man nach Alternativen sucht, wird man schnell politisch, findet aber weder rechts noch links eine Heimat. Die Linken hängen der Idee der Vollbeschäftigung nach, in deren idealer Welt arbeiten alle und sind glücklich. Bei den Konservativen mit ihrem reinen Kapitalismus geht es auch nur um die Arbeit: Menschen möglichst billig anstellen und dann deren Arbeitsleistung möglichst teuer verkaufen. Lohnarbeit leistet aber nicht, was sie verspricht. Sie verschafft einem zu selten Befriedigung.“Nichts für Hodgkinson. „Die Menschen wollen ja nicht alle arbeiten. Sie wollen nicht arm sein. Niemand scheint auf die Idee zu kommen, dass es zwischen den Extremen Arbeitslosigkeit und Vollzeitbeschäftigung noch andere Lösungen gibt. Das führt auch dazu, dass die Menschen verlernen, sich selbst Arbeit zu suchen - oder zu erfinden. Vor der industriellen Revolution hat Arbeit anders funktioniert. Da haben sich die Menschen ihre Jobs selbst geschaffen. Sie haben einen großen Teil ihres Essens selbst angebaut, also waren sie auch nicht so abhängig von Löhnen. Heute verwandelt die Gesellschaft die Menschen in Roboter, und wenn es keine Robotertätigkeiten mehr für sie gibt, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Je knapper die Zeit, desto mehr Geld gibt man aus, um ja nicht enttäuscht zu werden. Und dann ist es natürlich nicht so erholsam, wie man sich erhofft hatte. Während eines Wochenendes in Paris. Oder beim Familientag mit deinen Kindern in einem Freizeitpark. Ein Alptraum! Da bleibe ich lieber zu Hause. Die Freizeit ist in den Händen der Erholungsindustrie. Den ganzen Tag fütterst du deine Zeit ins System. Und abends stopfst du dann dein Geld hinterher.“Dann muss er sich erst mal von seiner langen Rede ausruhen. Zum Schluss rät er zum Kauf einer Ukulele und bittet darum, Faulheit und Müßiggang nicht zu verwechseln. Es gehe ihm nicht darum, zum Nichtstun aufzurufen! „Faulheit galt unter den mittelalterlichen Mönchen als eine Sünde. Müßiggang bedeutet letztlich genau das Gegenteil: Verantwor tung für sich selbst zu übernehmen. So viele Leute beschweren sich: Ich hasse meinen Job. Wir schreiben: Dann kündige!“Das wäre der Plan B. Nicht der schlechteste Plan, wenn man sich drauf einlässt.
Alle anderen müssen sparen, es hilft nichts. In ihrem Buch Nudge zitieren Thaler und Sunstein die lustige Anekdote der beiden Schauspieler Gene Hackman und Dustin Hoffman, die Hackman im Bonusmaterial einer DVD erzählt (sie sagen nicht, zu welchem Film das Bonusmaterial auf die DVD gepackt wurde, aber es wird wohl Das Urteil - jeder ist käuflich sein, der einzige Film, bei dem Hackman und Hoffman zusammen gespielt haben). Na, jedenfalls erzählt Gene Hackman aus der Zeit, als beide schon befreundet waren, aber noch keinen Erfolg als Schauspieler hatten. Eines Tages habe Hoffman ihn um ein Darlehen gebeten, Hackman war einverstanden. Um die Details zu besprechen, gingen die Freunde in Hoffmans Küche, in der eine ganze Reihe Einmachgläser aufgestellt war. In jedem der Einmachgläser befanden sich Geldscheine. Die Gläser waren beschriftet, auf einem stand „Miete“, auf einem anderen „Werkzeuge“und so weiter. Hackman fragte, wieso um Gottes willen Hoffman ihn anpumpe, er hätte hier doch mehr als genug - woraufhin Hoffman auf das Einmachglas mit der Beschriftung „Nahrungsmittel“zeigte. Das war leer.
Möglicherweise hat er es etwas weit getrieben, aber Dustin Hoffman hat mit seinen Einmachgläsern ein Prinzip angewendet, das auch viele große Unternehmen nutzen: die Budgetierung in verschiedenen Töpfen. Warum? Um Ausgaben besser kontrollieren zu können. Genauso kann jeder von uns, auch diejenigen mit geringem Einkommen, Einmachgläser (oder besser: echte Konten bei einer Bank) anlegen, um seine Finanzen besser im Griff zu behalten. Komischerweise denken alle immer nur daran, ein sakrosanktes Sparkonto anzulegen, das im besten Fall unangetastet bleibt. Die Experten raten allerdings auch dazu, ein Spaßkonto zu führen, auf dem ein Betrag liegt, den man verpulvern kann. Und ein Notfallkonto und so weiter.
LEIDER VERMEHRT SICH GELD NICHT ALLEIN DURCH SCHLAUE KONTOFÜHRUNG.
Das Modell der unterschiedlichen Konten ist nur einer von unzähligen Tricks, die uns dabei helfen können, besser mit unseren Finanzen umzugehen. Leider vermehrt sich Geld nicht allein dadurch, dass man es auf verschiedene Konten verteilt (oder zumindest kaum), dafür braucht es dann schon andere Mittel: Sparpläne, Aktien, Riesterrenten, Bausparen, Lebensversicherungen … die Möglichkeiten sind vielfältig, und was die richtige Wahl ist, hängt zu sehr von den Lebensumständen und der Risikobereitschaft jedes Einzelnen ab, als dass wir hier zuverlässige Tipps geben könnten. Wer etwas Geld übrig hat, sollte sich an seine Bank wenden (wenn man der vertraut und sich klar darüber ist, dass Banken mit Sparplänen jeder Art Geld verdienen wollen). Die Alternative zum Gespräch bei der Hausbank ist ein unabhängiger Finanzberater. Der kostet zwar Geld, optimiert aber die denkbaren Sparmöglichkeiten ohne Eigeninteresse. Wer gerade knapsen muss, sollte sich genau durchrechnen, ob er nicht dennoch wenigstens ein paar Euro auf einem Sparkonto zurücklegen kann. Und auch richtig: Die Geldinstitute haben wenig dafür getan, dass wir ihnen unser Geld bedenkenlos anvertrauen sollten. Die Alternativen sind trotzdem rar. Gold kaufen und im Garten verbuddeln? Der eine Haken: Da bringt das Gold keine Zinsen. Im Übrigen schwankt der Preis für Gold stark: Eine Feinunze kostete vor 1998 rund 300 Dollar und 2008 gelegentlich bis zu 1000 Dollar, aber der Preis fällt auch schnell wieder. Neben der unberechenbaren Preisentwicklung ist für Euro-Anleger auch die Handelswährung ein Risiko - das ist nämlich immer noch der unstete Dollar. Und auf Dollarbasis stieg der Goldpreis in den vergangenen zehn Jahren deutlich stärker als in Euro. Auch solche Effekte muss man einkalkulieren, wenn man Geld anlegt.
Schon richtig, am tollsten wäre es, sich vor diesen Schwierigkeiten mit dem Geld drücken zu können, schließlich hat ja schon John Lennon gesungen „Imagine no possessions“. Andererseits hatte er leicht reden, damals war Lennon längst Millionär.

INTERVIEW
„OFFENER ÜBER GELD REDEN!“
Die Finanzpsychologin Monika Müller erklärt, warum es uns so schwerfällt, über Geld zu sprechen.
Frau Müller, warum fällt es uns so schwer, über Geld zu reden? - Über Geld zu reden berührt in unserer Gesellschaft leider ein Tabu. Rufen Sie mal in eine Partyrunde: „Jetzt sagt jeder mal, was er verdient!“Es wird Funkstille herrschen.Woher das kommt? Als Baby lernen wir, dass wir so ziemlich alles bekommen, was wir benötigen - ohne Gegenleistung. Irgendwann machen wir aber eine einschneidende Erfahrung: Wir stehen im Supermarkt und greifen nach einer Süßigkeit im Regal - und hinter uns ruft unsere Mutter: „Finger weg! Das müssen wir bezahlen! “Plötzlich tritt das Konzept von Geld in unser Leben. Bald darauf folgt eine weitere Erkenntnis: Geld gibt es nur gegen Arbeit.Wir verstehen schnell, dass Geld eine einzigartige Bedeutung hat, scheinbar ist es wichtiger als fast alles andere.Wir denken, das ist normal, und projizieren auf Geld unsere wichtigsten Bedürfnisse: Geld steht dann für Freiheit. Oder für Sicherheit. Manchmal auch für Macht und Grenzen. In jedem Fall für intime Wünsche. Darüber reden viele nicht gern.
Stattdessen sparen wir im Stillen. - Oder kämpfen alleine mit unseren Schulden, statt einfach um Hilfe zu bitten. Oder geben vor, dass uns Geld nicht interessieren würde. Dabei ist Desinteresse meistens nur eine Abwehrhaltung: Da gibt es eine Sache, der wir nicht näher kommen wollen. Warum eigentlich nicht? Geld ist weder schlecht noch gut. Unangenehm ist nur die Erkenntnis, dem Irrtum aufgesessen zu sein, dass Geld Freiheit bedeutet. Oft ist genau das Gegenteil der Fall: Für den Karrieresprung samt Gehaltserhöhung bezahlt man häufig mit der Freiheit, tun und lassen zu können, was man will. Das führt zu einer Unzufriedenheit, die man mit teuren Schuhen oder einer tollen Uhr zu kompensieren versucht. Dafür braucht man dann wiederum noch mehr Geld. Der Kreislauf beginnt.
Was soll man stattdessen tun? Runter vom Gas bei der Karriereplanung? - Nicht unbedingt. Dass finanzielle Unabhängigkeit mit der Höhe des Bankkontos wächst, ist ein Missverständnis. Die bittere Wahrheit ist: Wer glaubt, seine Existenz durch Geld sichern zu können, ist in einem Mechanismus gefangen, der es unmöglich macht, jemals genug zu haben. Es geht vielmehr darum, sich auch unabhängig zu fühlen. Um diesem Gefühl auf die Spur zu kommen, rate ich jedem, sich zu hinterfragen: „Wer bin ich - mit und ohne Geld?“Eine spannende Aufgabe, wenn man aufrichtig zu sich selbst ist. Eine weitere wichtige Frage lautet: „Was bedeutet Geld für mich?“Was steht da ganz oben? „Freiheit?“„Sicherheit?“Wer es schafft, seine antrainierten Projektionen vom Geld zu lösen, erlebt oft ein emotionales Erdbeben. Meine Grundforderung: Wir sollten alle offener über Geld sprechen.
MONIKA MÜLLER, DIPLOMPSYCHOLOGIN - FCM Finanz Coaching, Wiesbaden; monika-mueller.de.