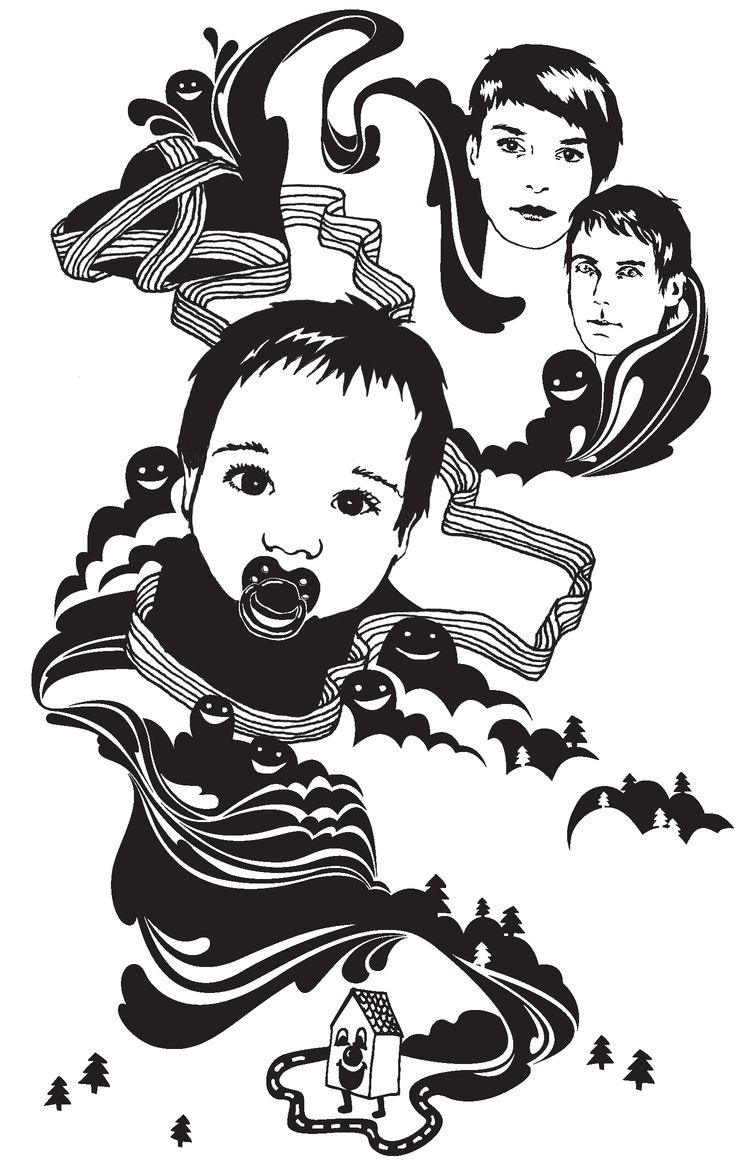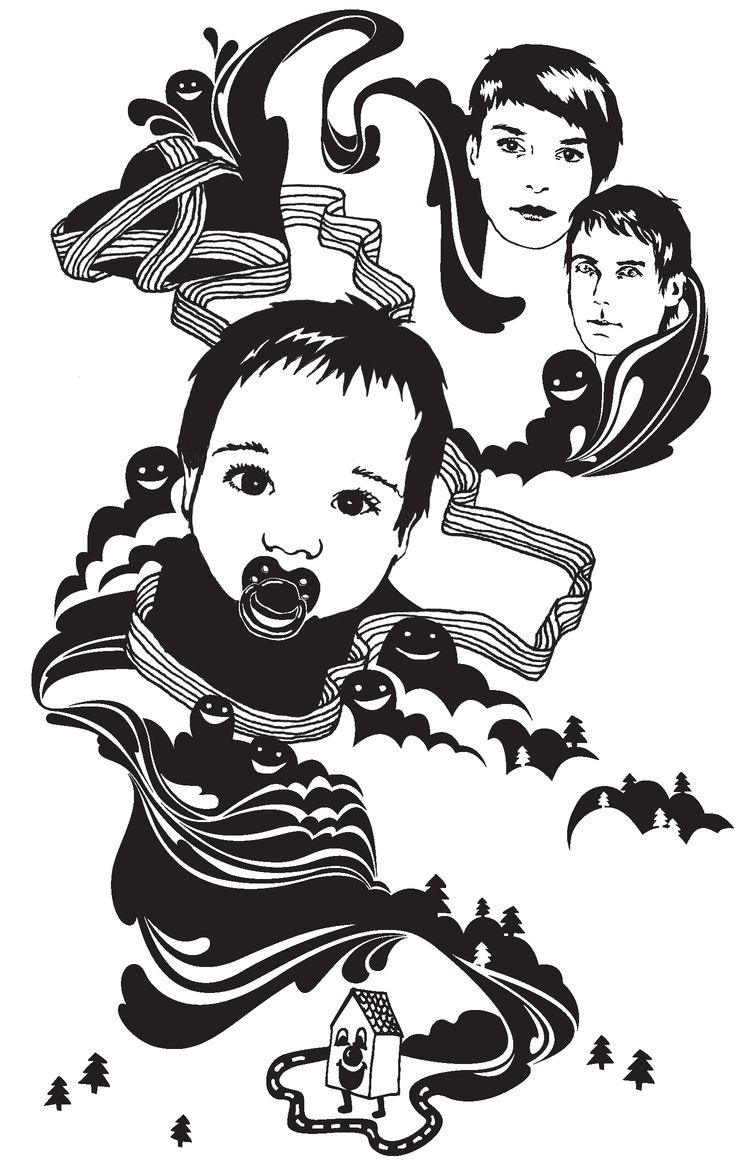12 FAMILIE GRÜNDEN
Soll ich auf den perfekten Zeitpunkt warten, um ein Kind zu kriegen - oder den Mut haben, auch in unsicheren Zeiten eine Familie zu gründen?
Welche Form der Verhütung mit welcher Wahrscheinlichkeit schief geht - Und ganz im Gegenteil:Wie wahrscheinlich es ist, sich ein Kind zu wünschen, aber nicht schwanger zu werden - Auf wen man hören sollte, wenn man sich fragt, ob man bereit ist für Babygeschrei - Von welchem Gerede man sich auf keinen Fall irremachen lassen darf - Und was eigentlich gute Eltern sind
„Familienplanung“ist ein häufig gesagtes Wort, so geläufig wie „Berufswunsch“oder „Altersvorsorge“. Doch kann man das: Familie planen? Zumindest kann man ziemlich verlässlich das Gegenteil planen. Die Kennziffern dazu liefert der Pearl-Index, der angibt, wie viele von 100 Frauen innerhalb eines Jahres trotz der jeweiligen Verhütungsmethode schwanger werden. Je niedriger der Pearl-Index, desto sicherer die Methode (die statistischen Schwankungen ergeben sich durch mögliche Anwendungsfehler). Am zuverlässigsten sind demnach die Sterilisation des Mannes (0,1), die Hormonspirale (0,16) und die Pille (0,1 bis 0,9), gefolgt von der Sterilisation der Frau (0,2 bis 0,3) und dem Vaginalring (0,4 bis 0,65). Das Kondom (2 bis 12) befindet sich statistisch in erschreckender Nähe zum Coitus interruptus (4 bis 18) und zur Kalendermethode (9). Gar nicht zu verhüten ist naturgemäß eine unsichere Verhütungsmethode: 85 von 100 Frauen werden auf diese Art binnen eines Jahres schwanger.
Die Frage, inwieweit Familienplanung wirklich möglich ist, zielt erst zuletzt auf die rohe Statistik. Vorher ist es eine finanzielle, gesellschaftliche und psychologische Frage. Was erwartet mich? Was tun Kinder? Was tun Kinder mit mir? Bin ich dem gewachsen? Was, wenn ich jetzt glaube, dass ich Kinder will, und wenn sie da sind, sie dann doch nicht will? Und wenn ich sie nicht liebe? Muss man Kinder bekommen, um der Gesellschaft zu helfen? Kann ich mir das leisten? Was ist mit meinem Job? Und mit meinen Träumen?
Kinder nicht zu bekommen ist eine Entscheidung, die man heute so und morgen anders treffen kann. Man kann sie rückgängig machen. Das kann man mit den meisten Entscheidungen im Leben, auch den großen. Beruf, Partner, Wohnort, alles nicht in Stein gemeißelt. Doch die Entscheidung, Kinder zu bekommen, ist eine endgültige. Wer einmal Kinder hat, wird sie immer haben, völlig egal, wie es mit seinem Leben und dem des Partners weitergeht. Bildlich gesprochen: Der Kreißsaal hat keine Hintertür. Sogar im Fall einer Abtreibung ist das ähnlich. Eine Abtreibung bricht die Schwangerschaft nämlich nur ab. Sie macht sie nicht rückgängig. Auch dieses Kind, obwohl ungeboren, wird seine Eltern auf seine Art ein Leben lang begleiten.
Die technische Seite der Familienplanung scheint nach all diesen großen Fragen also bloß noch eine Formsache zu sein, doch es lohnt sich, noch einmal einen Blick darauf zu werfen: Denn hier zeigen die Tücken, wie weit es mitunter her sein kann mit der vermeintlichen Planbarkeit der Familie. Selbst wenn Paare alle Schwierigkeiten durchdacht und alle Beschlüsse getroffen haben, die zum großen Vorhaben führen, ein Kind zu zeugen - selbst dann können sie an der Banalität der Natur scheitern. 85 von 100 Frauen werden schwanger, wenn sie nicht verhüten. Das sind viele. Aber 15 von 100 werden nicht schwanger. Die FDP ist eine bedeutende Partei, doch über solche Prozentzahlen würde sie sich eckig freuen. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung schätzt, dass 1,4 Millionen Paare in Deutschland unfreiwillig kinderlos sind. Viele von ihnen behalten dieses Problem für sich. Moderne Geschlechterrollen hin oder her: Unfruchtbarkeit nagt an dem Gefühl, ein ganzer Mann, eine vollwertige Frau zu sein.
TABUTHEMA: 1,4 MILLIONEN PAARE IN DEUTSCHLAND SIND UNGEWOLLT KINDERLOS.
Im antiken Griechenland war Kinderlosigkeit ein gesetzlicher Scheidungsgrund, und noch 1958 verstieß der Schah von Persien seine Ehefrau Soraya, weil diese ihm keine Kinder gebar. Heute würde er das zumindest noch eine Weile hinausschieben, denn inzwischen ist eine ganze Industrie aus der Sehnsucht gewachsen, die Natur zu überlisten. In Deutschland stehen 120 Fertilitätskliniken, mit deren Hilfe - etwa durch Hormonspritzen - bisher 150 000 Kinder entstanden sind. Verheiratete Paare müssen die Fruchtbarkeitsmedizin allerdings zur Hälfte bezahlen; nach dem jeweils dritten Versuch, künstlich eine Schwangerschaft herbeizuführen, stellen die Krankenkassen ihre Zuschüsse ein. Unverheiratete Paare tragen die Kosten von Operationen und Medikamenten von vornherein allein. Und manche Kliniken verweigern Frauen über 40 Jahren die Unterstützung, weil mit steigendem Alter die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die künstliche Befruchtung klappt - die Kliniken wollen sich ihre Erfolgsquoten nicht verderben.
Vergeblich auf die Schwangerschaft zu warten, monatelang, jahrelang, immer wieder zu hoffen, dass endlich dieser Strich im Teststreifen erscheint - das ist ein zusehends verbreiteter Kummer. Weil Beruf und Familie in Deutschland einander zwar nicht ausschließen, aber auch nicht gerade umarmen, ringen sich Frauen immer später dazu durch, sich ihren Kinderwunsch tatsächlich zu erfüllen. Manche warten so lange, bis es zu spät ist. Männer erwähnen in diesem Zusammenhang gern, dass Charlie Chaplin mit 73 noch Vater wurde. In der Tat, die 40 ist für Männer keine bedrohliche Altersgrenze. Allerdings hat sich ihre Spermiendichte in den vergangenen 50 Jahren in den Industriestaaten halbiert; schuld sind unter anderem schädliche Umwelteinflüsse. Und dann muss man noch die Ahnungslosigkeit vieler Paare erwähnen, die das Robert-Koch-Institut in einem Bericht für die Bundesregierung ermittelt hat: An den durchschnittlich fünf fruchtbaren Tagen im Monat hatte etwa die Hälfte der unfreiwillig Kinderlosen keinen Sex. Es ist bemerkenswert, wie schlecht sich viele Paare, die über künstliche Befruchtung ganz genau Bescheid wissen, mit der natürlichen auskennen.
So trivial kann Familienplanung scheitern: Man findet einen Partner, stabilisiert sein Leben, wünscht sich Kinder - und dann kommt einfach keins. Kinder sind nicht wie eine Amazon-Bestellung, heute geklickt, morgen geliefert. Sie sind eher wie … Trabis. Man kann nicht sagen: Jetzt. Man kann nur sagen: Ab jetzt. Und manchmal kommen sie nie.
Wer hat vorhin bei der Sache mit dem antiken Griechenland den Kopf geschüttelt? Kinderlosigkeit als Scheidungsgrund, wie rückständig? Kann man so sehen. Allerdings ist auch heute der Druck auf die Kinderlosen enorm. Die deutsche Familienministerin hat sieben Kinder, das sagt schon vieles. Sie selbst sagt auch vieles, und oft schimmert in ihren Sätzen der Hinweis durch, dass Kinderlose der Gesellschaft schaden. Man weiß ja: Die Deutschen sterben aus, wer soll später unsere Rente zahlen und so weiter. Raum ohne Volk. Ursula von der Leyens Vorgängerin im Familienministerium, Renate Schmidt (drei Kinder, immerhin), schlug Anfang 2007 mal vor, das Wahlrecht von Geburt an einzuführen, so dass Eltern für jedes minderjährige Kind eine Stimme mehr hätten. Ein Wahnwitz, der in der demografischen Panik erstaunlich ernst genommen wurde. Oder schauen wir auf Filmstars: Die verdienen Millionen an exklusiven Babyfotos. Kein roter Teppich, der nicht wenigstens einen schwangeren Bauch aushalten müsste. Nicht einmal die Sportschau kann man gucken, ohne an Kinder zu denken: Etliche Torschützen feiern ihre Treffer mit einem angedeuteten Schaukeln ihres Babys. Fußballer werden ja auch in einem fort Vater. Berliner übrigens auch. 2007 sind in Berlin zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg mehr Menschen geboren worden als gestorben.
SELBSTBEFRAGUNG
KINDERKRIEGEN
Warum eigentlich willst du ein Kind? Stichwort genügt.
Kennst du ein Kind, das so ist, wie deins mal sein sollte? Was genau gefällt dir an ihm?
Angenommen, nur eines von beidem wäre möglich: Sollte dein Kind klug sein oder nett?
Wie gerne wärst du selbst nochmal Kind? Angabe bitte in Prozent.
%
Was erwartest du von deinem Kind im Alter von 5, 10, 25 Jahren?
Was geht nicht mehr, wenn man Kinder hat?
Wer sagt das?
Für was wird das Kinderhaben wohl eine gute Ausrede sein?
Für welche Eigenschaft deines Kindes möchtest du von anderen Eltern mal beneidet werden?
Wärst du gerne dein eigenes Kind? Warum? Stichworte genügen.
Ein Kind ändert alles. Was genau, weiß aber nur, wer schon Kinder hat. Das ist schlecht für eine Planung. Das mit der Veränderung sagt sich ja so leicht. Sind nur vier Wörter: Ein - Kind - ändert - alles. Also, ein Baby bedeutet: Dass man eine Geburt überstehen muss, die so wehtut, dass kein Mensch, der nie gebar, sich das vorstellen kann. Dass man wenig schläft. Dass man nachts um eins, um drei, um fünf wach wird. Dass man dann manchmal sein Kind an die Wand werfen könnte. Dass man sich dafür hasst. Dass man viel, viel weniger Geld übrig hat. Dass man sich oft Sorgen um sein Kind macht. Dass es nicht mehr egal ist, was aus einem wird. Dass es stinkt. Dass man sich mit dem Partner öfter streitet. Dass man auf gar keinen Fall arbeitslos werden darf. Dass man davor Angst bekommt, seine Stelle zu verlieren, auch wenn man diese Angst vorher nie hatte. Dass man erst merkt, wie wichtig ein bisschen, nur ein bisschen Zeit für sich war. Dass man seine Freunde kaum noch sieht. Dass man praktisch nur noch übers Kind redet. Dass man nach der Geburt wochen- oder monatelang gar keinen und jahrelang keinen spontanen Sex mehr hat. Dass man sich seltener wäscht. Dass man nicht krank werden darf. Dass in der Wohnung alles durcheinanderliegt. Dass man Ärger bekommt, weil man Formulare, Anträge, Überweisungen und solche Sachen nicht mehr pünktlich erledigt. Dass man sich plötzlich fragt, was für Menschen die eigenen Eltern eigentlich so sind. Dass man seine Kindheit hinterfragt. Dass ein einziges kurzes Lachen des Kindes den ganzen langen Tag verzaubern kann. Dass … alles anders ist.
Planen kann man, was sich voraussehen lässt. Man kann Urlaub planen, indem man Routen berechnet, Sehenswürdigkeiten wählt und Zimmer bucht. Wie soll man ein Kind planen, wenn man kaum weiß, was es heißt, eins zu haben?
Es gibt wenige Menschen, die sagen, sie wollten prinzipiell keine Kinder. Es gibt auch wenige, die sagen, sie würden gerade „daran arbeiten“(hier folgen ein koketter Blick zum Partner, ein unsicheres Lächeln und ein langer Schluck aus dem Glas). Die meisten sagen, dass sie Kinder wollen, und zwar irgendwann, „wenn es passt“. Und wann passt es?
„Wenn ich mit dem Studium fertig bin …“
„… und mich ein paar Jahre im Beruf etabliert habe“
„Wenn ich genug Geld habe“
„Wenn ich den Richtigen gefunden habe“
„Wenn ich weiß, was ich mit meinem eigenen Leben anfangen will“
„Wenn wir die Weltreise gemacht haben“
„Wenn wir wissen, wo und wie wir leben wollen“
„Wenn ich mich ausgetobt habe“
Es gibt noch viel mehr Gründe, das Kind vor sich herzuschieben. Das ist nicht sarkastisch gemeint. Die meisten Gründe, die in diesem Zusammenhang genannt werden, sind triftig. Nur: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Zeitpunkt, an dem man keinen guten Grund mehr hat, vermutlich niemals kommen wird. Wie auch immer: Es spricht zu jeder Zeit etwas dagegen, Eltern zu werden.
Die triftigsten der zitierten Gründe sind wohl, wie so oft im Leben, das Geld und die Liebe. Was die Liebe angeht, würden viele aktuelle Paare weit miteinander gehen. Sie würden zusammenziehen, sich vielleicht verloben. Kann man ja auch alles revidieren. Aber ein Kind bedeutet, dass man mit diesem Partner ein Leben lang zu tun hat, ob verbunden oder getrennt. Und dass der Druck mit einem Mal viel größer wird, mit ihm zusammenzubleiben. Alleinerziehend zu sein ist ein verflucht hartes Los. Die Mühe hat dann keine Pausetaste mehr.
Das Thema Geld ist schnell erklärt: Kinder sind teuer. Nicht nur, weil sie Geld kosten, weil man etwas bezahlen muss: Windeln, Brei, Fläschchen, Schnuller, Kleidung, Möbel, eine durch den Platzbedarf höhere Miete, ein größeres (oder überhaupt ein) Auto, Medikamente, Versicherungen, Spielzeug, Bücher. Vor allem sind Kinder teuer, weil man ihretwegen weniger einnimmt. Ja ja, das Elterngeld, schon wahr, das existiert, aber zum einen wird es bloß rund ein Jahr lang gezahlt, und zum anderen bringt es unterm Strich weniger ein, als Ursula von der Leyens Werbefeldzug vermuten lässt. Was finanziell wirklich hilft, ist eigentlich nur, dass beide Elternteile voll weiterarbeiten und ihr Kind für zehn Stunden am Tag in die Krippe geben. Dann sind wir allerdings wiederum bei völlig abnormen Kosten für die Kinderbetreuung - und müssen den Eltern obendrein gratulieren, dass sie überhaupt eine gefunden haben. In Deutschland geht bloß jedes siebte Kind unter drei Jahren in eine Krippe. Die Plätze sind rar und teuer.
BESCHEUERTER IDEOLOGIEKAMPF: DIE GLUCKEN GEGEN DIE RABENMÜTTER.
Aber auch wenn der Platz gratis wäre: Mütter, die es biologisch richtig machen und in ihren Zwanzigern zum ersten Mal schwanger werden, müssen sich ökonomisch bestrafen lassen. Sie unterbrechen ihre Karriere in einer entscheidenden Phase und schauen zu, wie kinderlose Kolleginnen an ihnen vorbeiziehen. Kein Wunder, dass zwei von fünf Akademikerinnen nie eine Familie gründen. Und die Babypause für Männer ist in der Wirtschaft nur scheinbar kein Problem. Jedenfalls hat eine Studie der „Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft“ergeben, dass nur 29 Prozent der Beschäftigten glauben, ihr Unternehmen unterstütze wirklich Väter, die Familienpflichten übernehmen wollen. Als die Großgewerkschaft
ver.di untersuchen wollte, wie Unternehmen mit der Elternzeit umgehen, waren nur vier von 100 angesprochenen Firmen bereit, überhaupt an der Studie teilzunehmen.
Doch ganz gleich, ob man sein Kind in fremde Hände gibt oder in den eigenen lässt: Ins Rabeneltern-Dilemma gerät man so oder so. Denn Kinderbetreuung ist nicht nur ein finanzielles, es ist auch ein ideologisches Thema. Die Eva Hermans des Landes werden nicht müde zu behaupten, die Fremdbetreuung von Kindern schade ihrer Seele und ihrem Charakter; die Gegenseite hält Mütter, die mit ihren Kindern zu Hause bleiben, für Glucken und zitiert Studien, die zeigen, wie wertvoll die Fremdbetreuung sei. Sicher ist in Wahrheit nur so viel: Kinderbetreuung ja oder nein ist die falsche Frage. Wichtig ist nur, ob es den Kindern bei ihren Eltern gutgeht. Ab diesem Punkt kann man wenig falsch machen. Doch befreit diese Erkenntnis junge Eltern von ihrer Sorge, speziell sie könnten doch Rabeneltern sein? Wohl eher nicht.
Andersherum gefragt: Was sind denn gute Eltern? Denken wir uns auf eine beliebige Bank eines beliebigen Spielplatzes. Zur Linken: die coole Mutter, etwas nachlässig, aber nicht schlampig zurechtgemacht, sie liest ein Buch, das Baby im Kinderwagen zupft an ein paar aufgespannten Miniaturteddys herum. Geradeaus: die engagierte Mutter, etwas zerzaust, sie kommt gerade von der musikalischen Früherziehung und muss gleich weiter zum Kinderbauchtanz, jetzt hebt sie ihr Baby von der Wippe auf die Rutsche, an die Stange, in den Sand, auf das Karussell. Rechts: ein leerer Platz, diese Mutter ist im Büro. Jede dieser Frauen wird ihre Art, ihre Rolle zu leben und mit ihrem Kind umzugehen, mit Zähnen und Klauen verteidigen; in der Tat scheinen sich auf Spielplätzen die Mütter genauso zu zanken wie die Kinder, nur ohne die schnelle Versöhnung. Dabei fragt sich in Wahrheit jede ständig selbst, ob sie es wohl richtig macht. Und die Väter - die sind sowieso ziemlich desorientiert, wo in der heutigen Gesellschaft ihr Platz ist. Erzieher? Ernährer? Beides zusammen? Aber zu welchen Teilen? Gut möglich, dass die frühere Aufgabenverteilung - Vater Geld, Mutter Kinder - unfair und schädlich war. Übrigens für beide Seiten. Aber immerhin war sie klar. Auch in pädagogischen Dingen hat die Generation unserer Eltern oder die der Großeltern bestimmt viele verheerende Fehler gemacht - doch sie hatten nicht so viel Angst vor Fehlern wie wir. Die strengen Blicke von Öffentlichkeit und Ratgeberliteratur auf die Erziehungsmethoden heutiger Eltern bringen den Vorteil, dass kaum noch Eltern ihre Kinder verprügeln. Doch sie erziehen sie auch nicht mehr entspannt. Oder sie fürchten sich so sehr davor, an der größten denkbaren Herausforderung im Leben zu scheitern, dass sie die Herausforderung gar nicht erst annehmen. Man darf notfalls im Beruf versagen, in der Liebe oder in der Freundschaft - aber auf keinen Fall in der Erziehung. Mit der Selbstverständlichkeit des Elternwerdens ist auch die Sorglosigkeit des Elternseins dahin.
Niemand weiß, wie er sich in seiner Rolle als Mutter oder Vater fühlen wird. Wie sein Alltag aussehen wird, ob das Kind in eine Krippe gehen wird oder nicht. Ob das Geld reicht und was es bedeutet, falls nein. Ob die Liebe reicht. Und da soll man Familie planen?
Die größte Unwägbarkeit ist von alledem abhängig, und sie ist es auch wieder nicht. Doch planen kann man sie in keiner Weise: das Glück. Kinder sollen ihre Eltern glücklich machen. Das war früher anders, da sollten Kinder ihre Eltern absichern, dafür bereitstehen, sie später im Alter zu versorgen, und außerdem bekam man halt Kinder, allein schon wegen Gott. Und man bekam nicht nur ein Kind oder zwei, sondern so viele, wie die Natur zuließ. Der Berliner Familienforscher Hans Bertram meint, die kümmerliche Kinderzahl von heute durchschnittlich 1,45 Kindern pro Frau erkläre sich vor allem dadurch, dass die Vielkindfamilien so selten geworden seien. Wer kennt noch Familien mit drei Kindern oder mehr?
Wirklich? Anders gefragt: Wer kennt noch Familien mit drei Kindern oder mehr und wünscht sich, er wäre einer der Elternteile?
Ein Kind reicht heute schon deswegen, weil das Kind ja nicht mehr für unsere Altersvorsorge zuständig ist, sondern für unsere Vervollkommnung, für unseren Sinn im Leben, für unser Glück. Es ist eine Art Outsourcing der Selbstverwirklichung. Der Gedanke ist nicht so abwegig, denn natürlich bekommt das Leben eine andere Tiefe, sobald man Verantwortung für ein Kind trägt; obendrein für ein Kind, das ungefähr die Hälfte der eigenen Gene trägt und somit durchaus auch die Persönlichkeiten seiner Eltern fortsetzt. Aber was in der Liebe gilt, ist auch in der Elternschaft richtig: Kein anderer ist dafür da, einen glücklich zu machen, außer einem selbst.
Man kann eine Familie nicht wirklich planen. Seelisch nicht, charakterlich nicht, nicht einmal technisch; finanziell ist es schon undurchsichtig genug. Doch all das soll nicht bedeuten, man solle, wenn man nicht planen kann, einfach aufs Geratewohl in der Welt herumzeugen. Denn der erste Schritt zum Kind ist durchaus die Folge eines Plans - man hört ja auf zu verhüten. Und zwei Fragen muss man heute beantworten können, wenn man überlegt, ob man ein Kind zeugen soll oder nicht: Liebe ich meinen Partner? Und will ich prinzipiell Kinder? Wenn beides zutrifft, wird es gehen. Jetzt, später, darauf kommt es dann nicht an.