9
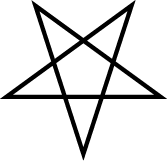
Vier Jahre zuvor
Ein fadenscheiniger Geist saß auf einer Betonbank in der Sonne und lauschte dem Gesang der Vögel in den Weiden. Bleich wie Schnee war ihr herzförmiges Gesicht, mit Akne gesprenkelt, und die spröden Lippen waren dünn. Strähniges braunes Haar hing über Wangen und Rücken. Ihre Hände lagen im Schoß, die Fingernägel waren abgekaut, und zwischen den Fingern hielt sie einen Bleistift wie eine Zigarette.
Die junge Frau war schlicht gekleidet, in Jogginghose und Hoodie. Auf ihrem Rücken stand Psychiatrische Klinik Medina.
Es war ein schöner Tag, jedenfalls hatte man ihr das gesagt. Andere Patienten liefen herum, warfen sich einen kleinen Gummiball zu oder spazierten über die vielen mit Klee bewachsenen Stellen des Hofs und suchten nach vierblättrigem Glücksklee. Die Schwestern meinten, es sei gut, wenn sie ein bisschen an die frische Luft komme, doch das Sertralin und das Aripiprazol in ihrem Kreislauf dämpften alles – die Sonne auf ihrer Haut, den Wind in ihrem Haar, das Rascheln der Peitschenzweige der Trauerweiden, den Duft frischgemähten Rasens.
Drinnen oder draußen spielte für einen Roboter keine Rolle. Abermals leckte sie sich über die Lippen und sah auf ihr Notizbuch.
Mehrere Rechtecke waren auf die oberste Seite gezeichnet, und darin fanden sich weitere Rechtecke, die ein in sich geschlossenes Gitter aus fünf Kästen bildeten. Jeder Kasten war durch eine unsichere Schlangenlinie geteilt. Charlie, einer der anderen Patienten, hatte ihr dieses grässliche Rätsel gezeigt, nachdem man sie hier aufgenommen hatte, und seitdem suchte sie wie versessen nach der Lösung. Man sollte sich jedes Gitter als »Haus« vorstellen und jeden inneren Kasten als »Zimmer«. Dann zog man eine ununterbrochene Linie durch alle Wände jedes »Zimmers«, ohne a) den eigenen Weg zu kreuzen oder b) mehr als einmal durch eine »Wand« zu gehen. Sie hatte das Gefühl, das Rätsel habe keine Lösung, doch das änderte nichts an dem Suchtcharakter, den es barg.
Sie blätterte um. Dutzende von Fünf-Zimmer-Rätseln. Sie blätterte weiter. Wieder Dutzende. In manchen der Rätsel-»Zimmer« standen die Worte yee tho rah geschrieben.
Etliche Seiten weiter im Notizbuch fand sie eine leere Seite. Sie starrte einen Augenblick darauf, ehe sie den Bleistift umdrehte und die Mine aufs Papier setzte.
Liebes Tagebuch
scheiß Ort hier
scheiß grüne Götterspeise mit Pfirsichen
Pfirsiche sind scheiß ekelig
scheiß Kartoffelbrei aus der Tüte
Kartoffelbrei aus der Tüte ist scheiß ekelhaft
Aber wen interessiert’s
Ich wünschte, ich würde hier mal eine anständige Tasse Kaffee bekommen
Willkommen in der Hölle
Sie unterbrach ihr Geschreibsel mit einem weiteren Lösungsversuch des unlösbaren Rätsels und zog träge die Linie durch jede der Wände. Schon glaubte sie, die Lösung gefunden zu haben, als sie entdeckte, dass in der Mitte eine Linie fehlte. Kacke. Abermals gescheitert.
»Hey«, sagte jemand hinter ihr. Sie seufzte und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Ihre Augen waren heiß und trocken. »Rate mal.«
»Was?«, fragte sie und schlug das Notizbuch zu.
»Ich heirate heute.«
Die junge Frau drehte sich um und sah den Sprecher an. Es war Mike Hurley, ein großer Kerl mit Halbglatze, der ein bisschen wie der junge Dwight Yoakam aussah. Er trug einen Anzug, eine ordentlich gebundene Krawatte und einen Tweedmantel mit Lederflicken am Ellbogen.
»Ja?«
»Ich trage meinen Sonntagsanzug.« Mike klopfte zufrieden nicht vorhandenen Staub von den Ärmeln. »Hey, willst du einen Witz über ein Gespenst hören?«
»Eigentlich nicht.«
»Das ist der richtige Geist.«
»Wie viel willst du haben, damit du abhaust, Mike?«, fragte sie und drückte das Notizbuch an ihre Brust.
Für gewöhnlich schwankten ihre Gefühle für Mike zwischen Verärgerung und echter Angst. Er hatte eine Art schizo-bipolarer Störung – was genau, wusste sie nicht, und sie bekam nie eine klare Antwort von ihm, was das anging –, und diese Störung führte dazu, dass er ständig ungefiltert seinen Gedankenfluss von sich gab. Daraus resultierte ein unendliches Kaleidoskop-Mischmasch von zehntausend verschiedenen Themen, und die hatten nahezu immer einen grotesken und einen verrückten Anteil. Manchmal mündeten sie in vage Drohungen und Verschwörungstheorien oder verschleierte Andeutungen in Richtung Selbstmord, und das zusammen mit dem Zittern seiner Hände und dieser Angespanntheit wie eine Gitarrensaite machten ihr Angst. Wenig hilfreich war auch, dass er, wenn er einmal angefangen hatte, mühelos eine Stunde oder länger reden konnte. Außerdem lauerte er gern hinter Ecken und überfiel sie mit überraschenden Aussagen, wie der Sache mit der Hochzeit oder einer Anekdote darüber, wie man einem Hund Pfeifen beibringt. Einmal war sie aus der Toilette beim Tagesraum gekommen, und er hatte ihr gegenüber enthüllt, dass sich sein Schwanz unzufrieden fühlte.
»Ich heiße Mark.«
»Wie auch immer.«
»Zehntausend Shilling in einem Kartoffelsack.« Mark bückte sich, riss einen Grashalm vom Rasen ab und kaute wie ein Landei darauf herum. »Wusstest du, dass nur einer von siebzehnhundert Grashalmen Spuren von Hundeurin aufweist?«
»Ach?«
»Statistisch ist es wahrscheinlicher, auf hoher See von einem Schwertfisch aufgespießt oder von einer Dampfwalze überrollt zu werden, als Gras in den Mund zu nehmen, auf das ein Hund gepisst hat.« Die Art, wie er sprach, bedächtig und wortgewandt, bildete einen scharfen Gegensatz zu seiner ansonsten neurotischen Art. Er verhielt sich, als sei er bis zum Rand mit Nitroglycerin gefüllt und könne bei der geringsten Erschütterung in die Luft fliegen. »Es ist schon fast Zeit für meine Pillen. Ich habe einen Goldfisch in meinem Zimmer. Was schreibst du da in dieses Notizbuch? Kann ich es sehen?«
»Lieber nicht«, antwortete die junge Frau. Ob nun bewusst oder unbeabsichtigt, hatte sie den Bleistift in ihrer Hand gedreht, und die Spitze ragte aus ihrer Faust.
»Okay«, sagte Mark. »In Ordnung.« Er ging nicht. »Erinnerst du dich an mich? Aus unserer gemeinsamen Highschool-Zeit?«
»Wir waren nicht zusammen …«, setzte sie an und besann sich dann eines Besseren.
»Mir scheint, du erinnerst dich nicht mehr.« Er schob die Hände in die Taschen. »Ist ja auch nicht deine Schuld, ich sehe heute anders aus. Früher hatte ich rote Haare, aber das habe ich gelöst, indem ich mir eine Kugel in den Kopf gejagt habe.« Zur Demonstration nahm er eine Hand aus der Tasche, bildete mit den Fingern eine Pistole und setzte sie sich an die Schläfe. »Du hast keine Ahnung, wie viele Sorten Käse es gibt. Weißt du, warum alle Drillsergeants in der Armee beschnitten werden? Sie brauchen die Vorhaut als Augenlid für das dritte Auge hinter ihrer Stirn, damit der Feind nicht abhören kann, was sie denken. Also gut, ich gehe dann mal. Sei nett zu dir und zu deinen Reptilien-Oberherren.«
Damit setzte er ein dämonisches Jack-Nicholson-Grinsen auf und ging davon.
Das Unbehagen in ihrem Bauch hatte sich gelegt. Sobald Mark/Mike außer Hörweite war, stand sie auf und ging hinein. Frische Luft oder nicht, sie wollte nicht im Hof sitzen, wenn ihn erneut der Drang befiel, jemanden vollzuquatschen.
Als sie die Tür zum Aufenthaltsraum öffnete, sah sie über die Schulter. Mark/Mike exerzierte enthusiastisch auf dem Weg in der Mitte des Hofs und salutierte zackig bei jeder Kehre. Plötzlich rannte er los zum anderen Ende des Hofs, riss verärgert die nächstliegende Tür auf und stürmte hindurch.
Sie schlich so schnell wie möglich hinein.
Im Aufenthaltsraum war es friedlich. Die meisten anderen Patienten des Flügels waren draußen, daher hatte sie den Raum fast für sich allein. Sie ging zu einer Couch, einem uralten, gemütlichen Beutestück aus einem Secondhandladen, und ließ sich darauf nieder, weil sie fernsehen wollte. Es lief ein Spielfilm, ein alter, der in den 70ern oder 80ern spielte, mit Polizisten und Autos, aber sie hatte keine Lust, die geistige Energie aufzubringen und den Titel herauszufinden.
Eine Weile später rüttelte sie jemand wach. Eine kleine, stämmige Frau mit Wuschelhaaren. Jennifer, eine Schwester aus der Spätschicht.
»Alles gut bei dir?«, fragte sie.
»Ja, alles gut«, sagte die junge Frau. Etwa jede halbe Stunde wurde man von den Schwestern kontrolliert. Es war ärgerlich, aber nicht so schlimm, wie es ohne die Dämpfung durch die Medikamente gewesen wäre. »Ist es schon Zeit fürs Abendessen?«
»Zwei Stunden hast du noch.« Jennifer zeigte mit dem Daumen über die Schulter. »In zwanzig Minuten fängt die Kunsttherapie an. Willst du dran teilnehmen oder lieber auf der Couch weiterschlafen?«
Sie suchte den Raum ab. Mike/Mark war nicht hier, doch einige Patienten waren von draußen hereingekommen und schauten fern, während sie döste. »Ich bleibe hier, danke.« Sie wühlte in ihrem Kopf und fand etwas, das vielleicht als Lächeln durchgehen würde. »Bin heute nicht so in der Stimmung für Kartoffeldruck.«
»Ganz wie du möchtest.«
Die Schwester ließ sie allein und sprach leise mit einem anderen Patienten, dann machte sie sich zur Flurtür auf. Als sie dort ankam, kam die Oberschwester herein, im Gefolge den größten und langgliedrigsten schwarzen Mann, den die junge Frau je gesehen hatte. Er machte den Eindruck, als sei er fast zweieinhalb Meter groß. Gekleidet war er in einen schicken blauen Anzug, der Kragen stand bis zum zweiten Knopf offen und gab den Blick auf einen hellen Anhänger auf seiner Brust frei.
Selbst durch den Medikamentendunst sah sie, dass er es nicht gewohnt war, elegante Kleidung zu tragen. Er hatte einen schweren Gang, müde, langsam, wie eine alte Giraffe; seine Augen waren hart und kalt.
Die Oberschwester und der Fremde unterhielten sich kurz an der Tür, dann suchten sie den Raum ab. Die Schwester entdeckte die junge Frau als Erste. »Da ist sie«, sagte sie und kam näher. Der Mann folgte ihr nicht.
»Hi, meine Liebe.« Schwester Anderson war eine in Honig getauchte Schlange: im ersten Moment süß, und dann im Innern pures Gift. Sie war hübsch, sah aus wie ein Starlet aus den 60ern, hatte scharfe Züge und eine schlanke Figur. »Wie geht es dir heute?«
»Besser. Freue mich aufs Essen.«
Anderson nickte. »Ich mich auch. Ich habe nicht viel zu Mittag bekommen, und Junge, tun mir die Füße weh.«
Oh, buuhuuu.
»Na ja, genug gejammert.« Anderson setzte ihr typisches Lächeln auf. Ihre Stimme klang wie Vogelgezwitscher, übertrieben angenehm, als würde sie mit einem Idioten reden. »Dieser nette Herr hier sagt, er würde gern mit dir reden. Er sagt, er war mit deiner Familie bekannt, als du noch ein Baby warst. Und er sagt, er kennt jemanden namens Cutty?«
Eis bildete sich in den Adern des Teenagers, als habe man ihr Freon injiziert. Cutty. Hexe. Cutty. Hexe. Die letzten Worte ihrer Mutter hallten durch die leeren Räume ihres Verstands und stachen wie scharfe Klingen durch das Zoloft und das Abilify.
»Was?«, fragte sie. Es fühlte sich an, als hätte sich die Kälte bis zu ihrem Gesicht und ihrem Mund ausgebreitet und die Lippen steif und mürbe gemacht.
»Er sagt, er heißt Heinrich. Er war ein Freund deiner Familie, ehe, äh …« Die Oberschwester legte den Zeigefinger an die Lippen. »… ehe du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast. Er sagt, er will dich mit nach Hause nehmen.«
Der Blick der jungen Frau schoss über Andersons Schulter zu dem Mann, der an der Tür stand und die Fingerspitzen in den Jacketttaschen hielt. Dieser Heinrich hatte eine Haltung wie ein Monolith und war der König der unbewegten, strengen Miene. »Ich habe kein Zuhause mehr«, sagte sie, zog die Beine auf die Couch und die Knie vor die Brust.
Anderson sah den Mann an und zuckte dezent mit den Schultern.
Er schlenderte herüber. »Ich übernehme mal, Ma’am«, sagte Heinrich mit tiefer Stimme, die gleichzeitig sanft und rau war, wie akustischer Kordsamt. Wenn er einen Cowboy-Hut gehabt hätte, hätte er ihn vermutlich vor die Brust gehalten. Die junge Frau hegte so den Verdacht, als verstecke er irgendwo einen, vermutlich in seinem Motelzimmer.
Anderson spitzte die Lippen, als sie sich aufrichtete, und sie warf ihr einen letzten strengen Blick zu, ehe sie die beiden ihrem Gespräch überließ.
Heinrich setzte sich neben der jungen Frau auf die Couch, zwischen sie und einen anderen Patienten. Er ließ ihr einen Augenblick, ob er es tat, um ihr die Möglichkeit zu geben, sich an seine Nähe zu gewöhnen, oder um sie einzuschüchtern, konnte sie nicht sagen. Schließlich meinte er mit ruhiger Stimme: »Du bist Robin, ja? Robin Martine. Ich bin hier richtig, oder?«
Sie beäugte ihn. »Vielleicht.«
»Ich bin Heinrich«, sagte er und bot ihr die Hand an. Sie nahm sie nicht. Er zog sie zurück und ballte sie behutsam zur Faust, als habe er etwas von ihr genommen. »Heinrich Hammer. Vor langer Zeit habe ich deine Mutter gekannt. Wir waren gute Freunde.«
»Ich glaube, Sie reden Mist«, erwiderte Robin. »Meine Mutter hatte keine Freunde. Und das ist echt ein scheißschräger Name.«
»Da war doch Miss Cutty, eine Weile jedenfalls, oder?«
Aus der Nähe wirkte die Haut in seinem Gesicht wie Sattelleder, und ein pechschwarzer Bart wuchs darauf wie Moos auf einem Stein. »Sie wissen gar nichts über Marilyn Cutty«, sagte Robin. »Kein verdammtes bisschen. Ich habe keine Ahnung, wer oder was Sie sind, aber bei mir sind Sie falsch.«
»Oh, ich bin ziemlich sicher, dass ich hier richtig bin.« Während er sprach, wurde sein Gesicht ein wenig dunkler, wenn das überhaupt möglich war. Dann hellte es sich wieder auf. »Ich kannte deine Mutter, ich weiß, wer Cutty ist, und vor allem – und ich denke, das ist am wichtigsten für dich –, ich weiß, was Cutty ist.«
Robins Herz flatterte in ihrer Brust.
»Sie ist eine Hexe«, fuhr Heinrich fort, »und du …«
»Hexen gibt es nicht. Hexen gibt es nicht.« Adrenalin schoss in ihren Blutkreislauf. Unter ihrer Jogginghose bildete sich eine Gänsehaut und zog sich die Oberschenkel hinunter. Ihre Blase drohte, die Schleusentore zu öffnen. »Hexen gibt es nicht.« Sie blickte an sich herunter und sah, dass sie ihr Notizbuch zerknüllte und zu einem Akkordeon zusammendrückte. »Cutty war nur irgendeine Frau …
(geh schon und schau nach, Vögelchen)
… die auf der anderen Straßenseite wohnte. Mein Vater hat meine Mutter ermordet. Er ist ein Mistkerl, und Hexen gibt es nicht.« Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht … »Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, warum Sie hier sind, aber ich glaube, ich möchte nicht weiter mit Ihnen reden.« Hexen gibt es nicht, Hexen …
(Mom hat es mich vergessen gemacht)
… gibt es nicht, Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht. Sie hörte das Reißen von Papier, das Brechen eines Bleistifts. Ein stechender Schmerz schoss durch ihre linke Hand, doch sie nahm ihn kaum wahr. Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es …
(die Frau hatte ein Loch als Gesicht)
… nicht, Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht.
Die Miene des Mannes hellte sich auf, und er zog die Augenbrauen hoch, als merkte er, dass er sich in die Bredouille gebracht hatte. »Hey, ganz ruhig«, sagte er sanft und beschwichtigend. »Tut mir leid, Kleine, beruhig dich, okay? Kein Grund, hier rumzuschreien.«
Schreien? Wer schrie?
(Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück.)
Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht.
Hier schreit niemand.
(Ich muss mich selbst schützen.)
Der Patient hinter Heinrich schaukelte hin und her und drückte die Fäuste an die Ohren. Irgendwo hinter ihnen jammerte jemand mit bebender Stimme. Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht, Hexen gibt es nicht. Anderson kam durch die Tür und schien zu zögern, ihr Blick schweifte durch den Raum, in dem die anderen Patienten immer erregter wurden. In einer Hand hielt sie eine Injektionsspritze.
»Nein!«, sagte Robin, bei der sich Angst in Wut verwandelte. »Kommen Sie ja nicht zu mir mit diesem verdammten Ding!« Man sah dabei ihre gelben Zähne, ihre fettigen Haare teilten sich und enthüllten ihr alarmiertes Gesicht. »Wenn Sie mich damit stechen, beiß ich Ihnen die Finger ab! Ich schwöre es!«
Der Mann packte sie an den Schultern. Seine Hände waren kräftig, stark wie Eisen, aber er brauchte nicht fest zuzudrücken. Er wendete gerade so viel Druck an, dass er sie bändigen konnte, es fühlte sich an, als würde sie mit Handschellen an die Wand gefesselt. Heinrich blickte über die Schulter zu der Schwester und schüttelte den Kopf. »Nein! Nicht die Chemiekeule. Ich komme schon mit ihr klar. Kümmern Sie sich nur um die anderen. Hier ist alles okay.«
»Sir, das sieht mir überhaupt nicht ›okay‹ aus. Sie verstören unsere Bewohner.«
»Ja … ich meine, nein. Hören Sie, ich will nur …«
»Gut, was immer Sie wollen, nehmen Sie das Mädchen mit nach draußen, ja?«, verlangte Anderson und kam anmarschiert, während die Spritze zwischen ihren Fingern hervorragte. »Weg von den anderen. Reden Sie im Hof mit ihr.« Sie und der Mann namens Heinrich zogen Robin an den Armen hoch und begleiteten sie aus dem Aufenthaltsraum hinaus.
Draußen im Sonnenschein, mit dem lebendigen grünen Gras und dem warmen Wind, wirkte alles ein bisschen weniger unheilvoll.
»Halte mal kurz den verfluchten Mund«, sagte Heinrich und setzte sich auf eine Bank. Inzwischen war er offensichtlich aufgebracht und gereizt. Robin ließ sich sofort ins Gras fallen. Sie zog die Knie vor die Brust, das zerknitterte Notizbuch klemmte zwischen ihren Beinen, und das Gras roch kühl, tröstlich, angenehm.
»Sir«, sagte Anderson scharf. »Diese Ausdruckweise ist nicht notwendig.« Sie hielt inne. »Und sehen Sie, sie hat sich selbst verletzt. Was haben Sie hier eigentlich vor?«
Robin stellte fest, dass sie sich den Bleistift ziemlich tief in die Hand gerammt hatte. Blut floss über den Handballen. Sie blickte die Schwester flehend an und blinzelte ins Sonnenlicht. »Ist doch nicht schlimm, ist doch nicht schlimm. Ich muss nicht ins Krankenhaus, ist doch nicht schlimm, mir geht es gut.«
Sie erhaschte einen Blick von Heinrich, in dem zugleich Frustration, Enttäuschung und Verständnis lag. Und eine Aufforderung. Komm schon, Kleine, reiß dich mal zusammen, schien er zu sagen. Ich bin so weit gefahren, um dich zu besuchen, und ich habe mehr von dir erwartet, nicht dieses Geschrei und diesen Wahnsinn.
Anderson nahm ihre Hand, drehte sie um und sah sich die Wunde an. »Ich denke, das muss auf jeden Fall desinfiziert und verbunden werden.«
»Mir geht es gut. Alles ist gut. Ich beruhige mich, glaube ich.«
Sie wischte das Blut an der Jogginghose ab. Anderson war sichtlich nicht damit einverstanden.
Der Mann zog ein Taschentuch aus einer Brusttasche seines Jacketts und wischte den Rest des Blutes ab, dann band er das Tuch fest um Robins Hand. »Bitte. Erledigt«, sagte er und drückte so fest auf ihre Hand, dass sie ihren Puls in den Fingerspitzen spürte.
Fern der anderen Patienten und anderen Schwestern bröckelte Andersons Fassade. Sie hatte beide Hände zu Fäusten geballt. »Bist du jetzt ruhig?«, knurrte sie und setzte die Kappe auf die Spritze. »Oder muss ich dich am Ende doch noch piksen?«
»Ja. Ich meine, nein. Ich meine, S-Sie brauchen nichts zu machen.«
Heinrich saß vor Robin in der Hocke und hielt noch immer die verbundene Hand. »Alles cool, nicht wahr? Wir können Freunde sein und uns ein bisschen unterhalten, ja?«
Robin nickte.
Heinrich rieb sich den Nacken und seufzte. »Ich denke, es ist alles in Ordnung.« Sein Blick ging zur Schwester und dann wieder zu Robins bleichem Gesicht. »Alles in Ordnung. Sie können gehen.«
»Ich hoffe nur, Sie nehmen sie tatsächlich mit, wie Sie gesagt haben«, meinte Anderson und schob die Spritze in die Tasche ihres Kittels. »Sie ist ein bisschen schwierig und …«
»Ich habe gesagt, Sie können gehen.« Seine Stimme war eisig.
Anderson drehte sich um und ging davon. »Die ist süchtig nach Aufmerksamkeit, das schwöre ich bei Gott«, murmelte sie vor sich hin. Ihre rosa-lila New-Balance-Sneaker wetzten den Weg entlang, während sie in ihrer geschäftigen Art über den Hof eilte und wieder im Aufenthaltsraum verschwand.
»Also«, sagte Heinrich, der immer noch vor ihr hockte, »wo waren wir stehengeblieben?«
»Hexen.« Sie sprach kaum lauter als im Flüsterton.
Er verharrte, und ein winziges Lächeln stahl sich in seine Mundwinkel. »Ja.« Er drückte ihre Hand leicht. »Genau, wir haben über … sie geredet.« Sie hielten einen Moment inne, saßen im Sonnenschein. Das Licht glänzte auf seinem kahlen braunen Kopf. Kühles Gras kitzelte an Robins Ellbogen.
Dann griff er in die Innentasche seines Jacketts und holte einen Zigarillo heraus. »Stört es dich, wenn ich rauche?«
Sie reichten den Zigarillo hin und her und rauchten immer abwechselnd. Sie hatte mit dem Rauchen angefangen, als alles den Bach runterging, und zuerst musste sie husten, doch der Zigarillo war so mild, dass sie nun keine Schwierigkeiten mehr hatte. Er schmeckte nach Kokosnuss, und nachdem sie so lange Zeit in einer schäbigen psychiatrischen Klinik gehockt und wenig anderes als Reinigungsmittel und Schweißfüße gerochen hatte, fühlte sie sich wie in einem tropischen Paradies.
»Sie sagen also, ich bin nicht verrückt. Diese Hokuspokus-Psycho-›Therapie‹, der mich der Psychiater unterzogen hat, Gehirnwäsche, Medikamente, Leugnung, das alles war Schrott.« Robin saß jetzt im Schneidersitz am Ende der Bank, und Heinrich hockte mit den Ellbogen auf den Knien vor ihr. Der Nadelstreifen-Anzug war marineblau, und er sah darin aus wie ein Zugschaffner. Aber dazu trug er schwarze Springerstiefel, die so auf Hochglanz poliert waren, dass man sich fast drin spiegeln konnte.
»Was ich behaupte, gesehen zu haben, sind keine Wahnvorstellungen, die durch – wie der Psycho-Heini es nennt – die Psychose hervorgerufen werden, welche wiederum durch das Trauma verursacht wird, den Tod meiner Mutter miterlebt zu haben. Das ganze letzte Jahr, die Zwangseinweisung, die Fixierung am Bett, das war … umsonst? Mit mir ist alles in Ordnung?«
»Ja. Ich fürchte, du bist nicht verrückt.« Jetzt hatte Heinrich den Zigarillo. Er aschte zwischen seinen Schuhen auf den Boden. »Na ja, wenn du verrückt bist, bin ich es auch.«
Am liebsten hätte sie geheult, ehrlich. Sie wollte, aber dank der Abgestumpftheit durch das Zoloft brachte sie keine Träne hervor. Der Gedanke, dass sie die ganze Zeit recht gehabt hatte, war eine Erleichterung, jedoch nur eine kleine, als hätte sie einen Stein aus dem Schuh gefischt. Und um ehrlich zu sein, wurde sie durch eine ziemlich bestürzende Vorstellung beeinträchtigt – Hexen gab es doch.
»Und … nun?«, fragte sie. »Was bedeutet das für mich?«
Er zog am Zigarillo und ließ sich die Frage durch den Kopf gehen. »Deine Mutter wurde ermordet«, sagte er auf seine unverblümte Art und blinzelte in den Rauch. »Von deinem lieben Daddy.«
»Ja, was du nicht sagst, Shaft. Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß. Dieses Arschloch von meinem Vater hat sie die Treppe runtergestoßen und ihr das Genick gebrochen.« Sie wollte ihren Vater nicht Dad nennen. Dad war reserviert für Männer, die sich kümmerten, die ein Kind anständig erzogen, es zum Angeln mitnahmen und auf dem Heimweg Eis kauften, Männer, die dich nach dem Abschlussball mit dem Auto abholten, weil du zu betrunken warst, um selbst zu fahren oder mit einem Jungen zusammen zu sein. Männer, die deine Mutter nicht ermordeten.
Sie war in der Küche gewesen, als es passierte, zehnte Klasse in der Highschool, sie machte sich gerade einen Krug mit Eistee. Sie rannte hinaus und erstarrte im Schock. Ihre Mutter lag auf dem Boden, unnatürlich verrenkt, eine Stoffpuppe im Kleid, der Kopf in bizarrem Winkel abgeknickt, der Blick in Richtung Decke.
Robin saß neben ihr und hielt sie fest, verzweifelt, verwirrt.
Ein paar Minuten später riss ihr Vater sie aus dieser Haltung. Einer von uns hat die Polizei gerufen, aber ich erinnere mich nicht, wer.
Der Tee, ich weiß noch … ich habe den Kessel auf dem Herd vergessen und fast das Haus abgebrannt. Die Küche und ein Teil des Wohnzimmers brannten schon, als die Polizei eintraf, aber die freiwilligen Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen, jedenfalls hatte man es ihr so erzählt. Aus dieser Nacht hatte sie nicht viele Erinnerungen. »Der Staat Georgia hat meinen Vater des Mordes angeklagt«, sagte sie leise, »Dritten Grades, zweiten Grades, vorsätzlich, ich weiß es nicht, ich war nicht beim Prozess. Aber dann hatte der Staat plötzlich die Vormundschaft für mich, die Bullen hatten mich mitgenommen. Und dank der Geschichte über Hexen und über das Auskotzen einer Katze hat der Psychiater meinen Geisteszustand als nicht aussagefähig eingestuft.«
»Dein Vater hat deine Mutter Annie umgebracht, weil sie ihn dazu gebracht haben«, sagte Heinrich. Seine Stimme bohrte sich in ihre Gedanken.
»Cutty«, murmelte Robin, »Hexe.«
Die verwirrten letzten Worte meiner Mutter, das Letzte, was sie zu mir gesagt hat, als ich dort saß und ihren schlaffen Körper hielt.
Ihr Vater war die Treppe heruntergekommen, steif und langsam, hatte kein Wort gesagt, sich mit einer Hand am Geländer festgehalten … und als er unten ankam, fiel er auf Hände und Knie und machte einen Buckel und würgte, als wollte er einen Haarballen ausspucken.
Er begann, Blut zu spucken.
Es kam wirklich aus ihm heraus, ich meine, er hat den ganzen Läufer besudelt, und dann hat er gewürgt. Er hat gewürgt und am Ende eine Katze erbrochen. Sein Hals hat sich gewölbt wie eine Melone, und dann schlängelte sich diese graugestreifte Katze aus seiner Kehle und kam jaulend und zischend aus seinem Mund, Fell und Ohren nass vor Blut. Sie hatte ausgesehen wie ein gewachstes Wiesel. Und obwohl sie so geschmiert war, blieb sie stecken. Sie musste sich den ganzen Weg erkämpfen. Aber bevor er erstickte, packte Robins Vater die gestreifte Katze am Kopf und zog sie heraus wie ein … wie ein Magier, der auf einer Geburtstagsparty Tücher aus dem Mund zieht.
»Er war ihr Vertrauter«, sagte Heinrich.
»Vertrauter?«
»Von den Frauen, die in dem Haus auf dem Hügel gegenüber von eurem wohnten. Marilyn Cutty, Theresa LaQuices und Karen Weaver. Diese Frauen sind wahrscheinlich der älteste und mächtigste Hexenzirkel in Amerika. Ich suche schon seit Jahren nach ihnen und nach einer Möglichkeit, sie zu erwischen.«
Cutty, die ulkige, wunderliche Marilyn Cutty, die sie so lange Jahre als Großmutterersatz betrachtet hatte, in deren Haus sie als Kind gespielt hatte. Robin erinnerte sich, auf dem Boden in Cuttys Wohnzimmer zu liegen und die Sonntagscomics zu lesen und die dreifarbige Katze Stanley zu streicheln, während sie ein bisschen high war von den duftenden Filzstiften, mit denen sie gemalt hatte. Wenn Robin während der häufigen Streitigkeiten ihrer Eltern in Marilyns Haus floh, ging diese mit ihr einkaufen, und jedes Mal kamen sie mit einem dieser schwierigen Lego-Bausätze nach Hause. Gott, sie liebte Lego. Du musst mir nichts kaufen, sagte Robin immer, und Marilyn antwortete dann: Ich weiß. Deshalb tue ich es.
Wie konnte diese alte Frau, die ein kleines Mädchen liebte und ihm Geschenke machte, so böse sein?
»Weißt du, Katzen tun alles, was ihnen eine Hexe sagt«, fuhr Heinrich fort. »Das ist nicht nur ein Klischee – Hexen haben tatsächlich schwarze Katzen, weiße Katzen und graue Katzen. Alle Arten von Katzen, aber eigentlich ist es ein bisschen komplizierter.«
Er reichte Robin den Zigarillo, den sie mit den Lippen packte wie einen Joint und sich die Lunge mit Rauch vollsog.
»Hexen können Katzen Befehle erteilen, wie die Ratten in diesem Film, Willard«, sagte der schlaksige Fremde. »Dazu sind sie in der Lage, weil Katzen der mesopotamischen Göttin Ereschkigal gehören und ihr unterworfen sind – sie sind Geschöpfe des Jenseits, und deshalb können sie auch Geister sehen.«
Robin erstarrte und sah ihn an, als wollte sie sagen: Du verarschst mich. Sie reichte ihm den Zigarillo.
»… ja«, spöttelte er, »Gespenster.«
Seine Stimme war hart, aber seine Augen waren voller Bedauern. »Das ist eine vollkommen andere Baustelle, aber vielleicht haben wir irgendwann Zeit dafür.« Er zog an der Royal Hawaiian, und Rauch schlängelte sich aus seiner Nase wie bei einem Drachen. »Im Augenblick musst du nur eins wissen: Deine Mutter ist eine Hexe gewesen.«
Sie war baff. Sprachlos.
Sie saß einfach nur da und versuchte, diese süße, hübsche, gutgelaunte Mutter, diese zierliche Hausfrau mit dem Lockenhaar
(Mom hat mich etwas vergessen gemacht),
mit dem albernen Sprachfehler und der tiefen, hingebungsvollen Liebe zum Christentum
(Ich muss mich selbst schützen),
mit dem finsteren Bild von Hexen in Einklang zu bringen, welches sie in den Monaten des Aufenthalts in der psychiatrischen Klinik entwickelt hatte. Sie hatte es die ganze Zeit gewusst, oder nicht? Ihr Blick fiel auf die Narben auf den Innenseiten ihrer Unterarme, der Hühnerkralle, dem Algiz, das in ihre Haut geschnitten war. Mom hatte versucht, sie Dinge vergessen zu lassen, die sie gesehen und gehört hatte, als sie noch klein war, und in ihrem Gedächtnis gab es Löcher wie in einem mottenzerfressenen Pullover, doch am Ende hatte sie es geschafft, einige davon festzuhalten. Ganz hinten in ihrem Kopf hatte dieser Verdacht verweilt, auch noch nach der Elektroschocktherapie.
Mom war eine Hexe. Heinrichs Behauptung belebte diese alten Narben der Erinnerung wieder. Du weißt, dass es stimmt.
»Es gibt gute Hexen, und es gibt böse Hexen«, sagte Heinrich. Manchmal, so schien es, traf auf eine Hexe beides zu. »Deine Mutter war eine gute Hexe, und sie war eine neue Hexe. Cutty hat sie vermutlich erst einige Jahre nach deiner Geburt überredet, ihr Herz aufzugeben.« Heinrich richtete seine harten Augen auf Robin. »Vielleicht tröstet dich der Gedanke, dass Annie bis nach deiner Geburt gewartet hat, ihr Herz Ereschkigal zu schenken. Hexen können keine Kinder bekommen. Um eine Mutter zu sein, muss man ein Herz haben.«
»Was hat das alles mit meinem Vater und den Katzen der Hexen zu tun?«
»Es gibt einen Pilz namens Cordyceps«, sagte Heinrich leise und bedächtig, als mache er ein Geständnis. »Das ist der wissenschaftliche Name. Er befällt das Gehirn von Ameisen und bringt sie dazu, Dinge zu tun, die sie normalerweise nie tun würden, wie zum Beispiel auf Bäume zu klettern, wo der Pilz aus ihren Köpfen platzt und seine Sporen in der Luft verteilt. Sich reproduziert.
Katzen können von einem Parasiten befallen werden, ›Toxoplasma Gondii‹, und der kann das Gehirn des Wirtes befallen und dessen Verhalten beeinflussen. Wenn sich eine Maus an Katzenkot infiziert, entwickelt die Maus eine Krankheit namens Toxoplasmose und benimmt sich wirr. Sie wird praktisch verrückt und fängt an, Katzen zu mögen. Du kannst dir vorstellen, was als Nächstes passiert: Die Maus endet im Bauch der Katze. Das ist der einzige Ort, wo sich der Parasit vermehren kann. Und, hakuna matata, der ewige Kreis des Lebens geht in die nächste Runde.«
Er nahm einen Zug und reichte ihr den Zigarillo. »Die Hexen haben herausgefunden, wie sie metaphysisch eine Katze in einen Menschen ›implantieren‹ können, so wie sich der Cordyceps im Gehirn der Ameise einnistet und so wie Toxoplasma Gondii Mäusehirne infiziert. Sie jaulen und zischen und krallen wie eine Katze. Weil sie eben Katzen im Körper eines Menschen sind. Körperfresser. Unsichtbare Parasiten, nehme ich an. Diese Parasitenkatzen verharren inaktiv in ihren menschlichen Wirten wie ungeborene pelzige Kinder, sind Schläfer und warten, bis die Hexen sie brauchen.«
»Das stimmte also mit meinem Vater nicht, in der Nacht, in der er meine Mutter die Treppe hinuntergestoßen hat«, sagte Robin. »Er war zum Vertrauten geworden und trug eine Katze ›in sich‹.«
Irgendwann hatte die Bedeutung ihres Gesprächs die Medikamente durchdrungen, und Tränen traten ihr in die Augen, als sie das Gefühl bekam, doch recht gehabt zu haben. Robin fuhr sich mit der Innenseite des Hoodies übers Gesicht. Allmächtiger Gott, sie hatte tatsächlich recht gehabt. Sie log nicht, sie hatte keine Wahnvorstellungen, sie hatte auch keine der anderen Störungen. Scheiß auf ihren Therapeuten. Scheiß auf Kunsttherapie. Scheiß auf Anderson.
Wie aus heiterem Himmel erschien ihr die Luft süßer. Sie fühlte sich, als hätte man sie aus einer verschlossenen Truhe gelassen, in die sie für ein Jahr eingesperrt gewesen war.
»Warum haben sie das getan?«, fragte sie.
Inzwischen hatten sie den Zigarillo so weit geraucht, wie es möglich war. »Warum sie Annie ermordet haben?« Heinrich zerdrückte den Zigarillo am Ende der Bank, machte ihn aus und schnippte ihn ins Gebüsch. »Sie brauchten Annie, um sie zu einer Dryade zu machen.«
»Was ist das?«
»Eine Dryade ist im Grunde eine Seele, die in einem Baum gefangen ist. Also, praktisch ist es der Name für das Baumgefängnis an sich, aber der Begriff bezieht sich auch auf die Kombination von Baum und Seele. Jedenfalls kommen Dryaden nicht in der Natur vor, deshalb muss man sie erschaffen – vorausgesetzt, man weiß wie, versteht sich. Wenn man eine Dryade aus einer normalen Person erschafft – nehmen wir mal an, Mr. Jedermann von der Straße – , dann tötet man ihn, leitet seinen Geist in einen Baum, und man hat lediglich einen sich seiner selbst bewussten Baum. Ziemlich beschissenes Dasein für den armen Mr. Jedermann, der den Rest der Ewigkeit mit Eichhörnchen verbringen muss, die ihm Eicheln in den Hintern schieben. Ansonsten ist nichts Besonderes dran.
Wenn man aber eine Dryade aus einer mit übernatürlichen Kräften beschenkten Person erschafft, zum Beispiel aus einer anderen Hexe, bekommt man etwas, das nag shi heißt. Wie die Person, aus der die Dryade erschaffen wurde, absorbiert es Energie. Und mit ein wenig Beschwörung und einem Eimer Menschenblut zweimal in der Woche wird es zu einer Art spirituellem Schwarzem Loch. Die Wurzeln des Baums saugen das Leben in einem Umkreis von Meilen auf, und wenn es sich um eine Stadt wie Blackfield handelt, zapft der Baum die Stadt an, um sich zu ernähren.
Der Seelenbaum saugt den Lebenswillen aus der Stadt und verwandelt diesen in seine Früchte. Pfirsiche, Äpfel, Zitronen, was auch immer die Dryade hervorbringt. Wohin geht all die Energie, fragst du? In die Frucht der Dryade. Die Frucht des Lebens. Die Frucht der Unsterblichkeit.«
»Weißt du, vielleicht hast du eine Chance, deine Mutter noch zu retten«, erklärte Heinrich ihr. »Sie ist möglicherweise nicht richtig tot. Nicht vollständig. Sie ist ein nag shi. Irgendwo im Inneren der Dryade existiert sie noch.«
Beim Gedanken, ihre Mutter wiederzusehen, lief es ihr kalt den Rücken hinunter.
Ihr eigenartiger Wohltäter legte ihr eine der rauen, knochigen Hände auf die Schulter. »Aber das wird nicht leicht«, sagte er. »Du musst viel trainieren. Du musst lernen, wie du sie besiegen kannst.« Er beugte sich zu ihr vor. »Wie würde es dir gefallen, hier herauszukommen?«
Im ersten Moment bohrte sich Angst wie ein Splitter tief in sie hinein. Ein ungewisses Gefühl der Verletzlichkeit keimte in ihr auf, wie bei einer Maus, die sich ins offene Gelände aufmacht, wo sie von allen Eulen und Adlern und Falken gesehen werden kann. Nachdem sie mitangeschaut hatte, wie sie ihre Mutter ermordet hatten, was sie ihrem Vater angetan hatten, fürchtete sie, sie würden auch hinter ihr her sein. Schließlich, als sich der Nebel aus Angst und Wahn und Paranoia lichtete, sie ihre Medikamente nahm und sich an die neue Umgebung gewöhnte, hatten die Betonmauern der psychiatrischen Klinik ein Gefühl von Sicherheit und Schutz erzeugt.
Sie blinzelte. Langsam ging es ihr wie diesem alten Kerl in dem Gefängnisfilm, der sich in der Welt draußen nicht mehr zurechtfindet. Die Verurteilten. Wie hieß der noch? Books? Hooks? Brooks?
»Ich möchte, dass du mich begleitest«, sagte er, »zurück zu mir, nach Texas.«
Texas, dachte sie und fuhr sich mit der Zunge über die aufgesprungenen Lippen.
Im Kopf sah sie Bilder von weiter, offener Wüste, trockenem Wind, struppigem Wüsten-Beifuß, Sand, Steppenläufern … es war berauschend. So anders als die glühend heißen, engen Wälder von Georgia. »Ich kann dich ausbilden«, sagte Heinrich. »Ich kann dir beibringen, was ich über Hexen weiß – und …«, er grinste höhnisch, »… mit meinem Wissen könnte ich ein ganzes Buch füllen.«
Der hoch aufgeschossene Fremde erhob sich von der Bank, zog sein Jackett zurecht und klopfte die Rückseite seiner Hose ab. »Wenn du mitkommst, kannst du ihnen alles heimzahlen, was sie dir angetan haben. Wenn du willst, kriegst du alle Hexen.«
Alle Hexen.
»Wie viele Hexen gibt es?«, fragte Robin und drohte, sich wieder in ihren Panzer zurückzuziehen. Sie blickte sich vorsichtig um. Die Sonne würde gleich untergehen, und die Schatten, die sich mit der Unendlichkeit der Pinien um sie herum vermischten, wurden länger und tiefer.
»Ein paar.«
»Wie viele sind ein paar?«
»Ich weiß nicht, ein paar hundert?« Heinrich winkte ab, als wollte er die Frage wegwischen. »Pass auf, die meisten sind schwach. Die sind nicht mal die Jagd wert. Kaum mehr als handlesende Hippies und verrückte Katzenladys. Aber ein paar sind echt böse. Der große Fisch ist jedoch Cuttys Hexenzirkel.« Er zog seine Manschetten zurecht und richtete die Ärmel. »Wenn du dein Training bei mir absolviert hast, kannst du deine ersten Erfahrungen mit den kleinen Würstchen machen, ehe du nach Blackfield zurückgehst und tust, was du tun musst. Ich sorge dafür, dass du bereit bist, ehe du gegen eine von ihnen antrittst. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du eine Killermaschine.«
Mitten in seiner Ansprache kam Mark (oder vielleicht auch Mike) aus dem Aufenthaltsraum, immer noch in dem eine Nummer zu großen Sonntagsanzug und Tweedmantel. Er fuchtelte wild vor sich herum, als wollte er den Rasen glattstreichen. Dann hielt er die Hand in die Höhe und machte kneifende Bewegungen vor seinen Augen, während er Robin und Heinrich ansah. »Ich zerquetsche deinen Kopf! Ich zerquetsche deinen Kopf!«, schrie er, und seine Stimme hallte vom Gebäude wider. »Seht meine Werke und erbebt, Proletarier! Ich bin der Unterdrückergeist des freien Marktes, des Kapitalismus, und ich zerquetsche euch den Kopf!«
Robin und Heinrich sahen sich an.
»Ich hatte eine Schale Quaker-Haferbrei zum Abendessen«, sagte Mark/Mike. »Der Hafer darin wurde von Sklaven gepflückt, die Nachkommen derjenigen sind, die im Jahre 1962 vom Neptun kamen.«
»Ich habe ein notariell beglaubigtes Dokument, das besagt, dass ich die Vormundschaft für dich übernehme«, sagte Heinrich.
»Geben Sie mir eine Minute, damit ich meinen Kram zusammenpacken kann«, sagte Robin.
Er hielt ihr die Tür auf, als Robin zum ersten Mal seit über einem Jahr die Psychiatrie von Medina verließ. Sie trug noch immer ihren Hoodie mit dem aufgedruckten Namen der Klinik und die Jogginghose, doch in der Sporttasche, die sie in der rechten Hand trug, befanden sich Kleidungsstücke, die die Polizei aus ihrem Schlafzimmer im Haus an der Underwood Road gerettet hatte. Unglücklicherweise saßen die inzwischen ein bisschen eng – zu lange war sie entweder ans Bett gebunden gewesen oder hatte im Aufenthaltsraum herumgesessen, weshalb sie einige Speckröllchen entwickelt hatte und die Kleidung nicht mehr passte.
In der anderen Hand hielt sie einen Vorrat an Medikamenten, Abilify und Zoloft für Monate in einem Ziplockbeutel, zusammen mit einem Tablettenschneider.
»Wir halten irgendwo unterwegs an und besorgen dir etwas zum Anziehen«, sagte Heinrich, als ihm die Aufschrift auf der Rückseite ihres Hoodies auffiel. Er führte sie die Treppe hinunter zum Parkplatz. »Ich muss dir allerdings sagen, du wirst ein bisschen von deinem Babyspeck einbüßen, wenn du mit dem Training anfängst. Dann werden dir die Sachen in der Tasche sicherlich wieder passen.«
»Das wäre nicht schlecht, denke ich«, sagte Robin. Ihre Brust fühlte sich eng an, ihr Herz klopfte laut. »Mir gefallen sie gut. Ich würde sie gern wieder tragen.« Ja, würde sie wirklich? Die Klamotten in der Sporttasche waren mädchenhaft – Blumenkleider, T-Shirt-Kleider, Jeans mit Glitzersteinen am Po. Diese Person war sie nicht mehr. Sie hatte alle Kleidungsstücke angeschaut, während sie packte, und das Gefühl gehabt, sie gehörten einem Kind.
Heinrich fuhr einen Ford Fairlane, einen schnittigen, riesigen Straßenkreuzer. Er war in tiefem Teufelsrot lackiert, fast burgunderfarben, mit makellosem Chrome.
»Nette Karre, Mister«, sagte sie, als er den Kofferraum aufsperrte. Sie warf ihre Tasche hinein.
»Danke. Ich habe ihn von meinem Vater geerbt. Er war Prediger. Fast dreißig Jahre ist er damit jeden Tag zum Gottesdienst gefahren.«
»Sehr schön.« Sie sah durch die Heckscheibe auf die Ledersitze. »Sehr sauber.«
»Ich versuche, ihn in Schuss zu halten.«
Sie stiegen ein, und er machte den Motor an. Der klang wie ein Löwe im Käfig kurz vor dem Ausbruch.
Sorge lag in Heinrichs Augen: »Alles gut?«
Er starrte sie an, als erwarte er, dass sie wieder herumschreien würde, während seine Hände auf dem Lenkrad lagen. Robin holte tief Luft und seufzte unsicher.
»Ja«, sagte sie und legte ihren Sicherheitsgurt an. »Ja, ich glaube schon.«
Heinrich fuhr vom Parkplatz auf die lange, gewundene Einfahrt, die sie für immer von der Psychiatrischen Klinik Medina fortbringen würde. Zwanzigtausend Pinien flogen mit den Schatten der untergehenden Sonne über die Windschutzscheibe. Sie kurbelte das Fenster nach unten und ließ den Wind durch ihr fettiges Haar wehen.
Mann, ich sehe fertig aus, dachte sie und schnitt eine Grimasse, als sie ihr Gesicht im Seitenspiegel sah. Sie sah verwahrlost aus, wie eine Obdachlose – Haare wie Bigfoot, eklige Zähne, dunkle Ringe um die Augen, aufgerissene Lippen vom ständigen Lecken, das die Medikamente auslösten.
Der Wagen wirkte stabil. Die Tür fühlte sich robust an, schwer, solide. Unterbewusst entwickelte sie ein Gefühl der Sicherheit, auch wenn sie es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste.
»Wenn nun …«, murmelte sie aus dem Fenster.
»Hmm?«, hakte Heinrich nach.
»Wenn das nun ein Neuanfang ist? Wenn mein Leben jetzt noch einmal komplett neu beginnt?«
»Nennen wir es ›neu durchstarten‹«, sagte Heinrich und stellte das Radio an. Es war leise, ein kaum hörbares Säuseln von Rauschen und Musik. »Oder ›zweiter Take‹, wie es beim Film heißt. Okay?«
»Okay.«
Sie langte hinüber, drehte das Radio lauter und ging alle Sender durch, bis sie etwas anderes als Country fand. »The Crow and the Butterfly« von Shinedown erfüllte den Wagen mit Musik.
»Nicht das, was ich ausgesucht hätte, aber ich kann damit leben«, sagte Heinrich.
»Worauf stehen Sie denn?«
»Rock. Oldies. Creedence, Cash, AC/DC, Skynyrd, Hendrix.« Er suchte weiter, bis etwas Älteres kam: Aerosmith. Dream on, dream on, dream on, dream on. »Na, also. Bei KZ106 Tennessee kann nichts schiefgehen.«
»Meine Mom mochte diesen Sender«, sagte Robin.
Ein Lächeln breitete sich auf Heinrichs Gesicht aus, und er drehte lauter, bis Steven Tylers Stimme den Sitz vibrieren ließ. »Rock on, then, baby, rock on then.«
Dreizehn Stunden Fahrt zwischen Georgia und Texas. Fast tausendfünfhundert Kilometer. Sie fuhren bis nach Mitternacht, hielten in Jackson, Mississippi, zum Übernachten an und fanden ein Zimmer mit zwei Betten in einem abgewirtschafteten Motel mitten im Nichts. Am nächsten Morgen wechselte Heinrich den marineblauen Anzug gegen Kleidung, die eindeutig mehr seinem Stil entsprach: schwarze Jeans, weißes Pionierhemd, schwarze Weste. Darüber trug er einen schwarzen Trenchcoat und einen schwarzen Gambler-Hut. Der Kragen des Hemds stand ein wenig offen, und wieder sah sie den Anhänger am Hals.
»Sie mögen schwarz, was?«, fragte Robin und setzte sich im Schneidersitz aufs Bett, während sie ein Omelett aus einem IHOP-Restaurant aß. Das war das Beste, was sie je in ihrem Leben gegessen hatte.
Der Mann band sich ein avocadogrünes Tuch um den Hals und stopfte es in den Hemdkragen. »Wenn es für Johnny Cash gut genug ist«, sagte er und begutachtete sich im mannsgroßen Spiegel, »ist es das auch für mich.«
»Sie sehen aus, als wären Sie hundert Jahre zu spät geboren.«
»Du hast mich erwischt. So habe ich mich mein ganzes Leben gefühlt.«
Sie hatte so eine Ahnung, dass sie am falschen Ort war und den falschen Weg mit dem falschen Mann einschlug. Ihr bisheriges Leben hatte sie ausnahmslos in Blackfield verbracht, und jetzt beschlich sie ein mulmiges Gefühl, so als wache sie im Bus auf und stelle fest, dass sie ihre Haltestelle verpasst hatte.
Diese Sorgen teilte sie Heinrich mit, der daraufhin lachte. Inzwischen waren sie wieder unterwegs. In einem Kaufhaus, an dem sie vorbeikamen, suchte sich Robin ebenfalls schwarze Kleidung aus: T-Shirt, Ripped Jeans, Army-Jacke. »Das nennt man ›Vertrauensvorschuss‹, Robin Hood«, sagte er. »Du bewegst dich auf unbekanntem Terrain. Das macht Angst, da hast du recht. Ich habe es hinter mir. Aber du bist jetzt in guten Händen. Du bist zu Boden gegangen, Kleine, aber der alte Hammer zieht dich hoch und klopft dir den Staub ab.«
Die Landschaft wechselte langsam von grünem Wald zu sumpfigem Delta und zu grasbewachsener Prärie, und nach und nach umgab sie schließlich dürres Buschland, das am Ende in die offene Wüste von Texas führte. So hatten sie eine Menge Zeit zu reden, und Heinrich übernahm den größten Teil. Er nutzte die Gelegenheit und setzte seinen Geschichtsunterricht fort.
»Hexen hat es immer gegeben. Nach meinen Recherchen hieß die erste Hexe Yidhra. Sie war eine Priesterin der Ereschkigal, der mesopotamischen Göttin des Totenlandes Irkalla. Yidhra wurde Hexe, indem sie ihr Herz opferte und im Gegenzug ein wenig von Ereschkigals Macht erhielt.
Die Göttin ersetzte Yidhras Herz mit libbu-harrani, dem sumerischen Wort für ›Herz-Straße‹ nach Irkalla, oder eigentlich vielleicht eine Art Leitung – so ähnlich, wie eine Steckdose in einem Haus den Strom vom Elektrizitätswerk holt. Ihr Herz wurde gegen eine direkte Verbindung zum Jenseits getauscht. Aus dieser Verbindung erhielt Yidhra ihre Kräfte: Hellsehen, Zauberei, Geisterbeschwörung, mit den Toten sprechen, die Unterwerfung von Tieren. So was eben.
Mit der Zeit wurde Yidhra die biblische ›Hexe von Endor‹, eine kleine Berühmtheit im alten Mesopotamien, eine berüchtigte Zauberin, ein Orakel und eine Kultgestalt, die Jünger und Schüler anzog, die ihr Herz ebenfalls Ereschkigal darbrachten.
Als sie ihren Lebensabend in Endor verbrachte, hatte sie viele hundert Frauen überzeugt, ihr Herz der Göttin des Todes zu schenken.«
Gegen Mittag fuhr der Fairlane durch Killeen und an der Armeebasis Fort Hood vorbei, wo Heinrich zum Tanken anhielt und für Robin eine Vanilla Coke kaufen, dann ging es wieder weiter.
Auf der anderen Seite der Stadt ließ die Bebauung deutlich nach, und es sah aus wie in den alten Westernfilmen, die sie mit ihrem Dad gesehen hatte. Robin schaute zu, wie die Landschaft vorbeizog, und stellte sich vor, wie John Wayne auf seinem Pferd über den steinigen Sand galoppierte und mit einer Hand sein Mare’s-Leg-Repetiergewehr schwenkte. Sie fuhren auf einer zweispurigen Straße, die fast bis nach Mexiko zwischen hohen, rauen Bur-Eichen und Riesenlebensbäumen mäanderte. Von dort bogen sie auf eine steinige, unbefestigte Straße ab und kamen schließlich an einer besonders großen Eiche heraus und parkten vor einem Ort, der aussah wie ein mexikanisches Dorf. Oder zumindest hätte das zugetroffen, wären da nicht die Schilder und Graffitis in dieser seltsamen Schrift gewesen, die auf Fassaden und Mauern angebracht worden waren.
»Willkommen in Hammertown«, sagte Heinrich. »Das ist der Nachbau einer nahöstlichen Stadt. Die Schilder sind auf Arabisch. Es ist ein ›Häuserkampf‹-Parcours. Die Armee hat das Gelände für Ausbildungszwecke gebaut, als Desert Storm vor der Tür stand, dann aber ein neues Gelände im Fort eingerichtet und dieses der Polizei von Killeen überlassen. Schließlich haben sie das Gelände im Fort auch für Zivilisten geöffnet, und dieses hier wurde aufgegeben.«
»Hier leben Sie?«
»Aber sicher.«
»Und niemand kümmert das?«
»Bisher jedenfalls nicht.« Heinrich öffnete den Kofferraum, nahm Robins Sporttasche heraus und trug sie zum Eingangstor. »Komm, ich zeige dir, wo du schläfst.«
Ihre Unterkunft befand sich, wie sich herausstellte, oben in einem weitgehend leeren, vierstöckigen Betonziegelbau, der laut ihrem neuen Schutzengel für die Ausbildung von Feuerwehrleuten genutzt worden war. Sie bekam eine Pritsche, die durch einen Vorhang von einem großen, offenen Raum mit einem Orientteppich in der Mitte getrennt war. Es sah aus wie das Studioapartment eines kleinen Drogenschmugglers. Durch die riesigen Fenster schaute man hinaus auf die texanische Wüste, und an den Wänden hingen Plakate von Blaxploitation-Filmen und Kung-Fu-Streifen aus den 70ern. Eine Couchgarnitur sah aus, als habe sie die Bombardierung von Hiroshima überstanden, beim Couchtisch zog sich ein Riss diagonal durch die Glasplatte, und an den Wänden entlang standen Regale voller Kriegsromane und Westernabenteuer von Louis L’Amour. Die Fenster hatten Moskitonetze anstelle von Glas, und wenn der Wind hindurchwehte, erzeugte er ein eigenartiges Surren.
Auf einem abgewetzten Nachttisch stand ein Plattenspieler. Heinrich legte eine Schallplatte auf, und Earth Wind & Fire erklärten, was geschehen würde, wenn man sich bei Sternschnuppen etwas wünschte. »Fühl dich wie zu Hause, Robin Hood«, sagte er, blieb in der provisorischen Kochnische stehen und trank Wasser aus einem Krug, den er aus dem Kühlschrank geholt hatte. »Ich kaufe mal ein bisschen Vorräte und anderen Kram ein. Bin in Kürze wieder da.«
Damit trabte Heinrich die Treppe hinunter und verschwand in der Dunkelheit.
Einige Minuten später hörte sie aus der Distanz, wie der Fairlane angelassen wurde, und dann gab es nur noch sie und die Musik. Sie saß auf der Couch, versuchte, ihre Mitte zu finden, und machte eine Bestandsaufnahme der Situation, in die sie sich manövriert hatte.
Nach einer Weile waren der Song und damit die Platte zu Ende. Robin nahm sie vom Teller und legte eine andere auf. Nadelkratzen, Knacken, Knistern.
»I keep a close watch on this heart of mine«, sang Johnny Cash.
Lange stand Robin am Fenster, während der texanische Wind sie mit trockener, geruchloser Luft durch das schwarze Netz umwehte. Grillen sangen leise draußen in den Büschen.
Auf dem Boden um Heinrichs Bett – eine Schaummatratze auf Gitterboxen aus Stahl – standen mehrere Plastikkästen, und Robin ging hinüber und sah sich den Inhalt an. Eine war mit Armeeoveralls gefüllt, jedenfalls hielt sie die Kleidung dafür. In einer lagen Unterwäsche und Socken. Sie öffnete die nächste und entdeckte ein Gewehr in grauem Schaumstoff.
Groß. Schwarz. Wahnsinn. Das Ding sah aus, als würde es in die Hände eines Revolutionärs oder eines Aufständischen gehören. Ihr Herz klopfte. Die Situation wurde ihr mit einem Schlag klar – sie war bei einem Mann in den Wagen gestiegen, den sie noch nie gesehen hatte, und zwar aufgrund dünnster und fantastischster Versprechen, sie war mit ihm über tausend Kilometer mitten in die Wüste gefahren, zu dieser ausgebrannten Festung aus Pappmaschee, Sperrholz und Betonbausteinen, wo sie nun im Staub kniete und sich das unverkennbare Werkzeug für einen unglaublich gewalttätigen Tod anschaute.
Auf dem Nachttisch lag neben einem schmutzigen Aschenbecher ein emailliertes Abzeichen: grün und gold. Es zeigte das Gesicht eines Hundes oder eines Wolfes im Profil auf einem goldenen Kreis, auf dem ein langer Satz in einer unlesbaren Sprache geschrieben stand. Es sah paramilitärisch aus oder stammte vielleicht von einem dieser Geheimbünde wie den Freimaurern oder den Illuminaten. Um den Hals des Hundes hing ein Bogen – ein Bogen, mit dem man Pfeile verschießen konnte.
O-ha. Ihre Hände wurden kalt. Sie wusste wirklich nichts über diesen Mann.
»These things shall pass so don’t you worry«, sang Cash. »The darkest time is just one hour before dawn.«
Sie schloss die Kiste, in der die Waffe lag, und öffnete die nächste.
Diese enthielt zusammengeschnürte Decken und einen elektrischen Haarschneider mit einer kleinen Sammlung verschieden langer Aufsätze. Sie nahm ihn heraus und suchte nach einer Steckdose. Neben dem Spülbecken fand sie eine. Sie stöpselte den Haarschneider ein und stellte ihn an. In der Einsamkeit des leeren Gebäudes brummte er verstörend, laut, gehässig elektrisch.
Robin setzte die Klinge an die Schläfe und rasierte ihr strähniges Haar, das ins Becken fiel.
Sie war fast fertig, als Heinrich kurz nach Mittag zurückkehrte. Er hatte die Arme voller Einkaufstüten. Die stellte er auf dem Küchentresen ab und schaute zu, wie sie sich den Kopf schor, während er die Vorräte einräumte.
Bald darauf war nur noch ein Streifen Haar auf ihrem Schädel übrig, ein leicht gekrümmter Iro mit welligen Locken. Mit vielsagendem Blick nahm der Mann ihr den Schneider ab und besserte die Kanten des Iros aus, dann spülte er das abgeschnittene Haar durch den Abfallzerkleinerer.
»Sieht gut aus. Willkommen im neuen Du.« Er nahm einen Becher Ben & Jerry’s aus einer Plastiktüte und schob ihn wie ein Barmann im Saloon über den Tresen. »Hoffentlich magst du Eiscreme.« Er holte einen zweiten Becher hervor, riss den Deckel ab und stach einen Löffel hinein. »Ich habe genau zwei Laster: Eiscreme und keine schlechte Kleidung. Und meinen Wagen. Drei Laster. Ich habe dir auch eine Packung mitgebracht, denn wenn du mein Eis anrührst, bringe ich dich um und werfe deine Leiche den Kojoten zum Fraß vor.«
Sie sahen sich einen endlosen Moment in die Augen, und Robin hätte am liebsten geschrien und sich durch das Fenster und das Moskitonetz geworfen. Heinrichs Gesicht war so unglaublich eindringlich, bis hin zum Grausigen – seelenlos, kalt, gefühllos wie Stahl und voll verschleiertem Bösen. In diesem Moment dachte sie wieder über die Möglichkeit nach, ob sie nicht einen schweren Irrtum begangen hatte, als sie hierhergekommen war.
Dann löste der Mann seinen Blick von ihrem und lachte in seinen Eiscremebecher, tief, kehlig aus dem Bauch, und damit übermittelte er mehr Wärme und Humor, als sie je bei einem erwachsenen Mann erlebt hatte.
»Du solltest deinen Blick sehen«, sagte er, immer noch lachend.
Bei diesen Worten begann sie zu grinsen wie ein Idiot, und als sie in der ersten Schublade, die sie aufzog, Besteck fand, als wohne sie seit Jahren hier, und dann einen Löffel Chubby Hubby herausbohrte und in den Mund steckte, entschied sie, dass diese Sache, als Guerilla-Hexenjägerin anzuheuern, durchaus Potential hatte, ein ziemlich cooler Job zu werden.
»Und damit begann die Ausbildung bei Heinrich«, sagte Robin. Als sie mit der Geschichte fertig war, hatten sie sich längst in die Küche verzogen. Sie saß auf einem Hocker an der Kochinsel, während Kenway neben dem Herd Burger auf einem Elektrogrill briet. Die Kamera stand auf einem Stativ mit krummen Beinen am Ende des Tresens.
»War es so wie im Film?«, fragte er und drehte einen Burger um. Ksssss. »Weißt du, diese Montagen mit Musik, wo du einen Boxsack verprügelst und mit Holzstangen gegen Dummys kämpfst?«
»Das ist Buffy die Vampirjägerin.« Robin sah ihn finster an. Sie bemerkte eine Glasvase mit Kaffeebohnen, zog sie herüber und roch daran. »Und … ich denke, ja, es gab schon einiges, das so war. Vor allem habe ich viel über esoterischen Texten gebrütet. Büchern aus der Bibliothek, Mikrofiche, Fotokopien aus Zeitschriften, gestohlenen Dokumenten …«
»Gestohlen?«
»Heinrich ließ sich von solchen Kleinigkeiten wie Gesetzen nicht daran hindern, das zu tun, was er tun musste. Das meiste hat er der Sekte gestohlen, der er angehört hatte, ehe er geflohen ist. Viel hat er mir darüber nicht erzählt, nur dass es ein ziemliches Stück Arbeit war.«
»Verstehe.« Er drehte den nächsten Burger um. Ksssss. »Ich schätze, für dich gilt das nicht, da du dich ja nicht vor dem Gesetz versteckst.« Er packte eine Scheibe Käse aus und meinte: »Du versteckst dich doch nicht vor dem Gesetz, oder? In einem Lieferwagen zu leben würde dann allerdings durchaus Sinn ergeben.«
»Heinrich hatte bereits alles zusammen, als ich ihn kennengelernt habe«, sagte Robin. »Natürlich gibt es da draußen ungefähr zwei Dutzend unaufgeklärte Fälle von Brandstiftung.« Und Überfällen, Vandalismus, Totschlag und Gott weiß was noch. Weitere Infos bei Bedarf. Sie legte den Zeigefinger an die Lippen. »Aber, pst!«
Kenway seufzte nachdenklich und legte Käse auf das brutzelnde Fleisch. »Du bist mir echt eine … Ich habe keine Ahnung, was ich mit dir anfangen soll.«
Küss mich doch einfach, dachte sie. »Danke, dass ich mal einen Abend woanders abhängen kann – nicht in meinem Wagen oder der Pizzeria. Und fürs Internet.«
Er grinste sie an. »Und für die Burger.«
»Und die Burger. Ich liebe Pizza, aber ich glaube, in letzter Zeit gab es die zu oft.«
»Und wie hast du mit dieser YouTube-Geschichte angefangen?«, erkundigte sich Kenway, legte Brötchen auf Teller und hob die Burger darauf.
»Weißt du, wie man im Football die Aufzeichnungen der Spiele aufbewahrt und sie später noch einmal durchgeht? Heinrich hat das gemacht, damit wir uns alles ansehen und unsere Technik verfeinern konnten. Ich habe dann vorgeschlagen, die Videos ins Internet zu stellen und Geld damit zu verdienen.« Ihr Magen knurrte wegen des Grilldufts. »Zuerst war er absolut dagegen, doch nachdem ich ihm gezeigt habe, wie sehr die Filme anderen YouTube-Videos ähnelten und wie viel Geld es uns einbringen würde, wurde er langsam mit der Idee warm. Solange ich sicherstellte, dass er in den Videos nicht auftauchte, oder wenn, dass sein Gesicht unkenntlich gemacht wurde.«
Aus Robins Jeans ertönte ein Ton und erschreckte sie beide. Sie grub in der Tasche und holte ihr Telefon heraus. Es war der Wecker, der auf sechs Uhr gestellt war. Sie machte ihn aus, rutschte vom Hocker und öffnete einen Schrank. »Hast du irgendwo Gläser?«
Kenway machte eine der anderen Türen auf. Robin nahm sich ein Glas und füllte es am Wasserhahn, ging dann zu ihrer Laptoptasche auf dem Couchtisch und nahm ein Tablettenfläschchen heraus. Sie nahm eine Pille und schluckte sie mit Wasser.
Neugierig schaute er dabei zu, sagte jedoch nichts.
Robin verstaute das Fläschchen wieder, kam zurück zur Kücheninsel, setzte sich und trank den Rest Wasser. Kenway beobachtete sie.
»Die Pillen sind … äh – die Psycho-Heinis sagen, ich habe Wahnvorstellungen oder so was. Ich habe Halluzinationen. Albträume. Posttraumatische Belastungsstörung. Als Kind hatte ich Nachtangst, und ich schätze, was ich erlebt habe, hat es nicht besser gemacht.« Sie tippte auf einen Farbfleck auf der Marmorplatte. »Die Medikamente helfen. Ich habe auch Zoloft genommen, doch das habe ich abgesetzt, als ich das, was sie mir in der Psycho-Klinik mitgegeben haben, verbraucht hatte. Ich mag es nicht. Es macht einen Zombie aus mir.«
Und um ehrlich zu sein, bin ich gar nicht so sicher, ob ich wirklich Halluzinationen habe. Inzwischen war es einfach zur Gewohnheit geworden, die Medikamente zu nehmen … Doch nach dem Erlebnis im Waschraum bei Miguel’s Pizza war ihr Glauben an Neuroleptika erschüttert. Und als ihr Glaube an das erschüttert wurde, von dem sie felsenfest sicher gewesen war, dass es ihre psychische Stabilität aufrechterhielt, fühlte sie sich plötzlich verwundbar.
Kenway war die Situation wohl unbehaglich. Er zupfte an seinem Hemd, als würde es nicht richtig passen.
»Vermutlich schreckt dich das jetzt ab, hm?«, murmelte Robin und verschränkte die Arme. »So ist das meistens mit Kerlen. Verdammt, sogar mit Mädels. Ich habe … schon früher versucht, jemand zu daten, aber sobald ich das Pillenfläschchen rauskrame, sind sie auf und davon. Konfuzius sagt: Steck deinen Schwanz nicht in eine Irre. Das gilt wohl auch dann, wenn man gar keinen hat.«
Kenway schob die Lippen vor und sah sie an – sah sie richtig an, bohrend, konzentriert, wie eine Ameise unter dem Vergrößerungsglas – , dann legte er den Pfannenwender zur Seite, zog eins seiner Hosenbeine hoch und zeigte seine Beinprothese. Er schnallte sie ab, ein anstrengender Prozess mit Schnaufen und Zerren und Reißen von Klettverschlüssen, dann hatte er sie gelöst, und es blieb ein Stumpf, der in einen Verband gewickelt war.
So groß Kenway auch war, das falsche Bein wirkte einen Meter lang und hatte ein Fußgelenk und eine Silikonauflage. Natürlich saß ein Schuh dran, der zweite von seinen Doc Martens.
»Wenn du davor nicht wegläufst …« Er stellte die Prothese auf den Küchentresen vor sie. »… laufe ich auch nicht vor dir weg.«