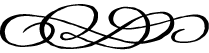
Lélinaz, Saint-Bois, Frankreich, April 1944
Marguérite wollte sich nicht damit abfinden, dass Antoine sie so einfach im Stich gelassen hatte. In den ersten Tagen nach ihrem letzten Treffen hatte sie gehofft, dass er seine Meinung noch einmal ändern würde. Jeden Tag war sie zu dem Steinkreuz geschlichen, um nachzusehen, ob sie dort eine Nachricht von ihm fand. Doch jedes Mal war sie enttäuscht worden. Dann hatte sie von Yves erfahren, dass Antoine nicht mehr im Dorf wohnte. Sein plötzliches Verschwinden konnte ihrer Meinung nach nur eines bedeuten: Er hatte sich gegen eine gemeinsame Zukunft mit ihr entschieden. Ihre Enttäuschung war größer, als sie zugeben wollte. Sie hatte sich eingebildet, auch allein zurechtkommen zu können. Doch nun musste sie feststellen, dass sie sich da gar nicht so sicher war. Auch das schöne Frühlingswetter dieses zweiten Apriltags konnte ihre trüben Gedanken nicht verscheuchen. Um ihnen zu entkommen, gesellte sie sich zu Léa in die Küche, um ihr beim Gemüseputzen zu helfen.
»Na, du redest ja heute wie ein Wasserfall«, bemerkte diese ironisch, nachdem sie eine ganze Weile schweigend ihre Arbeit verrichtet hatten. »Hat sich Antoine immer noch nicht gemeldet?« Marguérite spürte den besorgten Blick ihrer Freundin auf sich. Schon vor einiger Zeit hatte sie ihr von der Schwangerschaft erzählt und auch von ihrem Gespräch mit Antoine. Wie zu erwarten gewesen war, hatte Léa die Nachricht mit großer Sorge aufgenommen. Marguérite schüttelte den Kopf. »Dieser Mistkerl«, brummte die Freundin daraufhin. »Er hat dich gar nicht verdient!«
»Er wohnt nicht mehr im Dorf«, teilte sie ihr resigniert mit. »Das bedeutet ja wohl, dass es aus ist zwischen uns.« Um ihre Tränen zu verbergen, konzentrierte sie sich weiter aufs Gemüseputzen.
»Ich hab dich ja immer vor dem Kerl gewarnt«, begann Léa sofort, wie ein Rohrspatz zu schimpfen. »Was willst du von einem Kollaborateur auch anderes erwarten? Menschen, die zu feige sind, um für ihr Vaterland zu kämpfen, können keine Verantwortung übernehmen. Es war ein Fehler, dass du dich auf ihn eingelassen hast.«
»Antoine ist kein schlechter Kerl.« Trotz ihrer Enttäuschung musste Marguérite ihn verteidigen. »Er hat uns schon öfter geholfen. Léon hätten sie längst geschnappt, hätte er ihn nicht damals gewarnt!«
»Das bedeutet doch gar nichts«, widersprach Léa uneinsichtig. »Wusstest du eigentlich, dass sie sämtliche Milizionäre jetzt für die Razzien einsetzen?« Ihre Augen blitzten vor Empörung. »Bestimmt wurde auch Antoine dazu abkommandiert.« Marguérite war entsetzt über Léas Behauptung. Im Haus lagen bei allen die Nerven blank, seitdem sie von den Gräueltaten gehört hatten. So auch bei ihr. Das Schlimme war jedoch, dass sie es nicht wirklich ausschließen konnte. Solange Antoine bei der Miliz war, musste er gehorchen und deren Befehle ausführen. Die Vorstellung schnürte ihr die Luft ab. Léa ruderte sofort wieder zurück, als sie sah, wie sehr ihre Worte sie getroffen hatten. »Es tut mir leid! Ich wollte dich nicht verletzen!«, versicherte sie rasch. »Ich bin nur so wütend, dass es Menschen gibt, die zu so etwas fähig sind. Antoine gehört sicher nicht dazu.«
Léa streichelte hilflos Marguérites Arm, doch die Bemerkung stand im Raum und setzte ihr Gedankenkarussell wieder in Gang. Die heimtückische Aktion der Gestapo im Haus La Martellière in Voiron zeigte nur, in welcher Gefahr sie gerade lebten.
»Und wenn Antoine doch dabei war?«, fragte Marguérite verzagt.
Léa zuckte mit den Schultern und sah sie traurig an. »Mitgefangen, mitgehangen.« Als sie sah, wie niederdrückend ihre Antwort war, versuchte sie, die Freundin aufzumuntern. »Er wird schon nicht dabei gewesen sein.« Es gelang ihr nur halbherzig, deshalb nahm sie nun Marguérites Hände und drückte sie. »Du hast schon so vieles in deinem Leben geschafft. Das mit dem Kind bekommst du ohne Antoine bestimmt hin. Und ich bin ja auch noch da. Du kannst dich auf mich verlassen.«
»Aber alles um uns herum bricht zusammen …«
Marguérite wollte sich nicht trösten lassen. Sie entzog ihrer Freundin die Hände und krallte ihre Finger in den Stoff ihrer Schürze. Obwohl sie es versuchte, konnte sie ihrer Verzweiflung nicht Herr werden. Seit sie in anderen Umständen war, brachte sie jede Kleinigkeit aus der Fassung. Ihr Leben kam ihr im Augenblick so düster vor. Es war ihr unmöglich, Léas Zuversicht zu teilen. Alles lief darauf hinaus, dass die Gemeinschaft von Lélinaz schon sehr bald auseinanderfiel. Es gab nur noch schlechte Nachrichten. Anfang März war Unterpräfekt Wiltzer, ihr größter Unterstützer, ins Departement Vienne versetzt worden, dann waren Gesandte vom sozialen Hilfswerk für Emigranten in Lyon bei ihnen gewesen. Die Zlatins wollten ihnen die Gebäude der Kolonie abtreten. Daraufhin war Léa mit einem Passagierschein ausgestattet worden und ins Departement Hérault gereist, um nach einem neuen Unterschlupf für die Kinder und die Betreuer zu suchen. Erst wenige Tage zuvor war sie unverrichteter Dinge wieder zurückgekehrt.
Ein Rückschlag folgte auf den anderen. Eine ganze Weile ließ Marguérite sich von dieser Welle an Selbstmitleid mitreißen, dann ebbte sie ab, und sie konnte wieder klarer denken. Plötzlich machte sich ein anderes Gefühl in ihr breit. Sie empfand Trotz. Wut auf die verdammten Nazis und ihre französischen Helfer, die für die ganze Misere verantwortlich waren. Diese Menschen hatten ihr alles genommen, was ihr jemals im Leben etwas bedeutet hatte – ihre Eltern, ihr Zuhause, die Freunde und nun auch noch das bisschen Frieden, das sie in Izieu gefunden zu haben glaubte. Und Antoine gehörte zu diesen Menschen, die ihr das angetan hatten. Léa hatte recht. Es war das Beste, wenn sie ihn so schnell wie möglich vergaß. Unwillkürlich hielt Marguérite sich den Bauch. Das Kleine machte sich schon recht deutlich bemerkbar. Ihr Kind sollte es einmal besser haben. Sie würde alles tun, um es gesund auf die Welt zu bringen. Antoine brauchte sie nicht dazu.
Von draußen rief Marie-Louise nach ihnen und riss sie aus ihren trübseligen Gedanken. Die Nichte von Madame Perticoz war noch einmal zu ihnen hochgekommen, um Fotos von den Kindern zu machen. Sie war eine begeisterte Hobbyfotografin und hatte sich fest vorgenommen, jedem vor ihrer Abreise in eine ungewisse Zukunft eine Fotografie zu schenken. Es war ihre Art, die Kinder daran zu erinnern, dass es auch schöne Momente in dieser schlimmen Zeit der Flucht und des Versteckens gegeben hatte.
Léa putzte sich die Hände an der Schürze ab und wollte zu Marie-Louise hinausgehen, doch Marguérite hielt sie davon ab. »Lass mich das machen«, bat sie und verließ die Küche.
Marie-Louise empfing sie mit einem fröhlichen Winken. Um ihren Hals hing ihre Zeiss-Ikon-Kamera.
»Das Licht ist einfach herrlich heute«, schwärmte sie voller Tatendrang. »Am besten gehen wir nach hinten auf die Wiese. Dort blühen schon die ersten Schlüsselblumen.«
»Ich werde die Kinder zusammenrufen«, bot Marguérite sich an.
Sie war froh über die Ablenkung. Die meisten posierten gern vor der lebhaften jungen Frau, die es so liebte, Späße mit ihnen zu machen.
»Warte! Ich hab hier noch einen Brief für dich. Der Postbote hat ihn mir unten an der Bushaltestelle übergeben.«
Marie-Louise reichte ihr einen Umschlag. Marguérite erkannte Antoines Handschrift sofort und hätte ihn am liebsten zerrissen. Wahrscheinlich wollte er sich mit lächerlichen Entschuldigungen aus der Affäre ziehen. Darauf konnte sie im Augenblick gut verzichten. Achtlos steckte sie den Brief in ihre Rocktasche und versammelte die Kinder.
Während Marie-Louise mit den einzelnen Kindern die Fotos machte, kümmerte sie selbst sich um die anderen. Die Mädchen pflückten Schlüsselblumen, und die Jungen jagten übermütig über die Frühlingswiese. Sabine gesellte sich für einen Augenblick zu ihnen und nahm Marguérite beiseite.
»Wir brauchen für morgen Nacht noch ein paar zusätzliche Schlafstellen«, teilte sie ihr leise mit. »Miron und Yves werden nach Einbruch der Dunkelheit mit zwölf, vielleicht auch sechzehn Menschen hier eintreffen. Sie benötigen ein Dach über dem Kopf, bevor wir sie zu einer neuen Kontaktperson weiterschleusen.«
Marguérite erschrak. »Ist das nicht viel zu gefährlich? Die Gestapo und die Miliz schnüffeln doch überall herum.«
»Das müssen wir leider riskieren«, erwiderte Sabine unglücklich. »Wenn wir ihnen nicht helfen, haben sie keine Chance. Die Armen waren bereits in Drancy und haben Schreckliches durchgemacht. Auf dem Transport in deutsche Konzentrationslager ist ihr Zug entgleist. Es war eine Befreiungsaktion unserer Partisanen, die leider nicht ganz so verlief, wie sie geplant war. Eigentlich sollten die Gefangenen befreit werden, aber dann kam ihnen ein Trupp deutscher Soldaten in die Quere und hat alles niedergemäht, was ihnen vor die Gewehre gekommen ist. Nur ein paar wenige Menschen konnten entkommen. Sie sind völlig ausgezehrt und am Ende ihrer Kräfte. Wir sind ihre einzige Chance, verstehst du?« An Sabines Blick erkannte sie, wie ernst es ihr war. »Léa und du, ihr müsst dafür sorgen, dass weder die Kinder noch unsere Nachbarn Wind davon bekommen. Schafft ihr das?«
»Natürlich! Ich werde mich gleich um alles kümmern.« Marguérite gab sich zuversichtlich. Aber dann hatte sie doch noch etwas einzuwenden. »Und wie sollen wir die ganzen Menschen mit Lebensmitteln versorgen? Wir haben kaum genügend Vorräte für die Kinder.«
»Ich werde bei Madame Cojean anrufen«, versprach Sabine munter. »Bestimmt hat sie noch ein paar Lebensmittelkarten für uns übrig.«
Sie beide wussten, wie unwahrscheinlich dies war. Seitdem der hilfsbereite Unterpräfekt in ein anderes Departement versetzt worden war, konnte auch seine Sekretärin nicht mehr viel für sie tun. Sie würden sich mit dem behelfen müssen, was sie noch an Vorräten hatten. Marguérite machte sich sogleich an die Arbeit. In der ehemaligen Spinnerei gab es einen unbenutzten Lagerraum, der zwar staubig, aber immerhin einigermaßen trocken war. Ein weiterer Vorteil des Raumes war seine Nebentür. Durch sie konnte man die Flüchtlinge unbemerkt einschleusen. Sofort machte sie sich daran, den Raum zu fegen und für deren Ankunft vorzubereiten. Zum Glück gab es im Haus noch einige überschüssige Matratzen, die sie nun gut gebrauchen konnten. Da sie es allein nicht schaffte, holte sie sich Théo Reis zur Hilfe. Sie wusste, dass der junge Bursche verschwiegen war und keine Fragen stellen würde.
Während sie in die Vorbereitungen vertieft waren, sah sie, wie der Lieferwagen von Lucien Bourdon auf den Hof fuhr. Ihr fiel ein, dass Philippe Kartoffeln bei ihm bestellt hatte, die er nun brachte. Marguérite hätte es gern vermieden, ihm zu begegnen. Trotz ihrer Abfuhr stellte der Kerl ihr weiter nach. Dummerweise traf er genau in dem Moment ein, als sie mit Théo ein unhandliches Regal aus dem Lagerraum schaffte, das ihnen im Weg gewesen war. Es war voller Staub und Spinnweben und schwerer, als sie gedacht hätte. Lucien verstellte ihnen den Weg zum Schuppen.
»Frühjahrsputz?«, bemerkte er anzüglich, anstatt einfach mit anzupacken. Marguérite verzichtete auf eine bissige Bemerkung und ignorierte Lucien. Sie dirigierte Théo an ihm vorbei. Der Junge sah leider nichts, da er rückwärtslief. Plötzlich stolperte er über einen Stein und verlor das Gleichgewicht. Ehe er sichs versah, landete er auf dem Boden. Lucien brach sofort in schadenfreudiges Gelächter aus. »Zu blöd zum Tragen, was?« Théo rappelte sich auf und warf dem Bauern einen ärgerlichen Blick zu. Bevor er wieder anpacken konnte, stieß Lucien ihn beiseite und gab auch Marguérite zu verstehen, dass sie loslassen sollte. »Das ist was für einen richtigen Kerl wie mich«, meinte er großspurig. »Wo soll der Krempel hin?«
»In den Schuppen.«
Marguérite deutete in die Richtung und überließ ihm das Feld. Lucien schulterte das Gestell mühelos und schaffte es an den vorgesehenen Platz.
»Noch mehr zu schleppen?«, fragte er, kaum dass er wieder zurück war. Er schien seinen guten Tag zu haben. Marguérite beschloss, die Gelegenheit zu nutzen, ihn auch das restliche Gerümpel aus dem Raum schaffen zu lassen. Es gab noch so viel zu tun, dass ihr jede Hilfe recht sein konnte. Lucien packte tatkräftig mit an und half sogar noch, die Matratzen aus den oberen Räumen runterzuschaffen. »Wollt ihr etwa noch mehr Kinder im Heim aufnehmen?«, erkundigte er sich.
»Die Matratzen sind uns im Haupthaus im Weg«, behauptete sie rasch. »Wir wollen für die kleineren Kinder oben ein Spielzimmer einrichten.« Eine bessere Ausrede fiel ihr auf die Schnelle nicht ein.
»Jetzt, wo es grad Frühling geworden ist?«
Lucien warf ihr einen merkwürdigen Blick zu, hakte aber zum Glück nicht weiter nach. Es wurde Zeit, ihn wieder loszuwerden, bevor er zu neugierig wurde.
»Das wär’s«, erwiderte sie, kaum dass die letzte Matratze in der Spinnerei gelandet war. »Vielen Dank für deine Hilfe.«
Sie wartete darauf, dass er sich endlich verabschiedete. Doch Lucien gab sich nicht zufrieden.
»Du bist mir noch was schuldig«, forderte er frech. »Wie wär’s mit einem kleinen Spaziergang? Vielleicht auch auf die Almwiesen?«
Seine Bemerkung trieb ihr die Schamesröte ins Gesicht. Seine Anspielung gefiel ihr ganz und gar nicht. Zum Glück war Théo wieder ins Haus gegangen.
»Ich bin dir gar nichts schuldig. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten«, wies sie ihn zurecht. »Und nun entschuldige mich.«
Sie versuchte, an ihm vorbeizukommen, doch er hielt sie am Arm fest und sah sie lauernd an. »Nun komm schon«, raunte er ihr zu. Sein Atem stank nach Knoblauch und kaltem Zigarrenrauch. »Du hast dich lange genug geziert. Meinst du etwa, ich seh nicht, wenn eine Kuh schon mal bestiegen wurde? Ich kann dir das Bett mindestens genauso gut wärmen wie jeder andere Mann!«
»Was soll das?« Marguérite machte sich wütend von ihm los. Sie ärgerte sich maßlos, auch weil er sie auf ihre Schwangerschaft angesprochen hatte. Dabei war sie sicher gewesen, dass das weite Kleid, das Sabine ihr geliehen hatte, ihren Zustand noch immer gut verbarg. »Wenn du mich noch einmal anfasst, dann hol ich Verstärkung. Lass mich ein für alle Mal in Ruhe. Und wenn du es immer noch nicht kapiert hast, dann vielleicht so: Ich würde lieber ins Kloster gehen, als mich mit dir einzulassen!«
Luciens Lüsternheit verwandelte sich umgehend in Wut und kalte Berechnung. Seine kleinen Augen verengten sich zu Schlitzen, während sich seine unrasierte Mundpartie zu einer unschönen Fratze verzog.
»Hol dir doch Verstärkung«, provozierte er sie. »Dann werde ich den Leuten hier mal verraten, wer du in Wirklichkeit bist – nämlich ein Flittchen, jawohl!« Sein abschätziger Blick ließ Marguérite erschauern. »Spielst hier die Unschuldige und poussierst mit diesem Scheißkerl von der Miliz in den Bergen herum. Du brauchst es gar nicht zu leugnen. Ich hab euch nämlich gesehen!«, triumphierte er bösartig. Marguérite erbleichte. Also hatte er sie im Herbst doch in den Bergen entdeckt. »Wenn du willst, dass das unter uns bleibt, solltest du dich gut mit mir stellen.« Er packte sie erneut. »Nun? Was ist?«
In seiner Erregung war er so laut geworden, dass Sabine und Léa aus dem Haus kamen, um nachzusehen, was los war.
»Lassen Sie sofort Marguérite in Ruhe!«, fuhr Sabine dazwischen und baute sich vor dem Grobian auf, während Léa ihre Freundin rasch beiseitezog. »Und jetzt verschwinden Sie gefälligst von unserem Hof!«
Bourdon warf den drei Frauen nur einen verachtenden Blick zu. »Von Weibern wie euch lass ich mich doch nicht einschüchtern«, polterte er los. »Es wird Zeit, dass euch endlich mal jemand zeigt, wo es langgeht!«
»Wenn Sie sich da mal nicht täuschen«, entgegnete Sabine scheinbar unbeeindruckt. Sie hatte die Hände in die Hüften gestützt und trat einen Schritt auf ihn zu. »Noch einmal: Gehen Sie jetzt!«
Zum Glück erschien nun auch Philippe vor der Tür. Er hielt ein Küchenmesser in der Hand und trat entschieden neben die Frauen. Für einen Moment sah es so aus, als wollte Bourdon sich auf ihn stürzen, doch dann spuckte er nur vor ihnen aus.
»Ich scheiß auf euch«, schimpfte er hasserfüllt. »Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt, wenn ihr euch mit mir anlegt!« Damit drehte er sich auf dem Absatz um und verschwand in seinem Wagen.
Marguérite spürte erst jetzt, wie sehr sie das alles mitgenommen hatte. Sie zitterte am ganzen Leib, während sie dem aufwirbelnden Staub, den die Autoreifen von Bourdons Wagen hinterließen, hinterhersah.
»Ich glaube, nun haben wir es endgültig mit ihm verdorben«, bemerkte sie schuldbewusst. »Hoffentlich meint er seine Drohung nicht ernst.«
Sabine legte ihr beruhigend einen Arm um die Schultern. »Du hast das getan, was jede Frau tun sollte, wenn sie von einem Mann belästigt wird«, sagte sie entschieden. »Mach dir keine Sorgen. Bourdon kann uns nicht schaden. Er weiß von nichts. Außerdem ist er nur ein Choleriker. Er wird sich schon bald wieder beruhigen.«
Lucien schäumte vor Wut. Dieses Mal hatte Marguérite es zu weit mit ihm getrieben. Dieses verdammte Luder reizte ihn bis aufs Blut. Seine Wirkung auf das weibliche Geschlecht hatte bislang keine Frau infrage gestellt. Er war gewohnt, das zu bekommen, was er wollte. Und das würde auch sie über kurz oder lang einsehen müssen. Meinte wohl, sie wär was Besonderes, nur weil sie aus der Schweiz kam. Scheiß drauf! So einfach würde er sie nicht davonkommen lassen. Die kleine Hure würde schon noch erkennen, was sie an ihm hatte, schließlich hatte sie sich ja auch mit dem Mistkerl von Mardieu eingelassen.
Er raste die schmale Straße hinunter, dabei missachtete er den Gegenverkehr, indem er jede Kurve schnitt. Kurz vor Brégnier-Cordon kam ihm ein Automobil entgegen. Er bemerkte erst, dass er auf der falschen Spur war, als der Fahrer wild hupte. In letzter Sekunde gelang es den beiden, einander auszuweichen. Lucien geriet ins Schlingern. Er kam von der Fahrbahn ab und hörte ein hässliches Knacken an seiner Vorderachse. Dennoch gelang es ihm, das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen und zurück auf die Straße zu lenken. Mit klopfendem Herzen kam er zum Stehen.
Er stieg aus dem Wagen, um den Schaden zu begutachten. Die Vorderachse war etwas verschoben. Hoffentlich ist sie nicht ganz hin, dachte er. Er spürte, wie seine Wut erneut aufwallte. Verdammt! Schuld an diesem Dilemma war nur das verfluchte Weibsbild. Es hatte ihn dermaßen aus der Fassung gebracht, dass er unaufmerksam geworden war. Nervös suchte er nach einer Packung Zigaretten in seiner Jackentasche und zündete sich einen Glimmstängel an. Nach den ersten tiefen Zügen fühlte er sich etwas besser. Das Nikotin beruhigte seine Nerven.
Wieder ging ihm Marguérite durch den Kopf. Er hatte den Plan, sie zur Frau zu nehmen. Aber sie stellte sich immer noch dagegen, obwohl er alles besaß, was eine Frau begehrte. Ob vielleicht doch dieser Mardieu dahintersteckte? Als er vorhin behauptet hatte, dass er sie beim Poussieren erwischt hatte, hatte er sie nur provozieren wollen. Aber wieso war sie dann so rot geworden? Sein Verdacht schien ihm mit einem Mal sehr plausibel. Der Gedanke gefiel ihm ganz und gar nicht.
Lucien warf die halb gerauchte Zigarette zornig auf den Boden, um sich gleich darauf eine neue anzuzünden. Plötzlich wusste er nicht, was ihn mehr aufregte – die Tatsache, dass Marguérite und die anderen Weiber sich so vor ihm aufgebaut hatten, oder der Gedanke, dass Marguérite etwas mit Mardieu hatte. Der Kerl hatte ihn schon damals auf dem Scheunenfest lächerlich gemacht. Leider war er ihm nie wieder in die Quere gekommen, sonst hätte er sich an ihm gerächt. Vielleicht war es jetzt an der Zeit, ihn sich mal so richtig vorzunehmen. Dabei konnte er ihm auch klarmachen, dass er gefälligst die Finger von Marguérite zu lassen hatte. Der Gedanke gefiel ihm. Doch zuvor wollte er sein Mütchen an dem Bengel aus dem Waisenhaus kühlen. Wenn Mardieu schon nicht greifbar war, würde er eben den Bengel aus der Kolonie dafür büßen lassen. François war zwar nur ein mieser Ersatz, aber besser als gar nichts.
Etwas besänftigt, stieg er in seinen Wagen. Kurz vor Veyrin, einem kleinen Gehöft mit wenigen Häusern, wo er etwas zu erledigen hatte, hörte er ein ungutes Knirschen aus dem vorderen Teil seines Wagens. Durch das Ausweichmanöver hatte sein Gefährt wohl doch mehr abbekommen, als er gedacht hatte. Es gelang ihm gerade noch rechtzeitig, zum Stehen zu kommen, als die Achse brach. Laut fluchend verließ er den Wagen und sah sich den Schaden an. An eine Weiterfahrt war nicht zu denken.
Er winkte eine Bauersfrau zu sich, die gerade mit einer Schubkarre voller Mist daherkam, und fragte sie, ob sie jemanden kenne, der ihm weiterhelfen könne. Sie riet ihm, in das benachbarte Saint-Bois zu laufen. Dort gebe es einen Schmied, der hin und wieder auch Automobile repariere. Lucien blieb gar nichts anderes übrig, als sich zu Fuß dorthin auf den Weg zu machen.
Antoine war einer Kommandoeinheit der Gestapo in Belley unterstellt. Barbie hatte veranlasst, dass Laval ihn freistellte, sodass er direkt an ihn weisungsgebunden war. Seine neue Aufgabe gefiel ihm noch weniger als alles andere zuvor. Er und seine Leute waren, wie Barbie ihm schon gesagt hatte, dazu abgestellt, sämtliche Häuser und Gehöfte im weiten Umkreis zu kontrollieren. Jeder einzelne Bewohner hatte sich auszuweisen und eine Bescheinigung darüber zu erbringen, wer seine Vorfahren bis in die dritte Generation waren. Etwaige Auffälligkeiten hatte seine Truppe der Gestapo zu melden, die der Sache sofort auf den Grund ging.
Als Verstärkung hatte Barbie ihm ausgerechnet Francis André zur Seite gestellt, der seiner Aufgabe mit großem Eifer nachging. Dem hinterhältigen Schiefmaul war es bereits gelungen, in Voiron ein ganzes Haus voller Juden ausfindig zu machen. Damit brüstete er sich vor allen Kameraden, und er ließ keine Gelegenheit aus, Antoine zu provozieren. »Wird langsam Zeit, dass du auch mal was ablieferst«, stichelte er gern. »Bist dauernd unterwegs und hast immer noch niemanden erwischt!« Damit spielte er darauf an, dass er frühmorgens die Kaserne auf seinem Motorrad verließ und erst nach Einbruch der Dunkelheit wieder zurückkehrte. Die bissigen Bemerkungen scherten ihn wenig, doch er war sich bewusst, dass André ihm heimlich hinterherschnüffelte und nur darauf wartete, dass er ihm einen Fehler nachweisen konnte. Der Kerl verkraftete es einfach nicht, dass nun er, Antoine, Barbies engster Vertrauter war.
Antoine musste sich in Acht nehmen, denn er versah seine Arbeit mit Absicht schlecht. Nach all der Schuld, die er auf sich geladen hatte, wollte er nie wieder jemand Unschuldigen ans Messer liefern. Dazu hatte er sich eine Strategie ausgedacht, die es ihm ersparte, an einer Razzia oder einer Operation gegen Verfolgte teilzunehmen. Zwar konnte er die Gestapo nicht an ihren Aufgaben hindern, aber er konnte sie stillschweigend boykottieren, indem in den Gegenden, die er durchkämmte, kein Verdächtiger gefunden wurde. Natürlich musste er damit rechnen, dass man ihm über kurz oder lang auf die Schliche kam, doch noch genoss er den Schutz des Obersturmführers, und den wollte er sich zunutze machen. Jeder Hinweis, den er der Gestapo lieferte, lief ins Leere. Und vor allem achtete er darauf, dass sich die Aufmerksamkeit der Nazis nicht auf die Gegend von Izieu richtete.
Bislang war ihm das gut gelungen, doch es war nur eine Frage der Zeit, bis die Gestapo sich auch diese Gegend vornehmen würde. Er hoffte sehr, dass die Zlatins die Zeit nutzten, um die Kinder rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Genau das hatte er Marguérite in seinem Brief mitgeteilt. Seine Warnung sollte ihr zeigen, wie sehr er sich um sie sorgte. Aber vor allem hoffte er, dass sie ihm verzieh. Das Gespräch mit Barbie war ihm nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Es war ein freundschaftlicher Rat gewesen, den er durchaus ernst genommen hatte. Er hatte ihm die Augen geöffnet und gezeigt, wie wichtig ihm das Glück mit Marguérite war. Ihm war bewusst geworden, dass er alles verlieren würde, wenn er sie und das Kind im Stich ließ. Sie würden gemeinsam eine Lösung finden. Vielleicht war der Traum von Paris ja noch gar nicht ausgeträumt.
Leider hatte er noch nicht die Gelegenheit gehabt, persönlich mit ihr zu reden. Doch er hatte bereits Pläne gemacht. Der nächste Schritt war nun, Marguérite ordentliche Papiere zu beschaffen, die sie als Französin ausgaben. Und das musste so schnell wie möglich geschehen. Er hatte die Hoffnung, dass Miron oder Yves ihm dabei behilflich sein konnten. Ihre Kontakte zur Résistance waren vielfältig. Ob Marguérite bereit war, sich auf seinen Brief hin auf ein Treffen mit ihm einzulassen? Er hatte dafür gesorgt, dass sie ihn an diesem Tag erhielt. Doch würde sie überhaupt bereit sein, ihm zu verzeihen? Die Frage ließ ihm keine Ruhe.
Ursprünglich hatte er vorgehabt, ihr ein oder zwei Tage Bedenkzeit zu geben. Doch nun hatte er erfahren, dass die Nazis ihre Aktivitäten verstärkten. Barbie stand ebenfalls unter Erfolgsdruck. Auch wenn Marguérite nichts mehr von ihm wissen wollte, sie und die Kinder mussten möglichst schnell aus der Gegend verschwinden. Die Menschen in Izieu mussten erfahren, wie dringend das war. Um keine weitere Zeit zu verlieren, beschloss er, mit dem Motorrad nach Izieu zu fahren. Die Peugeot P53 war zum Glück ein zuverlässiges Fahrzeug, mit dem er sogar über unbefestigte Wege fahren konnte. Er würde Izieu auf abgelegenen Nebenstraßen erreichen. Kurz hinter dem Ortsausgang von Belley bog er Richtung Südwesten auf eine kleinere Straße ab und näherte sich kurz darauf zwei Fahrzeugen der Miliz, die von einem bewaffneten Militärtransporter begleitet wurden. Sie zwangen ihn zu einem kurzen Stopp.
Zu seiner Überraschung saß das Schiefmaul auf dem Fahrersitz des Führungsfahrzeugs. »Auf wessen Befehl bist du hier?«, raunzte er ihn unfreundlich an. Er tat gerade so, als hätte er ihm etwas zu befehlen.
»Das geht dich gar nichts an«, konterte Antoine unerschrocken. Dem Rang nach waren sie beide gleichgestellt. Es wurde Zeit, dass er das diesem Widerling unmissverständlich klarmachte. »Was macht ihr hier mit diesem Aufgebot?«
»Laval hat heute Nacht einen Tipp bekommen, dass hier irgendwo eine Gruppe Flüchtlinge unterwegs ist. Sie wurden am Lac du Bourget gesehen und müssen in der Gegend untergetaucht sein«, antwortete André widerwillig.
»Und wieso weiß ich nichts davon?« Antoine musterte abfällig den Konvoi. »Die Gestapo steht über den Milizen. Es ist deine Pflicht, mich über solch einen Einsatz zu informieren. Barbie wird nicht sehr erbaut sein, wenn er davon Wind bekommt!«
»Capitaine Laval hat grünes Licht gegeben, das genügt«, grunzte André unwillig. »Und was zählt, sind Erfolge und nicht irgendwelche Kompetenzstreitigkeiten«, fügte er angriffslustig hinzu. »Und du? Machst du wieder eine Spazierfahrt auf deinem Motorrad?«
»Ich werde euch unterstützen«, schlug Antoine geistesgegenwärtig vor. »Mit meinem Motorrad erwecke ich weniger Aufsehen als ihr in eurem Konvoi. Ich suche die Nebenwege in den Wäldern ab. Dort werden sie sich tagsüber am ehesten verstecken. Hab ich recht?« Er erwiderte Andrés herausfordernden Blick mit einem verbindlichen Lächeln. »Auf diese Weise ergänzen wir uns. Oder hast du etwas dagegen?« André kratzte sich am Hals und warf ihm einen finsteren Blick zu. Antoine war es tatsächlich gelungen, ihn zu verunsichern. »Ich werde euch Meldung machen, sobald ich etwas bemerke«, fügte er jovial hinzu und nickte André und seinem Beifahrer zum Abschied zu. Dann machte er sich wieder auf den Weg.
Um keinen Verdacht zu erwecken, bog er gleich in ihrer Nähe auf einen Waldweg ab, als hätte er wirklich vor, sich auf die Suche zu machen. In Wirklichkeit nahm er damit sogar eine Abkürzung nach Izieu, die über Saint-Bois führte. Der Konvoi der Miliz fuhr auf der Landstraße in dieselbe Richtung, würde aber länger brauchen. Der Waldweg war ziemlich holprig und nur schlecht zu befahren. Die Regenfälle der letzten Tage hatten den Boden matschig werden lassen, sodass er nur langsam vorankam. Noch streckten die Laubbäume ihre kahlen Äste in den Himmel, doch am Boden blühten bereits erste Märzenbecher und Veilchen. Antoine hatte das Waldstück bereits zur Hälfte durchquert, als ihm ein Gegenstand auffiel, der sich in einem Gebüsch verfangen hatte. Er hielt an und besah ihn sich genauer. Es war ein Kinderschal. Erst dann fielen ihm die Fußspuren ringsum auf, die noch recht frisch zu sein schienen. Ob diese von den Flüchtlingen stammten, die das Schiefmaul erwähnt hatte? Dummerweise führten sie ausgerechnet in Richtung Saint-Bois, wo André mit Sicherheit die ersten Hausdurchsuchungen veranlassen würde. Er hoffte nur, dass der Anführer klug genug war, seine Leute im Wald versteckt zu halten. Falls nicht, konnte er sie vielleicht noch warnen.
Er verfolgte die Spuren, bis sie sich abseits des Weges verloren. Er sah sich suchend um und kam zu der Überzeugung, dass die Gruppe eine Abkürzung über einen kurzen Felsanstieg genommen haben musste. Mit seinem Motorrad konnte er ihnen dorthin nicht folgen, doch das war auch nicht nötig. Glücklicherweise kannte er sich mittlerweile in der Gegend gut genug aus. Der Waldweg führte um den Felshügel herum. Mit etwas Glück stieß er auf der anderen Seite wieder auf Hinweise.
Er umrundete den Felsen und hielt nach Menschen Ausschau. Auf der Rückseite des Hügels endete der Wald abrupt. Ihm schloss sich ein abfallendes Wiesengelände an, das zu dem angrenzenden Dorf führte. Als Antoine die Stelle erreichte, sah er die zerlumpten Gestalten, die sich über die Wiese in Richtung des kleinen Dorfes schleppten, direkt auf Schiefmaul und seine Bagage zu, die jeden Augenblick dort eintreffen konnten. Der Anblick der ausgemergelten Gestalten, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnten, war für Antoine kaum zu ertragen. Viele stützten sich gegenseitig, andere wankten mehr oder weniger apathisch weiter. Nur ihr Anführer schien noch bei Kräften zu sein. Er eilte unentwegt von einem zum anderen, um die Menschen zum Weitergehen zu ermutigen.
Er war es auch, der schließlich Antoine bemerkte, der ihnen über den Wiesenabhang mit ausgestelltem Motor folgte. Der Mann rief seinen Leuten etwas zu, worauf diese wie angewurzelt stehen blieben und ihm angstvoll entgegensahen. Im nächsten Augenblick erkannte Antoine Miron und dieser ihn. Der Leiter des Kinderheims versuchte erst gar nicht, ihm eine Geschichte aufzutischen.
»Die Leute hier brauchen dringend Hilfe«, erklärte er nur, als Antoine vor ihm zum Stehen kam. »Sie haben die Hölle hinter sich. Wir …«
»Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit«, unterbrach ihn Antoine. »Ihr seid in großer Gefahr. Schon in Kürze wird hier ein Konvoi von der Miliz ankommen. Ihr müsst sofort wieder im Wald verschwinden.« Miron warf ihm einen misstrauischen Blick zu. Anscheinend war er unsicher.
»Der Pfarrer erwartet uns in der Kirche. Bis dorthin schaffen wir es doch noch«, erwiderte er schließlich. »Die Menschen brauchen dringend was zu trinken!«
Antoine wurde ungeduldig. »Habt ihr nicht verstanden? Die Miliz wird jedes einzelne Haus durchsuchen. Ihr müsst sofort zurück in den Wald! Sorg dafür, dass sich deine Leute zwischen den Felsen verstecken. Ich gebe euch Bescheid, sobald die Luft rein ist.« In der Ferne war plötzlich das Geräusch sich nähernder Fahrzeuge zu hören. Endlich verstand Miron und gab der Gruppe den Befehl, wieder im Wald zu verschwinden. »Ich lenke sie ab«, versprach Antoine noch und warf den Motor erneut an.
Als er kurz vor dem Dorf noch einen Blick über die Schulter warf, war niemand mehr zu sehen. Auf dem Dorfplatz erwartete er den Konvoi und informierte Francis André, dass er in dem Waldstück nichts Verdächtiges entdeckt hatte.
»Wir untersuchen alle Häuser«, gab der Caporal seinen Leuten den Befehl. »Lasst keinen Winkel außer Acht. Jeder, der sich verdächtig benimmt, wird abgeführt.«
Antoine beteiligte sich nicht an der Razzia. Er wartete an sein Motorrad gelehnt ab, bis die Soldaten alle Häuser durchsucht hatten. Die Bewohner wehrten sich nicht gegen die schwer bewaffneten Männer, aber er sah an ihren grimmigen Gesichtern, wie schwer es ihnen fiel, diese Willkür zu ertragen. Nach einer knappen Stunde hatten sie alles durchforstet. Wie erwartet waren sie auf keinerlei Spuren gestoßen. André fluchte, weil er sich einen schnelleren Erfolg versprochen hatte.
»Wir durchsuchen jetzt die Dörfer und Weiler bis runter zur Rhône«, teilte er Antoine mit.
Dieser versprach ihm, parallel dazu die Wälder abzusuchen. »Falls wir nichts finden, treffen wir uns heute Abend wieder in der Kaserne«, verabredeten sie. Antoine wartete, bis André mit seinen Leuten abgerückt war. Erst als das Geräusch der Automobile nicht mehr zu hören war, machte er sich auf den Weg zurück in den Wald.
Der Schmied von Saint-Bois hatte den Lieferwagen von Lucien mit seinem Ackergaul in seine Schmiede geschleppt, neben der sein Bruder eine kleine Autowerkstatt betrieb. Der Mechaniker hatte den Schaden begutachtet und Lucien insoweit beruhigt, als er die Vorderradachse sofort austauschen konnte, da er ein passendes Ersatzteil vorrätig hatte. Um die Zeit der Reparatur zu überbrücken, beschloss Lucien, in die Bar zu gehen, die jedoch erst mittags öffnete. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich so lange anderweitig zu beschäftigen. Hinter der Kirche fand er eine Bank, auf die er sich setzte. Missmutig wartete er. Irgendwann döste er ein.
Das Geräusch sich nähernder Militärfahrzeuge, die auf dem Dorfplatz anhielten, weckte ihn. Neugierig sah er nach, wer den Lärm verursachte. Als er die Miliz erkannte, beschloss er, lieber unsichtbar zu bleiben. Von seinem Platz hinter der Mauer erkannte er jedoch, dass die Soldaten ausstiegen und in die Häuser ausschwärmten. Wie jeder hier in der Gegend wusste auch Lucien, dass sie auf der Suche nach Juden waren. Man schaute besser, dass man ihnen aus dem Weg ging. Er setzte sich also wieder auf seine Bank hinter der Kirche und wartete ab, bis der Spuk vorüber war. Offenbar hatten sie nichts gefunden, denn nach einer guten Stunde bestiegen die Soldaten wieder ihre Automobile und fuhren davon.
Lucien wartete eine Weile und beschloss dann, es noch einmal mit der Bar zu versuchen. Der Dorfplatz war gähnend leer, und auch sonst war niemand unterwegs. Doch dann bemerkte er etwas. Hinter einer Häuserwand kam plötzlich eine Gruppe Menschen hervor, die völlig zerlumpt aussahen. Angetrieben von einem Mann, den er nur von hinten sehen konnte, rannten sie direkt auf die Kirche zu. Fast lautlos schlüpften sie durch den geöffneten Seiteneingang.
Lucien wusste sofort, dass es diese Flüchtlinge waren, nach denen die Miliz gerade gesucht hatte. Er grinste schadenfroh. Geschah Mardieu und seinen Leuten gerade recht, dass sie sie nicht erwischt hatten. Er stellte sich vor, dass sein Kontrahent unter den Milizen gewesen war und hoffte, dass er deswegen Ärger bekam. In diesem Augenblick drehte sich der Mann, der mit dem Rücken zu ihm gestanden hatte, um und ging auf einen uniformierten Milizangehörigen zu. Das war merkwürdig und erweckte seine Neugier. Beim genaueren Hinschauen sah er, dass der Zivilist Miron Zlatin vom Kinderheim war. Als sich auch der Milizionär in seine Richtung umwandte, erkannte er Antoine Mardieu. Beim Anblick seines verhassten Widersachers kochte neue Wut in ihm auf. Am liebsten hätte er ihn sich sofort zur Brust genommen. Doch dann setzte zum Glück sein Verstand wieder ein. Was zum Teufel hatte der Kerl mit diesen Flüchtlingen zu schaffen, die doch ganz offensichtlich von der Miliz gesucht wurden? Er dachte nach und hatte plötzlich eine viel bessere Idee, wie er den Mistkerl ein für alle Mal loswerden konnte.
Nachdem André und seine Leute verschwunden waren, half Antoine Miron, die Flüchtlinge sicher in die Kirche zu bringen. Miron war ihm überaus dankbar.
»Ohne dich hätte uns die Miliz geschnappt«, sagte er, als sie sich alle sicher in der Krypta befanden. »Hoffentlich ist dir klar, was du da getan hast! Wenn das deine Leute erfahren, werden sie dich dafür einen Kopf kürzer machen.« Er klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. Antoine freute sich über das Lob, umso mehr, als Miron ihm nun endlich zu vertrauen schien. »Ich habe dich falsch eingeschätzt und dir bis zuletzt misstraut«, gab er zu. »Das tut mir leid, aber du weißt ja selbst, wie vorsichtig man in Zeiten wie diesen sein muss.«
Antoine erwiderte nichts, weil ihm plötzlich bewusst wurde, dass er Mirons Anerkennung nicht verdient hatte. Er war kein guter Mensch, nur weil er diesen armen Menschen half. Seine vorherigen Verfehlungen konnte er nicht mit dem wettmachen, was er jetzt getan hatte.
»Wohin willst du die Leute bringen?«, fragte er, um vom Thema abzulenken.
»Sobald sie ein wenig zu Kräften gekommen sind, gehen wir nach Lélinaz und verstecken sie in der ehemaligen Spinnerei. Morgen Abend treffen wir einen Kontaktmann, der sie in einem Lieferwagen zur Schweizer Grenze bringen wird.«
Antoine erkundigte sich, auf welchem Weg sie zum Weiler gelangen wollten. Miron erklärte es ihm.
»Ihr könntet meinen Leuten auf dem Rückweg in die Quere kommen«, befürchtete Antoine. »Es ist sicherer, wenn ihr euch über Izieu vom Berg her dem Weiler nähert. Ich kann euch führen.«
»Werden dich deine Leute denn nicht vermissen?«, erkundigte sich Miron sofort wieder misstrauisch.
Antoine lachte freudlos. »Das werde ich in Kauf nehmen. Die Gefahr ist im Augenblick nicht allzu groß, weil meine Kameraden daran gewöhnt sind, dass ich meine eigenen Wege gehe.« Er schluckte, bevor er verriet, was seine eigentliche Aufgabe war. »Im Augenblick arbeite ich direkt für die Gestapo. Man hat mir weitreichende Befugnisse übertragen. Meine Kameraden müssen meine Handlungen respektieren.«
»Du gehörst jetzt zur Gestapo und verrätst dann deine Leute?« Miron wich zurück und sah ihn befremdet an.
Antoine zuckte hilflos mit den Schultern. »Glaub mir, den Posten hab ich mir nicht freiwillig ausgesucht. Aber nun verschafft er uns einen Vorteil, und den wollen wir nutzen!« Er schluckte. »Ich verabscheue meine Aufgabe und möchte gern etwas wiedergutmachen.« Mehr wollte er Miron nicht anvertrauen.
»Ist das nicht paradox?« Miron schien ihm kein Wort zu glauben. »Wieso bist du dann bei der Miliz?«
»Weil sie mich in der Hand haben«, gestand Antoine zerknirscht. »Meine Brüder sind in deutschen Arbeitslagern als Zwangsarbeiter. Man versprach mir, dass sie freikommen, wenn ich für die Miliz arbeite. Ich fand nichts Schlimmes daran, bis mir Marguérite die Augen geöffnet hat.«
»Marguérite?« Er sah, wie sich in Mirons Gesichtszügen erst Erstaunen, aber auch Unmut spiegelten. »Was hat sie damit zu schaffen?«
»Wir haben uns ineinander verliebt«, antwortete er schlicht.
»Was zum Teufel fällt dir ein?« Miron war nun sichtlich aufgebracht. »Ihr zwei passt nicht zusammen. Lass gefälligst die Finger von ihr!«
»Das kann nur sie selbst entscheiden«, erwiderte Antoine ungerührt. »Ich weiß längst, dass sie Jüdin ist. Sie hat mir alles erzählt.«
Miron wollte noch etwas erwidern, doch dann setzte er ein resignierendes Grinsen auf. »Du hast recht, das alles geht mich gar nichts an. Nehme mal an, dass du dann auch der Vater ihres Kindes bist? Sie wollte es uns nicht verraten.« Antoine zuckte mit den Schultern und nickte. Miron reagierte nicht weiter darauf. »Schauen wir, dass wir unsere Leute sicher nach Lélinaz bringen.« Damit war alles gesagt.
Antoine half ihm, sich um die Flüchtlinge zu kümmern. Die Menschen befanden sich in einem erbärmlichen Zustand. Die meisten von ihnen waren so ausgezehrt, dass sie nur noch aus Haut und Knochen bestanden. Ihre Wangen waren eingefallen, die Haut trocken und rissig, aber am schlimmsten fand er ihre hoffnungslosen Blicke. Er half dem Pfarrer beim Verteilen von Brot, Wasser und etwas Käse. Es war bei Weitem nicht genug für alle. Nur die Alten, Schwachen und Kinder bekamen etwas Nahrung. Manche waren jedoch selbst zum Essen schon zu entkräftet.
Nach zwei Stunden brachen sie auf. Schweigend setzte sich die Gruppe in Bewegung. Sie kamen nur langsam voran, da sie Umwege durch Wälder machen mussten, um von Weitem nicht gesehen zu werden. Lange nach Einbruch der Dunkelheit trafen sie endlich in Lélinaz ein. Die Kinder waren bereits in ihren Schlafsälen, sodass die Neuankömmlinge ungesehen in ihr Quartier gebracht werden konnten. Sabine und Marguérite nahmen sie in Empfang und sorgten dafür, dass jeder eine Schlafstelle und etwas zu essen bekam.
Als Marguérite ihn erblickte, sah Antoine ihr Erstaunen, bevor sie sich rasch wieder von ihm abwandte. Sein Herz begann zu klopfen, am liebsten hätte er gleich mit ihr gesprochen. Doch es gab zu viel zu tun. Er musste sich gedulden, bis jeder der heimlichen Gäste versorgt war. Ob sie seinen Brief schon gelesen hatte? Er sah ungeduldig auf die Uhr. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit, denn er musste noch runter ins Tal, um sein Motorrad zu holen, das er in einem Waldstück versteckt hatte. Seine Kameraden erwarteten ihn sicherlich längst. Schließlich passte er sie am Brunnen ab, wo sie für die Flüchtlinge einige Blecheimer mit Wasser füllte. Antoine trat unsicher auf sie zu und wusste nicht recht, wie er das Gespräch beginnen sollte.
»Du warst heute sehr mutig, wie ich hörte.« Marguérite nahm ihm den Anfang ab. Sie vermied allerdings, ihn anzusehen.
»Das war selbstverständlich«, gab er sich bescheiden. »Aber eigentlich war ich auf dem Weg zu dir.«
Sie hob den Blick. »Hattest du Angst, dass ich deinen Brief nicht lese?« Er erkannte einen Anflug von Spott in ihrem Gesicht, der jedoch gleich wieder verschwand. »Du musst dir um uns keine Sorgen machen. Wir alle wissen, wie ernst die Lage ist.« Sie erwähnte mit keinem Wort, dass er sie auch um Verzeihung gebeten hatte.
Antoine trat auf sie zu und berührte sacht ihren Arm. »Marguérite«, begann er hilflos. »Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Bitte verzeih mir!«
»Bist du nur hier, um mir das zu sagen?«
»Nein!« Er atmete tief durch. »Ich bin hier, um dich zu bitten, mir, nein uns, noch eine weitere Chance zu geben.« Sie sah ihn endlich an. Ihr Blick sagte mehr, als es jedes Wort vermocht hätte. Er konnte ihren Zweifel darin sehen, aber auch etwas, das ihn Hoffnung schöpfen ließ. Es ließ ihn mutiger werden. »Was sind schon Träume, wenn man niemanden hat, mit dem man sie teilen kann«, erklärte er mit belegter Stimme. »Ich habe begriffen, dass du und unser Kind … dass ihr das Allerwichtigste für mich seid.«
»Wir stehen deinem Lebenstraum doch nur im Weg!« Marguérites Stimme klang sofort wieder skeptisch und abweisend. »Selbst wenn ich dir glauben würde. Irgendwann würdest du mir genau das vorwerfen. Und das will ich nicht. Das ist mir erst jetzt klar geworden.«
»Wer sagt denn, dass unser Traum nicht mehr gelebt werden kann? Wir …«
»Antoine?« Miron trat aus der Dunkelheit zu ihnen und beendete abrupt ihre Unterhaltung. Antoine hätte ihn dafür am liebsten verdammt. Marguérite wandte sich sofort wieder ihren Eimern zu. »Komm noch auf einen Schnaps ins Haus«, forderte er ihn auf. »Philippe wird dich dann in Perticoz’ Automobil zu deinem Motorrad fahren. Er fährt damit über Ostern zu seinen Eltern und kann dich mitnehmen.«
»Noch einen Augenblick«, erwiderte Antoine. Dummerweise machte Miron keinerlei Anstalten, ohne ihn zu gehen. Dabei hatte er Marguérite noch so viel zu sagen. »Ich muss morgen nach Lyon, dort hab ich zwei Tage zu tun«, raunte er ihr zu. »Bitte komm in drei Tagen abends zu unserer Scheune.«
Er war nicht sicher, ob sie ihn verstanden hatte, doch dann fasste sie kurz nach seiner Hand und drückte sie. Da wusste er, dass sie da sein würde.