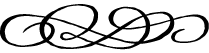
Izieu, Frankreich, Januar, Februar 1944
Das Jahr begann mit heftigen Schneestürmen, die die Kolonie von Izieu mehr oder weniger von der Außenwelt abschnitten. Léa und Marguérite nutzten die Zeit, um die zerschlissene Kleidung der Kinder zu flicken und liegen gebliebene Hausarbeiten zu erledigen, während Philippe mit den Älteren an einem neuen Kinofilm arbeitete. Mademoiselle Perrier war schon vor Silvester von ihrem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt und bestand auf ihrem morgendlichen Unterricht. Trotz der Aktivitäten im Haus war die Stimmung gedrückt. Die meisten Kinder vermissten gerade jetzt in der Weihnachtszeit ihre Eltern sehr. Viele weinten sich nachts in den Schlaf, was auch die Erwachsenen bedrückte, denn ständig kamen über das Büro der UGIF Hiobsbotschaften über Deportationen oder Hinrichtungen der Eltern oder Geschwister der ihnen anbefohlenen Kinder.
Hinzu kam die wachsende Bedrohung durch die Nazis. Gastons Verhaftung im Oktober war nur der Anfang einer ganzen Reihe von Razzien gewesen. Niemand fühlte sich mehr sicher, und das Misstrauen gegenüber der Bevölkerung wuchs, denn alle wussten, dass es Verräter unter ihnen gab. Am späten Vormittag, das neue Jahr hatte erst gerade begonnen, kam François viel zu leicht bekleidet nach Lélinaz. Er hatte den Weg von Bourdons Hof bis zur Kolonie nur mit einem Hemd und einer dünnen Jacke bekleidet hinter sich gebracht und war bis auf die Knochen durchgefroren. Der Fünfzehnjährige brachte ihnen einen Sack schrumpeliger Kartoffeln und einen Kohlkopf mit und legte ihn in der Küche ab, in der Marguérite und Léa ihre Näharbeiten verrichteten. Sabine und Miron brüteten über diversen Listen, die sich mit dem Unterhalt der Kolonie beschäftigten.
»Das ist für euch«, teilte ihnen François mit schlotternden Gliedern mit. »Bourdon hat mir endlich etwas Lohn gegeben.«
Er stellte sich an den Ofen und rieb sich seine steif gefrorenen Hände über dem Feuer. Marguérite stand auf, um dem Jungen eine Tasse Tee aufzubrühen.
»Wieso schickt der Kerl dich denn bei dem Wetter hinaus?«, wollte Sabine wissen. »Du hättest dir den Tod holen können!«
»Es war meine Entscheidung«, erwiderte François verlegen. »Monsieur Bourdon ging es heute Morgen nicht so gut … Da bin ich ihm lieber aus dem Weg gegangen.«
»Hat er dich wieder geschlagen?«, wollte Marguérite wissen.
Ihr Gewissen plagte sie, denn seit sie Lucien in seine Schranken gewiesen hatte, ließ er all seinen Unmut an dem Jungen aus. Hinzu kam, dass er noch mehr als schon gewöhnlich trank und dann zu Gewalttätigkeiten neigte. François antwortete nicht, doch sie wusste genau, dass er nur schwieg, weil er ihnen keine Sorgen bereiten wollte.
Léa ging hinaus und kam wenig später mit einem warmen Wollpullover zurück, den sie François reichte. »Der ist von Léon. Eigentlich wollte ich ihn auftrennen und etwas Neues daraus stricken, aber nun ist er bei dir wohl besser aufgehoben. Zieh deine nassen Klamotten aus und häng sie auf die Leine über dem Herd.«
Der Junge nahm den Pullover dankbar an und tat, was sie ihm aufgetragen hatte. Als er im Unterhemd vor ihnen stand, versuchte er, seinen von blauen Flecken übersäten Rücken sowie die roten Striemen zu verbergen, und zog eilig den Pulli über. Es war ihm sichtlich unangenehm, dass sie ihn dermaßen entsetzt anstarrten.
»Ich bin vom Scheunenboden gefallen«, murmelte er erklärend. »Das ist nicht weiter schlimm …«
»Du kannst jederzeit wieder zurückkommen, wenn dich Bourdon zu sehr drangsaliert«, sagte Miron besorgt. Er schien genau zu wissen, was in dem Jungen vorging. »Das ist keine Schande. Jeder weiß, was für ein Schinder der Mann ist.«
»Es ist alles gut so«, wehrte François eilig ab. »Ich komme mit Monsieur Bourdon schon irgendwie zurecht. Kann ich dann jetzt zu Jean-Paul und Octave? Ich würde gern wissen, wie es meinen Freunden geht!« Ganz offensichtlich wollte er weitere Nachfragen vermeiden.
»Geh nur.« Sabine nickte. Sie erkannte, wie unangenehm dem Jungen die Situation war. »Sie sind oben im Aufenthaltsraum. Die zwei werden sich freuen, dich zu sehen!«
François machte sich umgehend auf den Weg.
»Ich weiß wirklich nicht, warum der Junge es bei dem Grobian noch immer aushält«, entrüstete sich Léa. »Der quält ihn doch bis aufs Blut! Ich würde mir das jedenfalls nicht gefallen lassen.«
»François ist auf einem Bauernhof aufgewachsen«, erklärte Miron. »Er ist harte Arbeit gewohnt und offenbar auch einen harten Umgang. Ich werde mir Bourdon dennoch demnächst mal vorknöpfen. Er darf den Jungen nicht misshandeln.«
Kurze Zeit später klopfte es energisch an die Haustür. Die Anwesenden fuhren hoch und sahen sich alarmiert an. Allen ging ein ähnlicher Gedanke durch den Kopf. Wer sich bei diesem Wetter zu ihnen hinaufwagte, hatte keine guten Nachrichten. Sie sollten recht behalten. Es war Yves, der Bäcker, der sich auf den weiten Weg nach Lélinaz gemacht hatte, um ihnen von der Verhaftung Dr. Bendrihems zu erzählen.
»Die Gestapo kam mit zwei schwarzen Limousinen angefahren und stürmte sein Haus. Sie haben ihn vor den Augen seines kleinen Sohnes Gérard zusammengeschlagen und dann gleich abgeführt. Sie warfen ihm vor, Juden auf der Flucht unterstützt zu haben. Er ist nun in Montluc.«
Jeder von ihnen wusste, was das bedeutete. Das Gefängnis Montluc in Lyon stand für grausame Folter und Tod. Wer sich in den Händen des Obersturmführers Barbie befand, dessen Leben war nicht mehr viel wert.
»Aber wie sind sie auf ihn gekommen?«, fragte Sabine erschüttert. »Seine Tarnung war perfekt. Viele hielten ihn für einen Kollaborateur.«
Sie war leichenblass geworden, denn Albert Bendrihem war einer ihrer wichtigsten Verbündeten. Er hatte weitreichende Beziehungen zum jüdischen Kinderhilfswerk OSE und der UGIF und hatte schon Hunderten von Flüchtlingen das Leben gerettet.
»Er muss wie Gaston verraten worden sein«, knurrte Yves. »Wenn ich nur wüsste, wer der Kerl ist, dem würde ich persönlich den Hals umdrehen.«
»Vielleicht sind ihm unsere beiden Milizionäre auf die Spur gekommen. Die tun vielleicht nur so harmlos. Jeder von uns weiß doch, dass die Milizen die Handlanger der Gestapo sind.« Léa vermied es, Marguérite anzusehen.
Sie errötete prompt, weil sie genau wusste, auf was ihre Freundin anspielte. Léa machte kein Geheimnis daraus, dass sie ihr Verhältnis zu Antoine mit einigen Vorbehalten sah.
Doch dann sprang überraschend Yves für Antoine in die Bresche. »Glaub ich nicht! Flambert ist seit Wochen nicht mehr hier gewesen und kann nichts Wichtiges mitbekommen haben. Und Antoine ist in Ordnung. Er ist längst einer von uns. Das seht ihr daran, dass er dem Widerstand schon ein-, zweimal Interna der Milizen verraten hat. Von ihm wissen wir zum Beispiel, dass die Gestapo eine neue Operation plant, die schon sehr bald starten wird. Sie wollen über zweieinhalbtausend Soldaten in die Berge ins östliche Departement schicken, um die Widerstandsbewegung zu vernichten und jüdische Flüchtlinge festzunehmen. In nächster Zeit wird es hier ganz schön ungemütlich.« Yves wandte sich an Sabine und Miron. »Auch ihr seid längst nicht mehr sicher. Ich hoffe, ihr seid euch dessen bewusst.«
»Wenn wir wüssten, wohin wir die Kinder bringen sollen, wären sie schon längst weg …« Sabines Gesicht drückte mehr als Sorge aus. »Im Augenblick kann uns leider niemand helfen. In den nächsten Tagen erwarte ich jedoch Lili Garel vom Kinderhilfswerk OSE. Vielleicht wissen sie oder ihr Netzwerk irgendeinen Rat.«
Sie unterhielten sich noch eine Weile über unterschiedliche Möglichkeiten, allerdings fiel es Marguérite schwer, sich auf das Gespräch zu konzentrieren. In den letzten Wochen war ihr häufig schlecht gewesen, genau wie jetzt. Nur Léa bemerkte, wie sie sich eilig aus der Küche stahl. Nachdem sie ihren Magen entleert hatte, ging es ihr etwas besser. Sie wusch ihr Gesicht und betrachtete sich in dem halb blinden Spiegel, der am Ausgang hing. Trotz ihres erbärmlichen Zustands sah sie aus wie das blühende Leben. Ihre gewellten Haare schmiegten sich gefällig um ihr Gesicht, die Wangen waren rosig. Plötzlich fiel es ihr wie Schuppen von den Augen.
»Verdammt, du bist schwanger, Marguérite«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild.
Wie hatte sie nur so blind sein können? Ihre Monatsblutung war seit mehr als zwei Monaten überfällig, und auch sonst mehrten sich die Anzeichen, dass etwas anders war als sonst. Ihre Brüste waren voller geworden, und sie fühlte sich irgendwie seltsam. Die Erkenntnis brachte sie völlig aus dem Gleichgewicht. Sie versuchte, die Konsequenzen zu überdenken. Eine Schwangerschaft war alles andere als passend in ihrer jetzigen Situation. Was würde Antoine sagen? Sie musste es ihm so schnell wie möglich mitteilen, und dann würden sie gemeinsam überlegen müssen, wie ihre Zukunft aussehen sollte.
Mit dem Gedanken, dass sie schon bald eine kleine Familie sein würden, kam plötzlich ein Schwall von Glücksgefühlen. Sie hatte sich immer Kinder gewünscht, auch wenn sie mit Antoine natürlich nie darüber gesprochen hatte. Ihre Beziehung war noch so frisch. Hinzu kam, dass sie sich nur sehr selten sahen, da niemand von ihrer Verbindung wissen sollte. Antoine fürchtete zu Recht, dass seine Vorgesetzten dem Kinderheim zu viel Aufmerksamkeit schenken könnten, wenn er sich offiziell zu ihr bekannte. Sie wiederum würde Sabine und Miron nur schwer vermitteln können, weshalb sie sich ausgerechnet mit einem Kollaborateur eingelassen hatte. Auch wenn Antoine mittlerweile in der Kolonie ein und ausging und ihnen hin und wieder mit Geschenken und kleinen Arbeiten half, wurde er weiterhin mit gewissem Misstrauen angesehen.
Einzig Léa war in ihr Geheimnis eingeweiht. Sie brauchte sie als Verbündete, um sich heimlich mit Antoine treffen zu können. Ihre Freundin deckte sie zwar, doch sie war nicht begeistert von ihrem Verhältnis. Sie machte keinen Hehl daraus, dass auch sie Antoine nicht traute. »Er hat Beziehungen zur Lyoner Gestapo. Seine Vorgesetzten haben Mittel und Wege, ihn unter Druck zu setzen. Vergiss das niemals!«, sagte sie ihr immer wieder. Obwohl Marguérite ihrer Freundin heftig widersprach, war ihr durchaus bewusst, dass deren Befürchtungen nicht ganz unbegründet waren. Hatte Antoine ihr nicht selbst gestanden, wie sehr ihm daran lag, seine Brüder von der Zwangsarbeit in Deutschland zu befreien? Erst nach der Rückkehr der Brüder nach Grenoble konnte er einen selbstbestimmten Weg beschreiten. So stellte sich die Frage, welchen Preis er zu bezahlen bereit war.
Marguérite versuchte, den unguten Gedanken abzuschütteln. Antoine würde niemals etwas tun, das der Kolonie schadete. Sie liebte ihn von ganzem Herzen und wünschte sich nichts mehr, als eine gemeinsame Zukunft mit ihm zu haben. Doch weit hinten in ihrem Bewusstsein blieben Zweifel, das hatten die bitteren Erfahrungen in der Vergangenheit sie leider gelehrt. Und dennoch musste sie lernen, Antoine zu vertrauen. Sie war jetzt schwanger, und das änderte alles, auch für ihn. Er war der Vater ihres gemeinsamen Kindes und stand ebenso in der Verantwortung wie sie. Ihre Liebe gab ihr neue Zuversicht.
Sie überlegte, wie sie Antoine am schnellsten eine Nachricht zukommen lassen konnte. Für gewöhnlich trafen sie sich in einem Schuppen, den sie zu einem Liebesnest umfunktioniert hatten. Den Zeitpunkt für ihre Treffen teilten sie sich über kleine Botschaften mit, die sie an einem unauffälligen Ort hinterlegten. Es gab ein Wegkreuz auf halber Strecke ins Dorf, das von Steinen umrundet war. Unter einen der Steine legten sie die Nachrichten, die nichts anderes als Datum und Uhrzeit enthielten, sodass kein Unbefugter etwas damit anzufangen wusste. Leider verhinderten die Schneemassen im Augenblick eine Verabredung. Antoine und sie hatten sich zum letzten Mal kurz vor Weihnachten gesehen.
Zu Marguérites großer Bekümmerung änderte sich das Wetter auch in den folgenden Wochen nicht. Es schneite beinahe unentwegt. Miron und die Jungen schaufelten Unmengen an Schnee beiseite, sodass wenigstens die Zufahrt zum Hof und die Eingangsbereiche zugänglich blieben. Manchmal halfen ihnen auch die Nachbarn Perticoz. Marguérite blieb nichts anderes übrig, als sich weiter zu gedulden.
Anfang Februar gab es neue Hiobsnachrichten. Wie Antoine vorausgesagt hatte, waren im Zuge der Operation Korporal über zweitausendfünfhundert deutsche Soldaten von der Gestapo abkommandiert worden, um auf der Hochebene von Hauteville und in Valromey im Departement Ain Säuberungen durchzuführen. Dabei fiel der Gestapo im Rahmen einer Razzia das Büro der UGIF in Chambéry in die Hände. Dadurch war eine wichtige Anlaufstelle für die Flüchtlinge aufgeflogen. Aus Angst vor Repressalien beschloss das Kinderhilfswerk OSE, das bislang legal agiert hatte, all seine Häuser und Büros in der südlichen Zone zu schließen und nur noch aus dem Untergrund heraus zu arbeiten. Damit war die Kolonie weitgehend auf sich allein gestellt.
Obwohl die starken Schneefälle die Aktion Mitte Februar zwangsweise beendeten, blieb das Resultat verheerend: Achtunddreißig Häuser waren von den Deutschen in Brand gesteckt worden, vierzig Personen getötet und dreihundertvierzig weitere verhaftet worden. Zweihundertneunzig Menschen hatte die Gestapo nach Deutschland deportiert. Zu den betroffenen Städten gehörten auch Belley und Hauteville, wo acht Juden verhaftet und anschließend nach Auschwitz gebracht wurden. Die Mütter des achtjährigen Georgy Halpern und des zehnjährigen Hans Ament, die bei ihnen in der Kolonie wohnten, hatten der Verhaftung durch die Gestapo mit viel Glück entgehen können.
Nachrichten wie diese trugen nicht gerade dazu bei, das Vertrauen in Menschen wie Antoine zu steigern. Léa ließ deswegen keine Gelegenheit aus, Marguérite zu warnen. »Menschen seiner Art bringen nur Unheil über uns. Wenn er wirklich zu uns gehören will, soll er sich doch bekennen! Er steht auf der falschen Seite! Versteh das doch endlich!«
Irgendwann ertrug Marguérite die Sticheleien nicht länger. Sie machte sich ohnehin Sorgen über ihre Zukunft. Außerdem würde sich ihre Schwangerschaft nicht mehr lange verbergen lassen. In ihrer Not sah sie keinen anderen Ausweg, als sich der Freundin anzuvertrauen. Wie erwartet fiel Léa aus allen Wolken. Doch als sie ihrem Entsetzen eine Weile Ausdruck verliehen hatte, beruhigte sie sich wieder und verhielt sich wie eine echte Freundin. Sie nahm sie in die Arme und versprach ihr, alles zu tun, um ihr die Situation zu erleichtern. Das machte Marguérite sehr froh.
Und dann ließen die Niederschläge endlich nach. Ein kräftiges Hochdruckgebiet brachte Sonne und trockene Luft und verwandelte den verschneiten Weiler in ein glitzerndes Wunderland. Die Kinder, die das ständige Stubenhocken hatte unruhig werden lassen, konnten endlich wieder an die frische Luft gehen. Nach dem langen Eingesperrtsein tobten sie ausgelassen durch die weiße Pracht, bauten Schneemänner und errichteten Iglus oder bewarfen sich einfach nach Herzenslust mit Schneebällen. Marguérite und Léa hielten die Kinder von der Terrasse aus im Blick, als sich über den frisch freigeräumten Zufahrtsweg ein Lieferwagen näherte.
»Das ist Yves. Er bringt uns endlich Lebensmittel«, verkündete Léa fröhlich und zog Marguérite mit sich auf den Hof. »Komm, wir sehen mal nach, was wir alles geliefert bekommen. Hoffentlich ist mal wieder etwas Fleisch dabei!«
Neben Yves saß noch jemand. Als die beiden ausstiegen und Marguérite Antoine erkannte, begann sich sofort ihr Herzschlag zu beschleunigen. Er lächelte ihr zu, und sie sah ihm an, wie schwer es ihm fiel, sie nicht gleich in seine Arme zu ziehen. Mittlerweile waren auch Sabine, Miron und Philippe aus dem Haus getreten. Sie freuten sich ebenfalls über die sehnlichst erwartete Lebensmittellieferung. Während Yves sich mit den Zlatins und dem Koch unterhielt, machte Antoine sich daran, den Kofferraum zu leeren. Mit einem großen Korb in den Armen steuerte er auf die Küche zu.
»Los, lauf ihm hinterher«, zischte ihr Léa zu, die die günstige Gelegenheit früher erkannt hatte als Marguérite. »Lots ihn in die Seidenspinnerei, da ist gerade niemand, und ihr könnt in Ruhe reden. Notfalls halte ich Yves noch ein wenig auf.«
Marguérite befolgte den Rat ihrer Freundin und begab sich möglichst unauffällig ebenfalls in die Küche. Antoine erwartete sie bereits. Kaum hatte sie den Raum betreten, zog er sie auch schon in seine Arme und küsste sie leidenschaftlich.
»Ich hab dich so vermisst«, murmelte er sehnsüchtig in ihre Halsbeuge.
»Wir müssen dringend reden!« Sie machte sich umständlich aus seiner Umarmung frei. »Lass uns rüber in die Spinnerei gehen, dort haben wir ein wenig Ruhe.«
»Das hört sich gut an …« Er lächelte ihr verschwörerisch zu und versuchte, ihr noch einen Kuss zu geben.
Nervös schubste sie ihn von sich weg. »Nun geh schon! Ich komm dir gleich durch den Hinterausgang nach.«
»Aber beeil dich!«
Antoine warf ihr einen letzten sehnsuchtsvollen Blick zu, dann verschwand er rasch. Marguérite wartete noch einen Augenblick, bevor sie ihm folgte. Durch das Fenster sah sie, wie Miron Yves zum Haus führte. Der Bäcker hatte eine Flasche Schnaps in der Hand. Sie nahm es als Zeichen, dass die beiden noch eine ganze Weile beschäftigt sein würden.
Antoine wartete ungeduldig im Nebengebäude. Vorher hatte er sich vergewissert, dass sie auch wirklich allein waren. Marguérite und er hatten sich nun beinahe zwei Monate nicht mehr gesehen, und er verging vor Sehnsucht nach ihr. Als sie endlich eintrat, sah er sofort, dass sich etwas an ihr verändert hatte. Sie erschien ihm noch hübscher und begehrenswerter als jemals zuvor. Ihr Gesicht und auch ihr Körper wirkten runder und weiblicher. Sie war einfach hinreißend. Er trat auf sie zu, um sie in seine Arme zu schließen, doch sie hielt ihn auf Abstand.
»Warte«, sagte sie verlegen. »Wir müssen erst reden.«
»Das können wir auch später noch. Ich habe nachgesehen: Wir sind allein.« Antoine scherte sich nicht um ihren Einwand, sondern zog sie wieder zu sich heran. Dieses Mal ließ sie ihn gewähren und erwiderte seinen Kuss mit einer fast verzweifelten Innigkeit, die sie noch begehrenswerter erscheinen ließ. Er begann, ihre Brüste zu streicheln. Normalerweise gefiel ihr das, und sie schmiegte sich noch enger an ihn. Doch heute sperrte sie sich gegen seine Intimität. Er nahm an, sie fürchtete, dass sie überrascht werden könnten. »Keine Angst, hier sieht uns niemand«, flüsterte er, um ihr die Furcht zu nehmen.
»Darum geht es nicht!« Marguérite machte sich nun ganz von ihm los. Ihr Blick schweifte erst zögernd durch den Raum, bevor sie ihm in die Augen sah. »Ich bin schwanger«, brach es aus ihr heraus.
»Du bist was?«
Antoine war sicher, dass er sich verhört hatte. Das durfte, nein, das konnte einfach nicht sein. Er wusste doch, wie man mit einer Frau schlief, und hatte jedes Mal aufgepasst.
»Es gibt keinen Zweifel. Ich bin schwanger«, wiederholte sie dieses Mal sehr viel nachdrücklicher.
Es war kein Missverständnis. Mein Gott! Antoine fuhr sich fahrig durch die Haare.
»Aber ich kann unmöglich der Vater sein«, rutschte es ihm heraus.
Der Schock saß so tief, dass es ihm tatsächlich absurd erschien.
»Was willst du damit sagen?«
Marguérites Augen weiteten sich vor Entsetzen, und er begriff sofort, dass er nicht sehr sensibel reagiert hatte.
»Ich meine doch nur, dass ich immer aufgepasst habe. Nach allem, was ich weiß, kannst du einfach nicht schwanger sein! Bist du wirklich sicher, dass du dich nicht täuschst?«
Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Glaubst du, ich denke mir das hier nur so aus?«, fuhr sie ihn ungestüm an. »Seit Wochen mache ich mir Gedanken darüber, wie ich es dir sagen soll. Dabei habe ich mir allerlei Reaktionen von dir vorgestellt, allerdings nicht die, dass du leugnest, der Vater zu sein. Hältst du mich etwa für eine Hure?«
»Aber nein!« Antoine verstand nicht, wie sie ihn so missverstehen konnte. Ihre heftige Reaktion irritierte ihn. »So … so hab ich das doch nicht gemeint«, versuchte er, sich zu rechtfertigen. »Ich glaube nur, dass du dich irrst. Bist du dir wirklich sicher?«
»So sicher, wie man sich in meinem Zustand nur sein kann«, antwortete sie hitzig.
Antoine fühlte sich völlig überfordert. »Wir können jetzt kein Kind haben«, platzte es aus ihm heraus. »Denk doch an unsere gemeinsame Zukunft! Ein Baby würde all unsere Pläne zunichtemachen. Das kannst du doch auch nicht wollen.«
Der Gedanke, Vater zu werden und diese Verantwortung auf sich zu nehmen, war ihm so fremd, dass er davon ausging, Marguérite würde es nicht anders sehen.
»Es ist nun aber nicht mehr ungeschehen zu machen«, stellte sie tief enttäuscht fest. »Dafür ist es bereits zu spät. Es ist, wie es ist.«
Ihre Lippen waren fest aufeinandergepresst. Ihr Blick trotzig und bestimmt. Antoine spürte, wie er immer ungehaltener wurde. Nicht wegen Marguérite oder wegen des Babys, sondern wegen des Umstands, dass sich schon wieder ein Hindernis zwischen sich und seine Träume schob.
»Ich kann das nicht!«, platzte es aus ihm heraus. »Nun begreif das doch.«
Marguérites Augen füllten sich erneut mit Tränen, mit geballten Fäusten stand sie vor ihm. »Ich dachte, du freust dich.«
»Wie soll ich mich denn in unserer Situation über ein Kind freuen?«, entgegnete er verärgert über ihre Naivität. »Wie stellst du dir das vor?«
»Das weiß ich doch selbst nicht!« Ihre Stimme war ganz leise, ihre Verzweiflung war dennoch nicht zu überhören. »Ich bin von der Situation genauso überfordert wie du. Glaubst du, ich hätte mir das ausgesucht?«
»Natürlich nicht!« Antoine raufte sich erneut die Haare. Warum konnte denn nicht einmal in seinem Leben etwas so laufen, wie er es plante? Kaum glaubte er dem erdrückenden Schicksal eines Uhrmachers endlich entkommen zu sein, tappte er in eine Familienfalle. Das war ihm einfach alles zu viel. Sie mussten einen Weg aus der Misere finden. Im selben Atemzug wusste er, dass er Marguérite unrecht tat. »Bitte verzeih, aber das hat mich jetzt kalt erwischt. Wir sollten …«
Mit einer hilflosen Geste versuchte er, ihren Arm zu fassen, doch sie ging sofort auf Abstand.
»Ich muss wissen, ob du zu mir und unserem Kind stehst«, verlangte sie mit bebender Stimme.
In ihrem Blick lag eine Entschlossenheit, von der sie nichts mehr abzubringen schien.
»Natürlich möchte ich Kinder mit dir haben«, versuchte Antoine, ihr seine Sicht der Dinge zu erklären. »Aber doch nicht jetzt!« Er dachte kurz nach und kam zu der Überzeugung, dass es noch nicht zu spät sein könnte, die Sache ungeschehen zu machen. Ihm fiel ein, dass sich ein Kamerad von ihm kürzlich in einer ähnlichen Situation befunden hatte. »Ich weiß, wie wir das Problem lösen können«, setzte er behutsam an. »Ich kenne da jemanden …«
»Du willst, dass ich zu einer Engelmacherin gehe?« Er sah, wie sich ihr ganzer Körper versteifte.
»Es ist doch noch nicht zu spät, oder?« Ihr Schweigen interpretierte er als stummes Einverständnis. »Es ist für uns beide das Beste, glaub mir!«
»Du möchtest, dass ich unser Kind umbringe«, sprach sie tonlos aus, was er nicht gewagt hatte, so deutlich zu sagen.
»Das Baby ist doch noch so klein. Es ist noch nicht mal ein richtiger Mensch. Wir können später andere Kinder haben. Wenn du willst, einen ganzen Stall voll. Du wirst sehen, dass es die beste Lösung ist. Ich komme für alles auf.«
Er hoffte, sie mit seinen Worten beruhigen zu können, und wollte sie erneut in die Arme nehmen. Mit einer heftigen Bewegung hob sie beide Hände und hielt ihn auf Abstand. Ihr fassungsloser Blick sagte mehr als hundert Worte. Mit einem Mal hatte sich zwischen ihnen eine unüberwindbare Kluft aufgetan.
»Ich werde mein Kind niemals töten«, sagte sie mit fester Stimme. »Notfalls werde ich es eben allein aufziehen.«
Ihm war nicht entgangen, dass sie nun »mein« Kind sagte und nicht mehr von »ihrem« sprach. Diese Sturheit verärgerte ihn. Begriff sie denn wirklich nicht, in was für Schwierigkeiten sie da hineinsteuerten? Es ging doch nicht nur allein um seine, sondern auch um Marguérites Zukunft. Ein Kind würde alles zerstören.
»Überleg mal, in was für eine Welt unser Kind hineingeboren würde«, bemühte er sich erneut, ihr seine Sicht der Dinge zu vermitteln. »Wenn ich mich zu euch beiden bekenne, werden meine Vorgesetzten ganz genau deine Abstammung durchleuchten. Wenn sie herausfinden, dass du Jüdin bist, ist auch das Kind in Gefahr. Sie würden es uns wegnehmen, mal ganz davon abgesehen, dass auch du dann in ein Lager kämst.«
Marguérite stieß ein freudloses Lachen aus. »Ist das alles, woran du denkst?«, fuhr sie ihn an. »Oder ist dir in Wahrheit ein Kind nur deshalb lästig, weil es deine Zukunftspläne als Musiker durchkreuzen könnte? Gib doch wenigstens zu, dass das Kleine und ich für dein zukünftiges Leben in Paris nur ein Klotz am Bein wären.«
»Wir hatten gemeinsame Pläne!«, verteidigte sich Antoine.
Ihm war durchaus bewusst, dass auch dies ein Teil der Wahrheit war. Er fühlte sich genötigt, es zu verteidigen. »Musik ist unser Leben. Ich kämpfe schon mein ganzes Leben darum, meine Träume zu verwirklichen. Und du willst es doch auch. Das weiß ich ganz genau. Denk wenigstens über meinen Vorschlag nach.«
»Das muss ich nicht«, sagte Marguérite entschieden. »Wenigstens weiß ich nun, dass ich auf dich nicht zählen kann.« Sie blickte ausdruckslos an ihm vorbei. Mit einem Mal spürte sie ein leichtes Flattern in ihrem Bauch, wie der sanfte Flügelschlag eines Schmetterlings. Als ob das Kleine ihr ein Zeichen geben wollte: Hier bin ich, ich möchte leben … »Ich habe in meinem Leben schon mehr geschafft. Ich werde dieses Kind ohne seinen Vater aufziehen.«
Damit drehte sie sich auf dem Absatz um und ließ ihn einfach stehen.