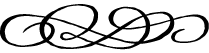
Massif de la Chartreuse, Frankreich, April 1944
Warum gab es kein Glück ohne Unglück, keine Liebe ohne Leid und kein Leben ohne Tod? In jedem hellen Augenblick war auch eine dunkle Seite verborgen. Das Dunkle kam immer dann, wenn man sich im Guten geborgen fühlte. Wenn Marguérite zwischen ihren Fieberträumen die Kraft hatte, für wenige Momente klar zu denken, grübelte sie über derlei Dinge. Waren es nicht die Gegensätze, die einen lehrten, die Welt zu begreifen? Wer nicht ums Dunkel wusste, konnte das Licht nicht erkennen. Weiß Gott, sie hatte beides zu Genüge kennengelernt. Auch damals, auf ihrer Flucht aus Deutschland …
Nach dem Verrat des Kutschers, der dazu geführt hatte, dass Clara, Mechthild und der kleine Samuel von den Milizen aufgegriffen worden waren, harrte sie stundenlang frierend in dem dunklen Verschlag des fremden Hofes aus und wagte es nicht, sich zu rühren. Durch ein Astloch in der Tür beobachtete sie, wie die Besitzerin des Hauses ihre Wäsche aufhängte. Auch als die Frau nach getaner Arbeit längst wieder im Haus verschwunden war, wagte sie es nicht hinauszugehen. Die Milizionäre durchsuchten womöglich jedes einzelne Anwesen.
Sie wartete, bis es dunkel wurde, und noch ein bisschen länger. Erst als die Alltagsgeräusche im Haus weniger wurden und die Bewohner sich schlafen legten, beschloss sie, das Versteck zu verlassen. Es war eine dunkle Nacht, die sie gut vor den Blicken möglicher Verfolger verbarg. Auf der anderen Seite war es schwer, sich zu orientieren. Sie wusste nur, dass sie der Hauptstraße in südlicher Richtung folgen musste. Um diese Straße zu finden, musste sie zurück zu dem Gasthof, in dem sie verraten worden waren.
Die Straßen waren zum Glück verlassen. Alains Wagen war ebenso verschwunden wie der Lastwagen der Milizionäre. Um von ja keinem Lichtfetzen erwischt zu werden, hielt sie sich im Schatten der Hauswände, bis sie schließlich den Ortsrand und die Straße erreichte, die sie hoffentlich nach Moval führen würde. Immerhin hatte sie mittags etwas zu essen gehabt und fühlte sich einigermaßen gestärkt. Sie versuchte, alle schlechten Gedanken auszublenden, während sie Stunde um Stunde lief, immer weiter, den Blick ängstlich in die Umgebung gerichtet. Aus Angst vor Entdeckung machte sie so gut wie keine Pausen, auch nicht, als sie ihre Füße kaum noch spürte und ihre Kraft immer mehr nachließ.
Ihre drei Begleiter fehlten ihr, auch wenn sie ständig geklagt hatten. Die Kinder hatten ihr das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden. Jetzt war sie ganz auf sich allein gestellt. Sie machte sich Vorwürfe. Armer kleiner Samuel, tapfere Mechthild und kluge Clara! Sie hatte ihre drei Leidensgenossen wie Geschwister ins Herz geschlossen. Marguérite, wie sie sich nun nannte, haderte mit ihrem Schicksal. Zum einen machte sie sich den Vorwurf, die anderen durch ihre Flucht im Stich gelassen zu haben, zum anderen wusste sie aber auch, dass sie ihnen nicht hätte helfen können. In Zeiten wie diesen musste jeder an sich selbst denken. Diese bittere Erfahrung war ihr jedoch kein Trost. »Wir werden in dir weiterleben«, hatte ihre Mutter zum Abschied gesagt. »Es ist der Wunsch deines Vaters und auch meiner, dass du jetzt gehst. Sonst war alles umsonst!« Doch wie sollte sie das schaffen? Dummerweise hatte sie bei ihrer Flucht die Tasche mit ihren Habseligkeiten zurücklassen müssen. Sie besaß nun weder Geld noch Papiere.
Im Morgengrauen erreichte sie endlich Moval. Es war nur eine kleine Ortschaft, ein Haufen zusammengewürfelter Bauernhöfe, die sich um eine einfache Kirche scharten. Die ersten Hähne krähten zu ihrer Begrüßung, als sie die Kirche durch einen Seiteneingang betrat. Hans hatte ihr eingebläut, dass sie sich im Beichtstuhl verbergen und warten sollte, bis sie von jemandem abgeholt wurde. Völlig erschöpft kroch sie hinter den Vorhang und kauerte sich auf die Kniebank vor dem Beichtgitter. Kaum hatte sie es sich dort ein wenig bequem gemacht, war sie auch schon eingeschlafen.
Sie wusste nicht, wie lange sie dort ausgeharrt hatte. Das Nächste, woran sie sich erinnerte, war die schwere Hand, die sich mit einem Mal auf ihre Schulter legte und die sie erschreckt hochfahren ließ.
»Keine Angst, du bist hier sicher«, hörte sie eine männliche Stimme. Sie konnte nicht sehen, zu wem sie gehörte, denn die Gestalt verdeckte den schmalen Eingang zum Beichtstuhl. Als sie sich mit steifen Gliedern aufgerappelt hatte und nach draußen getreten war, sah sie einen alten Mann in einer schwarzen Soutane, dessen kahler Schädel von einem weißen Haarkranz umgeben war. Schwarze Knopfaugen unter buschigen Augenbrauen musterten sie neugierig. »Ich bin Abbé Glasberg«, begrüßte sie der erstaunlich kleine Mann und reichte ihr seine Hand. »Wo sind deine Begleiter?« Bevor sie etwas sagen oder erklären konnte, brachte er sie zum Schweigen, indem er seinen Zeigefinger auf den Mund legte. Von draußen waren Geräusche zu hören. »Psst!«, flüsterte er mit einem vorsichtigen Blick rundum. »Bald ist Morgenandacht. Manche meiner Schäfchen können gar nicht früh genug hier sein. Wir wollen doch nicht, dass du entdeckt wirst. Zum Reden haben wir später noch genügend Zeit. Jetzt bringe ich dich erst einmal in ein sicheres Versteck.«
Sie folgte ihm durch die Sakristei ins Freie und von dort über den Friedhof zu einem abgelegenen Haus am Ortsrand. Es stand leer. Der Abbé schloss die Tür auf und führte sie zu einem versteckt liegenden Keller. In der dortigen Speisekammer stand ein großes Krautfass. Der Geistliche schob es beiseite, öffnete die Klappe, die sich darunter im Boden befand, und beschied sie, durch die Luke in das fensterlose Verlies zu klettern.
»Da rein?«, fragte Marguérite erschrocken. Das Gewölbe war so niedrig, dass sie kaum aufrecht stehen konnte.
»Es tut mir leid, dass ich dir nichts Bequemeres anbieten kann«, bedauerte der Abbé und wies mit einer Taschenlampe in einen engen Gang und dann zu einem Raum, in dem mehrere Matratzen auf dem Boden lagen. »Hier war schon eine ganze Weile niemand mehr«, entschuldigte er sich, als das Licht seiner Lampe über die Spinnweben an den Wänden huschte. »Ich werde dir einen Handfeger bringen, damit du etwas sauber machen kannst.«
»Wie lange muss ich hierbleiben?«, erkundigte sich Marguérite ängstlich. Der Gedanke, in dem dunklen Loch allein auszuharren, behagte ihr ganz und gar nicht.
»Ein paar Tage wirst du dich hier schon aufhalten müssen«, erwiderte der Abbé zu ihrer Enttäuschung. »Seit einiger Zeit tummeln sich die Milizen in der Gegend. Es gab einen Anschlag auf einen Eisenbahnwaggon, in dem Waffen transportiert wurden. Jetzt wollen sie die Verantwortlichen finden.« Seine buschigen weißen Augenbrauen hoben sich mitfühlend. »Du wirst es schon schaffen. Du bist schließlich nicht die Erste.« Er griff in die Tasche seiner Soutane und zog aus der Tiefe eine weitere Taschenlampe heraus, die er ihr reichte. »Nimm die so lange, bis ich zurückkehre. Mach sie nur an, wenn du sie wirklich brauchst. Sie wird nicht mehr lange leuchten. Und nun gedulde dich, bis ich wiederkomme, denn ich muss erst noch die Morgenandacht halten und ein paar Beichten abnehmen. Aber gleich im Anschluss werde ich dir etwas zu essen und Kerzen bringen. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.«
Er zwinkerte ihr freundlich zu und verschwand in der Dunkelheit. Marguérite hörte noch, wie er die Klappe verschloss und das Krautfass wieder darüberschob. Dann war sie allein. Die Dunkelheit ihres Verlieses hatte etwas furchtbar Beklemmendes. Sie fühlte sich noch einsamer und verlassener als zuvor und bemerkte erst jetzt, wie modrig es roch. Allen Warnungen zum Trotz knipste sie die Taschenlampe an und inspizierte den Raum. Er war nicht besonders groß und bot gerade mal vier schäbigen Matratzen Platz, auf denen je eine Decke und ein schmuddeliges Kissen lag.
Wie viele Menschen hier wohl schon vor ihr Unterschlupf gefunden hatten?
An den Wänden sah sie Kerben und eingeritzte Anfangsbuchstaben. Mit Schaudern erkannte sie, dass ihre Vorgänger hier manchmal mehrere Wochen hatten aushalten müssen. Allein der Gedanke, dass sie länger als einen Tag würde bleiben müssen, nahm ihr den Mut. Sie suchte sich die sauberste Matratze aus und hockte sich darauf, die Arme über den Knien verschränkt. So verharrte sie in düstere Gedanken versunken, bis nach einer gefühlten Ewigkeit der Abbé zurückkam. Wie versprochen brachte er ihr einen Teller mit lauwarmer Suppe, einen Kanten Brot und etwas Hartkäse. Außerdem einen Krug mit Wasser, ein Glas und einige Kerzen samt Streichhölzern. Auch den Besen hatte er nicht vergessen. Ihre Notdurft sollte sie in einem Eimer verrichten, der in einer der Ecken stand.
»Komm erst mal wieder zu Kräften«, forderte er sie zum Essen auf. Ihm war ihr hungriger Blick nicht entgangen. Schwerfällig ließ er sich auf einer der anderen Matratzen nieder und zündete eine Kerze an. Marguérite ließ sich nicht zweimal bitten. Gierig löffelte sie die fade Kohlsuppe, die mit Mehl gestreckt war, aber immerhin ihren Magen füllte. Auch das harte Brot und den alten Käse verschlang sie mit großem Appetit. »Morgen versuche ich, etwas Besseres aufzutreiben«, versprach ihr Retter. »Leider bin ich auf die Almosen meiner Gemeindemitglieder angewiesen. Die meisten besitzen nur wenig …« Er hob bedauernd die Hände und lächelte ihr zu. »Fühlst du dich einigermaßen satt?«
»O ja. Vielen Dank!« Sie lächelte zaghaft. Dann bekam sie plötzlich ein schlechtes Gewissen. »Habe ich Ihnen etwa alles weggegessen?« Wie hatte sie nur so selbstsüchtig sein können!
Abbé Glasberg hob beschwichtigend die Hände. »Mach dir um mich keine Sorgen!« Er klopfte auf seinen Bauch, der sich leicht vorwölbte. »Ich besitze zum Glück ein kleines Polster«, erklärte er mit einem humorvollen Zwinkern. Er bat sie, ihm zu erzählen, wie es ihr auf der Flucht ergangen war. Marguérite tat ihm gern den Gefallen. Es tat gut, endlich einmal über all das, was sie erlebt hatte, zu reden. Abbé Glasberg war ein geduldiger Zuhörer. »Mach dir keine Vorwürfe, mein Kind«, sprach er begütigend. »Gottes Wege sind für uns einfache Menschen oft nicht nachvollziehbar. Es war Sein Wille, dass du gerettet wurdest und deine Begleiter nicht. Hadere nicht mit deinem Schicksal, sondern nimm es dankbar an.«
Für Marguérite waren diese Worte nur ein geringer Trost, auch wenn der alte Mann fest daran zu glauben schien. »Wie wird es nur weitergehen?«, fragte sie schließlich zaghaft. »Bringen Sie mich bald fort von hier?« Sie deutete auf die zahlreichen Einkerbungen an den Wänden. »So lange werde ich doch wohl nicht bleiben müssen?«
»Das weiß Gott allein …« Der Pfarrer seufzte und erhob sich müde von seinem Sitz. »Erst muss sich hier alles wieder beruhigen. Es ist schon ein Wunder, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Hast du Papiere?«
Marguérite schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich musste sie bei meiner Flucht zurücklassen.«
»Das macht es nicht leichter.« Der Abbé kratzte sich am Kinn und dachte nach. »Ich kenne da jemanden in Belley, der uns helfen könnte. Allerdings wird es eine Weile dauern. Mal sehen, was ich für dich tun kann.« Damit verabschiedete er sich und ließ Marguérite im Dunkeln zurück.
Die darauffolgenden Tage wurden zu einer schrecklichen Tortur. Sie zogen sich in quälender Langsamkeit dahin und waren angefüllt von Langeweile und Selbstzweifeln. Nicht nur die Dunkelheit und der Mangel an Tageslicht zehrten an Marguérites Nerven, auch die Unsicherheit über ihre Zukunft. Hinzu kam, dass sie nichts zu tun hatte. Um das Zeitgefühl nicht zu verlieren, beschloss sie, Kerben in eine der Wände zu ritzen. Da sie kein Gespür für Tag und Nacht hatte, wollte sie sich an den Besuchen des Pfarrers orientieren, der jeden Tag zu kommen versprach. Immer wenn er ging, sollte ein neuer Strich dazukommen.
Damit sie etwas zu tun hatte, hatte der Geistliche ihr einen verknoteten Haufen alter Wolle und zwei Stricknadeln mitgebracht. Marguérite hatte noch nie besonders viel für Handarbeiten übriggehabt und zeigte sich nicht sehr begeistert. Doch als ihr Retter sie in der zweiten Nacht nach draußen begleitete, hob sich ihre Stimmung. Die frische Luft tat ihrer Lunge gut, und sie spürte mit aller Kraft, wie sehr sie die Freiheit vermisste. Über dunkle Gassen brachte der Abbé sie zu einem Haus, das sie durch einen Hintereingang betraten. Dort wartete ein Mann mit einer Fotoausrüstung, um sie zu fotografieren.
»Das ist nötig für die neuen Papiere«, erklärte er ihr. »Wenn alles klappt, wirst du schon bald von hier fortkönnen.«
Marguérite hielt sich an dem Wort »bald« fest und hoffte, dass ihre Isolation schnell ein Ende finden würde. Die kleinen Auszeiten in der Nacht wurden für sie die Höhepunkte dieser quälenden Zeit. Leider waren sie immer viel zu schnell vorüber und ließen ihr Verlies danach noch viel schrecklicher erscheinen. Die verfilzte Wolle hatte sie entwirrt, zu einem Knäuel aufgerollt und daraus einen Schal gestrickt, der so kratzig war, dass ihre Haut juckte, als sie ihn zur Anprobe um den Hals schlang. Sehnlichst wartete sie auf das Ende ihrer Einzelhaft. »Ich werde noch verrückt, wenn ich nicht wenigstens mal kurz tagsüber nach draußen darf«, klagte sie bei jedem Besuch von Abbé Glasberg, obwohl sie wusste, wie undankbar sie ihrem Wohltäter gegenüber war.
Ihre Geduld wurde für zehn Tage auf die Probe gestellt. Dann hatte ihr Leid endlich ein Ende. Der Abbé erlöste sie aus ihrer freiwilligen Haft und brachte sie nach draußen. Zu Marguérites Überraschung war es nicht dunkle Nacht wie sonst, sondern bereits früher Morgen. Obwohl es ein neblig trüber Tag war, dessen schwaches Licht kaum die Landschaft erhellte, erschien er ihr wie ein gleißender Sommertag. Sie atmete tief ein und aus und fühlte sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder lebendig.
Ihr Wohltäter stellte sie einer jungen Frau mit Namen Léa Feldblum vor. Sie war etwa in Marguérites Alter und schien genau zu wissen, was sie wollte.
»Komm mit mir nach Izieu«, bot sie ihr in ihrer offenen herzlichen Art an. »Dort ist ein Kinderheim eröffnet worden. Du kannst als Wäscherin oder Küchenhilfe Unterschlupf finden. Ich hab gehört, dass die Leiter des Heimes dringend nach vertrauenswürdiger Unterstützung suchen.«
»Aber ich habe noch nie als Wäscherin oder Küchenhilfe gearbeitet«, gab Marguérite erschrocken zu bedenken. »Sie werden mich bestimmt gleich wieder davonjagen. Ich fürchte, ich habe zwei linke Hände!«
»Das hast du ganz bestimmt nicht!« Léa ließ ihre Einwände einfach nicht zu. »Sabine und Miron Zlatin haben ein großes Herz. Die Hauptsache ist, dass du kein Aufheben um dich machst. Wir dürfen auf keinen Fall auffallen. Bekommst du das hin?« Sie sah sie prüfend an.
»Natürlich«, erwiderte Marguérite.
»Das einzige Problem wird sein, dass dein Französisch nicht akzentfrei ist«, überlegte Léa gleich weiter. »Vielleicht können wir ja behaupten, dass du in der Schweiz aufgewachsen bist.«
»Daran habe ich auch schon gedacht«, mischte sich nun Abbé Glasberg ein und übergab Marguérite mit dem für ihn so typisch aufmunternden Augenzwinkern ihre neuen Papiere. »In deinen Papieren steht, dass du im schweizerischen Wallis aufgewachsen bist. Das dürfte deinen Akzent erklären. Sie sind übrigens erst gestern Abend fertig geworden«, entschuldigte er sich. »Aber es ist gute Arbeit, die es rechtfertigt, dass du so lange warten musstest. Damit solltest du bei einer Kontrolle keine Schwierigkeiten bekommen.«
»Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen jemals für Ihre Hilfe danken kann«, antwortete Marguérite gerührt.
Doch der Abbé winkte nur ab. »Das war doch selbstverständlich!« Plötzlich sah sie eine Träne unter seinen buschigen Augenbrauen glitzern, und im nächsten Augenblick schloss der alte Herr sie in ihre Arme. »Du bist eine tapfere junge Frau, meine Tochter. Gott behüte dich auf deinem Weg!«
Am späten Nachmittag erreichten Marguérite und Léa Feldblum mit dem Autobus Belley. Nach der einsamen Zeit im dunklen Keller des Abbé genoss Marguérite das helle Licht und die warme Junisonne, die sich mittlerweile hinter den Wolken hervorgeschoben hatte, aber noch viel mehr die Gesellschaft der Gleichaltrigen. Während ihrer mehrstündigen Reise hatte sie sich mit Léa angefreundet. Die dunkelhaarige junge Frau mit den ebenmäßigen Gesichtszügen und dem fröhlichen, warmen Lachen hatte sofort ihr Herz erobert. Sie erfuhr, dass auch sie durch die widrigen Umstände den Kontakt zu ihrer Familie verloren hatte und nun auf sich allein gestellt war.
»Fast meine ganze Familie ist nach Deutschland deportiert worden«, berichtete sie mit einem wehmütigen Lächeln. »Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen! Ich lebe für eine bessere Zukunft.«
Marguérite beneidete die neue Freundin für ihre Fröhlichkeit und die Unbeschwertheit, die sie sich hatte bewahren können. Sie selbst kam sich dagegen schwach und viel zu grüblerisch vor.
Als sie vor der Kathedrale ausstiegen, atmete sie tief ein und fragte sich, was die Zukunft ihr nun bringen mochte. Léa schien ihre Gedanken zu erraten. Sie stieß sie kameradschaftlich in die Seite.
»Wir gehen zuerst zur Unterpräfektur«, erklärte sie bestimmt. »Monsieur Wiltzer ist kein Freund der Kollaboration. Obwohl er immer wieder Schwierigkeiten mit seinen Vorgesetzten riskiert, hilft er uns. Wir sollen uns an seine Sekretärin, Madame Cojean, wenden. Sie wird uns sagen, wie wir schnell zum Waisenhaus kommen.«
Dank der Hilfe von Madame Cojean, einer stillen, eher unauffälligen Frau, bekamen sie noch am selben Tag eine Mitfahrgelegenheit nach Izieu. Auf der Ladefläche eines Ford LKW, der Maschinenteile transportierte, fuhren sie die knapp zwanzig Kilometer bis ins Dorf Brégnier-Cordon, das nicht weit von der ehemaligen Seidenspinnerei entfernt war, in der die von den Eltern weggeschickten Kinder untergebracht worden waren. Der Fahrer, ein wortkarger Mann mit tief in die Stirn gezogener Schiebermütze, würdigte sie keines Blickes, als er sie in dem kleinen Ort vor dem Brunnen aussteigen ließ.
Außer einer Bäckerei und einem Gasthof war nicht viel los. Léa ergriff erneut die Initiative und erkundigte sich in der Bäckerei nach dem Weg zum Weiler Lélinaz, der in Richtung Izieu lag. Die freundliche Bäckerin riet ihnen, nicht die Hauptstraße, sondern einen Nebenweg zu nehmen, der zwar steiler war, aber um einiges kürzer.
»In ungefähr einer halben Stunde seid ihr an eurem Ziel«, meinte sie. »Wollt ihr zu dem neuen Waisenhaus?«
»Genau, das wollen wir«, entgegnete Léa fröhlich. »Aber nun müssen wir uns auf den Weg machen. Wir werden nämlich schon erwartet.« Damit unterband sie weitere neugierige Fragen.
Während sie den steilen Anstieg durch ein Waldstück bewältigten, erkundigte sich Marguérite nach dem Ehepaar Zlatin. Léa erzählte ihr, dass die Leiterin der Kolonie Polin und 1926 nach Frankreich emigriert war. In Nancy hatte Sabine ihren späteren Ehemann Miron kennengelernt, der aus Russland stammte. Nach ihrer Heirat, die Ehe war kinderlos geblieben, betrieben die beiden beinahe zwölf Jahre lang eine Geflügelfarm in Nordfrankreich, bevor sie 1939 die französische Staatsbürgerschaft erwarben. Mit der Besetzung Nordfrankreichs durch die deutsche Wehrmacht hatte das jüdische Ehepaar sein Anwesen verloren und Zuflucht im freien Südfrankreich gesucht. In der Nähe von Montpellier hatte Miron einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb geleitet, während Sabine im Krankenhaus der Militärkaserne in Lauwe als Krankenschwester beim Roten Kreuz tätig gewesen war. Im Februar 1941 war sie aufgrund der antisemitischen Gesetze des Vichy-Regimes entlassen worden.
»Nach ihrer Entlassung haben die Zlatins für verschiedene Organisationen gearbeitet, die jüdischen Flüchtlingen, vor allem Kindern, helfen. Aber sieh selbst! Die beiden sind wunderbare Menschen.«
Als sie endlich aus dem Waldstück heraustraten, sahen sie ihr Ziel, die Villa Anne-Marie, vor sich. Das Anwesen war im 19. Jahrhundert von einem Fabrikanten erbaut worden, der in einem Nebengebäude eine Seidenspinnerei betrieben hatte. Später wurde das Haupthaus als Ferienheim genutzt. Angrenzend befand sich ein Bauernhof, der von der Familie Perticoz betrieben wurde. Schon auf den ersten Blick war klar, dass die Häuser in einem schlechten Zustand waren. Von den Wänden blätterte der Putz ab, und auch sonst machten sie einen reichlich verwahrlosten Eindruck.
Noch bevor Léa und Marguérite den kleinen Weiler erreichten, kamen ihnen Miron und Sabine Zlatin entgegen. Obwohl gerade rundum Trubel herrschte, nahmen sie sich die Zeit, die beiden Neuankömmlinge ausgiebig zu begrüßen. Sabine führte die jungen Frauen in die behelfsmäßig eingerichtete Küche und ließ ihnen vom Koch frische Milch bringen. Marguérite hatte schon seit Wochen keine so köstliche Stärkung mehr bekommen.
»Unsere Nachbarn sind zum Glück sehr freigiebig«, berichtete Sabine und erklärte ihnen sogleich, dass ein großer Teil der Lebensmittel, die sie bekamen, aus Spenden der Nachbarn bestand. »Wir bekommen über die Sekretärin des Unterpräfekten zwar Lebensmittelscheine, doch sie würden bei Weitem nicht ausreichen.«
Miron trat zu ihnen in die Küche. Er sah verschwitzt aus, da er geholfen hatte, einen Lastwagen zu entladen. »Das waren endlich die neuen Matratzen für die Stockbetten«, teilte er Sabine erleichtert mit. »Jetzt haben die Neuankömmlinge wenigstens ein Lager.« Er setzte sich erschöpft zu ihnen an den Tisch.
»Es ist alles noch ziemlich provisorisch«, erklärte Sabine den beiden jungen Frauen. »Aber zusammen werden wir es schon schaffen.« Sie lächelte ihnen zu. »Miron organisiert fast alles für unser tägliches Leben, und ich kümmere mich um das andere. In Zeiten wie diesen ist Solidarität wichtiger denn je.« Sie erfuhren, dass sich im Augenblick zweiundvierzig Kinder in dem Waisenhaus aufhielten, aber es demnächst doppelt so viele werden könnten. »Es gibt so viele Kinder, die unsere Hilfe brauchen«, fuhr Sabine betrübt fort. »Seit die Rassengesetze auch in der freien Zone gelten, ist auch hier keine jüdische Familie mehr sicher. Die Kinder haben ohne Ausnahme traumatische Erlebnisse gehabt. Manche von ihnen wurden Hals über Kopf von ihren Eltern getrennt, obwohl sie noch sehr klein sind. Andere mussten mit ansehen, wie ihre Eltern und Großeltern von der Gestapo abtransportiert wurden. Alle haben Entbehrungen und Schicksalsschläge hinter sich, aber vor allem sind sie traurig und fühlen sich in ihrer Welt unsicher und allein. Unsere Aufgabe ist es, ihnen ein wenig Lebensfreude zurückzugeben. Wenn wir ihnen nicht helfen, werden sie nicht überleben! Aber das lassen wir nicht zu, solange es Menschen gibt, die uns unterstützen, nicht wahr?«
Marguérite war beeindruckt von Sabines entschiedenem Auftreten. Die Frau wusste, was sie wollte, und schien sich nicht unterkriegen zu lassen. Wie sie bald herausfinden sollte, war sie diejenige, die hier die wichtigen organisatorischen Entscheidungen traf. Ihr Mann Miron war für die praktischen Dinge zuständig.
»Durch meine Arbeit im Krankenhaus habe ich gute Beziehungen zu der Präfektur im Departement Hérault«, sagte Sabine mit einer Offenheit, die Marguérite erstaunte. Sie schien keinerlei Misstrauen gegen sie zu hegen, obwohl sie sie gar nicht kannte. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, verriet sie ihnen die Hintergründe zu dem Kinderheim. »Jean Benedetti, mein damaliger Vorgesetzter, hat sich nicht um die Rassengesetze der Vichy-Regierung geschert, sondern mir erlaubt, mich um unsere jüdischen Freunde in den französischen Lagern zu kümmern. Er verhalf mir zu einer Arbeit beim Kinderhilfswerk OSE als Sozialarbeiterin. So bekam ich Zugang zu den Internierungslagern in Agde und Rivesaltes. Von da aus gelang es mir, die Befreiung vieler Kinder zu organisieren. Wir haben sie dann in sogenannte Kinderheime des Hilfswerks gebracht, unter anderem nach Palavas. Leider ist die politische Lage dort sehr brenzlig geworden, weil die Deutschen mittlerweile überall sind. Deswegen sind wir in die italienische Zone ausgewichen. Ein paar der Kinder aus Palavas sind bereits hier. Die anderen kommen in den nächsten Tagen und Wochen.«
»Sind die Kinder hier denn sicher?«, erkundigte sich Léa skeptisch. »Angeblich hat die Gestapo in Lyon nun auch Milizionäre nach Belley entsandt.«
»Das stimmt leider«, gab Miron ihr recht. Sein Gesichtsausdruck wirkte angewidert. »Deshalb wird es ja auch Zeit, dass endlich jemand die verdammten Nazis in die Schranken weist. Zum Glück gibt es hier noch ein paar mutige Männer, die …« Der warnende Blick seiner Frau ließ ihn abrupt verstummen. Er brummte unwillig. »Nun ja, wir hoffen alle, dass sie uns in Ruhe lassen«, vollendete er seinen Satz offenbar anders als ursprünglich beabsichtigt.
Sowohl Marguérite als auch Léa zogen es vor, nicht weiter darauf einzugehen. Also gab es doch einige Geheimnisse, die sie nichts angingen. Sabine erhob sich nun, um anderen Aufgaben nachzugehen. Miron zeigte ihnen, wo sie schlafen konnten, und wies ihnen ihre zukünftigen Aufgaben zu. »Ihr seid natürlich hauptsächlich für die Kinder verantwortlich«, erklärte er ihnen bei seiner Führung durch das Haus, »aber es gibt noch viele andere Dinge zu tun. Jeder hilft, wo er kann.« Er stellte ihnen den Koch vor, einen jungen Mann mit einem lustigen Gesicht und wirr abstehenden Haaren. »Philippe schafft es immer wieder, aus beinahe nichts ein akzeptables Essen zu zaubern. Falls nötig, müsst ihr auch ihm zur Hand gehen, ebenso wie Ninette, die einmal pro Woche die Wäsche hier macht.«
Auf dem Gang begegnete ihnen ein weiterer junger Mann mit einem offenen Lächeln. Miron stellte ihn als Léon Reifmann vor. »Léon und seine Familie unterstützen uns ebenfalls«, erklärte Miron. »Seine Schwester Suzanne ist Ärztin, was uns natürlich von großem Nutzen ist, und Léon selbst …«
»… ist hier Mädchen für alles und vor allem für die gute Laune zuständig«, vollendete dieser fröhlich Mirons Satz und machte eine weit ausladende Verbeugung in ihre Richtung, was Léa zu einem herzlichen Lachen veranlasste.
»Wir verstehen uns alle als eine große Familie«, ergänzte Sabine, die gerade ihren Weg kreuzte, aber gleich wieder verschwand.
»Und deswegen würde ich vorschlagen, dass ich damit anfange, euch die lieben Kleinen vorzustellen!« Léons anpackende Art gefiel Marguérite. Er bedeutete ihnen, ihm nach draußen zu folgen, wo einige Kinder rund um den Brunnen spielten. Da das Wetter gut war und die Temperaturen angenehm, hatten sie sich ihrer langen Wollstrümpfe entledigt, sie rannten barfuß über die Wiese. Ihr Lachen klang ungezwungen. »Wir haben zwar Strom, aber leider kein fließendes Wasser«, erklärte Léon. »Deswegen müssen sich alle hier draußen waschen. Auch das Geschirr wird hier abgespült und die Wäsche gewaschen.«
Einige Kinder hörten auf zu spielen und beäugten neugierig die beiden jungen Frauen, die sie noch nicht kannten. Allerdings waren sie so scheu, dass sie es nicht wagten, sich ihnen zu nähern. Erst als Léon sie zu sich rief, kamen sie angelaufen. Von Nahem betrachtet, wirkten die Kinder keineswegs so unbekümmert, wie ihr Lachen hätte vermuten lassen. Marguérite gingen sofort der kleine Samuel und seine beiden Schwestern durch den Kopf. Sie wurde sehr traurig.
Schon bald hatten sich Marguérite und Léa an ihr neues Leben gewöhnt. Die Tage waren anstrengend, aber auch erfüllt von vielen Aufgaben, die sie forderten. Während Léa sich als geschickte Hauswirtschafterin entpuppte, kümmerte sich Marguérite hauptsächlich um die Betreuung der jüngeren Kinder. Sie fassten sofort Zutrauen zu ihr und suchten oft Trost bei ihr, den sie ihnen gab, so gut sie konnte. In ihrer Gesellschaft fühlte sich Marguérite aufgehoben und gebraucht, ein Gefühl, das sie schon lange nicht mehr gehabt hatte. Sie brachte den Kleinen Kinderreime und einfache Kreisspiele bei. Manchmal bastelten sie mit Naturmaterialien, die sie selbst gesammelt hatten, aber am liebsten ging sie bei schönem Wetter mit ihnen an die frische Luft. Sie erkundeten die Umgebung und sangen gemeinsam Lieder.
Um die älteren Kinder und Jugendlichen kümmerte sich meist Léon Reifmann, aber auch Philippe Dehan, der Koch. Marguérite lernte ihn als nachdenklichen jungen Mann kennen, der gern tüftelte. So baute der Koch für die älteren Jungen eine Laterna magica und ermunterte sie, auf Papierstreifen ihre eigenen Kinofilme zu gestalten. Besonders an Regentagen malten die jungen Künstler unermüdlich an Filmsequenzen über Tarzan und die Musketiere, die Jagd eines Gendarmen nach einem Räuber oder eine schöne Südseetänzerin. Nach dem Abendessen gab es dann regelmäßig kleine Kinoaufführungen, die alle begeisterten.
Miron Zlatin kümmerte sich Tag und Nacht um die täglichen Dinge. Er wandte sich an den Secours National, der sie mit notwendigen Decken, Matratzen und Möbeln versorgte. Dabei wurde er von der Sekretärin des Unterpräfekten unterstützt. Über Madame Cojean bekamen sie Nahrungsmittelkarten, die ihnen Fleisch, Gemüse und Käse bescherten. Auch ihr Nachbar, der Bauer Perticoz, ließ den Kindern immer wieder Essbares zukommen, vor allem dann, wenn Miron nicht genügend Geld auftreiben konnte. Sein Knecht Julien spielte mit den Jungen gern Fußball oder tobte mit den jüngeren Kindern über die Wiese, bis sie vor Lachen Bauchweh bekamen. An den wirklich lebensnotwendigen Dingen mangelte es selten, auch wenn es ihnen oft an ausreichender Kleidung oder passenden Schuhen fehlte. Um für den Kleidungsmangel Abhilfe zu schaffen, machte sich Miron mit Léon auf und bat in der Nachbarschaft um Spenden. Die Bauern mochten zwar Eigenbrötler sein, aber sie zeigten auch ein Herz für die Kinder. Viele gaben gern ab, was sie entbehren konnten.
Weder sie noch die Leute aus dem Dorf wussten, dass sich in Lélinaz jüdische Kinder aufhielten. In der offiziellen Version handelte es sich um Waisenkinder aus ganz Frankreich. Dazu mussten einige Vorkehrungen getroffen werden. Den Kindern mit allzu deutsch klingenden Namen wurden neue gegeben. Aus Arnold Hirsch wurde Jean-Paul Barreau, aus Fritz Loebmann ein François Lauban, aus Otto Wertheimer ein Octave Wermet und aus Egon Gamiel der Edmont Gamiel. Diese Jungen waren schon etwas älter und kamen häufiger mit der übrigen Bevölkerung in Kontakt.
Als die erste Heumahd bevorstand, arrangierte Miron, dass sie sich bei den Bauern als Hilfskräfte verdingen konnten. Im Austausch dafür gab es dringend benötigte Lebensmittel. Die Jungen schufteten bis zum Umfallen und waren heilfroh, wenn die anstrengende Arbeit auf den Feldern am Abend vorüber war. Nur François, der in Deutschland auf einem Bauernhof aufgewachsen war, liebte die Beschäftigung in der freien Natur. Als es darum ging, dass die schulpflichtigen Kinder demnächst unterrichtet werden sollten, bat er Miron inständig, doch weiter bei einem Bauern als Knecht arbeiten zu dürfen.
»Ich bekomm ohnehin keine Zahlen und Buchstaben in meinen Kopf. Dafür habe ich Kraft für zwei«, flehte er so inständig, dass Miron sich breitschlagen ließ.
Er versprach ihm, sich umzuhören. Doch ihr Nachbar Perticoz hatte bereits einen Knecht, andere Bauern in der Umgebung hatten genügend eigene Kinder oder konnten sich keine zusätzliche Hilfskraft leisten. Nach langem Suchen fand er schließlich einen Bauern, der ein paar Kilometer entfernt von ihnen seinen Hof hatte. Allerdings war sein Ruf nicht besonders gut. Lucien Bourdon stammte ursprünglich aus Lothringen und galt als selbstgefälliger Eigenbrötler. Keiner arbeitete gern für ihn, da er trank und dann gewalttätig wurde. Er bot sich an, den Jungen zu nehmen, wenn er auf seinen Lohn verzichtete.
»Gebt mir den Jungen, und ihr habt einen Esser weniger«, war Bourdons Angebot. »Er kann bei mir eine Menge lernen und wird euch nicht länger auf die Nerven gehen!«
Miron zögerte mit seiner Zusage. Es gefiel ihm nicht, wie der Junge ausgenutzt werden sollte. Schließlich gab Bourdon nach und versprach, einmal im Monat etwas Gemüse und Kartoffeln vorbeizubringen. Miron zierte sich immer noch, doch François, den die Aussicht, die Schulbank drücken zu müssen, mehr schreckte als die harte Arbeit, bedrängte ihn so lange, bis er schließlich nachgab.
»Du kannst jederzeit aufhören und wieder zu uns zurückkommen«, erinnerte der Heimleiter ihn, bevor er endlich einwilligte.
An dem Tag, als Lucien Bourdon den Jungen persönlich abholte, traf Marguérite zum ersten Mal auf ihn. Sie spielte gerade mit einigen Kindern Blinde Kuh, als er mit seinem Pferdefuhrwerk neben ihnen zu stehen kam und sie anglotzte wie eine preisgekrönte Milchkuh. Marguérite wurde erst darauf aufmerksam, als die Kinder ihr Spiel unterbrachen und zu kichern begannen. Sein abschätzender Blick hatte etwas an sich, das ihr die Schamesröte ins Gesicht trieb.
»Kann ich Ihnen helfen?«, erkundigte sie sich knapp.
Bourdons Kleidung strotzte vor Schmutz, der Gestank zog bis zu ihr herüber. Sein brauner Hals verriet, dass er sich schon einige Zeit nicht mehr gewaschen hatte. Ungeachtet ihres unfreundlichen Tons, stieg er vom Kutschbock und baute sich vor ihr auf.
»Bist wohl die Neue hier?« Seine Stimme klang reichlich selbstgefällig. »Hab dich schon ein paarmal mit den Gören auf den Wiesen in der Nähe meines Hofs gesehen.«
»Das mag sein«, entgegnete sie reserviert. »Was wünschen Sie?«
»Bin hier, um mir von euch meinen neuen Knecht abzuholen«, verkündete er wichtigtuerisch. »Mir gehört der Hof im nächsten Tal. Einer eurer Bengel wird dort für mich arbeiten. Sieben Kühe und acht Schweine. Dazu zwei Hektar Wiesen und genügend Wald, um ein wenig Holz zu verkaufen. Ich bin also kein armer Schluckspecht.«
»Monsieur Zlatin und François erwarten Sie schon. Sie sind hinter der Scheune im Garten«, teilte sie ihm mit und hoffte, dass er endlich verschwand.
»Das hat Zeit«, verkündete Bourdon und versuchte ein Lächeln. »Bist ein hübsches Ding. Kannst übrigens ruhig Lucien zu mir sagen«, meinte er anzüglich. »Wir sind hier in der Gegend nicht so förmlich. Und wie heißt du?«
»Marguérite«, antwortete sie widerwillig und wandte sich von ihm ab. »Ich muss mich jetzt wieder um die Kinder kümmern.«
Bourdon lachte nur. »Die Gören können ja wohl mal warten, wenn sich zwei so Hübsche wie wir hier unterhalten, oder?« Er zwinkerte ihr zu und trat noch einen Schritt näher auf sie zu. »Du gefällst mir! Das sag ich übrigens nicht zu jeder, die daherkommt.«
Marguérite schäumte bereits innerlich vor Wut und hätte dem aufdringlichen Typen am liebsten so richtig die Meinung gesagt. Doch sie wollte keinen Streit vom Zaun brechen, um nicht seinen Unmut auf die Kolonie zu ziehen. Deshalb beschloss sie, ihn einfach stehen zu lassen.
»Kommt, Kinder, wir gehen jetzt runter zum Bach«, ordnete sie an und ging davon, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Sie hörte, wie Bourdon amüsiert auflachte. »Wir sehen uns wieder, kleine Wildkatze!«, rief er ihr hinterher.
Sie hoffte von Herzen, dass ihr das erspart blieb.
Nur zwei Tage später tauchte Bourdon wieder bei ihnen im Weiler auf. Marguérite half gerade Léa beim Wäschewaschen. Dieses Mal hatte sich der Bauer ordentlich zurechtgemacht. Er trug ein sauberes Hemd und eine ungeflickte Hose. Außerdem hatte er sich gewaschen und rasiert. In seinen klobigen Händen hielt er einen dürftigen Blumenstrauß, den er ihr in die Hände drückte, noch ehe sie sich die Seifenlauge an ihrer Schürze hatte abtrocknen können. Ohne den Strauß eines Blickes zu würdigen, legte sie ihn auf dem Brunnenrand ab und sah ihn empört an.
»Was soll das?«
»Ich möchte dir den Hof machen. Das merkt man doch wohl«, erklärte Bourdon prompt. Ihm schien gar nicht in den Sinn zu kommen, dass ihr das unangenehm war. »Außerdem möchte ich, dass du mich zum Scheunenfest im September begleitest«, fuhr er fort, ohne ihr die Gelegenheit zu geben, darauf zu reagieren. Léa warf ihr einen amüsierten Blick zu. Marguérite hatte ihrer Freundin bereits von dem aufdringlichen Bauern erzählt. »Oder hast du etwa schon einen Verlobten?«
»Nein, das habe ich nicht«, platzte es aus Marguérite empört hervor.
»Dann ist ja alles klar! Dann sind wir verabredet!«
Léa begann zu kichern, was Marguérite nur noch mehr ärgerte.
»Moment mal! Ich hab nicht gesagt, dass ich mir Zeit nehmen kann«, protestierte sie wütend.
»Dafür sorge ich schon! Ich rede mit Zlatin.«
Lucien nickte den beiden Frauen zu und marschierte in Richtung Haus davon.
»Puh, in dem hast du aber einen hartnäckigen Verehrer …« Léa prustete los.
»Der soll mich bloß in Ruhe lassen«, erwiderte Marguérite und schnaubte. »Der bildet sich ja weiß Gott was ein.«
»Die Mädchen in der Gegend stehen angeblich auf Lucien«, zog Léa sie weiter auf. »Du solltest dich glücklich schätzen, dass er dich auserwählt hat. Ich an deiner Stelle würde mir sein Angebot noch einmal überlegen.«
»Da trete ich lieber ins Kloster ein, bevor ich mit diesem Lucien zum Tanzen gehe.«