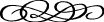
Massif de la Chartreuse, Frankreich, April 1944
Ohne sich umzudrehen, hastete Marguérite durch das Gebüsch talwärts. Auch als sie den Weiler Lélinaz schon ein gutes Stück hinter sich gelassen hatte und sich dem Dorf näherte, verlangsamte sie ihre Schritte nicht. Wie Antoine es ihr geraten hatte, machte sie um Brégnier-Cordon einen großen Bogen. Ihre Ausdauer war nicht besonders gut, nicht nur wegen der Mangelernährung der letzten Monate, sondern vor allem durch die Tatsache, dass ihr Körper nun zwei Leben zu versorgen hatte. Rennen, du musst rennen, sagte ihr Verstand, doch die Füße wurden immer schwerer, und ihr Atem glich nur noch einem rasselnden Keuchen. Das unebene Gelände machte das Vorankommen nicht leichter. Ihre Schuhe waren durchgelaufen und kaum für einen Gewaltmarsch geeignet.
Endlich erreichte sie die Straße, die an der Rhône entlangführte. Auf ihr gab es außer lichtem Gebüsch keinerlei Versteckmöglichkeiten, und doch war sie gezwungen, ihr zu folgen, bis sie an eine Brücke kam, weil sie auf die andere Flussseite musste. Sobald ihr das gelungen war, musste sie sich südlich halten, bis sie die Berge erreichte. Jedes Mal, wenn sich ein Fuhrwerk oder ein Automobil näherte, kauerte sie sich in das spärliche Gebüsch und hoffte, dass sie unbemerkt blieb. Sie durfte auf keinen Fall riskieren, einem Gendarmen oder gar einem Posten der Miliz in die Hände zu laufen, da sie keine Ausweispapiere bei sich trug.
Nach einer quälend langen Stunde Fußmarsch erreichte sie endlich eine Brücke. Sie überlegte, wie sie sie am besten überqueren könnte. Es gab keinen Sichtschutz, und die Brücke war bestimmt gute hundert Meter lang. Falls ein Militärfahrzeug kam, war sie ihm schutzlos ausgeliefert. Sie lauschte in ihrer Deckung nach Geräuschen, und als sie nichts hörte, wagte sie sich heraus. Die Brücke war noch länger, als sie gedacht hatte, und ihr fehlte die Kraft zu rennen, denn ihre Füße waren bereits wund und zeigten die ersten blutigen Blasen. Sie hatte schon mehr als die Hälfte geschafft, als sie aus der Ferne Motorengeräusche hörte. Der Weg zurück zu dem Gebüsch, in dem sie sich verborgen hatte, war zu weit. Ihr blieb nichts anderes übrig, als zu versuchen, die Brücke so schnell wie möglich hinter sich zu lassen. Doch am anderen Ende erwarteten sie außer ein paar Büschen nur Äcker und Wiesen, die keinerlei Schutz boten.
Ungeachtet ihrer schmerzenden Füße, beschleunigte Marguérite ihr Tempo. Jeder Schritt war eine Qual, das Blut sickerte bereits durch ihre Strümpfe. Doch die Furcht vor den Milizionären oder der Gestapo war viel größer als der Schmerz. Sie konnte die Wagen bereits in der Ferne sehen. Wie sie befürchtet hatte, waren es Militärfahrzeuge, gleich eine ganze Kolonne. Allein die Vorstellung lähmte sie, genau wie die Schuldgefühle darüber, dass sie die Kleinen dem Schicksal überlassen hatte.
Ihre Schritte wurden langsamer. Vielleicht war es ja das Beste, einfach aufzugeben. Was hatte sie schon für eine Chance? Der Abstand bis zur rettenden Böschung wollte einfach nicht kleiner werden. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis einer der Fahrer sie erblickte. Doch dann spürte sie eine sanfte Regung in ihrem Bauch. Es war nicht mehr als ein kleiner Tritt und doch so real und Hoffnung spendend, dass sie neuen Mut schöpfte. Mit einem Mal fiel es ihr beinahe leicht, alle Kräfte zu bündeln und schneller zu gehen, bis sie schließlich wieder rannte. Die Kolonne war vielleicht noch zweihundert Meter von ihr entfernt, als sie endlich die schützende Böschung erreichte und sie rasch hinunterkraxelte, um sich unter der Brücke zu verbergen.
Allerdings hatte sie nicht damit gerechnet, wie steil der Abhang zum Fluss abfiel. Sie verlor den Halt und rutschte ab. Erst als ihr Körper schon halb im Wasser lag, gelang es ihr, sich an einem Busch festzuhalten. Das Wasser war eisig, und die Strömung zerrte an ihr. Bibbernd vor Kälte verharrte sie in dieser Position. Im nächsten Moment hörte sie, wie die Lastwagen zum Halten kamen. Das konnte nur bedeuten, dass man sie entdeckt hatte. Kurz darauf brüllte jemand auf Deutsch einen unverständlichen Befehl. Das einzige Wort, das sie verstehen konnte, lautete: »Absuchen!«
Sie versuchten, sie aufzuspüren.
Marguérite stockte der Atem. Sie vergaß fast, wie schrecklich kalt ihr war. Durch das Gestrüpp sah sie einen Soldaten mit einem Gewehr im Anschlag an die Böschung treten. In nur wenigen Sekunden würde er sie entdecken und auf sie schießen. Sie schloss die Augen und ergab sich ihrem Schicksal.
»Keinen Sprengstoff gefunden, Herr Hauptmann«, hörte sie ihn plötzlich rufen und dann: »Einsteigen!«
Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Vorsichtig öffnete sie die Augen und sah, wie der Soldat wieder verschwand. Einen Moment später ratterten die Lastwagen über die Brücke. Sie hatten nicht nach ihr gesucht, sondern Angst vor einem Anschlag des Maquis gehabt. Noch nie war sie ihrem Schicksal so dankbar gewesen wie in diesem Augenblick.
Sobald sie sich sicher sein konnte, dass der Konvoi verschwunden war, machte sie sich daran, sich aus ihrer Falle zu befreien. Doch das war leichter gesagt als getan. Sie spürte ihre Beine kaum noch vor Eiseskälte, ganz zu schweigen von der nachlassenden Kraft ihrer Arme. Nur mit großer Mühe gelang es ihr, wieder an Land zu kriechen. Sie hatte Glück, dass die Sonne schien. Obwohl es erst Anfang April war, wärmten ihre Strahlen. Nach und nach spürte sie, wie das Blut in ihren Beinen wieder zu zirkulieren begann, auch wenn das mit einem schmerzhaften Kribbeln verbunden war. Sie dachte an ihr Kind und hoffte, dass es von all den Ängsten und Qualen nichts mitbekam. Schließlich hatte sie genügend Kräfte, um sich Stück für Stück nach oben zu kämpfen.
Die nächste Herausforderung war, die Äcker und Wiesen schnell hinter sich zu bringen. In weiter Ferne lag ein größeres Waldstück, das bereits in die Berge der Chartreuse überging. Irgendwo dahinter lag Grenoble. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie bis dorthin brauchen würde. Aber war es nicht müßig, darüber nachzudenken? Sie beschloss, sich bei ihrem Marsch an die Ackerraine zu halten, denn sie waren von Buschwerk gesäumt. Auch wenn es ein Umweg war, war sie dort vor unliebsamen Blicken viel besser geschützt.
Tapfer kämpfte sie sich voran. Das unfreiwillige Bad hatte immerhin den Vorteil gehabt, dass ihre von Blasen geplagten Füße nicht mehr ganz so sehr schmerzten. Schritt für Schritt quälte sie sich weiter. Die unablässige Anstrengung bewirkte, dass ihre Gedanken bald genauso träge wurden wie ihre Schritte. Sie hatte nur ein Ziel im Kopf. Sie wollte vor Einbruch der Dunkelheit das Waldstück erreichen, um sich dort einen Platz zu suchen, wo sie die Nacht verbringen konnte. Erst leise, dann immer fordernder stellte sich der Hunger als neuer Begleiter ein. Er war ihr zwar schon seit Langem ein wohlbekannter Vertrauter, doch nun machte er sich mit einem bissigen Grimmen bemerkbar. Sie hatte seit vierundzwanzig Stunden nichts mehr gegessen. Außerdem quälte sie ein brennender Durst.
Marguérite vermutete, dass sie bereits sechs Stunden oder mehr unterwegs war – die Sonne hatte ihren Höhepunkt schon überschritten. Antoine hatte ihr gesagt, dass sie für den Weg nach Grenoble mehrere Tage benötigte. Doch wie sollte sie das ohne Verpflegung schaffen? Sie bereute, dass sie am Fluss nichts getrunken hatte. Ob sie es wagen konnte, an einem der Bauernhöfe in der Umgebung um etwas Wasser zu bitten? Sie verwarf die Idee sofort wieder, denn in Zeiten wie diesen konnte man den Menschen nicht einfach vertrauen.
Gegen Abend, als die Sonne bereits hinter den Bergen verschwunden war, erreichte sie endlich den Beginn des Waldes. Von dort führte ein schmaler Pfad in steilen Windungen nach oben. Antoine hatte ihr geraten, so weit zu laufen, bis sie an eine der Schutzhütten auf den Almwiesen kam, die die Bauern im Sommer bewirtschafteten. Sie waren meist unverschlossen und für jedermann zugänglich. Doch dazu musste sie erst einmal den Berg hinaufsteigen. Diese Herausforderung schien ihr mit einem Mal unmöglich. Ihre Kräfte waren aufgezehrt. Jetzt, da die Sonne weg war, bekam sie auch wieder die Kälte zu spüren. Ihre Kleidung war immer noch klamm, und sie hatte keine Ahnung, wie sie darin die Nacht überstehen sollte. Unfähig, auch nur einen Schritt weiterzugehen, suchte sie unter einer großen Tanne Schutz. Sie kauerte sich zwischen ihre mächtigen Wurzeln und schlief vor Erschöpfung sofort ein.
Als sie ein paar Stunden später erwachte, war es tiefe Nacht. Sie hörte den Ruf eines Waldkauzes und das Knacken von Zweigen ganz in ihrer Nähe. Durch das Geäst der Bäume drang fahles Mondlicht in den Wald. Es war immerhin hell genug, um ihr ein weiteres Stück den Weg zu weisen. Marguérite rappelte sich hoch und machte sich an den Aufstieg. Der Schlaf hatte ihr gutgetan, auch wenn der Hunger sich sofort wieder meldete. Vielleicht finde ich dort oben ja ein Stück Käse, das die Bauern im Sommer vergessen haben, redete sie sich ein. Der Gedanke an Essen verlieh ihr tatsächlich neue Kraft. Gleichzeitig musste sie an Antoine denken. Wie es ihm wohl ergangen war? Sie versuchte, sich einzureden, dass ihm die Leute der Gestapo tatsächlich seine Geschichte abgekauft hatten. Andernfalls hätte es doch sicherlich einen Tumult oder gar eine Schießerei gegeben, aber sie hatte nichts gehört. Warum nur war Antoine nicht mit ihr gekommen? Würde er wirklich versuchen, die Kinder zu retten, oder …?
Marguérite schob ihre Zweifel energisch beiseite. Sie würden es beide schaffen – für ihr gemeinsames Kind und ihre Zukunft!
Sie lief die ganze Nacht durch. Einmal kam sie an einen kleinen Bach, an dem sie ihren Durst gierig stillte. Die unterschiedlichen Geräusche der Waldtiere, die sie anfangs noch erschreckt hatten, wurden ihr schon bald vertraut. Trotz des versteckten Lebens herrschte im Wald eine Friedlichkeit, die sich wohltuend auf ihre Seele legte. In der Morgendämmerung zog Nebel auf. Sie befand sich schon ziemlich weit oben in den Bergen, hatte aber keine Ahnung, ob die Richtung, die sie eingeschlagen hatte, die richtige war. Außerdem fühlte sie erneut eine große, bleierne Müdigkeit, die jeden ihrer Schritte schwerer werden ließ. Sie kam nur noch langsam und schleppend voran.
Seit einer geraumen Weile wurde ihr abwechselnd heiß und kalt, als hätte sie Fieber. Sie versuchte, es zu ignorieren, einen klaren Gedanken zu fassen. Es gelang ihr nicht.
Als sie auf eine höher gelegene Almwiese kam, fühlte sie sich so matt, dass sie sich einfach an einem großen Stein niedersacken ließ. Von wirren Träumen begleitet, fiel sie in einen unruhigen Schlaf. Noch einmal hörte sie das gellende Schreien von Mina, als sie von ihrer Schwester getrennt und wie ein Sack Kartoffeln auf die Ladefläche geworfen wurde. Sie beobachtete, wie einer der Soldaten Miron Zlatin zusammenschlug, und sah Léon Reifmann durch das Gebüsch rennen. Und plötzlich waren die Schergen auch bei ihr und Antoine. Sie waren aus dem Hinterhalt gekommen und hatten sie gepackt. Antoine versuchte, sie zu befreien, und stürzte sich auf einen der bewaffneten Männer, um ihn von ihr wegzuziehen. Sie wehrte sich, doch die Hände des Mannes legten sich wie Schraubstöcke um sie. Dann hörte sie einen Schuss und sah, wie eine Kugel Antoines Gesicht zerfetzte.
Marguérite erwachte von ihrem eigenen Entsetzensschrei, nur um sofort wieder in den Abgründen ihrer Fieberfantasien zu versinken. Sie merkte nicht, wie sich der Nebel verzog und Sonnenstrahlen ihren geschundenen Körper beschienen. Als grobe Hände nach ihren Schultern fassten, erwachte sie noch einmal. Sie versuchte vergeblich, sich zu wehren, und versank erneut in Bewusstlosigkeit.