41
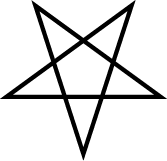
Am Nachmittag des vierten Tages erwachte sie mit riesigem Hunger und Durst. Kenway hatte in einem Rollstuhl die ganze Zeit neben ihr gesessen und ihr so viel Flüssigkeit wie möglich eingeflößt, meistens, indem er ein in Wasser getränktes Tuch in ihrem Mund ausdrückte. Isabella, die Krankenschwester war, hatte eine Kochsalzlösung mitgebracht und hielt eine Infusionsflasche in der Hand, als Robin die Augen aufschlug.
Sie hatte Hunger, und sie war erleichtert darüber, wie normal der Hunger war. Wie menschlich. Hunger auf Burritos, Chow Mein, Hamburger, Pizza und nicht auf komplette Zivilisationen. Diese dämonische Gier zu zerstören und zu verschlingen war weg.
»Guten Nachmittag, Rip Van Winkle«, sagte Kenway und lächelte.
Hinter ihm lief der Fernseher, und Frauen schrien sich in gedämpfter Lautstärke an. Robin lag auf dem Sofa. Den Tisch hatten sie vor das Entertainment-Center geschoben, damit Kenway Platz für seinen Rollstuhl hatte.
»Nachmittag?« Sie blinzelte. »Wie lange habe ich geschlafen?«
»Fast vier Tage.«
»Wow.«
Sie nahm sich selbst unter die Lupe. In der Zwischenzeit hatte sich an ihrer Erscheinung nichts geändert; vollkommen menschlich waren ihre Beine, ihr rechter Arm, die rechte Schulter und der Kopf; der linke Arm und der Torso steckten immer noch in diesem chitinartigen schwarzen Exoskelett.
»Verdammt.« Ihr Magen knurrte.
»Was?«
»Ich hatte gehofft, der Kram wäre verschwunden«, sagte sie und klappte Daumen und Finger der linken Hand aneinander, dass es wie Kastagnetten klang. Ihre linke Hand sah aus wie ein Handschuh mit segmentierten Fingern. Über ihre Knöchel zog sich ein zerfurchter Grat.
»Das bekommen wir schon wieder hin«, sagte Kenway. »Wir kriegen das hin, Baby. Wir finden eine andere Transfigurationsreliquie und du machst da weiter, wo du aufgehört hast.«
»Vermutlich.«
»Jetzt, nachdem Sie wach sind, brauchen Sie das wohl nicht mehr«, sagte Isabella und hielt die Infusionsnadel und die Lösung in die Luft. »Hört sich an, als wären Sie hungrig. Vom Mittagessen sollte noch was übrig sein, wenn Sie möchten.«
»Ja, bitte.«
»Gut, dass du aufgewacht bist«, sagte Kenway. »Sie findet keine Vene bei dir, deshalb wollte ich die Salzlösung schon andersherum verabreichen …«
»Mit Schlauch durch die Nase?«
»Äh, nein, anal.«
»Du wolltest mir Salzwasser in den Hintern pumpen?«
»Notfall-Hydrierungstechnik. Das bringen sie jedem Kampfsanitäter von hier bis Timbuktu bei. Wenn etwas bescheuert klingt, aber funktioniert«, sagte er und drehte den Rollstuhl herum, »ist es nicht bescheuert.«
»Was für eine wunderbare Art, einen langen, harten Tag ausklingen zu lassen. Mit einem Arsch voll Meerwasser.« Robin schob sich hoch und saß dann benommen mit den Händen an der Stirn da, lauschte der Telenovela und verstand nur jedes dritte Wort. Sie spürte die Carbon-Dorne, die aus ihrer Stirn ragten, zwischen den Fingern.
»Noch nicht wieder fit?«, fragte Kenway.
»Geht so.«
Obwohl die Sonne nur schwach durch die Jalousien hereinschien, war ihr das Zimmer zu hell. Elisas und Isabellas Wohnzimmer war sehr gemütlich, holzverkleidet und voller Kitschfiguren und religiösem Krimskrams. »Ach, Mist«, sagte sie und starrte auf ein grelles Porträt der Jungfrau Maria. »Was denken die darüber, dass jetzt ein Dämon mit Hörnern auf ihrer Couch schläft?«
»Elisa war kaum hier. Sie hilft Navathe, Gendreau und Rook, unsere Sachen aus dem Winnebago zu bergen. Ich lasse ihn zu Jakes Werkstatt schleppen und verkaufe ihn als Schrott. Tja, Isabella, sie ist wirklich sehr freundlich, hält sich aber nicht sehr gern in deiner Nähe auf.«
»Tut mir echt leid wegen deines Wohnmobils.«
»Unsres Wohnmobils.« Kenway drückte ihre linke Hand. Sie spürte es kaum durch den Carbonpanzer.
»Ja, aber du hast es für mich gekauft.«
»So ist das Leben.« Er zuckte mit den Schultern.
»Ja, so ist es.« Sie rieb sich das Gesicht und verzog den Mund. »Besonders mein Leben. Und jetzt, da wir zusammen sind, könnte es auch für dein Leben gelten.« Robin sah ihm in die Augen. »Du bist beinahe draufgegangen. In dem Clubhouse. Meinetwegen.«
»Bin ich aber nicht.«
»Aber fast. Ich habe es jedenfalls geglaubt.«
»Bin ich aber nicht.«
Sie seufzte verzweifelt und starrte ihm in die Augen.
»So ist das Leben«, wiederholte er.
Sie stand auf und reckte sich, wobei ihr Rücken zufrieden knackte. »Hast du schon gegessen?«, fragte sie, drehte den Rollstuhl um und schob Kenway vor sich her in die Küche.
»Nein, heute noch nicht.«
Sie zog einen Stuhl vom Tisch weg, stellte Kenways Rollstuhl an der Kante ab und setzte sich ihm gegenüber an die Ecke. Ihr gepanzerter Rücken klapperte an die Lehne des Holzstuhls, und bei dem Geräusch zuckte Isabella leicht zusammen, sagte jedoch nichts, während sie Teller mit lauwarmen Spagetti und Knoblauchbrot vor ihnen abstellte.
»Danke. Für alles.« Robin nahm sich ihr Essen. »Weil ich mich hier fast eine Woche einnisten durfte. Und weil … weil Sie nicht sauer auf mich sind wegen der Sache mit Santiago.«
»Meinetwegen brauchen Sie sich da keine Gedanken zu machen«, sagte Isabella und zeigte auf den gelben Ring um ihr Auge, wo ihr Schwager ihr ins Gesicht geschlagen hatte. »Er war ein Arschloch. Ob er den Tod verdient hat, weiß ich nicht, aber anständige Prügel hatte er mindestens verdient. Die Sache hat so geendet, wie sie enden musste.« Ihre harte Miene wurde milder. »Was ist da draußen passiert?«
»Das Ding in diesem Motorrad hat ihn in etwas verwandelt, das keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen hatte«, sagte Robin. »Ich weiß nicht, ob er später wieder zum Menschen geworden wäre. Er hatte ja schon eine Schraube locker, glaube ich, aber La Reina hat ihm alle Schrauben rausgedreht und dann noch seine Batterien verkehrt herum eingesetzt.«
»Elisa«, sagte Isabella, »wird es vielleicht nicht so einfach wegstecken. Immerhin war er ihr Bruder. Ich weiß nicht, was sie fühlt.«
Robin war geknickt.
»Carly habe ich in letzter Zeit kaum gesehen. Sie ist gleich am nächsten Tag wieder zur Schule gegangen, aber ich habe das nicht für eine gute Idee gehalten. Sie kommt danach nicht nach Hause. Sie geht auch mit den anderen Kids nicht zur Mall. Ich glaube, eigentlich mag sie die Mall nicht, sie bringt sie vielleicht mit ihrem Vater in Verbindung. Marina hat sich immer mit ihr in der Mall verkrochen, wissen Sie, wenn Santiago …« Isabella unterbrach sich und ging zum Kühlschrank. »Was möchten Sie trinken? Sprite, Tee, Dr. Pepper …«
»Ich nehme eine Dr. Pepper«, sagte Robin und wickelte Spagetti um ihre Gabel.
Sobald sie den ersten Bissen im Mund hatte, gab es kein Halten mehr. Sie schlang es herunter, als würde es kein Morgen geben, Gabel in der einen, Knoblauchbrot in der anderen Hand. Isabella setzte sich ihr gegenüber und aß ein Schälchen Eiskrem.
Sah aus wie Fudge Ripple. Von Zeit zu Zeit erwischte Robin sie dabei, wie sie auf ihre Hörner starrte.
»Wie geht es ihr?«
»Marina?« Isabella seufzte. »Sie ist ruhig. Gleichmütig, könnte man sagen. Schon komisch.«
»Sie weiß jetzt, was auf der anderen Seite ist.«
»Sozusagen. Viel hat sie nicht erzählt. Es sei schön gewesen. Sie habe jetzt keine Angst mehr vor dem Tod.« Isabella hörte auf zu essen und starrte in das Schälchen. »Ehrlich gesagt ist es ein bisschen gruselig.«
»Sie sagt aber nicht, dass sie wieder tot sein will«, betonte Robin.
»Ich weiß.«
Ein Wagen bog in die Einfahrt ein, der Kies knirschte. Kurz darauf kamen Gendreau, Navathe, Rook und Elisa durch die Tür vom Carport herein.
»Miss Martine!«, rief der Curandeiro und umarmte Robin. »Sie sind wach!«
»Ich bin wach.« Sie drückte ihn mit ihrem menschlichen Arm.
»Wir haben so gut wie alles aus dem Winnebago rausgeholt«, sagte Navathe und hielt Walmart-Tüten in die Höhe, die offensichtlich Toilettenartikel und Kameraausrüstung enthielten. »Ein Bundespolizist ist vorbeigekommen und hat uns ein bisschen geholfen. Wir haben ihm die noch brauchbaren Konserven für ein Obdachlosenheim in Lockwood mitgegeben. Jake schleppt den Winnebago in seine Werkstatt und verschrottet ihn.«
»Was hat der Polizist wegen der Überreste von Tuco auf der Vorderseite gesagt? Wegen dem Blut und so?«
»Wir haben ihm erzählt, wir wären mit einem Hirsch zusammengekracht.«
»Was hat er dazu gesagt?«
»Muss ja ein ziemlich großer Hirsch gewesen sein!«
»Glücklicherweise hat er nicht gefragt, wohin der Hirsch verschwunden ist«, sagte Kenway.
»Nein, und wir hatten die Schwerter und die Schusswaffen schon am Tag zuvor rausgeholt«, sagte Gendreau. »Ich glaube, die Waffen sind nicht zu hundert Prozent legal.«
Die Carporttür ging erneut auf. Carly trat ein. Sie hatte die Schultasche über die Schulter geschlungen. Sobald sie die Versammlung in der Küche sah, stutzte sie. Ihr Blick wanderte über die Gesichter.
»Was denn?«, fragte sie kalt.
Elisa sah auf die Wanduhr. »Es ist Viertel vor zwei, Schatz. Die Schule geht bis drei. Warum bist du so früh zurück?«
»Mir geht es nicht gut.«
»Dir geht es nicht gut?« Elisa wirkte alarmiert. »Was hast du denn?«
»Nichts, für das sich irgendwer von euch auch nur einen Scheiß interessiert«, sagte Carly und blickte noch einmal wütend in die Runde.
»Carlita!«, rief Isabella.
Das Mädchen marschierte aus dem Raum. Sekunden später knallte die Tür des Gästezimmers zu.
Alle verstummten und suchten in den Gesichtern der anderen still nach Antworten oder vielleicht der Erlaubnis, wieder sprechen zu dürfen. »Sie ist ganz durcheinander wegen ihrer Eltern«, sagte Robin, die ein schlechtes Gefühl im Bauch hatte.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll.« Elisa spielte mit dem Wachsobst in der Mitte von Isabellas Tisch herum. »Ich kenne mich mit Teenagern nicht aus und schon gar nicht mit solchen, die gerade einen Elternteil verloren haben, während der andere Teil kurz davor steht, ins Kloster zu gehen.«
»Besonders, wenn diejenige, die den Vater umgebracht hat, in der Küche sitzt und Spagetti isst«, fügte Robin hinzu. So hungrig sie war, hatte sie doch plötzlich den Appetit verloren. Sie stand auf. »Wo ist sie?«
»Marina?«, fragte Isabella.
Robin nickte.
»Draußen.«
Verbranntes Gras und hartgebackene Erde knirschten unter Robins Füßen, als sie nach draußen ging und die Fliegengittertür hinter sich zumachte. Isabellas Garten war nicht gerade groß, aber da sich weiter nichts darin befand und die texanische Sonne gnadenlos vom Himmel brannte, wirkte er geräumig. Vertrocknete Gerippe ragten an einer Seite aus mit Steinen gesäumten Beeten.
Im Schatten einer Wüstenweide saß Marina Valenzuela auf einem altersschwachen Gartenstuhl. In einer Hand schwitzte ein halbes Glas Limonade. Ohne Sonnenbrille blinzelte sie in den grellen Himmel.
»Hey«, sagte Robin und ging zu ihr.
»Buen día«, sagte Marina.
»Heißer Tag.«
Keine Antwort. Carlys Mutter starrte auf die Rückseite des Hauses oder vielleicht auch ins Leere. Robin ließ sich neben ihr ins stachelige braune Gras sinken. Gelegentlich räusperte sich Marina, seufzte oder schloss kurz die Augen, aber die meiste Zeit starrte sie einfach in die Luft.
Für Robin sah das nach Schock aus. »Alles so weit okay?«
»Klar«, erwiderte Marina eher kraftlos.
»Es tut mir leid.«
»Was?«
Diesmal hatte Robin keine Antwort.
»Sie haben getan, was Sie Ihrer Meinung nach tun mussten«, sagte Marina. »Sie hatten recht. Sie haben mir und meiner Tochter ein Versprechen gegeben. Mich hierher zurückzuholen war die einzige Möglichkeit, es einzuhalten.«
»Sie …«
»Ja.« Marina nippte an der Limonade. Eis klirrte im Glas. »Sie braucht mich. Ich weiß. Deshalb bin ich hier.«
Nicht gerade überzeugend, dachte Robin und blickte sie von der Seite her an. Unwillkürlich fühlte sie sich schuldig, weil die Frau so abdriftete. War es tatsächlich notwendig gewesen, sie aus der Matrix-Kapsel ihres persönlichen Paradieses zu zerren und in diese heiße, dumme, ungerechte Welt zurückzuholen?
Ja, das war es. Marina war vor ihrer Zeit gestorben. Ihr Parkschein war sozusagen noch nicht abgelaufen. Wenn sie in hohem Alter gestorben wäre … Das hätte einen Unterschied gemacht, oder?
Oder?
»So sieht das also aus?«, fragte Marina. »Eine, cómo se dice, Nahtoderfahrung? Man sieht und erlebt den Himmel, und dann kommt man zurück in die Welt.«
Eine einsame Grille zirpte irgendwo im Gebüsch.
»Ich fühle mich …« Marina blickte in ihre Limonade, als würde sie die gesuchten Worte dort finden. »Ich fühle mich, als hätte ich in der Lotterie gewonnen und müsste anschließend jeden Penny zurückgeben.«
Robin zuckte zusammen.
»Und jetzt bin ich ein Geist.«
Willkommen im Club.
»Ich bin die zum Leben erwachte La Llorona. Ich bin ein Geist mit gebrochenem Herzen, der gezwungen ist, auf der Erde zu wandeln und nach etwas zu rufen, was er nicht bekommen kann.«
In Robins Brust begann etwas zu brennen – Adrenalin, kein Höllenfeuer –, und sie stand steif auf und stellte sich vor die andere Frau. »Nein. Lassen Sie sich nicht so hängen. Ich habe Sie nicht im Angesicht der Hölle und gegen den Widerstand zweier Göttinnen hergeholt, damit Sie jammern und wieder sterben wollen.«
Marina sah verschreckt auf.
»Sie sind im besten Alter, Marina. Machen Sie was draus«, fuhr Robin fort. »Ich habe Ihnen Ihre Bürde, Santiago, von den Schultern genommen; jetzt bedanken Sie sich damit, dass ich meine Zeit nicht verschwendet habe, und machen Sie etwas aus dem Rest Ihres Lebens. Und passen Sie auf das kleine Mädchen auf, wenn Sie schon dabei sind. Carly braucht Sie nämlich – und wird Sie immer brauchen. Jetzt wissen Sie wenigstens, was Sie erwartet, wenn Sie über die Ziellinie kommen, aber im Augenblick sollten Sie mal in die Gänge kommen und aufhören, sich nach diesem verdammten Narnia-Fjord zu sehnen. Leben Sie, verdammt noch mal! Oder muss ich Ihnen auch erst in den Hintern treten?«
Marina richtete sich im alten Gartenstuhl auf, goss den Rest ihrer Limonade auf dem Boden aus und hielt das Glas mit beiden Händen. Es sah aus, als würde sie sich selbst umarmen. Mit plötzlich gehetztem Blick sagte sie: »Dieses Ding unten im Strudel …«
»Das ist die übernatürliche Erscheinung, die alle Hexen pampert, die ich je gejagt habe«, sagte Robin. »Die will mich in die Hölle holen. Und mein Dämonen-Daddy wartet da unten vermutlich auch auf mich.«
Marinas Blick ging wieder ins Leere.
Einen Moment lang befürchtete Robin, dass sie sich wieder zurückziehen würde, doch dann holte sie eine Jackie-Onassis-Sonnenbrille hervor und schob sie sich ins Gesicht. »Wenn dieses grässliche Wesen da unten auf die Bösen wartet – dann werde ich mein Leben so führen, dass ich niemals in die Hölle und ihm begegnen muss.« Marina holte tief durch die Nase Luft, hielt sie an und stand auf. »Ich werde nicht an einer Erkältung sterben, mein Sohn. Ich werde sterben, weil ich gelebt habe.«
»Schön gesagt«, meinte Robin. »Ist das ein Zitat?«
»Aus Willa Cather, Der Tod kommt zum Erzbischof.«
»Hatte keine Ahnung, dass Sie so belesen sind.«
»Ich war nie viel in der Kirche. Disculpame pero, Gott hat nie viel für mich getan. Aber Bücher können einen auf eine Art erlösen, wie es Religion nicht kann. Sie können einem Kraft geben, etwas beibringen, sie können eine Zuflucht bieten, wenn einem die Welt zu viel wird. Ich wollte, dass Carly ebenfalls eine solche Zuflucht hat, deshalb bin ich mit ihr oft in die Bibliothek gegangen und habe immer dafür gesorgt, dass wir Bücher zu Hause hatten.«
»Ich habe auch viel gelesen«, sagte Robin, als sie über den toten Rasen zum Haus gingen. »Fachbücher. Geschichte und okkultes Zeug. Aber ich habe selten zum Spaß gelesen. Nicht seit der Kindheit.«
»Vielleicht wäre es ein guter Zeitpunkt, damit wieder anzufangen.«
Robin dachte darüber nach und hielt Marina die Tür auf.
»Ihr Fels war eine Idee Gottes«, sagte die andere Frau und lächelte schwach, während sie erneut Willa Cather zitierte: »Das Einzige, das die Eroberer ihnen nicht nehmen konnten.«