4
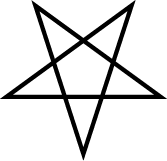
Auf seiner Royal Enfield fühlte sich Santiago Valenzuela wie ein Gott – wie einer dieser griechischen Götter, vielleicht wie der Gott des Krieges, der Pisse und Blitze versprühte. Er konnte sich an den Namen nicht erinnern, vielleicht hatte er den auch noch nie gehört, nichtsdestoweniger saß er aufrecht auf seinem Sattel und umklammerte siegessicher die Griffe des Lenkers. Wind schlug ihm ins Gesicht. Er trug keinen Helm, daher flatterte sein Haar als kohlenschwarze Mähne. Auf dem Weg aus Lockwood erhaschte er einen Blick auf seine Spiegelung im Fenster eines Wendy’s und fand, er sähe aus wie ein Löwe, der durch den Busch jagt.
La Reina war kein normales Motorrad. Sie war keine schlanke Straßenmaschine, die in flammendem Rot lackiert war und an der Chrom blitzte. Stattdessen sah sie eher aus wie etwas, mit dem Indiana Jones vor Nazi-Schergen fliehen würde: Sie sah aus wie aus einem Bausatz gefertigt, primitiv, aber kraftvoll, und hatte ein Zyklopenauge als Scheinwerfer und so dünne Speichen wie ein Fahrrad. Auspuff und Motor waren grau wie Kanonenrohre, alles andere war in pulverbeschichtetem Olivgrün gehalten: klassische Army-Power.
Er hatte sie vor drei Jahren bei einer Polizeiauktion erstanden. Eigentlich hatte er nach einem zweiten Wagen gesucht, mit dem Carly fahren lernen könnte, wenn sie alt genug wäre, doch die armeegrüne Maschine hatte ihn sofort verzaubert und nicht mehr losgelassen. An diesem kühlen Samstagmorgen im November hatte er auf seinem Klappstuhl gesessen, und die Stimme des Auktionators war über seinen Kopf hinweggerauscht. Das Einzige, was er gehört hatte, war ein eigentümliches Geräusch mitten in seinem Kopf, als würde jemand langsam lange Papierstreifen zerreißen.
Zuerst hielt er es für eine Einbildung. Santiago sah über die Schulter und betrachtete die Gesichter um sich herum, doch alle saßen still wie Schaufensterpuppen. Manche hatten die Hände gehoben.
Hören die das nicht? Er blinzelte. Hören die das nicht? Was zum Teufel ist das?
»Zweitausend, zweitausend, höre ich zweitausendfuffzig?«, schrie der Auktionator, ein kleiner Kahlkopf mit Karohemd. Er stand hinter einem Pult, das aus dem Konferenzraum der Polizei von Lockwood geliehen war.
Der graue Himmel war der Deckel auf einem Bleisarg. Santiago starrte das grüne Motorrad an. In der Maschine war etwas gefangen, das herauswollte. Raaaaatschsch. Das Geräusch kroch seinen Hinterkopf entlang, bis er es nicht mehr ertragen konnte – er sah das Geräusch regelrecht aus den Augenwinkeln, eine verschwommene Bewegung, als würde er mit dem Finger an den Augapfel drücken.
»Zweitausend, zweitausend, höre ich zweitausendfuffzig?«
Santi hielt ihm ein Peace-Zeichen entgegen.
»Zweitausendfuffzig … Höre ich zwei eins?«
Raaaaatschsch. Seine Finger blieben oben, der Preis stieg in die Höhe. Lass mich raus, schien das Geräusch zu flehen, eine Kralle, die in einem Karton über das Papier kratzte, ein Knochensplitter, der über die Innenseite eines Helms strich. Bring mich zurück auf die Straße. Los. Ich gehöre auf die Straße.
»Keine Gebote mehr? Keine weiteren Gebote. Letzte Chance, letzte Chance. Viertausend.« Der Auktionator knallte seinen Kugelhammer auf die Kante des Pults. Der Griff war mit Blumen bemalt. An diese Blumen würde sich Santiago ewig erinnern, winzig blau mit weißem Kelch. »Verkauft, an den Mann in der schwarzen Weste.«
Zwei Wochen später verkaufte er sein altes Bike, eine Harley Shovelhead von 1974, die er von seinem Vater Emiliano geerbt hatte.
Seitdem hatte er das eigenartige Phantomkratzen nicht mehr gehört.
Die Jungs im Clubhaus fragten ihn, warum er das Erbstück vertickt hatte, zogen ihn wochenlang damit auf und fragten ihn, ob die Maschine ein Willkommensgeschenk der Armee war. Er konnte nur erwidern, dass es Liebe auf den ersten Blick gewesen war. Und das stimmte ja auch gewissermaßen. Im Laufe der Zeit nannte er das Bike immer häufiger »Königin« – La Reina –, was Vergleiche mit Lorena Bobbitt auf den Plan rief und dumme Bemerkungen, er solle sich den Schwanz nicht verbrennen, wenn er ihn in den heißen Auspuff stecke. Dem machte er rasch ein Ende.
Als er sie gekauft hatte, war sie noch mit Seitenwagen ausgerüstet gewesen. Eine Zeit lang ließ er ihn dran. Mehrmals (wem wollen wir was vormachen: oft) füllte er Eis in den Seitenwagen und benutzte ihn als rollenden Bierkühler. Manchmal ließ er in der »guten alten Zeit«, in den Wochen und Monaten nach dem Kauf, auch Carly mitfahren. Es gab nichts Schöneres, als wenn die süße Kleine im Seitenwagen saß wie ein Präriehund, der aus seinem Loch späht, und wenn der Wind durch das seidige Haar peitschte, das unter ihrem Helm hervorschaute.
Dann wuchs sie offiziell zum echten Teenager heran und verzichtete auf die abendlichen Fahrten, eine Blume, die zu groß für ihren Topf war, und Santi ließ sich immer seltener bei den Feten mit den Jungs sehen (so nannte er sie damals wirklich, »Feten«), bis er schließlich an einem heißen Sommerabend den Seitenwagen abgebaut hatte, als würde er eine Krücke weglegen.
Es dauerte Stunden, er fand einfach immer noch weitere Schrauben, mit denen der Seitenwagen am Rahmen befestigt war, und schließlich gab er auf und sägte das verdammte Ding ab, wie einen Arm, der unter einem Felsen eingeklemmt war. Heute stand der Seitenwagen inmitten von Unkraut am Holzschuppen hinter ihrem Mobilheim, eine grüne Schote, die im Schatten eines Hickorybaums rostete. Anders als das Motorrad, dessen Zustand sich nie zu verschlechtern schien, rostete der Seitenwagen in einer Twilight-Zone der Korrosion vor sich hin, und der Boden wies mittlerweile große Löcher auf.
Er erinnerte sich an das grässliche Kreischen der Pendelsäge, die sich durch die Halterungen biss. In einer dunklen Ecke seines Kopfes hatte er sich gefragt, ob die Elektrosäge schrie oder das Motorrad.
Bevor er den Seitenwagen entfernt hatte, hatte er praktisch gar keine Inspektion an der Maschine vorgenommen, sondern nur Öl nachgefüllt. Man sagt, eine Harley sei erst eine Harley, wenn sie tropft, aber die Enfield war so sauber wie an dem Tag, an dem er sie gekauft hatte. Natürlich war sie schon damals nicht makellos gewesen, sondern offensichtlich gebraucht. Aber der Zustand hatte sich nie verschlechtert. Vor der Amputation des Seitenwagens hatte es keine sichtbaren Mängel gegeben, abgesehen von ein paar kleinen Schrammen und Dellen. Santiago hatte an einem Samstag beim Rasenmähen einen Stein aufgewirbelt, der den Scheinwerfer getroffen hatte. Er blieb kaputt, bis er eine neue Birne besorgt und ein neues Glas bestellt hatte.
Er hatte wild geflucht, als er die Lampe beschädigt hatte. Und geschimpft, was das Zeug hielt. In der Woche hatte Marina ihren Zahn verloren, weil sie das Frühstück auf den Boden hatte fallen lassen. Santi schlief eine Weile auf der Couch. (Ihre Ehe hätte vielleicht dauerhaft gelitten, wenn er gewusst hätte, dass sie das Rührei vom Boden aufgehoben hatte, während er draußen rauchte und Dampf abließ, es zurück in die Pfanne getan und es ihm trotzdem serviert hatte.)
Nach dem Abmontieren des Seitenwagens wurde die Königin für einige Monate zur Zicke. An dem Morgen, nachdem Santi die aufwändige Amputation vorgenommen hatte, schleppte er sich erschöpft und sauer nach draußen und entdeckte einen riesigen Ölfleck unter ihrem hängenden grauen Bauch.
Zuerst dachte er, versehentlich eine Leitung durchtrennt zu haben, aber er fand keinen Schaden. Er hatte sogar die elektrischen Leitungen zum Rücklicht des Seitenwagens abgebaut, ehe er das Gestell durchtrennte, und auch da war alles intakt. Trotzdem verlor sie unaufhörlich jeden Liter Öl, den er nachkippte, als würde sie unter einer mechanischen Version von Montezumas Rache leiden. Monatelang kam La Reina nur schwach hustend in Gang, wann immer er sie startete, und röchelte wie Archies alter Klapperkasten, als wollte sie ihn für seine Tat bestrafen.
Schließlich wurde es wieder besser. Sie lernte, ohne die Krücke zu laufen, wurde kräftiger, begann sich in Kurven zu legen wie eine geschmeidige Schlange, was mit dem Seitenwagen nicht möglich gewesen war. Sie ließ das wenig elegante Image des Zweiten Weltkriegs hinter sich und entwickelte neue Kraft.
Der weiße Armee-Stern auf dem Benzintank leuchtete so hell wie am Tag der Auktion. Santiago streichelte mit der Handschuhhand über den Stern, der in der bleichen Texassonne brennend heiß geworden war, und folgte Marina in ihrem Chevrolet Blazer über die Stadtgrenze hinaus nach Keyhole Hills. Die Kleinstadt wurde immer schäbiger, je weiter sie hineinfuhren, die Rasenflächen vor den Häusern wurden grauer und lagen voller Spielzeug und Müll. Schließlich rollte der Wagen durch das eigentliche Herz von Keyhole, wo es nichts als staubige Wohnwagen gab und das Gras nur noch als braune Stoppeln wuchs.
Marina parkte den Wagen wie gewohnt auf dem kahlen Fleck vor dem Mobilheim. Santiago knatterte an ihr vorbei zum Holzschuppen in der hinteren Ecke, wo der amputierte Seitenwagen zwischen knisterndem, verblichenem Unkraut gammelte. Der »Holzschuppen« war kaum mehr als ein Unterstand mit drei Wänden, aus rauem, grauem Holz und einem Giebeldach, damit die Königin im Trockenen stand, wenn es regnete, was selten vorkam. Er wendete die Maschine und schob sie rückwärts in den Schuppen. Der Motor ging mit einem letzten Blubbern aus. Santi schwang das Bein in weitem Bogen über das Motorrad, wie John Wayne, wenn er von einem Pferd steigt, und tätschelte liebevoll La Reinas Flanke.
Die Schlüssel steckten in der Sonnenblende des Autos. Er schob sie sich in die Tasche. Im Haus herrschte drückende Hitze, obwohl Marina bereits die Runde machte und alle Fenster öffnete. Schon rann ihm der Schweiß hinunter und sammelte sich auf der Oberlippe. Die Klimaanlage war den ganzen Tag abgeschaltet gewesen. Das Licht der Dunstabzugshaube brannte und beleuchtete den Herd milde, und das erschien ihm als Verschwendung, aber er stellte es wortlos ab. Er ging von Zimmer zu Zimmer, öffnete Fenster und schaltete Lampen aus. Das Nachtlicht im Badezimmer war eingesteckt. Er zog es heraus. Es war noch hell genug. Der Ventilator im Schlafzimmer lief, ein klapperndes Miststück, das die heiße Luft aus dem Garten ansaugte. Er stellte ihn ab. Der Lufterfrischer im Schlafzimmer roch süßlich nach Geburtstagskuchen. Er stöpselte ihn aus, und nachdem er dem Drang widerstanden hatte, ihn aus dem Fenster zu werfen, ließ er ihn in den Abfalleimer im Bad fallen. Der DVD-Player unter dem Fernseher im Schlafzimmer blinkte 12:00. Er steckte ihn ebenfalls aus und entschied sich, auch den Stecker des Fernsehers zu ziehen.
So viel Mist in diesem Haus verbrauchte sinnlos Strom, weil er eingesteckt war, aber nicht benutzt wurde.
Das erinnerte ihn an die Mädchen. Sie hatten sich wegen der Stromrechnung im Einkaufszentrum versteckt, er wusste es. Für gewöhnlich ließ er sie dann in Ruhe. Als er heute nach Hause gekommen war, war er furchtbar wütend gewesen, weil man ihn rausgeschmissen hatte – schlecht gelaunt und gereizt und sauer – , doch nachdem er eine Weile im Einkaufszentrum herumgelaufen war, hatte sich der Zorn gelegt und köchelte nur noch leise vor sich hin.
Es war ein schöner Tag. Draußen waren jede Menge hübsche Mädchen unterwegs. Wie konnte man da wütend sein, wenn einem der Wind ins Gesicht blies und man die Königin zwischen den Knien hatte?
Er fand die Stromrechnung in einem Stapel Werbesendungen auf dem Küchentisch. Marina stand am Spülbecken und trank ein Glas Wasser. Carly saß auf der Couch und schaute irgendeinen hirnverbrannten Quatsch im Fernsehen. $ 179,45. Letzten Monat waren es $ 152,72. Wofür verdammt noch mal verbrauchen wir so viel Strom? Er versuchte sich zu erinnern, wie oft sie letzten Monat die Klimaanlage benutzt hatten.
»Es liegt an der Lampe draußen, Schatz«, sagte Marina über die Schulter. Sie schlang einen Arm um sich und sprach in ihr Glas, dessen Rand an ihrer Unterlippe lag. »Sie ist uralt und brennt Tag und Nacht.« Santi beugte sich über den Tisch vor und lugte durch die Jalousien in den Vorgarten. Auf einem Strommast am Zaun leuchtete grell eine blaue Lampe, die summte und giftig schimmerte. Sie war schon da gewesen, als sie vor zwölf Jahren eingezogen waren.
»Das kann es nicht sein«, sagte er und ließ die Stromrechnung auf den Tisch fallen. »Es ist nur eine Birne. Ist das nicht außerdem eine städtische Lampe? Wieso sollen wir dafür zahlen?«
»Weil sie auf unserem Grundstück steht, Baby.«
Am liebsten hätte er den Fernseher abgestellt, aber er wusste, das war eine der wenigen Sachen, die Carly davon abhielt, wie eine heiße Katze durch die Straßen zu ziehen, und am allerwenigsten brauchte er jetzt noch einen Wurf Kätzchen.
Es erstaunte ihn, wie geistlos das Zeug war, das Carly guckte. Sendungen über Leute, die zwanghaft Farbe aßen oder ihre Zehennägel in Gläsern sammelten. Italo-Teenager in New Jersey mit weißblondiertem Haar und oranger Haut von zu viel Selbstbräuner. Fetter weißer Abschaum. Eine Familie von Kleinwüchsigen. Er lachte schnaubend und rümpfte die Nase. Wie beknackt ist das denn? Adrenalin schoss langsam in sein Blut ein. Marina hatte das Wasser ausgetrunken, wusch das Glas in der Spüle aus und stellte es in das Geschirrgestell.
Als sie sich umdrehte, stand Santiago direkt hinter ihr. Sie zuckte zusammen, sagte aber nichts. »Ich liebe dich«, sagte er und legte ihr die großen Hände auf die Schultern.
Unterwürfige Zuneigung zeigte sich verletzlich in ihren Augen. »Ich liebe dich auch, Santi.«
Seine Beckenmuskeln zuckten. Er bekam eine Erektion. Das Blut sammelte sich in seinem Schwanz, härtete ihn wie einen zu stark aufgepumpten Reifen und erzeugte Enge im Schritt seiner Wranglers. »Wir schaffen das«, sagte er zuversichtlich. Sein angespanntes Lächeln drang nicht bis zu den Augen vor. »Wie immer.«
»Ja«, sagte Marina. Sie entspannte sich.
»Liebste.«
»… Ja?«
»Du warst nicht im Einkaufszentrum, um Bikinis zu kaufen, oder?«
Rrrraatschsch. Fingernägel auf einem Sargdeckel.
»Nein, Santi.« Marina betrachtete seine Brust. »Nicht deswegen. Ich …«
»Warum hast du mich angelogen?«
»Tut mir leid.« Ihre Mundwinkel bewegten sich weit nach unten. »Ich wusste, du würdest wegen der Stromrechnung sauer auf mich sein, und ich wollte deswegen nicht zu Hause sein.«
»Ist mir gleichgültig«, sagte er. »Ist doch egal, ob ihr im Einkaufszentrum wart.«
Verwirrt sah sie ihn an.
»Ich weiß, warum ihr dort wart. Ist mir gleich. Ich habe immer gewusst, wo du bist. Es ist normal, vor Schmerz zu fliehen. Deswegen kann ich dir keinen Vorwurf machen. Mich nervt es eher, dass du mich angelogen hast.«
»Ich wollte …« Sie wandte den Blick ab. »Na ja, ich wollte …«
»Was?«
»Ich hatte Angst, du würdest …«
Santiago sah hinüber zu Carly. Deren Augen klebten am Fernseher. Sie bekam nichts mit.
Er wandte sich wieder seiner Frau zu, seine Hände folgten dem Schwung ihrer Schultern zu ihrem zarten Kinn. Die Ohrläppchen lagen auf seinen Zeigefingern. Rrrraatschsch. Er küsste sie, innig, besitzergreifend. Sein Schwanz war heiß und eisenhart und pochte.
Zu seiner gelinden Überraschung fanden ihre Hände seine Hüften, und sie erwiderte den Kuss. Seine Zunge strich über die Rückseite ihrer Zähne. Er zog sich zurück und spürte noch das Gefühl ihrer weichen Lippen auf seinen. Ihr Make-up roch nach Süßigkeiten, ihr Lippenstift fühlte sich fettig an wie Speck.
»Angst wovor?«, fragte er.
»… Angst, du würdest mir wehtun.«
»Amor, wenn ich dir wehtun wollte, könnte ich das jederzeit tun. Dazu brauche ich keine dumme Stromrechnung.« Seine Daumen streichelten ihr Kinn und landeten auf ihrer Luftröhre, die Spitzen aneinander. Er drückte leicht zu, und der liebvolle Blick in Marinas Augen verwandelte sich umgehend in Panik.
»Santi?«, fragte sie, doch das war das letzte Wort, das sie herausbrachte, während seine Hände um ihre Kehle zudrückten.
Ihr Gesicht wurde knallrot. Rrrraatschsch.
Das Gefühl, Marina zu würgen, war so überwältigend, fast sexuell. Sein Schwanz zuckte wieder, unfreiwillig und krampfhaft. Sein Puls trommelte darin einen heißen, schwachen Takt gegen den Reißverschluss. Er ergötzte sich an ihrem außergewöhnlichen Gesicht, am Schwung ihrer Wangen und ihres Kinns, daran, wie zart und zerbrechlich das alles wirkte, an den dunklen Augen, die ihn verwirrt und erschrocken anstarrten. Ihr Herz versuchte rhythmisch, Blut an seinen Daumen vorbeizudrücken.
Marinas Hände krallten sich in seinem Hemd zu Fäusten. Sie schnappte nach Luft. Er verhinderte das, drückte seinen Mund wieder auf ihren und küsste sie erneut. Aus ihrer Nase kam kein Hauch.
Sie versuchte, sich ihm zu entwinden, doch seine Hände hielten sie fest. Marina tastete auf dem Küchentresen hinter sich herum – an ihrem Hinterkopf spürte sie den Schrank, ihre Finger schlugen gegen den Toaster – , doch nichts war in Reichweite. Sie erwischte ein Handtuch und peitschte es ihm an den Kopf, ohne Wirkung. Santi drückte so hart zu, dass seine Bizepse zuckten. Marina riss vor Panik den Mund weit auf, ihre glasigen Augen traten hervor, und aus ihrem Schlund kam nur ein schwaches Rasseln: kkuuuhhkkk, kkuuuhhkkk.
»Ich bin es einfach leid«, sagte er ihr in das Gesicht, das dunkler wurde, beinahe lila. Die Lücke, wo ihr Eckzahn fehlte, füllte ihre rosa Zunge aus. »Ich gebe und gebe und gebe, und du nimmst nur.« Seine Lippen verzogen sich zu einem wütenden Grinsen. »Heute habe ich nichts mehr zu geben. Was willst du jetzt nehmen?«
»Daddy?«, fragte Carly.
Seine Tochter stand hinter ihm, ihre Handtasche in der Hand.
»Was machst du denn?« Carly hatte eine gesenkte Haltung eingenommen, die Knie gebeugt, Kampf oder Flucht, große Augen, schlaffer Mund. Er roch die Angst in ihrem Mädchenschweiß. Es roch nach Schlangen und Filzstift.
»Nichts«, gab er zurück. Seine Erektion drückte hart in Marinas Bauch. »Geh fernsehen.«
»L-lass Mama los«, verlangte Carly.
»Verzieh dich zu deiner verdammten Glotze.«
»Ich sage dir, Daddy, lass Mama los.«
Rrrraatschsch. Tatsächlich ließ er los. Langsam sanken seine Hände an seine Seiten. Marina schnappte nach Luft, als sei sie vom Perlentauchen hochgekommen. Sie krümmte sich und hustete lautstark.
»Du meinst, du hast hier was zu sagen?« Er ging auf Carly zu. »Wie bitte?«, fragte er und hob die Stimme. »Wie wäre es, wenn du zum Teufel einmal tust, was ich dir sage?« Aus den Augenwinkeln sah er, wie seine rechte Hand in die Höhe ging und gebieterisch auf Carlys Gesicht zeigte. »Geh und guck dir deine dusseligen Sendungen an und kümmer dich um deinen Scheiß.«
Sie zog etwas aus der Handtasche. Ein Deo?
Er ging einen Schritt auf sie zu. Sie warf die Handtasche auf den Tisch und umklammerte die Dose mit beiden Händen vor sich, wie ein Werfer, der für seinen Fastball ausholt.
Marina erkannte die Dose in ihrer Hand. »Nein, Carlita!«
»Was hast du v…«,
setzte er zu sagen an. Carly sprühte ihm ins Gesicht, einen schmierigen Strom, der ihn nass am Haaransatz traf.
Zuerst reagierte er geschockt, dann verwirrt. Das roch nicht wie Deo. Eher nach billiger Salsa oder vielleicht Sriracha. Seine Nase brannte. »Scheiße, verdammt«, sagte er und hob die Hand, um es abzuwischen. Doch anstatt seine Augen klar zu bekommen, zog er einen brennenden Schmerz über seine Stirn. Seine Hände waren rostig orange. Orangensaft? Batteriesäure? Die Flüssigkeit rann über sein Gesicht, durchdrang die Wälle seiner Augenbrauen. Als sie schließlich die empfindliche Haut der Lider erreichte, begriff er, was es war: Pfefferspray.
Bärenspray las er auf der schwarzen Dose in der Hand seiner Tochter, sechs Sekunden zu spät.
Scoville-Grad: 300.000
Heiliger Tittenfick!
Eine üble Wolke Pfeffer füllte die Küche mit würgender Hitze. Carly und Marina begannen zu husten, das lila Gesicht der Mutter wurde schweißnass, und Marina keuchte und schnappte nach Luft. Santiago bekam davon nichts mit, da sein Kopf voller Teufel mit Mistgabeln aus den heißesten Bereichen der Hölle war. Sobald das Spray seine Augen erreichte, schlitzten Rasierklingen über das Weiße seiner Augäpfel. Der Schrei, den er ausstieß, klang nach ungefilterter, primitiver Todesangst, der Schrei eines sterbenden Pterodaktylus. »Scheiße!«, heulte er schrill und drückte seine Knöchel mit der Stirn auf den Linoleumboden. »Scheiße!«
»Gottogott«, jammerte seine Frau hektisch. Sie holte Wasser aus dem Hahn und keuchte. »Hier, Santi« – hust, hust –, »dreh dich um.«
Das tat er. Marina goss Wasser über seine Augen. Das half nicht. Das Wasser verteilte das Pfefferspray in alle Ecken seines Gesichts und machte alles noch schlimmer. Es war in seinen Ohren. Die heißen Spitzen, die ihm in die Augäpfel bohrten, ließen nicht nach; sie drangen tiefer ein, bis er fühlte, wie sie in sein Gehirn stachen. Seine Augäpfel waren Kastanien, die über einem lodernden Feuer geröstet wurden, und jeden Moment konnten sie platzen, peng-peng, wie zwei Knallkörper. Brutzelnder Schleim würde überall in die Küche spritzen.
Santiago wälzte sich auf Hände und Knie und schlug mit dem Kopf panisch auf den Boden, bum bum bum, Schädel auf Linoleum. Sein Hirn fühlte sich an wie Gelee, das in seinem Kopf herumwackelte, aber das war nichts im Vergleich mit den kosmischen Ausmaßen der Qualen in seinem Gesicht. Wenn er sich selbst k.o. schlug, würde er die Schmerzen einfach verschlafen.
»Milch!«, sagte Carly und hustete.
»Wofür Milch?« Marina riss die Kühlschranktür auf. »Wir haben keine Milch!«
»Der Typ im Laden …«, Carly keuchte und hustete, »… hat gesagt, Milch hilft. Hier!« Sie nahm die Reste ihres Smoothies, riss den Deckel ab und goss ihn ihrem Vater ins Gesicht.
Die Erleichterung war sofort spürbar, genügte jedoch nicht, bot nur laue Linderung auf einer Strahlenverbrennung. Santiago schmeckte Blaubeeren. Er kroch über den Boden und zog sich am Spülbecken hoch, machte den Wasserhahn an und hielt das Gesicht unter den kalten Strom. Doch damit wusch er nur den Smoothie ab. Der Schmerz blieb und wurde sogar noch stärker.
Wütend packte Santi die Mikrowelle mit beiden Händen und schleuderte sie durch den Raum. Beide Frauen schrien. Ein Fenster zersplitterte, und die Mikrowelle traf den Tisch mit einem erschütternden Krachen, prallte ab und rutschte über den Boden. Santiago tastete den Tresen ab und fand noch etwas: den Toaster. Er riss das Kabel heraus, trennte dabei die Drähte vom Stecker, sodass Funken flogen, und warf den Toaster in Richtung einer der Weiberstimmen.
Ein gedämpftes metallisches Geräusch. Carly stöhnte.
Santi riss eine Schublade auf und wühlte sich durch Utensilien. Dabei schnitt er sich einen Finger an einem Filetiermesser auf. Er fluchte vor sich hin, packte etwas anderes und warf einen Eisportionierer, mit dem er die Pinnwand herunterriss. Coupons und Take-away-Speisekarten segelten durch die Luft. Er warf den Pizza-Roller. Wieder brach Glas. Die Vordertür ging auf, und er hörte, wie seine Frau und seine Tochter nach draußen rannten. Santi drückte sich vom Küchentresen weg, stieß einen Stuhl zur Seite und rannte gegen die halbgeöffnete Tür, die ihn wie ein Hammer gegen die Stirn traf. Sterne tanzten vor seinen Augen.
Während er die Fliegengittertür aufdrückte und auf die Veranda trat, hörte er die Türen des Blazer, und trotz des Schmerzes musste er wie wahnsinnig lachen.
»Ich habe den Schlüssel, Schlampe!«, rief Santiago. »Ihr fahrt nirgendwohin!«
Da es kein Geländer gab, das ihn aufgehalten hätte, stürmte er über die Kante der Veranda und landete kopfüber auf dem harten trockenen Boden wie Willy Kojote.
Jeder Quadratzentimeter seines Kopfes fühlte sich an wie in Lava getaucht. Santiago kroch auf dem Bauch durch den staubigen Garten am Mobilheim entlang, bis seine tastenden Hände den Hahn für den Gartenschlauch fanden. Er drehte ihn auf, der Schlauch wurde dick. Er folgte dem Schlauch bis zu der Sprühpistole am Ende, fluchte unentwegt, legte sich auf den Rücken und spritzte sich das Gesicht ab. Eiskaltes Wasser, das nach Gummi roch, lief ihm in die Nase, erstickte ihn, drückte sich unter seine Lider. Er hielt sich die Nase zu und bemühte sich, die Augen offen zu halten, um sie zu spülen.
Das vertraute Kratzen an der Schädelwand. Rrraatschsch.
Bring mich auf die Straße, Santi.
Er ließ die Sprühpistole los, und das Wasser stoppte. Während er nach Luft schnappte, war die Hitze wieder da, und reflexartig kniff er die Augen zu.
Na, los! Lass uns fahren.
»Verdammt! Ich bringe euch beide um!« Er zog sich umständlich das Hemd aus und sprühte sich wieder ins Gesicht. Ein Blitz schoss durch seine Nebenhöhlen, als würde sein Hirn zu groß für den Kopf, drückte seine Augäpfel heraus, und er konnte nicht anders, er musste die Augen öffnen.
Was er durch den Nebel als Erstes sah, war Carlys verängstigtes Gesicht. Seine Frau und seine Tochter waren aus dem nutzlosen Wagen gestiegen und flohen zu Fuß. Er stieß ein heiseres Gebrüll aus. Blut tropfte aus seiner Nase und schmeckte auf seiner Zunge nach Salz und Kupfer.
Schneeweißes Haar bedeckte den Rücken seiner Hand wie Brotschimmel, der im Zeitraffertempo wuchs. Das gleiche Knacken wie in seinem Kopf, diese Walnuss im Schraubstock, breitete sich jetzt in seinen Armen aus, als würden sie länger werden und als würden sich die Knochen dehnen. Seine Knöchel knirschten. Die Adern unter seiner Haut drehten sich, während die Muskeln dahinter wogten. Seine Fingernägel wurden länger und richtig spitz.
Was zum Teufel soll das?
Dieses Phänomen war seltsam und erschreckend – und gleichzeitig vertraut. Gott, es tut so weh … Es tut noch mehr weh als das Pfefferspray. Geht es wieder los?
(Wieder? Ist es schon einmal passiert?)
– Ja, Baby, ich warte hier. Wir fahren wieder los, haha, hoho –
Blasse Erinnerungen zogen durch die Dunkelheit hinter seinen Lidern. Er stand mit anderen Männern in der Wüste. Gelbe Augen funkelten in der Nacht. Jemand zog sich seine Unterhose aus und sie waren alle nackt …
Angewidert und verängstigt öffnete er die Augen, um der Szene zu entfliehen, und erhaschte gerade noch einen Blick auf Marina, die Carly panisch wegzog. Santiago brüllte – oder vielleicht dachte er nur, dass er brüllte; das Kratzen in seinem Kopf übertönte sogar das unablässige Rauschen des Verkehrs auf dem Highway.
Sonnenlicht entfachte die Hitze auf den Wangen und in den Augen neu. Begleitet wurde sie vom Soundtrack einer Kralle, die über eine Schiefertafel gezogen wird. Rasch sprühte er sich wieder Wasser ins Gesicht.
– Sie entkommen, Santi. Du kannst sie dir schnappen, wenn du einfach nur aufstehst. Streng dich ein bisschen an! –
Schon einige Male hatte sich Santiago verwundert gefragt, ob diese Stimme, die in seinem Kopf sprach und vom Motorrad kam, die Jungfrau Maria sei. Unmöglich – die Jungfrau Maria würde ihn nicht zu Taten anstiften, nach denen er mit Blut besudelt war, wenn er wieder zu Sinnen kam. Oder? Die Gestalten, die er in seinen Träumen sah, die Bestien, mit denen er unterwegs war, war das Teil eines Plans von Gott und der Heiligen Mutter?
Nein, unmöglich.
Manchmal wollte er ihr sagen, sie solle sich trollen, wer immer sie war. Aber die Stimme war wie guter Whiskey, seidig und heiß und geschmeidig, mit dem primitiven Geschmack eines blinden, ursprünglichen Triebes, wie Masturbation oder reinste Wut. Sie sang zu ihm, und wenn er die Augen wieder aufschlug, war alles vorbei und ließ ihn mit einem Gefühl von Verwunderung, Scham und manchmal einem ehrfürchtigen Schauer gegenüber dem, wobei er sich gerade selbst beobachtet hatte, zurück.
Nächte, die man in der verschwitzten Haut von jemand anderem verbrachte, waren eben Albträume im kalten Licht des Morgens, halbe Erinnerungen, zusammengeflickte Filmrollen, die beim Abspielen ruckten und zuckten.
Rückblenden, die durch seinen Kopf getrieben wurden wie Blätter vom Wind, wie Szenen eines Horrorfilms, den er vor langer Zeit gesehen hatte.
Krallen, die sich aus seinen Fingerspitzen schoben, die aber doch nur ein Spiel des Lichts waren, oder?
Oder?
Jedes Mal, wenn er unter ihrem Bann stand, schlug es ein Loch in seinen Kopf. Und inzwischen war dieses Scheißteil so löchrig wie ein Schweizer Käse. Eine posttraumatische Belastungsstörung von einem Krieg, in dem er nie gekämpft hatte. Seit der Spritztour in die Wüste und dieser Art wirren Visionssuche.
Peyote hatte diese unheimlichen Sinneseindrücke freigesetzt, diese flüchtigen Blicke auf wilde Grausamkeit. Nicht lange nach dem Kauf der Royal Enfield hatte ihn einer der Jungs dazu überredet, ein paar Pilze zu probieren, und von der Nacht erinnerte er sich an nichts anderes mehr, als dass er auf das Motorrad gestiegen und vom Clubhaus losgefahren war. Am nächsten Morgen wachte er nackt neben einem Lagerfeuer auf dem hartem Steinboden auf, und das Motorrad stand bei ihm und hielt Wache wie ein Pferd in einer alten Marlboro-Reklame.
Woran er sich erinnerte: Der Anblick riesiger Pfotenabdrücke im Sand um das improvisierte Lager, von Klauen, doppelt so groß wie seine Hand, hatte ihm eine Scheißangst gemacht. Damals hatte er sich eingeredet, dass in der Nacht ein Berglöwe ums Lager gestrichen war.
Jetzt spannte er seine schmerzenden Hände an und betrachtete sie durch die Tränen.
Na los, schnappen wir uns diese Nutten, diese Flittchen, die dir wehgetan haben, flüsterte La Reina in seinem Kopf. Fahr sie nieder. Zermalme sie mit unserem Getriebe. Verbrenne sie in unserem Motor. Die gehören uns. Dieses Haus gehört uns.
»Ja, Mutter Maria«, sagte Santiago, über dessen Lippen totes Gras strich. »Geheiligt werde dein Name.«
Die Straße gehört uns.