8
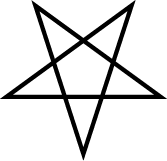
Sie zogen unter dem blauweißen Lichtschein surrender Laternen durch die mitternächtlichen Straßen und suchten nach einer Zuflucht. Donner grummelte leise an einem Himmel, der düsterer und düsterer wurde.
Zuerst waren Carly und Marina zu Elisa Valenzuela geflohen, Marinas Schwägerin.
Da Elisa nachts im Walmart von Lockwood im Lager arbeitete, hatte sie geschlafen, doch ihre Freundin Isabella Talamantes war da gewesen, hatte ihnen geöffnet und sie hereingelassen, da sie nichts von dem Pfefferspray-Zwischenfall gewusst hatte. Sie hatte nur beiläufig eine Bemerkung fallen gelassen, dass ihnen ein scharfer Geruch anhaftete. Sogar nachdem sie die Würgemale an Marinas Hals gesehen hatte, war Isabella nicht übermäßig besorgt gewesen. Sie war betroffen, hatte sich jedoch an die Blutergüsse gewöhnt, die Santi immer wieder auf dem Körper seiner Frau hinterließ. Isabella war examinierte Krankenschwester und arbeitete im Zentrum für betreutes Wohnen in Keyhole Hills, daher verfügte sie über hinreichend medizinisches Fachwissen, aber sie sagte nichts.
Nicht meine Baustelle.
Sobald sie ihr jedoch die Vorfälle geschildert hatten, die zur Flucht aus dem Haus geführt hatten, änderte Isabella ihren Kurs um hundertachtzig Grad und warf sie hinaus. »Ich möchte nicht, dass er hier ausrastet«, sagte sie und scheuchte sie so freundlich wie möglich nach draußen. »Ich mag dich wirklich gern, Marina. Aber du weißt, wie Santi in letzter Zeit drauf ist.«
»Elisa würde nicht so … so …« – Carly dachte, ihre Mutter würde den Satz mit feige sein beenden – »… reagieren; sie würde ihrem Bruder die Stirn bieten und …«
»Er ist aber nicht mein Bruder«, konterte Isabella.
Inzwischen hatten die drei die vordere Veranda erreicht. Isabella zog sich rückwärts ins Haus zurück und sprach durch die Fliegengittertür zu ihnen. »Ich habe Angst vor ihm. Haben wir doch alle. Er ist fies. Er ist schon fast wieder so wie früher. Und es liegt nur an diesem verdammten Motorrad. Seit er diese blöde Enfield gekauft hat, ist es, als hätte dieses Scheißding die Kontrolle über sein Leben übernommen. Er macht euch fertig wegen der Haushaltsrechnungen und gibt sein ganzes Geld nur für diese Maschine aus.«
»Wo sollen wir denn hingehen?«, hatte Carly gefragt.
»Ist mir gleichgültig, solange ihr von hier verschwindet.«
»Du bist mir eine schöne Freundin«, fauchte Marina.
Isabella starrte sie lange durch das Fliegengitter hindurch an. »Ich will Santiago in diesem hysterischen Zustand nicht hier haben.« Sie seufzte und schien in sich zusammenzufallen. »Warum geht ihr nicht zu Gil? Gil hat ein Gewehr. Santi hört auf Gil, und wenn er auf Gil nicht hört, dann bei Gott auf eine Ladung Schrot im Arsch.«
Also gingen sie zu Guillermo Delgado.
Die Fenster von Gils Haus waren dunkel, die Türen waren verschlossen, das Motorrad stand nicht da. Vermutlich war er im Heroes und trank gegen seine Dämonen an. Sie zogen weiter, huschten über den Gehweg, während der Tag sich dem Ende zuneigte, lauschten nach dem dämonischen Fauchen des Motors von La Reina und saßen schließlich auf dem Bürgersteig hinter dem Conoco, bis Marina sich beschwerte, dass ihr der Hintern wehtat.
Als sie das zweite Mal bei Gil vorbeischauten, war er immer noch nicht da, und deshalb machten sie sich in Richtung Lockwood auf, durch die Seitenstraßen parallel zur Hauptstraße, damit Santi sie möglichst nicht entdecken würde.
»Wo gehen wir hin?«, fragte Carly.
Während sie zuerst fast wie Hasen gerannt waren, gingen sie nun gemächlicher. Marina kämpfte sich müde weiter, wie ein Roboter, der sein Ziel vergessen hat, aber immer noch in Fahrt ist. »Ich weiß auch nicht«, antwortete ihre Mutter. »Vielleicht zur County-Polizei.« Das wäre eine bessere Idee, als zur Polizei von Keyhole zu gehen, denn diese Behörde steckte, wie jeder wusste, mit den Los Cambiantes unter einer Decke. Einige Angehörige der Gang waren selbst Polizisten, glattrasierte, martialische Kerle auf schwarz-weißen Motorrädern. »Vielleicht gehen wir einfach weiter, bis wir Texas hinter uns haben. Und lassen uns irgendwo anders nieder.«
Nicht sehr realistisch, wie Carly wusste, aber immerhin ein tröstlicher Gedanke.
Ein bekanntes Knattern ließ sich aus der Ferne hören. Marina blieb, den Schreck im Gesicht, im warmen orangenen Licht einer Natriumdampflampe stehen.
La Reina.
Es hatte sie mitten auf einem der seltenen Abschnitte der Straße erwischt, wo es keine Verstecke gab, einer geraden zweispurigen Strecke, die an beiden Seiten von Mauern und Zäunen begrenzt wurde. Nördlich von ihnen stand ein hohes Lagerhaus, das fast einen Block lang war, und im Süden wurde eine Gruppe Fahrzeuge in verschiedenen Zuständen der Schrottreife von einem Maschendrahtzaun eingeschlossen.
Carly entschied sich für den Zaun und die Wagen. Am Rande des orangenen Lichts stand ein Müllcontainer. Sie kletterte hinauf und dann weiter auf den Zaun, stieg vorsichtig über den Stacheldraht und holte sich dabei einen schmerzhaften Kratzer. Sie sprang nach unten, landete in der Hocke und fiel auf ihren Arm.
Das Geräusch der sich nähernden Enfield klang wie ein dumpfes Schnarchen. Santiago war vielleicht noch drei Blocks entfernt, fuhr langsam, suchte nach ihnen. Marina schleuderte ihre Handtasche über den Zaun und kletterte auf den Müllcontainer wie ein Baby, das auf eine Couch krabbelt, steif und unbeholfen. Eine der Plastikluken gab ein Knacken von sich und drohte unter ihrem Gewicht nachzugeben.
»Mach schon, Mama!«, flehte Carly.
Marina antwortete ihr auf Spanisch und arbeitete sich über den Stacheldraht vor wie eine Spinne, die über Gitarrensaiten kriecht.
»Mach schon. Er kommt!«
»Ich gebe mir ja Mühe!«
Als Carly den Scheinwerfer wie Saurons suchendes Auge an einem Stoppschild zwei Block weiter sah, sprang Marina endlich. Ihre Jeansjacke verhakte sich in dem Stacheldraht, sie schaffte es nicht ganz nach unten und blieb in der Jacke hängen wie ein Säugling. Ihre Schultern wurden bis zu den Ohren hochgezogen.
»Mist!«, zischte Marina und fügte weitere spanische Flüche hinzu. Ihre Zehen kratzten am Kies. »Hilf mir, Carlita!«
Der Scheinwerfer blieb wie ein ferner Stern an der Kreuzung stehen. Anschließend fuhr La Reina langsam an und dann in gemächlichem Tempo über den Asphalt, gerade schnell genug, damit sie nicht umkippte. Carly packte ihre Mutter am Bund der Jeans und zog heftig, doch Marina hing am Draht und wippte nur auf und ab.
»Du musst die Jacke ausziehen«, sagte sie. Marina wand und schlängelte sich wie ein Fisch am Haken.
Der Scheinwerfer näherte sich dem Ende des Blocks. Marina rutschte aus ihrer Jacke, fiel auf die Knie und ließ die Jacke am Draht hängen. Trockenes Unkraut raschelte, während Carly sie in ein Labyrinth von Autos hetzte, und das raue Getöse von Santiagos Motorrad dröhnte in ihren Ohren, während er vorbeizog und die Jacke am Zaun entweder nicht wahrnahm oder nicht erkannte. Der Lichtstrahl bewegte sich weiter.
Minutenlang kauerten Carly und ihre Mutter hinter einem weißen Hyundai mit platten Reifen. Eine tückische Stimme in Carlys Kopf warnte sie unablässig: Er kann eure Füße unter dem Wagen hindurch sehen, er sieht deinen Kopf, er hört deinen Atem, er findet dich, ER WIRD DICH HOLEN, ER KOMMT, ER KOMMT.
La Reinas Motor verhallte in der Ferne in Richtung Osten.
»Maldita sea«, fluchte Marina auf Spanisch und angelte nach ihrer Jeansjacke. »Meine einzige gute Jacke. So was Dummes.«
»Das ist nicht so tragisch, Mom.« Carly packte den Zaun mit beiden Händen und sah die Straße entlang. Sie konnte es kaum glauben, dass ihr Vater wirklich verschwunden war, und misstraute dem Knattern des Motors, das sich in die Nacht verzog. Halb erwartete sie, dass er mit abgestelltem Motor und ohne Licht umkehrte und lautlos wie ein Geist heranrollte.
Marina hörte auf zu fluchen und gesellte sich zu ihrer Tochter am Zaum. »Es tut mir leid, Liebes.«
»Was denn?«
»Ich weiß nicht.« Sie hob die Hände und verzog das Gesicht, niedergeschlagen und verzweifelt. Nach der Flucht über den Zaun war sie außer Atem, verschwitzt und zerzaust. »Das alles. Das …«
»Ist doch nicht deine Schuld, Mom. Du …«
»Ich habe ihn geheiratet.«
»Wenn du ihn nicht geheiratet hättest, würde es mich nicht geben.« Carly umarmte ihre Mutter fest. Als sie sich von ihr löste, sah sie die Würgemale am Hals ihrer Mutter. »Du bist auch nicht diejenige, die das Motorrad gekauft hat. Es ist echt nicht deine Schuld. Okay?«
»Meinst du …« Marina wischte sich mit der Handfläche eine Träne weg. »Meinst du wirklich, es liegt am Motorrad?«
»Manchmal sieht Dad La Reina so an, als würde sie mit ihm sprechen und er wäre der Einzige, der sie hören kann. Ist dir das noch nie aufgefallen? Wie ein Hund, wenn man ihn mit Lauten lockt. Er … er legt sogar den Kopf schief.«
Marina ließ den Zaun los und schritt gestikulierend um Carly herum. »Jetzt redest du aber Unfug. Als Nächstes siehst du noch Chupacabra und so was. Bigfoot.« Sie drohte mit dem Zeigefinger. »Und nenn es nicht ›La Reina‹, als wäre es eine Frau, Carlita. Es ist keine Frau, es ist ein Motorrad!« Ihre Ermahnung endete mit Unsicherheit und Zweifel in der Stimme. »Und überhaupt! Wo sind wir hier eigentlich gelandet?«
Das Mädchen sah sich die Autos an, die kreuz und quer um sie herum abgestellt waren.
»Wir verstecken uns hier.«
Sie versuchten, verschiedene Türen zu öffnen, an einem Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend Wagen, doch alle waren abgeschlossen. Carly überlegte, eins der Fenster mit einem Ziegelstein einzuschlagen, den sie unter einem Reifen gefunden hatte, doch der Lärm hätte vielleicht unerwünschte Aufmerksamkeit erweckt, und außerdem wollte sie sich zumindest einen gewissen Schutz vor Santiago auf der anderen Seite des Zauns sichern, falls er zurückkäme.
Am Ende des Platzes zeichnete sich die Silhouette eines Wohnmobils vor dem Nachthimmel von Keyhole Hills ab. Carly probierte, die Türen zu öffnen, die jedoch abgeschlossen waren – alle drei, Fahrertür, Beifahrertür und die zum Wohnbereich.
»Das Fenster da ist offen«, sagte Marina und zeigte auf die Seite des Wohnmobils.
Eins der Fenster stand etwas offen. »Heb mich hoch, dann klettere ich rein und mache die Tür von innen auf«, sagte Carly. »Wir verbringen die Nacht hier und überlegen uns morgen früh, wie es weitergeht.«
Ihre Mutter sah sie eine Sekunde lang schockiert an, aber gleichzeitig auch bewundernd. »Also gut, mi pequeña ladrona.«
Carly durchsuchte die Handtasche ihrer Mutter und fand einen Fingernagelknipser. Daran befand sich auch eine kleine Nagelfeile mit einer Spitze. Marina machte eine Räuberleiter, und ihre Tochter setzte den Fuß darauf. Schwankend hob die Mutter sie an. Carly stach durch das Fliegengitter und sägte es von oben nach unten auf, sodass sich ein Schlitz an einer Seite ergab. Dann schnitt sie weiter von rechts nach links über den Boden und machte ein L-förmiges Loch.
Carly warf den Nagelknipser zur Seite, packte den Fensterrand, zog sich hoch und stützte sich mit den Füßen an der Wand des Wagens ab. »Okay«, sagte sie und versuchte unbeholfen einen Klimmzug. Marina drückte Carlys Po mit beiden Händen nach oben. Carly lehnte den Oberkörper auf den Fensterrahmen.
Drinnen war es stickig und heiß. Sie lag bäuchlings auf einem Spülbecken, während sie mit den Beinen strampelte. Sie zog sich in den Wagen und stieg von der Spüle.
Von draußen warfen Straßenlaternen durch die roten Vorhänge hindurch ein fiebriges Licht in den Innenraum. An den Wänden hingen Gegenstände, die Carly zuerst für riesige, verzierte Kreuze hielt – schließlich hatte sie ihre Kindheit in einem katholischen Haus verbracht – , bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnten.
Klingen. Schwerter, Dolche, einige Äxte. Tomahawks.
»Scheiße, nee«, murmelte sie und nahm eine exotische dreizackige Waffe von der Wand, die ein bisschen wie eine Mistgabel mit Schwertgriff aussah.
»Carlita?«, zirpte draußen jemand.
Carly ließ ihre Mutter ein, machte die Tür zu und schloss sie wieder ab. »Was ist das?«, fragte Marina und begaffte die Waffen an den Wänden. »Der Winnebago von Conan dem Barbar?«
»Wer soll das sein?«
Marina zuckte zusammen. »Ach, Kind, du schaffst es, dass ich mich so alt fühle.«
Schweißperlen bildeten sich auf Carlys Stirn und rannen ihr den Rücken hinab. »Ich fühle mich, als wäre ich schon einmal hier gewesen«, sagte sie und setzte sich in die Sitzecke. Sogar der Resopaltisch war warm. Ihre Mutter ging nach vorn, wo hinter der Windschutzscheibe die Lichter des Geschäftsviertels blau und silbern glitzerten, und hockte sich hinter das Armaturenbrett.
»Verdammt, keine Schlüssel.«
»Ich wollte ihn auch nicht stehlen, Mom. Ich wollte nur die Nacht hier verbringen. Dann überlegen wir uns morgen, was wir machen.«
Carly ging nach hinten und öffnete das Fenster über dem Bett. Eine kühle Nachtbrise strömte herein und trocknete den Schweiß. Carly legte sich aufs Bett – das äußerst ordentlich gemacht war – und schloss erschöpft die Augen. Die Decke roch nach Mann: forsch, dunkel, scharf. Kurz fragte sie sich, wie der Mann wohl hieß und wie er war, dann schlief sie schon.
»Carlita.«
Ein drängendes Flüstern. Jemand schüttelte sie. »Carlita.«
Sie drehte sich um und sah ihre Mutter verschlafen an. Marina saß im Schneidersitz auf dem Bett neben ihr und war nur als Silhouette zu erkennen, schwarzer Kopf und Schultern vor dem gelb gestreiften Schein, den eine Straßenlaterne durch die Jalousie hereinwarf.
»Ja?«
Marina sagte lange Zeit nichts. Carly spürte, wie sie ihr Gesicht musterte. Schließlich fuhr sie fort: »Hast du gestern auch gesehen, was ich gesehen habe?«
Jetzt verschlug es Carly die Sprache. »Dad?«
Als müsste ihre Mutter die Worte aus einem Sumpf in ihren Gedanken ziehen, sagte Marina leise, fast im Flüsterton: »Ja. Es sah aus, als ob …«
Carly lief es kalt den Rücken hinunter. »Ich wollte nichts sagen, falls ich es mir nur …« Eingebildet habe? Verrückte bilden sich Dinge ein, oder? Sie sagte etwas über eine optische Täuschung und Santi, der vielleicht Schaum vom Spray auf den Armen hatte. Das Haar auf seinen Armen wurde weiß und länger, wie … Fell?
»Dieser Schrei, den er ausgestoßen hat, ehe wir weggelaufen sind«, sagte Marina, »der klang nicht …«
(menschlich?)
»… wie mein Mann.«
Vielleicht war es doch nicht nur ihre Fantasie gewesen, vielleicht waren Santis Augen tatsächlich gelb geworden und hatten dunkle golden schimmernde Iriden bekommen. Carlys Hände suchten einander. Sie lag in der Dunkelheit, knibbelte an ihren Fingernägeln und starrte ihre Mutter mit ratloser Angst an.
Regen prasselte auf das Dach nieder.