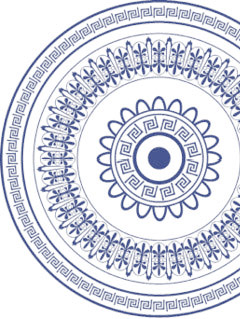
Kapitel 9
Oder was wäre Herakles für ein Mann gewesen, wenn er gesagt hätte: »Wie soll ich’s anfangen, dass mir kein großer Löwe, kein großer Eber, keine wilden Menschen zu Gesichte kommen?« – Warum solltest du dich darüber bekümmern? Kommt dir ein großer Eber zu Gesicht, so wirst du nur einen desto rühmlicheren Kampf kämpfen; sind es lasterhafte Menschen, so wirst du die Erde von Bösewichten befreien.
Am 13. Oktober 1992 sah ich im Fernsehen die Wahlkampfdebatte der möglichen Vizepräsidenten der USA. Ich war erst vor wenigen Jahren aus Rom in die Vereinigten Staaten übergesiedelt, und allein die Idee von Fernsehdebatten als »Infotainment« war für mich neu. Auf dem Podium befanden sich drei Männer: die Berufspolitiker Al Gore und Dan Quayle sowie ein unbeholfener Typ namens James Stockdale – der Mann, der weiter vorne schon kurz erwähnt wurde.
Für Stockdale war es kein guter Abend. Er hatte die Debatte mit einem komischen Statement begonnen: »Wer bin ich? Warum bin ich hier?« Anfangs fanden die Leute, dass solche Bemerkungen von einer liebenswerten Bescheidenheit zeugten, bis deutlicher zutage trat, dass er tatsächlich so gut wie keine Ahnung hatte, was er bei dieser Debatte eigentlich sollte. Er wirkte irgendwie ungeschickt, und ich hätte an jenem Abend nie gedacht, dass er für mich einmal zu einem Vorbild werden sollte – mehrere Jahrzehnte nach jener Sendung und ungefähr zehn Jahre nach seinem Tod. Stockdale war nämlich ein moderner Stoiker, und seine Geschichte verdient es, erzählt zu werden.
Dafür müssen wir bis ins Jahr 1965 zurückgehen. Anfang August hatten die Amerikaner nach dem sogenannten »Tonkin-Zwischenfall« begonnen, ernsthaft in den Vietnamkrieg einzugreifen: Laut amerikanischer Lesart wurden amerikanische Kriegsschiffe im Golf von Tonkin von nordvietnamesischen Schnellbooten beschossen oder provoziert – was genau geschah, blieb nebulös –, was die Regierung unter Präsident Lyndon B. Johnson jedenfalls zum Anlass für eine verstärkte militärische Intervention nahm und als offizielle Rechtfertigung für »Vergeltungs«-Bombardements in Nordvietnam nutzte.
Als Stockdale, damals Kommandeur eines Jagdgeschwaders, diese Nachricht erhielt, lautete sein Kommentar: »Vergeltung wofür?« Man befahl ihm zu schweigen.
Am 9. September wurde Stockdale bei einem Flug über Nordvietnam abgeschossen und gefangen genommen. Er sollte siebeneinhalb Jahre im Kriegsgefangenenlager, dem sogenannten »Hanoi Hilton«, zubringen, wo ihm, Schläge und Folter inklusive, nichts erspart blieb. Man legte ihm regelmäßig Fußfesseln an und sperrte ihn in eine fensterlose Zelle, die einen mal drei Meter maß. Aus Angst, die Nordvietnamesen könnten ihn zu Propagandazwecken missbrauchen, schlitzte er sich mit einem Rasiermesser die Kopfhaut auf, um entstellt auszusehen. Als das nicht den erhofften Erfolg brachte, rammte er sich einen Hocker ins Gesicht, womit er endlich wie ein Opfer von Misshandlungen wirkte und damit für die feindliche Propaganda wertlos war. Ein anderes Mal schnitt er sich sogar die Pulsadern auf, weil er fürchtete, unter der zu erwartenden Folter womöglich militärische Geheimnisse preiszugeben.
Schließlich wurde er freigelassen und kehrte in einem elenden körperlichen Zustand in die Vereinigten Staaten zurück. In einem der Interviews, die er in der Folgezeit gab, wurde er gefragt, wer die geringste Chance gehabt habe, aus dem »Hanoi Hilton« herauszukommen, und gab eine erstaunliche Stellungnahme ab.
»Oh, das ist leicht zu beantworten: die Optimisten. Diejenigen, die sagten: ›Zu Weihnachten sind wir hier raus.‹ Weihnachten kam, Weihnachten ging. Dann sagten sie: ›Zu Ostern sind wir raus.‹ Ostern kam, Ostern ging. Und dann Thanksgiving und wieder Weihnachten. Und dann starben sie an gebrochenem Herzen. […] Das ist eine sehr wichtige Lektion. Man darf den Glauben, dass man am Ende siegen wird – einen Glauben, den zu verlieren man sich nicht erlauben kann –, nicht mit der Disziplin verwechseln, die man braucht, um den brutalsten Tatsachen der gegenwärtigen Wirklichkeit ins Auge zu blicken, wie immer sie auch aussehen mögen.«
Der Interviewer bezeichnete das als »Stockdale-Paradoxon«, doch er hätte es ebenso der antiken Quelle zuschreiben können, nämlich Epiktet. Und genau diesem großen Lehrmeister verdankte der Offizier Stockdale seine lebensrettenden Einsichten.
1959, also etliche Jahre vor dem Vietnamkrieg, hatte die Navy ihn zum Studium an die Stanford University geschickt, um dort seinen Master in Internationalen Beziehungen und – ausgerechnet – Vergleichendem Marxismus zu machen. Weil ihn die vorgegebenen Kurse ziemlich langweilten, spazierte er ins Institut für Philosophie, wo er Professor Phil Rhinelander begegnete, der Stockdales Leben grundlegend verändern sollte.
Der Marineoffizier schrieb sich in Rhinelanders zweisemestrigen Kurs »Die Probleme des Guten und des Bösen« ein. Da inzwischen das erste Semester halb vorüber war, bot der Professor ihm ein Einzeltutoriat an, damit er seinen Rückstand aufholen konnte. Beim letzten Termin nahm Rhinelander ein Exemplar von Epiktets Handbüchlein und reichte es Stockdale mit den Worten: »Für Sie als Angehöriger des Militärs wird das, glaube ich, von besonderem Interesse sein. Friedrich der Große hatte auf seinen Feldzügen immer ein Exemplar dabei.«
Stockdale las tatsächlich wiederholt das Handbüchlein sowie die Lehrgespräche und sagte später, Epiktet habe ihm das Leben gerettet – indem er ihm zum einen die nötige moralische Stärke verlieh, die Schicksalsprüfung, wie er die Gefangenschaft sah, zu überstehen, und ihm zum anderen die rationale Klarsicht gab, zu erkennen, was man in einer solchen Lage tun konnte und was nicht. Es handelte sich um nicht mehr und um nicht weniger als eine brutale Anwendung der stoischen Dichotomie der Kontrolle.
1981 wurde Stockdale Dozent an dem in Stanford ansässigen Think Tank Hoover Institution und schrieb und lehrte dort in den nächsten zwölf Jahren über den Stoizismus.
Nichts von dem, was Sie hier lesen, sollte als Verteidigung der amerikanischen Intervention in Vietnam gedeutet werden oder die Dämonisierung der Nordvietnamesen legitimieren. Worauf es mir ankommt ist die persönliche Lebensgeschichte, denn Stockdale hatte eine Wahrheit erkannt, die nicht allein auf den Krieg, sondern auf das Leben insgesamt zutrifft: Moral und Selbstachtung aufrechtzuerhalten ist wichtiger, als sich um Fakten und äußere Umstände zu kümmern. Es ist ein Psychospiel, zugegeben. Aber gerade dafür ist der Stoizismus überaus nützlich, denn er ist selbst ein großes Psychospiel, in dessen Zentrum die Aufrechterhaltung von Moral und Selbstachtung steht.
Die Feuertaufe, ob sich dieser theoretische Ansatz in der Praxis bewähren würde, kam für Stockdale an jenem Tag, als er abgeschossen wurde.
»Nach Betätigung des Schleudersitzes hatte ich ungefähr dreißig Sekunden Zeit, um meine letzten Worte in Freiheit zu sprechen, ehe ich direkt auf der Hauptstraße jenes kleinen Dorfes landete. Und so flüsterte ich zu mir selbst: ›Das werden mindestens fünf Jahre dort unten. Ich verlasse die Welt der Technik und betrete die Welt von Epiktet.‹«
Kaum war er in Gefangenschaft geraten, wurde Stockdale sehr schnell klar, was es auf sich hatte mit Epiktets Dichotomie der Kontrolle. Binnen Minuten wurde aus dem geachteten Offizier, der hundert Piloten und mehr als tausend Armeeangehörige befehligte, ein Opfer, das scheinbar hilflos der Willkür anderer ausgeliefert war.
»Als sie mich überwältigt und mit den Fäusten bearbeitet und mir die Arme verdreht und verrenkt hatten, dauerte es noch drei oder vier Minuten, ehe der Typ mit dem Tropenhelm in seine Trillerpfeife blies. Ich hatte ein ganz übel gebrochenes Bein und fühlte deutlich, dass mir dieses Problem für den Rest meines Lebens erhalten bleiben würde. Und wie sich herausstellte, sollte sich diese Ahnung bewahrheiten.«
Später erinnerte er sich, dass auch Epiktet sein ganzes Leben lang verkrüppelt war. Doch wie heißt es so schön bei unserem Lehrmeister:
»Eine Lähmung behindert ein Bein, nicht aber die sittliche Entscheidung. Sag dir das bei allem, was dir zustößt. Du wirst nämlich finden, dass es für etwas anderes hinderlich ist, nicht aber für dich selbst.«
Stockdale hatte siebeneinhalb Jahre Zeit, über die Wahrheit dieses Satzes nachzudenken.
Allerdings hatte er, noch bevor er von den Nordvietnamesen abgeführt wurde, den Entschluss gefasst, während seiner Gefangenschaft Epiktets Ratschläge peinlich genau zu befolgen: Egal, welche Rolle ihm das Schicksal zugewiesen hatte, er wollte sie so gut wie möglich ausfüllen. Stets ermahnte er sich, nicht zu vergessen, dass seine Feinde nur dann gewinnen konnten, wenn er der Angst nachgab und seine Selbstachtung verlor. Um dies zu verhindern, machte er sich ein möglichst zutreffendes Bild vom Charakter seiner Bewacher, vor allem des Mannes, der als sein Folterknecht ausersehen war.
Übrigens scheint er ganz in stoischer Tradition zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass dieser Mann nicht von Grund auf böse war, vielmehr einfach seinen Job machte, und zwar dem eigenen Verständnis nach gut und effizient. Eichmann lässt grüßen. Stockdale dürfte das zwar nicht gutgeheißen haben, vermochte es indes aus einer inneren Logik heraus nachzuvollziehen. Folterknechte sind nun einmal dazu da, den Widerstand des Gefangenen zu brechen und ihm Furcht einzuflößen. Bloß kehren sich dabei, wie die Geschichte zeigt, die Positionen von Gut und Böse leider allzu oft um. Bei Epiktet heißt es dazu lapidar:
»Wenn nun jemand, der weder sterben noch um jeden Preis leben will, sondern es hinnimmt, wie es ihm gegeben wird, auf den Tyrannen losgeht, was hindert ihn, sich diesem ohne Furcht zu nähern? – Nichts.«
Da er Epiktets Philosophie verinnerlicht hatte, verstand Stockdale sich als Mann mit einem Auftrag. Er scharte als ranghöchster Offizier die Gefangenen um sich und tat sein Bestes, um den Gefängnisalltag so sinnvoll wie möglich zu strukturieren und die Widerstandskraft seiner Soldaten mit praktischen Ratschlägen zu stärken. Zugleich wurde ihm mehr und mehr klar, dass die offizielle Vorgabe der US-Regierung, dem Feind lediglich Namen, Dienstrang, Nummer der Erkennungsmarke und Geburtsdatum zu nennen, schnell dazu führen würde, dass viele Gefangene hingerichtet werden würden. Deshalb ersann er eigene Richtlinien, die einen Mittelweg anstrebten. Nicht gänzlich abblocken und dennoch bestreiten, sich irgendwelcher Verbrechen schuldig zu fühlen, oder einfach was erfinden. Zu Letzterem gibt es ein grausames Beispiel:
Nels Tanner, ein Freund von Stockdale, sollte seinen Wärtern die Namen von Piloten nennen, die den Dienst quittiert hatten, um ihre Oppositionshaltung zum Krieg zu demonstrieren. Tanner lieferte zwei Namen: Leutnant Clark Kent, das bürgerliche Alter Ego von Superman, und Leutnant Ben Casey, die Hauptfigur einer bekannten Arztserie. Allerdings waren die Folgen für Tanner alles andere als witzig, als man ihm auf die Schliche kam: Erst hängte man ihn drei Tage an den hinter dem Rücken zusammengebundenen Handgelenken auf, und dann musste er mehr als hundert Tage in einem Fußblock und in Isolationshaft zubringen. Andere, wie Stockdale und neun Mithäftlinge, bezahlten diese Art des Widerstands damit, dass sie drei bis vier Jahre in Einzelhaft verbrachten.
Howie Rutledge, ein weiterer Gefährte von Stockdale, beschäftigte sich später in seiner Magisterarbeit damit, ob die Willenskraft eines Menschen eher durch Folter oder durch Einzelhaft gebrochen wird. Die Resultate, die aufgrund von Fragebögen erhoben wurden, waren frappierend: Wer weniger als zwei Jahre in Einzelhaft zugebracht hatte, bezeichnete die Folter als das Schlimmste – wer hingegen mehr als zwei Jahre isoliert gewesen war, gab an, diese Erfahrung sei sogar noch schlimmer gewesen als die Folter.
Stockdale interpretierte Rutledges Erkenntnisse im Licht der Lehren Epiktets – es sei weniger der körperliche Schmerz als das Schamgefühl, das einen Menschen wirklich breche. Und gefragt, was die Früchte aus all seinen Lehren seien, hatte der Philosoph geantwortet: »Seelenruhe, Freiheit, Standhaftigkeit des Gemüts«. Auf James Stockdale traf das ganz sicher zu.
Natürlich mag man fragen, ob es wirklich der Stoizismus war, der Stockdale immun gegen Folter und Einzelhaft machte, oder ob der Stoizismus lediglich die nachträgliche Rationalisierung einer großartigen Leistung lieferte, die sich seinem angeborenen Charakter verdankte. Oder philosophischer ausgedrückt: Lässt sich Tugend erlernen, oder werden die Menschen mit ihrer speziellen Form von Tugend beziehungsweise Untugend geboren? Nicht allein die alten Griechen haben über dieses Thema ausführlich debattiert, auch die moderne Biologie und die Entwicklungspsychologie haben eine ganze Menge an empirischen Indizien entdeckt, die für unsere Fragestellung relevant sind.
In Platons Dialog Menon wird Sokrates von der Titelfigur gefragt:
»Kannst du mir wohl sagen, Sokrates, ob die Tugend gelehrt werden kann? Oder ob nicht gelehrt, sondern geübt? Oder aber weder angelernt noch angeübt, sondern von Natur sie dem Menschen einwohnt, oder auf irgendeine andere Art?«
Nach einer längeren Erörterung schließt Sokrates, dass »Tugend« im Prinzip lehrbar sein könnte – in der Praxis allerdings nicht, weil man nirgendwo Lehrer für sie finde. Was impliziert, dass tugendhafte Leute letztlich bereits so geboren werden. Aristoteles hingegen vertritt eine andere Theorie und hat die wichtige Unterscheidung zwischen moralischer Tugend und intellektueller Tugend getroffen, wobei Erstere einer natürlichen Veranlagung, ergänzt durch erworbene Gewohnheiten, entspringt, während Letztere aus dem Nachdenken eines reifen Geistes hervorgeht. Daraus folgt, dass es drei Quellen der Tugend gibt: Manches resultiert aus unserer natürlichen Grundausstattung, anderes entsteht durch Gewohnheit besonders in der frühen Kindheit hinzu, und wieder anderes kann intellektuell erworben und damit ebenfalls gelehrt werden.
Dieses »gemischte« Modell des Erwerbs von Tugend ist mit der stoischen Philosophie gut vereinbar. Bekanntermaßen vertraten die Stoiker ein Entwicklungsmodell der Moral: Sie glaubten, dass wir von Natur aus mit der Fähigkeit ausgestattet seien, nicht nur an uns selbst zu denken, sondern desgleichen an andere – seien es nun Personen, die sich um uns kümmern, oder Menschen, mit denen wir in unserer frühen Kindheit regelmäßigen Kontakt haben. Wenn wir als Sieben- oder Achtjährige das Alter der Vernunft erreicht haben, sind wir imstande, unseren tugendhaften Charakter auf zweierlei Weise weiter auszubauen: durch Gewohnheit und mit fortschreitendem Alter zudem immer mehr durch explizite philosophische Reflexion.
Auch die moderne Psychologie bedient sich eines solchen Modells. Dazu gehört etwa Lawrence Kohlbergs Theorie von den sechs Stufen der Moralentwicklung; es ist der vielleicht berühmteste Versuch, zusammenfassend darzustellen, wie sich Menschen moralisch entfalten. Diese sechs Stufen sind in drei Phasen gegliedert: die präkonventionelle Moral (sie beginnt mit einem durch Gehorsam und Bestrafung geregelten Stadium und geht dann in ein Stadium der Eigenorientierung über), die konventionelle Moral (geht von einem Stadium der personengebundenen Zustimmung und Konformität über in eine der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung und des Ansprechens auf Autorität) und die postkonventionelle Moral (geht aus einem Stadium des Ansprechens auf einen subjektiv wahrgenommenen Gesellschaftsvertrag über in ein Stadium des Festhaltens an allgemeinen ethischen Prinzipien).
Doch ist Kohlbergs Theorie in verschiedener Hinsicht kritisiert worden. So heißt es unter anderem, er habe zu viel Nachdruck auf rationale Entscheidungsfindung und auf das ethische Konzept der Gerechtigkeit gelegt und zu wenig auf die Rolle der instinktiven Entscheidungen beziehungsweise weiterer ethischer Tugenden. Dennoch lässt sich das Modell recht gut an die verschiedensten Kulturen anlegen, selbst wenn die Menschen die sechs Stufen unterschiedlich schnell durchlaufen und je nach Kultur manche Aspekte stärker betont werden als andere.
Sei es, wie es ist: Wir brauchen keine spezielle moderne Theorie der moralisch-psychischen Entwicklung, um der allgemeinen Idee beizupflichten, dass wir unsere Ethik aus einer Kombination von Instinkten, Training und – je nachdem – expliziter kritischer Reflexion beziehen. Diese steht im Einklang mit biologischen Forschungsergebnissen zur Interaktion von Genen und Umwelteinflüssen bei einer ganzen Reihe von Lebewesen, denn komplexe Merkmale, besonders im Verhalten, scheinen sich fast immer in einem ständigen Feedback von Genen und Umwelt zu entwickeln. Natur, durchsetzt von Kultur.
Kehren wir nach diesem kleinen Ausflug in angrenzende Themengebiete zum Stoizismus zurück.
Vorbilder wie James Stockdale, Paconius Agrippinus, Helvidius Priscus und Malala Yousafzai unterstreichen, dass der Stoizismus eine praxisorientierte Philosophie ist und kein abstraktes Theoretisieren. Obwohl die Stoiker natürlich ihre Lehren auch gelehrt, sprich viel geredet haben, um ihre ethischen Prinzipien weiterzugeben, lag der inhaltliche Schwerpunkt nie auf einem theoretischen Gebäude, sondern auf den Möglichkeiten der praktischen Umsetzung. Darauf, wie sich wirkliche Menschen verhalten, und nicht, wie sie reden. Das Beobachten und Nachahmen von Vorbildern ist hierfür also äußerst hilfreich und eine wirkungsvolle Methode, an der eigenen Tugend zu arbeiten. In modernen Gesellschaften funktioniert das im Grunde nicht viel anders als früher, bloß dass wir heutzutage bei der Auswahl der Vorbilder ein eher schlechtes Händchen haben. Wir heben Schauspieler, Sänger, Sportler, Promis und so manche andere Eintagsfliege in den Himmel, um irgendwann aus allen Wolken zu fallen, wenn wir realisieren, wen wir uns da als Idol oder Vorbild ausgesucht haben.
Ein Problem ist ferner die inflationäre Verwendung des Wortes »Held«, wobei hier speziell die Vereinigten Staaten den Vogel abschießen. Nicht jeder, der als Held bejubelt wird, ist per definitionem einer – ein bisschen weniger wäre hier meist genug. Hinzu kommt, dass die Etikettierung »Held« inzwischen auch bei Menschen zum Zuge kommt, die beispielsweise bei einem Terrorangriff ums Leben kamen. Bloß sind das keine Helden, sondern Opfer. Sie haben in diesem Moment wahrscheinlich weder Mut noch Sorge um andere Menschen empfunden, waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein schrecklicher Tod, ganz gewiss, aber kein Heldentod.
Sicherlich muss ein Held keine außerirdische Lichtgestalt sein, nein, selbst Helden sind nicht perfekt, wie bereits die Stoiker wussten. Weil es eben keine perfekten Menschen gibt, ganz einfach. Das gilt genauso für Vorbilder. Schließlich würden wir unerreichbar hohe Standards setzen, wenn wir Perfektion zum integralen Bestandteil dieses Konzepts machten.
Manche Religionen tun das freilich. Für Christen ist Jesus das Modell des Gutmenschen schlechthin, dem allzu Menschliches recht fern war. Nur: Wer will einem solchen Vorbild überhaupt nacheifern? Da müssten die Gläubigen ja tatsächlich versuchen, wie Götter zu sein. Undenkbar. Als zum Irren und Scheitern vorherbestimmte Wesen müssen wir akzeptieren, dass unser Pfad zur Erlösung die göttliche Gnade ist.
Die Stoiker als äußerst praktisch veranlagte Philosophen und gute Kenner der menschlichen Psyche gingen gleich anders an die Sache heran. Als Seneca, der einen Essay über das Wesen des weisen Menschen schrieb, verdächtigt wurde, die Messlatte so hoch zu hängen, dass es niemandem wirklich gelingen könne, Weisheit zu erlangen, entgegnete er seinen Kritikern:
»Keinen Grund gibt es, dass du sagst, dieser unser Weise sei nirgend zu finden. Nicht denken wir dies als nichtigen Glanz menschlicher Charakterstärke aus, und nicht ersinnen wir ein großartiges Bild von einer Sache ohne Realität, sondern wie wir ihn uns vorstellen, haben wir ihn (als wirklich) erwiesen, werden wir ihn erweisen, selten vielleicht und in den großen Abständen von Zeitaltern nur einen (nicht nämlich gibt es Großes, das übliche und gewöhnliche Maß Übertreffendes häufig); übrigens gerade dieser Cato, von dessen Erwähnung diese Erörterung ausgegangen ist – vielleicht steht er oberhalb unseres Idealbildes.«
Marcus Cato, bekannt als »Cato der Jüngere«, war römischer Senator und politischer Gegner von Julius Caesar. Als römischer Aristokrat war Cato ein Kind seiner Zeit und in ihren Denkweisen verhaftet. So vermochte er beispielsweise nicht zu erkennen, dass die Republik, die er so vergötterte, auf Sklaverei und militärischen Eroberungen fußte und von großer Ungleichheit gekennzeichnet war – wenngleich nicht in solchem Maße wie später im Kaiserreich der Fall, das Cato verhindern wollte.
Als er sich im Jahr 72 v. Chr. freiwillig meldete, um gegen den rebellischen Sklaven Spartakus zu kämpfen, dachte er sicher keine Sekunde darüber nach, ob der Aufstand nicht womöglich als Reaktion auf extreme Ungerechtigkeit durchaus berechtigt sein könnte. Und wie die meisten Römer dürfte sich Cato kaum daran gestört haben, dass die Frauen in seiner Gesellschaft sich mit einer untergeordneten Stellung bescheiden mussten.
Mit anderen Worten: Heute würden seine politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen mit Pauken und Trompeten durchfallen. Bleibt die Frage, ob er sich überhaupt völlig über seine eigenen Verhältnisse hätte erheben können? Würde man ihn mit einer solchen Erwartungshaltung nicht zu einer gottgleichen Gestalt machen, die zustande bringen soll, was kein menschliches Wesen vermag? Richtiger scheint mir auf jeden Fall, ihn an den Standards seiner Kultur und seiner Epoche zu messen – und wenn man die zugrunde legt, ist er tatsächlich ein Vorbild.
Trotz seiner Einbindung in die Denkweisen seiner Zeit war Cato nämlich ein ungewöhnlicher Bursche. Mit vierzehn fragte er etwa seinen Erzieher Sarpedon, weshalb niemand einschreite, um die illegalen Machenschaften des Diktators Lucius Cornelius Sulla zu stoppen. Als Sarpedon antwortete, dass die Leute Sulla mehr fürchteten als hassten, erwiderte Cato: »Gebt mir ein Schwert, auf dass ich mein Land von der Sklaverei befreie.«
Womit er, versteht sich, natürlich nicht die wirkliche Sklaverei meinte, sondern die politische Versklavung.
Bereits der junge Cato galt als Verteidiger von Moral und Recht und in philosophischen Kreisen als Vorbild für einen praktizierten Stoizismus. Dazu gehörte, dass er sehr bescheiden lebte, obgleich er ein großes Vermögen geerbt hatte. Als man dem Achtundzwanzigjährigen das Kommando für eine Militäraktion in Makedonien übertrug, marschierte er an der Seite seiner Männer und teilte mit ihnen Nahrung und Schlafquartier. Kein Wunder, dass seine Legionäre ihn verehrten – auch weil er als unbestechlich galt, damals wie heute ein nicht allzu häufig anzutreffender Charakterzug.
Als Gegner politischer Amtsanmaßung geriet Cato fast zwangsläufig in einen offenen Konflikt mit Caesar, der in Sullas Fußstapfen getreten war, dem römischen Senat den Krieg erklärte und die Umwandlung der Republik zum Kaiserreich vorbereitete. Alea iacta est – »Der Würfel ist gefallen« –, soll er gesagt haben. Der Rest ist, wie man sagt, Geschichte: Nach einer anfänglichen Niederlage schlugen Caesars Truppen die Senatsarmee, und als Cato sich weigerte, die Niederlage anzuerkennen, verfolgte der neue Stern am römischen Himmel ihn und bezwang ihn in einer Entscheidungsschlacht. Cato, der Caesar nicht lebend in die Hände fallen wollte, machte es nach Art der alten Römer und versuchte, mit seinem Dolch Selbstmord zu begehen. Den dramatischen und ziemlich krassen Rest hat Plutarch überliefert:
»Weil die verletzte Hand dem Stoße nicht den gehörigen Nachdruck geben konnte, starb er nicht gleich auf der Stelle, sondern fiel in der Todesangst vom Bette und machte durch das Umwerfen eines daneben stehenden geometrischen Tisches ein starkes Poltern, sodass die Bedienten, die es hörten, laut aufschrien und sein Sohn mit den Freunden sogleich hereinstürzte. Man fand ihn in seinem Blute liegen, und die meisten Eingeweide zum Leibe heraushängen; doch lebte er noch und sah um sich. Dieser Anblick setzte alle in die größte Bestürzung, der Arzt aber trat hinzu und suchte, die Eingeweide, die unverletzt geblieben waren, wieder an ihren Ort zu bringen und die Wunde zuzunähen. Darüber erholte sich Cato wieder, und da er zur Besinnung kam, stieß er den Arzt von sich, öffnete mit seinen Händen die Wunde, zerriss die Eingeweide und gab auf diese Weise den Geist auf.«
Caesar war von der Todesnachricht nicht begeistert, fühlte sich offenbar um die Genugtuung betrogen, mit Cato nach seinem Gusto verfahren zu können. »O Cato, ich missgönne dir diesen Tod, denn du hast mir auch die Erhaltung deines Lebens nicht gegönnt«, soll er gesagt haben trotz dieses entsetzlichen Sterbens. Immerhin erklärt Letzteres, weshalb Seneca an einen solchen Mann dachte, als es um echte stoische Vorbilder ging.
Womöglich haben Sie nach diesen Exkursen über Folter, Isolationshaft sowie Catos unappetitlichen Selbstmord den Eindruck gewonnen, dass Stoizismus nichts für zarte Gemüter ist. Darauf bezog sich ebenfalls mein Kollege, der Philosoph Nigel Warburton: »Wie sieht es denn mit dem gewöhnlichen Leben aus, in dem die Menschen kaum einmal solchen Extremsituationen begegnen oder ein solches Maß an Mut und Durchhaltevermögen zeigen müssen?«
Eine gute Frage, auf die es sogar eine ziemlich einfache Antwort gibt: Wenn wir von großen Taten hören, werden wir nicht allein davon inspiriert, was Menschen im Extremfall zu leisten vermögen. Implizit werden wir außerdem daran erinnert, wie viel leichter unser Leben heutzutage meist ist.
Und so sollte es eigentlich gar nicht so viel Mut brauchen, um sich dem Chef entgegenzustellen, wenn er Ihren Kollegen schlecht behandelt, oder? Schlimmstenfalls werden Sie gefeuert – Sie riskieren weder Einzelhaft noch Folter. Wie schwierig ist es wirklich, sich im Alltagsleben anständig zu verhalten, obwohl keine schwerwiegenden Folgen zu erwarten sind? Wo es, verglichen mit Beispielen aus der Geschichte, um so gut wie nichts geht? Stellen Sie sich einfach mal vor, um wie vieles besser die Welt wäre, wenn wir alle jeden Tag ein bisschen mehr Mut aufbringen würden, einen etwas schärferen Sinn für Gerechtigkeit und unsere Handlungen öfter einer mäßigenden Gewissensprüfung unterzögen. Die Geschichten über Cato, Stockdale und die anderen, denen wir in diesem Kapitel begegnet sind, sollten uns dabei helfen, so die stoische Spekulation, die Dinge ins rechte Licht zu rücken – und das heißt, etwas bessere Menschen zu werden, als wir es bislang sind.