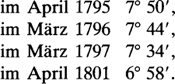
in die
des
Neuen Kontinents
Am 17. März [1801] morgens erblickten wir das östlichste Inselchen der Gruppe der Kleinen Caymans. Nachdem ich die ungefähre Berechnung mit der chronometrischen Länge verglichen batte, erkannte ich, daß die Strömungen uns in der Zeit von 17 Stunden 20 Meilen westwärts gebracht hatten. Das Inselchen, welches die englischen Seefahrer Caymanbrack und die spanischen Cayman chico oriental nennen, bildet eine Felsenwand, kahl und steil nach Süden und Südosten abfallend. Sein nördlicher und nordwestlicher Teil ist niedrig, sandig und mit wenig Vegetation bedeckt. Der Felsen hat ziemlich dünne, horizontale Schichten. Nach seiner weißen Farbe und wegen der Nähe der Insel Cuba würde ich ihn für Jurakalk halten. Wir näherten uns dem östlichen Ende des Caymanbrack bis auf eine Entfernung von 400 Toisen. Die benachbarte Küste ist nicht ganz frei von Gefahren und unter dem Wasser liegenden Klippen; indessen hatte die Temperatur des Meeres auf der Oberfläche nicht merklich abgenommen. Sie zeigte 25,5°; während ich sie unter 20° 25′ Breite auf offener See und 15 lieues von Caymanbrack den Cayos de los doce leguas entfernt zu 25,3° des hundertteiligen Thermometers gefunden hatte. An anderem Ort habe ich an die Zweifel erinnert, welche über die astronomische Lage der Großen und Kleinen Caymans so lange bestanden. Auch werden diese Zweifel wohl dann erst ganz behoben werden, wenn ein und derselbe Beobachter mit mehreren Chronometern die drei Inselchen nacheinander untersucht und ihre Länge und Entfernungen in Verknüpfung mit dem Meridian des Kaps San Antonio bestimmt haben wird. Die Uhr von Louis Berthoud gab mir als Länge des östlichen Kaps von Caymanbrack 82° 7′ 37″ an, die Länge des Hafens von Batabanó von 84° 45′ 56″ und der Stadt Trinidad de Cuba von 82° 21′ 7″ vorausgesetzt. Die durch ungefähre Berechnung reduzierte Breite und die Kompaßstriche des Windes zur Meridianbeobachtung schienen mir 19° 40′ 50″ zu ergeben. Don Ciriaco Cavallos, der diese Gegenden ein Jahr nach mir besucht hat, berechnete sie zu 19° 42′; aber die Länge, die er nach der Zeitübertragung von Aguadilla auf Puerto Rico annimmt, ist 8′ östlicher als die meinige. Unter den Steuermännern ist die Meinung sehr verbreitet, daß um die Cayman-Gruppe herum die Abweichung der Magnetnadel sehr verschieden von der sei, die man am westlichen Ende von Jamaica und bei der Insel Pinos beobachtet. Die kalkartige Natur des Felsens und die in diesen Gegenden angestellten magnetischen Versuche sprechen indes nicht für solche Vermutung. Wenn man auf einem Meer navigiert, dessen Strömungen mit den Winden und den Jahreszeiten wechseln, und wenn man nur sehr unvollkommen die relative Lage des Abfahrtpunkts und die Inselchen, die man vermeiden will, kennt, ist es wohl natürlich, daß man eben diese Inselchen oft gerade da erscheinen sieht, wo man sie am wenigsten erwartet. Man beschuldigt dann den Kompaß, während man nur die Ungewißheiten ungefährer Berechnung oder die Unvollkommenheit der astronomischen Geographie beklagen sollte.
Solange wir Sicht auf den Felsen von Caymanbrack hatten, schwammen Seeschildkröten von außerordentlicher Größe um unser kleines Fahrzeug. Die Menge dieser Tiere ließ Christoph Columbus der ganzen Gruppe der Caymans den Namen des Felsens der Schildkröten (Peñascales de las Tortugas) geben. Die Matrosen wollten, um einige zu fangen, ins Wasser springen; aber eine so große Anzahl Haifische begleitete sie, daß der Versuch zu gefahrvoll gewesen wäre. Die Haifische bissen in starke eiserne Haken, die man ihnen vorhielt und die gut zugespitzt und in Ermanglung an Leinen befestigter Angelhaken am Tauwerk befestigt waren; auf diese Weise gelang es, sie bis zum halben Leib hervorzuziehen, und wir sahen mit Verwundern, obgleich ihr Rachen von Blut troff, daß sie stundenlang von neuem nach dieser Art Angelhaken griffen. An Bord eines spanischen Schiffs erinnert der Anblick dieser Haifische die Matrosen an die Lokalmythe der Küsten Venezuelas, wo einst der Segen eines heiligen Bischofs das Verhalten der Haifische milderte, die sonst überall der Schrecken der Seefahrer sind. Sollten diese sanften Haifische des Hafens von Guaira in ihrer Art von denen verschieden sein, die im Hafen Havannas oft die schrecklichsten Unfälle verursachen? Und gehören sie vielleicht zur kleinen Gruppe der glatten Haie (emissoles), die Cuvier unter dem Namen Meerquappe (musteli) von der Meersau (milandre) getrennt hat?
Der Wind blies immer stärker aus Südosten, je mehr wir uns dem Kap Negril und dem westlichen Ende der großen Víbora-Bank näherten. Wir sahen uns oft genötigt, das Segel zu reffen, und waren bei der außerordentlichen Kleinheit unseres Fahrzeugs fast beständig unter Wasser. Den 18. März [1801] mittags befanden wir uns unter 18° 17′ 40″ Breite und 81° 50′ Länge. Der Horizont war bis zur Höhe von 15° mit den rötlichen Dünsten bedeckt, die unter den Wendekreisen so verbreitet sind und die auf der Oberfläche des Erdballs immer ohne Wirkung auf das Hygrometer zu sein scheinen. Wir kamen 50 Meilen westlich von Kap Negril des Südens ungefähr auf die Stelle, wo mehrere Karten eine isolierte Untiefe angeben, deren Lage an die von Sancho Pardo gegenüber dem Kap San Antonio de Cuba erinnert. Auf dem Grund sahen wir keine Veränderung. Es scheint, daß der Rocky shoal, 4 Faden von Kap Negril, ebensowenig wie der Felsen (Cascabel) vorhanden ist, von dem man so lange glaubte, er bezeichne das östliche Ende der Víbora (Pedro Banc), ebenso wie Portland Rock oder la Sola das östliche Ende meint. Den 19. März, um 4 Uhr abends, kündete uns die schlammige Farbe des Meeres an, daß wir den Teil der Víbora-Bank erreicht hatten, wo man nicht mehr 15, sondern kaum noch 9 bis 10 Faden Wassertiefe findet. Unsere chronometrische Länge betrug 81° 3′; unsere Breite wahrscheinlich unter 17°. Ich war erstaunt, bei der Beobachtung des Mittags unter einer Breite von 17° 7′ noch keine Veränderung in der Farbe des Wassers zu sehen. Da ich zweimal die Bank in ihrer Länge und Breite befahren und versucht habe, die Lage der gefährlichsten Orte festzustellen, wird mir erlaubt sein, hier zu bemerken, daß nur die Karte des Kapitäns de Mayne mit dem übereinstimmend schien, was ich selbst über die wahre Gestalt und die südlichen und östlichen Grenzen der Víbora-Bank beobachtet habe. Diese Karte bezeichnet sehr genau unter 16° 54′ und 17° 5′ Breite und 81° 2′ Länge die plötzliche Abnahme der Tiefe, die ich soeben erwähnte, sowie die Lage der Klippen 24 Meilen südöstlich der Pedro Cayos (Nordostcayos), auf denen wir bei der Fahrt von Nueva Barcelona nach Havanna in der Nacht vom 6. Dezember [1800] in Gefahr gewesen waren zu scheitern. Die spanischen Fahrzeuge, die von Batabanó oder von Trinidad de Cuba nach Cartagena bestimmt sind, gehen gewöhnlich über den westlichen Teil der Víbora-Bank mit 15 bis 16 Faden Tiefe. Die Gefährlichkeit der unter dem Wasser liegenden Klippen fängt erst beim Meridian von 80° 45′ westlicher Länge an. Wenn man über den südlichen Saum der Bank streift, wie es die Steuerleute bei der Überfahrt von Cumaná oder von anderen Häfen der Tierra Firme nach Gran Cayman oder nach Kap San Antonio oft zu tun pflegen, muß man auf steilen Küsten der Bank nicht über eine Breite von 16° 47′ gehen. Glücklicherweise zieht sich die Strömung über die ganze Bank südwestlich.
Betrachtet man die Víbora-Bank nicht als ein untergetauchtes Land, sondern als einen erhöhten Teil der Oberfläche der Erdkugel, der nicht das Niveau des Meeres erreichen konnte, sieht man mit Verwunderung, daß dieses große submarine Inselchen gleich den nahen Landstrichen von Jamaica und Cuba seine größten Höhen am östlichen Ufer hat. Hier befinden sich Portland Rock, Pedro Kays und South Kays umgeben von gefährlichen, unter dem Wasser liegenden Klippen. Der Grund hat 6 bis 8 Faden; doch gegen die Mitte der Bank, längs ihrer Kammlinie, wird er erst nach Westen, dann nach Nordosten allmählich 10, 12, 16 und 19 Faden tief. Betrachtet man auf einer Karte die Nähe der hohen Landesteile von Santo Domingo, Cuba und Jamaica, die an Windward Channel angrenzen, die Lage des Inselchens Navaza und die der Bank von Hormigas zwischen den Kaps Tiburón und Morant, endlich die Klippenkette, die sich von der Víbora-Bank über Bajo Nuevo, Serranilla und Quita-Sueño bis zum Mosquito-Sund hinzieht, dann kann man in diesem System von Inselchen und Untiefen die fast ununterbrochene Spur einer gratartigen Erhebungslinie, die von Nordosten nach Südosten streicht, nicht verkennen. Diese Kammlinie und der alte Damm, der durch die Sancho-Pardo-Klippe das Kap San Antonio mit der Halbinsel Yucatán verband, teilt das große Meer der Antillen in drei besondere Becken, denen ähnlich, die man vom Mittelmeer kennt. Ich habe bei dieser Überfahrt, so wie früher, als ich auf einem amerikanischen Schiff mit dem Kapitän Newton von Nueva Barcelona nach Havanna ging, den Einfluß untersucht, den die Tiefe des Meeres auf die Temperatur seiner Oberfläche ausübt; doch sind diese wiederholten Versuche nicht glücklich gewesen. Zwischen Caymanbrack und dem Parallelkreis des Kaps Negril, folglich nördlich der Víbora-Bank, fand ich im tiefsten Wasser 25,5 bis 25,8°. Auf der Bank selbst, bei 9 oder 10 Faden Tiefe, zeigte das trübste Meerwasser noch 25,6°. Ist es die Schnelligkeit der Strömungen, welche die Bank keine Wirkung auf die Temperatur ausüben läßt? Mehr gegen Norden, zwischen den Jardines und Jardinillos und besonders bei den Klippen von Diego Pérez war nach der Veränderung des Grundes bis 4,2° Unterschied. Im Campeche-Sund sinkt bei 15 Faden die Temperatur der Oberfläche um 2,5°; auf der großen Neufundland-Bank habe ich (im Juli 1804) das Thermometer zwischen 8,3 und 12,2° gefunden, während es sich fern der Bank, außerhalb des Gulfstream, bei 19,4° hielt, im Gulfstream stand es auf 21,1°. Herr Sabine betrachtet auch in seinem mit ausgezeichneten Beobachtungen angefüllten Werk über die Verteilung der Wärme auf dem Erdball die Schnelligkeit der Strömungen als die wahre Ursache des Nichteinwirkens gewisser Untiefen auf die Temperatur des Ozeans. Dieser Umstand ist für die Sicherheit der Schifffahrt sehr wichtig. Eine plötzliche Veränderung in der Wärme des Wassers muß jedesmal die Aufmerksamkeit der Seefahrer auf sich ziehen; sie deutet entweder einen Wechsel der Strömungen oder die Nähe einer Bank an; aber so wie es Bänke gibt, die sich nicht durch die Farbe des Wassers offenbaren, ebenso gibt es deren auch, die keine merkliche Wirkung auf die Temperatur des Ozeans ausüben. Überhaupt scheint es mir (und noch während der vier Tage, die ich auf der großen Neufundland-Bank zugebracht habe, ist mir dieser Unterschied aufgefallen), daß die Abnahme der Temperatur am bedeutendsten am steilen Abfall der Bänke ist und wenig gegen die Mitte zunimmt. Sollte diese Erscheinung nicht beweisen, daß die Kälte der Untiefen weniger durch die Wasserteilchen erzeugt wird, die während des Winters oder der Nacht im Sommer auf der Oberfläche des Ozeans erkalten und auf den Grund sinken, als durch die Erhebung der unteren Schichten des Ozeans und deren Vermischung mit den oberen Schichten am Steilabfall der Bank?
Die Farbe des trüben Wassers auf der Untiefe der Víbora-Bank ist eigentlich nicht milchig wie in den Jardinillos und auf der Bank von Bahama, sondern schmutziggrau. Diese Verschiedenheit der Färbung, die auf der Neufundland-Bank, im Archipel der Bahama-Inseln und auf der Víbora-Bank so auffällt, und diese veränderliche Menge erdiger Teile, die in dem mehr oder minder trüben Gewässer der Sunde schweben, können durch das ebenso veränderliche Einsaugen der Lichtstrahlen bis zu einem gewissen Punkt beitragen, die Temperatur des Meeres zu modifizieren. Da wo die Untiefen auf ihrer Oberfläche 8 bis 10° kälter als das sie umgebende Meer sind, darf man sich über den Wechsel des Klimas, den sie örtlich hervorbringen, nicht wundern. Daß eine Masse sehr kalten Wassers wie auf der Neufundland-Bank in der Strömung der Küstenstrecke von Peru (zwischen dem Hafen von Callao und Punta Pariña) oder in der afrikanischen Strömung am Kap Verde auf die Atmosphäre des Meeres und auf das Klima der benachbarten Länder einwirkt, ist natürlich; doch weniger begreiflich ist, daß sehr schwache Veränderungen der Temperatur (z.B. ein hundertteiliger Grad auf der Víbora-Bank) der Atmosphäre der Untiefen einen besonderen Charakter geben können. Wirken diese unter dem Meer befindlichen Inselchen auf die Bildung und Anhäufung der Dunstbläschen in einer anderen Weise als durch das Abkühlen des Wassers der Oberfläche?
Als wir die Víbora-Bank verließen, wollten wir zwischen Bajo Nuevo und der Klippe von Comboy hindurchfahren. Man glaubte damals, Bajo Nuevo liege im Meridian des westlichen Endes der Víbora-Bank, unter 81° 28′ Länge und 15° 57′ Breite. Einige Jahre später, 1804, wurde der Fregattenkapitän Don Manuel del Castillo, Mitarbeiter des Herrn Fidalgo, abkommandiert, um die Lage der Felsen von Roncador, Serrana, Serranilla und der benachbarten gefährlichen Stellen zu bestimmen; und dieser setzte die Bajo Nuevo in eine Breite von 15° 49′ und eine Länge von 80° 56′. Wäre diese Angabe richtig, was ich übrigens bezweifle, müßten wir am Tag des 20. März [1801], als wir uns mittags in einer Breite von 16° 5′ befanden, diese Untiefe fast berührt haben. Meine chronometrische Länge betrug am 19. März auf der Víbora-Bank 81° 6′; am 22. März auf dem Parallelkreis von 13° 41′ aber 80° 49′. Aus diesen zuverlässigen Angaben geht hervor, daß, ohne auf partielle, von der Strömung bewirkte Abweichungen zu rechnen, unser Weg uns unter dem Meridian von 80° 55′ durch den Parallelkreis des Bajo Nuevo geführt haben muß. Der geschickte Seefahrer de Mayne scheint völlig an der Existenz dieser Untiefe zu zweifeln und bezeichnet auf seiner Karte nur Comboy (unter 15° 40′ Breite und 80° 12′ Länge), das Castillo vergeblich zwischen 15° 45′ und 15° 54′ Breite gesucht hatte. Man muß hoffen, daß neue Beobachtungen die Länge von Bajo Nuevo, das für die von Havanna nach Portobelo und Cartagena gehenden Schiffe so gefährlich werden kann, feststellen können. Ich habe geglaubt, nicht mit Stillschweigen die Zweifel übergehen zu dürfen, die eigene Erfahrung mir eingeflößt hat. Die Temperatur des Meeres war unter einer Breite von 16° 5′ und 13° 36′ beständig 26,6°; 26,8°; 26,5°.
Den 22. März [1801]. – Wir fuhren über 30 lieues westlich an Roncador vorbei. Diese Untiefe führt den Namen der Schnarcher, weil nach alten Traditionen die Steuerleute versichern, daß man es in weiter Ferne schnarchen (roncar) höre. Ereignet sich dieses Geräusch wirklich, so gründet es sich wahrscheinlich auf ein periodisches Zurückströmen der in einem höhlenreichen Felsen zusammengepreßten Luft. Ich habe die gleiche Erscheinung an mehreren Küsten beobachtet, unter anderem auf den Lava-Vorgebirgen von Teneriffa, im Kalk Havannas und im Granit Unter-Perus zwischen Trujillo und Lima. Auf den Canarischen Inseln hatte man sogar den Plan entworfen, eine Maschine auf dem Ausstrom der zusammengepreßten Luft anzubringen und das Meer als Bewegungskraft zu gebrauchen. Während im Meer der Antillen, mit Ausnahme der Küsten von Cumaná und Caracas, die Herbstäquinoktien (el cordonazo de San Francisco) überall gefürchtet werden, haben die Frühlingsäquinoktien dagegen keinen Einfluß auf die Ruhe dieser tropischen Gegenden – eine Erscheinung, die fast das Umgekehrte von der ist, die man in den höheren Breiten beobachtet. Seitdem wir die Víbora-Bank verlassen hatten, blieb das Wetter bemerkenswert schön. Die Meeresfläche, indigoblau, zuweilen blaßviolett, wegen der zahllosen Menge Medusen und Fischeiern (purga de mar), die es bedeckten, war nur leicht bewegt. Das Thermometer hielt sich im Schatten auf 26 bis 27°; keine Wolke zeigte sich am Horizont, und doch ging der Wind beständig von Norden oder höchstens Nordnordwest. Sollte man diesem Wind, der die höheren Schichten der Atmosphäre abkühlte und darin Eiskristalle bildete, die Höfe zuschreiben, die sich zwei Nächte hintereinander um den Mond zusammenzogen? Der Umfang dieser Halos war jedesmal nur klein, von einem Durchmesser von 45°. Ich habe niemals Gelegenheit gehabt, welche zu sehen und zu messen, deren Durchmesser 90° erreicht. Dem Verschwinden eines dieser Mondhöfe folgte die Bildung einer dicken schwarzen Wolke, welcher einige Regentropfen entfielen; bald aber nahm der Himmel wieder seine unveränderliche Heiterkeit an, und man sah eine lange Reihe Sternschnuppen und Feuerkugeln, die sich in gleicher, dem Wind der unteren Regionen entgegengesetzter Richtung bewegten.
Den 23. März [1801]. – Der Vergleich der Schätzung mit der chronometrischen Länge zeigte die Stärke einer Strömung, die nach Westsüdwesten trieb. Auf dem Parallelkreis von 17° war ihre Geschwindigkeit 20 bis 22 Meilen in 24 Stunden. Ich fand die Meerestemperatur ein wenig gefallen und unter der Breite von 12° 35′ nur noch bei 25,9° (die Luft 27,0°). Den ganzen Tag hindurch bot das Himmelsgewölbe ein merkwürdiges Schauspiel, das selbst auf die unempfindlichsten Matrosen Eindruck machte und von mir schon am 13. Juni 1799 bemerkt worden war. Keine Wolke war zu erblicken; nicht einmal etwas von jenen leichten Dünsten, die man die „trockenen“ nennt; und dennoch färbte die Sonne die Luft und den Horizont des Meeres mit einem schönen Rosenrot. Der Nacht zu bedeckten zuerst dicke bläuliche Wolken den Himmel, und als diese verschwanden, sah man in unermeßlicher Höhe leichte Wölkchen, regelmäßig in Zwischenräumen und in zusammenlaufenden Streifen angeordnet. Die Richtung dieser Streifen ging von Nordnordwest nach Südsüdost, oder noch genauer Nord 20° West, folglich der Richtung des magnetischen Meridians entgegen. Sollte die gleichförmige Bedeutung der Zwischenräume dieser kleinen Dunstgruppen als Wirkung eines elektrischen Abstoßens zu betrachten sein, so wie eine solche in den Lichtenbergschen Figuren auf dem Elektrophor [Kondensator], in der Gefrierung der Dünste auf unseren Fensterscheiben und in den Dendriten des Mangans, welche die Risse im Jurakalk ausfüllen, zu bemerken ist? Ich sah mit Verwunderung, daß die Konvergenzpunkte oder die Pole dieser Wolkenstreifen nicht unbeweglich blieben, sondern sich nach und nach den Weltpolen näherten, ohne sie jedoch zu erreichen. Gegen 2 Uhr morgens wurden die Dünste unsichtbar. Seitdem habe ich häufig dieses Phänomen beobachtet, das an einige Erscheinungen bei Nord- und Südlichtern erinnert und gewiß nicht die bloße Wirkung einer optischen Täuschung ist (parallelgehende Streifen von Wolken in der Richtung des Windes). In Quito, Mexico, Italien und Frankreich zeigt es sich in allen Jahreszeiten, besonders in sehr ruhigen Nächten. Ich habe es in meinen Tagebüchern mit dem Namen „bewegliche und unbewegliche Polarstreifen“ bezeichnet. Die letzteren befinden sich öfters im magnetischen Meridian des Ortes. Viele Naturforscher in Europa haben ihre Aufmerksamkeit auf diese Streifen gerichtet; und es ist zu wünschen, daß man genau das Azimut ihrer Pole, die Richtung und Schnelligkeit ihrer Bewegung und ihr Verhältnis zur stündlichen Deklination und zur Intensität der magnetischen Kräfte mißt.
Den 24. März [1801]. – Wir kamen in eine Art von Golf hinein, der östlich die Küsten von Santa Marta und westlich die von Costa Rica begrenzt; denn die Mündungen des Río Magdalena und des Río San Juan de Nicaragua befinden sich unter dem gleichen Parallelkreis, beinahe bei 11° Breite. Die Nähe des Pazifischen Ozeans, die Gestalt der benachbarten Landesteile, die geringe Breite des Isthmus von Panamá, das Niedrigerwerden des Bodens zwischen dem Golf von Papagayo und dem Hafen San Juan von Nicaragua, endlich die Nachbarschaft der Schneeberge von Santa Marta und viele andere Umstände, die hier aufzuzählen zu weit führen würde, geben diesem Golf ein besonderes Klima. Die Atmosphäre wird durch seine heftigen Winde bewegt, die man im Winter unter dem Namen brizotes de Santa Marta kennt. Legt sich ein solcher Wind, treibt die Strömung nach Nordosten; und der Kampf der kleinen Winde aus Osten und Nordosten mit der Strömung läßt das Meer hoch und in starken Wellen gehen. Bei Windstille wird die Fahrt der Schiffe, die von Cartagena nach dem Río Sinú, der Mündung des Atrato und Portobelo segeln, durch die Küstenströmung sehr aufgehalten. Die brizotes dagegen meistern die Bewegung des Wassers und geben ihm eine entgegengesetzte Richtung nach Westsüdwesten. Diese letztere Bewegung nennt der Major Rennell in seinem großen, geistreichen hydrographischen Werk drift, und er unterscheidet sie von den eigentlichen Strömungen, die nicht von der örtlichen Wirkung des Winds, sondern von Verschiedenheiten im Niveau der Oberfläche des Ozeans, von Anhäufungen und Auftürmungen des Wassers in sehr entfernten Gegenden herrühren. Die Beobachtungen, welche bereits über die Stärke und Richtung der Winde, über die Temperatur und Schnelligkeit der Strömungen und über den Einfluß der Jahreszeiten oder der sich immer verändernden Abweichung der Sonne gesammelt wurden, sind hinreichend gewesen, wenigstens im großen das verwickelte System dieser pelagischen Flüsse aufzuklären, die die Oberfläche des Ozeans durchschneiden; aber weniger leicht ist es, die Ursachen der Veränderungen zu ergründen, welche die Bewegung der Gewässer in ein und derselben Jahreszeit und bei ein und demselben Wind erfährt. Warum treibt der Gulfstream bald auf die Küsten von Florida, bald auf den Rand der Bahama-Bank zu? Warum fließt das Wasser während ganzer Wochen von Havanna nach Matanzas und (um ein Beispiel des Corriente por arriba anzuführen, der zuweilen im östlichsten Teil der Tierra Firme bei gleich schwachem Wind bemerkt wird) warum von Guaira nach dem Cap Codera und nach Cumaná?
Den 25. März [1801]. – Je mehr wir uns den Küsten von Darién näherten, desto heftiger ging der Wind aus Nordosten. Wir hätten glauben können, in ein anderes Klima versetzt zu sein. Während der Nacht wurde das Meer stürmisch; doch erhielt sich die Temperatur des Wassers (unter 10° 30′ bis 9° 47′ Breite) auf 25,8°. Wir erblickten morgens beim Aufgang der Sonne einen Teil des Archipels von San Bernardo, der im Norden den Golf von Morrosquillo schließt. Ein heller Strich zwischen den Wolken erlaubte mir, Stundenwinkel zu nehmen. Das Chronometer zeigte an der kleinen Insel Mucara eine Länge von 78° 13′ 54″. Wir kamen beim südlichsten Ende des Placer de San Bernardo vorbei. Das Wasser war milchfarbig, obgleich ein Senkblei von 25 Faden keinen Grund fand; Erkaltung des Wassers war nicht zu bemerken, wahrscheinlich abermals wegen der Schnelligkeit der Strömung. In der Ferne ragten die Berge von Tigua über dem Archipel von San Bernardo und dem Kap Boquerón hervor. Das stürmische Wetter und die Schwierigkeit, gegen den Wind zu segeln, bewogen den Kapitän unseres erbärmlichen Fahrzeugs, Schutz in der Reede des Río Sinú zu suchen oder, besser gesagt, nahe bei der Punta del Zapote, am Ende des östlichen Ufers der Ensenada [Bucht] de Cispata, in welche sich der Río Sinú oder Zenu der ersten conquistadores ergießt. Es regnete sehr stark, und ich benutzte diese Gelegenheit, um die Temperatur des Regenwassers zu messen, die ich bei 26,3° fand, während das Thermometer in der Luft und an einer Stelle, wo die Kugel nicht benäßt wurde, sich bei 24,8° hielt. Dieses Resultat wich bedeutend von dem ab, welches ich in Cumaná erlangt hatte, wo das Regenwasser um einen Grad kälter als die Luft war.
Auf die Tierra Firme des südlichen Amerika zurückgekehrt, will ich noch einen letzten Blick auf das ganze Becken des Meeres der Antillen werfen und in einer Tabelle die Temperatur-Angaben vereinigen, die meine Tagebücher über die Fahrt zur See enthalten. Hinzu füge ich, was ich den handschriftlichen Noten verschiedener Reisender entnehmen konnte, die sich auf meine Bitte denselben Nachforschungen gewidmet und ihre Thermometer mit Sorgfalt berichtigt haben.
[Es folgen an dieser Stelle: Tabellen der Oberflächentemperaturen des Antillenmeeres im Süden des Yucatán-Kanals mit Erläuterungen; Tabelle der Oberflächentemperatur des Atlantischen Ozeans in den Zonen von 0 bis 45° nördlicher Breite; Resultate; mittlere Oberflächentemperaturen des nördlichen Atlantischen Ozeans mit Erläuterungen. RH, III, S. 513–530; Paulus Usteri u.a., 6.Teil, S. 21–50].
Unsere Überfahrt von der Insel Cuba nach den Küsten des südlichen Amerika fand ihr Ziel an der Mündung des Río Sinú und dauerte 16 Tage. Die Reede bei Punta del Zapote, wo wir Anker warfen, hatte einen sehr schlechten Ankergrund. Wegen des stürmischen Meeres und des heftigen Wellenschlags hatten wir Mühe, die Küste mit unserem Boot zu erreichen. Wie schön erschien uns dieses Land! Wie mußte es der kleinen Zahl Reisender erscheinen, die, für die Reize der Natur empfänglich, beim Anblick eines dichten, von Palmen überkrönten Waldes ihren Genuß nicht nach der Zivilisation des Ortes, wo sie landeten, bemaßen! Alles verkündete uns, daß wir eine wilde, selten von Fremden besuchte Region betraten. Nur aus wenigen zerstreuten Häusern bestand das Dorf Zapote. Hier, in einer Art von Schuppen, fanden wir viele Schiffsleute, alles Farbige, versammelt, die in Pirogen den Río Sinú herabgefahren waren, um Mais, Bananen, Federvieh und andere Lebensmittel nach dem Hafen von Cartagena zu bringen. Diese Pirogen von 50 bis 60 Fuß Länge gehörten größtenteils Pflanzern (haciendados) aus Lorica. Der Wert ihrer Ladungen belief sich bei den größeren Fahrzeugen auf 2000 Piaster. Der Boden solcher Pirogen ist flach, und sie können das Meer nicht befahren, wenn es sehr stürmisch ist. Seit 10 Tagen wehten an dieser Küste die brizotes mit Heftigkeit aus Nordosten, während wir in offener See bis zu 10° Breite nur einen leichten Wind und ein beständig ruhiges Meer gehabt hatten. In den Luft- wie in den Meeresströmungen bewegen sich zuweilen einige Schichten mit außerordentlicher Schnelligkeit, während andere, ihnen ganz nahe, fast unbeweglich bleiben. Die Zambos des Río Sinú langweilten uns durch ihre unnützen Fragen über den Zweck unserer Reise, unsere Bücher und den Gebrauch unserer Instrumente; dabei blickten sie mißtrauisch auf uns; um uns ihrer Neugierde zu entziehen, gingen wir trotz des Regens in den Wald, um zu herborisieren. Wie gewöhnlich hatte man versucht, uns vor den Boas (traga-venado), den Vipern und Jaguaren große Angst einzuflößen; doch ein langer Aufenthalt in den Missionen der Chaimas-Indianer und am Orinoco hatte uns an diese Übertreibungen gewöhnt, die weniger der Leichtgläubigkeit der Eingeborenen beizumessen sind als ihrem böswilligen Vergnügen, die Weißen zu plagen. Wenn man die Küsten von Zapote, die mit Rhizophora-Bäumen [Rhizophora Mangle] [Mangroven. Anmerkung des Hrsg.] bedeckt sind, verläßt, tritt man in einen Wald, bemerkenswert durch eine große Verschiedenartigkeit der Palmen. Wir sahen hier dicht aneinandergedrängt die Stämme des Corozo del Sinú, unser ehemaliges Genus Alfonsia, das Öl in Überfluß gibt; Cocos butyracea, hier palma dulce oder palma real genannt, sehr verschieden von der palma real auf der Insel Cuba; die palma amarga mit gefächerten Blättern, die zum Decken der Dächer benutzt werden, und die Latta, ähnlich der kleinen Palme Piritu am Orinoco. Schon den ersten conquistadores war diese Verschiedenheit der Palmen aufgefallen. Die Alfonsia oder vielmehr die Art der Elaeis, die wir an keinem anderen Ort gesehen haben, erreicht nur eine Höhe von 6 Fuß; ihr Stamm ist unförmig dick und die Fruchtbarkeit ihrer Blütenscheiden so groß, daß sie über 200.000 Blüten enthalten. Obgleich von diesen (ein einziger Baum hat oft über 600.000) eine große Anzahl nicht zur Reife gelangt, bleibt doch der Boden mit einer dicken Fruchtschicht bedeckt. Derselbe Anblick hat sich uns oft im Schatten der Mauritia-Palmen, des Cocos butyracea, des Sejé und des Pihiguao am Atabapo wiederholt. Keine andere Familie der Baumpflanzen besitzt eine solche Zeugungskraft in der Entwicklung ihrer Blütenorgane. Man zerstößt die Mandel des corozo del Sinú im Wasser; und nachdem die oben schwimmende Ölschicht durch Sieden gereinigt worden ist, ergibt sie die manteca de corozo, ein dickeres Öl als das der Cocospalme, das zur Beleuchtung der Kirchen und Häuser gebraucht wird. Die Palmen der Abteilung der Cocoineen des Herrn Brown sind die Oliven der tropischen Region. Als wir weiter in den Wald kamen, stießen wir auf kleine Fußwege, die erst neulich mit der Axt geschlagen zu sein schienen. Ihre Krümmungen führten uns zu einer großen Menge neuer Pflanzenarten: Mougeotia mollis, Nelsonia albicans, Melampodium paludosum, Jonidium anomalum, Teucrium palustre, Gomphia lucens und ein neues Genus der Composeen, Spiracantha cornifolia. An den feuchten Stellen duftete ein wunderschönes Pancratium und ließ uns vergessen, wie gefährlich der Eintritt in diese finsteren, sumpfigen Wälder für die Gesundheit ist.
Nachdem wir ungefähr eine Stunde gegangen waren, fanden wir an einem freien Platz mehrere Menschen mit der Ernte des Palmweins beschäftigt. Die schwärzliche Hautfarbe der Zambos kontrastierte wunderbar mit der eines kleinen Mannes von blonden Haaren und bleichem Gesicht, der keinen Teil an der Arbeit zu nehmen schien. Ich hielt ihn anfangs für einen Schiffsjungen, der irgendeinem nordamerikanischen Fahrzeug entsprungen sein mochte, wurde aber bald aufgeklärt, als sich dieser blonde blasse Mann als einer meiner Landsleute, der an den Küsten der Ostsee geboren war, zu erkennen gab. Er hatte in der dänischen Marine gedient und wohnte seit einigen Jahren am Río Sinú in der Nähe von Santa Cruz de Lorica. Nach Zapote war er gekommen, um, wie die Müßiggänger im Lande sagen, „andere Länder zu sehen und sich ein wenig zu ergehen (para ver tierras y pasear no más)“. Der Anblick eines Menschen, der ihm von seinem Vaterland erzählen konnte, schien wenig Reiz für ihn zu haben; und da er das Deutsche fast vergessen hatte, ohne doch im Kastilischen sich deutlich ausdrücken zu können, war unsere Unterhaltung nicht gerade sehr belebt. Während meiner fünfjährigen Reise im spanischen Amerika habe ich nur zweimal Gelegenheit gehabt, meine Muttersprache zu reden. Der erste Preuße, dem ich begegnete, war ein Matrose aus Memel, der auf einem Schiff von Halifax diente und sich nicht eher zu erkennen geben wollte, als bis er einige Flintenschüsse auf unsere Piroge gefeuert hatte. Dieser zweite vom Río Sinú war durchaus friedfertig. Ohne auf meine an ihn gerichteten Fragen zu antworten, wiederholte er unaufhörlich mit einem stillen Lächeln, das Land sei warm und feucht, in den pommerschen Städten seien die Häuser schöner als in Santa Cruz de Lerica, und ein längeres Verweilen in den Wäldern werde uns unfehlbar die calenturas, die dreitägigen Fieber, woran er selbst lange krank gelegen hatte, zuziehen. Wir hatten Mühe, dem braven Mann unseren Dank für so wohlmeinenden Rat zu beweisen; denn nach der Strenge seiner Grundsätze, die man sogar für etwas aristokratisch hätte halten können, durfte ein Weißer, ginge er auch barfuß, niemals Geld in der Gegenwart „dieses schlechten gelben Volkes (gente parda)“ annehmen. Weniger geringschätzig als unser europäischer Landsmann, grüßten wir höflich die Gruppe der Farbigen, die beschäftigt war, mit großen tutumas oder Früchten der Crescentia cujete Palmwein in die Stämme der umgefällten Bäume zu füllen. Wir baten sie, uns diese Arbeit zu erklären, die wir schon in den Missionen der Katarakte sahen. Der Weinstock des Landes ist die palma dulce, der Cocus butyracea, den man in der Nähe von Malgar im Magdalenental Weinpalme und hier wegen seines majestätischen Wuchses Königspalme nennt. Nachdem der Stamm, der gegen die Höhe nur wenig abnimmt, umgeworfen ist, wird unterhalb des Blätter- und Blütenwuchses im holzigen Teil eine Aushöhlung, 18 Zoll lang und 8 Zoll breit, 6 Zoll eingetieft. Man bearbeitet diese Höhlung so, als wolle man einen Nachen bauen. Nach drei Tagen findet sie sich mit einem weißgelblichen, sehr klaren Saft gefüllt, der einen zucker- und weinartigen Geschmack hat. Die Gärung scheint beim Fällen des Stamms anzufangen, aber die Vitalität seiner Gefäße erhält sich, denn wir sahen, daß der Ausfluß des Safts selbst dann noch stattfindet, wenn der Gipfel der Palme (der Teil, dem die Blätter entstammen) einen Fuß höher als das untere Ende, das der Wurzeln, gelegt ist. Der Saft steigt fortwährend in die Höhe, so wie in den baumartigen Euphorbien, die eben gefällt sind. Während 18 bis 20 Tagen sammelt man täglich von diesem Palmwein; er ist weniger süß, hat aber mehr Weingeist und ist beliebter. Ein Baum gibt bis zu 18 Flaschen Saft, jeder von 42 Kubikzoll Inhalt. Die Eingeborenen versichern, daß der Ausfluß reichhaltiger sei, wenn man die Blattstengel, die am Stamm bleiben, verbrennt.
Die große Feuchtigkeit und Dichte des Waldes nötigte uns zur Rückkehr, um vor dem Untergang der Sonne das Ufer zu erreichen. An vielen Stellen zeigte sich dichter Kalkstein, vielleicht von tertiärer Formation; doch erschwerte eine dicke Lage von Ton und Dammerde die nähere Beobachtung; eine Schicht von glänzendem Kohlenschiefer schien mir jedoch auf eine ältere Formation zu deuten. Herr Pombo bestätigt in einem namens der Handelskammer von Cartagena erstatteten Bericht ausdrücklich, daß es wirkliche Steinkohlen an den Ufern des Sinú gebe. Wir begegneten Zambos, die auf ihren Schultern Zylinder von palmito trugen, der so unzweckmäßig Palmkohl genannt wird; sie waren 3 Fuß lang und 5 bis 6 Zoll dick; das Sternartige gab ihnen ein blendendes Weiß. Es scheint, daß in diesen Gegenden seit Jahrhunderten die Palmschäfte eine beliebte Nahrung gewesen sind. Ich halte sie für völlig harmlos, obgleich die Historiker erzählen, daß zur Zeit, als Alonso López de Ayala Gouverneur von Urabá war, viele Spanier starben, weil sie „unmäßig vom palmito gegessen und zugleich Wasser getrunken“ hätten. Vergleicht man die krautartigen Fasern der jungen, noch nicht entwickelten Palmblätter mit dem Sago der Mauritia, aus dem die indianischen Guaraunos Brot, welches dem aus der Jatrophawurzel ähnlich ist, zubereiten, dann wird man unwillkürlich an die auffallende Analogie erinnert, welche die neuere Chemie zwischen den Holzfasern und dem Wurzelmark gefunden hat. Wir verweilten am Ufer, um Flechten, Opegraphen und viele Arten Schwämme (Boletus, Hydnum, Helvela, Thelephora) zu pflücken, die am Rhizophora-Baum [Mangrove] hingen und zu meiner großen Verwunderung dort gediehen, obgleich das Salzwasser sie bespülte. Die Nacht überraschte uns; und da wir das Mißgeschick hatten, bei der Rückfahrt zu unserem Schiff in einem kleinen Kanu ein Ruder zu zerbrechen, gelang es nur mit Mühe, uns auf einem starkwogenden Meer wieder einzuschiffen.
Bevor wir diese Küste verlassen, die so selten von Reisenden besucht wird und noch in keinem neueren Werk beschrieben ist, will ich hier einige während meines Aufenthalts in Cartagena erhaltene Notizen zusammenstellen. Der Río Sinú nähert sich in seinem Oberlauf den Zuflüssen des Atrato, der von derselben Wichtigkeit für die gold- und platinreiche Provinz Choco ist, wie es der Magdalenenstrom für Cundinamarca oder der Río Cauca für die Provinzen Antioquia und Popayán sind. Die drei großen eben genannten Flüsse bilden bis jetzt die einzigen Handelswege, man kann fast sagen, die einzigen Verkehrsmittel für die Einwohner. In einer Entfernung von 12 lieues von der Mündung des Río Atrato nimmt dieser östlich den Río Sucio auf, an dessen Ufer das indianische Dorf San Antonio liegt; fährt man ihn aufwärts über den Río Pabarando hinaus, gelangt man in das Tal des Río Sinú. Nach mehreren fruchtlosen, vom kriegerischen Geist des Erzbischofs Gongora diktierten Versuchen, Kolonien in Nord-Darién und auf der östlichen Küste des Golfs von Urabá anzulegen, riet der Vizekönig Espeleta dem Hof, seine ganze Aufmerksamkeit auf den Río Sinú zu wenden, die Kolonie auf Cayman zu zerstören, die Kolonisten im spanischen Dorf San Bernardo del Viento, in der Gerichtsbarkeit von Lorica, zu sammeln und von diesem Posten, welcher der westlichste ist, die friedlichen Eroberungen des Ackerbaus und der Zivilisation gegen die Ufer des Pabarando, Río Sucio und Atrato auszudehnen. Die Anzahl der unabhängigen Indianer, welche die Landstriche zwischen Urabá, Río Atrato, Río Sucio und Río Sinú bewohnen, betrug nach einer Zählung (padrón) im Jahre 1760 weniger als 1800, die in drei kleinen Dörfern (Suraba, Toanequi und Jaraguai) verteilt waren. Zur Zeit meiner Reise rechnete man diese Bevölkerung zu 3000 Einwohnern. Diese Eingeborenen, in der allgemeinen Benennung Caymanes, leben in Frieden mit den Bewohnern von San Bernardo del Viento (pueblo de Españoles), das auf dem westlichen Ufer des Río Sinú tiefer als San Nicolás de Cispata und nahe an der Mündung des Flusses liegt. Sie haben nicht die Wildheit der Indianer von Darién und Cunas, die auf dem linken Ufer des Atrato wohnen und oft die für den Handel der Stadt Quibdó in Choco bestimmten Pirogen angreifen, ja selbst in den Monaten Juli und November Streifzüge in das Gebiet von Urabá machen, um die Früchte der Cacao-Bäume einzusammeln, welche noch Überbleibsel der ehemaligen Anpflanzungen französischer Kolonisten sind. Der Cacao von Urabá ist vortrefflich, und die Indianer von Darién verhandeln ihn mit anderen Erzeugnissen zuweilen an die Bewohner des Río Sinú, indem sie in das Tal dieses Flusses durch eines der in ihn fließenden Gewässer, den Jaraguai, gelangen.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß am Anfang des 16. Jahrhunderts der Golf von Darién als eine kleine Bucht im Lande der Cariben angesehen wurde. Das Wort Caribana hat sich noch im Namen des östlichen Kaps dieser Bucht erhalten. Wir wissen nichts über die Sprachen der Indianer von Darién, Cunas und Caymanes; auch nicht, ob sich caribische oder aruakische Wörter in ihrer Mundart wiederfinden; aber trotz Anghieras Zeugnis über die Stammverwandtschaft der Cariben der Kleinen Antillen und der Indianer von Urabá nennt sie Pedro de Cieça, der so lange unter diesen letzteren lebte, niemals Cariben oder Kannibalen. Er beschreibt die Männer dieses Stamms als nackt, mit langen Haaren, die benachbarten Länder durchwandernd, um Handel zu treiben; die Frauen als reinlich, gut gekleidet und gekämmt und außerordentlich zuvorkommend (amorosas y galanas). „Ich habe in keinem der indianischen Länder, die ich besuchte“, erzählt der conquistador, „schönere Frauen gesehen, nur haben sie den Fehler, zu häufige Gespräche mit dem Teufel zu führen.“
Der Río Sinú ist durch seine Lage und Fruchtbarkeit von höchster Wichtigkeit für die Versorgung der Festung Cartagena mit Lebensmitteln. In Kriegszeiten stellen sich die feindlichen Schiffe gewöhnlich zwischen den Morro de Tigua und die Boca de Matunilla. Sie sind in dieser Stellung öfters den Angriffen der Kanonierschaluppen von Cartagena ausgesetzt gewesen. Diese können den Kanal von Pasacaballos durchfahren, der bei Santa Ana die Insel Baru vom Kontinent trennt. Seit dem 16. Jahrhundert ist Lorica die bedeutendste Stadt am Río Sinú geblieben; aber ihre Bevölkerung, die sich 1778 unter der Statthalterschaft des Don Juan Díaz Pimienta auf 4000 Seelen belief, hat seitdem beträchtlich abgenommen, da nichts geschehen ist, die Stadt gegen die Überschwemmungen und die von ihnen erzeugten tödlichen Dünste zu schützen.
Die einst so beträchtlichen Goldwäschen des Río Sinú, besonders zwischen seinen Quellen und dem Dorf San Gerónimo, haben beinahe gänzlich aufgehört, so wie die der Ciénega de Tolu, Urabá und aller Flüsse, die dem Gebirgsstock von Abibe entströmen. „Darién und Zenu“, sagt der Baccalaureus Enciso in seinem Anfang des 16. Jahrhunderts herausgegebenen ›Précis de Géographie‹, „sind so reich an Goldklumpen, daß man dieses Metall mit Netzen im fließenden Wasser fischt.“ Durch diese Erzählungen gelockt, schickte der Gouverneur Pedrarias 1515 seinen Leutnant Francisco Becerra nach dem Río Sinú. Diese Unternehmung hatte die traurigsten Folgen; denn Becerra wurde mit seiner Mannschaft von den Eingeborenen niedergemetzelt, von welchen die Spanier nach damaliger Sitte viele als Sklaven fortgeführt hatten, um sie auf den Antillen zu verkaufen. Gegenwärtig, wo die Provinz Antioquia mit ihren goldführenden Gängen den Bergwerksspekulationen ein so weites Feld eröffnet, wäre es ohne Zweifel klug, in den fruchtbaren Landstrichen des Sinú, Río Domaquiel, Urabá und Darién del Norte den Goldwäschen die Kultur der Kolonialprodukte, besonders des Cacao, der hier von der vortrefflichsten Qualität ist, vorzuziehen. Die Nähe des Hafens von Cartagena würde auch die äußerst vernachlässigte China-Ernte für den europäischen Handel wichtig werden lassen. Dieser kostbare Baum wächst bei den Quellen des Río Sinú und in den Gebirgen von Abibe und Maria. Nirgendwo anders, mit Ausnahme der Sierra Nevada von Santa Marta, findet sich die echte fiebervertreibende Chinarinde mit haariger Blütenkrone der Küste so nahe. Eine vom Prior des Consulado in Cartagena, Don Ignacio Pombo, verfaßte Denkschrift enthält die nützlichsten Ansichten über die Kolonisation des Río Sinú, über die Einrichtung einer Post, die zu Lande von Lorica nach Urabá und von da zu Wasser nach Quibdó, nach Zurücklassung der Korrespondenz von Antioquia an der Mündung des Bebará gehen müßte, und über den Handel mit Bauholz, zu welchem die von der Sierra da Abibe und den Bergen des Choco herabkommenden Flüsse wie der Sinú, Damaquiel, Suriquilla, Sucio und Atrato einzuladen scheinen.
Der Río Sinú und der Golf von Darién sind nicht von Columbus besucht worden. Der westlichste Punkt, an dem dieser große Mann am 26. November 1503 das Land betrat, ist Puerto de Retreto, gegenwärtig Puerto de Escribanos genannt, in der Nähe von Punta de San Blas, im Isthmus von Panamá. Zwei Jahre früher hatten Rodrigo de Bastidas und Alonso de Ojeda, von Amerigo Vespucci begleitet, die ganze Küste der Tierra Firme vom Golf von Maracaibo bis Puerto de Retreto entdeckt. Da ich in den vorhergehenden Bänden oft Gelegenheit hatte, von Neu-Andalusien zu sprechen, will ich hier nur eine historische Bemerkung über den ursprünglichen Sinn dieser Benennung wiedergeben. Ich habe diese zum ersten Mal in dem Vertrag gefunden, den Alonso de Ojeda mit dem conquistador Diego de Sicuessa abschloß, einem mächtigen Mann, wie die zeitgenössischen Historiker sagen, „weil er ein schmeichelnder Höfling voll glücklicher Einfälle war". Man nannte 1508 Neu-Andalusien das ganze Land vom Cap de la Vela bis zum Golf von Urabá, wo die Canilla del Oro anfing. Der Río Sinú gehörte folglich damals zu Neu-Andalusien – ein Name, der seitdem auf die Provinz Cumaná beschränkt worden ist.
Ein glücklicher Zufall hat mich im Lauf meiner Reisen an die beiden Enden der Tierra Firme geführt, an die gebirgige, grünende Küste von Paria, wohin Christoph Columbus in seiner poetischen Begeisterung die Wiege des Menschengeschlechts setzte, und an die seichten, feuchten Küsten, die sich von der Mündung des Río Sinú gegen den Golf von Darién erstrecken. Der Vergleich dieser wieder verwilderten Landstriche bestätigt, was ich anderswo über den wunderlichen und zuweilen rückläufigen Gang der Zivilisation in Amerika gesagt habe. Auf der einen Seite war es die Küste von Paria, die Insel Cubagua und Margarita, auf der anderen der Golf von Urabá und von Darién, welche die ersten spanischen Kolonisten aufnahmen. Der Reichtum an Gold und Perlen, der sich seit undenklicher Zeit in den Händen der Eingeborenen aufgehäuft hatte, gab seit Anfang des 16. Jahrhunderts diesen Gegenden eine populäre Berühmtheit. In Sevilla und in Toledo, in Pisa, in Genua und in Antwerpen wurden diese Namen gleich denen von Ormus und Calicut genannt. Die römischen Päpste erwähnten sie in ihren Bullen; Bembo nennt sie in den bewundernswerten Blättern, die Venedigs Ruhm erhöht und dessen Freiheit überlebt haben. Es liegt so etwas unendlich Verführerisches im ersten Helldunkel eines glücklichen Beginnens; die schöpferische Phantasie des Menschen vergrößert ungebunden, was erst entworfen ist. Dieser Reiz eines unbestimmten Hoffens, dieses Vergnügen, durch die Macht des Gedankens die engen Grenzen der wirklichen Welt zu erweitern, spricht sich überall aus: im Ursprung großer Entdeckungen wie in den nicht vollendeten Schöpfungen der zeichnenden Künste, in der ersten Entwicklung eines edlen Charakters wie in dieser unbefangenen zutraulichen Jugend der Völker, die sich am Aufbau ihres gesellschaftlichen Gebäudes versuchen.
Europa sah am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts in den Teilen der von Columbus, Ojeda, Vespucci und Rodrigo de Bastidas entdeckten Neuen Welt nur die Vorposten der weiten Länderräume von Indien und dem östlichen Asien, deren ungeheure Reichtümer an Gold und Diamanten, an Perlen und Gewürzen in den Erzählungen von Benjamin de Tudela, Marco Polo, Rubruk und Mandeville gepriesen worden waren. Mit einer von diesen Berichten erfüllten Einbildungskraft ließ Christoph Columbus am 12. Juni 1494 von einem Notar eine Urkunde aufnehmen, in welcher 60 seiner Gefährten, Steuerleute, Matrosen und Reisende an Eides Statt bezeugten, daß die südliche Küste von Cuba zum Kontinent von Indien gehöre. Die Beschreibung der Schätze von Catay und Cipango, der himmlischen Stadt Quinsai und der Provinz Mango, welche in seinen Jugendjahren seine Sehnsucht entflammt hatte, verfolgte ihn wie ein Phantom bis an das Ende seiner Tage. Als er auf seiner vierten und letzten Reise an den Küsten von Cariay (Poyais oder Mosquito-Coast), von Veragua und des Isthmus anlegte, glaubte er sich an den Mündungen des Ganges. Diese geographischen Täuschungen, dieser geheimnisvolle Schleier, der die ersten Entdeckungen umhüllte, trugen dazu bei, die Gegenstände zu vergrößern und die Aufmerksamkeit Europas auf Regionen zu lenken, deren Namen kaum bei uns bekannt sind. Neu-Cádiz, die Hauptniederlage für Perlenfischerei, erhob sich auf einem Inselchen, das wieder unbewohnt wurde. Das äußerste Ende der felsigen Küste von Paria ist gleichfalls verödet. Mehrere Städte unter den Namen Antigua del Darién, Urabá, San Sebastián de Buenavista wurden an der Mündung des Río Atrato gegründet. In diesen zu Anfang des 16. Jahrhunderts so berühmten Orten war nach der Aussage der Historiker die Blüte der kastilianischen Helden versammelt; von dort zog Balboa aus, um die Südsee zu entdecken; Pizarro, als er Peru eroberte und verheerte; Pedro de Cieça, der, immer kämpfend, die Andenkette über Antioquia, Popayán und Cuzco bis zum La-Plata-Strom verfolgte und hiermit einen Weg von 900 lieues zu Lande zurücklegte. Die Städte Dariéns sind zerstört worden; altes, verfallenes Gemäuer steht hier und da auf den Hügeln von Urabá, und europäische Fruchtbäume, unter die inländischen gemischt, bezeichnen allein dem Reisenden die Stelle, welche jene einst einnahmen. Fast im ganzen spanischen Amerika sind die von den conquistadores zuerst bevölkerten Länder in die Barbarei zurückgefallen. Andere, später entdeckte Gegenden haben die Aufmerksamkeit der Kolonisten angezogen. Dies ist der natürliche Gang der Dinge, wenn es darum geht, einen weiteren Kontinent zu bevölkern. Man kann hoffen, daß man auf niederere Orte, die zuerst ausgewählt worden waren, zurückkommen wird. Es ist kaum begreiflich, daß die Mündung eines großen Flusses, der einem gold- und platinreichen Land entströmt, unbewohnt geblieben ist. Indes hat der Atrato, ehemals Río del Darién, San Juan oder Dabaiba genannt, mit dem Orinoco ein gleiches Schicksal gehabt. Die Indianer, die um das Delta dieser Flüsse herumirren, sind im Zustand der Wildheit geblieben. Umsonst ruft man die großen Schatten von Christoph Columbus und Vespucci an, deren einer 1498 den Kanal von Pedernales, eine der Mündungen des Orinoco, und der andere 1501 den Golf von Urabá fand und untersuchte. Diese Daten allein genügen, um sich gegen den Schlendrian des Mutterlands und gegen den Geist der Jahrhunderte, die der Epoche der großen Entdeckungen folgten, zu verwahren.
Wir lichteten die Anker auf der Reede von Zapote am 27. März [1801] bei Sonnenaufgang. Das Meer war weniger unruhig und etwas wärmer, die Raserei des Windes jedoch noch die gleiche. Nördlich bis zum Morro de Tigua zog sich eine Reihe kleiner Felsenkegel von ungewöhnlicher Form hin, welche unter dem Namen Tetas de Santero, Tolú, Rincón und Chichimar bekannt und deren zwei letzte der Küste am nächsten sind. Einige Höhenwinkel der Tetas de Tolú gaben ihnen kaum eine Höhe von 240 Toisen; sie erheben sich inmitten der Savannen, in welchen man auf den Stämmen von Toluifera balsamum den köstlichen Balsam von Tolú sammelt, der ehemals in den europäischen Apotheken so berühmt war und mit dem man noch einen kleinen Handel am Corozal, Caimito und in der Stadt Tacasuan treibt. In den Savanas Altas del Tolú schweifen halbwilde Rinder und Maultiere umher. Viele dieser Berghügel zwischen Ciénega de Pesquero und Punta del Comissario sind gleich Basaltkegeln zu zweien gekuppelt; jedoch ist es sehr wahrscheinlich, daß sie wie die Tetas de Managua im Süden Havannas kalkartig sind. Wir fuhren in den Archipel von San Bernardo zwischen den Inseln Salamanquilla und dem Cap Boquerón. Kaum hatten wir den Golf von Morrosquillo verlassen, als das Meer so unruhig wurde, daß unser kleines Fahrzeug fast beständig unter Wasser war. Der Mond schien hell, und der Kapitän suchte vergebens Schutz an der Küste nördlich vom Dorf Rincón. Der Anker wurde bei 4 Faden Tiefe geworfen; doch da wir entdeckten, daß wir uns auf einem Korallenriff befanden, zogen wir vor, auf offener See zu lavieren.
Vom Morro de Tigua an, wo die Gruppe der kleinen Berge endet, von denen jeder einzeln aus der Ebene emporsteigt, ist die Konfiguration der Küste einzigartig. Zwischen den Bocas de Matuna und Matunilla befindet sich anfangs ein sumpfiges Terrain von 8 Quadratlieues, das sich durch die Ciénega de la Cruz mit dem Dique de Mahates und dem Río Magdalena verbindet. Die Insel Barú bildet mit der Insel Pierra Bomba den großen Hafen von Cartagena und ist eigentlich nur eine Halbinsel, 14 Meilen lang und vom Kontinent durch den schmalen Kanal von Pasacaballos getrennt. So wie eine Inselgruppe (der Archipel von Don Bernardo) dem Kap Boquerón gegenübersteht, so liegt ein anderer Archipel (von Rosario) beim südlichen Ende der Halbinsel Barú. Unter 10,75° und 11° Breite zeigt sich wieder diese Zerrissenheit der Küste. Die Halbinseln bei Ensenada de Galera de Zamba und bei dem Hafen von Sacanilla bieten denselben Anblick wie die Halbinsel Barú. Gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen hervorgebracht; und der Geognost darf diese Analogien in der Gestalt einer Küste nicht übersehen, die von der Punta Caribana bei der Mündung des Atrato bis über das Cap Vela hinaus in einer Länge von 120 lieues allgemein von Südwesten nach Nordosten reicht.
Der Wind legte sich während der Nacht. Wir konnten nur bis zu der Insel Arenas kommen, bei welcher wir Anker warfen. Ich fand ihre Länge 78° 2′ 10″, die von Cartagena zu 77° 50′ 0″ angenommen. Bei meiner Ankunft an diesem Ort konnte ich dieses chronometrische Resultat mit dem des Herrn Fidalgo vergleichen. Dieser geschickte Seefahrer setzte die Insel Arenas 10′ 35″ westlich vom Meridian der Kathedrale von Cartagena. Das Wetter wurde in der Nacht stürmisch. Wir gingen am Morgen des 29. März von neuem unter Segel, in der Hoffnung, noch am gleichen Tag in die Boca Chica einfahren zu können. Der Westwind wehte mit äußerster Heftigkeit, und wir konnten mit unserem zerbrechlichen Fahrzeug nicht gegen Strömung und Wind fahren. Selten habe ich das Meer ungestümer gesehen. Die Wellen brachen sich schäumend auf dem Verdeck. Wir lavierten in kurzen Zügen, als wir durch ein falsches Manöver bei der Befestigung der Segel (wir hatten nur vier Matrosen), vielleicht auch durch die Schuld des Steuermanns, für einige Minuten in augenscheinliche Gefahr gerieten. Der Kapitän, nicht gerade ein kühner Seemann, wollte nun nicht die Küste entlangfahren; so flüchteten wir uns mit Rückenwind in eine Bucht der Insel Barú, südlich von der Punta Gigantes. Es war Palmsonntag; und der Zambo, der uns zum Orinoco gefolgt war und uns erst bei unserer Rückkehr nach Frankreich verließ, erinnerte sich, daß wir im vergangenen Jahr am selben Sonntag nördlich von der Mission Uruana auch in Gefahr gewesen waren, durch einen Windstoß umzuschlagen.
Es sollte in der Nacht eine Mondfinsternis und am folgenden Tag eine Bedeckung des Sterns α der Jungfrau eintreten. Die Beobachtung dieses letzten Phänomens hätte für die Bestimmung der Länge von Cartagena sehr wichtig sein können. Umsonst bat ich den Kapitän, mir einen seiner Matrosen mitzugeben, der mich zu Lande nach der Schanze Boca Chica begleiten sollte. Die Entfernung betrug fünf Meilen. Man machte mir Einwendungen wegen des unbebauten Zustands dieser Gegenden, wo sich weder Wohnstätten noch Fußwege befänden. Ein kleines Ereignis, das uns den Palmsonntag noch unheilbringender hätte machen können, rechtfertigte die Vorsicht des Kapitäns. Bei schönem Mondschein wollten wir am Ufer Pflanzen sammeln und waren kaum in unserem Kanu dem Land nahe, als aus dem Gesträuch ein junger Neger trat, der ganz nackt, mit Ketten beladen und mit einem kurzen Säbel bewaffnet war. Er lud uns ein, an dem mit großen Rhizophora-Bäumen [Mangroven] bedeckten Gestade als einem Ort, wo keine Brandung zu befürchten sei, zu landen, und bot sich an, uns in das Innere der Insel Barú zu führen, wenn wir ihm einige Kleidungsstücke versprechen wollten. Sein hinterlistiges, wildes Aussehen, die oft wiederholte Frage, ob wir Spanier wären, und unverständliche Worte, die er an seine hinter den Bäumen versteckten Gefährten richtete, flößten uns Mißtrauen ein. Ohne Zweifel waren diese Schwarzen entlaufene Neger, dem Gefängnis entsprungene Sklaven. Diese Klasse von Unglücklichen ist am meisten zu fürchten; denn sie haben den Mut der Verzweiflung und einen durch die Härte der Weißen hervorgerufenen Durst nach Rache. Wir waren ohne Waffen; sie schienen zahlreicher als wir, und sie wollten uns vielleicht zum Landen überreden, um sich unseres Kanus zu bemächtigen; daher hielten wir es für klüger, nach unserem Schiff zurückzukehren. Der Anblick eines nackten, auf unbewohntem Strand umherirrenden Menschen, der um Hals und Arme Ketten, die er nicht ablösen kann, mit sich schleppt, ließ uns einen schmerzlichen Eindruck zurück; und dieser wurde noch durch das rohe Bedauern unserer Matrosen vermehrt, die gern an Land gegangen wären, um sich der Flüchtlinge zu bemächtigen und sie heimlich in Caragena zu verkaufen. In den Gegenden, wo Sklaverei herrscht, wird die Seele mit dem Anblick des Schmerzes vertraut und erstickt den Instinkt des Mitgefühls, der des Menschen Natur charakterisiert und erhebt.
Bei der Insel Barú, unter dem Meridian von Punta Gigantes vor Anker liegend, beobachtete ich die Mondfinsternis vom 29. März 1801. Der völlige Austritt fand statt um 11h 30′ 12,6″ mittlerer Zeit. Einige auf dem blauen Himmelsgewölbe zerstreute Dunstgruppen machten die Beobachtung des Austritts ungewiß. Ich maß die Zunahme der Verfinsterung mit dem Sextanten, eine Methode, die den Seefahrern nicht genug anzuempfehlen ist, weil man sie auch bei stürmischem Meer anwenden kann und sie die Beobachtungsmittel vervielfältigt. Um Nutzen aus einer Naturerscheinung zu ziehen, die allgemein als nicht besonders wichtig für die Bestimmung der Längen angesehen wird, muß man auf die zufällige Kompensation der Fehler rechnen können. Herr Oltmanns hat diese Beobachtung erörtert und daraus die Länge von 5h 11′ 22″ gefolgert. Das Chronometer gab mir 14,7″ als Unterschied der Meridiane von Punta Gigantes und Cartagena. Während der gänzlichen Verfinsterung hatte die Mondscheibe, wie es fast immer geschieht, ohne zu verschwinden, eine rötliche Färbung, der mit einem Sextantenglas beobachtete Rand aber eine wellige Bewegung trotz der bedeutenden Höhe des Gestirns. Es schien mir, daß der Mond lichtvoller blieb, als ich ihn je in der gemäßigten Zone gesehen habe. Begreiflich ist es, daß die Lebhaftigkeit des Lichts nicht vom Zustand der Atmosphäre allein abhängt, welche die Sonnenstrahlen mehr oder weniger geschwächt bricht, indem sie sie im Schattenkegel krümmt; aber sie wird auch durch die veränderliche Durchsichtigkeit des Teils der Atmosphäre modifiziert, durch den wir den verfinsterten Mond erblicken. Unter den Wendekreisen vermindern eine große Klarheit des Himmels und eine gleichförmige Verteilung der Dünste das Verschwinden des Lichts, welches uns die Mondscheibe zuwirft. Besonders auffallend war mir während der Verfinsterung ein Mangel von Gleichförmigkeit in der Verteilung des durch die Erdatmosphäre gebrochenen Lichts. Die Zentralregion der Scheibe zeigte eine Art abgerundeter Wolke, einen Schatten, dessen Bewegung von Osten nach Westen ging. Der Teil, wo der Austritt stattfinden sollte, war daher einige Minuten vorher viel heller als der westliche Rand. Soll man diese Erscheinung der ungleichen Reinheit unserer Atmosphäre, einer örtlichen Anhäufung von Dünsten zuschreiben, welche durch Absorption eines beträchtlichen Teils des Sonnenlichts dieses auf einer Seite weniger in den Schattenkegel der Erde eingehen ließe? Wenn eine ähnliche Ursache bei Zentralverfinsterung in Erdnähe zuweilen die Scheibe gänzlich unsichtbar macht, ist es nicht auch geschehen, daß man nur einen kleinen Teil des Mondes – eine unregelmäßig ausgezackte Scheibe – sah, von welcher verschiedene Teile sich nacheinander erhellten?
Am 30. März morgens umfuhren wir die Punta Gigantes, um nach der Boca Chica, der jetzigen Einfahrt des Hafens von Cartagena, zu segeln. Von hier bis zum Ankerplatz an der Stadt sind es noch 7 bis 8 Meilen; und obgleich wir einen práctico [Küstenlotse] genommen hatten, um uns durch die gefahrvollen Stellen zu bringen, stießen wir doch mehrmals auf Sandgrund. Im Augenblick der Landung hörte ich mit großem Vergnügen, daß die unter Herrn Fidalgos Befehl stehende Expedition zur Aufnahme der Küsten noch nicht in See gegangen sei. Dieser Umstand machte es mir nicht nur leicht, mich über die astronomische Lage mehrerer Städte des Litorals zu vergewissern, die mir als Anhaltspunkte gedient hatten, um die Längen der Llanos und des Orinoco chronometrisch zu bestimmen; sondern er trug auch bei, mich über die künftige Richtung meiner Reise nach Peru klarer sehen zu lassen. Die Überfahrt von Cartagena nach Portobelo und die Passage über den Isthmus, den Río Chagre und Cruces sind gleicherweise kurz und leicht; aber es stand zu befürchten, daß bei einem längeren Aufenthalt in Panamá, ehe sich eine Gelegenheit nach Guayaquil fände, die Südseefahrt in einer den Winden und Strömungen entgegengesetzten Richtung außerordentlich langwierig werden dürfte. Ich entsagte ungern der Hoffnung, mit Hilfe des Barometers die Berge des Isthmus zu nivellieren, obgleich es schwer gewesen wäre, damals vorauszusehen, daß bis zum Augenblick, wo ich diese Zeilen schreibe (1827), während so viele Messungen an anderen Punkten von Mexico und Columbia gemacht worden sind, man in derselben Unwissenheit über die Höhe des Gebirgszuges, welcher die Wasser des Isthmus scheidet, bliebe. Alle Personen, die wir um Rat fragten, waren sich einig, uns zu beweisen, daß die Landreise längs der Cordilleren, über Santa Fé de Bogotá, Popayán, Quito und Cajamarca, einer Seereise vorzuziehen sei und uns ein ungeheures Feld zu Nachforschungen bieten werde. Die Vorliebe der Europäer für die tierras frias, für das kalte und gemäßigte Klima, das auf dem Rücken der Anden herrscht, gab diesen Ratschlägen noch mehr Gewicht. Man wußte uns genau die Entfernungen anzugeben, doch man täuschte sich in der Berechnung der Zeit, die wir gebrauchen würden, um sie auf Maultieren zurückzulegen; und man schien keine Ahnung zu haben, daß ein Weg von 600 lieues, der bei jedem Schritt für Geographie und Botanik Interesse bietet, über 18 Monate erforderte, um von Cartagena nach Lima zu gelangen. Trotz dieser Verzögerung oder vielmehr eben wegen der Langsamkeit, womit wir über Cundinamarca durch die Provinzen Popayán und Quito gegangen sind, bereue ich es nicht, der Reise von Bogotá die Passage über den Isthmus geopfert zu haben. Diese Abänderung meines Weges hat mir Gelegenheit gegeben, die Karte des Río Magdalena zu zeichnen, die astronomische Lage von 80 binnenländischen Punkten zwischen Cartagena, Popayán, dem Oberlauf des Amazonenstroms und Lima zu bestimmen, den Fehler in der Länge Quitos zu finden, einige tausend neue Pflanzen zu sammein und in großem Maßstab die Beziehungen zu beobachten, welche die Gesteine von syenitischem Porphyr und Trachyt mit der Glut der Vulkane haben.
Die Resultate dieser Arbeiten, deren Wichtigkeit zu würdigen mir nicht zusteht, sind schon vor langer Zeit publiziert worden. Meine in Kopien seit 1802 in Amerika und Spanien vervielfältigte und das Land zwischen Almaguer und Santa Marta von 1° 54′ bis 11° 15′ Breite umfassende Karte des Río Magdalena ist 1816 erschienen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte kein Reisender die Beschreibung Neu-Granadas unternommen, und das Publikum, außer in Spanien, kannte die Befahrung des Magdalenastroms nur durch einige von Bouguer verfaßte Zeilen; dieser Gelehrte hatte den Strom von Honda abwärts befahren; da es ihm aber an astronomischen Instrumenten fehlte, konnte er bloß 4 oder 5 Breiten mittels eilig verfertigter kleiner Gnomone bestimmen. Heutzutage haben sich die Reisebeschreibungen von Amerika eigentümlich vermehrt. Durch politische Ereignisse sind in die Länder, welche sich freie Institutionen gegeben haben, eine Menge Personen geführt worden, die sich bei ihrer Rückkehr in Europa dann vielleicht zu sehr beeilten, ihre Tagebücher zu publizieren. Sie haben die Städte, worin sie sich aufgehalten haben, sowie die Ansichten einiger durch Schönheit der Landschaft ausgezeichneter Punkte beschrieben und uns mit der Kleidung und Nahrung der Einwohner und den verschiedenen Arten, in Kanus, auf Maultieren oder auf Menschenrücken zu reisen, bekannt gemacht. Diese Werke, von denen mehrere unterhaltsam und instruktiv sind, haben die Völker der Alten Welt mit denen des spanischen Amerika, von Buenos Aires und Chile bis Zacatecas und Neu-Mexico, vertraut werden lassen. Es ist zu bedauern, daß der Mangel einer gründlichen Kenntnis der spanischen Sprache und einer gehörigen Sorgfalt in der Angabe der Namen der Ortschaften, Flüsse und Stämme die wunderlichsten Mißverständnisse verursacht hat; betrüblich ist es auch (und die Bewohner des südlichen Amerika haben sich besonders darüber zu beklagen), daß in einer würde- und geschmacklosen Sprache die Sitten der Einwohner auf die ungerechteste und geringschätzigste Weise geschildert werden. Indem man mit Leichtsinn das Ernsteste der menschlichen Natur berührt und die Völker wie Individuen charakterisieren will, hat man noch in unseren Tagen in einigen Reisebeschreibungen die Aufzählung von Lastern und Tugenden, womit die alten Lehrbücher der Geographie verunstaltet sind und die nur auf vagem Volksglauben beruhten, wieder aufleben lassen. Man hat vergessen, daß die großen menschlichen Gesellschaften, in dem, was ihre Neigungen Edles oder Verkehrtes haben, doch sämtlich eine gewisse Familienähnlichkeit zeigen und sie sich nur durch stufenweise Nuancen einiger intellektueller Fähigkeiten und seelischer Dispositionen voneinander unterscheiden, deren Störung das, was man Fehler des Nationalcharakters nennt, konstituiert.
In der verspäteten Herausgabe meiner ›Relation Historique‹, der ich wissenschaftliche Werke von eingeschränkterem Interesse habe vorausgehen lassen, sind mir Reisende zuvorgekommen, die Amerika 25 Jahre nach mir besucht haben. Ich darf mir dessenungeachtet schmeicheln, daß alles, was die folgenden Blätter Wesentliches bieten, heute noch ebenso neu sei, als ob ich es unmittelbar nach meiner Rückkehr in Europa bekanntgemacht hätte. Eine solche Behauptung könnte denen anmaßend und verwegen scheinen, die sich vorstellen, daß eine Region schon bekannt sei, sobald sie in allen Richtungen von Armeen durchkreuzt oder von einer Menge wegen Handelsspekulationen angezogener Europäer besucht worden ist; man wird sie aber tadellos und natürlich finden, wenn man sich auf den Boden begibt, den sich der Verfasser dieses Werkes vorzugsweise gewählt hat. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, seit den bloß astronomischen Beobachtungen von La Condamine, Bouguer, Don Jorge Juan und von Ulloa, bis zum Zeitpunkt meiner Reise ist keine Zeile in Europa veröffentlich worden, welche, selbst auf die unvollkommenste Weise, von der Gestalt der Oberfläche, der Ausdehnung und Höhe der Hochebenen, den Modifikationen des Klimas oder den Mitteltemperaturen, dem Anblick und der Verteilung der Pflanzenwelt, der geognostischen Beschaffenheit des Bodens und den Veränderungen in der Neigung und Intensität der Magnetnadel gehandelt hätte. Die Unabhängigkeitskriege haben diese schönen Regionen des Erdballs dem europäischen Gewerbefleiß und Handel geöffnet; aber die Schriften, die seitdem über die Republiken Colombia und Peru erschienen sind, stammen von Personen, die nach ihren Beschäftigungen und vielleicht auch nach dem Maß ihrer Kenntnisse nicht imstande waren, über die Physikalische Geographie der von ihnen besuchten Gegenden Licht zu verbreiten. Ich habe bei der Redaktion meines Tagebuchs alles unterdrückt, was schon über den Aspekt und die Bauart der Städte, die Kleidung der verschiedenen Menschenklassen, das Materielle des gewöhnlichen Lebens und die Transportmittel gesagt worden ist. Ich habe mich besonders der Polemik enthalten, die die Lektüre der Reisen so ermüdend macht, und habe mich bei meinem eifrigsten Wunsch, Irrtümer zu vermeiden, nicht mit den Meinungen anderer, die über denselben Gegenstand schrieben, beschäftigt. Ich wünschte der Beschreibung meiner Reise ihre Unabhängigkeit von vorübergehenden Umständen und den ihr eigenen Charakter eines wissenschaftlichen Werkes zu bewahren. Um diesen Zweck zu erreichen, habe ich mich besonders bemüht, der Einbildungskraft des Lesers das Naturgemälde der Cordilleren und der Ebenen darzustellen, dieser Kräfte einer mächtigen und bewegten Natur, die wechselweise erzeugt und zerstört, diesen ewigen Einfluß, den die Gestalt der Erde, der Lauf der Flüsse, die sich durchschneiden, und die Pflanzenschicht, die sie bedeckt, auf den gesellschaftlichen Zustand, die Institutionen und die Schicksale der Völker ausüben.
*
Während der sechs Tage, die wir in Cartagena verbrachten, waren unsere interessantesten Streifzüge nach der Boca Grande und dem Hügel Popa, der die Stadt beherrscht und eine sehr weite Aussicht bietet, gerichtet. Der Hafen, oder vielmehr die Bahía, ist 9½ Meilen lang, wenn man die Gesamtlänge von der Stadt an (bei der Vorstadt Jehemani oder Xexemani) bis zu der Ciénega de Coco rechnet. Diese Ciénega ist eine der Buchten der Insel Barú, südwestlich des Estero de Pascaballos, durch den man zum Eingang in den Dique de Mahates gelangt. Die beiden Enden der kleinen Insel Pierra Bomba bilden nordwärts mit einer Landzunge des Kontinents, südwärts mit dem Kap der Insel Barú die beiden einzigen Einfahrten in die Bai von Cartagena, von denen die erste Boca Grande, die zweite Boca Chica heißt. Diese ungewöhnliche Bildung des Terrains hat seit einem Jahrhundert ganz entgegengesetzte Theorien über die Verteidigung eines Platzes verursacht, der nach Havanna und Puerto Cabello der wichtigste der Tierra Firme und der Antillen ist. Die Ingenieure sind im Widerspruch hinsichtlich der Wahl der Öffnungen gewesen, die geschlossen werden sollten, und man hat nicht, wie in mehreren Werken erzählt wird, nach der Landung des Admirals Vernon 1741 zum ersten Mal den Plan gefaßt, die Boca Grande zu verschütten. Die Engländer erzwangen die kleine Einfahrt, als sie sich zum Herrn der Bai machten; da sie aber die Stadt Cartagena, die tapferen Widerstand leistete, nicht einnehmen konnten, zerstörten sie das Castillo Grande, auch Santa Cruz genannt, und die zwei kleinen Schanzen San Luis und San José, welche die Boca Chica verteidigten. Diese Ereignisse machten einen tiefen Eindruck in Gegenden, deren Bewohner an einen ununterbrochenen Frieden gewöhnt waren. Die Sorglosigkeit, mit welcher 1735 der Dienst in der Festung Cartagena versehen wurde, war so groß, daß „die Schildwachen, ohne abgelöst zu werden, während zwei oder drei Monaten ihre Schilderhäuser bewohnten, darin wie in einem Landhaus schliefen und am Tag zum Arbeiten nach der Stadt gingen".
Die unnütze Sorge, welche die Nähe der Stadt bei der Boca Grande einigen Ingenieuren einflößte, war der Grund, weshalb nach der englischen Expedition der Hof von Madrid beschloß, diese Einfahrt bis zu einer Entfernung von 2640 varas [span. Ellen] zu schließen. Man fand 2½ bis 3 Faden Wasser und errichtete auf Pfählen eine Mauer oder vielmehr einen Steindamm, 15 bis 20 Fuß hoch. Seine Abdachung nach der Seite des Meeres ist ziemlich ungleich und selten von 45 Grad. Dieses ungeheure Werk wurde unter dem Vizekönig Espeleta im Jahre 1795 vollendet und hat mehrere hundert Galeerensklaven das Leben gekostet. Nach den Rechnungen, die man in der Contaduria findet, beliefen sich die Kosten auf anderthalb Millionen Piaster; aber es ist wahrscheinlich, daß der General Arevalo 400.000 Piaster, die von den für die Befestigungen der Boca Chica und Castillo de San Lazaro bestimmmten Geldern genommen wurden, hinzugefügt hat. Diese Befestigungen sind nach den vom Brigadier Don Agustín Cramer entworfenen Plänen seit 1786 ausgeführt worden; doch muß die Zuschüttung der Boca Grande nicht diesem geschickten Ingenieur zugeschrieben werden. Als er die festen Plätze Cartagena und Portobelo besichtigte, war die Arbeit schon begonnen, und man weiß aus mündlichen Überlieferungen, daß er diesem Unternehmen ebenso wie Don Jorge Juan ablehnend gegenüberstand. Der Kunst ist es nicht gelungen, die Natur zu besiegen. Das Meer zielt darauf, die Boca Chica mit Anschwemmungen zu schließen, während es unaufhörlich daran arbeitet, die Boca Grande zu öffnen und zu erweitern. Die Strömungen, die während eines großen Teils des Jahres, besonders bei heftigem Wehen der vendavales [Seewinde], von Südwesten nach Nordosten treiben, schwemmen Sand in die Boca Chica und selbst in die Bai. Das Fahrwasser von 17 bis 18 Faden Tiefe wird immer enger, und wenn man nicht ein regelmäßiges Ausräumen durch Bagger einführt, werden die Schiffe nicht mehr hineinkönnen ohne Gefahr, mehrmals zu stranden. Diese kleine Einfahrt ist es, die man hätte schließen sollen; sie hat nur 260 Toisen Öffnung, und das Fahrwasser oder der schiffbare Kanal nimmt 110 Toisen ein. Die Untiefe der Salmedina-Bank macht sie für Schiffe, die aus Nordwesten kommen, gefährlich, und ihre Entfernung vom Hafen oder dem Ankerplatz nahe bei der Stadt (7 Meilen Distanz) würde im Fall eines Angriffs von der Seite des Ozeans das Auslaufen der Kriegsschiffe sehr hemmen. In der Boca Grande arbeitet die Strömung, die vom Kap Galera Zamba herkommt, ohne Unterlaß, das zu zerstören, was Menschenwerk gebildet hat, und die Schleichhändler und Fischer unterstützen diese Arbeit der Wellen. Südwärts ist der Damm auf mehr als 20 Fuß Länge weggerissen worden. Im Jahre 1800 hatte dieser Bruch 9 Fuß Tiefe, und nach einem heftigen Streit zwischen den Behörden über die Möglichkeit eines feindlichen Angriffs durch die Boca Grande ließ der Kommandant des Hafens von Cartagena, Don Joaquin Fidalgo, alle lanchas cañoneras [Kanonenboote] durch den zerrissenen Damm auslaufen. Man hat seitdem den Grund wieder um 3 oder 4 Fuß verringert, aber diese Ausbesserungen sind nicht dauerhaft. Beschließt man vielleicht einmal, die Boca Chica aufzugeben und die Boca Grande in dem Zustand, den ihr die Natur vorgeschrieben zu haben scheint, wiederherzustellen, wird man neue Befestigungen südsüdwestlich von der Stadt aufführen müssen. Dieser Kriegsplatz hat von jeher für seinen Unterhalt große Geldopfer erfordert und ist unter der vormaligen spanischen Herrschaft öfters die Ursache der größten finanziellen Verlegenheiten gewesen. Die Errichtung der Festungswerke, die Verschüttung der Boca Grande und die Rüstungen des Vizekönigs Don Manuel Antonio Flores veranlaßten die Einführung der Tabakregie, und die Bedrückungen eines Regente Visitador reizten 1781 das Volk zu einem Aufstand, anfangs in Socorro und dann in Zipaquirá, fast vor den Toren der Hauptstadt Bogotá. Unter der Verwaltung des Vizekönigs Don Pedro de Mendinueta, der den Ruf der ehrenvollsten Uneigennützigkeit hinterlassen hat, beliefen sich die jährlichen Ausgaben der Befestigung, Artillerie und Marine in Cartagena auf 980.000 Piaster und die für den Isthmus von Panamá auf 400.000 Piaster.
Wenn die Republik Colombia nicht das Verteidigungssystem für ihre Küsten, die eine Ausdehnung von 660 lieues marines haben, bedeutend vereinfacht, wird ihr bald nur die Wahl bleiben, die zahlreichen Befestigungen von Cumaná, Morro de Barcelona, Guaira, Puerto Cabello, Castillo de San Carlos (an der Mündung des Sees Maracaibo gelegen), Torreón de San Jorge de Río Hacha, Morro de Santa Marta, Cartagena de Indias, Portobelo, Fuerte de San Lorenzo de Chagre, Panamá und Guayaquil nach und nach in Trümmer fallen zu sehen oder aber zu ihrer Unterhaltung jährliche Ausgaben zu machen, die besser der Vergrößerung ihrer Kriegsmarine dienten. Auf den guten Zustand dieser Marine, auf die ungesunden Küsten und auf eine zweckmäßige Verteilung der Landtruppen muß sich die Verteidigung Colombias gründen.
Die Unzuträglichkeit Cartagenas wird in den Erzählungen derer, welche die höheren Landstriche (tierras frias) von Colombia bewohnen, übertrieben und variiert mit dem Zustand der großen Sümpfe, von denen die Stadt östlich und nördlich umgeben ist. Die Ciénega de Tesca ist über 15 Meilen lang und verbindet sich mit dem Ozean in der Nähe des Dorfes Guayeper. Wenn in sehr trockenen Jahren das angeschwemmte Land das Salzwasser hindert, die ganze Ebene zu bedecken, wirken die Ausdünstungen, die sich während der Tageshitze bei einem Thermometerstand von 28 und 32° ergeben, sehr verderblich auf die Gesundheit der Einwohner. Ein kleiner, mit Hügeln übersäter Landstrich trennt die Stadt Cartagena und die Insel Manga von der Ciénega de Tesca. Diese Hügel, deren einige über 500 Fuß Höhe erreichen, beherrschen die Stadt. Der Castillo de San Lázaro zeigt sich in der Ferne wie eine große Felsenpyramide; in der Nähe betrachtet, sind seine Befestigungswerke weniger furchtbar. Ton- und Sandschichten, die zur tertiären Formation der Nagelfluhe gehören, sind mit Ziegelsteinen überkleidet und ergeben ein Bauwerk, das leicht zerbröckelt. Der von einem Kloster und einigen Batterien begrenzte Cerro de Santa Maria de la Popa erhebt sich über das Kastell San Lázaro und verdiente schon wegen dieses Umstands stärkere und ausgedehntere Werke. Das in der Klosterkirche aufbewahrte Marienbild wird seit langer Zeit von den Seeleuten verehrt. Der Hügel selbst bildet einen länglichen Rücken von Westen nach Osten und endet als rundliche Kuppe, was ihm das Aussehen des Hecks eines Schiffes gibt. Der Kalkstein, voll Carditen, Mäandriten und anderen petrifizierten Korallen, gleicht ziemlich dem Tertiärkalkstein der Halbinsel Araya bei Cumaná. In den losgebrochenen Teilen bekommt er Risse und zerfällt, und die Erhaltung des Klosters, dessen Fundamente so wenig solide sind, wird vom Volk als eines der größten Wunder der Schutzpatronin des Ortes angesehen. Nahe beim Cerro de la Popa wird an manchen Stellen eine Breccie von Mörtelkalk sichtbar, der eckige Bruchstücke von lydischem Stein enthält. Ist diese Nagelfluheformation dem Tertiärkorallenkalk aufgesetzt? Rühren die Bruchstücke des lydischen Steins von sekundärem Kalk her, der dem von Zacatecas und Morro de Nueva Barcelona gleich ist? Mir fehlte die Muße, diese Fragen zu entscheiden. Die Aussicht, die man von Popa genießt, ist eine der ausgedehntesten und mannigfaltigsten, die ich kenne. Die Krümmungen und das Zerrissene der Küste geben ihr einen eigentümlichen Charakter. Wie man mir versichert, sieht man zuweilen aus den Fenstern des Klosters und selbst auf offener See vor der kleinen Schanze der Boca Chica die Schneegipfel der Sierra Nevada de Santa Marta. Die Entfernung von Horqueta bis zum Popa beträgt 78 lieues marines. Diese Berggruppe von kolossaler Höhe umhüllen meist dichte Wolken, und sie bleibt besonders in der Jahreszeit unsichtbar, in welcher die periodischen Winde mit Heftigkeit wehen. Obgleich nur 45 Meilen von der Küste entfernt, kann sie doch den Seeleuten, die den Hafen von Santa Marta suchen, so wenig zum Signal dienen, daß die Expedition des Herrn Fidalgo während der ganzen Zeit seiner Operationen an den Küsten nur einmal die Nevados aufnehmen konnte.
Eine traurige Vegetation von Cactus, Jatropha gossypifolia, Croton und Mimosen deckt den ariden Abhang des Cerro de la Popa. Als wir an diesen unfruchtbaren Orten herborisierten, zeigten unsere Führer uns ein dichtes Gebüsch von Acacia cornigera, das durch ein tragisches Ereignis berühmt geworden war. Von allen Arten der Mimosaceen ist diese Akazie mit den stärksten Stacheln bewaffnet; diese sind bis zu 2 Zoll lang und dienen, da sie hohl sind, Ameisen von außerordentlicher Größe zur Behausung. Eine Frau, der nicht unbegründeten Eifersucht und der Vorwürfe ihres Ehemannes müde, hatte einen höchst raffinierten Racheakt geplant. Mit Hilfe ihres Liebhabers gelang es ihr, jenen gefesselt nachts in einen Strauch Mimosa cornigera zu werfen. Je mehr er sich sträubte, desto mehr zerrissen die holzigen Stacheln des Baums seine Haut. Auf sein Geschrei kamen endlich Vorübergehende herbei und fanden ihn nach mehrstündigem Leiden mit Blut bedeckt und grausam von den Ameisen gequält. Dieses sonderbare, zur Besserung eines eifersüchtigen Mannes ersonnene Mittel ist vielleicht ohne Beispiel in der Geschichte der menschlichen Perversitäten; es beweist eine Heftigkeit der Leidenschaften in den unteren Schichten, die man weniger dem Klima als der Roheit der Sitten zuschreiben muß.
Die wichtigste Beschäftigung, der ich mich in Cartagena widmen konnte, war der Vergleich meiner Beobachtungen mit den von den Offizieren der Expedition des Herrn Fidalgo aufgenommenen astronomischen Ortsbestimmungen. Niemals ist wohl eine Mitteilung mit größerer Offenheit und Zuvorkommenheit angeboten worden als die, deren Resultate ich in einem anderen Werk aufgezeichnet habe. Schon 1787 (unter dem Ministerium des Herrn Valdés) hatten Don José de Espinosa, Don Dionisio Galiano und Don José de Lanz der spanischen Regierung vorgeschlagen, sie mit der Aufnahme der amerikanischen Küsten zu beauftragen, um den Atlas von Tofiño bis zu den westlichen Kolonien auszudehnen. Der Plan dieser Offiziere, die seitdem so viele Beweise ihrer Kenntnisse und ihres Eifers gegeben haben, wurde angenommen; aber erst 1792 liefen 4 Brigantinen unter den Befehlen des Don Cosme Churruca und Don Joaquin Francisco Fidalgo von Cádiz aus, um ihre wissenschaftlichen Operationen bei der Insel Trinidad zu beginnen. Churruca fing die Aufnahme der Antillen an, die er jedoch nur bis zum östlichen Teil von Santo Domingo ausweiten konnte. Ein neuer Seekrieg, ferner Klagen, die sich in den Kolonien über den Kostenaufwand der Expedition erhoben, und Mißverständnisse mit dem Generalkapitän von Puerto Rico und dem Admiral Ariztizabal zwangen Churruca anfangs des Jahres 1795, nach Spanien zurückzukehren. Der König ernannte ihn zum Befehlshaber des Schiffes San Juan, und er fiel ruhmwürdig in der Schlacht von Trafalgar, kaum 44 Jahre alt. Don Joaquin Francisco Fidalgo und Don Manuel del Castillo betrieben mit mehr Erfolg die Aufnahme des Litorals von der Insel Trinidad bis zum Escudo de Veragua. Diesen Offizieren sowie den Herren Noguera und Ciscar verdankt man eines der ausgezeichnetsten Werke der neueren Hydrographie. Da ein Teil der Küsten außerordentlich ungesund ist, sind viele der Seeleute ein Opfer der Strapazen und der feuchten Hitze des Klimas geworden. Um die Unterbrechungen zu verhüten, womit ein neuer Krieg mit England seine Unternehmung bedrohte, begab sich Fidalgo selbst nach Jamaica, wo er mit der edelsten Gastfreundschaft empfangen wurde. Man versichert, daß die gesamte Arbeit dieser Aufnahme die Kassen Neu-Granadas während 18 Jahren nahezu 1½ Millionen Piaster gekostet habe.
Trotz des heftigen Schwankens unseres kleinen Fahrzeugs gab mein Chronometer von Louis Berthoud die Länge Cartagenas auf 8″ ungefähr so an, wie sie aus allen richtigen Himmelsbeobachtungen hervorgeht. Ich hatte für den Unterschied der Meridiane vom Morro Havannas und von Cartagena 6° 55′ 10″ erhalten, woraus sich für die Länge des letzteren Hafens 77° 47′ 57″ ergibt. Die von Herrn Noguera, einem geschickten Mitarbeiter Fidalgos, beobachtete Sternbedeckung am 23. März [1801] gab Herrn Oltmanns 77° 48′ 15″. Ich habe (im April 1801) die Inklination der Magnetnadel zu 39,35° (neue Einteilung) gefunden und die Intensität von 240 Schwingungen zu 10′ Zeit. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß das gleiche Instrument mir in Madrid (Januar 1798) eine Inklination von 75,67° und an Schwingungen 241 angegeben hatte. Diese Beobachtungen, untereinander verglichen, sind sehr wichtig für die Theorie der magnetischen Kräfte geworden, da sie zuerst gezeigt haben, daß die isodynamischen Linien keineswegs parallel mit den Linien gleicher Inklination sind, d.h., daß die Kraft nicht abnimmt wie die Inklinationen. Ich habe meine Inklinationsbussole von Borda am Fuß des Cerro de la Popa bei Cartagena in ein Mimosaceengebüsch gestellt und dort die magnetische Abweichung (im April 1801) von 7° 2′ nordöstlich gefunden. Diese Abweichung scheint zumindest seit 1795 abgenommen zu haben, denn es wäre gewagt, sich auf viel ältere Beobachtungen zu berufen. Herrn Fidalgos Expedition hat auf der Mole von Cartagena mit einem Theodoliten von Ramsden gefunden:
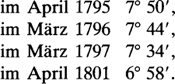
Die von Fidalgo mir freundlichst mitgeteilten Beobachtungen sind mit großer Sorgfalt gemacht worden, und der Kompaß des Theodoliten von Ramsden hat 1801 bis auf einige Minuten exakt dieselbe Abweichung angegeben wie der 12 Zoll lange und nach Lamberts Grundsätzen eingerichtete Apparat, dessen ich mich während meiner Reisen bedient habe. Wegen dieser Übereinstimmung zeichne ich hier nach den ungedruckten Handschriften des Herrn Fidalgo die Resultate auf, die sich diesem Seefahrer längs der ganzen Küste der Tierra Firme ergeben haben: [Es folgen neun Meßwerte.] Fügt man zu diesen Resultaten die Abweichungen, die ich im Landesinneren, in Caracas, Hacienda del Tuy, Hacienda de Cura, Calabozo und Caripe, beobachtet habe, wird man trotz des Einflusses einiger Lokalstörungen einen sehr regelmäßigen Gang dieser Naturerscheinungen erkennen. Die numerischen Elemente in der Theorie des Erdmagnetismus können nur aus Beobachtungen erwiesen werden, die unter sich vergleichbar sind.
Da ich nicht so glücklich war, über den Isthmus zu gehen, habe ich auch nicht durch vergleichende, in kurzen Zeiträumen an der Mündung des Río Chagre und im Golf von Panamá gemachte Beobachtungen die oft geäußerten Zweifel über die relative Höhe des Atlantischen Ozeans und der Südsee lösen können. Ich habe mich beschränken müssen, in jedem Hafen durch die Mittel, die mir zur Hand waren, den täglichen Stand des barometrischen Luftdrucks festzustellen. Es kann hier auch nur vom Vergleich der scheinbaren Höhen die Rede sein; denn die Ungewißheiten, welche noch die Wirkungen der Kapillarität verhüllen, erlauben nicht, mit derselben Genauigkeit die wahren Höhen, die mittleren des absoluten Drucks der Atmosphäre am Rande des Meeres zu bestimmen. Indem ich die Ausdehnungen des Quecksilbers auf null Grad der Temperatur reduzierte, habe ich für Cumaná 0,75.858 m gefunden, für Cartagena 0,75.868 m, für Veracruz 0,75.859 m; woraus sich für den Atlantischen Ozean nach Elementen, denen das Spiel der stündlichen Veränderungen zufällig eine viel größere Übereinstimmung gab, als die Natur der Phänomene eigentlich zuläßt, 0,75.862 m ergibt. Meine Beobachtungen von Callao und Acapulco haben für die Südsee, auf beiden Seiten des Äquators, 0,75.885 m und 0,75.899 m geboten, folglich für die Südsee, wenn man die Beobachtungen immer auf den Nullpunkt der Temperatur reduziert, 0,75.892 m. Herr Arago hat schon bei Gelegenheit seiner wichtigen Untersuchungen über die relativen Höhen der Meere einen Teil meiner Beobachtungen erörtert. Die mittleren Resultate, die ich hier bekanntmache, gründen sich auf die Gesamtheit der barometrischen Höhen, die ich in den Häfen Cumaná, Cartagena, Veracruz, Callao und Acapulco beobachtete und die Herr Oltmanns von neuem berechnet hat, indem er sie von der regelmäßigen Wirkung der stündlichen Tages- und Nachtvariationen befreite. Ich muß hinzufügen: Wenn der geringe Unterschied zwischen der Zahl 0,75.892 m und der, die den mittleren Druck auf dem Niveau des Atlantischen Ozeans darstellt, nicht den Irrtümern der Beobachtung und des Instruments beigemessen werden könnte, dann ergäbe sich daraus, daß die Südsee ungefähr um 3 m niedriger als der Atlantische Ozean wäre. Andere in Guayaquil und an den Küsten von Trujillo angestellte Beobachtungen würden mir einen Unterschied, der noch etwas größer und in demselben Sinn wäre, erbringen; doch ich muß hier daran erinnern, daß ich mich meiner Barometer nur zu den Operationen eines geologischen Nivellements bedient habe, die weit weniger Präzision als die sehr heikel zu behandelnde Bestimmung des relativen Meeresniveaus erfordern. Wollte man die Zweifel gänzlich beheben, die noch die große Frage hinsichtlich der relativen Höhe beider Ozeane bietet, müßte man Beobachtungen, die während eines ganzen Jahres gemacht wären, sammeln und genauere, langen Landreisen weniger ausgesetzte Instrumente, als ich hatte, zu Hilfe nehmen; man müßte die ungleiche Höhe von Ebbe und Flut berücksichtigen sowie deren verschiedene Stunden in der Lage des Hafens auf den beiden entgegengesetzten Küsten Amerikas und die stündlichen Abweichungen des Barometers, die, wenn auch regelmäßig in ihren Eintrittszeiten, dies doch nicht hinsichtlich der abmessenden Quantität in dem Maße sind, wie man es vorausgesetzt hat. Wie dem auch sein mag, so beweisen schon die hier angeführten Beobachtungen, daß ein Unterschied des Niveaus zwischen dem Atlantischen und dem Südmeer besteht, ein Unterschied, der die Wirkung der Strömung sein kann, die gegen die östlichen Küsten des Isthmus treibt, und der sehr klein sein muß. Es bedarf ungewöhnlicher Umstände der Strömungen, der Verdunstung oder des Absinkens, um im Niveau große Ungleichheiten hervorzubringen, und Ursachen, die rein örtlich sind, können sich ihrer Natur nach nicht auf die großen Becken der Meere erstrecken. Im Augenblick meiner Abreise von Paris nach Berlin, im April 1827, habe ich eine schöne Reihenfolge von 58 barometrischen Höhen erhalten, die die Herren Pentland und Don Mariano de Rivero mit einem vorzüglichen Barometer von Fortín während zwei Tagen und zwei Nächten im Hafen von Callao beobachtet haben. Diese Höhen, auf den Nullpunkt der Temperatur reduziert, ergaben im Juni 1826 für die Ufer der Südsee 0,76.071 m, eine Höhe, die nur um  Millimeter geringer als die ist, welche Herr Arago als die barometrische Mittelhöhe der Küsten der Normandie bezeichnet. Da nun Herr Boussingault im November 1822 mit Hilfe desselben hervorragenden Barometers von Fortín im Hafen von Guaira, das heißt am Rande des Antillen-Meers, 0,76.017 m gefunden hat, scheint der Vergleich dieser beiden Angaben (vorausgesetzt, daß die Barometerröhre nicht ausgewechselt oder daß sie durch eine von gleichem Durchmesser ersetzt worden ist) die Resultate zu bestätigen, die ich durch weniger genaue Mittel erlangt hatte.
Millimeter geringer als die ist, welche Herr Arago als die barometrische Mittelhöhe der Küsten der Normandie bezeichnet. Da nun Herr Boussingault im November 1822 mit Hilfe desselben hervorragenden Barometers von Fortín im Hafen von Guaira, das heißt am Rande des Antillen-Meers, 0,76.017 m gefunden hat, scheint der Vergleich dieser beiden Angaben (vorausgesetzt, daß die Barometerröhre nicht ausgewechselt oder daß sie durch eine von gleichem Durchmesser ersetzt worden ist) die Resultate zu bestätigen, die ich durch weniger genaue Mittel erlangt hatte.
Wir verlängerten unseren Aufenthalt in Cartagena, solange es unsere Arbeiten und der Vergleich meiner astronomischen Beobachtungen mit denen des Herrn Fidaldgo erforderten. Die Gesellschaft dieses ausgezeichneten Seefahrers sowie die des Herrn Pombo und Don Ignacio Cavero (ehemaliger Sekretär des Vizekönigs Góngora) wurde für uns eine ergiebige Quelle statistischer Informationen. Ich habe mehrmals Gelegenheit gehabt, die Memoiren des Herrn Pombo über den Chinarindenhandel und über den Zustand der Bevölkerung und des Ackerbaus der Provinz Cartagena anzuführen. Wir fanden auch im Haus eines Artillerieoffiziers (des Brigadiers Don Domingo Esquiaqui) eine sehr bemerkenswerte Sammlung von Zeichnungen, Maschinenmodellen und Mineralien von Neu-Granada. Andererseits boten uns die Osterprozessionen ein Schauspiel, das ganz geeignet war, den Grad der Zivilisation und die Sitten der unteren Schichten zu charakterisieren. Die Ruhealtäre waren mit einer ungeheuren Menge Blumen verziert, unter denen Plumiera alba und Plumiera rubra am glänzendsten prangten. Nichts kommt den wunderlichen Kostümen derjenigen gleich, die eine Hauptrolle in diesen Prozessionen spielten. Bettler, eine Dornenkrone auf dem Kopf und ein Kruzifix in der Hand, baten um Almosen. Ihr Gesicht war mit einem schwarzen Tuch bedeckt; und so gingen sie von Haus zu Haus, nachdem sie für das Recht zu betteln der Geistlichkeit einige Piaster gezahlt hatten. Pilatus war mit einem gestreiften seidenen Rock angetan, und die Apostel, um einen großen, mit Zuckerwerk bedeckten Tisch sitzend, wurden auf den Schultern der Zambos getragen. Beim Untergang der Sonne sah man in den Hauptstraßen Gliederpuppen, die Juden darstellten, in französischer Kleidung und mit stroh- und raketengefüllten Leibern, an Stricken aufgehängt gleich unseren Laternen. Das Volk wartete stundenlang auf den Augenblick, wo an los judíos Feuer gelegt würde. Man klagte laut, daß wegen der Feuchtigkeit der Luft die Juden nicht so gut wie gewöhnlich brannten. Dieser „heilige Zeitvertreib“ (ein Name, den man diesem barbarischen Schauspiel gegeben hat) ist freilich nicht dazu angetan, die Sitten zu mildern.
Da wir besorgt waren, der ungesunden Luft Cartagenas zu lange ausgesetzt zu sein, zogen wir uns am 6. April [1801] in das indianische Dorf Turbaco (das alte Taruaco) zurück, das in einer reizenden Lage am Eingang eines dichten Waldes, ungefähr 5 lieues südöstlich vom Popa, liegt. Wir waren froh, eine schlechte Herberge (fonda) zu verlassen, die mit Soldaten, Überbleibseln der unglücklichen Expedition des Generals Rochambeau, angefüllt war. Ihre endlosen Diskussionen über die Notwendigkeit der an den Schwarzen in Santo Domingo verübten Grausamkeiten erinnerten mich unwillkürlich an die Begriffe und die Greuel der conquista des 16. Jahrhunderts. Herr Pombo überließ uns sein schönes Haus in Turbaco, vom Erzbischof Vizekönig Góngora erbaut. Wir verweilten hier so lange, bis alle Vorbereitungen für unsere Fahrt auf dem Río Magdalena und für die lange Landreise von Honda nach Bogotá, Popayán und Quito abgeschlossen waren. Wenige Aufenthalte in den tropischen Gegenden sind mir reizvoller als der in Turbaco vorgekommen. Das Dorf liegt wahrscheinlich 180 Toisen über dem Meeresspiegel. Schlangen sind dort sehr häufig und dringen bei ihrer Rattenjagd bis in das Innere der Häuser; auch kriechen sie auf die Dächer, um den Fledermäusen nachzustellen, deren Geschrei uns oft des Nachts belästigte. Die Hütten der Indianer stehen auf einer Plattform mit steilem Gefälle, so daß das Auge überall auf schattige Täler fällt, die kleine Bäche durchschneiden. Von der Terrasse, die unser Haus umgab, genossen wir besonders beim Auf- und Untergang der Sonne den herrlichen Anblick der Sierra Nevada de Santa Marta. Diese kolossale Gebirgsgruppe ragt in einer Entfernung von 35 lieues marines gegen Ostnordosten majestätisch hervor. Wir haben oben gesehen, daß nach Winkeln, die auf der Fahrt genommen wurden, die höchsten Punkte der Sierra Nevada (Picacho und Horqueta) 3000 Toisen übersteigen. Der mit ewigem Schnee bedeckte Teil, den man von Turbaco aus am deutlichsten sieht, und der in der Zeit der periodischen Winde durch die Wirkung der herabströmenden Wasser dazu beiträgt, die Temperatur niedriger zu halten, ist wahrscheinlich der Pic von San Lorenzo. Eine dichte Vegetation deckt die Hügel und Ebenen zwischen dem Deich von Mahates und den Schneebergen; ihre Frische erinnerte uns oft an die schönen Wälder des Orinoco. Wir waren erstaunt, so nahe den Küsten in einem seit drei Jahrhunderten von Europäern besuchten Land riesenhafte Bäume zu finden, die zu bis dahin unbekannten Arten gehören wie Rhinocarpus excelsa (eine Anacarde, die die Creolen wegen der Form ihrer schneckenförmig gebogenen Frucht caracoli nennen), Ocotea turbacensis und Mocundo oder Cavanillesia platanifolia, deren große fünfflügelige Früchte Laternen aus geöltem Papier gleichen, die an den Zweigen hängen. Wir gingen täglich von 5 Uhr morgens bis zur einbrechenden Nacht im Wald herborisieren; diese langen Spaziergänge würden noch viel größeren Reiz gehabt haben, wenn wir in diesen fruchtbaren und sumpfigen Gegenden nicht von den mosquitos, zancudos, jején und den unzähligen Arten Schnaken, die ich in meiner Reise am Casiquiare und Orinoco beschrieben habe, so geplagt worden wären. In der Mitte dieser herrlichen Wälder, die der Blütenduft des Crinum erubescens und Pancratium litorale durchwürzt, trafen wir häufig auf indianische conucos, das heißt kleine Anpflanzungen von Bananen und Mais, in welche die Eingeborenen, stets geneigt, die Nähe der Weißen zu fliehen, sich gegen Ende der Regenzeit zurückzuziehen pflegen. Diese Liebe zu Waldungen und zur Einsamkeit kennzeichnet überall die amerikanischen Stämme. Obgleich die spanische Bevölkerung sich mit der indianischen von Turbaco vermischt hat, zeigt diese doch denselben Mangel an Bildung, der in den Missionen Guayanas so auffallend ist. Betrachtet man die Ackergerätschaften, die Bauart der Bambushütten, die grobe Kleidung und geringe Geschicklichkeit der Eingeborenen, fragt man sich, was die kupferfarbigen Stämme seit dem 16. Jahrhundert durch die Berührung mit dem gebildeten Europa gewonnen haben.
Die Bewohner von Turbaco, die uns beim Sammeln der Pflanzen begleiteten, sprachen oft von einer sumpfigen Gegend, in der Mitte eines Palmenwaldes gelegen, die sie mit dem Namen der kleinen Vulkane, los volcáncitos, bezeichneten. Sie erzählten, daß, nach einer im Dorf erhaltenen Tradition, diese Gegend ehemals entzündet gewesen sei, doch daß es einem guten, durch seine Frömmigkeit bekannten Mönch gelungen sei, durch häufige Besprengung mit Weihwasser das unterirdische Feuer zu löschen und den Feuervulkan in einen Wasservulkan, volcán de agua, zu verwandeln. Diese Erzählung erinnerte mich an den Streit der Geologen des letzten Jahrhunderts über Neptunismus und Vulkanismus. Der Pfarrer von Turbaco, der Gelehrte des Ortes, versicherte uns, daß los volcáncitos nichts anderes seien als heiße Quellen, in denen Schwefel schwämme und die bei ihrem Ausfluß aus der Erde bei stürmischem Wetter eine Art „Stöhnen“ vernehmen ließen. Wir hatten lange genug die spanischen Kolonien bewohnt, um zu wissen, wie mißtrauisch man den wunderbaren Erzählungen gegenüber sein muß, durch welche die Eingeborenen die Aufmerksamkeit der Reisenden gern auf die gewöhnlichsten Naturerscheinungen zu richten suchen; und wir wußten auch, daß diese Erzählungen weniger dem Aberglauben der Eingeborenen als dem der Weißen, der Mestizen und der afrikanischen Sklaven zuzuschreiben sind. Die Träumereien einzelner Individuen, die über die fortschreitenden Veränderungen der Oberfläche des Erdballs grübeln, haben zu allen Zeiten und in allen Zonen das Gepräge historischer Überlieferungen angenommen. Ohne daher den vermeintlichen Traditionen von Turbaco Glauben zu schenken, ließen wir uns von den Indianern nach den volcáncitos des Waldes führen und fanden dort das Phänomen der Salsen oder Luftvulkane, dessen Studium nicht ohne Interesse für die wichtige Kenntnis der Schlammausbrüche ist.
Wir durchschritten in einer Länge von mehr als 2500 Toisen eine dichte Waldung, die mit Cavanillesia, Pirigara superba voller großer Nymphenblüten und Gyrocarpus, dessen Frucht sich beim Herabfallen in der Luft wie ein Federball dreht, angefüllt war. Der Weg zieht sich östlich hin; allmählich steigt das Terrain bis zu einer Erhöhung von 20 oder 25 Toisen über dem Plateau von Turbaco; da aber eine üppige Vegetation den Boden überall bedeckt, werden nur an einigen Stellen Kalksteinbänke sichtbar, die viel Mäandriten und andere petrifizierte Korallen enthalten. Es ist wahrscheinlich, daß diese Kalkart zur Tertiärformation Cumanás und des Cerro de la Popa gehört. Man hat uns versichert, daß dieses Gestein sich zwischen dem Río Sinú und den Sabanas altas de Tolú zeige, wo man nach Herrn Pombo auch die Spuren älterer Formationen, vornehmlich kohlenhaltiges Terrain, erkenne.
In einem Teil des Waldes von Turbaco, der besonders reich an Palmen ist, befindet sich eine lichte Stelle von 800 Quadratfuß, die von aller Vegetation entblößt, aber mit Gebüschen der Bromelia karatas, deren Blatt dem der gewöhnlichen Ananas gleicht, eingefaßt ist. Der Boden zeigt an seiner Oberfläche nur Schichten von grauschwärzlichem Tonschiefer, durch Austrocknung in fünf- und siebeneckige Prismen geborsten. Was man die volcáncitos nennt, sind 15 bis 20 kleine, abgestumpfte Kegel, die sich in der Mitte dieses lichten Platzes erheben und 3 bis 4 Toisen hoch sind. Die höchsten befanden sich auf der Südseite, und ihre Grundfläche hatte zur Zeit, als ich mich in dieser Gegend aufhielt, einen Umfang von 220 bis 240 Fuß. Herr Louis de Rieux, dessen Vater unter dem Ministerium des Herrn Urquijo mit der Inspektion der Chinarinde von Santa Fé beauftragt war und der sich seitdem in der Verteidigung seines Vaterlandes, der Republik Colombia, auszeichnete, hat die Zeichnung entworfen, die ich in meinen ›Vues des Cordillères et monumens des peuples indigenès de l’Amérique‹ [Planche XLI] in Kupfer habe stechen lassen. Bei Ersteigung dieser Schlammvulkane fanden wir auf der Spitze jedes Kegels eine Öffnung von 15 bis 28 Zoll im Durchmesser. Ein erhöhter Rand umgibt diese kleinen Krater, die mit Wasser angefüllt sind, aus dem ziemlich periodisch Luftblasen von beträchtlichem Volumen aufsteigen. Ich habe oft in zwei Minuten fünf solcher Explosionen bemerkt. Die Kraft, mit welcher die Luft aufsteigt, läßt auf einen heftigen Druck im Inneren der Erde schließen. Auch hört man von Zeit zu Zeit ein dumpfes, starkes Getöse, das um 15 oder 18 Sekunden dem Heraustreten der Luftblasen vorangeht. Ich war mit einem in Grade geteilten Gefäß versehen, und während ich hier das Gas, das ich in Turbaco analysiert habe, in Trichter aus zusammengerollten Bananenblättern einfing, sah ich mit Erstaunen, daß eine einzige dieser dicken Wasserblasen 10 bis 12 Kubikzoll elastisches Fluidum enthielt. Die Gasausströmungen sind zuweilen so heftig, daß das Wasser aus dem kleinen Krater gleichsam herausgeworfen wird oder, nachdem es eine Bresche in den Rand gerissen hat, am Abhang eines Kegels herunterfließt.
Einige der Öffnungen, durch welche das Gas entweicht, befinden sich in der Ebene, wo der Boden nicht gewölbt ist. Ich habe beobachtet, daß die Explosionen nicht gleichzeitig geschehen, wenn die Öffnungen, die nicht auf dem Gipfel der Kegel liegen und mit einer kleinen, 10 bis 14 Zoll hohen Tonmauer umgeben sind, fast benachbart sind. Es scheint, daß jeder Krater das Gas durch einen verschiedenen Leiter empfängt und daß diese Leiter, die in ein und demselben Reservoir komprimierten Gases enden, mehr oder weniger dem Ausströmen des luftförmigen Gases widerstehen. Ohne Zweifel ist es dieses selbe Fluidum, dessen Ausdehnung den Tonboden in Kegeln gehoben hat; und das dumpfe Geräusch, das dem Aufsteigen der Luftblasen vorangeht, zeigt wohl an, daß man auf einem der hohlen Terrains (tierras huecas) steht, die im südlichen Amerika, selbst fern entzündeter Vulkane, so verbreitet sind. Die indianischen Kinder, die uns begleiteten, halfen uns, diese kleinen Krater mit Tonerde zu verstopfen; doch das Gas fand immer wieder seinen Ausweg an den gleichen Punkten, indem es die Erde auswarf, die sich an den Rändern anhäufte. Da die volcáncitos sich an einem ziemlich begangenen Weg befinden, haben die Eingeborenen oft Gelegenheit, sie zu beobachten. Sie versichern, daß seit zwanzig Jahren die Zahl und Form dieser Kegel sich nicht merklich verändert habe und daß die kleinen Krater selbst in den trockensten Jahreszeiten mit Wasser angefüllt seien. Die Temperatur dieses Wassers ist nicht höher als die der Atmosphäre. Das hundertteilige Thermometer zeigte in einem nahen, von Ocotea und Caracoli beschatteten Bach 23,7°; in der freien Luft an den volcáncitos, jedoch ohne den Sonnenstrahlen ausgesetzt zu sein, 27,5°; im Wasser der Krater, auf dem Gipfel der Kegel, sehr gleichmäßig 27 bis 27,2°. Kein leuchtendes Phänomen ist an diesen Orten bemerkt worden; und obgleich die Salsen von Taman, deren Wasser durchgängig kalt ist, zur Zeit großer Ausbrüche Flammen ausgeworfen haben, zögere ich dennoch gelten zu lassen, daß die oben erwähnte Tradition des volcán de fuego, der durch häufige Besprengungen mit Weihwasser zu einen volcán de agua y de aire bekehrt wurde, auf alte historische Erinnerungen in Turbaco gegründet sei. Wir konnten ohne Anstrengung beim Loten mit langen Stangen 6 bis 7 Fuß tief in die Öffnungen der Kegel eindringen; der Boden ist von außerordentlicher Weichheit, so daß sich schwer spüren läßt, wo man auf den wirklichen Grund der Öffnung kommt. Es schien uns, daß die kleinen Krater der Kegel allgemein nur eine Tiefe von 24 bis 30 Zoll hatten. Das Gas steigt durch eine grauschwärzliche Tonerde, hebt diese auf und trübt das Wasser, dem es sich zu entziehen scheint. Läßt man dieses Wasser in einem Gefäß ruhig stehen, wird es ganz klar und behält einen schwachen Alaungeschmack, ohne Schwefel im Kontakt mit dem Oxygen der Atmosphäre abzusetzen.
Die Versuche, die ich in Turbaco über das zu verschiedenen Zeitpunkten in der Öffnung der Kegel angesammelte Gasfluidum anstellen konnte, haben mir ein merkwürdiges Phänomen dargeboten, indem sie nahelegen, daß dieses Fluidum fast reiner Stickstoff sei. Man bemerkt keine Spur des Geruchs von geschwefeltem Hydrogenium, es gibt keine merkliche Verminderung, wenn man das Gas mit Regenwasser in der Röhre des Fontanaschen Eudiometers schüttelt; ebenso gibt es wenig oder fast gar keine Absorption oder merklichen Niederschlag mit dem Kalkwasser. Hundert Teile Luft der volcáncitos, mit hundert Teilen Salpetergas vermischt, zeigten nur eine Verminderung von 5 Teilen, was also kaum 1½ Hundertstel Oxygen angibt. Da die Luft der volcáncitos einen ganzen Tag hindurch in Verbindung mit Wasser gewesen war, konnte die kleine Menge Oxygen den Luftblasen zugeschrieben werden, die sich vom Wasser der Glocken abgelöst hatten. Bei Wiederholung des Versuchs am 17. und 18. April [1801] mit frischer, auf den Kegeln eingesammelter Luft brachte das Salpetergas nicht mehr Absorption als Kalkwasser hervor. Es war also weder Sauerstoff noch Kohlensäure darin enthalten. Es ist beinahe überflüssig, zu erwähnen, daß ein entzündeter Körper beim Eintauchen in eine mit der Luft der kleinen Vulkane angefüllte Flasche plötzlich erlöscht. Da ich kein Eudiometer von Volta besaß, konnte ich auch die Frage nicht lösen, ob diese Luft reiner Stickstoff oder ob sie mit einem kleinen Teil Wasserstoff vermischt ist. Erst kurze Zeit nach meiner Rückkehr von Mexico nach Paris vermochten Gay-Lussac und ich zu bestimmen, innerhalb welcher Grenze man in einer großen Masse Stickstoff den Wasserstoff erkennen könne.
Da die Umgebung von Turbaco, besonders die cañaverales (Zuckerpflanzungen), von phosphorischen Insekten (Elater noctilucus) wimmelt, habe ich die Gelegenheit genutzt, um an der leichten Luft der volcáncitos mit diesen Tieren einen Teil der Versuche zu wiederholen, die ich einige Jahre früher mit leuchtendem Holz ausgeführt hatte. Der Phosphor leuchtete in dieser eben eingesammelten Luft nur 40 oder 50 Sekunden; und die Phosphoreszenz des Insekts hörte nach 18 oder 25 Sekunden ganz auf; nachdem ich jedoch einige atmosphärische Luftblasen in die Röhre hineingelassen hatte, kehrte sofort der Glanz zurück. An dem phosphorischen Weidenholz hatte ich dieselbe Erscheinung bemerkt. Wenn Elater und Holz unter Flußwasser leuchten, so ohne Zweifel, weil eine an Sauerstoff reiche Luft in diesem Wasser gelöst ist. Es schien übrigens, daß ein längeres Verweilen in der Luft der kleinen Vulkane den Elater erkranken ließ. Zog man ihn aus der Flasche heraus, war seine Phosphoreszenz sehr schwach, stieg aber, wenn man das Tier entweder mit den Fingern kniff oder wenn man mittels eines galvanischen Reizes die beiden äußersten Enden seines Körpers mit Zink und Silber berührte.
Woher entsteht diese ungeheure Masse Stickstoff, die den Luftvulkanen von Turbaco entsteigt und die man an einem Tag auf mehr als 3000 Kubikfuß schätzen kann? Während meiner Reise in Amerika war ich sehr geneigt, die Salsen nur als ein kleines Lokalphänomen zu betrachten. Ich hatte gesehen, daß der Salzton der deutschen Mineralogen große Massen atmosphärischer Luft in den Sinkwerken absetzte, die auf dem Grund gewisser Steinsalzgruben gegraben werden, um dort Süßwasser zuzuleiten, und ich bildete mir ein, daß der Stickstoff der volcáncitos gleichfalls einer in das Innere der Erde eingedrungenen Luft zugeschrieben werden könnte, welche, der Oberfläche sehr nahe, durch die Berührung mit Tonschieferschichten zersetzt wäre, wie ich sie in den sekundären (und tertiären) Formationen längs des Litorals des Río Sinú bis an der Küste von Paria gesehen habe. Ich kannte damals nur aus Berichten Dolomieus und aus einigen sehr unvollkommenen Beschreibungen die Schlammvulkane Siziliens, die schon Strabon erwähnt; und das Phänomen der Salsen, die zu gewissen Zeiten Flammen auswerfen und bei ihrem ersten Ausbruch Steinblöcke ausschleudern, war mir so wie dem größten Teil der Geognosten dieser Zeit unbekannt. Seit etwa fünfzehn Jahren haben sich unsere Einblicke glücklicherweise erweitert. Man weiß, daß die tätigen Vulkane, welche Lava, Schlacken, saure Dünste und luftartige Fluiden ausspeien, daß die heißen Quellen, welches auch ihre Temperatur sei, daß die Salsen (kleine Luft-, Schlamm- und Naphthavulkane) und die Erdbeben eng untereinander verbundene Naturerscheinungen, Wirkungen einer gleichen Ursache sind, deren Zentralpunkt sich in einer großen Tiefe des Inneren der Erdkugel befindet.
Die Salsen oder Schlammvulkane auf der Halbinsel Taman und an den Ufern des Kaspischen Meeres haben von Zeit zu Zeit große Feuerausbrüche gehabt, deren Flammenstrahlen in bedeutender Entfernung wahrgenommen wurden und denen heftige Erderschütterungen vorausgegangen sind; allerdings zeigt im gewöhnlichen Zustand der Schlammvulkan von Taman, wie ihn Pallas und Parrot beschrieben haben, gleich den volcáncitos von Turbaco, Lachen, aus deren Inneren sich nicht Wasserstoff, sondern Stickstoff entwickelt. Dagegen hat in der Salse von Terrapilata in Sizilien, die Ähnlichkeit mit der von Macaluba hat, der Pater La Via das Gas eines der kleinen Kegel anzünden können, worauf eine azurblaue Flamme sich 5 Fuß hoch erhob. Das aus anderen Salsen ausströmende gasartige Fluidum ist nicht genau analysiert worden, und man kennt bis jetzt nicht die Verbindungen von Wasserstoff, Stickstoff und Kohlensäure, welche diese luftförmigen Mischungen eingehen können. Die in Turbaco und Taman ausgeführten chemischen Analysen beweisen schon, daß es nicht wahr ist, daß die Schlammvulkane zu allen Zeiten nur Wasserstoff entwickelten. Sie haben ihre Stadien wie die eigentlichen Vulkane (Vesuv, Ätna, Tunguragua, Cotopaxi), die ganz verschiedene Dünste und luftartige Fluiden in die Atmosphäre ausströmen, wenn sie tätig sind oder in einem Zustand langer Ruhe, wo sie den Solfataren gleichen. Die Vulkane an beiden Ufern des Kaspischen Meeres, die Hydrogen, Naphtha, Asphalt, tonigen Schlamm und Seesalz hervorbringen, weisen auf einem kleinen Erdraum eine große Mannigfaltigkeit von eng untereinander verbundenen Erscheinungen auf, über welche der Bericht über die Umschiffung des Kaspischen Meeres, von Herrn Eichwald (ehemals Professor an der Universität zu Kasan), in diesem Augenblick herausgegeben, sehr großes Licht verbreiten wird. Man hat zu lange die Salsen von Baku und der ganzen Halbinsel Apsheron mit den Feuern von Pietra Mala in Italien verwechselt. Die Tataren bestätigen, daß die meisten Naphthaschlünde sich an den östlichen und westlichen Küsten des Kaspischen Meeres öffneten, indem sie Flammen auswarfen und Steinblöcke herausschleuderten. Diese Bruchstücke von bedeutendem Umfang sind in der Nähe der Salsen des Golfs von Balchan und auf der Insel Tscheleken von Herrn Eichwald und nahe den beiden Salsen von Monte Zibio von Herrn Bertrand-Geslin untersucht worden. Sie bezeugen die Wirkung eines elastischen Fluidums, das die sekundären Schichten erhoben und durchbrochen haben muß. Eine Reihe eng untereinander verbundener, einfacher oder verwickelter, beständig oder mit Intervallen wirkender Naturerscheinungen tut sich in den Salsen der beiden Kontinente kund. Diese Salsen sind so mannigfaltig in ihrem Aussehen, daß man sie zu einem gegebenen Zeitpunkt unter ein und demselben Namen zu bezeichnen Mühe hat. Die unterirdische Hitze, die sich in Zwischenräumen in ihnen entwickelt (z.B. in dem Feuerausbruch von Gokmali am 27. November 1827), beweist ihre Verbindung mit sehr tiefen Spalten, mit der gemeinschaftlichen Quelle der Vulkane, der Thermalwasser und der Erdbeben. Wie verschieden sind diese Flammen und große Felsblöcke auswerfenden Salsen von den friedlichen Luftvulkanen bei Turbaco, die im kleinen die Erhebungen der Gebirge unseres Planeten und des Mondes durch die Ausdehnung eines elastischen Fluidums darzustellen scheinen!
*
Unser Aufenthalt in Turbaco war höchst angenehm und nützlich für unsere botanischen Sammlungen. Noch heute, da ich nach einem so langen Zeitraum von den Ufern des Ob und den Grenzen der chinesischen Sungarei zurückkehre [28.12.1829], richtet sich meine Phantasie gern auf das Bild dieser Bambuswälder; auf diese wilde Überfülle des Bodens, wo die Orchideen sich um die alten Stämme der Ocotea und des indischen Feigenbaums winden; auf diesen majestätischen Anblick der Schneegebirge, die leichten Nebel, die beim Aufgang der Sonne den Grund der Täler erfüllen, auf die Kronen gigantischer Bäume, die wie Laubinseln einem Dunstmeer entsteigen – dies alles stellt sich noch unaufhörlich meiner Erinnerung dar. Unser Leben in Turbaco war einfach und reich an Arbeit; wir waren jung, vereint in Neigung und Charakter, voll Hoffnung auf die Zukunft, nahe einer Reise, die uns auf die höchsten Gipfel der Andenkette, zur Anschauung brennender Vulkane, in ein ständig durch Erdbeben erschüttertes Land führen sollte; und so fühlten wir uns hier glücklicher als zu irgendeiner anderen Zeit unserer weit zurückliegenden Expedition. Die seitdem verflossenen Jahre, die nicht ohne bittere Erfahrungen und Schmerzen gewesen sind, haben den Reiz dieser Eindrücke noch erhöht; und ich glaube gern, daß mein unglücklicher Freund, Herr Bonpland, aus der Ferne seines Exils in der südlichen Hemisphäre, in der Einsamkeit Paraguays noch oft mit Freude unserer herborisierenden Streifzüge in Turbaco, der kleinen Quelle von Torecillo, des ersten Anblicks einer blühenden Gustavia oder einer fruchtbeladenen Cavanillesia gedenkt.
Während der zehn Tage, die wir in dem schönen Landhaus Don Ignacio Pombas wohnten (anfangs des Monats April), hielt sich die Lufttemperatur konstant zwischen 23,7 und 28° des hundertteiligen Thermometers, während sie in Cartagena bis 31 und 34,5° stieg, ein Unterschied, der anderen Ursachen als der kleinen Erhöhung des Bodens beizumessen ist. In den unteren Luftschichten unbedeutender Höhen hängt die Abnahme des Wärmestoffs von vielen kleinen Lokalursachen ab. In den heiteren Nächten war der Abendtau stärker, als ich ihn längs den Küsten von Südamerika noch beobachtet hatte. Die Wirkung solcher Ausstrahlung des Bodens gegen einen außerordentlich klaren Himmel ließ mich beinahe vergebens die Bestimmung der Breite von Turbaco mittels der großen Gestirne des südlichen Himmels versuchen; der Tau verhüllte den künstlichen Horizont, und die Sonnenhöhen um die Mittagszeit waren zu groß, um sie mit einem Reflexionsinstrument zu messen. Ich fand die Breite mittels der Sterne α und β des Zentaur zu 10° 18′ 5″.
Die Gesundheit des Herrn Bonpland hatte während unserer Fahrt auf dem Orinoco und Casiquiare so stark gelitten, daß wir beschlossen, dem Rat der Eingeborenen zu folgen und uns mit allen Hilfsmitteln zu versehen, welche damals die Fahrt auf dem Río Magdalena für die von Cartagena und Santa Marta nach Honda Reisenden bieten konnte. Anstatt in einer Hängematte oder auf dem Boden auf einem Fell liegend zu schlafen und auf diese Weise allen Qualen der Moskitos ausgesetzt zu sein, folgten wir der Sitte des Landes, verschafften uns Matratzen, ein leichtes Feldbett und besonders einen toldo, nämlich ein baumwollenes Tuch von sehr dichtem Gewebe, das man mit viel Vorsicht unter der Matratze einschlägt und so eine Art festgeschlossenes Zelt bildet, durch das, wenn die Enden des toldo nicht zufällig verrutscht werden, die Insekten nicht durchdringen können. Zwei solche in dicke Lederzylinder verschlossene Betten machten die Ladung eines Maultiers aus. Diese Vorkehrung kann nicht genug gelobt werden und ist bei weitem den Vorhängen von Gaze (Moskitonetz) vorzuziehen, deren man sich in Europa bedient, die zwar kühler als der toldo sind, aber den Insekten zugängliche Öffnungen lassen. Unsere Vorräte (el rancho) waren für eine lange Flußreise gedacht, und so verließen wir Turbaco am 19. April [1801], um 11 Uhr nachts. Wir hatten als Reisegefährten einen alten französischen Arzt, Herrn de Rieux, aus Carcassonne gebürtig, und den jungen Sohn des unglücklichen Nariño, von seinem Oheim Don Mariano Montenegro begleitet. Das Schicksal dieser Menschen flößte ein lebhaftes Mitgefühl ein, und ihre Unterhaltung vergegenwärtigte schmerzlich den Zustand der Unterdrückung, worin dieses unglückliche Land damals schmachtete. Herr de Rieux, ein liebenswürdiger, sehr gebildeter Mann, war als Arzt des Vizekönigs Ezpeleta aus Europa gekommen. Politischer Umtriebe beschuldigt, wurde er 1794 in Honda aus seinem Haus gerissen und mit Ketten beladen nach Cartagena in die Gefängnisse der Inquisition geschleppt. Der Aufenthalt an einem feuchten, ungesunden Ort verursachte ihm Anfälle chronischer Blindheit. Mehr als ein Jahr verging, ohne daß ihm erlaubt wurde, seiner Gattin und seiner alten Mutter, die der Kummer bald dahinriß, von sich Nachricht zu geben. Sein Vermögen wurde verstreut; da aber nichts zu seiner Schuld aufzufinden war, schickten ihn seine Richter (bajo partido de registro), um ihn loszuwerden, in die Gefängnisse von Cádiz, wo man sich ebensowenig mit seinem Prozeß beschäftigte. Er wurde dort mit größerer Milde behandelt, und es gelang ihm, an die Küste Afrikas zu entfliehen. In Tanger faßte er den kühnen Plan, nach Spanien zurückzukehren, geradewegs nach Madrid, sich den Ministern vorzustellen und um den Schutz des französischen Botschafters, des tapferen Admirals Truguet, nachzusuchen. Zwei Jahre verlor er mit nutzlosen Versuchen, einen Prozeß anzustrengen. Endlich trat Herr d’Urquijo an die Stelle des Friedensfürsten. Dieser Staatsmann war ein geschworener Feind der Inquisition, deren Verfolgungen er in jungen Jahren wegen einiger literarischer Versuche ausgesetzt gewesen war und zu deren Sturz er späterhin beitrug. Die Erzählungen des unglücklichen Herrn de Rieux weckten Herrn d’Urquijos Mitgefühl; und durch einen jener wunderbaren, aber zur damaligen Zeit auf der Halbinsel so häufigen Glückswechsel wurde der französische Arzt mit einer Pension von 2000 schweren Piastern in dasselbe Land zurückgeschickt, wo man ihn in Ketten gelegt und eines Staatsverbrechens beschuldigt hatte. Man gab ihm den Titel eines Generalinspektors der China-Bäume, die zerstreut in den Wäldern wachsen, und übertrug ihm den Anbau des Zimts und der Muskatnuß, obgleich der Laurus der Provinz Los Canelos und der Otoba durch ihre spezifischen Eigenheiten und die Schwäche ihres Gewürzstoffs von Laurus cinnamomun und Myristica moschata von Ostindien durchaus verschieden sind. Man kann sich leicht die Empfindungen vorstellen, mit welchen er denselben Fluß hinauffuhr, den er in Ketten und als Staatsgefangener einst hinabgefahren war. Wir waren ihm schon in Havanna begegnet, und seine Gesellschaft war uns um so angenehmer, als ihn sein Sohn, ein junger, hoffnungsvoller Mann, begleitete, der Vergnügen daran fand, Pflanzen nach der Natur zu zeichnen.
Ein Bürger, dessen Name sich seitdem in der Geschichte der Revolution von Cundinamarca ausgezeichnet hat und der als Präsident der Republik nach der verlorenen Schlacht von Pasto sein Leben wunderbar rettete, indem er drei Tage lang ohne Nahrung in den Wäldern umherirrte, war zu gleicher Zeit mit Herrn de Rieux inhaftiert worden. Don Antonio Nariño befand sich in den Gefängnissen von Santa Fé de Bogotá, als ich die Reise auf dem Magdalenafluß mit seinem Sohn, einem Knaben von zwölf Jahren, und seinem Schwager, Herrn Montenegro, ausführte. Dieser hatte sich lange Zeit wegen des Goldstaubhandels (el rescate del oro de los lavaderos) im Choco und in der Provinz Antioquia aufgehalten. Er lehrte mich zuerst den kleinen Canal de Raspadura kennen sowie die Nähe des Golfs von Cupica bei der Mündung des Atrato. Es war ein sonderbarer Zufall, daß Nariños junger Sohn den Strom in dem gleichen Boot mit dem Unglücksgefährten seines Vaters hinauffuhr, dem übrigens der Vizekönig Mendinueta auf Bitte des berühmten Botanikers Mutis soviel Milderung in seiner Haft gewährte, wie die strengen Befehle des Hofes nur erlaubten. Alles ließ damals die baldige Befreiung Antonio Nariños, eines der kenntnisreichsten Kaufleute im spanischen Amerika, hoffen; aber er hat sein Gefängnis von Bocachica nur verlassen, um als erster Magistrat einer entstehenden Republik eingesetzt zu werden und der doppelten Gefahr äußerer Verteidigung und bürgerlicher Unruhen die Stirn bieten zu müssen. Es liegt etwas derart Dramatisches in diesem Gemisch von Glück und Mißgeschick, daß man mir verzeihen wird, so ausführlich über die Personen gesprochen zu haben, die uns von Turbaco nach Sante Fé begleiteten. Ich habe während meines Aufenthalts in dieser Stadt Herrn Nariño nicht in seinem Kerker gesehen; aber einige Jahre später, als er, seiner republikanischen und militärischen Würden schon entsetzt, sich anschickte, in sein Vaterland zurückzukehren, um an dem Kongreß von Cucuta teilzunehmen, kam er nach Paris und dankte mir für die Sorgfalt, die Bonpland und ich für seinen, durch die Beschwerden der Fahrt auf dem Río Magdalena geschwächten Sohn gezeigt hatten. Seltsame Schicksale der Menschen, die in Zeiten leben, wo große politische Bewegungen die menschliche Gesellschaft erschüttern!
Wegen des schlechten Zustands der Mündung des Río Magdalena, von Cieça Río de Santa Marta genannt, gibt es nur zwei Wege nach Honda, entweder von Santa Marta durch die Ciénega und den Caño Sucio nach Baranquilla und Soledad oder durch die Ciénega de Pasacaballos in den Kanal (dique) von Mahates, der ein zum Teil künstlicher Seitenarm des großen Flusses ist und sich in der Richtung von Osten nach Westen, von Barancas Nuevas nach Rocha erstreckt. Da das westliche Ende dieser Passage, in welcher der Kanal sich mit Lachen von salzigem Wasser verbindet, eine ziemlich schwierige Fahrt darbietet, gehen die Reisenden gewöhnlich von Cartagena durch Turbaco und den Landweg nach Mahates, um sich auf dem Dique in einem näher bei Barancas Nuevas gelegenen Zwischenhalt einzuschiffen. Diesem letzten Weg folgten auch wir mit dem Gepäck, das wir von Cartagena nach Lima, eine Entfernung von mehr als 700 lieues, mit uns schleppen mußten, immer in der Hoffnung, entweder in Callao oder Valparaíso der Expedition des Kapitäns Baudin zu begegnen.
Wir verließen Turbaco in einer kühlen, dunklen Nacht. Unser Weg führte uns durch einen Bambuswald, dem ähnlich, der sich auf dem Weg von Turbaco nach Ternera findet, und dessen Stämme, am Wipfel gebogen, sich zu einer Höhe von 40 oder 50 Fuß erheben. Die Maultiertreiber hatten Mühe, den Pfad zu erkennen, der äußerst schmal und morastig war. Schwärme phosphoreszierender Insekten erhellten die Spitzen der Bäume gleich beweglichen Wolken, die ein mildes, bläuliches Licht verbreiteten. Bei Tagesanbruch befanden wir uns in Arjona; dies ist die Grenze der Waldung von Bambus, einer baumartigen Graminee, die nur einzelne Gruppen im nordöstlichen Teil Südamerikas (an den Küsten von Cumaná und Caracas) wie an den Ufern des Casiquiare bildet, während sie nach Nordwesten und besonders auf den Anden von Quindío weite Erdstriche bedeckt und den wahren Charakter einer geselligen Pflanze hat.
Wir querten den Dique eine Viertellieue südwestlich von Mahates nicht auf einem Floß, deren es keine gab, sondern in einem kleinen Kanu, das zehn- bis zwölfmal hin- und herging, um unser Gepäck zu holen, während die Maultiere durchschwimmen mußten. Dieser für den Handelsverkehr von Cartagena so wichtige Kanal war damals im allerkläglichsten Zustand, mit Schlamm angefüllt und sieben Monate des Jahres hindurch fast ganz ohne Wasser. Der Boden ist tonig, und bei den großen Hochwassern des Magdalena reißt eine gewaltige Strömung oft die steile Böschung mit fort, die keinen Widerstand entgegensetzt. Das Terrain ist so eben, daß die Salzwasser durch die Ebbe bis San Estanislao wenige lieues östlich von Mahates gelangen. Die spanische Regierung erhob in Friedenszeiten jährlich fast 40.000 Piaster Zoll für die Waren, die durch den Kanal gehen und den dique entero oder medio dique [den ganzen oder den halben Deich], nach der Wassermenge der Durchfahrt, zahlen müssen. Man denkt, daß 80.000 Piaster genügt hätten, um den Kanal zu reinigen und eine Schleuse zu bauen, durch die man den Ablauf des Wassers hätte regulieren können.
In dem jämmerlichen Dorf Mahates warteten wir fast den ganzen Tag auf die Lasttiere, die unser Gepäck zum Landungsplatz des Río Magdalena bringen sollten. Die Hitze war fürchterlich; denn in dieser Jahreszeit weht kaum ein Windhauch. Traurig lagen wir auf dem Großen Platz ausgestreckt auf dem Boden, mein Barometer, das einzige mir damals verbliebene, war bei der Passage des Dique zerbrochen worden. Ich hatte mir mit der Hoffnung geschmeichelt, das Gefälle des Flusses messen, die Schnelligkeit der Strömungen und die Lage der Ortschaften durch astronomische Beobachtungen bestimmen zu können. Nur Reisende begreifen, wie schmerzlich ein solches Ereignis ist, das sich mir leider öfters auf den Anden, in Mexico und im Norden von Asien, und jedesmal zu meiner gleich tief empfundenen Betrübnis, wiederholt hat. Von allen Instrumenten, mit denen ein Reisender versehen sein muß, ist das Barometer trotz aller seiner Vervollkommnungen das, welches ihm den meisten Umstand und Kummer macht; und die Chronometer, die zuweilen plötzlich, ohne daß man die Ursache erraten kann, ihren Gang verändern, lassen die gleichen Klagen aufkommen. Hat man, mit physikalischen und astronomischen Instrumenten beladen, Reisen von einigen tausend lieues durch die Kontinente zurückgelegt, möchte man in der Tat am Ende seiner Wanderung ausrufen: Glücklich die, welche ohne Instrumente reisen, die zerbrechen, ohne Herbarien, die der Nässe ausgesetzt sind, ohne Tiersammlungen, die verderben! Glücklich die, welche die Welt durchstreifen, um sie mit eigenen Augen zu schauen, die trachten, sie zu verstehen und die anmutigen Eindrücke aufzunehmen, die der Anblick der Natur hervorruft, deren Genuß einfacher, aber auch ruhiger und weniger der Störung unterworfen ist!
In den Händen der Eingeborenen sahen wir mehrere schöne Arten großer Aras (guacamayos), die sie im nahen Wald getötet hatten, um sie zu essen. Wir machten uns daran, die starken Gehirne dieser Vögel zu zergliedern, die viel weniger Intelligenz als die eigentlichen Papageien haben. Ich zeichnete die einzelnen Teile, sobald Bonpland sie abgelöst hatte, und untersuchte das Zungenbein und den unteren Luftröhrenkopf dieser schönen Arten, die nur mühsam einige Töne hervorbringen und deren Stimme so rauh ist. Dies war eine Art der Untersuchung, auf die Herr Cuvier jüngst die Aufmerksamkeit der Anatomen gelenkt und die auch für mich viel Anziehendes hatte. Ich begann, mich über den Verlust meines Barometers zu trösten. Die Nacht erlaubte mir nicht, durch eine Sternbeobachtung die Breite zu bestimmen. Sonnenhöhen gaben mir als die Länge von Mahates 77° 35′ 33″, Cartagena zu 77° 50′ 0″ angenommen. Am 20. April [1801], um 3 Uhr morgens und bei einer Kühle, die uns köstlich vorkam, obgleich sich das hundertteilige Thermometer auf 22° hielt, waren wir bereits auf dem Weg nach dem Einschiffungsplatz des Río Magdalena im Dorf Barancas Nuevas. Wir kamen wieder durch einen dichten, majestätischen Wald, der aus Cavanillesia, Bambus, Palma amarga und Mimosaceen, namentlich Inga mit purpurroter Blüte, bestand. Auf der Hälfte des Weges von Mahates nach Barancas lag eine Gruppe Hütten, die alle aus Bambusrohr erbaut und von Zambos bewohnt waren. Die Vermischung der Indianer und Neger ist in diesen Gegenden sehr gewöhnlich. Die Frauen der kupferfarbenen Stämme haben eine besondere Neigung für die Afrikaner, und viele Neger von Choco, aus der Provinz Antioquia und von Simitarra, nachdem sie ihre Freiheit als Lohn der Arbeitsamkeit erlangt haben, lassen sich im Tal des Flusses nieder. Es ist oft erwähnt worden, wie die Weisheit der ältesten spanischen Gesetze die Freilassung der Neger begünstigte, während andere europäische Völker, die sich einer hohen Bildung rühmen, sie gehemmt und durch das Mißtrauen einer unvernünftigen und unmenschlichen Gesetzgebung erschwert haben.
Überall, wo die durch das doppelte Stimulans der Hitze und der Feuchtigkeit erregte Üppigkeit der Vegetation es erlaubt, die geognostische Constitution des Bodens zu untersuchen, findet man östlich von Mahates nicht mehr jene rezenten Formationen von Kalkstein mit Madreporen angefüllt, die sich zwischen Cartagena und Turbaco erheben. Das herrschende Gestein wird hier ein Sandstein von tonartiger Verkittung, in Bänke getrennt, deren Streichen sehr regelmäßig von Nordosten nach Südwesten geht und deren Fallen 70 Grad nach Nordwesten ist. Überall, wo ich zwischen 4 und 9½° nördlicher Breite diesen Sandstein von Neu-Granada untersuchen konnte, besteht er aus abwechselnden Schichten von kleinkörnigem, quarzigem und schieferartigem Sandstein und aus wirklichem Konglomerat [Puddingstein. Anmerkung des Hrsg.], in welchem eckige Bruchstücke lydischen Steines von 2 bis 3 Zoll Breite, Tonschiefer, Gneis und Quarz eingefügt sind. Diese Trümmer von Urgebirgsgestein zeigen sich besonders bei Honda und Espinal. Das Bindemittel des Sandsteins ist tonig und eisenhaltig, zuweilen sogar etwas kieselartig. Die Farben des Gesteins wechseln von gelblichem Grau zu bräunlichem Rot. Diese letzte Nuance ist dem Eisenoxid zuzuschreiben; auch findet man überall etwas von der sehr kompakten Brauneisenerzader, in welcher Sandstein nesterweise in kleinen Schichten und unregelmäßigen Gängen eingefügt ist. Der lydische Stein, vom schönsten Schwarz und selten von Quarzadern durchzogen, ist viel häufiger in den groben Konglomeraten als die Fragmente von Urgebirgsgestein. Überall überwiegt der kleinkörnige, schiefrige Sandstein um seiner Masse willen die Konglomerate mit groben Bruchstücken. Wir werden bald sehen, daß auf den Höhen von 800 und 1000 Toisen über dem Meeresspiegel diese Konglomerate fast gänzlich verschwinden. Bei Zambrano, auf dem westlichen Ufer des Río Magdalena, im Süden von Teneriffa, nimmt der Sandstein eine kugelförmige Struktur an. Ich habe dort abgeplattete Kugeln von 2 bis 3 Fuß Durchmesser gesehen, die sich durch Zersetzung in 12 bis 15 konzentrische Schichten separieren. Der Sandstein dieser Kugeln, die sich beim Landungsplatz von Barancas Viejas auf der Oberfläche des Bodens in Form von kleinen konischen Erhöhungen zeigen, ist außerordentlich feinkörnig.
Ich werde dieses Kapitel beenden, indem ich an einige allgemeine Beobachtungen erinnere, nach welchen diese sandige Formation des Dique von Mahates und des Tals des Río Magdalena sich als innig verbunden mit der großen Formation der Ebenen (Llanos) des Orinoco darstellt. Eine Masse Sandstein von ungeheurem Umfang deckt fast ohne Unterbrechung nicht nur die unteren nördlichen Regionen Neu-Granadas zwischen Mompós, Mahates und den Gebirgen von Tolú und Maria, sondern auch das Becken des Magdalena zwischen Teneriffa und Melgar sowie das des Río Cauca zwischen Cartago und Cali. Einige verstreute Fragmente von Schiefersandstein oder Kohlenschiefer, die man nahe bei der Mündung des Río Sinú östlich vom Golf von Darién fand, machten es ziemlich wahrscheinlich, daß diese sandige Formation sich selbst bis zum Río Atrato und dem Isthmus von Panamá erstreckt. Sie erhebt sich zu bedeutenden Höhen auf dem östlichen Zweig der Cordilleren, gegen die Páramos von Chingasa und Suma Paz. Ich habe den Sandstein Neu-Granadas, fast ohne ihn einen Augenblick aus dem Auge zu verlieren, vom Tal des Magdalena (von Honda und Melgar) über Pandi bis zur Hochebene von Bogotá, ja selbst bis über den See Guatavita und die Kapelle Unserer Lieben Frauen von Montserrate verfolgen können. Er lehnt sich an die große Bergkette an, welche die Wasserscheide zwischen den Zuflüssen des Magdalena und denen des Meta und Orinoco bildet, bis zu mehr als 1800 Toisen über dem Meeresspiegel. Mehrere sekundäre Terrains (der Sandstein mit Schichten wirklicher Kohle, Gips in Begleitung von Steinsalz, eine Kalkart fast ohne alle Versteinerungen), die man auf der Hochebene von Bogotá für eine Gruppe örtlicher Formationen halten möchte, füllen das Bassin von Funza an und steigen bis in die Schluchten hinab, deren Niveau 7000 Fuß tiefer ist. Auf dem Weg von Honda nach Santa Fé scheint die Sandsteinschicht allerdings in der Ausdehnung ihrer Überlagerung durch den Übergangstonschiefer von Villeta unterbrochen; aber die Lage der Salzquellen von Pinceima und Pizará nahe bei Muzo läßt mich glauben, daß auch von dieser Seite, an den Ufern des Río Negro, dem Nebenfluß des Magdalena (zwischen dem Hornblende- und dem kohlenhaltigen Schiefer von Muzo, der Smaragde enthält, und dem Übergangsschiefer mit Kupfergängen von Villeta), der kohlehaltige Sandstein und der salzführende Gips der Hochebene von Bogotá und Zipaquirá sich mit den homonymen sandigen Terrains verknüpfen, die das Magdalena-Tal zwischen Honda, der Landenge von Carare und Zambrano erfüllen. Der Sandstein der niedrigen Regionen, überall wo er nicht von Schichten von Felskristall (gewöhnlich primitive oder intermediäre genannt) erhoben worden ist, zeigt ziemlich horizontale Bänke. Im Gegensatz dazu neigen die Bänke auf den Höhen auf ziemlich konstante Art zu Gruppen. Der Sandstein der Hochebene von Bogotá und der, welchen man beim Aufstieg zu den beiden Kapellen oberhalb der Stadt Santa Fé in einer Höhe von 1650 und 1687 Toisen bemerkt, besteht gleichförmig aus sehr feinen Quarzkörnern. Man findet in ihnen vom lydischen Stein fast keine Spur mehr; die Quarzkörner sind so dicht aneinander, daß der Fels zuweilen das Aussehen eines körnigen Quarzes annimmt. Aus diesem selben quarzigen Sandstein ist die natürliche Brücke von Icononzo gebildet, über die wir bei unserer Reise von Santa Fé nach Popayán und Quito gekommen sind. Diese sandigen Gesteine brausen im allgemeinen nicht von Säuren auf. Mit Ausnahme des Brauneisenerzes und (was ziemlich merkwürdig ist) mit Ausnahme einiger verstreuter Nester von sehr reinem Graphit enthält diese Formation auch, und in allen Höhen, Schichten braunen Tons, der sich fett anfühlt und nicht glimmerartig ist. In Gachansipa, Chaleche und beim Hügel von Suba im Becken von Bogotá wird dieser Ton zuweilen stark kohlenstoffhaltig und geht in den Brandschiefer der deutschen Geognosten über. Das abführende Salz von Mesa de Palacios bei Honda ist ein in diesen Gegenden berühmtes Magnesiumsulfat. Es braust auf mit den tonigen Schichten des Sandsteins. Fast nirgends zeigt dieses Gestein heterogene nach Zonen gemischte Färbung, noch die Massen nicht zusammenhängenden und linsenförmigen Tons, die besonders in Deutschland den bunten Sandstein auszeichnen.
Nach diesem allgemeinen Gemälde füge ich noch einige Betrachtungen über die Lagerung des Gesteins, das uns beschäftigt, an. Ich habe die tonige Sandstein-Formation des Río Magdalena und des Plateaus von Bogotá unmittelbar auf einem schönen Granit ruhen sehen, der mit Turmalinen angefüllt war (Peñon de Rosa, nördlich von Banco, und am Wasserfall von La Peña bei Mariquita), sowie auf dem Gneis (Río Lumbi, bei den Silberminen von Santa Ana), auf dem Übergangstonschiefer (zwischen Alto de Gascas und Alto del Roble, nordwestlich von Santa Fé de Bogotá, wenn man gegen Villeta hinabsteigt). Ich kenne bis jetzt kein anderes sekundäres Gestein, das unter dem Sandstein von Neu-Granada läge. Diese Formation enthält Höhlen bei Facatativá und Pandi; sie hat mächtige Schichten nicht von Braunkohle, aber von blättriger, kompakter Steinkohle, mit Pechkohle vermischt, zwischen La Palma und Guaduas, in einer Höhe von 600 Toisen, nahe bei Vélez und der Villa de Leiva; in Chipo bei Canoas; in Suba, auf dem Cerro de los Tunjos in der großen Höhe von 1370 Toisen. Die Reste organisierter Körper aus dem Tierreich sind in diesem Sandstein außerordentlich selten. Ich habe nur ein einziges Mal fast mikroskopische Trochiliten in einer Schicht eingeschalteten, verhärteten Tons gefunden, südlich von Icononzo, im Cerro du Portachuelo. Es wäre möglich, daß die Steinkohlen von Guaduas und Canoas ein neueres, über den Sandstein von Bogotá gelagertes Terrain sind; indes schien mir nichts diese Vermutung der Überlagerung anzukündigen. Ich weiß, daß in Europa die Pechkohle ganz besonders der Braunkohle des tertiären Sandsteins und den Basalten angehört, die auf Stämme dicotyledonischer Bäume ausgegossen wurden; doch sie bildet auch, ganz unbestreitbar, kleine Schichten in der Schieferkohle des roten Sandstein- und Quarzporphyrterrains.
Die Formationen, welche den Sandstein von Neu-Granada bedecken und ihn ganz besonders als roten Sandstein in der Serie der sekundären Gesteine zu charakterisieren scheinen, sind der stinkende Kalkstein (am Zusammenfluß des Caño Morocoy und des Río Magdalena) und der blättrige Gips (Becken des Río Cauca, bei Cali, und des Río Funza, bei Santa Fé de Bogotá). In diesen zwei Becken des Cauca und des Funza, deren absolute Höhe um 900 Toisen verschieden ist, sieht man von unten nach oben drei Formationen ganz regelmäßig aufeinanderfolgen: die des roten Sandsteins oder des kohleführenden Sandsteins, des blättrigen Gipses und eines kompakten Kalksteins. Die zwei letzteren machen vielleicht nur ein und dasselbe Terrain aus, das die Formation des Zechsteins darstellt, der in diesen hohen tropischen Regionen gewöhnlich ohne alle Versteinerungen ist, doch im Tal des Magdalena, bei Tocayma, einige Ammoniten, Wirbelknochen des Krokodils und Abdrücke von Fischen enthält. Gips fehlt oft, aber in der großen Höhe von 1400 Toisen (in Zipaquirá, Enemocón und Sesquiler) führt er Salz und in grauem und braunem Ton (Salzton) mächtige Depots von Steinsalz, die seit Jahrhunderten ausgebeutet werden. Diese Depots, womit die Zerklüftungen ausgefüllt sind, scheinen nach genaueren, jüngst in Europa gemachten Beobachtungen ohne Zweifel durchgängig dem Keuper und Muschelkalk anzugehören, das heißt viel neueren Formationen, als der Zechstein ist; so wäre es auch möglich, daß im Becken von Bogotá der rote Sandstein unmittelbar mit diesen salzführenden Formationen bedeckt wäre und daß der Gips von Zipaquirá und der Kalk von Tocayma dem wahren Zechstein gleich fremd wären; meine Reisejournale erlauben mir nur diese Zweifel anzudeuten, deren Lösung den Geognosten zukommt, die jene tropischen Regionen unter dem Einfluß neuer Ideen über die Typen der ausgebreitetsten Formationen besuchen werden.
Nach dem Ensemble [dem Ganzen] der Tatsachen, die ich soeben über die Lagerung des Sandsteins von Neu-Granada vereinigt habe, zögere ich nicht, dieses Gestein, das sich besonders eigentümlich entwickelt hat, als roten Sandstein (Totliegendes) und nicht als Buntsandstein (Sandstein von Nebra) anzusehen. Ich weiß, daß sich häufig Schichten von Ton und Brauneisenerz besonders in diesem bunten Sandstein entwickelt haben und daß oolithförmige Konkretionen (Rogenstein) sehr oft in diesem Gestein fehlen. Es ist nicht zweifelhaft, daß in Europa dieser über dem Zechstein liegende, bunte Sandstein auch einige Spuren von Kohle, kleine Schichten von extrem quarzigem Sandstein (körnigem Quarz) und Steinsalz enthält. Alle diese Analogien würden mir sehr wichtig scheinen, wenn Schichten von grobem Konglomerat, die in den unteren Regionen mit Schichten von kleinkörnigem Sandstein abwechseln, und wenn eckige Bruchstücke des lydischen Steines und selbst Gneis und Glimmerschiefer, die in den eingeschalteten Konglomeraten eingefügt sind, nicht den Sandstein von Neu-Granada als die Parallele des roten Sandsteins charakterisierten. Wenn der bunte Sandstein (z.B. im Norden Englands oder an der Wimmelburg in Sachsen) Bruchstücke von Granit und Syenit zeigt, sind diese gerundet und einfach mit Ton umhüllt; sie bilden kein kompaktes, festes Konglomerat von eckigen Bruchstücken wie im roten Sandstein oder der Kohle. Dieses letzte Gestein, das älteste unter den sekundären Gesteinen, kommt im Mansfeldschen wie in Neu-Granada sehr häufig in eingeschobenen Massen von Ton und kleinen Schichten von braunem und rotem Eisenerz vor. Die kugelförmige Struktur, die der Sandstein an den Ufern des Magdalena bei Zambrano zeigt, findet sich wieder im roten oder kohlenhaltigen Sandstein Ungarns bei Klausenburg sowie im alten und weißlichen Konglomerat Sachsens, das den kohlenhaltigen Sandstein mit dem Zechstein verbindet, und sogar in der Nähe von Lausanne, in der Molasse des Aargaus (tertiärer Sandstein mit Braunkohle). Das Ganze der Lagerungsverhältnisse ist es, was das Alter einer Formation bestimmt; es sind nicht seine Zusammensetzung und Struktur allein. Es gibt Länder, wo der rote und der Buntsandstein als ein und dieselbe Formation betrachtet werden können, in welcher sich Zechsteinbänke entwickelt finden oder gänzlich fehlen.
Der rote Sandstein Neu-Granadas scheint im nördlichen Teil des Beckens des Río Magdalena, zwischen Mahates, Turbaco und der Küste des Antillen-Meeres, unter einen mit Sternkorallen und Seemuscheln angefüllten Tertiärkalk hinabzureichen; steigt man aber zu einer Höhe von 1400 Toisen auf, ist die kalk- und salzhaltige Gipsformation, die auf dem roten Sandstein ruht, im Campo de Gigantes, westlich von Suacha, im Becken von Bogotá, mit Anschwemmungen ungeheurer Knochen von Mastodonten bedeckt. Der Tendenz der neueren Geognosie gemäß, die den Bereich der tertiären Formation auf Kosten der sekundären ausdehnt, könnte man versucht sein, den Sandstein von Honda, den Gips mit Steinsalz von Zipaquirá und den Kalkstein von Tocayma und von Bogotá als spätere Formationen, die der Kreide folgten, anzusehen. Nach dieser Hypothese wären die Kohlen von Guaduas und Canoas Braunkohle, das Steinsalz von Zipaquirá, Enemocón, Sesquiler und Chamesa tertiäre Depots, wie man es von mehreren Salzlagern der Toscana, des östlichen Europa und Asiens behauptet. Ich hatte bis jetzt noch nicht das Glück, Abdrücke von Farnkräutern in der Kohle von Canoas zu sehen; aber auf dem Plateau von Neu-Granada widerspricht diesen Hypothesen, welche die sekundäre Formation in die tertiäre verwandeln, die Seltenheit oder vielmehr der fast gänzliche Mangel an Fossilien organischer Körper bis zu einer senkrechten Höhe von 10.000 Fuß und die Mächtigkeit der sandigen und kalkartigen Schichten, die gleichförmig verteilt, sehr kompakt, durchaus nicht mit Sand vermischt und ohne alle Nieren von Silex und kieselsäurehaltigen Infiltrationen sind.
Es scheint, daß sich der Sandstein, den ich bis auf eine Höhe von 1700 Toisen im westlichen Teil des Páramo de Chingasa gefunden habe, über den Kamm der östlichen Cordilleren hinzieht und bis zu den Ebenen von Casanare erstreckt; wenigstens haben die Herren Boussingault und Rivero, die einzigen Geognosten, die nach mir diese Gegenden besuchten, den roten Sandstein auf den Hochebenen von Barquisimeto, Tocuyo, Mérida und Trujillo gefunden sowie wirkliche Steinkohle bei Carache, südlich des Páramo de las Rosas. Die Lager von Steinsalz und die Salzquellen folgen einander über die östliche Cordillere (die, an der die Stadt Santa Fé de Bogotá liegt) vom Tal des Río Negro, eines Nebenflusses des Magdalena, bis zum Tal des Meta, des Nebenflusses des Orinoco; von Pinceíma und Zipaquirá bis Chita, Chamesa und Receptor in einer Richtung von Südwesten nach Nordosten. Es ist wie eine salzführende Kluft, welche die Längenachse der Cordilleren durchschneidet. Diese Identität der Sekundärformationen oder Depots gleichförmig ausgebreiteten Sandsteins (obgleich unter sehr verschiedenem Fallen der Lagerstätten) in den niedrigen Gegenden des Magdalenastroms und den Ebenen zwischen dem Meta und dem Apure wie auf den Plateaus und dem Rücken der Gebirge scheinen mir – beim gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse – unwiderlegbare Anzeichen der Erhebung der ganzen Kette. Dieses sind geognostische Tatsachen, die sich (nach Herrn Pentland) auch im Sandstein der niedrigen Gegenden Chiles, auf dem Plateau von Titicaca und an den Ufern des Beni finden und in sehr natürlicher Verbindung mit den Tatsachen stehen, welche die Herren Leopold von Buch und Elie de Beaumont mit soviel Scharfsinn auf dem Alten Kontinent über die Entstehung der Gebirge und ihr relatives Alter gesammelt haben.
[An dieser Stelle folgen dem Kapitel XXIX „Zusätze“ vor allem zum ›Cuba-Werk‹. Diesen Text findet der Leser in Band III (›Cuba-Werk‹) der vorliegenden Studienausgabe S. 170–207 samt den statistischen Tafeln zur Bevölkerungsanalyse S. 208–226.]