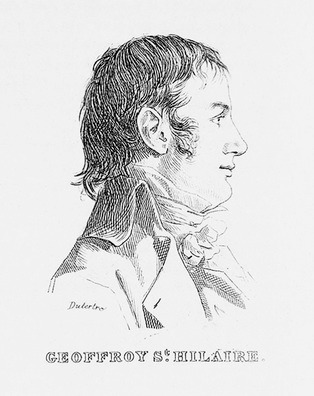
Das wissenschaftliche Wunderkind Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
Als Napoleon Bonaparte 1798 in Ägypten einmarschierte, brachte er nicht nur Schiffe, Soldaten und Waffen mit. Er hielt sich selbst für einen Wissenschaftler und nahm sich vor, das Land umzukrempeln. Dazu wollte er den Nil regulieren, den Lebensstandard verbessern und sowohl die Kultur- als auch die Naturgeschichte Ägyptens kennenlernen. Zu seiner Mannschaft gehörten einige führende französische Ingenieure und Wissenschaftler. Einer von ihnen war Étienne Geoffroy Saint-Hilaire.
Mit seinen 26 Jahren war Saint-Hilaire ein wissenschaftliches Wunderkind. Er hatte bereits den Lehrstuhl für Zoologie am Museum für Naturgeschichte in Paris inne und sollte zu einem der größten Anatomen aller Zeiten werden. Schon im Alter zwischen 20 und 30 Jahren machte er sich mit seinen anatomischen Beschreibungen von Säugetieren und Fischen einen Namen. In Napoleons Gefolge hatte er die spannende Aufgabe, viele Tierarten zu sezieren, zu untersuchen und zu benennen, die Napoleons Leute in den Tälern, Oasen und Flüssen Ägyptens fanden. Eine davon war ein Fisch, von dem der Leiter des Pariser Museums später sagte, dieser allein habe Napoleons gesamte Expedition nach Ägypten gerechtfertigt. Nicht in dieser Beschreibung eingeschlossen war wohl Jean-François Champollion, der mit Hilfe des Steins von Rosetta die ägyptischen Hieroglyphen entzifferte.
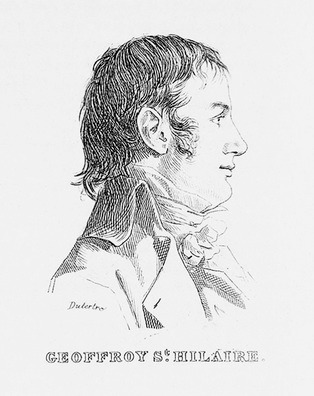
Das wissenschaftliche Wunderkind Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
Von außen sah das Tier mit Schuppen, Flossen und Schwanz wie ein ganz gewöhnlicher Fisch aus. Anatomische Beschreibungen umfassten zu Saint-Hilaires Zeit aber auch die detaillierten Ergebnisse des Sezierens; häufig stand ein Künstlerteam bereit, um jedes wichtige Detail in wunderschönen, oftmals farbig gestalteten Lithographien einzufangen. Der Schädel hatte auf der Oberseite hinten, in der Nähe der Schulter, zwei Löcher. Schon das war seltsam, aber die eigentliche Überraschung steckte in der Speiseröhre. Sie beim Sezieren eines Fisches freizulegen ist normalerweise eine wenig spektakuläre Angelegenheit, denn sie führt als einfaches Rohr vom Mund zum Magen. Hier jedoch war es anders. Die Speiseröhre hatte auf jeder Seite einen Luftsack.
Solche Säcke waren in der Wissenschaft bereits bekannt. Bei einer ganzen Reihe verschiedener Fische waren Schwimmblasen beschrieben worden; selbst Johann Wolfgang von Goethe machte darüber einmal eine Bemerkung. Die Luftsäcke sind sowohl bei Salz- als auch bei Süßwasserfischen vorhanden; sie füllen sich mit Luft oder leeren sich und sorgen damit für einen neutralen Auftrieb, wenn der Fisch sich in unterschiedlichen Wassertiefen aufhält. Wie in einem U-Boot, das bei dem Befehl »Tauchen« Luft nach außen pumpt, so verändert sich auch die Luftmenge in der Schwimmblase, so dass das Tier sich in unterschiedlichen Tiefen und bei unterschiedlichem Wasserdruck bewegen kann.
Hier jedoch förderte gewissenhaftes Sezieren eine Überraschung zutage: Die Luftsäcke waren durch einen kleinen Gang mit der Speiseröhre verbunden. Und dieser kleine Gang, eine winzige Verbindung vom Luftsack zur Speiseröhre, hatte große Auswirkungen auf Saint-Hilaires Denken.
Die Beobachtung der Fische in freier Wildbahn bestätigte, was Saint-Hilaire bereits aufgrund ihrer Anatomie vermutet hatte. Sie schluckten Luft. Sie sogen die Luft durch die Löcher hinten am Kopf ein. Und man konnte bei ihnen sogar eine Art synchronisiertes Luftsaugen beobachten: Ganze Gruppen schnauften im Einklang. Diese heute als Flösselhechte bekannten atmenden Fische machten mit der aufgenommenen Luft oft auch andere Geräusche, beispielsweise ein Rumpeln oder Stöhnen, was vermutlich der Partnersuche diente.
Die Fische taten noch etwas anderes, was vollkommen unerwartet kam. Sie atmeten Luft. Die Säcke waren voller Blutgefäße, ein Zeichen, dass die Fische mit diesem System den Sauerstoff in ihr Blut aufnahmen. Und was noch wichtiger war: Sie atmeten die Luft durch die Löcher oben auf dem Kopf ein, während der Körper im Wasser blieb.
Damit hatte man nun einen Fisch, der nicht nur Kiemen besaß, sondern auch mit einem anderen Organ Luft einatmen konnte. Es braucht nicht besonders betont zu werden, dass die Spezies zu einer Berühmtheit wurde.
Einige Jahrzehnte nach der Entdeckung in Ägypten schickte man eine österreichische Mannschaft auf eine Expedition: Sie sollte anlässlich der Hochzeit einer österreichischen Prinzessin das Amazonasgebiet erkunden. Das Team sammelte Insekten, Frösche und Pflanzen, neue Arten, die man zu Ehren der königlichen Familie benennen wollte. Unter den Entdeckungen war auch ein neuer Fisch, der, wie alle Fische, sowohl Kiemen als auch Flossen besaß. In seinem Inneren hatte er aber ebenfalls unverkennbare Gefäße: in diesem Fall keinen einfachen Luftsack, sondern ein Organ mit den Bläschen, Blutgefäßen und Geweben, die für eine echte Lunge nach Art der Menschen charakteristisch sind. Dieses Tier überbrückte die Kluft zwischen zwei großen Gruppen von Lebewesen: den Fischen und den Amphibien. Als Symbol für die Verwirrung gaben die Entdecker ihm den Namen Lepidosiren paradoxus – was auf Lateinisch so viel wie »paradoxer Schuppensalamander« bedeutet.

Lungenfische haben sowohl eine Lunge als auch Kiemen. Mit der Lunge atmen sie Luft wie wir, wenn der Sauerstoffgehalt des Wassers ihren Bedarf nicht deckt. Bei anderen Fischen tragen Schwimmblasen zum Auftrieb bei.
Man kann sie nennen, wie man will – Fische, Amphibien oder irgendetwas dazwischen: Diese Tiere hatten Flossen und Kiemen für das Leben im Wasser, aber auch eine Lunge, mit der sie Luft atmeten. Und sie waren kein Einzelfall. Im Jahr 1860 entdeckte man im australischen Queensland einen weiteren Fisch mit einer Lunge. Diese Spezies hatte außerdem ein sehr charakteristisches Gebiss. Solche Zähne, die wie flache Ausstechförmchen geformt waren, kannte man von den Fossilien einer längst ausgestorbenen Art – das Tier namens Ceratodus hatte man in mehr als 200 Millionen Jahre altem Gestein gefunden. Die Folgerung war klar: Lungenfische, die Luft atmen, sind weltweit verbreitet und leben seit Hunderten von Jahrmillionen auf der Erde.
Manchmal verändert eine scheinbar seltsame oder kleine Beobachtung unseren Blick auf die ganze Welt. Lungen und Schwimmblasen von Fischen führten dazu, dass eine ganze Wissenschaftlergeneration sich für die vergleichende Anatomie interessierte und zu ihrer Erforschung sowohl Fossilien als auch lebende Tiere untersuchte. Die Fossilien zeigen, wie das Leben in der entfernten Vergangenheit aussah, und die heute lebenden Tiere machen deutlich, wie anatomische Strukturen funktionieren und wie die Organe sich von der Eizelle bis zum ausgewachsenen Organismus entwickeln. Wie wir noch genauer erfahren werden, ist dies ein sehr leistungsfähiger Ansatz.
Die Kombination von Untersuchungen an Fossilien und Embryonen war für die Naturforscher, die auf Darwin folgten, ein sehr fruchtbares Arbeitsgebiet. Bashford Dean (1867–1928) hatte sich in Akademikerkreisen einen ungewöhnlichen Namen gemacht: Er war der Einzige, der jemals sowohl am Metropolitan Museum of Art als auch unmittelbar gegenüber auf der anderen Seite des Central Park am American Museum of Natural History den Rang eines Kurators bekleidete. Er hatte in seinem Leben zwei Leidenschaften: Fischfossilien und Schlachtrüstungen. Am Met begründete er die Sammlung von Rüstungen und ihre Ausstellungen, am American Museum jenseits des Parks baute er die Fischsammlung auf. Wie es zu einem Menschen mit solchen Interessen passt, war er ein skurriler Charakter. Er entwarf seine eigene Rüstung und ging sogar so weit, sie auf den Straßen von Manhattan anzulegen.
Wenn er nicht gerade mittelalterliche Kampfkleidung trug, erforschte Bashford Dean vorzeitliche Fische. Irgendwo in der Verwandlung des Embryos von der Eizelle zum ausgewachsenen Tier, so glaubte er, müssten Lösungen für die Rätsel der Vergangenheit und Abstammung der Fische von Vorläuferarten liegen. Als er Fischembryonen mit Fossilien verglich und sich einen Überblick über die Arbeiten in den anatomischen Instituten seiner Zeit verschaffte, erkannte Dean, dass Lunge und Schwimmblase in der Embryonalentwicklung mehr oder weniger gleich aussehen. Beide Organe schnüren sich vom Darmrohr ab und bilden Luftsäcke. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass die Schwimmblase auf der Oberseite des Rohres in der Nähe der Wirbelsäule entsteht, während die Lunge sich unten auf der Bauchseite abschnürt. Vor dem Hintergrund solcher Erkenntnisse vertrat Dean die Ansicht, Schwimmblase und Lunge seien unterschiedliche Versionen des gleichen Organs, das durch den gleichen Entwicklungsprozess entsteht. Tatsächlich sind Luftsäcke in irgendeiner Form bei praktisch allen Fischen mit Ausnahme der Haie vorhanden. Wie viele wissenschaftliche Ideen, so hat auch Deans Vergleich eine lange Geschichte. Vorläufer findet man schon im 19. Jahrhundert in den Arbeiten deutscher Anatomen.
Aber was haben die Luftsäcke mit Mivarts Kritik und Darwins Antwort zu tun?
Erstaunlich viele Fische können über längere Zeit Luft atmen. Der 15 Zentimeter lange Schlammspringer ist in der Lage, mehr als 24 Stunden im Schlamm zu laufen und zu überleben. Der zutreffend benannte Kletterfisch schlängelt sich nach Bedarf von einem Teich zum anderen und klettert dabei manchmal sogar über Zweige und kleine Äste. Aber dieser Fisch ist nur eine einzige Spezies. Hunderte andere können Luft schlucken, wenn die Sauerstoffkonzentration in dem Wasser, das sie bewohnen, abnimmt. Wie machen diese Fische das?

Bashford Dean, Kurator am Metropolitan Museum of Art und am American Museum of Natural History, liebte sowohl Rüstungen als auch Fische.
Manche, darunter der Schlammspringer, nehmen Sauerstoff über die Haut auf. Andere besitzen oberhalb der Kiemen ein besonderes Organ für den Gasaustausch. Manche Welse und andere Arten absorbieren Sauerstoff mit dem Darm: Sie schlucken die Luft wie ihre Nahrung und nutzen sie zum Atmen. Und eine Reihe von Fischen haben auch eine Lunge mit zwei Flügeln, die aussieht wie unsere. Lungenfische leben im Wasser und atmen meist mit den Kiemen, aber wenn der Sauerstoffgehalt in ihrer Umgebung nicht ausreicht, um den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, drängen sie an die Oberfläche und saugen Luft in die Lunge. Die Fähigkeit, Luft zu atmen, ist keine eigenwillige Ausnahme bei einem ganz besonderen Fisch, sondern weit verbreitet.
Kürzlich nahmen Wissenschaftler der Cornell University sich den Vergleich von Schwimmblase und Lunge noch einmal vor, dieses Mal mit neuen Methoden der Genetik. Ihre Frage lautete: Welche Gene tragen dazu bei, dass die Fische während der Embryonalentwicklung eine Schwimmblase bilden? Sie durchforsteten den Katalog der Gene, die in einem Fischembryo aktiv sind, und fanden etwas, worüber sich Dean und Darwin gefreut hätten. Für die Ausbildung der Schwimmblase sorgen bei Fischen die gleichen Gene, die bei Menschen – wie auch bei Fischen – die Lunge entstehen lassen. Den Luftsack gibt es bei praktisch allen Fischen; manche nutzen ihn als Lunge, andere als Hilfsmittel für den Auftrieb.
Hier zeigt sich, wie vorausschauend Darwins Antwort auf Mivart war. Die DNA zeigt eindeutig, dass Lungenfische, Saint-Hilaires Flösselhechte und andere Arten, die eine Lunge haben, unter den Fischen die engsten heute noch lebenden Verwandten landlebender Tiere sind. Die Lunge ist keine Erfindung, die plötzlich entstand, als die Tiere sich so entwickelten, dass sie gehen konnten. Fische besaßen bereits eine Lunge und atmeten damit Luft, bevor die ersten Tiere das feste Land betraten. Die Invasion des Landes durch die Nachkommen der Fische brachte kein neues Organ hervor, sondern veränderte nur die Funktion eines Organs, das bereits vorhanden war.