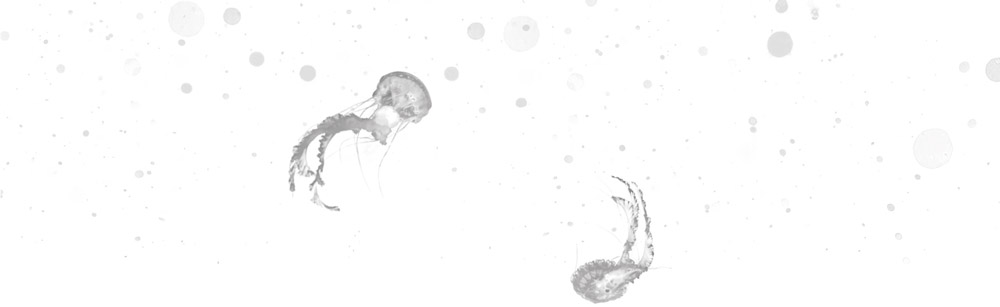
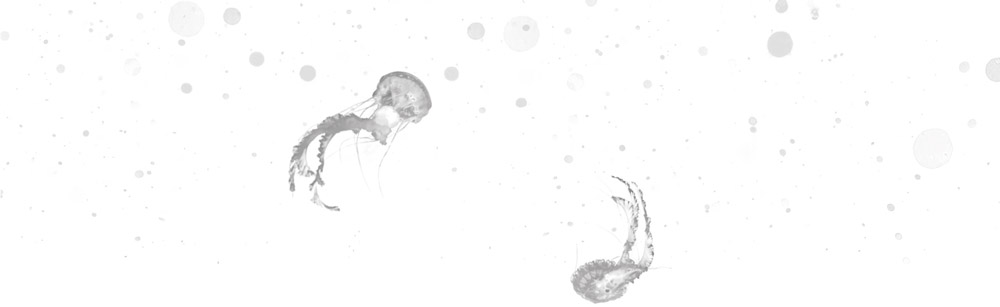
12
Bisher habe ich mich noch niemals von jemandem verabschieden müssen. Nicht auf diese Weise. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, als meine Mutter gestorben ist. Und obwohl ich gewartet und gewartet habe, dass mein Vater von der Arbeit wieder nach Hause kommt, ist er nie zurückgekehrt. Von keinem der beiden konnte ich mich richtig verabschieden.
Im Hangar wartet mein Großvater mit aschgrauem Gesicht. Aber er lächelt ein weinig, als er auf die Buchstaben zeigt, die uns von der einen Seite des U-Boots entgegenleuchten. »Ich nehme an, das war deine Idee.«
Ich nicke und mustere den Schriftzug meines Schiffs: Kabul. Es sieht toll aus. Der Geburtsort meiner Mutter und die Stadt der Vorfahren meines Vaters. Ich glaube, es würde ihm gefallen. Jedes Mal wenn er mich seine Kabuli Peree nannte, seine Fee aus Kabul, strahlten seine warmen haselnussbraunen Augen noch heller.
Im und um das Boot ist einiges los. Deathstar und ein paar andere Besatzungsmitglieder laufen über die Gangway hinein und hinaus und bereiten das Ablegen vor. Überall werden noch letzte Kontrollen durchgeführt. Die Zwillinge sind wohl irgendwo im Inneren des Schiffs.
Mein Großvater nimmt mich zur Seite und wir setzen uns auf eine der Holztreppen. Er greift in seine Tasche. »Das ist für Jojo.«
Es ist ein rotes Halsband mit einem silbernen Glöckchen. Ich schüttle es und muss beim Klang des leisen Bimmelns lächeln.
»Es war für Benji gedacht«, fährt er fort. »Ich wollte es ihm nach der großen Flut geben, wenn wir sicher und wohlbehalten an einem neuen Ort angekommen wären.«
Ich starre ihn an. Er spricht fast nie über die Zeiten, in denen die Erde sich völlig verändert hat, und ich habe auch nicht oft danach gefragt. Es ist so ein schwieriges Thema für ihn. »Opa, du hast noch nie etwas von Benji erzählt.«
»Benji war mein Hund.«
»Aber du hast nicht … Warum hast du mir nie gesagt, dass du einen Hund hattest?« Ich lehne mich an ihn und atme seinen vertrauten warmen und süßen Duft ein.
»Was würde es auch nützen, in der Vergangenheit zu schwelgen, mein Kind? Jeder hat etwas verloren. Wir alle haben jemanden verloren. Und die Tiere haben genauso sehr gelitten wie wir. Sie sind in Panik geraten, rannten kopflos und brüllend davon. Einige Menschen haben versucht, ihre geliebten Tiere bis zum Schluss zu beschützen. Sie sind dennoch ertrunken. Katzen, Hunde, Rinder, die wilden Tiere – Milliarden von ihnen sind auf der ganzen Erde umgekommen.«
Mein Herz wird schwer und immer schwerer und schwerer.
Ich habe unzählige 3-D-Simulationen angeschaut und all die Live-Aufnahmen, Dokumentarfilme und endlosen Wiederholungen gesehen – das haben wir alle und tun es nach wie vor. Aber sie sind fast immer aus dem Blickwinkel eines anderen erzählt. Einen Bericht aus erster Hand zu hören, von meinem Großvater, der über seine eigenen Erfahrungen spricht, ist etwas ganz anderes. Kein Wunder, dass er nicht gerne darüber redet.
Ich schlucke und lege meine Hand auf seine. »Und Benji?«
»Benji … er ist weggelaufen, als die Erdbeben begannen. Wir haben ihn überall gesucht, bis wir losmussten, um noch ein Schutzzentrum erreichen zu können.« Er hebt die Schultern und schüttelt den Kopf. »Ich habe es nie erfahren. Vielleicht hat er es geschafft und den Rest seines Lebens bei einer liebevollen Familie gelebt.« Bei dem Gedanken greift er nach meiner Hand.
Meine Lippen beben. Ich kuschle mich noch näher an ihn. »Opa, hast du dich jemals gefragt, ob deine biologischen Eltern überlebt haben?«
Er holt zittrig Luft, sein Blick wirkt müde und weit entfernt, als er einen Arm um mich legt. »Am Anfang ständig. Auch wenn alles dagegen gesprochen hat. Und einige Jahre später hat es sich dann bestätigt – meine Eltern sind nur zwei von den Milliarden Menschen gewesen, die bei der Katastrophe ums Leben gekommen sind.« Er holt tief Luft und atmet sie gleich wieder aus. »Die Menschen haben gehofft, wenn sie sich auf dem Meer befinden, könnte sie das vor allem bewahren, was noch kommen würde. Aber schließlich fanden diese Schiffe der letzten Hoffnung alle nur ihren Weg auf den Grund der Welt.«
Ein schreckliches Bild nach dem anderen blitzt vor meinem inneren Auge auf und ich zittere. So viel hat mein Großvater noch nie über diese Zeit erzählt.
Er fährt mit einer zittrigen Hand durch die Luft. »Und da ist meine Tante Esther mit mir abgehauen – als sie erfuhr, welche Pläne meine Eltern für uns alle hatten. Es war eine sehr verwirrende Zeit. Es herrschte das reinste Chaos. Keine Betrugsidee wurde ausgelassen. Und überall waren Untergangspropheten und unzählige Selbstmorde … Und dann gab es natürlich noch diejenigen, die begeistert waren von der Aussicht auf so drastische Veränderungen und diese Neuigkeit begrüßten. Die Armen allerdings konnten sich keine Begeisterung leisten – sie haben das alles nie begrüßt, mein Kind.« Er schüttelt den Kopf.
Ich schlucke. »Warum bist du bei anderen Menschen aufgewachsen? Warum bist du nicht bei deiner Tante Esther geblieben?«
»Nach der Katastrophe ist sie meine einzige noch lebende Verwandte gewesen. Aber sie ist sechs Wochen später gestorben. Giftstoffe aus dem Wasser sind an verschiedenen Orten eingesickert und so haben Krankheit und Tod um sich gegriffen. So viele haben wir in diesen Wochen direkt danach verloren. Niemand hatte auch nur geahnt, wie viel Wasser tief in der Erdkruste verborgen war. Durch den Aufprall des Kometen wurde es freigesetzt und der Wasserspiegel stieg einfach immer weiter an, mein Kind. Bis wohin, war nur eine Vermutung. Viel zu viele Gebäude haben den verheerenden Auswirkungen nicht standhalten können, der Druck, der auf ihnen lastete, ist viel höher gewesen, als man jemals angenommen hätte. Verkehrsunfälle … So viele unvorhersehbare Dinge.« Er stößt einen langen, schweren Seufzer aus und drückt mit einer Hand meine Schulter. »Respice, adspice, prospice.«
Ich schlucke an dem Schmerz in meinem Herzen vorbei und nicke. »›Respektieren, nachdenken, voraussehen.‹ Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und das werde ich, Opa, versprochen. Ich werde versuchen, in jede Richtung zu schauen, so gut ich kann – immer.« Mir versagt die Stimme. Ich drücke seine Hand. »Vermisst du sie … die Alte Welt? Hast du dir jahrelang gewünscht, dass alles wieder so sein würde, wie es einmal gewesen ist? Kommt dir diese Welt jetzt vor wie ein Traum?«
»Die Erinnerungen sind immer noch greifbar. Die Angst habe ich nie ganz vergessen. Und die Albträume haben nie ganz aufgehört. Natürlich wünsche ich mir, dass wir immer noch auf der Erdoberfläche leben würden. Aber weißt du, Queenie, die Alte Welt ist nicht der Sehnsuchtsort gewesen, für den sie heute gehalten wird. Die Wirklichkeit war tatsächlich anders. Die Veränderungen des Klimas … Sie war zu einem beängstigenden Ort geworden. Auf jeden Fall weit entfernt von der ›Verlorenen Welt‹.« Er schmunzelt.
Die Verlorene Welt ist eins der Hotels der Campbells. Ich bin vor Kurzem dort gewesen, als die Zwillinge mich zu ihrem 16. Geburtstag dorthin eingeladen haben. Es befindet sich in Notting Hill und soll das Leben in den ersten drei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts widerspiegeln, also kurz bevor sich die gesamte Erde im Jahr 2035 neu ordnen musste. Es ist der glücklichste Ort, den ich kenne. Alles dort ist perfekt: Es wachsen Bäume und Vögel singen, die Blumen blühen, die Sonne scheint und Kinder spielen »draußen«. Es sieht zauberhaft aus und fühlt sich auch so an.
Großvater schiebt mir eine lange Haarsträhne hinters Ohr. »Es hat mich so stolz gemacht, wie du dich während des Rennens verhalten hast, mein Kind, so selbstlos. Ich glaube, so stolz bin ich noch nie auf dich gewesen.«
»Aber, Opa, ist es wirklich selbstlos, wenn man den Tod eines anderen nicht auf dem Gewissen haben will? Ist das dann eine selbstlose Tat oder hat man nur auf sich selbst geachtet?«
»Ich möchte, dass du nie und nimmer daran zweifelst, dass du ein gutherziger Mensch bist, Leyla Fairoza McQueen. Hörst du?«
Ich nicke.
Seine Gesichtszüge entspannen sich und er lächelt, in seinen Augen glitzert es, als er mir auf die Nase tippt. »Deinen Vater kennenzulernen war das Beste, was mir passieren konnte. Auch wenn wir nicht blutsverwandt sind, ist er wie ein Sohn für mich. Er ist mein Sohn. Die McQueens sind meine Familie. Erinnerst du dich an den Tag, als du dir mein altes Drachenboot für eine Spritztour ›geborgt‹ hast?« Er grinst. »Du warst erst 12 Jahre alt. Ich glaube, ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich damals aus dem Fenster meines Arbeitszimmers schaute und dich in meinem U-Boot an mir vorbeirauschen sah. Es war, als würde meine ganze Welt vor mir zusammenbrechen. Ich habe gedacht, ich würde dich nie wiedersehen.«
»Das tut mir leid, Opa. Die lila Farbe war so toll, dass ich es einfach ausprobieren musste.«
Er schmunzelt. »Du sahst so schuldbewusst aus, als du es eine Stunde später zurückgebracht hast, aber bist zugleich vor Begeisterung fast geschwebt. Weißt du, deine Mutter war genau wie du, Queenie. Niemand konnte Soraya etwas verbieten, was sie tun wollte. Sobald sie eine Idee im Kopf hatte …« Er blickt in die Ferne, eine tiefe Traurigkeit im Blick. »Deine Mutter wäre so stolz auf dich gewesen. Ich werde auf dich aufpassen, das werden wir alle.« Er räuspert sich. »Die Welt da draußen ist gefährlich und ich muss dich beschützen, mein Kind. Bitte versteh, dass alles, was ich tue, immer im Hinblick auf dein Wohlergehen geschieht.«
»Das weiß ich, Opa, mach dir keine Sorgen. Ich verstehe das.«
»Und du hast alles, was du brauchst, ja?«
Nicht ganz, Opa. Ich werde illegal reisen … Ich nicke bestätigend und wippe mit den Beinen. Wie kann ich mich über ihn ärgern, weil er mir Dinge verschwiegen hat, wenn ich jetzt genau dasselbe tue?
»Gut. Du wirst deinen Vater finden und ich weiß, er würde dir alles selbst erklären wollen. So gerne ich mit dir über einige Angelegenheiten sprechen möchte, es ist nicht an mir, das zu tun.«
Was zum Beispiel? Meine Neugier ist geweckt. Mir ist klar gewesen, dass Opa mir nicht alles erzählt hat – selbst als er endlich mit der Wahrheit über das Verschwinden meines Vaters herausgerückt ist –, aber ihn das jetzt bestätigen zu hören, macht mich ganz schwindelig. Was könnte so wichtig sein, dass mein Vater es mir selbst sagen will? Ich öffne den Mund, doch schließe ihn gleich wieder. Ich werde warten, bis Opa im Cottage eingetroffen ist. Jetzt ist es Zeit aufzubrechen. Ich schlucke und halte mich noch einen Moment an ihm fest, unfähig, ihn loszulassen.
Obwohl er einmal alles verloren hat, seine Familie, seine Freunde, sein Zuhause – die gesamte Welt, wie er sie kannte –, hat er nie die Hoffnung verloren. In seinen Augen glitzern jetzt Tränen. »Wir treffen uns in meinem Cottage. Shalom, Queenie.«
Ich gebe ihm einen Kuss auf die Wange. »Salaam, Opa. Bis bald.«
Ich schlucke und wende mich um. Gerade kommen ein paar Techniker und Deathstar die Gangway herunter, um mir zu sagen, dass sie mit ihren Arbeiten fertig sind. Die Kabul ist abfahrbereit.
»Pass schön auf dich auf – und auf das Schätzchen hier.« Der Mechaniker zeigt auf das U-Boot und grinst. »Der Navigator wird dich darauf aufmerksam machen, falls im Maschinenraum etwas nicht stimmen sollte. Aber wenn das jemals der Fall sein sollte, wird er dich Schritt für Schritt da durchführen. Oh, und vielleicht möchtest du noch die Tür des Moonpools sichern – denn seit sechs Minuten bin ich nicht mehr der Vater dieses Schätzchens und sie hört nun nicht mehr auf mich.« Seine Mundwinkel sinken herab.
Ein Schauder läuft mir über den Rücken, als ich mir eine Öffnung in den Abgrund vorstelle. »Keine Sorge, die Tür des Moonpools werde ich bestimmt niemals aufschließen.« Dankbar umarme ich das Genie.
Auf der Gangway halte ich einen Moment inne und winke meinem Großvater zu. Ich atme tief ein und wieder aus.
Und dann betrete ich mein U-Boot.
Ich folge den gedämpften Stimmen, die aus dem Salon kommen.
Tabby scheint Theo gerade zu irgendetwas die Meinung zu sagen. Die beiden verstummen, als ich mich nähere. Tabby presst die Lippen zusammen und verschränkt die Arme. Sie hält meinen Blick fest und lächelt.
Theo wirft mir ein schiefes Lächeln zu und räuspert sich. »Da bist du ja, Leyla. Super. Alles ist fertig. Komm, ich muss dich noch auf den neuesten Stand bringen. Den Namen finden wir übrigens ganz toll!«
Wir machen einen Rundgang durch das ganze Schiff mit Ausnahme der jetzt unter Druck stehenden luftdichten Kammer. Ich schaue in den danebenliegenden kleineren Raum und entdecke das Tauchboot. Es ist ein kompakter Zweisitzer, dessen Außenseite von einem unzerstörbaren Titankäfig geschützt ist.
Mir fällt mein Bild ein und ich greife in meine Tasche. Es ist eins meiner Lieblingsbilder – Papa hat es mir gegeben – und ich betrachte es, während ich es an der Wand vor dem Moonpool aufhänge. Wie surreal und doch auf seltsame Weise passend, dass dieses Bild einer Szene aus dem Jahr 332 vor Christus nun hier hängen wird – wie anders die Welt jetzt ist …
Der Kunstdruck zeigt Alexander den Großen, wie er in einer gläsernen Tauchglocke ins Meer hinabgelassen wird. Wahrscheinlich hat er auf diese Weise mehrere Tauchgänge unternommen. Das Gemälde ist Teil eines Quintetts gewesen, das einst für Akbar, den großen Mogulkaiser, geschaffen worden ist. Und jetzt hängt ein Abzug davon in meinem U-Boot, der Kabul, und das in London, am Vorabend des 22. Jahrhunderts. Ich weiß, dass es das alte Persien schon lange nicht mehr gibt, aber manchmal kommt es mir so vor, als wäre das nur einen Wimpernschlag lang her, und jetzt leben wir im Meer. Kein Wunder, dass mein Vater Zeit und Raum oft als magisch bezeichnet hat!
»Leyla!« Tabby hält Jojo auf dem Arm und knuddelt sie, während sie mich anstarrt. »Du hast keine Zeit zu träumen!«
Wir gehen in den nächsten Raum und sie zeigt mir alles. Sie hat schon fast alle meine Kisten ausgepackt und die Sachen verstaut. Die Küche ist eingeräumt, die Vorräte eingelagert.
»Vergiss nicht, was ich dir über meine Modifikation gesagt habe«, erinnert Theo mich. »Theoretisch müsste das Anti-Tracking-Gerät sich einschalten, sobald du losfährst, damit du nicht im System des Verkehrsordnungsamts erscheinst. Aber ich habe es noch nicht geschafft, das zu testen. Der Navigator wird einen Test laufen lassen, wenn du unterwegs bist. Ist der negativ, hältst du an Brighton Pier in Belvedere – das liegt sowieso mehr oder weniger auf deiner Route. Sam, eine Freundin von mir, weiß, dass du vielleicht bei ihr auftauchst. Also, wenn es ein Problem damit gibt, kann sie dir helfen.«
Als er mich in den Kontrollraum führt, hellt sich Theos Gesicht plötzlich auf und seine Augen leuchten. »Los, ruf deinen Navigator«, drängt er und schlingt mir ein neues Armband ums Handgelenk.
Ich zögere einen Moment. Was, wenn mir ihre Wahl nicht gefällt? »Navigator, bitte.«
Oscar Wilde höchstpersönlich erscheint vor mir.
Ich starre ihn an. »Das gibt’s doch nicht! DER HAMMER! Oh mein Gott, Leute!«
Er sieht genauso aus, wie er in den Archiven immer abgebildet ist. Extravagant gekleidet, trägt er nur, was in der viktorianischen Zeit in Mode war: eine Samtweste, eine Plüschjacke und dazu eine Kniebundhose. Ich schaue noch genauer hin – kein Flackern. Erstaunlich! Mr Wilde begrüßt mich mit einer schwungvollen Verbeugung. Er spricht mit einem sympathischen Akzent und versichert mir mit sanfter Stimme, dass es keinen Grund zur Sorge gibt und er nun an meiner Seite ist.
Ich drehe mich mit offenem Mund zu Theo um, der grinsend einen Daumen in die Luft reckt.
»Na gut, ich habe ihn nach dem Hochladen noch ein wenig verändert. Mr Wilde ist jetzt dein persönlicher Super-Haushälter.«
Ich bin wie gebannt. Er sieht so echt aus!
Theos Miene wird ernst. »Der Navigator kennt nicht den Weg aus der Stadt hinaus. Wir haben keine konkreten Routen eingetragen, weil wir nicht riskieren wollten, dass jemand von offizieller Seite etwas über deine Pläne erfährt. Hierher hätte Sebastian seine Leute als Erstes geschickt, um dich zu überprüfen, und du brauchst so viel Zeit wie möglich, damit du einen Vorsprung erhältst. Deshalb musst du Oscar jetzt informieren, Leyla.«
Ich nicke. »Mr Wilde, wir geben unsere Reise jetzt ein und dann erfahren Sie unsere genaue Route.« Rede ich gerade tatsächlich mit Oscar Wilde, als wäre er ein realer Mensch? Verrückt, aber so ist es! Wärme breitet sich auf meinem Gesicht aus.
»Oscar, bitte«, betont mein Navigator, und zwar auf so charmante Weise, wie ich es mir immer vorgestellt habe. »Und lassen Sie sich Zeit, meine Liebe. Wenn es nicht zu lange dauert, warte ich mein ganzes Leben lang auf Sie.« Er senkt den Kopf.
Ich erkenne das Zitat und quietsche vor Freude. Und während Theo mir die Funktionen des Navigators erklärt, verspricht er mir, dass Oscar noch mehr Überraschungen auf Lager hat.
»Er ist supertoll! Vielen, vielen Dank! Oh mein Gott, du bist genial.«
Ich umarme Theo und wir tragen die geplante Reise ein, wobei wir alle Sicherheitsstützpunkte angeben, die ich auf dem Weg vermeiden muss.
Jojo huscht aus dem Kontrollraum und Tabby rennt ihr rufend hinterher.
Ich wende mich wieder zu Theo um. »Versprich mir, dass du dir nicht so viele Sorgen machst.«
Er drückt meinen Arm. »Wir kommen klar. Du musst dich auf dich selbst konzentrieren.« Auf einmal dreht er sich von mir weg und beißt sich auf die Unterlippe. »Leyla …« Er räuspert sich. »Es gibt etwas, was du wissen solltest. Du wirst … Du wirst nicht …«
Tabby kommt mit Jojo herein. Sie sieht uns an und hält Theos Blick fest.
»Was werde ich nicht, Theo?«, frage ich.
Er wird rot und winkt ab. »Versprich mir, dass du dich nicht von deinem Plan ablenken lässt.«
Das versichere ich ihm, so gut ich kann, auch wenn ich glaube, dass er mir eigentlich etwas anderes sagen wollte, bevor Tabby wieder aufgetaucht ist, aber ich habe keine Ahnung, was. Dann ist auf einmal schon die Zeit gekommen.
Tabby ist blass und ihr Gesicht angespannt, der Blick ihrer sonst so hellen Augen trübt sich, als sie auf mich zukommt. »Ich liebe dich. Ich hoffe, das weißt du.« Sie schluckt und übergibt mir Jojo widerstrebend. Ich umarme Tabby.
»Sei nicht albern. Natürlich weiß ich das, verdammt noch mal.« Wir grinsen beide unter Tränen. »Ich liebe dich auch. Alles wird gut. Mach dir keine Sorgen.«
Tabby verdreht die Augen. »Glaubst du immer noch an den ganzen hoffnungsvollen magischen Kram, Leyla?«
»Das solltest du auch«, sage ich und nicke beharrlich.
Einen Moment lang sieht Tabby so ernst und wehmütig aus, dass mir fast das Herz bricht. »Ich denke, jeder Vater, der sein Kind so erzieht, dass es glaubt, die Welt sei voller Magie und dass es immer Hoffnung gibt, ganz gleich, was auch geschieht – so ein Vater hat eine Tochter verdient, die ihn eines Tages rettet, wenn er sie wirklich braucht.«
»Oh, Tabs.« Wir umarmen uns noch einmal.
Theos Augen sind groß, als er einen Arm um mich legt. »Leyla, versprich uns, dass du vorsichtig bist. Versprich es.«
»Versprochen. Vielen, vielen Dank. Für alles, Leute. Ich liebe euch beide so sehr.«
Wir kuscheln uns schweigend in einer letzten Dreier-Umarmung aneinander.
Als sie weggehen, würde ich am liebsten schreien. Die Zwillinge steigen die Treppe hinauf. Das Geräusch der Hauptzugangsluke, die sich fest hinter ihnen schließt, ist übermächtig. Sie sind weg. Ich bin allein.
Auf einmal ist mir alles um mich herum zu viel, zu schwer und zu anspruchsvoll. Die Panik greift wie mit Krallen nach mir und meine Beine geben fast unter mir nach.
Nein.
Nicht jetzt, verflucht noch mal!
Oscar erscheint und bei seinem plötzlichen Auftauchen zucke ich zusammen. Daran muss ich mich erst einmal gewöhnen.
»Meine Liebe, wir sind bereit zum Ablegen.«
Das Schiff gleitet, getragen von dem großen Gerüst aus Stahl und Holz darunter, langsam vorwärts auf das riesige Tor am Ende des Hangars zu. Wow! Tief einatmen. Ich drücke meine Schultern durch. Es ist Zeit, hier raus und in Sicherheit zu kommen. Sobald ich im Cottage in King’s Lynn bin, kann ich überlegen, was ich als Nächstes unternehme. Dann wird mein Großvater keine andere Wahl haben, als mir alles zu sagen, was er weiß. Und das wird mich einen Schritt näher zu meinem Vater bringen. Das muss es.
Ich gehe in den Salon und rufe Oscar. Jojo hat sich auf eine Erkundungstour gemacht, bevor ich sie davon abhalten konnte. Ich schaue aus dem Fenster und beobachte, wie mehrere Mechaniker sich Zeichen und gegenseitig Anweisungen geben, während das Schiff sich weiter voranbewegt. Die Zwillinge und mein Großvater haben sich so hingestellt, dass ich sie gut sehen kann. Mein Puls rast. Ich hebe ein letztes Mal die Hand und sie erwidern meine Geste, bevor sie aus meinem Blickfeld verschwinden.
Auf Wiedersehen … Oh Gott.
Das riesige Tor öffnet sich. Der Mechaniker daneben gibt mir mit einem Daumen hoch zu verstehen, dass alles in Ordnung ist, und das Schiff verlässt den Hangar.
Sobald mein Boot sich in dem nächsten geschlossenen Bereich befindet, klappt das Tor hinter mir zu. Die Kammer wird geflutet. Ich laufe mit verschränkten Armen vor dem Aussichtsfenster hin und her. Hoffentlich weiß der Navigator genau, was er tut. Ich halte den Atem an, als das Wasser um mich herum immer höher steigt. Endlich öffnen sich die Außentüren. Das U-Boot bewegt sich hinunter von dem Haltegerüst und gleitet dann hinaus in die Gewässer Londons.
Das Boot bekommt sofort Auftrieb. Bismallah.
Mein Herzschlag rauscht mir in den Ohren. Ich schaue mich in alle Richtungen um. Tausende von Lasern blinken auf den Dächern. Die Neujahrsfeierlichkeiten haben begonnen. Lichtstrahlen in allen Farben, Formen und Größen pulsieren durch das Wasser zum Takt der Musik, die bis weit nach Mitternacht über die Bildschirme abgespielt wird. Helligkeit flimmert mir aus weit entfernten Fenstern entgegen, wo bereits Partys stattfinden, durchs Wasser. Die ganze Stadt schimmert und glänzt. Auf ewig beleuchtet wiegt London seine Bewohner in den Armen. Mein Herzschlag setzt eine Sekunde aus. Werde ich hierher zurückkehren können, wenn ich meinen Vater gefunden habe?
Von weiter oben, wo ich jetzt bin, ist die Stadt kaum noch zu sehen. Ich stehe ganz still und nehme alles in mich auf. Das tiefe, rhythmische Summen im Inneren des Fahrzeugs kann ich sowohl hören als auch fühlen. Der Seegang des Meeres, wie er aufsteigt und abfällt, wirkt in einem Tauchboot anders, schwerer und doch sanfter, fast beruhigend. Die Strömung allerdings ist unbeständiger. Auf dieser Höhe wäre es schwierig, ein Tauchboot zu steuern. Kleinere, wendigere Schiffe sind beim Navigieren durch die Straßen im Vorteil, aber in den turbulenteren oberen Gewässern ist die Herausforderung zu groß für sie. Die kräftigen Transportschiffe können so weit hochfahren, dass sie sogar ein wenig natürliches Licht abbekommen.
Noch weiter nach oben und wir könnten genauso gut auf offener See sein.
Oh Gott. Ich atme flach und schnell. Ich muss einen Weg finden, mich dieser Angst entgegenzustellen.
Etwas bewegt sich neben dem Fahrzeug. Eine kleine Gestalt, die hinauf- und hinabtaucht. Zum zweiten Mal in den letzten Tagen erscheint ein Delfin, von den Seitenlichtern des Schiffs wird sein glänzender Körper in einen silbrigen Schimmer getaucht. Er schwimmt spielerisch neben dem U-Boot her, bevor er weitergleitet und Luftblasen aufsteigen lässt. Meine Lippen verziehen sich zögernd zu einem Lächeln. Diese wunderbare Kreatur kann nur ein gutes Zeichen sein.
Vielleicht ist das, was vor mir liegt, gar nicht so schlimm, wie ich befürchte?