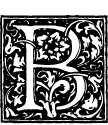 lut klebte an ihren Händen.
lut klebte an ihren Händen.
Sie starrte auf ihre Handflächen und versuchte sich zu erinnern. Die letzten Tage waren verschwommen, doch seit ihr Meister gestorben war, war alles verschwommen. Von diesem Moment an war die Zeit nicht mehr etwas Festes, sondern nur noch ein Fluss, in dem sie dahintrieb und gelegentlich ans Ufer angespült wurde. Sie erinnerte sich, die Wache der Königin getötet zu haben, jedoch nicht, wie sie danach entkommen war, wie sie es hierher geschafft hatte.
Zu ihrer Linken befand sich ein kleiner Bach. Brenna wusch darin ihre Hände, bürstete das getrocknete Blut von den Fingernägeln. Sie hatte einen Mann in Burns Copse getötet, erinnerte sie sich auf einmal, wegen Nahrung und Geld. Sie hatte ihn überrascht, bevor er eine Waffe ziehen konnte, und er hatte sie nur wie hypnotisiert angestarrt, bis sie ihm das Messer zwischen die Rippen gestoßen hatte. Er hatte auch ein Pferd, doch sie konnte nicht reiten; außerdem würde sie das Tier nicht verkaufen können, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ganz Tearling hielt sie für einen Albino, und der Meister hatte gesagt, das sei gut, ein gutes Geheimnis, das sie für sich behalten sollten. Doch sie war ebenso wenig ein Albino wie verrückt, und seit dem Tod des Meisters war bereits etwas von ihrer früheren Farbe, ihrem Leben zurückgekehrt. Doch nicht genug, um unbeachtet ein Pferd zu verkaufen. Nicht genug, um mit einer Menschenmenge zu verschmelzen.
Der Meister.
Sie hatte nicht um ihn geweint, doch nur, weil Tränen so eine feige Art des Trauerns waren. Zuerst übte man Rache, und viele Jahre später, wenn alles ausgeglichen war, konnte man in Trauer versinken. Die Schreie des Meisters hallten immer noch in ihrem Geist wider, sie konnte sie nicht zum Schweigen bringen. Sie hatte gespürt, wie er gestorben war, seinen Schmerz und, viel schlimmer noch, die alles überwältigende Panik in den letzten Momenten, als er erkannte, dass es keinen Ausweg mehr gab, dass letztendlich jemand stärker war als er, mit dem er keinen Handel abschließen konnte. Sie hatte schon ihr ganzes Leben lang seinen Schmerz auf sich genommen, seit ihrer gemeinsamen Kindheit. Die Anstrengungen hatten sie erbleichen lassen.
Brenna richtete sich auf, nachdem sie sich die Hände gewaschen hatte, und wandte sich wieder nach Osten, auf der Suche nach ihrer Beute. Sie nutzte dafür nicht ihren Geruchssinn, sondern tastete sich mit ihrem Geist durch die Menschenmengen, watete durch ihre Gefühle wie durch schlammiges Wasser, bis sie gefunden hatte, wonach sie suchte. Diese spezielle Gabe war sehr nützlich für den Meister gewesen, denn wenn jemand versucht hatte, vor der Lieferung zu fliehen, konnte er sich nirgends vor Brenna verstecken. Als sie jung war, hatten die Caden mehr als einmal versucht, sie wegen dieser Fähigkeit anzuwerben, sie dem Meister zu entreißen. Drei von ihnen hatte sie getötet, bevor sie endlich aufgaben. Letztes Jahr hatten sie es erneut versucht; eine Abordnung war zum Meister gekommen und hatte ihre Dienste gefordert, um die Raleigh-Erbin zu finden. Doch sie wollten den Preis, den der Meister verlangte, nicht zahlen.
Wenn sie doch nur gezahlt hätten!, dachte Brenna aufgebracht. Auch wenn ihre Gedanken diesen Weg bereits viele Male beschritten hatten, wurden Bitterkeit und drängendes Verlangen nach Rache nicht weniger. Wenn sie doch nur gezahlt hätten, vielleicht wäre der Meister dann noch am Leben!
Sie hielt ihr Gesicht in den Wind, spürte die Bewegungen auf der Zunge. Das Miststück war immer noch irgendwo da draußen, aber in einem kalten, dunklen Raum. Brenna prüfte die Wände, schmeckte sie auf der Zunge, dicke Steinmauern.
»Gefangen, nicht wahr?«, flüsterte sie. Sie wusste es nicht sicher, bildete sich aber gern ein, dass das Miststück sie hören konnte. Sie besaß große Macht, das spürte Brenna sogar jetzt, weit entfernt und schwach, so wie sie auch immer die Macht oben im Fairwitchgebirge wahrgenommen hatte. Kurz hatte sie überlegt, nach Norden zu gehen, in die Berge, und dort um Hilfe zu bitten. Was auch immer dort lebte, war sehr mächtig; Brenna spürte die Anziehung unter ihren Füßen. Doch irgendetwas ging im Fairwitchgebirge vor sich, und sie fühlte, wie sich die Kraftlinien, von denen Tearling durchzogen war, verschoben. Das war zu unsicher, und sie wollte keine Ablenkungen. Sie hatte genug Essen, um es bis zur Mortgrenze zu schaffen, und sie brauchte auch sehr wenig. Wut war nährender als Nahrung.
Doch wenn das Miststück in den Kerkern von Demesne gefangen gehalten wurde, war sie wahrscheinlich außerhalb Brennas Reichweite. Es würde dem Meister nicht dienen, wenn sie beim Versuch, in den Palast zu gelangen, getötet würde. Es musste einen anderen Weg geben.
Nach kurzer Überlegung sah sich Brenna im Wald um. Die meisten Tiere waren vor ihr geflüchtet, nun kehrten sie langsam aus ihren Verstecken zurück, seit sie sich still verhielt. Nach ein paar Minuten Suche fand sie ein graues Eichhörnchen, das hinter einem Baum hervorspähte. Bevor es auch nur blinzeln konnte, hatte sie sich daraufgestürzt. Das Eichhörnchen verbiss sich in ihre Hand, was Brenna ignorierte – Schmerz war schließlich nur eine Illusion des Geistes –, und sie drehte dem Tier den Hals um. Mit dem Messer des toten Mannes schlitzte sie das Eichhörnchen der Länge nach auf und ließ das Blut auf den Boden fließen. Sie musste schnell sein. Blut würde andere Raubtiere anlocken, die dann wiederum ein Jäger verfolgte. Brenna würde sich zur Wehr setzen können, wollte aber keine Spuren hinterlassen. Sie war zwar jetzt frei; der Meister hatte ihr aber oft gesagt, man dürfe Mace nicht unterschätzen.
Sie warf den Kadaver zur Seite, beugte sich über die kleine Blutlache und atmete tief den Kupfergeruch ein. Zu wissen, wo sich jemand befand, war einfach. Herauszufinden, wo sich jemand aufhalten würde, war schwieriger, doch es war möglich und wahrscheinlich sehr viel leichter, als auf eigene Faust in die Mortkerker einzudringen.
Was, wenn sie dort stirbt?
Brenna verdrängte den Gedanken. Der Tod des Miststücks in Mortgefangenschaft wäre sicher nicht angenehm, doch kein Vergleich zu dem, was Brenna mit ihr vorhatte. Brenna hatte gelitten, der Meister hatte gelitten, und sie glaubte nicht, dass die Zukunft ihnen ihre Rache vorenthalten würde.
Regungslos blickte sie lange in die rote Lache, die Augen weit aufgerissen, jeder Atemzug voller Schmerz. Ein paar hundert Meter entfernt rollten die Wagen der Rückkehrer über die Mortstraße, die Flüchtlinge kehrten aus Neulondon zurück in ihre Dörfer an der Grenze. Obwohl niemand Brenna sah, schauderten alle, als sie an ihr vorbeikamen.
Schließlich richtete Brenna sich auf und lächelte. Ihre Wangen hatten wieder ein wenig Farbe gewonnen. Sie packte das blutige Messer und ihren Beutel mit Essen, dann wandte sie sich nach Südosten.
Javel zog den Umhang fester um sich und wünschte, er könnte mit den Schatten des überhängenden Gebäudes verschmelzen. Vor ein paar Minuten war eine weitere Mortpatrouille an ihm vorbeigekommen. Früher oder später würde jemandem auffallen, dass er bewegungslos hier herumstand, und annehmen, dass er nichts Gutes im Schilde führte.
Die Adresse, die Dyer herausgefunden hatte, lag gegenüber: ein imposantes Ziegelhaus mit drei Stockwerken, umgeben von einer hohen Steinmauer mit Eisentoren. Javel konnte nicht einmal einen Blick durch die Fenster werfen, denn zwei Wachen standen auf dem Grundstück an den Toren und öffneten sie nur für ausgewählte Leute. Laut Dyer hatte eine Madame Arneau Allie gekauft, mehr wollte er ihm allerdings nicht sagen. Seit sie die Königin auf der Rue Grange gesehen hatten, hätte Allie auch vom Erdboden verschwunden sein können. Dyer und Galen hatten ihre Basis in eine verlassene Fabrik im Stahlbezirk verlegt und verbrachten die Abende mit Erledigungen und geheimen nächtlichen Treffen mit Männern, die Javel nicht kannte. Diese Männer waren Mort und trugen Stahlwaffen, doch sie waren keine Soldaten. Eine Rettungsaktion wurde geplant, und Javel fühlte sich überflüssiger denn je.
Auf der anderen Straßenseite näherte sich eine offene Kutsche von der Rückseite des Hauses. Dort mussten die Ställe liegen, denn wenn Gäste eintrafen, führte einer der Wachmänner die Pferde rasch um das Haus herum. Javel hatte bereits einige Männer kommen und gehen sehen. Zwei waren betrunken gewesen. Eine bittere Erkenntnis dämmerte ihm, drehte ihm den Magen um und ließ seine Knie weich werden.
Das könnte irgendein Haus sein, sagte er sich. Doch das war Unsinn. Dieses Viertel war vielleicht sauberer als das Gut, doch manche Dinge waren überall gleich. Er wusste, was er vor sich hatte. Er rieb sich die Stirn und merkte, dass er schwitzte, selbst in der kühlen Spätherbstluft. Er hatte gewusst, dass es im Bereich des Möglichen lag, rief er sich in Erinnerung. Niemand kaufte eine hübsche Frau wie Allie, um sie als Haushaltshilfe arbeiten zu lassen, und er hatte alles versucht zu akzeptieren, dass sie eine Prostituierte sein könnte. Doch jetzt fragte er sich, ob das reichte. Als er sich seine Frau unter einem anderen Mann vorstellte, hätte er am liebsten auf etwas eingeschlagen.
Hohes, fröhliches Lachen ließ ihn aufblicken. Fünf Frauen waren aus dem Haus getreten und unterhielten sich. Alle trugen Taschen über den Schultern, waren in glitzernde Stoffe gekleidet und geschminkt, die Haare auf dem Kopf aufgetürmt.
Allie stand in ihrer Mitte.
Javel war wie gelähmt. Es war seine Allie; er sah ihre blonden Locken, die jetzt auf dem Kopf zusammengefasst waren. Doch ihr Gesicht war so anders. Älter, mit kleinen Fältchen in den Augenwinkeln, aber das war es nicht, was ihn stutzen ließ. Seine Allie war lieb gewesen, süß. Diese Frau sah … gerissen aus. Eine gewisse Härte lag um ihren Mund. Sie lachte so fröhlich wie die anderen, aber das war nicht das Lachen, das Javel kannte: breit und geheimnisvoll, kalt wie das Eis auf einem dunklen See. Javel beobachtete verwundert, wie sie aus freiem Willen in die Kutsche stieg und sich immer noch lachend neben den anderen Frauen niederließ.
Ein großer, kräftiger Mann war ihnen gefolgt. Als auch er in die Kutsche kletterte, sah Javel ein Messer unter seinem Mantel aufblitzen. Noch ein Wachmann, auch wenn Javel bereits bei seinen Erkundungsgängen durch Demesne herausgefunden hatte, dass die meisten Prostituierten sehr viel besser als in Neulondon behandelt wurden. Selbst die Straßenhuren wurden nicht belästigt. Er wusste nicht, warum fünf exklusive Prostituierte in Demesne einen Bewacher brauchten, aber er konnte sich dem Wagen so jedenfalls nicht nähern, zumal da ja auch noch der Kutscher war.
Die Kutsche setzte sich in Bewegung und verließ das Anwesen. Wie im Traum folgte ihr Javel und zwang sich, einen Abstand von mindestens dreißig Metern zu wahren. Ein dunkler Abgrund hatte sich in ihm aufgetan. In den letzten sechs Jahren hatte er sich Allies Leben oft vorgestellt, und die Bilder in seinem Kopf hatten ihn so zielstrebig in die Wirtshäuser getrieben wie ein Bauer seine Ziegen zum Markt. Nie hatte er sich dabei vorgestellt, dass sie lachte.
Als die Kutsche an der nächsten Kreuzung anhielt, näherte sich Javel, huschte in die nächste Gasse und machte die nächste unangenehme Entdeckung: Alle fünf Frauen, Allie eingeschlossen, sprachen Mort. Die Kutsche bog auf die Rue Grange ab, und Javel folgte ihr weiter geduckt. Auf diesem Abschnitt der Straße herrschte lebhaftes Treiben, Geschäfte, Händler und Kunden dominierten das Bild. Javel begann, den Wagen zu verlieren, als der Kutscher wundersamerweise die Fahrt verlangsamte und an den Rand fuhr, damit die Frauen aussteigen konnten. Zwei überquerten die Straße, und Javel erkannte erstaunt, dass sie zum Einkaufen unterwegs waren. Allie ging als Erstes in eine Apotheke.
Der Kutscher blieb auf seinem Platz, ebenso der Bewacher, der die Straße jedoch aufmerksam im Blick behielt. Beim ersten Anzeichen von Ärger würde er sicher sofort aufspringen und einschreiten. Javel näherte sich vorsichtig, ohne genau zu wissen, was er als Nächstes tun würde. Ein Teil von ihm wollte zurück in die Sicherheit der verlassenen Fabrik flüchten, zurück in eine Zeit, als er noch nichts von Allies tatsächlichem Leben wusste.
Den Kutscher und den anderen Mann im Blick behaltend, ging er beiläufig auf die Apotheke zu. Menschen stießen gegen ihn, doch er drängte sich an ihnen vorbei Richtung Tür. Der Kutscher erzählte irgendeine Geschichte, der andere Mann lachte, und Javel schlüpfte rasch in die Apotheke.
Er fand Allie in einer dunklen Ecke, wo sie vor einem Verkaufstresen wartete. Der Apotheker war nirgends zu sehen, Javel hörte nur das Klirren von Flaschen hinter einem grünen Vorhang. Er wünschte, die Umstände wären anders, ohne ein potenzielles Publikum, das jeden Moment auftauchen konnte, doch vielleicht würde sich ihm so eine Chance nie wieder bieten. Jetzt oder nie.
»Allie.«
Erschrocken blickte sie auf, und Javels Welt wurde in ihren Grundfesten erschüttert, als er ihre Augen sah, die kalt und misstrauisch unter den violett bemalten Lidern hervorblickten. Sie sah ihn lange an.
»Was willst du?«
»Ich bin gekommen …« Javels Stimme versagte. Er erinnerte sich zurück: die langen Nächte, die er im Halbschlaf in den Wirtshäusern verbracht hatte, Allies Gesicht vor Augen, den Selbsthass, der ihn immer wieder überwältigt hatte. Sechs lange Jahre hatte er sie hiergelassen, damit sie zu der Frau wurde, die jetzt vor ihm stand. Wenn er sie erneut im Stich ließ, wie könnte er damit leben?
»Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu holen«, brachte er schließlich mühsam heraus.
Allie stieß einen heiseren Laut aus, den Javel schließlich als Lachen erkannte.
»Warum?«
»Weil du meine Frau bist.«
Sie lachte laut auf, ein Geräusch wie eine Ohrfeige.
»Wir können dich hier herausbringen«, erklärte er. »Ich habe Freunde, ich kann dich in Sicherheit bringen.«
»Sicherheit«, murmelte sie. »Wie süß.«
Javel errötete. »Allie …«
»Ich heiße Alice.«
»Ich bin gekommen, um dich zu retten!«
»Was bist du doch für ein Held!«, rief sie aus, doch ihre Augen blickten unverwandt kühl, und Javel hörte Wut aus ihren Worten heraus. »Und wo warst du vor sechs Jahren, als deine Tapferkeit mir hätte helfen können?«
»Ich bin dir gefolgt«, beteuerte Javel. »Ich bin dir die ganze Mortstraße entlang gefolgt!«
Sie starrte ihn kalt an. »Und?«
»Thornes Leute waren zu mächtig, ich konnte nichts tun. Es war aussichtslos, dass wir hätten fliehen können.«
»Und in den Jahren danach?«
»Ich war …« Doch was hätte er ihr schon sagen können? Dass er im Wirtshaus gewesen war?
»Ich habe es versucht«, erklärte er niedergeschlagen.
»Wie schön, du hast es versucht«, antwortete Allie. »Doch da du damals ein Feigling warst, darfst du dich jetzt nicht auf deine Tapferkeit berufen. Du kommst sechs Jahre zu spät. Ich habe mir hier ein Leben aufgebaut. Ich bin zufrieden.«
»Zufrieden? Du bist eine Hure!«
Allie musterte ihn eingehend. Bei diesem Blick hatte Javel sich immer etwa einen halben Meter groß gefühlt, doch seit ihrer Heirat hatte er ihn nur ein paarmal gesehen, üblicherweise, wenn er versprochen hatte, etwas zu tun, und es dann vergessen hatte. Es war, als hätte jemand sie mit einem Zauberspruch belegt; wenn er sie nur von hier wegbringen könnte, dann würde der Zauber gebrochen und sie sich in die Frau von früher zurückverwandeln.
»Stimmt etwas nicht, Alice?«, fragte eine Stimme. Javel drehte sich um und sah den stämmigen Bewacher in der Tür stehen; das Funkeln in seinen Augen brachte Javel zum Erschaudern. Dieser Mann würde ihn mit Freuden zusammenschlagen.
»Alles in Ordnung«, erwiderte Allie fröhlich. »Ich mache nur Bekanntschaften.«
Javel blieb der Mund offen stehen, als er plötzlich den Zweck dieses Einkaufsausfluges erkannte, den Grund für die schönen Kleider und die aufwendige Schminke.
»Nun, gebt mir Bescheid, wenn Ihr etwas braucht, Ma’am.« Sichtlich enttäuscht, verließ der Mann den Laden.
Javel merkte, dass er den Mann problemlos verstanden hatte, weil er Tear gesprochen hatte. Die Brutalität quoll ihm aus jeder Pore, doch sein Verhalten Allie gegenüber war ausgesucht höflich. Javel wandte sich wieder an seine Frau und wünschte, er könnte seinen letzten Satz an sie zurücknehmen, doch wahrscheinlich würde es keine Rolle spielen.
»Ich bin tatsächlich eine Hure«, erklärte Allie schließlich. »Aber ich arbeite, Javel. Ich verdiene mein eigenes Geld und bin niemandem verantwortlich.«
»Was ist mit deiner Zuhälterin?«, erwiderte er aufgebracht und hasste das Gift in seiner Stimme, konnte es jedoch nicht unterdrücken.
»Ich zahle Madame Arneau Miete, eine sehr viel angemessenere Miete als in einem ähnlichen Haus in Neulondon.«
Javel fehlten die Worte. Er wünschte, er könnte in diesem Moment seine Hände um Madame Arneaus Hals legen.
»Als Gegenleistung bekomme ich ein paar wunderschöne Räume und drei warme Mahlzeiten am Tag. Ich werde gut beschützt, ich kann mir die Arbeit einteilen, und ich suche mir meine Kunden selbst aus.«
»Was für ein Bordell erlaubt einer Hure so viele Freiheiten?«, wollte er wissen. »Außerdem ändert es nichts daran, dass es ein übles Gewerbe ist.«
Allie verengte die Augen, und ihre Stimme wurde noch kälter und schärfer, wenn das überhaupt möglich war. »Die Art, die erkannt hat, dass eine glückliche, gesunde Prostituierte sehr viel profitabler ist. Ich verdiene dreimal so viel wie du als Torwache.«
»Aber wir sind immer noch verheiratet! Du bist meine Frau.«
»Nein. Du hast mich aufgegeben, als du zugesehen hast, wie ich vor sechs Jahren in diesen Käfig geklettert bin. Ich will nichts von dir, und du hast kein Recht, irgendetwas von mir zu fordern.«
Javel wollte protestieren – man konnte eine Ehe doch nicht so leicht auflösen, sicher nicht einmal in Mortmesne –, als in diesem Moment der Apotheker hinter dem grünen Vorhang hervorkam. Er war ein kleiner Mann mit beginnender Glatze und Brille, der eine Schachtel in der Hand hielt.
»Bitte sehr, meine Dame«, sagte er und reichte Allie die Schachtel. Auch er sprach Tear, was Javel verwunderte, der noch nie Tear auf den Straßen von Demesne gehört und sich seinen winzigen Mortwortschatz mühsam erarbeitet hatte. »Das hier reicht für zwei Monate. Nehmt es immer mit einer vernünftigen Mahlzeit ein. Sonst könnte die Übelkeit stärker werden.«
Allie nickte und zückte eine Geldbörse voller Münzen. »Danke.«
»Kommt in zwei Monaten wieder, dann mische ich Euch eine neue Portion. Ihr solltet das Mittel allerdings nach dem sechsten Monat nicht mehr nehmen, um dem Kind nicht zu schaden.«
Bei den letzten Worten des Apothekers beschlich Javel ein unwirkliches Gefühl. Er bemerkte kaum, wie Allie einige Münzen über den Tresen reichte und die Schachtel in ihrer Tasche verstaute. Der Apotheker blickte zwischen ihr und Javel hin und her und verschwand wieder hinter seinem Vorhang, als er die angespannte Atmosphäre wahrnahm.
»Du bist schwanger«, sagte Javel, weniger eine Frage, sondern um sich selbst zu überzeugen.
»Ja.« Sie starrte ihn an, als wolle sie ihn warnen fortzufahren.
»Was wirst du tun?«
»Tun? Ich werde mein Baby auf die Welt bringen und es zu einem guten Menschen erziehen.«
»In einem Bordell!«
Allies Blick durchbohrte ihn wie ein Pfeil. »Drei Frauen, die Madame Arneau für genau diesen Zweck beschäftigt, werden sich um mein Kind kümmern und es später unterrichten. Und wenn mein Kind älter ist, wird keine Schande an dem Wissen haften, dass seine Mutter eine Hure war. Wie findest du das?«
»Ich finde das kriminell.«
»Ja, Javel, das kann ich mir vorstellen. Ich hätte früher vielleicht auch so gedacht. Aber diese Stadt behandelt Frauen so viel besser, als Neulondon es je versucht hat. Vielleicht war es tatsächlich mutig von dir hierherzukommen, keine Ahnung. Jedenfalls waren wenige Risiken mit diesem Mut verbunden. Wie immer, und ich verdiene etwas Besseres. Wenn dir dein Leben lieb ist, halte dich von mir fern.«
Sie verließ den Laden, die Tür laut hinter sich ins Schloss werfend. Javel stand bewegungslos gegen die Wand gepresst. Klaustrophobie drohte ihn zu überwältigen, das Geschäft war plötzlich zu klein, doch er wagte es nicht, nach draußen zu gehen, nicht bis er sicher wusste, dass sie weggefahren war. Er betete, dass der Apotheker nicht zurückkam, und zum Glück tat er das auch nicht. Als Javel vorsichtig durch die Glastür des Ladens spähte – Stunden schienen vergangen zu sein – und den Wagen nicht mehr sah, atmete er tief durch und ging ins Freie.
Auf der Straße ging das Leben weiter, was Javel kaum verstand. Wie konnte alles normal seinen Gang gehen, wenn sich für ihn doch alles geändert hatte? Ein süßer Duft lag in der Luft, Gebäck aus einer nahe gelegenen Bäckerei, doch auf Javel wirkte der Geruch abstoßend, eine klebrige Süßlichkeit über dem Schmutz, genau wie die ganze Stadt. Sechs Jahre hatte er sich um Allie gesorgt, hatte gelitten wegen ihr, und jetzt wusste er nicht, was er tun sollte. Wieder zu seinem alten Leben zurückzukehren war undenkbar. Weiterzugehen erschien ihm aber noch schlimmer. Und die Nacht brach herein.
Er stand auf dem Gehweg und hielt sich den Kopf wie ein Mann, der tief in Gedanken versunken war, doch sein Geist war leer. Er nahm die Hand von den Augen, sah auf, und plötzlich war alles so einfach.
Er stand vor einem Wirtshaus.
Selbst Mace konnte die beiden Priester nicht finden.
Die Königinnengarde sollte die ganze Zeit bei Mace bleiben. Die Königin persönlich hatte das befohlen, und Aisa konnte sich nicht vorstellen, dass einer der anderen diese Aufgabe weniger ernst nahm als sie selbst. Doch Mace war eben Mace, und wenn er verschwinden wollte, dann konnte ihn niemand aufhalten. Gestern war er plötzlich weg gewesen und erst jetzt zurückgekehrt, durch die Geheimtür in der Küche, womit er Milla einen gehörigen Schrecken eingejagt hatte, als sie gerade Eintopf kochte.
Mace’ spontane Ausflüge trieben die Garde in den Wahnsinn, doch Aisa verstand, dass Mace sie alle nur in äußerst begrenztem Umfang ertrug, denn das Bewachen lag ihm im Blut, nicht das Beschütztwerden. Manchmal musste er ihnen einfach entwischen, um allein zu sein. Aisa hatte gedacht, dass Mace irgendwohin zum Trinken ging oder spionierte, bis sie eines Tages ein Gespräch zwischen Elston und Coryn mitangehört hatte: Er suchte nach dem Festungspriester, Pater Tyler, und einem zweiten Geistlichen, Pater Seth; auf beide hatte der Arvath ein Kopfgeld ausgesetzt.
»Die Caden suchen auch nach ihnen«, bemerkte Coryn. »Sie wollen das Kopfgeld, unseres oder das des Arvaths, völlig egal. Wer hätte gedacht, dass sich zwei alte Männer so gut verstecken können?«
»Sie werden sich nicht für immer verbergen können«, knurrte Elston. »Und bei jedem Ausflug des Captains ist es wahrscheinlicher, dass der Heilige Vater davon Wind bekommt.«
Aisa hätte gern mehr gehört, doch in diesem Moment hatte Coryn sie an der Tür gesehen und weggescheucht.
Jedes Mal, wenn Mace von seinen Erkundungsgängen ohne die beiden Priester zurückkehrte, wirkte er mutloser. Aisa glaubte, dass Pater Tyler tot war, denn sie konnte sich kaum vorstellen, wie der scheue Priester sich so lange verstecken konnte. Sie war nicht die Einzige mit dieser Vermutung, doch niemand wagte diese vor Mace offen auszusprechen. Sie hatten gelernt, ihn in solchen Momenten allein zu lassen, heute jedoch begann Mace, nachdem er auf einen der Stühle um den Tisch gesunken war, sofort zu brüllen.
»Arliss! Kommt her!«
Die Worte brachten den Boden des Thronsaales zum Erbeben.
»Arliss!«
»Immer mit der Ruhe!«, brüllte Arliss über den Korridor zurück. »Ich komme ja schon, verflucht noch mal.«
Mace beugte sich über den Tisch, das Gesicht eine einzige Gewitterwolke. Sein Unvermögen, die beiden Priester zu finden, war nur ein Teil des Problems, dachte Aisa. Das wahre Problem war der leere Silberthron. Die Abwesenheit der Königin lastete auf allen schwer, am meisten jedoch auf Mace. Aisa dachte, dass der Captain unter seiner harten Schale mehr litt als Pen.
Arliss humpelte heran. »Ja, Mr. Mace?«
»Was sind die letzten Neuigkeiten vom Heiligen Vater?«
»Heute Morgen kam eine neue Nachricht. Wenn wir ihm nicht Pater Tyler übergeben und die Steuerbefreiung des Arvath erneuern, droht er uns allen mit dem Ausschluss aus Gottes Kirche.«
»Wen meint er mit ›uns‹«?
»Die ganze Festung, angefangen bei der Königin bis zum letzten Dienstboten.«
Mace lachte und rieb sich die roten Augen mit einer Hand.
»Das ist überhaupt nicht zum Lachen. Mir ist Gott egal, aber hier leben viele gläubige Menschen. In der Garde gibt es praktizierende Christen. Ihnen wird es etwas ausmachen.«
»Wenn sie so dumm sind, das Wort Gottes von diesem Stück Scheiße aus dem Arvath anzunehmen, dann verdienen sie das Höllenfeuer.«
Arliss zuckte mit den Schultern, auch wenn Aisa sah, dass er gern noch etwas erwidert hätte.
»Sie wollen nur Pater Tyler? Pater Seth nicht?«
»Nur Pater Tyler. Das Kopfgeld wurde noch einmal verdoppelt.«
»Seltsam. Und man weiß immer noch nicht, was passiert ist, als er aus dem Arvath floh?«
»Irgendein Handgemenge, ein Alarm in den Räumlichkeiten des Heiligen Vaters. Mehr konnte ich nicht herausfinden.«
»Seltsam«, wiederholte Mace.
»Übrigens heißt er nicht mehr Pater Tyler oder Festungspriester in diesen Nachrichten. Der Heilige Vater hat ihn umgetauft.«
»Und?«
»Der Abtrünnige.«
Mace schnaubte verächtlich. »Ist noch etwas passiert, während ich weg war?«
»Noch ein Dorf in den Gebirgsausläufern wurde angegriffen.«
»Was war das für ein Angriff?«
Arliss schüttelte den Kopf. »Es gibt nur zwei Überlebende, Sir, und ihre Berichte ergeben nicht viel Sinn, sie sprechen von Monstern und Geisterwesen. Gebt mir noch ein paar Tage.«
»Gut. Was sonst noch?«
Arliss wandte sich an Elston, der plötzlich äußerst verlegen wirkte.
»Wir müssen über Pen sprechen, Sir«, murmelte er leise.
»Wieso?«
Elston blickte zu Boden und suchte nach Worten, weshalb Arliss sich einschaltete.
»Der Junge trinkt zu viel …«
»Das weiß ich.«
»Ich bin noch nicht fertig. Letzte Nacht geriet er in eine Schlägerei. Eine öffentliche Schlägerei.«
Aisa riss die Augen auf und schwieg, um nicht bemerkt und verscheucht zu werden wie von Coryn letztens.
Pen, dachte sie und schüttelte beinahe traurig den Kopf.
»Zum Glück befand er sich in einer meiner Spielhöllen, sonst wäre er wahrscheinlich tot. Er nahm es ohne Schwert mit fünf Männern auf. Hat ordentlich Prügel eingesteckt. Ich habe versucht, es unter den Teppich zu kehren, aber so etwas verbreitet sich immer irgendwann.«
»Wo ist er?«
»In seinem Quartier, schläft den Rausch aus.«
Mace stand mit grimmigem Gesicht auf.
»Es tut mir leid, Sir«, sagte Elston niedergeschlagen. »Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten, aber …«
»Mach dir keine Gedanken, Elston. Für diesen Schlamassel bin ich selbst verantwortlich.«
Mace ging mit weiten, bestimmten Schritten den Gang entlang zu den Unterkünften der Wachen. Elston, Coryn und Kibb folgten ihm nach einem Moment, und Aisa heftete sich vorsichtig an ihre Fersen. Als sie das Ende des Korridors erreichten, blieben sie beim scharfen Klatschen einer Handfläche, die auf Fleisch traf, stehen.
»Hoch mit dir!«
Pen murmelte etwas Unverständliches.
»Wir haben dich lange genug verhätschelt, du liebeskrankes Balg. Raus aus dem Bett, oder ich mache dir Beine, und dabei werde ich garantiert nicht zimperlich sein. Du bist eine Schande für dich und die ganze Garde. Du bist eine Schande für mich.«
»Warum?«
»Ich habe dich ausgesucht, du kleines Stück Scheiße!«, brüllte Mace. »Glaubst du etwa, du warst der einzige Junge auf der Straße, der mit einem Messer umgehen konnte? Ich habe dich ausgesucht! Und jetzt brichst du zusammen, wenn ich dich am dringendsten brauche!«
Pen murmelte wieder etwas Unverständliches. Er war immer noch betrunken, dachte Aisa, oder hatte zumindest einen schrecklichen Kater. Ähnliches Gebrabbel hatte sie unzählige Male bei Dad gehört. Jetzt sagte Pen lauter: »Ich bin eine Leibwache, und Ihr braucht keine Leibwache. Wir sitzen hier und tun gar nichts, während sie da drüben ist! Ich habe niemanden zu bewachen!«
Holz zersplitterte, ein Poltern, gefolgt von Pens Schmerzensschrei.
»Sollen wir reingehen?«, flüsterte Aisa, doch Elston schüttelte den Kopf und legte einen Finger an die Lippen. Ein schleifendendes Geräusch drang durch die Tür; Mace zog Pen schwer atmend über den Boden.
»Du warst der Schlaue, der Kluge, Junge. Du solltest einmal Captain dieser Garde werden, wenn wir anderen zu alt und zu langsam geworden sind. Und jetzt schau dich an, wie du dich in deinem Elend suhlst wie ein Schwein in seiner Scheiße.«
Aisa spürte, wie jemand an ihrem Hemdsaum zupfte, und sah nach unten. Ihre kleine Schwester Glee blickte zu ihr auf.
»Glee!«, flüsterte sie. »Du darfst doch nicht hier unten sein.«
Glee starrte sie weiter blicklos an, und Aisa erkannte, dass sie sich in einem ihrer Trancezustände befand.
»Glee? Kannst du mich hören?«
»Deine Chance«, flüsterte das kleine Mädchen. Ihre Augen waren so leer, dass sie hohl erschienen. »Du wirst es klar und deutlich sehen. Sie biegen um die Ecke, und du wirst deine Chance ergreifen.«
Aisa öffnete den Mund. Sie sollte sich jetzt nicht um Glee kümmern, denn zwischen Mace und Pen wurde die Lage immer angespannter. Sie hörte noch mehr zersplitternde Möbel, dann das Klatschen einer Faust auf Fleisch.
»Geh zu Maman, Glee.« Sie drehte ihre Schwester herum und gab ihr einen sanften Schubs in Richtung Korridor. Aisa sah ihr einige Sekunden verwirrt nach, bevor sie sich wieder zu den Quartieren wandte. Elston und Kibb lehnten am Türrahmen, und Aisa nahm all ihren Mut zusammen, kniete sich hin und spähte an Elstons Beinen vorbei ins Zimmer.
Pen war tief über eines der Becken, die an der gegenüberliegenden Wand standen, gebeugt. Mace ragte hoch über ihm auf und hatte ihn am Nacken gepackt. Aisa hatte den Eindruck, dass Mace ihn sofort wieder nach unten ins Wasser drücken würde, wenn Pen versuchen sollte, sich zu früh aufzurichten. Elston gab Mace ein Zeichen, ob sie gehen sollten, doch der zuckte nur mit den Schultern.
Pen richtete sich auf und schnappte nach Luft; seine braunen Locken klebten ihm am Kopf. Aisa zuckte zusammen, als sie sein Gesicht sah: überall blühten Blutergüsse, beide Augen waren schwarzviolett verfärbt, ein Streifen getrocknetes Blut überzog eine Wange. Mace wirkte allerdings nicht besorgt.
»Bist du jetzt nüchtern, Junge?«
»Warum tun wir nichts?«, heulte Pen. »Wir warten und warten, während sie da drüben …«
Mace verpasste ihm eine Ohrfeige.
»Du hast Nerven, Pen. Wenn du nur einmal über deinen eigenen Kummer hinweggeblickt hättest, wäre dir einiges klar geworden. Hier ist eine ganze Stadt voller Menschen, die alle nach Hause zurückkehren müssen. Eine Kirche, die den Thron zerschmettern will. Und ein eitriges Geschwür unter dem Gut. Du kennst die Königin, Pen. Wenn wir uns nicht um diese ganzen Probleme kümmern würden, nur um sie zurückzuholen, würde sie uns beide umbringen.«
»Ohne sie hier wird alles nur schlimmer – die Kirche …«
Mace’ Blick flackerte. »Das stimmt. Und du könntest eine große Hilfe sein, doch stattdessen ertränkst du deinen Kummer in Alkohol und Kneipenschlägereien. Glaubst du, die Königin würde dich gern so sehen? Wäre sie stolz auf dich?«
Pen sah zu Boden.
»Sie würde dich jämmerlich finden, Pen, genau wie ich.« Mace holte tief Luft und verschränkte die Arme. »Wasch dich, und zieh dir saubere Kleidung an. Dann ab mit dir. Tu, was du tun musst, denk darüber nach, ob du Mitglied der Garde bleiben willst. Du hast zwei Tage. Komm in deiner besten Verfassung zurück oder überhaupt nicht. Verstanden?«
Pen sog scharf die Luft ein, seine blutunterlaufenen Augen blickten verletzt. Aisa hoffte, dass Mace ihm noch eine Ohrfeige verpassen würde, doch dieser kam nur auf die Tür zu und scheuchte sie alle weg.
»Es tut mir leid, Sir«, wiederholte Elston.
»Nicht deine Schuld, El«, wiederholte Mace und schloss die Tür zu den Quartieren hinter sich. »Ich habe eine alte Regel gebrochen, und das hätte ich nicht tun sollen.«
»Glaubt Ihr, er kommt zurück?«
»Ja«, erwiderte Mace knapp.
Arliss wartete vor seinem Büro auf sie, die üblichen Unterlagen in der Hand, doch jetzt stand Ewen bei ihm und blickte über Arliss’ Schulter wie ein schüchternes Kind.
»Wir haben Schätzungen zur Ernte …«, begann Arliss, doch Mace unterbrach ihn.
»Ewen, was beschäftigt dich?«
Ewen trat hinter dem Schatzmeister hervor, die Wangen leicht gerötet. »Ich würde gern mit Euch sprechen, Sir.«
»Sprich.«
Ewen holte tief Luft, als ob er sich auf eine Rede vorbereitete. »Ich gehöre nicht zur Königinnengarde. Ihr seid sehr gütig zu mir gewesen, Sir, Ihr und die Königin, dass ich den Umhang tragen und so tun durfte, als gehörte ich dazu. Aber ich bin kein echter Wachmann der Königin, und das werde ich auch nie sein.«
Mace warf Elston einen scharfen Blick zu. »Hat jemand mit dir darüber gesprochen, Ewen?«
»Nein, Sir. Alle waren so freundlich wie Ihr selbst«, antwortete Ewen und errötete noch mehr. »Ich habe eine Weile gebraucht, um von selbst darauf zu kommen, aber jetzt weiß ich es. Ich bin kein echter Wachmann der Königin, und ich wäre gern wieder von Nutzen.«
»Und wie willst du das anstellen?«
»Wie bisher auch, Sir, als Kerkermeister. Eine Gefangene ist auf freiem Fuß.«
»Eine Gefangene …« Mace starrte ihn einen Moment lang an. »Himmel, Ewen. Nein.«
»Ich wäre gern wieder von Nutzen«, wiederholte Ewen starrsinnig.
»Ewen, weißt du, wie wir Brenna überhaupt fangen konnten? Coryn ist durch Zufall auf sie gestoßen, als sie gerade in einer von Thornes Morphiumhöhlen im Drogenrausch war. Du hast gehört, was Will unten passiert ist. Coryn hatte riesiges Glück, dass sie ihn nicht hatte kommen sehen. Ich würde nicht mal den besten Schwertkämpfer von Tearling hinter der Hexe herschicken. Und auf keinen Fall kann ich dich aussenden.«
Ewen straffte die Schultern, bis er aufrecht dastand. »Ich weiß, was sie ist, Sir. Ich wusste es schon von dem Tag an, an dem ich sie das erste Mal sah. Und ich habe gehört, was sie an die Wand geschrieben hat. Sie will der Königin Schaden zufügen.«
Mace runzelte die Stirn. »Hast du mit deinem Vater darüber gesprochen?«
»Mein Vater ist mittlerweile tot, Sir. Doch selbst im Sterben hat er noch gesagt, ich solle alles tun, um die Königin zu schützen.«
Mace schwieg, doch Aisa sah, dass er betroffen war.
»Ewen, sie ist keine gewöhnliche Gefangene. Du kannst sie nicht töten, denn die Königin hat ihr Wort gegeben, sie am Leben zu erhalten. Wenn du versuchst, so eine Hexe lebendig zu fassen, wirst du wahrscheinlich dabei sterben. Ich schätze deinen Mut, aber das kann ich nicht zulassen. Die Königin würde genauso reagieren. Es tut mir leid.«
Ewen starrte schweigend zu Boden.
»Wir werden etwas anderes für dich finden. Etwas, das der Königin hilft. Das verspreche ich.«
»Ja, Sir.«
»Du kannst gehen.«
Ewen entfernte sich mit gebeugten Schultern über den Korridor in Richtung des Audienzsaales.
»Vielleicht hättet Ihr ihn gehen lassen sollen«, bemerkte Arliss leise.
»Das wäre ein schönes Erbe für meine Zeit als Regent gewesen, nicht wahr? Ein Kind auf eine Selbstmordmission schicken.«
»Er will etwas Ehrenwertes tun, Sir«, schaltete sich Elston unerwartet ein. »Vielleicht wäre es gut, es ihm zu erlauben.«
»Nein. Ich bin kein Kindermörder mehr.«
Aisa erstarrte, doch keiner schien überrascht von seinen Worten.
»Das ist schon sehr lange her«, murmelte Arliss, doch Mace lachte bitter auf und schüttelte den Kopf.
»Ihr wollt nett sein, alter Mann, aber egal, wie sehr wir versuchen, der Vergangenheit zu entfliehen, sie ist immer da. Ich habe mit dieser Zeit abgeschlossen, aber das heißt noch lange nicht, dass das umgekehrt genauso gilt.«
»Ihr seid ein guter Mann geworden.«
»Ja, das bin ich«, erwiderte Mace mit einem Nicken, seine Augen waren allerdings beinahe ohne Leben. »Doch das löscht nicht aus, was davor war.«
Während sie den Korridor entlanggingen und über die Ernte sprachen, blieb Aisa, wo sie war. Immer wieder drehte und wendete sie die Worte, doch sie ergaben keinen Sinn. Sie hielt Mace für den besten Mann im Königinnen-Trakt, vielleicht mit Ausnahme von Venner, und sie konnte den Captain der Garde, den sie kannte, nicht mit dem Bild vereinen, das die Worte in ihr ausgelöst hatten: ein Mann, der mit einer Sense durch Reihen kleiner Gestalten pflügte.
Ein Kindermörder.
Zwei Stunden später versammelten sie sich im Thronsaal zur Audienz des Regenten. Elston, Aisa, Coryn, Devin und Kibb hatten sich um das Podest herum postiert, die übrige Garde stand im Raum verteilt. Mace saß auf einem der Stühle auf dem Podest, Arliss neben ihm, während die Bittsteller eingelassen wurden. Der leere Thron glänzte im Fackellicht.
»Gott helfe mir«, murmelte Mace. »Ich habe mich immer gefragt, warum sich die Königin bei diesen Gelegenheiten nicht beherrschen konnte. Jetzt frage ich mich, wie sie das überhaupt überstanden hat.«
Arliss kicherte. »Die Wut der kleinen Königin ist sehr mächtig. Und sehr unterhaltsam. Ich vermisse das Mädchen.«
»Wir alle vermissen sie«, antwortete Mace mürrisch. »Dann wollen wir sie mal würdig vertreten.«
Aisa wandte sich zu den Türen und setzte den von Elston empfohlenen Gesichtsausdruck teilnahmsloser Ruhe auf. Die Adeligen kamen zuerst, nach einer alten Regel, die Mace und Arliss schon einmal abschaffen wollten, wie Aisa gehört hatte. Doch tatsächlich beschleunigte es das Ganze. Mittlerweile erschienen weniger Adelige zur Audienz bei Mace, und heute waren nur zwei gekommen, die beide um Steuererleichterungen ersuchten. Keiner arbeitete auf den Feldern, und selbst Aisa sah, dass hier bald Abhilfe geschaffen werden musste. Es würde nicht nur zu wenig zu essen geben, sondern auch jedem Adeligen im Königreich einen Grund verschaffen, sich um die Steuern zu drücken. Lady Bennett und Lord Taylor lauschten verdrießlich, während Mace mit außerordentlicher Geduld erklärte, dass er im Moment wegen der aktuellen Ereignisse in dieser Sache keine Entscheidung treffen konnte. Aisa wusste, dass Arliss an einer Lösung für das Problem mit der Ernte arbeitete, wie man die Menschen am schnellsten nach Hause brachte, doch es dauerte lange, die Familien für eine solche Reise zu Fuß auszurüsten. Beide Bittsteller verließen den Thronsaal mit leeren Händen und missgestimmt, wie so viele zuvor auch.
Nach den Adeligen kamen die Armen. Aisa mochte sie lieber, denn ihre Probleme waren echt. Ungesühnte Verbrechen, vermisstes Vieh, Besitzstreitigkeiten … Mace fand oft Lösungen für diese Fälle, an die Aisa niemals gedacht hätte. Die Garde entspannte sich leicht während dieses Teils der Audienz, selbst Aisa, die beinahe Spaß hatte. Bis sich die Menge teilte und sie plötzlich ihren Vater vor sich sah.
Sofort zuckte ihre Hand zu ihrem Messer, und so viele widersprüchliche Gefühle drohten sie zu überwältigen, dass sie sie erst sortieren musste. Da war Erleichterung – Erleichterung, weil sie einige Zentimeter seit dem Frühjahr gewachsen war und Dad gar nicht mehr ganz so groß erschien. Außerdem spürte sie Hass, ein dauerhaft brennendes Feuer, das mit der Entfernung und der Zeit nur noch glühender geworden war und sich durch ihren Kopf und ihren Bauch fraß. Am drängendsten war aber das Bedürfnis, ihre beiden jüngeren Schwestern Glee und Morryn zu suchen und sie vor allem Übel der Welt zu beschützen, ganz besonders vor Dad.
Mace hatte Dad ebenfalls erkannt, denn ein Muskel zuckte in seinem Kiefer. Er beugte sich vor und fragte leise: »Willst du gehen, Raubkatze?«
»Nein, Sir«, antwortete Aisa und wünschte, ihre Entschlossenheit wäre so sicher wie ihre Stimme. Dad mochte zwar nicht mehr drohend über ihr aufragen, aber er sah immer noch so aus wie früher. Er war Steinleger, und sein Oberkörper schien doppelt so breit wie der Rest seines Körpers. Als er sich dem Thron näherte, zog Aisa das Messer und packte es mit plötzlich schweißfeuchter Faust.
Mace gab Kibb ein Zeichen und sagte leise: »Sorg dafür, dass Andalie nicht hereinkommt.«
Dad war nicht allein, wie Aisa jetzt erkannte. Mit ihm war ein Priester aus der Menge getreten. Der Geistliche trug die weißen Roben des Arvath, hatte die Kapuze aber so tief ins Gesicht gezogen, dass sein Gesicht verdeckt war. Nach einem scharfen, unergründlichen Blick in ihre Richtung ignorierte Dad sie und konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf Mace.
»Ihr schon wieder, Borwen?«, fragte Mace müde. »Was steht heute an?«
Dad sah aus, als wollte er antworten, doch da trat der Priester vor und schlug die Kapuze zurück. Aisa hörte, wie Mace leise und scharf den Atem einsog, und automatisch brachte sie ihr Messer in Position, während Elston vorstürzte. Die restliche Wache begab sich umgehend auf ihre Plätze um das Podest herum. Aisa folgte den Männern und sprang zwei Stufen nach oben, um sich hinter Cae und Kibb aufzustellen.
»Eure Heiligkeit«, sagte Mace langsam. »Was für eine Ehre. Euer letzter Besuch war das reinste Vergnügen.«
Der Heilige Vater selbst! Aisa versuchte, ihn nicht anzustarren. Vergeblich. Sie hatte sich das Oberhaupt von Gottes Kirche als alten Mann vorgestellt, doch er war viel jünger als Pater Tyler, das Haar noch beinahe schwarz, das Gesicht nur von ein paar hauchfeinen Linien durchzogen. Mace sagte, der Heilige Vater ginge nirgendwo ohne Leibwache hin, doch Aisa sah niemanden in der Menge. Dennoch tat sie es den anderen Wachen gleich, die sich schützend um Mace aufgestellt hatten.
»Ich komme, um Gerechtigkeit von der Regierung der Königin zu fordern«, verkündete der Heilige Vater mit tiefer, volltönender Stimme. Jetzt sah Aisa seine Augen: schwarz, beinahe reptilienartig und bar jeder Emotion. »Unser Gemeindebruder Borwen suchte uns vor einigen Wochen mit großem Kummer auf. Die Königin verwehrt ihm seine elterlichen Rechte.«
»Tatsächlich?« Mace lehnte sich zurück. »Und warum sollte sie das tun?«
»Aus persönlichem Vorteil. Sie wollte Borwens Frau als ihre Dienerin.«
Mace starrte Borwen nieder. »Das ist also das Märchen der Woche? Es ist dumm. Andalie ist niemandes Dienerin.«
»Ich vertraue auf die Wahrheit von Borwens Geschichte«, erwiderte der Heilige Vater. »Borwen war einige Jahre ein aufrechtes Mitglied von Pater Deans Gemeinde und …«
»Ihr seid doch nicht gekommen, um für diesen Kinderschänder zu sprechen. Was wollt Ihr wirklich?«
Der Heilige Vater zögerte einen Moment. »Ich fordere außerdem die Rückkehr des Abtrünnigen.«
»Ich habe Euch mittlerweile sicher schon zehn Mal gesagt, dass wir ihn nicht haben.«
»Das glaube ich nicht.«
»Nun, das wäre ja nicht das erste Mal, dass Ihr etwas glaubt, ohne einen Beweis dafür zu haben, nicht wahr?« Mace’ Worte klangen neckend, doch eine dicke Ader pochte gefährlich an seiner Stirn. »Wir haben Pater Tyler nicht, und damit ist das Thema beendet.«
Der Heilige Vater lächelte sanft. »Und wie steht es dann um Borwens Fall?«
»Borwen ist ein Kinderschänder. Wollt Ihr wirklich den Arvath mit so jemandem in Verbindung bringen?«
»Das ist Verleumdung«, erwiderte der Heilige Vater ruhig, auch wenn Aisa sah, dass sein Lächeln einen Moment lang unsicher geworden war. Vielleicht hatten sie geglaubt, Mace würde diesen Punkt nicht bei einer öffentlichen Audienz ansprechen. Aisa wusste nicht, ob sie erleichtert oder enttäuscht sein sollte, dass er es getan hatte.
»Borwen ist ein guter Christ. Jeden Tag besucht er die Morgenmesse. Abends opfert er seine Zeit …«
»Borwen hat gar keine andere Möglichkeit, als ein guter Christ zu sein«, knurrte Mace. »Denn er weiß, dass seit sechs Monaten ein Mann der Stadtwache ihm auf meinen Befehl hin nicht von der Seite weicht. Seine Nachbarn sind darüber sehr froh, wie ich gehört habe.«
Aisa war überrascht. Sie hätte nicht gedacht, dass Mace sich für irgendetwas interessierte, das nicht direkt die Königin betraf. Sie fragte sich, ob Maman davon wusste. Dad war sicher kein vorbildliches Gemeindemitglied; ihre Familie war nur ein paar Mal im Jahr in die Kirche gegangen.
»Borwen hat aus tiefstem Herzen Buße getan für seine früheren Taten«, erwiderte der Heilige Vater. »Er ist jetzt geläutert und will nur noch bei seiner Frau und seinen Kindern sein.«
»Geläutert«, sagte Mace höhnisch. »Ihr könnt viel erzählen, Borwen. Früher oder später wird sich die Verderbtheit in Euch wieder Bahn brechen, das wissen wir beide. Und wenn ich Euch dabei erwische, werde ich Euch erledigen.«
»Meine Kinder gehören mir!«, brüllte Dad. »Ihr habt kein Recht, sie mir vorzuenthalten!«
»Ihr habt Eure Kinder in dem Moment aufgegeben, in dem Ihr Hand an sie gelegt habt. Und an ihre Mutter.«
Aus dem Augenwinkel nahm Aisa eine Bewegung wahr: Maman, die mit verschränkten Armen an der Tür stand. Kibb hatte sie nicht gesehen – oder tat zumindest so –, und Aisa schwieg ebenfalls. Woher wusste Mace von Maman? Hatte sie ihm davon erzählt? Das war unwahrscheinlich, schließlich verstanden sich die beiden überhaupt nicht.
»Meine Tochter steht dort drüben!«, knurrte Dad. »Fragt sie! Fragt sie, wie schlecht man sie behandelt hat!«
Aisa erstarrte, als plötzlich alle Blicke im Raum auf sie gerichtet waren.
»Eure Tochter arbeitet für mich«, erwiderte Mace rasch, und Aisa erkannte, dass er auf die Richtung, die das Gespräch eingeschlagen hatte, nicht vorbereitet gewesen war. »Sie spricht auf meinen Befehl hin, nicht auf Euren.«
Aisa spürte Dads Blick auf sich und sah Triumph in seinen Augen. Dad kannte sie immer noch gut. Er wusste genau, dass sie ihr Martyrium nicht aufdecken, nichts von ihrer schrecklichen Vergangenheit erzählen würde. Ihre Schande vor Fremden einzugestehen, unter deren aufmerksamen Blicken … wie könnte sie danach weitermachen? Selbst wenn man ihr glaubte, wie sollte sie ihr Leben weiterführen in dem Wissen, dass jeder sofort nur an diese eine Sache denken würde, was sie alles hatte ertragen müssen. Wer konnte sich dem stellen?
Die Königin, ertönte plötzlich ihre innere Stimme. Die Königin würde das Wort ergreifen und sich allen Folgen stellen.
Doch Aisa konnte das nicht.
»Aisa hat schon genug mitgemacht«, sagte Mace. »Und kein wahrer Christ würde sie zwingen, alles noch einmal aufleben zu lassen.«
»In der Tat, Gott liebt Kinder«, mischte sich der Heilige Vater mit einem Nicken ein. »Bis auf die Lügner.«
»Seht Euch vor, Vater.« Mace’ Stimme war leiser geworden, ein Warnsignal für die, die ihn kannten. Der Heilige Vater schien sich nicht darum zu kümmern. Aisa fragte sich, ob der Priester es darauf anlegte, verprügelt oder verhaftet zu werden; das käme dem Arvath nur zugute. Doch Mace war zu klug, um ihm in die Hände zu spielen … zumindest hoffte Aisa das. Diese leise Wut war viel schlimmer als sein Brüllen. Wieder spürte sie Dads Blick auf sich und unterdrückte den Impuls, zu ihm zu sehen.
»Wenn das Kind tatsächlich eine Anschuldigung vorzubringen hätte, würde es das doch sicher tun«, erwiderte der Heilige Vater abschätzig. »Diese grundlosen Anschuldigungen gegen Borwen sollen nur die Tatsache verschleiern, dass die Gesetze der Königin eigenmächtig sind und nur ihren Bedürfnissen dienen. Alle Männer Gottes sollten ihn verteidigen.«
»Ihre eigenen Bedürfnisse. Als die Mort anrückten, öffnete die Königin die Festung, um über zehntausend Flüchtlinge aufzunehmen. Wie vielen hat der Arvath Obdach geboten?«
»Der Arvath ist heilig«, erwiderte der Heilige Vater. Aisa sah erleichtert, dass Mace ihn aus der Ruhe gebracht hatte. »Kein Bürgerlicher darf Gottes Haus ohne die Erlaubnis des Heiligen Vaters betreten.«
»Wie vorteilhaft für Gott und Eure Heiligkeit. Und was sagt Jesus Christus über Obdachlose, die man aufnehmen soll?«
»Ich würde gern auf den Abtrünnigen zurückkommen, Lord Regent«, sagte der Heilige Vater rasch. Aisa warf einen Blick in die Menge, doch sie konnte nicht erkennen, ob man den plötzlichen Rückzug des Mannes bemerkt hatte. Die meisten starrten nur mit offenem Mund Richtung Podest.
»Was ist mit Pater Tyler?«
»Wenn er bis Freitagmittag nicht an uns übergeben wird, wird die Kirche alle Bediensteten der Krone exkommunizieren.«
»Ich verstehe. Wenn alles andere keine Wirkung zeigt, greift Ihr zu Erpressung.«
»Das stimmt nicht. Doch Gott ist überaus enttäuscht über das Versagen der Krone, die Sünde in Tearling zu bekämpfen. Ohne die Königin hatten wir gehofft, Ihr würdet die Gelegenheit ergreifen und unnatürliches Verhalten unter Strafe stellen.«
Elston bewegte sich unruhig neben ihr, doch als Aisa ihm einen Blick zuwarf, ließ er sich nichts anmerken und sah ausdruckslos in die Menge.
»Wie steht es mit dem Geld für die fällige Eigentumssteuer?«, fragte Mace plötzlich. »Habt Ihr sie für das neue Jahr bereits?«
»Ich weiß nicht, was Ihr meint«, erwiderte der Heilige Vater leicht angespannt.
Mace brach in Gelächter aus. Bei dem Geräusch entspannte Aisa sich etwas, die Starre wich aus ihren Schultern. Sie ließ den Blick erneut durch den Raum schweifen und bemerkte, dass Maman Mace nicht aus den Augen ließ, während ein leichtes Lächeln ihre Lippen umspielte.
»Wisst Ihr, Anders«, sagte Mace, »ein paar Minuten war ich mir nicht sicher, was Ihr hier wollt. Jetzt bin ich im Bilde. Ich sage es noch einmal klar und deutlich: Was auch immer geschieht, wir werden am ersten Februar Eure Steuerzahlung erhalten.«
»Hier geht es nicht um Geld, Lord Regent.«
»Es geht immer um Geld. Ihr belegt Tearling mit dem Zehnten und wollt alles selbst behalten, Euch in Luxus suhlen und auf Kosten der Leichtgläubigen und Hungernden leben. Ihr profitiert davon.«
»Die Menschen geben freiwillig für eine heilige Sache.«
»Ach, auf einmal?« Mace verzog das Gesicht zu einem gehässigen Grinsen. »Aber ich weiß genau, wohin das Geld wandert. Letzte Woche haben wir zwei Eurer Vollstrecker festgenommen. Ihr macht Geschäfte mit der Krippe.«
Ein Raunen ging durch die Menge, und das Lächeln des Heiligen Vaters wurde einen Moment unsicher, bevor er antwortete.
»Grundlose Anschuldigungen!«, rief er. »Ich bin Gottes Bote …«
»Dann ist Euer Gott ein Zuhälter von Kindern.«
Die Menge schnappte nach Luft.
»Und Ihr!«, Mace wandte sich an Borwen. »Ich war mir auch nicht ganz sicher, was Ihr hier wollt, aber jetzt verstehe ich es. Ihr dachtet, mit einem Mann auf dem Thron hättet Ihr bessere Chancen, dass man Euer lächerliches Anliegen bewilligt. Wenn Ihr noch einmal versucht, Euch Eurer Frau und den Kindern zu nähern, dann …«
»Was? Werdet Ihr mich töten?«, brüllte Borwen. »Das soll eine Drohung sein? Ich bin bereits tot, meine Kinder wurden mir genommen, und wo ich auch hingehe, verachtet man mich. Warum tötet Ihr mich nicht gleich?«
»Das werde ich nicht tun«, sagte Mace leise. Seine dunklen Augen blickten kalt. »Ich werde Euch verhaften und Eurer Frau die Entscheidung über Euer Schicksal überlassen.«
Dad wurde kreidebleich.
Mace ging die Stufen des Podests hinab und fixierte dabei den Heiligen Vater. »Ihr werdet mich nicht mit Drohungen erpressen, genauso wenig wie Ihr mich von den Verfügungen der Königin ablenken werdet. Diesen Unsinn will ich hier nicht mehr sehen. Dem nächsten Priester, der einen Fuß in die Festung setzt, wird es nicht so gut ergehen. Und Ihr, Borwen … Ihr tretet mir nie wieder unter die Augen.«
Aisa glaubte, das Herz würde ihr gleich aus der Brust springen. Maman und Wen hatten sie so oft wie möglich vor Dad in Schutz genommen, doch es war etwas anderes, wenn jemand von außerhalb der Familie einen verteidigte. Wenn es erlaubt gewesen wäre, Mace zu umarmen, dann hätte sie es getan, denn sie empfand plötzlich eine derart überwältigende Liebe zu ihm wie bisher nur zu ihrer Mutter.
»Komm, Bruder Borwen«, befahl der Heilige Vater. »Es ist genau, wie ich es immer gesagt habe: Die Glynn-Krone erstickt an ihrem Stolz. Gott weiß von dieser Ungerechtigkeit, doch wir werden deinen Fall auch vor die Bürgergerichte bringen und aufdecken, was hier vor sich geht.«
»Versucht das ruhig«, erwiderte Mace ungerührt. »Doch seht Euch vor, Eure Heiligkeit. Borwens Kinder sind nicht seine einzigen Ankläger.«
»Niemand hat ihn irgendeiner Sache beschuldigt, Lord Regent.«
»Ich beschuldige ihn.«
Aisa hatte die Worte ausgesprochen, bevor sie darüber nachdenken konnte. Alle Blicke waren auf sie gerichtet, und sie wünschte sich über alles, sie hätte geschwiegen.
»Hast du etwas gesagt, Kind?«, fragte der Heilige Vater. Seine Stimme war honigsüß, während seine Augen wütend leuchteten. Seltsamerweise veranlasste gerade das Aisa weiterzusprechen. Sie dachte, jedes Wort wäre noch härter als das vorhergegangene, doch dann stellte sie erleichtert das Gegenteil fest. Es war, als wäre ein Damm in ihrer Kehle gebrochen.
»Ich war drei oder vier, als du angefangen hast.« Sie konnte ihm nicht in die Augen sehen, nur auf sein Kinn. »Auch bei Morryn hast du in diesem Alter angefangen. Wir mussten sie unter dem Fußboden vor dir verstecken.« Aisa hörte, wie ihre Stimme schrill vor Emotionen wurde, doch sie konnte nicht mehr aufhören. »Immer warst du hinter uns her, Dad, du konntest uns einfach nicht in Ruhe lassen, daran erinnere ich mich so deutlich …«
»Lügen!«, keifte der Heilige Vater.
»Das ist nicht wahr!«, schrie Aisa. »Es ist die Wahrheit, und Ihr wollt sie einfach nicht hören.«
»Raubkatze«, sagte Mace sanft, und mit einem tiefen, wütenden Atemzug verstummte sie.
»Keine Angst, Kind, alles ist in Ordnung. Aber bitte geh jetzt. Coryn, bring sie zu ihrer Mutter.«
Coryn zupfte sie leicht am Arm, und nach einem Moment ging Aisa mit ihm. Sie warf einen letzten Blick zurück, alle Augen waren immer noch auf sie gerichtet. Dad stand immer noch neben dem Heiligen Vater, das Gesicht vor Wut gerötet.
»Geht es dir gut?«, fragte Coryn leise.
Aisa wusste nicht, was sie sagen sollte. Ihr war übel. Sie hörte, wie Mace den beiden Männern befahl, die Festung zu verlassen.
»Aisa?«, fragte Coryn noch einmal.
»Ich habe den Captain in Verlegenheit gebracht.«
»Nein, das hast du nicht«, antwortete er, und sie war ihm für seinen geschäftsmäßigen Ton dankbar. »Du hast uns sehr geholfen. Jetzt wird es der Arvath nicht mehr wagen, deinen Vater vor ein Bürgergericht zu schicken. Zu viele Leuten waren heute hier.«
Alle werden es wissen. Aisa ertrug den Gedanken kaum.
»Den Caden wird es egal sein«, bemerkte Coryn beiläufig, und Aisa hielt inne.
»Warum sagst du das?«
»Ich habe dein Gesicht gesehen, Mädchen. Ich weiß, dass wir dich eines Tages verlieren werden. Doch ob grauer oder roter Umhang, lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft überschatten.«
»Ist das schwer?«
»Ja. Selbst der Captain kämpft jeden Tag damit.«
Kindermörder, erinnerte sich Aisa. Plötzlich stand Maman mit ausgebreiteten Armen vor ihr, und in Aisa brach alles zusammen. Sie war bereit gewesen, Dad zu töten, schon seit Jahren, doch jetzt erkannte sie, dass sie etwas viel Schwierigeres getan hatte: Sie hatte es laut ausgesprochen.
Tyler glaubte nicht an die Hölle. Er hatte schon lange beschlossen, dass, wenn Gott ihn bestrafen wollte, es auch jetzt schon unzählige Möglichkeiten gab. Die Hölle wäre überflüssig.
Doch wenn es eine Hölle auf Erden gab, befand Tyler sich gerade darin.
Er und Seth versteckten sich in einer Nische tief in einem Tunnel, begraben in den Gedärmen der Erde. Sie hatten sich durch eine winzige Öffnung in der Mauer gequetscht. Boden und Wände, die Tyler mit einem brennenden Streichholz beleuchtete, waren von Schimmel überzogen. Im letzten Moment, bevor das Streichholz erlosch, sah Tyler, dass es Seth schlechter ging. Seine Wangen waren hohl vom Fieber, seine Augen gelblich verfärbt von der Infektion. Tyler hatte Seths Wunde seit Tagen nicht angesehen, doch ganz sicher würden sich rote Streifen vom Bauch seines Bruders die Brust hinaufziehen. Nach der Flucht aus dem Arvath hatte Tyler Seth zu einem Arzt gebracht, den er mit seinem gesparten Geld bezahlt hatte. Aber der Mann war kein echter Arzt, und auch wenn er Seth etwas gegen die Schmerzen gegeben hatte, konnte er die Infektion nicht aufhalten.
Das Streichholz erlosch flackernd, keine Sekunde zu früh, denn in diesem Moment hörte Tyler sich rasch fortbewegende Schritte im Tunnel.
»Der östliche Ast!«, keuchte ein Mann. »Zum östlichen Ast, und dann treffen wir uns an der Straße.«
»Das sind Caden, ich weiß es«, sagte ein anderer Mann mit vor Furcht schwacher Stimme. »Sie kommen.«
»Was sollen die Caden hier unten? Damit können sie kein Geld verdienen.«
»Los, alle in den östlichen Ast, schnell!«
Die Schritte entfernten sich rasch. Tyler lehnte sich mit wild klopfendem Herzen gegen die Wand. Er und Seth hatten bereits eine Menge Probleme – wenn hier unten aber wirklich Caden waren, wäre das verheerend. Zu Beginn ihrer Flucht war Tyler einige Male an die Oberfläche gegangen, um Münzen gegen Essen und sauberes Wasser einzutauschen. Bei diesen Gelegenheiten hatte er auch gehört, dass der Arvath ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt hatte. Tyler und Seth hatten sich schon lange ihrer Priesterroben entledigt, doch selbst in bürgerlicher Kleidung fühlten sie sich an der Oberfläche nicht länger sicher. Seit über zwei Wochen hatte Tyler die Tunnel nicht mehr verlassen, und ihre Vorräte waren fast aufgebraucht.
»Ty?«, fragte Seth leise. »Glaubst du, sie sind hinter uns her?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Tyler. Er hatte gedacht, hier unten wären sie sicher, doch Sicherheit hatte ihren eigenen Preis. Bei seinen Erkundungsgängen durch die Tunnel hatte er viel gesehen und schließlich erkannt, worum es sich bei diesem Labyrinth wirklich handelte. Da war er wieder in die spirituelle Dunkelheit zurückgefallen, in der er die letzten Wochen im Arvath verbracht hatte.
Gott, warum lässt du das zu? Diese Welt ist deine Schöpfung. Warum quälst du die Menschen, indem sie hier verweilen müssen?
Wenig überraschend, erhielt er keine Antwort.
Er wusste, dass er Seth hier herausbringen musste, und das sehr bald. Er hatte nach einem unterirdischen Weg zur Festung gesucht; Mace musste auf einem solchen Weg unbemerkt zu seinem Leseunterricht in den Arvath gekommen sein. Doch Tyler hatte Angst, sich zu weit von der Sicherheit der Nische zu entfernen. Auf Seth waren nur tausend Pfund ausgesetzt, auf seinen eigenen Kopf jedoch mittlerweile fünftausend. Kein Caden würde sich eine solche Gelegenheit entgehen lassen. Von dem Gerede, das Tyler in einem düsteren Wirtshaus mitangehört hatte, wusste er, dass das Kopfgeld auch seine Besitztümer umfasste. Das sagte Tyler, dass der Heilige Vater sie beide zwar auf jeden Fall tot sehen wollte, sein Hauptinteresse aber bei der polierten Kirschholzkiste lag, die Tyler in seiner Tasche aufbewahrte. Er sehnte sich danach, sie noch einmal herauszunehmen und zu öffnen, doch sie mussten sparsam mit den Streichhölzern umgehen. Er drückte die Tasche eng an sich und spürte die tröstenden Kanten der Kiste.
Nach einigen Wochen in den Tunneln hatte Tyler sich einiges zusammengereimt: Seit Königin Elyssas Tod hatte niemand mehr die Tearkrone gesehen. Sie musste sie der Kirche gegeben haben – eine merkwürdige Handlung für jemanden, der nicht an den Gottesdiensten teilnahm, aber Elyssa wäre nicht die Erste, die auf dem Totenbett zu Gott gefunden hätte. Tyler hatte die Mutter der Glynn-Königin nie kennengelernt, doch sie wurde als die Sorte Mensch beschrieben, der sich den Weg in den Himmel erkaufen wollen könnte. Die Krone war zweifellos wertvoll, aus massivem Silber und mit Saphiren besetzt, doch für Tyler ging ihr Wert weit über das Finanzielle hinaus. Jeder Herrscher seit Jonathan Tear hatte diese Krone getragen und viele blutige Erbfolgekriege mitangesehen. Man munkelte, sie besäße auch magische Kräfte, auch wenn Tyler das für übertrieben hielt. Für ihn war die Krone ein Artefakt, ein Zeuge der wilden, streitbaren, außergewöhnlichen Geschichte von Tearling, und Tyler konnte ebenso wenig sorglos mit so einem Gegenstand umgehen, wie er Seth zurücklassen konnte. Außerdem hatte er ein Versprechen gegeben. Der Gedanke an die Frau, Maya, zerriss ihn. Sie hatte ihm die Krone gegeben, und er hatte sie dort vor einem Tisch voller Drogen zurückgelassen. Wenn er sie mitgenommen hätte, wäre er enttarnt worden, das wusste er. Doch das brachte ihm keinen Frieden. Anders war nicht dafür bekannt, Gnade walten zu lassen, und Tyler konnte sich nicht vorstellen, welches Schicksal Maya nach seiner Flucht erwartete. Wenigstens sein Versprechen wollte er halten und die Krone der Königin übergeben. Doch von hier unten aus würde ihm das kaum gelingen.
Dröhnende Schritte ertönten über Tylers Kopf, und ihn überlief ein Schauder. Vielleicht waren es die Caden oder eine andere Gruppe der verlorenen und verdammten Seelen, die Tyler hier unten gesehen hatte. Als die Schritte zahlreicher wurden, dachte Tyler an eine weitere Information, die er in dem Wirtshaus aufgeschnappt hatte: Mobs zogen durch die Straßen von Neulondon, mit Schwertern und geschnitzten Kreuzen, die Gott lobpreisten und allen Gewalt androhten, die es ihnen nicht gleichtaten. Nichts Offensichtliches verband diese Randalierer mit Gottes Kirche, und doch war Tyler klar, dass der Heilige Vater dafür verantwortlich sein musste. Er hätte seine Bibel verwettet, dass diese Menschen ihre Anweisungen aus dem Arvath erhielten.
Früher war diese Kirche einmal gut, dachte Tyler, und das war die Wahrheit. Nach den Tearmorden hatte die Kirche verhindert, dass Chaos ausbrach. Sie hatte mit den ersten Raleighs gearbeitet und dafür gesorgt, dass William Tears Kolonie sich nicht in alle vier Himmelsrichtungen zerstreute. Im zweiten Jahrhundert nach der Überfahrt hatte ein geschäftstüchtiger Prediger namens Denis den Katholizismus für sich entdeckt und den großen Wert von Theatralik und Ritualen erkannt, um Anhänger um sich zu scharen. Denis hatte die Erschaffung und Organisation des Arvath organisiert, eine Lebensaufgabe, die die Kirchenkassen geleert hatte und ihn vorzeitig altern ließ. Nur drei Tage nach der letzten Steinlegung war Denis gestorben, und die Kirche erkannte ihn mittlerweile als ersten Heiligen Vater an, doch es hatte schon viele Männer vor ihm gegeben, die Gottes Kirche auf denselben Weg geführt hatten. Tyler, der so viel mündliche Überlieferung wie möglich gesammelt hatte, wusste, dass seine Kirche alles andere als perfekt war. Doch selbst das dunkelste Kapitel in ihrer Geschichte war nichts gegen den gegenwärtigen Zustand des Arvath.
Natürlich hätte der Heilige Vater nichts davon in Anwesenheit der Königin gewagt. Anders fürchtete Königin Kelsea, fürchtete sie so sehr, dass er Tyler vor gar nicht langer Zeit eine Phiole mit Gift gegeben und ihm einen schrecklichen Auftrag erteilt hatte. Die Königin hatte sich an Mortmesne ausgeliefert – bei seinen kurzen Ausflügen an die Oberfläche hatte Tyler diese Neuigkeit nicht überhören können –, und Mace führte das Königreich in ihrer Abwesenheit. Aber die Menschen in Tearling liebten Mace nicht, sie hatten Angst vor ihm, und Angst war bei Weitem nicht so gefährlich. Ohne die Königin war der Heilige Vater erstarkt.
Sie muss zurückkommen, dachte Tyler fast schon gebetsartig. Sie muss.
Neue Schritte ertönten in dem Tunnel vor ihrer Nische, und Tyler presste sich wieder gegen die Wand. Einige Männer rannten an der schmalen Öffnung vorbei; außer den Laufgeräuschen gaben sie keinen Laut von sich. Selbst durch die Mauer spürte Tyler die militärische Effizienz und den zweckmäßigen Einklang in ihren Bewegungen.
Caden, dachte er. Wonach suchten sie? Nach Tyler und Seth oder nach jemand anderem? Eigentlich spielte es keine Rolle. Nur ein Paar scharfer Augen war nötig, um den Spalt in der Mauer auszumachen, und dann wären sie enttarnt.
Die Schritte entfernten sich, ohne langsamer zu werden, und Tyler entspannte sich. Als Seth sich zitternd an ihn drängte, legte Tyler die Arme um seinen Freund. Seth lag im Sterben, litt unerträgliche Schmerzen, und Tyler konnte nichts für ihn tun. Er hatte Seth bei der Flucht aus dem Arvath geholfen, doch was hatte es ihnen gebracht? Sie wurden von allen gejagt.
Lieber Gott, betete Tyler, auch wenn er wusste, dass die Worte niemanden erreichen würden. Lieber Gott, bitte zeige uns dein Licht.
Doch nur Dunkelheit umgab sie, das unaufhörliche Tropfen von Wasser und irgendwo da draußen die verklingenden Schritte von Mördern.