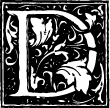 er Aufstieg war anstrengend.
er Aufstieg war anstrengend.
Katie Rice hatte diesen Weg schon unzählige Male genommen, den kurvigen Pfad auf der Bergrückseite hinauf, die ganze Strecke vom Fluss zur Stadt. Sie kannte jede Besonderheit am Wegesrand: den gespaltenen Felsen, dessen Gesicht sie nach der dritten Kurve wie ein Wegweiser begrüßte, die jungen Eichen, die auf halbem Weg gerade begannen, sich über die Biegung zu neigen, die Stelle, an der der Wind von der Ebene den Weg abgetragen hatte. Bei der Versammlung letzte Woche hatte William Tear von dieser Stelle gesprochen. Er hatte gesagt, man müsste sie irgendwie verstärken, und nach Freiwilligen gefragt. Hundert Hände waren in die Höhe geschossen.
Katie kannte den Weg in- und auswendig und hasste ihn dennoch. Sie verabscheute die lange Wanderung, auf der man nichts tun konnte außer denken. Doch die Schaffarm war am Fuß des Berges, und Katie liebte Wolle so sehr, wie sie das Laufen hasste. Sie war drei gewesen, als Mum ihr das erste Mal Stricknadeln gegeben hatte, und jetzt mit vierzehn war sie nicht nur die beste Strickerin der Stadt, sondern auch eine der besten Spinnerinnen und Färberinnen. Diese Wanderungen waren der Preis dafür, dass sie ihre eigene Wolle spinnen und färben konnte.
Sie trat aus den Bäumen heraus, und die Stadt lag vor ihr: Hunderte kleiner Holzhäuser bedeckten die sanft gerundete Hügelspitze und erstreckten sich bis zum Fluss, der an der Stadt entlang eine Biegung machte und sich nach Südwesten schlängelte. Mum sagte, sie hätten diesen Ort ursprünglich gefunden, indem sie vom Meer aus flussaufwärts gewandert seien. Katie versuchte sich vorzustellen, wie sich das Land den ersten Siedlern präsentiert haben musste: nur ein paar dicht mit Bäumen bewachsene Hügel. Sechzehn Jahre waren seit der Überfahrt vergangen, was Katie wie eine sehr lange Zeit erschien, auch wenn es das natürlich in Wirklichkeit nicht war.
Sie drehte sich um und ging rückwärts, denn das war ihre Lieblingsaussicht: die Bäume, die den Hügel bedeckten, der strahlend blaue Fluss vor den grün-goldenen Feldern. Von hier aus konnte Katie die Feldarbeiter sehen; etwa fünfzig arbeiteten auf einem breiten Rechteck mit Ackerfurchen auf der anderen Flussseite. Sie würden bis zum Sonnenuntergang arbeiten, und falls nötig, im Licht von Lampen weitermachen. Die zwei Jahre vor Katies Geburt waren schrecklich gewesen, die Hungerzeit, wie Mum sie nannte, als die Siedler noch nicht wussten, wie man Ackerbau betreibt. Über vierhundert Menschen – fast ein Viertel der Gruppe – waren gestorben. Jetzt war der Anbau von Nahrung die wichtigste Tätigkeit in der Stadt.
Nächstes Jahr wäre Katie endlich alt genug, um nach der Schule in die Lehre gehen. Sie könnte dann auf der Farm arbeiten, doch das wollte sie wahrscheinlich gar nicht. Sie mochte keine körperliche Arbeit, Sachen heben und herumtragen. Doch im September und Oktober arbeiteten alle auf den Feldern, bis auf die Babys und die alten Leute mit Arthritis. Es gab noch nicht genug hauptberufliche Bauern, und die Ernte musste vor dem Frost eingebracht werden. Wenn sich jemand beschwerte – und das geschah immer –, erzählten die Erwachsenen regelmäßig die Geschichten aus der Hungerzeit: Wie sie alle Hunde bis auf die Welpen schlachten mussten, um etwas zu essen zu haben; wie einige Gruppen nachts aufbrachen, um nach Essen zu suchen, und vermutlich im Schnee erfroren; wie William Tear seine Rationen weggegeben hatte, bis er so dünn und unterernährt war, dass er an Lungenentzündung erkrankte und beinahe starb. Jetzt hatten sie genug Feldfrüchte, Kartoffeln, Karotten, Erdbeeren, Kohl und Kürbis, außerdem einen gesunden Bestand an Hühnern, Kühen und Schafen. Keiner musste Hunger leiden. Trotzdem musste Katie jeden Herbst die Hungerzeit erneut durchleben, und selbst jetzt bereitete ihr der Gedanke an die Ernte Übelkeit.
Letztes Jahr hatte William Tear bei der Versammlung etwas gesagt, das Katie niemals vergessen würde: Dass eines Tages die ganze Ebene mit Feldern bedeckt sein würde, so weit das Auge reichte. Katie konnte sich das zu geraden Reihen gezähmte Grasland nicht vorstellen. Sie hoffte, dass sie diesen Tag nicht mehr erleben würde. Sie wollte nicht, dass sich an dem Ausblick etwas änderte.
»Katie!«
Als sie sich umdrehte, sah sie Row etwa hundert Meter vor ihr auf dem Weg. Katie beeilte sich freudig, zu ihm aufzuholen. Mit Row würde der Heimweg interessant werden, wie immer.
»Wo kommst du gerade her?«, fragte sie.
»Vom südlichen Abhang. Ich habe nach Metall gesucht.«
Katie nickte verstehend. Row war ein Metallarbeiter, einer der besten der Stadt. Er lernte in Jenna Carvers Werkstatt. Viele Leute brachten ihren Schmuck zu ihm zur Reparatur, außerdem auch Gegenstände des Alltags wie Teekessel oder Messer. Doch diese Reparaturarbeiten waren für Row nur Pflichterfüllung. Seine Liebe gehörte seinen eigenen Arbeiten: Schmuckstücke und Armbänder, aufwendig verzierte Kaminwerkzeuge, Messer mit kunstvollen Handgriffen, winzige Statuen, die man auf einen Tisch stellen konnte. Zu Katies letztem Geburtstag hatte Row ihr die kleine silberne Figur einer Frau geschenkt, die unter einer Eiche saß. Allein die Blätter zu ritzen musste ihn Tage gekostet haben. Die Statue war Katies wertvollster Besitz; sie stand auf ihrem Nachttisch, neben ihrem Bücherstapel. Row war ein begabter Künstler, doch das von ihm bevorzugte Metall war schwer in der Stadt zu bekommen. Deshalb machte er sich oft auf tagelange Erkundungstouren in die Umgebung auf. Einmal war er für eine Woche Richtung Norden gewandert und hatte einen riesigen Wald gefunden, an dessen Rand sich ein großes Kupfervorkommen befand. Row wollte unbedingt zu diesem Wald zurück und hatte sogar William Tear um Erlaubnis gebeten, eine Expedition in den Norden zu leiten. Bisher hatte Tear ihm jedoch noch keine Antwort gegeben.
Sie gingen am Friedhof vorbei, eine einen halben Hektar große Fläche unter einem Kiefernhain, der seit Neuestem von einem Holzzaun umgeben war. Irgendetwas war auf den Friedhof eingedrungen, Wölfe oder vielleicht auch nur Waschbären; in den letzten Wochen hatte Melody Banks, die für den Friedhof zuständig war, einige aufgegrabene Gräber entdeckt, deren Inhalt überall verteilt war. Melody verschwieg, um welche Gräber es sich gehandelt hatte, und die sterblichen Überreste waren längst wieder beerdigt. Katie fürchtete sich nicht besonders vor Friedhöfen oder Toten, doch auch ihr gefiel die Vorstellung nicht, dass Tiere die Knochen ausgruben. Sie war erleichtert, als die Stadt bei der Versammlung für einen Zaun gestimmt hatte.
»Eines Tages«, sagte Row, »wenn ich zu entscheiden habe, werde ich alles ausgraben und verbrennen lassen.«
»Wieso glaubst du, dass du einmal entscheiden wirst?«, fragte Katie. »Vielleicht werde ja ich das tun.«
»Vielleicht auch wir zwei«, erwiderte Row grinsend, doch Katie hörte einen ernsten Unterton heraus. Sie hatte gar kein Interesse daran, die Stadt zu leiten, sich mit den unzähligen Pflichten zu beschäftigen, um die sich William Tear täglich kümmern musste. Doch Rows Ambitionen waren echt. Selbst mit fünfzehn war ihm die Ineffizienz der Stadt ein Dorn im Auge, und er war sich sicher, sie besser leiten zu können. Er sehnte sich nach Verantwortung, und Katie fand, dass er ein Talent dafür hatte. Row war der geborene Problemlöser. Doch bisher schien keiner der Erwachsenen in der Stadt seine Qualitäten erkannt zu haben, und dieser Mangel an Anerkennung war ein wunder Punkt.
Katies eigene Unzufriedenheit hatte einen anderen Grund. Sie liebte die Stadt, liebte die wunderschöne einfache Idee, dass alle sich umeinander kümmerten. Doch in den letzten Jahren hatte sie sich von der Gemeinschaft manchmal eingeengt gefühlt, von ihrer Nettigkeit, davon, dass jeder ein Auge auf den anderen haben sollte. Katie mochte die meisten ihrer Nachbarn nicht, sie hielt sie für langweilig oder dumm oder, was am schlimmsten war, für Heuchler, die Freundlichkeit vortäuschten, weil es von ihnen erwartet wurde, weil Tear über alles wachte. Katie war Ehrlichkeit lieber, selbst wenn diese unfreundlich geäußert wurde. Sie wollte, dass alles offen ausgesprochen wurde.
Ihre nettere Hälfte schrieb sie Mum zu, die eine von William Tears engsten Beratern war und an seine Vision glaubte. Katie wusste nicht, wer ihr Vater war; Mum mochte Frauen, keine Männer, und Katie war sich fast sicher, dass Mum irgendeinen willigen Mann für die Vaterschaft benutzt und ihn dann vergessen hatte. Katie war die Identität ihres Vaters egal, doch sie fragte sich oft, ob dieser unsichtbare, unbekannte Mann für ihre Unzufriedenheit verantwortlich war, für die wachsende Ungeduld, die in ihr brodelte und manchmal schon fast an Boshaftigkeit grenzte.
»Na, wieder am Umkippen?«, fragte Row, und Katie lachte.
»Nein, ich denke nur nach. Schadet ja nichts.«
Row zuckte mit den Schultern. Ihr Bedürfnis, eine Sache von allen Seiten zu betrachten – er nannte es »Umkippen« –, war ihm fremd. Er war der Meinung, dass seine Ansichten immer richtig waren, und er hatte nie das Bedürfnis verspürt, genauer darüber nachzudenken. Manchmal machte Katie das wahnsinnig, doch oft war es auch eine Erleichterung. Row blickte niemals zurück und fragte sich, ob er irgendetwas falsch gemacht hatte, ob er ungerecht gewesen war. Die kleinen Fehler des Tages verfolgten ihn nachts nicht.
Sie bogen um die Kurve auf die Hauptstraße, gingen an der Bibliothek vorbei, wo die Bibliothekarin Ms. Ziv gerade die letzten Besucher aus der Tür scheuchte. Die Bibliothek war ein großes Gebäude, das einzige zweigeschossige Haus der Stadt; außerdem war es nicht wie die anderen aus Eiche, sondern aus Ziegelsteinen erbaut. Die Bibliothek war Katies Lieblingsort, an dem es immer dunkel und ruhig war, inmitten der vielen Bücher. Row fühlte sich dort auch wohl, auch wenn er einen anderen Geschmack als Katie hatte. Die kleine Abteilung mit Büchern zu okkulten Themen hatte er bereits durchgelesen, doch er beschäftigte sich immer wieder damit. Es gab strenge Regeln, wie man die Bücher berühren und mit ihnen umgehen durfte, und Ms. Ziv nahm sich jeden zur Brust, der es wagte, eine Seite umzuknicken oder gar das Buch aus seinem Plastikschutzumschlag zu nehmen. Katie hatte Ms. Ziv einmal gefragt, wie groß der Bestand war, und diese hatte ihr zugeflüstert, dass es sich um fast zwanzigtausend Bände handelte. Sie hatte offensichtlich auf eine beeindruckte Reaktion gehofft, doch diese war ausgeblieben. Katie las zwei bis drei Bücher in der Woche. Wenn sie das auf ihr gesamtes Leben umrechnete, würde sie genug Lesestoff haben, doch was, wenn ihr die meisten davon nicht gefielen? Was, wenn die Bücher, die sie noch nicht gelesen hatte, gerade ausgeliehen waren? Es würde keine neuen Bücher mehr geben, aber wahrscheinlich immer mehr Menschen, sehr viel mehr. Nur Katie schien zu erkennen, dass zwanzigtausend eigentlich fast nichts war.
Ms. Ziv hatte die letzten Nachzügler hinauskomplimentiert. Katie winkte ihr zu, und die gehetzt wirkende Frau erwiderte den Gruß, bevor sie im Innern der Bibliothek verschwand und die Tür hinter sich schloss.
»Row!«
Katie drehte sich um und sah, wie Anita Berry ihre Verandatreppe hinuntereilte und auf sie zulief. Katie konnte mit Anita nicht viel anfangen, doch sie zwang sich zu einem Lächeln, denn Rows Wirkung auf die Mädchen amüsierte sie immer wieder. Row sah unglaublich gut aus, selbst Katie war das bewusst; manchmal fiel es ihr auf, wenn sie Row einmal nicht nur als guten Freund betrachtete. Er hatte das Gesicht eines Engels: hohe Wangenknochen über einem schmalen Gesicht und einen breiten, sinnlichen Mund. Sein braunes Haar war beinahe schwarz und fiel ihm über die Stirn in die schwarzen Augen. Sein Aussehen und seine Ausstrahlung zogen nicht nur Mädchen an. Mehr als einmal hatte Katie erlebt, wie auch ältere Frauen mit ihm flirteten, manchmal auch ältere Männer.
»Hallo, Anita«, begrüßte Row sie. »Wir haben es etwas eilig, wir sehen uns dann in der Schule.«
Katie unterdrückte ein Grinsen, als sie weitergingen und Anita sichtlich enttäuscht zurückblieb. Row stieß ihr den Ellbogen in die Rippen, und sie warf ihm ein breites Lächeln zu. Row wusste, was er den Frauen antat; für ihn war es ein Spiel. Katie war eigentümlich stolz auf seine Aufmerksamkeit ihr gegenüber, ein Gefühl, das sie nicht vollständig verstand. Sie und Row hatten die körperliche Anziehungskraft einfach übersprungen und waren gleich zu etwas Besserem und Stärkerem übergegangen als Sex: Freundschaft, eng und loyal, ganz anders als die Freundschaften, die Katie bei gleichaltrigen Mädchen miterlebte, die nur an Klatsch und Tratsch und Verrat interessiert zu sein schienen. Bis auf ein paar ungeschickte Küsse und Berührungen mit Brian Lord hatte Katie noch keine Erfahrung mit Sex, doch sie war sich sicher, dass er ihrer Freundschaft mit Row nur schaden würde.
Vor seinem Haus blieb Row stehen und betrachtete voller Abscheu die Tür, in der seine Mutter auf ihn wartete. Im Gegensatz zu ihrem beliebten Sohn mochte Mrs. Finn niemand. Sie war nervös und weinerlich und sagte immer das Falsche. In ihren Augen war Row perfekt, doch für diese Loyalität liebte er sie nicht; hauptsächlich schien er ihr verächtliche Gleichgültigkeit entgegenzubringen.
»Willst du nicht reingehen?«, fragte Katie.
Row grinste reuig und senkte die Stimme. »Manchmal will ich einfach nur ausziehen, verstehst du? Mir mein eigenes Haus bauen, auf der anderen Seite der Stadt … außer dass sie mich dort wahrscheinlich auch nicht in Ruhe lassen würde.«
Katie schwieg, gab ihm im Stillen aber recht. Rows Vater war einer der engsten Freunde von William Tear gewesen, doch Mr. Finn war kurz nach der Landung gestorben, und Mrs. Finn klammerte sich mit einer Verzweiflung an ihren Sohn, die geradezu peinlich war. Mrs. Finns Beispiel zeigte Katie immer wieder, was sie an ihrer eigenen Mutter hatte, mit der zwar nicht zu spaßen war, die aber immer gerecht und eine der am meisten respektierten Frauen der Stadt war. Mum gestand Katie sehr wenig Spielraum zu, doch sie erstickte sie auch nicht oder brachte sie vor anderen Menschen in Verlegenheit.
»Wir könnten wegrennen«, schlug Katie schließlich vor. »Einfach auf die Ebene rennen und dort unser Lager aufschlagen. Sie würde uns dort nie finden.«
»Ach, Rapunzel.« Row legte ihr eine Hand an die Wange, und Katie lächelte unwillkürlich. Bei ihrer ersten Begegnung hatte sie hinter der Schule geweint, weil Brian Lord sie fest an den Haaren gezogen hatte und sie nach der Pause nicht wieder hineingehen wollte, weil dort Brian sein würde – er saß direkt hinter ihr und zog sie dauernd an den Haaren. Mrs. Warren hatte ihn bereits deswegen geschimpft, doch er wartete nur, bis sie sich abwandte, dann tat er es wieder. Diese Grausamkeit und Ungerechtigkeit hatte die sechsjährige Katie zum Weinen gebracht, und sie überlegte gerade, sich ihre Haare so kurz wie Tante Maddy schneiden zu lassen, als Row sich neben sie an die Schulhauswand setzte. Katie hatte bisher immer Angst vor ihm gehabt, er war nämlich schon in der dritten Klasse, doch er hörte ihr aufmerksam zu, untersuchte ihren Kopf und erzählte ihr dann die Geschichte von Rapunzel, deren langes Haar ihr die Flucht aus ihrem Gefängnis ermöglicht hatte.
Wenn so etwas doch nur möglich wäre, dachte Katie ungeduldig.
»Row!« Mrs. Finn war auf die Veranda herausgetreten. Sie war eine hagere Frau mit großen, flehenden Augen, die Mundwinkel ständig missmutig herabgezogen. Katie hatte eigentlich daran gedacht, sich zum Abendessen einzuladen, doch jetzt beschloss sie, lieber nach Hause zu gehen.
»Row, komm jetzt rein!«
»Meine Mutter würde uns wahrscheinlich nicht finden«, sagte Row. »Deine aber schon.«
»Das stimmt. Mum ist wie ein Bluthund.«
»Row!«, rief Mrs. Finn erneut. »Wo warst du denn nur?«
Row lächelte ergeben und ging in Richtung Veranda. Katie setzte ihren Weg den Hügel hinauf fort, auf dessen Spitze sie wohnte, direkt neben William Tear. Sein Haus war von Mums und Maddy Freemans flankiert und somit gut geschützt. Niemand in der Stadt wollte sich mit einem von ihnen anlegen.
»Katie!« Mrs. Gannett rief von ihrer Veranda aus nach ihr. Katie wäre am liebsten weitergelaufen, da Mrs. Gannett eine alte Klatschtante war, doch das hätte Mum erfahren. Daher blieb sie stehen und winkte.
»Er ist bei euch zu Hause«, erzählte Mrs. Gannett ihr.
»Wer?«
»Du weißt schon.« Mrs. Gannett flüsterte beinahe. »Er. Tear.«
Mit Mühe unterdrückte Katie ein Augenrollen. Sie wusste, dass sie Tear wie alle anderen verehren sollte, doch wenn sie hörte, wie jemand seinen Namen mit diesem ehrfürchtigen Ton aussprach, würde sie am liebsten über ihn herziehen und allen zeigen, dass er gar nicht so großartig war. Doch das wagte sie nicht. Er hatte so etwas an sich, vielleicht war es der durchdringende Blick aus seinen grauen Augen, mit dem er sie bedachte. Diese Augen machten ihr Angst. Sie schienen bis in ihr tiefstes Inneres blicken und Dinge sehen zu können, die keiner wissen durfte. Sie vermied es, direkt mit ihm zu sprechen.
Sie mochte jedoch Lily, Tears Frau – nicht Ehefrau, wie sie sich gleich in Erinnerung rief; William Tear und Lily waren nicht verheiratet. Aber jeder mochte Lily. Sie war eine der wenigen echten Frauen, die Katie kannte, doch sie spürte, dass Lilys Ehrlichkeit hart erkämpft war, denn sie hatte auch etwas Trauriges an sich, eine Melancholie, die von Zeit zu Zeit sichtbar wurde, wenn Lily sich unbeobachtet fühlte. Sah William Tear es auch? Doch, das musste er, er schien ja alles zu sehen.
Die Sonne begann gerade unterzugehen, als sie die Anhöhe erklommen hatte, doch alle Lampen brannten bereits, das Kerzenlicht flackerte sanft im sanften Abendwind. Auch diesen Beruf könnte Katie lernen: Kerzenzieherin. Sie wollte auf keinen Fall mit den Bienenstöcken der Stadt arbeiten, doch Mum hatte ihr versichert, dass sie als Kerzenzieherin nur mit dem Wachs arbeiten würde, nicht mit den Bienen. Katie wusste nicht, warum sie heute so viel über ihren zukünftigen Beruf nachdachte; es würde noch Monate dauern, bis sie sich entschieden haben musste. Vielleicht weil sie dann endlich älter wäre. Sie wollte nicht mehr jung sein.
»Katie!«
Als sie aufblickte, sah sie Mum auf der Veranda, die Hände in die Hüften gestützt. Die Haare hatte sie zu einem unordentlichen Knoten zusammengebunden, auf ihrem Hemd prangten Flecken, die nach Eintopf aussahen. An manchen Tagen trieb sie Katie in den Wahnsinn, doch dann liebte sie ihre Mutter wieder heiß und innig, die so starrköpfig war, dass sie beim Kochen nicht einmal eine Schürze tragen wollte.
»Beeil dich, Schatz«, sagte sie, umarmte Katie und scheuchte sie ins Haus. »Wir haben Besuch.«
Als Katies Augen sich an das Kerzenlicht im Wohnzimmer gewöhnt hatten, erkannte sie William Tear und Tante Maddy beim Kamin, die leise miteinander sprachen.
»Katie, mein Mädchen«, sagte Tante Maddy, als sie sich umdrehte. »Wie geht es dir?«
Katie umarmte sie erfreut; auch wenn Maddy Freeman nicht ihre echte Tante war, liebte sie sie beinahe so sehr wie Mum. Mit Tante Maddy konnte man Spaß haben; sie wusste immer ein schönes Spiel oder wie man einen verregneten Nachmittag im Haus verbringen konnte. Doch sie konnte auch gut zuhören. Tante Maddy hatte Katie alles über Sex erklärt, als sie neun Jahre alt war, zwei Jahre bevor Mrs. Warren das Thema in der Schule behandelte, und lange Zeit, bevor Katie mit ihrer Mutter darüber sprechen konnte.
Tante Maddys Umarmung erdrückte sie beinahe. Sie war stark genug, um auf der Farm zu arbeiten oder bei den Tieren, doch ihre Aufgabe war es, William Tear zu beraten. Mum, Tante Maddy, Evan Alcott … Mindestens zwei von ihnen begleiteten Tear überallhin, und trotz ihrer gemischten Gefühle dem Mann gegenüber war Katie stolz, wenn sie Mum oder Tante Maddy an seiner Seite sah.
»Katie, lass uns bitte in den Garten gehen«, bat Tante Maddy, und Katie folgte ihr gehorsam, wobei sie sich fragte, ob sie in Schwierigkeiten steckte. Tante Maddy hatte keine eigenen Kinder, um die sie sich sorgen könnte, weshalb sie Katie für deren Geschmack viel zu sehr im Auge behielt.
Der Garten erstreckte sich weit und wurde nur durch einen einfachen Holzzaun geschützt, der den Hund der Caddells fernhalten sollte. Die Sonne stand tief über den Häusern, ein blendend heller, orangefarbener Ball, der gerade den Horizont berührte. Katie hörte noch die Rufe der Nachbarskinder, doch diese würden bald verstummen. Die Stadt war nachts immer totenstill.
Tante Maddy ließ sich auf der breiten Holzbank unter dem Apfelbaum nieder und klopfte auf den Platz neben sich.
»Setz dich, Katie.«
Mit wachsender Unruhe gehorchte sie. Sie benahm sich nur selten daneben, doch wenn, dann erwischte normalerweise Tante Maddy sie.
»Nächstes Jahr beginnt deine Ausbildung«, meinte Tante Maddy beiläufig.
Aha, ein Gespräch über ihre Zukunft, nicht die Vergangenheit. Katie entspannte sich und nickte.
»Hast du schon eine Ahnung, was du machen möchtest?«
»Am liebsten würde ich in der Bibliothek arbeiten, aber Mum sagt, das will jeder, sodass man eigentlich keine Chance hat.«
»Das stimmt. Ms. Ziv hat mehr Helfer, als sie beschäftigen kann. Was wäre deine zweite Wahl?«
»Irgendwas, schätze ich mal.«
»Es ist dir egal?«
Katie sah auf und erkannte zu ihrer Erleichterung, dass sie nicht mit Tante Maddy, der Erzieherin, sprach. Es gab nämlich zwei Tante Maddys, und gerade saß die mitfühlende neben ihr, die Katie geholfen hatte, ein bei einer Rauferei ruiniertes Kleid zu verstecken, als sie sieben Jahre alt gewesen war.
»Mich interessiert einfach nicht viel«, gab Katie zu. »Ich weiß, dass ich einige Ausbildungen hassen würde, wie die Imkerei. Doch auch die anderen wären mir egal.«
Plötzlich lächelte Tante Maddy. »Ich wüsste da eine Ausbildung für dich, Katie, mein Mädchen, die dir sicher gefallen würde. Deine Mutter hat sich einverstanden erklärt, doch es muss unter uns bleiben.«
»Um was handelt es sich?«
»Du darfst es niemandem erzählen.«
»Nicht einmal Row?«
»Vor allem ihm nicht«, erwiderte Tante Maddy todernst, und Katies Widerrede erstarb auf ihren Lippen.
»Ich kann durchaus ein Geheimnis bewahren«, sagte sie stattdessen.
»Gut.« Tante Maddy wählte ihre Worte mit Bedacht. »Als wir den Ozean überquerten, haben wir alle Waffen zurückgelassen und damit auch die Möglichkeit, uns gegen Gewalt zur Wehr zu setzen. Wir glaubten nicht, dass wir hier so etwas benötigen würden. Du hast von Waffen gelesen, nicht wahr?«
Katie nickte langsam und dachte dabei an das Buch neben ihrem Bett, in dem sich Männer gegenseitig mit Pistolen erschossen. In der Stadt gab es keine Pistolen, nur Messer und Pfeil und Bogen, die aber nur zum Jagen und zum Handeln verwendet wurden. Es war sogar verboten, ein Messer offen auf der Straße zu tragen.
»Vor der Überfahrt wurden deine Mutter und ich an Waffen ausgebildet«, erzählte Tante Maddy leise, den Blick in die Ferne gerichtet. »Wir hatten Pistolen, doch wir brauchten sie nicht. Wir haben gelernt, mit unseren Händen zu töten.«
»Menschen zu töten?« Katie blinzelte fassungslos. In den Büchern passierte so etwas ständig, doch das waren nur Geschichten. Sie versuchte sich vergeblich vorzustellen, wie Tante Maddy oder Mum jemanden umbrachten. Ihres Wissens nach war bisher erst ein Bewohner der Stadt durch Gewalt gestorben, den ein Wolf vor Jahren auf der Ebene gerissen hatte. Bei der Versammlung hatte man darüber gestritten, doch Katie war damals zu jung gewesen, um alles zu verstehen. Manche hatten gefordert, Wachposten am Stadtrand aufzustellen, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet waren. Solche Entscheidungen wurden immer demokratisch getroffen, doch William Tear hatte sich gegen den Antrag ausgesprochen, und wenn er etwas ablehnte, dann war daran nichts mehr zu ändern. Katie blickte auf Tante Maddys Hände, dann ihre muskulösen Arme, die von Narben übersät waren.
»Lässt du William Tear deshalb nie allein?«, fragte sie. »Falls du jemanden töten musst?«
Dieses Mal blinzelte Tante Maddy überrascht. »Natürlich nicht. Wir sind bei ihm, falls er etwas braucht.«
Gerade hatte sie gelogen, dachte Katie. Sie war deshalb nicht verletzt; Erwachsene logen die ganze Zeit, aus genauso albernen Gründen wie Kinder. Doch es war seltsam, dass Tante Maddy bei diesem Gespräch, das bisher so überraschend ehrlich gewesen war, sich in diesem Punkt für eine Lüge entschieden hatte.
»Wir wollen früh mit deiner Ausbildung beginnen, Katie. Nächsten Monat schon. Wie deine Mutter und ich sollst du lernen, wie man sich der Gewalt entgegenstellen kann, sollte sie uns begegnen.«
»Warum? Was für eine Gewalt?«
Tante Maddys Gesicht wurde verschlossen, ihre Augen zeigten kein Gefühl mehr.
»Wahrscheinlich gar keine, Katie. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.«
Noch eine Lüge, und jetzt regte sich Ärger in Katie wie ein Tier auf der Lauer.
»Hat es etwas mit dem Friedhof zu tun?«, fragte sie, als sie an die aufgewühlten Gräber dachte, deren Inhalt überall verstreut gelegen hatte. Man hatte ein Tier dafür verantwortlich gemacht, doch insgeheim hatte Katie das in Frage gestellt. Hätten Tiere nicht wahllos alles aufgegraben? Hier waren aber nur drei oder vier bestimmte Gräber betroffen gewesen.
»Nein«, erwiderte Tante Maddy. »Doch es gibt vielleicht andere Gefahren. Betrachte es als Vorsichtsmaßnahme.«
»Werde nur ich ausgebildet?«, fragte Katie und dachte dabei an ihre Körpergröße. Sie war nicht klein, aber auch nicht groß, und sie war schlank. Wenn sie sich mit bloßen Händen gegen einen Mann wehren müsste, wäre sie auch mit guter Ausbildung wahrscheinlich unterlegen.
»Nein. Wir haben einige von euch Jugendlichen ausgewählt. Deine Freundin Virginia. Gavin Murphy. Jonathan Tear. Lear Williams. Jess Alcott. Und noch ein paar andere.«
»Aber Row nicht?«
»Nein, Rowland Finn wird nicht dazugehören, und er darf auch nichts davon wissen.«
Wieder spürte Katie den Ärger in sich aufsteigen. Row war so talentiert, warum konnten das die Erwachsenen nicht wenigstens einmal zur Kenntnis nehmen? Die mangelnde Anerkennung verletzte ihn, auch wenn er es so gut wie möglich verbarg, und Katie empfand diese Verletzung, als wäre es ihre eigene.
»Willst du es machen?«, fragte Tante Maddy.
Katie schluckte und versuchte, das Tier in sich zu zähmen. Sie wollte es wirklich, aber das bedeutete auch, ein Geheimnis vor Row zu haben. Könnte sie das? Zwischen ihnen gab es keine Geheimnisse. Row wusste alles von ihr.
»Kann ich darüber nachdenken?«
»Nein«, sagte Tante Maddy freundlich, aber unerbittlich. »Du musst dich jetzt entscheiden.«
Katie starrte zu Boden, konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Sie wollte es wirklich. Sie hatte zwar noch nie etwas vor Row verheimlicht, doch sie glaubte, es dieses eine Mal tun zu können. Von diesem Geheimnis wollte sie ein Teil sein.
»Ich bin dabei.«
Tante Maddy lächelte, dann deutete sie mit dem Finger Richtung Haus. Katie drehte sich um und sah, wie William Tear auf sie zukam. Ohne nachzudenken, sprang sie auf und stellte sich vor die Bank. Tante Maddy drückte ihre Schulter und entfernte sich, doch das bemerkte Katie kaum. Sie konnte sich nur an eine andere Gelegenheit erinnern, bei der sie allein mit William Tear gewesen war, letztes Jahr beim Abendessen, als sie beide gleichzeitig in die Küche gegangen waren. Katie hatte schweigend dagestanden, wie erstarrt, und war froh gewesen, als er mit seinem Teller wieder zurück an den Tisch gegangen war. Jetzt fühlte sie sich genauso.
»Du musst keine Angst haben, Katie.« Tear setzte sich auf Tante Maddys Platz auf die Bank. »Du bist nicht in Schwierigkeiten. Ich will nur mit dir reden.«
Katie nickte und setzte sich wieder, auch wenn sie ihr Bein wegen eines zuckenden Muskels kaum stillhalten konnte.
»Möchtest du diese Ausbildung machen?«
»Ja.« Irritierenderweise wollte Katie noch viel mehr sagen: dass sie ein Geheimnis bewahren konnte, dass sie eine gute Kämpferin wäre und nichts tun würde, um der Stadt zu schaden.
»Ich weiß«, sagte Tear. Katie zuckte überrascht zusammen. »Unter anderem aus diesem Grund haben wir dich ausgewählt. Es geht nicht nur um Messer und Kämpfe, Katie. Ohne Vertrauen ist das beste Training der Welt nichts wert. Ich beobachte dich schon seit Jahren. Du hast eine Gabe, die wir alle bemerkt haben, eine Gabe, hinter die Dinge zu blicken. Die Stadt wird es brauchen, und ich werde nicht immer hier sein.«
Katie sah ihn verwundert an. Sie hatte sich nie viele Gedanken über Tears Alter gemacht, im Gegensatz zu den anderen Erwachsenen in der Stadt. Tear musste mindestens fünfzig sein, doch das war nur eine Zahl; Tear war weder alt noch jung, er war einfach da. Doch seine Worte waren unmissverständlich.
»Sind Sie krank, Sir?«
»Nein.« Tear lächelte. »Mir bleiben noch viele Jahre, Katie. Ich bin nur vorsichtig. Da wäre außerdem noch etwas.«
Er griff unter seinen Wollpullover und zog einen kleinen Beutel hervor, der von einem Streifen Hirschhaut zusammengehalten wurde. Katie war dieser Beutel bisher noch nie aufgefallen, und sie beobachtete aufmerksam, wie Tear ihn aufzog und auf seine Handfläche entleerte: ein glitzernder, tiefblauer Edelstein – ein Saphir, vermutete Katie –, der in der untergehenden Sonne reflektierte. Viele Menschen in der Stadt besaßen Schmuck, den sie bei der Überfahrt mitgebracht hatten, doch Katie hatte einen Stein von dieser Größe noch nie gesehen. Tear hielt ihn ihr hin, doch einen Moment lang konnte sie ihn nur sprachlos ansehen.
»Na los, nimm ihn.«
Sie gehorchte und stellte fest, dass der Stein warm war. Wahrscheinlich von Tears Brust, doch Katie schien es seltsamerweise, als sei der Saphir lebendig, würde beinahe schon atmen.
»Ich möchte, dass du mir etwas versprichst, Katie. Doch sei gewarnt, es ist ein wichtiges Versprechen, das du nicht auf die leichte Schulter nehmen darfst. Dieser Stein lässt die Leute ihre Lügen bereuen.«
Katie schloss die Finger um den Saphir und spürte seine Hitze. Das Blut pulsierte schneller durch ihre Adern. Als sie aufblickte, bemerkte sie etwas Erschreckendes: Eine Träne rann über Tears Wange nach unten, die so überhaupt nicht zu der Welt passte, die Katie bisher gekannt hatte.
»Versprich mir, Katie, dass du immer das Beste für diese Stadt tun wirst.«
Katie ließ erleichtert die Schultern sinken, denn dieses Versprechen fiel ihr leicht. Doch Tear war es offensichtlich so wichtig, dass sie sich zwang, langsam und bedächtig zu sprechen.
»Ich verspreche zu tun, was am besten für diese Stadt ist.« Und da dies noch nicht genug zu sein schien, fuhr sie fort: »Wenn jemals jemand versuchen sollte, der Stadt Schaden zuzufügen, würde ich ihn aufhalten. Ich würde … ihn töten.«
Tear zog die Augenbrauen hoch. »Ein wildes Tier. Das hat deine Mutter schon gesagt. Doch jetzt reden wir nicht mehr übers Töten, nicht wahr?« Er streckte die Hand aus, und Katie ließ den Saphir hineinfallen. »Ich hoffe, dass es niemals zu solcher Gewalt kommen wird. An diesem Ort soll nicht getötet werden.«
»Sir, darf ich Ihnen eine Frage stellen.«
»Aber natürlich.«
Katie nahm ihren ganzen Mut zusammen. »Sie haben manchmal Visionen. Das sagen alle.«
»Ja, das stimmt.«
»Wenn der Stadt Gefahr drohen sollte … von wem? Wissen Sie das?«
Tear schüttelte den Kopf. »Meine Visionen sind oft nur wenig mehr als Schatten, Katie. Vielleicht ist es auch gar nichts.«
»Aber Sie glauben das nicht.«
»Nein. Auch wenn ich nur Schatten sehe, sind sie normalerweise wahr.« Er hielt den Stein in die Höhe und ließ das letzte Sonnenlicht hindurchscheinen. »Dieser Saphir hat große Macht, doch mit Einschränkungen. Er funktioniert nicht auf Befehl. Ich kann ihn benutzen, aber nicht kontrollieren.«
»Woher haben Sie ihn? Noch aus der alten Welt?«
»Ja und Nein.«
Verwirrt sah sie den Mann neben sich an.
»Irgendwann erzähle ich dir vielleicht die Geschichte, Katie. Doch für heute sei dir bewusst, dass du ein wichtiges Versprechen gegeben hast. Wir beginnen nächste Woche, und bis dahin darfst du mit niemandem darüber sprechen, nicht einmal mit deinen Freunden. Wir haben noch nicht alle informiert.«
»Kann ich mit Mum darüber reden?«
»Natürlich. Aber sonst mit niemandem.«
Sie zögerte, wollte nach Row fragen, warum er nicht beteiligt war. Row war sicher der klügste Teenager der Stadt, vielleicht bis auf Jonathan Tear … Tante Maddy hatte auch ihn erwähnt, erinnerte sich Katie. Er war nur ein Jahr älter als sie, doch drei Jahre über ihr in der Schule und viel erwachsener als seine Altersgenossen. Jonathan begleitete seine Eltern nie, wenn diese zum Abendessen herüberkamen, und obwohl er nebenan wohnte, sah Katie ihn kaum. Er war Furcht erregend intelligent. Katie hatte gehört, dass man extra für ihn eine spezielle Klasse mit höherer Mathematik einrichten musste, selbst nachdem er schon einige Schuljahre übersprungen hatte. Doch er hatte keine Freunde, und in der Schule war er ein Außenseiter. Niemand schikanierte ihn, weil er William Tears Sohn war, aber er war eindeutig anders als die anderen. Row wäre doch sicher auch keine überraschendere Wahl.
»Katie?«
Sie drehte sich um und sah, dass Tear sie mitfühlend anlächelte, als ob er ihre Verwirrung erkannt hätte. Der Edelstein war mitsamt dem kleinen Beutel wieder unter dem Pullover verschwunden, doch Katie nahm es kaum wahr. Sie war gebannt von Tears Augen, die weder grau noch hellgrau waren, sondern hell und durchsichtig, fast silbern in der untergehenden Sonne.
»Du musst keine Angst mehr vor mir haben«, sagte er. »In Ordnung?«
Katie nickte und erwiderte das Lächeln. Sie dachte an all ihre abfälligen Gedanken über Tear und seine Speichellecker und schämte sich plötzlich. Er war ein wahrhaft guter Mann. Einen Moment lang spürte Katie seine Güte so stark, als wären sie mit einem Seil miteinander verbunden. Plötzlich verstand sie, warum Mum diesem Mann über den Ozean gefolgt war.
Er will für alle nur das Beste, dachte sie. Hinter all dem Gerede und der Heldenverehrung ist das die Wahrheit. Ich wünschte, ich könnte es Row erzählen.
»Danke«, sagte Tear, und Katie wusste, dass sie diesen Moment niemals vergessen würde: der große Mann, der ihr zulächelte, der Fluss, der sich unter ihnen durch die Landschaft wand, die letzten Reste der blutroten Sonne über ihnen. Diesmal erwiderte sie das Lächeln nicht, wusste instinktiv, dass es diesem gewichtigen Moment nicht angemessen wäre.
»Lass uns hineingehen.«
Sie ging neben ihm, horchte auf das Geräusch ihrer Schritte auf dem dünnen, harten Gras, doch ihre Gedanken waren woanders. Tear hatte recht; ihr Vorhaben musste ein Geheimnis bleiben. Kämpfen und Waffen … das war so entgegen allen Regeln der Stadt, dass Katie sich nicht einmal vorstellen konnte, was passierte, sollte es bekannt werden. Virginia Warren, Lear Williams, Gavin Murphy, Jess Alcott, Jonathan Tear, sie selbst und noch ein paar andere. Jedoch nicht Row.
Warum nicht?, fragte sie sich und warf einen Blick auf Tears lange Beine, seine dicken Wollschuhe. Was weiß er, das ich nicht weiß?
Mum lehnte an der Wand vor der Küchentür, die Hände hinter dem Rücken und wartete auf sie.
»Erledigt«, sagte Tear und legte Mum eine Hand auf die Schulter. »Wirklich eine Wildkatze, Dori. Ganz wie die Mutter.«
Er ging ins Haus, und Katie sah Mum abwartend an. Ihr Verhalten war unvorhersehbar; manchmal ging sie überraschend rational mit Katies Fehlern um, manchmal brachten sie allerdings auch die seltsamsten Dinge aus dem Gleichgewicht. Jetzt lächelte sie, ihre Augen blickten jedoch wachsam.
»Caitlyn Rice, du hast noch nie in deinem Leben ein Geheimnis bewahren müssen, das so wichtig wie dieses ist.«
»Ich weiß.« Katie überlegte einen Moment und platzte dann schließlich heraus: »Mum, Row ist so klug! Warum hat man ihn nicht auch ausgewählt?«
»Ah.« Mum suchte nach Worten. »Row ist … ein unberechenbarer Junge.«
»Was meinst du damit?«
»Nichts. Komm rein und deck den Tisch.«
Katie folgte ihr schweigend, immer noch über diese Bemerkung nachdenkend. Row hatte eine schadenfrohe Seite, das wusste sie; er mochte es, andere Menschen zu verwirren. Doch darin lag nichts Boshaftes, bisher hatten sie immer über seine Streiche lachen können. Eigentlich müsste sie an seiner Stelle Ärger empfinden, doch da war nur Traurigkeit. Nur sie sah Rows echten Wert, und einem Teil von ihr gefiel das; es war wie ein gemeinsames Geheimnis. Doch in diesem Moment hätte sie all diese sorgfältig gehütete Vertrautheit weggegeben, damit der Rest der Stadt ihn ebenso deutlich sah. Und wie sollte sie das alles überhaupt vor ihm verbergen? Eine Ausbildung erforderte viel Zeit. Wie sollte sie verhindern, dass Row es herausfand?
Tear wird sich darum kümmern.
Die Stimme ertönte tief in ihrem Innern und klang verwirrend erwachsen, doch Katie wusste, dass sie recht hatte. Tear würde sich tatsächlich darum kümmern. Nicht nur ein Geheimnis wurde hier bewahrt; sondern noch viele mehr, die sich kreisförmig auf der täuschend glatten Oberfläche der Stadt ausbreiteten. Sie dachte an den riesigen Saphir und schauderte. Sie hatte versprochen, die Stadt zu beschützen, und damit war es ihr ernst, doch in ihr tobte ihre andere Seite, die sich nicht mehr um andere kümmern wollte, nur noch um sich selbst.
Ich kann beides, beharrte sie, aber es klang verzweifelt, als ob etwas in ihr selbst wusste, dass sie eines Tages würde wählen müssen.
Kelsea erwachte mit einem Ruck, umgeben von Dunkelheit. Undeutlich sah sie ihren Bewacher, doch sein sanft im Takt mit dem fahrenden Wagen schaukelnder Kopf sagte ihr, dass er schlief. Der Himmel über ihr war tiefschwarz. Kelsea dachte, dass der Morgen bald anbrechen müsste, doch noch war davon nichts zu sehen.
Ich habe es gesehen.
Licht leuchtete plötzlich über dem Wagen auf. Kelsea sah eine kunstvoll geschmiedete Straßenlampe über sich. Gleichzeitig erkannte sie, dass das Holpern von einem sanften Dahinrollen abgelöst worden war. Offensichtlich befanden sie sich wieder auf einer Art Straße. Die Nachtluft war eiskalt, und Kelsea zog ihren Umhang enger um den Oberkörper. Eine weitere Straßenlampe warf ihr Licht auf den Wagen, als sie darunter hindurchfuhren. Kelsea sollte sich aufsetzen, ihre Umgebung erforschen, doch sie lag nur unbeweglich da.
»Ich habe es gesehen«, sagte sie leise, als ob die Worte es real werden ließen. »Ich habe es gesehen.«
Instinktiv legte sie suchend die Hand auf die Brust, doch natürlich waren die Steine nicht mehr da, schon lange nicht mehr. Aber wenn Kelsea die Augen schloss, sah sie alles vor sich: die Stadt, den Wald, den Caddell, die Almontebene in der Ferne. Wie war das möglich? Selbst Lilys Welt war nie so klar und deutlich gewesen.
Sie ist nicht Lily.
Nein, sie sah durch die Augen eines anderen Menschen, eines jungen Mädchens, das in Tearling heranwuchs, lange bevor das Königreich überhaupt so hieß. Ihre Mutter war Dorian Rice, die sich mit einer Kugel im Bauch in Lily Mayhews Garten geflüchtet hatte. Das Mädchen hieß Katie Rice. Jahre waren seit der Überfahrt vergangen, Jonathan Tear war erst fünfzehn Jahre alt. Kelseas Herz schmerzte, denn sie wusste, dass der Junge nur fünf oder sechs Jahre später ermordet werden und William Tears Utopie ins Chaos stürzen würde.
So wenig Zeit. Wie konnte alles so schnell auseinanderfallen?
Ein Rätsel ohne Lösung, außer Kelsea könnte zurück in die Vergangenheit reisen und selbst nach Antworten suchen. Doch aus eigener bitterer Erfahrung wusste sie, dass diese kleinen Ausflüge einen schrecklichen Preis hatten.
Andererseits bist du gerade ja auch mit nichts anderem beschäftigt.
Kelsea lächelte müde bei diesem Gedanken, dessen Pragmatismus sie an Mace erinnerte. Von diesem Wagen aus konnte sie wirklich kaum etwas tun. Die Kavallerie hatte gestern die Grenze und den Argivepass überquert und die restliche Mortarmee hinter sich gelassen. Sie wusste nicht, ob die Rote Königin bei ihren Männern geblieben oder in die Nacht vorausgeritten war. Kelsea blickte in den Himmel hinauf, der sich gerade ein wenig aufhellte. Einen Moment lang vermisste sie ihr Land so sehr, dass sie beinahe wieder geweint hätte. Sie hatte Tearling in Mace’ Hände übergeben, ja, und das war ein Trost. Doch sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ihr Königreich in größten Schwierigkeiten steckte.
Eine weitere Lampe zog über ihr vorbei und schaukelte sanft in der morgendlichen Brise. Selbst diese Kleinigkeit in Mortmesne ärgerte Kelsea. Straßenlampen mussten nachts entzündet und morgens gelöscht werden, oder man verschwendete zu viel Öl. Wer kam denn in dieses Nirgendwo und kümmerte sich um die vielen Lampen? Wieder trauerte Kelsea um die verlorenen Saphire, denn die Lampen schienen ihre eigene wertvolle Lektion zu erteilen: Angst förderte Effizienz.
Nicht verloren.
Kelsea zuckte überrascht zusammen, denn die Stimme in ihrem Innern war unmissverständlich Lilys. Es stimmte, die Steine waren nicht völlig verloren. Sie befanden sich jedoch im Besitz der Roten Königin, konnten also genauso gut auf dem Mond sein. Die Rote Königin konnte sie sich nicht zunutze machen, Kelsea aber auch nicht.
Warum kann sie sie nicht benutzen? Lilys Stimme kam aus weiter Ferne, ertönte tief in Kelsea, war voller Dringlichkeit. Denk nach, Kelsea. Warum kann sie sie nicht benutzen?
Kelsea dachte angestrengt nach. Row Finn hatte etwas von Tearblut gesagt, doch beim Versuch, sich an seine exakten Worte zu erinnern, schmerzte ihr Kopf. Die Rote Königin hatte Tearblut in sich, hatte Finn gesagt, aber Kelseas war stärker. Sie hatte die Saphire weggegeben, wie konnte sie dann immer noch in die Vergangenheit sehen? Plötzlich erinnerte sie sich an einen Traum von vor einer Woche: die Überfahrt, die Schiffe und der dunkle Himmel mit der strahlenden Öffnung am Horizont. William Tear hatte eine Tür durch die Zeit geschaffen, und auf ihre eigene begrenzte Weise hatte Kelsea dasselbe getan, eine Öffnung in die Vergangenheit geschaffen. War es möglich, dass dieses Fenster immer noch offen war, selbst ohne die Saphire? Wenn die Überfahrt, die sie gesehen hatte, echt war, passte sie zu dem, was sich ihr jetzt gezeigt hatte: Lilys Schwester Maddy Freeman, viele Jahre älter, aber gesund und am Leben.
Je eher Kelsea von diesem Wagen herunterkam, desto besser. Während ihr Geist auf Wanderschaft war, hatte sie keine Kontrolle über sich, wie ihr Mace und Pen gesagt hatten. Sie rollte sich auf den Rücken, wobei sich Holzsplitter in ihren Umhang bohrten. Wenn sie William und Jonathan Tear nur irgendwie erreichen, ihnen von der stürmischen Zukunft berichten könnte, die Geschichte ändern, anstatt einfach nur zuzusehen …
Ein Totenschädel tauchte in ihrem Sichtfeld auf.
Kelsea zuckte hoch und schnappte nach Luft. Der Schädel war hoch über ihr auf einem Spieß zwischen den Lampen befestigt. Ein paar Fleischfetzen hingen noch am Kieferknochen. Die Augenhöhlen waren blutverkrustet und schwarz. Kurz darauf passierten sie die nächste Lampe und den nächsten Schädel. Dieser war sehr alt; Wind und Wetter und die Zeit hatten deutliche Spuren hinterlassen.
Nun, damit wäre zumindest eine Frage beantwortet. Sie befanden sich auf der Pike Straße, der Straße der aufgespießten Köpfe.
So leise wie möglich stand Kelsea auf, ihre Ketten in der Hand haltend, damit das Rasseln ihren Bewacher nicht weckte. Die Morgendämmerung brach herein, der Himmel im Osten färbte sich rosa, das Land selbst lag noch im Dunkeln, durchbrochen nur von der Straße mit den Lampen und den Schädeln. Der Weg führte leicht abwärts, doch in der Ferne konnte Kelsea sehen, dass er schließlich steil auf eine riesige Barriere zulief: eine hohe, hervorragend befestigte Mauer, ein schwarzes Bollwerk vor dem sich aufhellenden Himmel. Hinter der Mauer sah Kelsea die Dächer vieler Gebäude, außerdem eine weitläufige Anlage, mit Stacheln und kleinen Türmchen versehen, die alles überragte.
Demesne, dachte sie, und ihr Magen verkrampfte sich. Früher hatte es einmal Evanston geheißen, die Hauptstadt von Neueuropa, die Stadt auf dem Plateau, Stein für Stein von den Siedlern erbaut. Doch jetzt wirkte die Stadt wie aus einem Albtraum.
Kelsea setzte sich wieder, wobei sie ihren Bewacher im Auge behielt, der sich langsam regte. Sie hüllte sich eng in ihren Umhang und versuchte, Mut zu sammeln, doch dieser Brunnen schien ausgetrocknet zu sein. Sie befand sich auf ihrer eigenen Überfahrt, diese Reise war allerdings nicht mit William Tears zu vergleichen.
Diese Reise führte in die Finsternis.
Als Ducarte durch die Tür trat, ahnte die Königin die schlechten Nachrichten schon. Seit Tagen wartete sie auf seinen Bericht, versuchte, sich in Geduld zu üben – auch wenn das völlig gegen ihre Natur war –, weil sie wusste, dass Ducarte Zeit brauchte, um die Situation beurteilen zu können. Sie hatte ihn erst vor zwei Wochen von der Grenze nach Hause geschickt. Nach dem Zwischenfall mit dem Mädchen war er nicht mehr als Kommandant zu gebrauchen, da er völlig außer sich zu sein schien. Er zuckte bei lauten Geräuschen zusammen, und manchmal musste die Königin ihn zwei- oder dreimal ansprechen, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatte gehofft, dass die Rückkehr zu seinen alten Pflichten, auf die Stelle, die er geschaffen und zu seiner gemacht hatte, ihm helfen würde, zu sich selbst zurückzufinden. Doch sobald Ducarte den Thronsaal betrat, erkannte sie, dass sich nichts geändert hatte. Eher hatte sich sein Zustand noch verschlechtert. Was auch immer das Mädchen mit ihm angestellt hatte – sie war gründlich dabei vorgegangen. Hatte vielleicht sogar dauerhaften Schaden angerichtet. Ohne Ducarte wäre die Position der Königin noch geschwächter als bisher.
Eine Rebellion war im Anmarsch. Trotz ihrer Bemühungen um Diskretion hatte sich ihre Abwesenheit herumgesprochen, und der Anführer der Aufständischen, Levieux, hatte eine Belagerung von Cite Marche ausgerufen. Keiner der Schwachköpfe, denen sie die Verantwortung übertragen hatte, hatte auch nur die geringste Anstrengung unternommen, diesen Levieux aufzuhalten oder seine Identität aufzudecken. Ihre Armee war endlich aus Tearling zurückgekehrt, doch noch langsamer, als der Auszug vonstattengegangen war. Dieses gemächliche Tempo wirkte wie ein Verrat auf die Königin. Vor ihrer Abreise hatte sie Ducartes Stellvertreter General Vine explizite Anweisungen erteilt, dass jeder Mann, der in Tearling beim Plündern ertappt wurde, am nächsten Baum gehängt werden sollte. Doch vor General Vine zitterte keiner. Nur die Angst vor der Königin hielt die Soldaten noch im Zaum, und sie spürte, dass diese Furcht beständig abnahm. Ihre Leutnants und Generäle waren loyal, denn sie wussten, dass sie nach ihrer Rückkehr für ihren Anteil an den ausgefallenen Plünderungen entschädigt werden würden. Der Rest der Armee hingegen … Verflucht, sie brauchte Ducarte! Wie konnte er jetzt einfach so zusammenbrechen, wo sie ihn am wenigsten entbehren konnte?
Doch die Königin zeigte ihren Groll nicht. Selbst die Hälfte von Ducartes altem Können war immer noch mehr, als die meisten Männer zu leisten vermochten. Hinter ihm traten zwei Leutnants ein, die so klug waren, sich hinter Ducarte zu postieren und respektvoll zu Boden zu blicken.
»Was gibt es Neues, Benin?«
Ducarte warf seinen Umhang zurück und ließ sich auf den nächsten Stuhl sinken. Noch ein verstörender Anblick. Ducarte war früher lieber gestanden; heute schien er immer eine Stütze zu benötigen.
»Cite Marche versinkt im Chaos, Majestät. Letzte Woche ist ein Mob in die Lagerhäuser der Krone eingebrochen und hat alles mitgenommen, Nahrung, Glas, Stahl, Waffen. Die wachhabenden Soldaten sind verschwunden, ebenso wie Major Givene, und außer ihm hat niemand die Autorität, die Stadtmiliz zu mobilisieren.«
»Ich habe die Autorität.«
»Natürlich, Majestät, ich wollte damit nicht sagen …«
»Schickt die Miliz raus, und findet mein Eigentum.«
»Da könnte es ein Problem geben, Majestät. Wir haben ein paar Leute mit Glas oder Stahl erwischt, doch immer nur mit einem oder zwei Stücken. Dieser Rebellenbastard Levieux hat die Sachen bereits verteilt, und zwar offensichtlich über die gesamte Stadt. Die Nahrungsmittel sind sicher schon verbraucht, und wir müssten die halbe Bevölkerung festnehmen, um den Rest zurückzubekommen.«
»Er hat alles gestohlen, um es weiterzugeben?«
»Offensichtlich, Majestät.«
Die Königin schwieg, doch in ihr kochte die Wut. Nicht genug, dass sie ein Vermögen für eine Invasion ausgegeben hatte, die ihr nichts eingebracht hatte. Jetzt musste sie sich auch noch damit auseinandersetzen.
»Wenn Ihr Givene findet, hängt ihn an der Stadtmauer von Cite Marche auf.«
»Ja, Majestät.« Ducarte zögerte einen Moment, dann fragte er: »Seinen Kopf?«
»Den ganzen Mann!«, brüllte sie. »Den ganzen Mann, Benin! Lebendig! Wenn sich die Krähen erst an ihm gütlich getan haben, werden wir schon sehen, was für ein Rebell er ist.«
»Zu Befehl, Majestät«, erwiderte Ducarte stumpf, und am liebsten wäre die Königin von ihrem Thron gesprungen und hätte ihn geschlagen. Vor beinahe zwanzig Jahren hatte Ducarte einmal einen Verräter aus Callae bei lebendigem Leib gehäutet, langsam und methodisch. Er hatte die Schreie des Mannes ignoriert und das Fleisch abgeschabt wie ein Künstler einen Lehmblock. Der alte Ducarte hätte sofort gewusst, was sie von ihm wollte. Die Königin atmete tief durch, während es in ihr gefährlich brodelte.
»Was ist mit Demesne?«
»Im Moment scheint es relativ ruhig zu sein, Majestät, doch das bleibt sicher nicht mehr lange so.«
»Warum nicht?«
»Ich habe einige meiner Spione aufs Land geschickt, Majestät, um die Wahrscheinlichkeit eines Sklavenaufstandes einzuschätzen. Aus dieser Richtung dürfte jedoch wenig Gefahr drohen.«
Die Königin nickte. Die Strafen für entflohene Sklaven waren immer ausreichend hoch gewesen, um als effektive Abschreckung zu dienen. »Aber?«
»Es herrscht eine seltsame Wanderbewegung, Majestät. Die Dörfer von Glace-Vert sind verlassen. Die Menschen nehmen alles, was sie tragen können, und ziehen in den Süden. Viele drängen sich schon in Cite Marche.«
»Warum?«
»Meine Leute waren zu weit verstreut, um ordentliche Nachforschungen anzustellen, Majestät. Sie konnten nur einige freiwillige Aussagen aufnehmen. Im Fairwitchgebirge gibt es einen alten Aberglauben …« Ducarte unterbrach sich und hustete leise. »Ein Wesen, das durch die Berge und Ausläufer streift und nach Kindern sucht …«
»Die Waise«, murmelte die Königin.
»Majestät?«
»Nichts. Ich weiß von diesem Aberglauben, Benin; er ist älter als ich. Was hat sich geändert?«
»Es gibt neue Berichte, Majestät, von Dörfern, die nicht nur von einem Wesen, sondern einer ganzen Armee angegriffen werden. Mein Spion in Devin’s Copse fand Blut und Knochen auf dem Boden der leeren Häuser. Meine Leute haben insgesamt acht verlassene Dörfer gefunden. Zwei meiner Spione werden seit über einer Woche vermisst.«
»Was wäre eine andere Erklärung dafür?«, fragte die Königin. Doch ihre Stimme klang hohl, denn die Frage war eigentlich überflüssig. Das dunkle Geschöpf war auf der Jagd. Das könnte sie Ducarte sagen, doch dann würde er nach einer Erklärung fragen, und was sollte sie ihm dann erzählen?
Vor langer Zeit floh ein verängstigtes junges Mädchen aus einem Dorf in Glace-Vert. Sie befand sich bereits im Exil und war nach Norden gezogen, um sich dort zu verstecken. Doch in den Dörfern von Glace-Vert fand sie keinen Schutz, nur Misshandlungen, weshalb sie lieber in den Bergen verhungern wollte. Sie war auf den Tod vorbereitet, doch eines Nachts sah sie ein flackerndes Feuer …
»Ich habe wie gesagt nicht die Kapazitäten, die Menschen zu befragen, aber ich kann Euch sagen, Majestät, dass sie von ihren Erzählungen überzeugt waren. Irgendetwas verrichtet sein blutiges Werk im Norden, und wenn es nach Süden zieht, wird das ganze Königreich bei Euch Schutz suchen.«
Die Königin lehnte sich zurück, das Blut pulsierte unangenehm in ihren Schläfen. Vor zwei Wochen war sie aus einem Albtraum erwacht, dem schlimmsten Albtraum ihres Lebens, in dem das dunkle Geschöpf sie durch die Korridore ihres Schlosses gejagt hatte, durch die gesamte neue Welt … und es war aus Fleisch und Blut gewesen, nicht mehr länger durch das Feuer gebunden.
Frei. Ob man es das dunkle Geschöpf nennt oder die Waise – und die armen Menschen im Fairwitchgebirge mussten es bei irgendeinem Namen nennen, um irgendetwas die Schuld am Verschwinden ihrer Kinder zu geben –, es konnte sich frei bewegen. Würde es auch in ihre Richtung kommen? Gab es daran überhaupt einen Zweifel?
Evie!
Die Stimme hallte in ihrem Kopf wider, doch die Königin drängte sie zurück, während sie traurig ihren ältesten und loyalsten Verbündeten musterte. Ducarte stützte die verschränkten Arme auf die Knie und starrte zu Boden. Er war noch nicht sechzig, doch er sah aus wie ein alter Mann, erschöpft und müde. Der alte General Ducarte, der Leiter der Internen Sicherheit, vor dem das ganze Königreich gezittert hatte, war tot, und die Königin trauerte um ihn. Ducarte hatte die Rebellion in Callae niedergeschlagen, hatte der Königin zu dem eisernen Griff um das Land verholfen. Doch jetzt war er gebrochen, und die Königin realisierte erst jetzt, dass es ihr mit Abstand schwerster Fehler gewesen sein könnte, Ducarte nach Tearling zu schicken. Ohne ihn konnte niemand sie beschützen, nicht einmal vor der Armee selbst.
War das nicht der einzige?, fragte sie sich panisch. Habe ich noch andere Fehler begangen? Und wenn ja, wie viele?
»Was wollt Ihr tun, Majestät?«
Die Königin trommelte mit den Fingern auf die Armlehne des Throns und fragte dann beinahe beiläufig: »Wo ist das Mädchen?«
Ducartes Ausdruck veränderte sich nicht, doch er wurde kaum merklich bleicher und schien blitzartig zu altern. Die Königin dachte auch nicht gern an das Mädchen; die Erinnerung an das Gespräch im Zelt war so schrecklich, dass sie sie in den hintersten Winkel ihres Geistes verbannt hatte. Das Mädchen wusste jetzt so viel …
Evie!
… so viele Dinge, die die Königin hatte mit ins Grab nehmen wollen.
»Man hat sie gestern hergebracht, Majestät. Sie ist im Kerker, sicher und wohlauf.«
Doch Ducarte schien nicht von seinen Worten überzeugt zu sein.
»Ich will, dass sie gut bewacht wird.«
»Fürchtet Ihr, sie könnte ausbrechen, Majestät?«
»Natürlich nicht. Ich mache mir Sorgen, dass sie sterben könnte. Eure Leute sind nicht gerade zimperlich, Benin. Ich brauche das Mädchen am Leben.«
»Ihr Name ist ein Schlachtruf für die Rebellen. Wäre es nicht besser, sie einfach hinzurichten?«
Die Königin schlug mit der Faust auf die Armlehne und sah zu ihrer Befriedigung, wie er zusammenzuckte.
»Habt Ihr mich gehört, Benin?«
»Ja, Majestät. Am Leben, zu Befehl.«
Doch die Königin vertraute ihm nicht länger. Würde Ducarte sich je gegen sie wenden? Nichts schien mehr sicher. Wehmütig dachte sie an Beryll, ihren alten Kämmerer, der für sie durchs Feuer gegangen wäre. Doch Beryll war tot, und an seiner Stelle diente der Königin nun Juliette, die immerzu zu flüstern schien. Selbst jetzt vergaß sie sich, als sie an der Wand lehnte und einer der Palastwachen schöne Augen machte. Die anderen Kammerdiener der Königin waren im Raum verteilt und achteten kaum auf das Gespräch.
»Was gibt es noch?«
»Die Armee, Majestät«, wagte Ducarte sich mit einem unsicheren Blick auf die beiden Männer hinter ihm vor. »Sie ist ein Problem. Viele der Soldaten weigerten sich, nach ihrer Entlassung nach Hause zurückzukehren. Sie halten geheime Versammlungen ab, die wir natürlich registrieren. Wir haben Berichte von öffentlicher Trunkenheit und Schlägereien in ganz Demesne, und für die zerschlagenen Möbel und missbrauchten Frauen geben die Leute Euch die Schuld.«
Die Königin lächelte und antwortete mit einem süffisanten Unterton: »Und warum unternehmt Ihr nichts dagegen, Benin?«
»Ich habe keine Macht mehr über meine Männer, Majestät«, gestand Ducarte steif ein. »Sie wollen keine Plattitüden oder Patriotismus. Sie wollen plündern, alle Mann bis hinunter zur Infanterie. Ansonsten wollen sie eine finanzielle Entschädigung.«
Die Königin nickte, doch was Ducarte da forderte, war unmöglich. Sie war immer ihre eigene Schatzmeisterin gewesen und wusste daher genau, wie viel Geld sich in ihren Verliesen befand. Sie hatte zwar Reserven, doch seit die Tearlieferung eingestellt worden war, kam sehr viel weniger Geld herein. Auf keinen Fall verfügte sie über genug, um Tausenden von unzufriedenen Soldaten auch nur annähernd das zu bezahlen, was sie sonst bei der Tearinvasion für sich beansprucht hätten. Kurz überlegte die Königin, allen dennoch einen kleinen Bruchteil auszuzahlen; eine solche Geste würde zwar die Schatzkammer leeren, war manchmal aber notwendig. Die Königin hatte schon einige Male so gespielt, und es hatte sich immer ausgezahlt.
Doch etwas an dieser Vorstellung widerstrebte ihr. Schließlich war sie auch nicht bezahlt worden. Die zwei Tearsaphire hingen unter ihrem Kleid, doch sie waren nur hübsche Steine. Die ganze Macht, die ganze Unbesiegbarkeit, die sie sich von der Tearinvasion erhofft hatte, war auf die leeren Trophäen reduziert worden, die jetzt zwischen ihren Brüsten hingen. Nach ihrer Rückkehr in den Palast hatte sie alles versucht, jeden Zauberspruch, den sie kannte, doch die Saphire weigerten sich, mit ihr zu sprechen. Es war zum Verrücktwerden. Sie hatte Tearblut in sich – zumindest hatte das dunkle Geschöpf ihr das gesagt –, weshalb sie sie eigentlich zum Leben erwecken können müsste. Wieso hatten die Steine keine Macht mehr?
Ducarte wartete immer noch auf eine Lösung, aber die Königin hatte keine. Ihre Soldaten waren kleine Kinder. Die Führungsriege hatte sie fürstlich entlohnt. Was diese mit dem Geld anfingen, war ihnen überlassen.
»Das ist meine Armee«, erwiderte sie schließlich. »Die Männer arbeiten für mich. Wenn sie das vergessen, kann ich sie gern daran erinnern.«
»Angst wird sie nur für gewisse Zeit im Zaum halten, Majestät.«
»Wartet nur ab, Benin.«
Ducarte wollte noch etwas erwidern, doch nach einem Moment nahm er seine niedergeschlagene Haltung wieder ein und ließ den Kopf hängen. Zum sicher hundertsten Mal fragte sich die Königin, was das Mädchen mit ihm angestellt hatte. Sie hätte sich nie vorstellen können, dass dieser Mann zu Angst fähig war, und jetzt schien er nur noch ein zitterndes Häufchen Elend zu sein.
»Noch etwas?«
»Ja, eine besorgniserregende Beobachtung. Wenn Eure Soldaten sich versammeln, werden sie von meinen Leuten beobachtet. Vor zwei Tagen haben sich zehn Leutnants in einem verlassenen Haus im südlichen Bezirk getroffen.«
»Und?«
»Es waren auch zwei Priester anwesend.«
»Priester aus Tearling?«
»Ja, Majestät. Den zweiten haben wir nicht erkannt, doch der andere war Pater Ryan, der nach der Hinrichtung von Bruder Matthew die rechte Hand des Heiligen Vaters wurde.«
Die Königin zog verächtlich die Lippen zurück. Die Prinzipien des Tearpapstes waren so fadenscheinig, dass sie beinahe nicht zu erkennen waren, und der Handel, den er mit der Königin eingegangen war, war jetzt in der Schwebe. Dem Heiligen Vater war es nicht gelungen, das Mädchen zu töten, und die Königin hatte ihre Armee abgezogen. Sie würde Tearling in nächster Zukunft in Ruhe lassen; auch wenn die Steine alle Kraft verloren zu haben schienen, hatte sie einen Eid darauf geschworen, den sie nicht brechen würde. Doch sie hätte wissen müssen, dass dieser hinterhältige Bastard im Arvath sich seine eigene Entschädigung suchen würde. Wie gern sie ihm den Hals mit bloßen Händen umgedreht hätte.
»Was war der Grund des Treffens?«, verlangte sie zu wissen.
»Ich weiß es noch nicht, Majestät. Zwei der Leutnants sind in Haft, aber sie schweigen.«
»Dann bringt sie zum Reden!«
»Natürlich, Majestät.« Doch Ducarte klang entmutigt, und die Königin wusste, was er dachte: Es war schwer, Menschen von konspirativen Treffen im Dunkeln abzuhalten.
Evie!
»Himmel noch mal, sei ruhig!«, flüsterte sie.
»Majestät?«
»Nichts.« Die Königin massierte sich die Schläfen, wollte ihren Geist zur Ruhe zwingen. Das Mädchen hatte großen Schaden bei Ducarte angerichtet, damit war er aber nicht allein. Die Königin hatte gedacht, sie hätte Evelyn Raleigh vor langer Zeit getötet, doch jetzt bevölkerte Evelyns untoter Geist ihr Inneres. Sie brauche Frieden, Zeit, um nachzudenken und zu überlegen, was sie als Nächstes tun sollte. Tee und ein heißes Bad. Dann würden die Antworten kommen, und wenn nicht, dann würde sie wenigstens schlafen und etwas von dem Nebel beseitigen, der ihren Geist im Moment ständig verschleierte. Sie war sich so sicher gewesen, dass die Tearsaphire ihre Schlaflosigkeit heilen würden, doch natürlich hatten sie nichts dergleichen getan. Jeden Tag versuchte sie verzweifelt, den Schlaf nachzuholen, der ihr in der Nacht zuvor verwehrt geblieben war.
Das helle Klirren von Metall hallte durch den Raum. Instinktiv sprang die Königin vom Podest und kauerte sich daneben. Irgendetwas prallte gegen die Rückseite ihres Throns, doch sie war schon hinter einen der breiten Pfeiler geeilt, die das Podest einrahmten. Sie nahm Bruchstücke des Geschehens wahr: Ducarte, der mit einem seiner Leutnants rang, ein Messer, das am Fuß der Stufen lag, der andere Leutnant, der mit dem Schwert in der Hand auf den Pfeiler zuging.
Ein Attentat, dachte die Königin fast schon amüsiert. Ein altes Spiel, das schon lange keiner mehr gewagt hatte zu spielen. Sie drückte sich gegen die glatte Rundung des Pfeilers und überlegte fieberhaft. Ja, die Armee war unzufrieden, das allein würde jedoch niemanden zu so einer drastischen Maßnahme verleiten. Sie hielten sie anscheinend für verletzlich. Glaubten sie, sie hätte Tearling aus Schwäche verschont? Unverschämtheit. Könnte Ducarte dahinterstecken? Unwahrscheinlich, eher war er ebenfalls ein Ziel des Anschlags. Niemand mochte ihn, nicht einmal seine eigenen Truppen.
Sie spürte, wie sich ihr der zweite Soldat näherte, fühlte seinen Herzschlag, leicht und schnell wie der eines Kaninchens, auf der anderen Pfeilerseite. Sie könnte ihn sofort töten, doch diese zwei Männer hatten das Komplott sicher nicht alleine ausgeheckt; sie brauchte also wenigstens einen von ihnen lebendig. Aus der Raummitte ertönte das gurgelnde Geräusch eines Mannes, der gerade erdrosselt wurde. Sie hoffte, dass es sich dabei nicht um Ducarte handelte, doch das lag durchaus im Bereich des Möglichen. Der Angreifer schob sich gerade um den Pfeiler, näherte sich ihr von links, und die Königin machte sich bereit, seine Schwerthand anzugreifen. Dann schlug etwas gegen den Pfeiler, so stark, dass die Königin den Aufprall durch drei Meter festes Gestein spürte. Das Schwert des Soldaten fiel klirrend vor ihr zu Boden.
»Majestät? Geht es Euch gut?«
Die Stimme sprach mit starkem Tearakzent. Die Königin spähte um den Pfeiler und sah eine ihrer Kammerzofen, das neue Mädchen, das Juliette nach Minas Tod ausgewählt hatte. Die Königin konnte sich nicht an ihren Namen erinnern. Als sie sich hinter dem Pfeiler hervorwagte, sah sie, dass die junge Frau den Leutnant mit dem Gesicht voran gegen die steinerne Säule presste und ihm ein Messer an die Kehle hielt. Unwillkürlich war die Königin beeindruckt. Auch wenn das Mädchen groß und muskulös für eine Frau war – so wie alle Kammerdiener der Königin –, war sie doch kleiner als der Soldat. Trotzdem hielt sie ihn mit eiserner Kraft fest.
Der Zustand des Thronsaales sprach für sich. Juliette hatte sich nicht bewegt, ebenso wenig wie die anderen Bediensteten. Der Captain der Königinnengarde, Ghislaine, zog gerade Ducarte unter dessen Angreifer hervor, und selbst von ihrem Standort aus konnte die Königin sehen, wie sich Ducartes Kehle hässlich verfärbte. Der andere Leutnant war tot, ein Messer hatte ihn in den Rücken getroffen. Die meisten Wachen der Königin standen an der Wand aufgereiht, beobachteten aufmerksam ihre Bewegungen, hatten sich allerdings kaum gerührt.
Gütiger Himmel, dachte die Königin. Meine eigene Wache!
Sie wandte sich an die neue Kammerzofe. »Wie heißt du?«
»Emily, Eure Majestät.«
»Benin! Fühlt Ihr Euch imstande, eine Verhaftung vorzunehmen?«
»Es geht mir gut!«, knurrte Ducarte. »Er hat mich überrascht.«
Die Königin presste die Lippen aufeinander. Niemand überraschte Ducarte. Sie wandte sich wieder an die junge Frau, Emily, und musterte sie von oben bis unten: gute Tearabstammung, groß und blond, mit sehnigen, muskulösen Armen. Hübsch, aber nicht zu hübsch; ihr Gesicht trug den nichtssagenden Ausdruck, den die Königin immer mit der Unterklasse der Tear verbunden hatte.
»Du bist mit der Lieferung gekommen«, bemerkte die Königin.
»Ja, Eure Majestät«, antwortete das Mädchen in einer Mischung aus Tear und gebrochenem Mort. »Erst vor einem Monat ich Dienstbotin wurde.«
Eine Kammerdienerin, die nicht einmal die Sprache richtig beherrschte! Juliette musste wirklich verzweifelt gewesen sein. Und doch konnte es ihr die Königin angesichts der jüngsten Ereignisse nicht verübeln. Sie hätte die Angreifer auch selbst überwältigen können, aber das spielte keine Rolle. Von allen Menschen im Raum hatten nur zwei reagiert: Ghislaine und die Sklavin. Kompetente Mortsprecher gab es genügend, aber Loyalität war in dieser Zeit eine Seltenheit. Was für ein Jammer, dass das Mädchen aus Tearling war!
»Übergib ihn General Ducarte«, befahl sie Emily. »Benin! Ich will Namen!«
»Ja, Eure Majestät«, erwiderte Ducarte und rappelte sich auf. Die neue Kammerdienerin überreichte ihm den Gefangenen, während die Königin Juliette aufmerksam im Auge behielt, die angestrengt versuchte, ihre Anspannung zu verbergen. Ob das ein Zeichen für Schuld war, wusste die Königin nicht. Sie schien mittlerweile von Verrat umgeben zu sein. Es war wie in der alten Tearsage: der einsame Herrscher, der sicher in seiner Burg saß, so stark bewacht, dass er nicht hinausgehen konnte. Ducarte hatte sie gewarnt, dass der Abzug der Armee große Probleme mit sich bringen würde, und jetzt wurde ihr klar, dass er seine Männer besser kannte als sie. Sie hätte auf ihn hören sollen. Als Ducarte den Gefangenen Richtung Tür führte, musste sich die Königin eine unangenehme Wahrheit eingestehen: Dieser jämmerliche Mann war ihr einziger Vertrauter und das, was einem Freund noch am nächsten kam. Ohne einander würden beide nicht lange überleben.
»Benin!«
Er drehte sich um. »Majestät?«
Die Königin holte tief Luft; sie hatte das Gefühl, als müsste sie ihrer Kehle jedes Wort abpressen. Um Hilfe zu bitten … das war das Schlimmste für sie. Doch ihr blieb keine Wahl.
»Es sind nur noch wir beide übrig, Benin. Versteht Ihr?«
Ducarte nickte, ein Muskel zuckte in seinem Gesicht, und die Königin erkannte mit einem Mal, dass er sie genauso abstoßend fand wie sie ihn. Darüber würde sie nachdenken müssen, doch erst später, wenn diese Krise bewältigt war und sie endlich eine Nacht geschlafen hatte.
»Geht.«
Ducarte verließ den Saal, den Leutnant vor sich herstoßend. Aus ihm würde man wahrscheinlich sowieso nicht viel herausbekommen; in einer unzufriedenen Armee gab es eine reiche Auswahl an potenziellen Angreifern, und ein kluger Verschwörer weihte den Auftragsmörder in nichts ein. Ihr unbekannter Feind, dieser Levieux, war sehr klug. Die Königin ließ sich wieder auf dem Thron nieder und musterte die Ansammlung möglicher Verräter vor sich: Wachen, Bedienstete, Soldaten, Höflinge, mindestens dreißig Menschen, die alle daran arbeiteten, sie zu Fall zu bringen. Juliette gab Anweisungen, die Leiche aus dem Saal zu bringen, doch ihr Blick zuckte immer wieder ängstlich zur Königin.
Diese sah zu der Tear, die wieder bei den anderen Kammerdienern an der Wand stand. Sie sollte mehr über das Mädchen erfahren, herausfinden, warum eine Tearfrau so gut mit dem Messer umgehen konnte. Aber auch das musste warten; zu viele andere Dinge waren dringender. Ganze Dörfer waren verwaist, die Bewohner von Glace-Vert geflohen. Die Königin verfügte über keine Armee mehr, sondern nur noch über eine Bande von Mördern. Die Waise, das dunkle Geschöpf, oder wie auch immer es sich nannte, war auf dem Weg, und sie konnte ihm nichts entgegensetzen. Das Mädchen könnte sich als nützlich erweisen, doch sie war auch ein gefährlicher Unsicherheitsfaktor, und am allermeisten verabscheute die Königin Unsicherheit. Am liebsten hätte sie geschrien, irgendetwas geworfen, irgendetwas getan, damit diese ganzen Menschen sie nicht länger anstarrten und darauf warteten, dass sie einen weiteren Fehler beging.
»Emily, nicht wahr?«, fragte sie die Frau.
»Ja, Eure Majestät.«
Die Königin betrachtete sie eingehend. Sie konnte niemandem trauen, das war ihr nun klar, aber vielleicht war eine Tearsklavin tatsächlich die beste Wahl. Im Großen und Ganzen empfanden die Tear, die mit der Lieferung gekommen waren, keine Loyalität mehr gegenüber ihrer Heimat, sondern eher Hass. Es war ein großes Risiko, einer Tearsklavin Zugang zur Tearkönigin zu gewähren, aber das Mädchen hatte wenigstens etwas getan, verflucht noch mal … und das war mehr, als die Königin von den meisten Anwesenden sagen konnte, selbst ihren eigenen Wachen. Wieder dachte sie voller Sehnsucht an Beryll, an eine Zeit, in der Loyalität nicht die Wahl zwischen zwei Übeln bedeutet hatte.
»Du bist keine Kammerzofe mehr«, erklärte die Königin. »Du bekommst eine besondere Aufgabe. Geh hinunter in den Kerker. Ich will einen umfassenden Bericht über die Tearkönigin. Ich will wissen, wo sie ist, wie sie gefangen gehalten wird, in welchem Zustand sie sich befindet. Finde heraus, ob sie Forderungen an ihre Wärter gestellt hat.«
Das Mädchen nickte und warf Juliette einen triumphierenden Blick zu, deren Gesicht sich verdüsterte. Zwischen den beiden herrschte keine große Sympathie, ein gutes Zeichen.
»Und besorg dir einen Lehrer für Mort. Lern schnell. Ich will kein Wort Tear mehr aus deinem Mund hören.«
Noch ein gutes Zeichen: Emily widersprach nicht und stellte auch keine Fragen. Sie nickte nur und verließ den Raum.
Der Blick der Königin fiel auf das frische Blut auf dem Boden. Rebellion und Aufstand. Kein Herrscher konnte sich dem lange widersetzen, nicht mit Gewalt. Levieux und das dunkle Wesen … einen Moment fragte sie sich, ob die beiden wohl gemeinsame Sache machten. Doch nein, das dunkle Geschöpf würde sich niemals herablassen, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Selbst die Königin, die gedacht hatte, sie wären Verbündete, war nur ein Bauer für ihn gewesen. Das dunkle Wesen würde warten, bis sie schwach war, bis die Rebellion, die durch Mortmesne tobte, größten Schaden angerichtet hatte, und erst dann würde es sie holen kommen.
Ich könnte fliehen, dachte die Königin, aber das war auch kein Ausweg. Man hasste sie auch in Cadare und Callae. Ihr blieb nur der Norden, wo das dunkle Geschöpf wartete, und der Westen, die schlechteste Möglichkeit von allen. Wenn sie den Tear in die Hände fiel, würde man sie in Stücke reißen, nur um ihre Schreie zu hören. Und selbst wenn sie fliehen könnte, in dunkle Löcher und düstere Ecken, welches Leben wäre das, wo sie es doch gewohnt war, ganze Königreiche zu lenken.
Evie! Komm her!
»Nein«, flüsterte sie. Schon lange bevor die Tear die erste Lieferung geschickt hatten, war sie eine Sklavin gewesen, und jetzt konnte sie nicht mehr zurück. Lieber würde sie sterben. Sie dachte an ihren oft wiederkehrenden Albtraum, der sie jetzt seit Monaten quälte: die letzte Flucht, das Mädchen, das Feuer und der Mann in Grau hinter ihnen. Du wirst fliehen, hatte ihr das dunkle Wesen prophezeit, und vielleicht würde sie das auch, doch erst ganz am Ende, wenn ihr nichts mehr geblieben war. Sie hob trotzig das Kinn und starrte auf die Verräter vor sich.
»Der Nächste.«