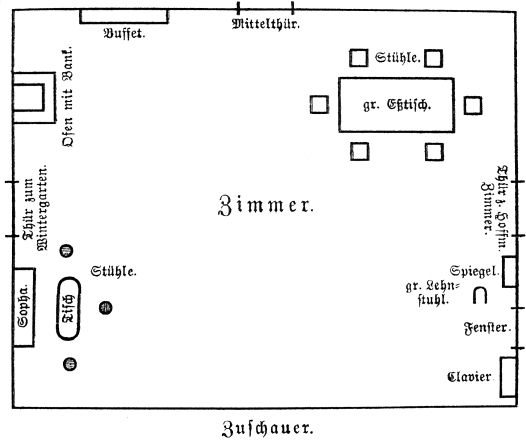
Abbildung: Bühnenbildskizze zu Beginn des 1. Akts im Erstdruck von Gerhart Hauptmanns Drama Vor Sonnenaufgang (1889).
Divergierende Entwicklungstraditionen
Die Lyrik des deutschen Naturalismus weist – im Unterschied zur Erzählprosa und zur Dramatik dieser Diskursformation – ein hochgradig disparates Erscheinungsbild auf. Das hängt damit zusammen, dass die Autoren im Wesentlichen an zwei unterschiedliche literarische Entwicklungstraditionen anknüpften, für die in schlagwortartiger Verkürzung die Namen jener beiden literarischen Generationengruppen stehen können, die für das Selbstverständnis des Frühnaturalismus von entscheidender Bedeutung waren: Sturm und Drang bzw. Junges Deutschland (vgl. Kapitel III.5.). Die Bezugnahme auf die beiden Vorgängerbewegungen diente dabei einer Abgrenzung von der epigonalen Gründerzeitdichtung, sollten so doch außer Gebrauch gekommene Ausdrucksregister revitalisiert und für die Gestaltung von Themenkomplexen der ‚Moderne‘ fruchtbar gemacht werden. Genieästhetik und Vormärzdichtung boten sich vor allem deshalb als Referenzgrößen an, weil sie auf ganz unterschiedliche Weise Problemlösungsoptionen für die gegenwärtige Misere der Lyrik eröffneten. Die Sturm-und-Drang-Bewegung führte vor, wie mit Rekurs auf die inkommensurable Individualität des Subjekts normpoetische Vorgaben gesprengt werden konnten, und das Junge Deutschland lieferte den Beleg, dass auch übermächtig scheinende Form- und Inhaltsmuster wie die der romantischen Dichtung erfolgreich abgelöst werden konnten, in diesem Fall durch ein strahlkräftiges Konzept politisch-operativer Literatur. Beide Male – und hier konvergieren die sonst so heterogenen Strömungen – ging es darum, schablonenhaft gewordene Gestaltungskonventionen aufzuweichen, um auf diese Weise eine Entautomatisierung der Wahrnehmung zu erreichen.
Bezüge zu Sturm und Drang und Jungem Deutschland
Obgleich natürlich auch auf bestimmte Themenfelder zurückgegriffen wurde, orientierten sich die naturalistischen Autoren in der Praxis doch vorrangig an Formwahl und Sprachgebrauch der Vorgängerbewegungen. Bei der Sturm-und-Drang-Lyrik waren es die gehobene Stillage, das Pathos und die Tendenz zur Missachtung prosodischer Regularitäten, die begeisterte Nachahmung fanden, bei der Vormärzdichtung der weitgehende Verzicht auf rhetorische Schmuckformen, die Annäherung an die Alltagsrede und die wirkungsästhetische Akzentuierung. Auf diese Weise bildeten sich zwei höchst unterschiedliche, ja gegenläufige Spielarten naturalistischer Lyrik heraus: eine, welche die Formelhaftigkeit der Gründerzeitliteratur durch Pathetisierung, und eine, welche sie durch Entpathetisierung zu überwinden suchte. So begegnen sowohl Texte in ‚hoher‘ Tonlage und mit gewählter Diktion als auch solche, die sich gezielt der ‚niederen‘ Stilebene bedienen. Anschaulicher Beleg dieser ästhetischen Diffusität ist die Lyrikanthologie Moderne Dichter-Charaktere. Auch wenn sich hier nur wenige Gedichte finden, die sich von der Durchschnittsproduktion ihrer Zeit abheben, macht sich doch eine gewisse Akzentverlagerung bemerkbar. Deutliches Zeichen hierfür sind etwa all jene Texte, die auf eine geregelte metrische Gestaltung verzichten und sich freier Rhythmen oder Knittelversen bedienen. War es bei ersteren die Möglichkeit, die eigenen Texte mit Pathos aufzuladen, welche die Autoren der jungen Generation anzog, so weckte der Knittelvers im Gegensatz dazu gerade wegen seines „(scheinbar) unkünstlerischen Charakters“ (Wagenknecht 1981, 46) Interesse; zudem wirkte er gegenüber anderen Versformen unabgenutzt. Der Aufschwung, den diese beiden Vertextungsweisen in den achtziger Jahren erlebten, veranschaulicht, wie divergent der frühnaturalistische Zugang zur Lyrik faktisch war. Als signifikant können in diesem Zusammenhang auch die zahlreichen Variationen der ‚hohen‘, religiös konnotierten Genres Psalm (Bleibtreu, Conradi, Gradnauer, Henckell, Kirchbach) und Gebet (Adler, Bohne, Henckell, Jerschke, Linke) in den Modernen Dichter-Charakteren gelten, die auf die messianische Komponente vieler frühen naturalistischen Gedichte verweisen und diese Texte als „Variante der heroischen Lyrik“ (Fohrmann 1996, 410) erkennbar werden lassen.
Zur Rolle Detlev von Liliencrons
Während genieästhetisch inspirierte Dichtung ausschließlich in historischen Mustern vorlag, wirkte für das Konzept entpathetisierter Literatur in hohem Maß ein zeitgenössischer Autor vorbildhaft: Detlev von Liliencron. Bei ihm handelt es sich um einen Schriftsteller, der mit dem Kunstprogramm des Naturalismus sympathisierte und zu seinen Kollegen mehr oder weniger enge Beziehungen unterhielt, der wegen der Abgeschiedenheit seiner Wohnorte (Insel Pellworm bzw. Kellinghusen in Holstein) aber nie Teil einer der regionalen Gruppierungen war, die sich herausbildeten. Vor allem Liliencrons Erstlingspublikation Adjutantenritte und andere Gedichte (1883) wirkte auf viele junge Autoren wie die Einlösung ihrer Hoffnungen auf eine nichtepigonale Dichtung, die sich den Anforderungen moderner Lebenswirklichkeit stellt und inhaltliche Grenzen des Darstellungswürdigen ebenso wie formale Reglementierungen souverän ignoriert. Schon die Zeitgenossen konstatierten: „Seine ersten Werke sind epochemachend gewesen wegen der in ihnen enthaltenen Wirklichkeitsdichtung.“ (Benzmann 1896/97, 347) Liliencron erweiterte nicht nur das Themenspektrum der Lyrik um bislang weitgehend tabuisierte Bereiche, er setzte sich auch über angestammte Vertextungsregeln hinweg. So begründete er unter Rückgriff auf ausländische Vorbilder eine eigenständige Spielart des Prosagedichts. Die von ihm betriebene Lockerung formaler Gestaltungskonventionen, die mit einem konsequent de-rhetorisierten Sprachgebrauch einherging, wurde für nicht wenige Nachwuchsautoren zum Vorbild für ihre eigene Schreibpraxis.
Arno Holz
In vielem ähnlich wie Liliencron verfuhr Arno Holz, der sich freilich vor allem auf Heinrich Heine berief, den er zu seinem ästhetischen „Schutzpatron“ (Holz 21892, 378) erklärte. Tatsächlich weist Holz‘ frühe Lyrik zahlreiche Parallelen zu Heines Dichtungspraxis auf: Darauf deuten u.a. das ausgiebig thematisierte Konfliktverhältnis des ‚poetisch‘ gestimmten Subjekts mit seiner ‚prosaischen‘ Umwelt, die kokette Selbstcharakterisierung als „allerletzter“ „Epigone“ (Holz 21892, 5) und als „Tendenzpoet“ (Holz 21892, 393), aber auch Verfahrensweisen wie die Schaffung von schnoddrigen Komposita-Neologismen – „Mauldreckschleuderthum“ (Holz 21892, 430) –, die entlarvende Verwendung des unreinen Reims – „Poesie“/„Patchouli“ (Holz 21892, 59), „Limburger Käs“/„Tohuwabohuessays“ (Holz 21892, 55) –, die Integration fremdsprachiger Ausdrücke – „Mussjöh“ (Holz 21892, 126), „Versfaiseur“ (Holz 21892, 296) –, der illusionsbrechende Einsatz überraschender Schlusspointen und der literarische wie politische Anspielungsreichtum hin. Vollends die Wahl des Titels, den er seiner Gedichtsammlung Buch der Zeit (1886) gab und der überdeutlich auf das Buch der Lieder (1824) rekurriert, weist Holz als Heine-Nachfolger aus.
Buch der Zeit
In diesem Band unternimmt der Autor nachgerade programmatisch den Versuch, eine zeitgemäße Dichtung unter Rückgriff auf die lyrische Formtradition des bisherigen 19. Jahrhundert zu begründen. Und so bietet sich das Buch der Zeit in formaler Hinsicht als Kompendium unterschiedlichster Vers- und Strophenformen dar. Zugleich ist Holz bemüht, das Themenspektrum auf möglichst viele Bereiche der Wirklichkeit auszudehnen: „Eisenbahnen und Telegraphen, Dampf und Elektrizität werden als angemessene Gegenstände der Kunst nachdrücklich geklamiert“ (Schutte 1976, 59) – „Auch dies ist Poesie!“ (Holz 21892, 28) hält der Autor den an der Vergangenheit orientierten Vertretern der Gründerzeitpoesie ebenso mahnend wie stolz entgegen. Den theoretischen Stichwortgebern des Naturalismus erweist er dabei mehrfach seine Reverenz, etwa wenn er sich als „Zeitgenosse von Emile Zola“ (Holz 21892, 355) charakterisiert oder mit Blick auf das Buch The Origin of Species (1859) mit gezielt blasphemischem Unterton von der „heiligen Schrift des Darwin“ (Holz 21892, 86) spricht. Alles in allem ist Holz‘ Lyriksammlung auf weite Strecken von einer polemischen Haltung geprägt. Der Autor präsentiert sich als spitzzüngiger Satiriker, der einerseits Kollegen- und Gelehrtenschelte betreibt und andererseits das kapitalistische Wirtschaftssystem, die Obrigkeit und die christliche Religion attackiert. Im Zuge solcher breitflächigen Kritik an der eigenen Gegenwart geraten auch die für die damalige Zeit typischen sozialen Begleiterscheinungen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses wie Fabrikarbeit, Armut und Prostitution in den Fokus. Gebündelt begegnen sie in der urbanen Verdichtungszone „Großstadt“, der Holz eine eigene Rubrik widmet. Vor allem die hier vorgenommene Thematisierung eines neuen, durch Akzeleration geprägten Erfahrungsraums mit seinen schneidenden Gegensätzen hat den Autor bald weithin bekannt gemacht und ihm den Ruf eingetragen, er sei einer der „Begründer der […] ‚Großstadtlyrik‘“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 487) in Deutschland. Diese Einschätzung ist sicher nicht falsch, muss allerdings mit Blick auf die deutlich frühere und obendrein ästhetisch überzeugendere Gestaltung des Phänomens Großstadt in der Literatur der Nachbarländer Frankreich und England relativiert werden.
Sprachgebrauch
Bedeutsamer für die Entwicklungsgeschichte der Lyrik dürfte letztlich Holz‘ Sprachgebrauch sein. Das Buch der Zeit jedenfalls erweist sich bei näherem Hinsehen als komplexes intertextuelles Gebilde, das mithilfe von Allusionen, Zitaten oder Kontrafakturen zum einen in hohem Maß auf Fremdtexte Bezug nimmt (viele Gedichte werden sogar von Mottotexten begleitet), über gezielten Dialekt- und Fremdwortgebrauch sowie den Einsatz von Umgangs- und Alltagssprache aber auch diverse mündliche Redemuster in sich aufnimmt. Als Beispiel hierfür kann der folgende, bereits im Titel auf eine Gedichtgruppe Goethes anspielende Text gelten:
Nicht „antiker Form sich nähernd“
In München schneit’s, und das Volk schreit nach Brod.
Gaslichtverbreitung.
Der Aetna raucht und Fürst Bismarck ist todt.
Nein, diese Zeitung!
Wozu durch alle diese Ritzen
Sein Blut ins Nichts vertropfen?
Gemüthlich hinterm Ofen sitzen
Und seine Pfeife stopfen!
Die Sonne scheint, und die Welt ist rund.
Grün wehn die Cypressen.
Ein Schnabus lässt sich trinken und
Ein Rollmops essen!
(Holz 21892, 427)
Ironisierung durch Intertextualität
Gegensätze der modernen Welt werden hier nebeneinander gereiht, wobei – wie sich bald herausstellt – die „Zeitung“ das Transportmedium dieser unverbundenen Nachrichten ist. Die scheinbare Zusammenhanglosigkeit der versammelten Meldungen verweist auf das eigentliche Problem, das der Text thematisiert, nämlich die Frage, wie sich der Einzelne angesichts sozialer Not, die von der Fülle täglicher anfallender Nachrichten verdeckt wird, verhalten soll. Ein mögliches – offenbar weit verbreitetes – Reaktionsmuster wird im weiteren Verlauf des Gedichts vorgeführt, nämlich das eines ungerührten „Weiter so“. Auch wenn andernorts Kälte und Hunger herrschen, ist das für den saturierten Bürger kein Grund, etwas gegen fremdes Leid zu unternehmen, solange er selbst „hinterm Ofen“ sitzen kann und genug zu „trinken“ und zu „essen“ hat. Obwohl Holz diese Haltung an keiner Stelle wertend kommentiert, entlarvt er sie doch als egozentrischen, sozial verantwortungslosen Quietismus. Dies erreicht er durch die Art und Weise, wie er Sprache einsetzt. Der Text wird nämlich bei näherem Hinsehen als – unmarkierte – Rollenrede erkennbar. Und da die so präsentierten Aussagen aus lauter Allgemeinplätzen („die Welt ist rund“) bestehen und mit unangebrachtem Pathos („sein Blut ins Nichts vertropfen“) sowie verniedlichenden dialektalen Verballhornungen („Schnabus“) durchsetzt sind, erscheinen sie als sprachlicher Ausdruck einer bornierten Gesinnung. Die dergestalt betriebene Ironisierung der Rede decouvriert die dahinter stehende Einstellung als eine, die den aktuellen Problemen aus Bequemlichkeit ausweicht. Implizit wird damit aber auch eine Haltung eingeklagt, die sich den angedeuteten Widersprüchen stellt.
Karl Henckell
Ansätze, die Lyrik für gesprochene Sprache zu öffnen, finden sich auch bei anderen Schriftstellern des Naturalismus. Am konsequentesten verfuhr hier wohl Karl Henckell, der sich mehrfach darum bemühte, moderne Großstadtwirklichkeit in akustischen Momentaufnahmen einzufangen. Beobachten lässt sich dies etwa im Text Berliner Abendbild, in dem Vielstimmigkeit zum zentralen Organisationsprinzip wird:
[…]
Hastig huschen Gestalten vorbei,
Keine fragt, wer die and’re sei,
[…]
Kaufmann, Werkmann, Student, Soldat,
Bettler in Fetzen, Hure im Staat.
[…]
Werkmann bebt vor des Winters Noth:
„Fänd‘ ich, ach fänd‘ ich mein täglich Brod!
[…]“
Bruder Studio zum Freunde spricht:
„Warte, das Mädel entkommt uns nicht!
Siehst du, sie guckt; brillant, famos!
Walter, nun sieh‘ doch – die Taille bloß!“
Steht der Gardist in Positur,
Weil der Hauptmann vorüber fuhr,
Ließ seine Donna im Stich – allein:
„Ja, liebste Rosa, Respekt muß sein.“
„Blumen, Blumen, o kauft ein Bouquet,
Rosen und Veilchen, duftend und nett!
Bitte, mein Herr, ach so sei’n Sie so gut!“
„Scheer’ dich zum Teufel, du Gassenbrut!
Retzow, auf Ehre, wahrer Skandal.“
„Unter Kam’raden ganz egal.“
„Sehen Sie, bitte! Grandiose Figur,
Wirklich charmant, merveilleuse Frisur.“
„Echt garantiert? Doch das macht nichts aus.
Hm! Begleiten wir sie zu Haus?“
„Neuestes Extrablatt! Schwurgericht!“
Hei, das drängt sich neugierig dicht.
„So ein Schwindler, ein frecher Hund,
Schlägt erst todt und leugnet es rund.“
Wie das rasselt, summt und braust!
Wie es mir vor den Ohren saust!
[…] (Arent [Hrsg.] 1885, 279f.)
Simulation mündlicher Rede
Ordnet das Gedicht anfangs noch ganz konventionell jedem Sprecher eine Äußerung zu, wird das Stimmengewirr, das hier literarisch nachgebildet wird, schließlich so groß, dass sich die Redeelemente verselbständigen. Die von Henckell betriebene „Montage von Gesprächsschnipseln“ (Bullivant 1982, 184) stellt zweifellos eine verfahrenstechnische Neuerung in der Lyrik der achtziger Jahre dar. Sie bildet in gewisser Weise vor, was dann erst die experimentelle Erzählprosa von Holz und Schlaf und schließlich die Dramatik des ‚konsequenten‘ Naturalismus programmatisch betreiben, nämlich die Simulation mündlicher Rede. Ziel einer solchen lyrischen Mimikry von Oralität ist indes nicht die bloße Kopie von Wirklichkeit, vielmehr sollen auf diese Weise insbesondere klassenspezifische Sprach- und Denkstrukturen entlarvt werden. Ein gutes Beispiel hierfür stellt Henckells Gedicht Tadellos dar, in dem ein zufällig am Rande einer Pferderennbahn aufgeschnapptes Gespräch zwischen zwei Offizieren mit unterschiedlichem Dienstrang in einer Weise wiedergegeben wird, dass der Eindruck entsteht, man sei selbst als Zuhörer dabei gewesen:
[…]
„Ä, ä, ä … wie sagten Sie?
Tadellos nahm Fox die Hürde.“
„Tadellos schlug Fix den Pott,
Schwanzeslänge“ – „,Was Sie sagen!‘“ –
„Kellner, Münchnerr! Aber flott!
Tadellos ist Pitt geschlagen.
Schneidig kühler Herbsttag das!
Ä, ä, ä … Herr Hauptmann meinen?
Ja, die Rennbahn war zu naß –
Tadellos kein Sonnenscheinen“ …
(Henckell 1894, 67f.)
Fonografische Karikierung
Die offenkundig an der Diktion Liliencrons geschulte Textpassage nähert sich bereits einem – fiktiven – Gesprächsprotokoll an, wobei die fonografische Treue der Wiedergabe von Sprecheigentümlichkeiten hier noch karikierende Funktion hat. Gleichwohl evozieren die wenigen Zeilen das Bild zweier gewollt ‚schneidig‘-selbstbewusst auftretender preußischer Offiziere. Ihre Herkunft wird durch einen einzelnen, aber charakteristischen Berolinismus („Münchnerr“) ebenso erkennbar wie ihr militärisches Metier durch die Kasernenhofsprache, die sich durch unvollständige Sätze („Schwanzeslänge“), syntaktische Inversionen („Schneidig kühler Herbsttag das!“) und redundante Floskeln („Tadellos“) auszeichnet. Vorgeführt werden aus dem sozialen Kontext gerissene, auf Grund ihrer Fragmentierung aber um so bezeichnendere Sprechakte, die in ihrer durch die Versifizierung begünstigten starken Verkürzung und ihrer gleichzeitigen reimtechnischen Banalisierung die Hohlheit eines Habitus und damit eines ganzen Berufsstandes entlarven. Besonders demaskierend wirkt dabei, dass die Ansätze verbaler Verständigung entweder irritiertes Stocken hervorrufen („Ä, ä, ä …“) oder zu inhaltlich sinnlosen Aussagen führen, die obendrein grammatisch inkorrekt sind („Tadellos kein Sonnenscheinen“).
Neubegründung politischer Dichtung
Karl Henckell kommt aber noch in anderer Hinsicht Bedeutung für die naturalistische Lyrik zu, gehört er doch zu jenen Autoren, die sich nachdrücklich um eine Neubegründung politischer Dichtung bemüht haben. Zeugnis hiervon geben neben dem – mit einer Vorrede von Heinrich Hart versehenen – Poetischen Skizzenbuch (1885) und dem Band Strophen (1887) vor allem seine beiden in Deutschland verbotenen Gedichtsammlungen Amselrufe (1888) und Diorama (1890). Auch wenn in der Anthologie Moderne Dichter-Charaktere erst wenige Texte enthalten sind, die auf soziale Verhältnisse ausdrücklich Bezug nehmen – zu nennen wären hier Friedrich Adlers Nach dem Strike, Karl Henckells Lied vom Arbeiter, Arno Holz‘ und Oskar Jerschkes Gedichte Meine Nachbarschaft, An die oberen Zehntausend und Für die Zukunft, Julius Harts Hört ihr es nicht? und Hermann Conradis Licht den Lebendigen –, war der Ruf nach einer gesellschaftsbezogenen Lyrik doch bereits in der ersten Hälfte der achtziger Jahre hörbar geworden. In einem Aufsatz vom Oktober 1883 entwickelte Arno Holz das Programm einer solchen engagierten Poesie, und zwar bezeichnenderweise im Rückgriff auf die politische Dichtung des Vormärz, aber mit gleichzeitiger Abgrenzung von ihr:
Diese soziale Lyrik würde alle Vorzüge der politischen besitzen, ohne jedoch mit deren Nachteilen behaftet zu sein. […] Sie würde […] auf jede wahrhaft große und bedeutsame Frage ihrer Zeit eine Antwort geben, ohne sich mit kleinlichen Einzelfragen eines Sonder-Interesses abzugeben und auf diese Weise, wie ihre politische Schwester, unwiderruflich das Interesse der Nachwelt zu verlieren. Sie würde […] die Zeit selbst, in dichterische Gebilde krystallisiert […] einer […] Nachwelt überliefern. (zit. nach Scheuer 1971, 37)
‚Soziale Lyrik‘
Holz‘ Gedanke wurde in der Folgezeit mehrfach aufgegriffen und variiert. So verpflichtet Heinrich Hart im Geleitwort zu Henckells Poetischem Skizzenbuch die Versdichtung ausdrücklich auf Kontemporaneitiät und Zeitbezogenheit: „Wie jede andere Kunstform aber muß die Lyrik […] aktuell sein, das heißt, den Geist der Zeit, der auch der Geist des Einzelnen ist, zum Ausdruck bringen.“ (Arent [Hrsg.] 1885, VIII) Und Bleibtreu erklärt das „Hineinragen der Wirklichkeit in die lyrische Auffassung“ (Bleibtreu 1973, 49) zum Charakteristikum moderner Poesie. Im Zuge dieser inhaltlich-funktionalen Neubestimmung der Lyrik kam es auf breiter Ebene zu einem Aufschwung politischer Dichtung. Erkennbar wird deren soziale Akzentuierung u.a. daran, dass nun die Figur des ausgebeuteten Lohn- bzw. Fabrikarbeiters Eingang in die Literatur fand. Leo Berg konstatiert denn auch: „Ein Erkennungs-Zeichen […] für die moderne Poesie ist das Auftreten des vierten Standes in der modernen Dichtung“. (Berg 1891, 6) Tatsächlich begegnen in der Lyrik der achtziger Jahre vielfach Texte, in denen Angehörige der Arbeiterklasse auftauchen. Ein frühes Beispiel ist Henckells in den Modernen Dichter-Charakteren abgedrucktes Lied vom Arbeiter, doch auch in der späteren Sammlung „Diorama“ findet sich ein Gedicht, das sich An das Proletariat wendet. Maurice Reinhold von Stern veröffentlichte gar einen ganzen Band mit Proletarier-Liedern (1885); dessen unter der veränderten Überschrift Stimmen im Sturm (1888) erschienene zweite Auflage ist explizit „dem arbeitenden Volk gewidmet“.
Wie sehr das Konzept einer ‚sozialen Lyrik‘ in der Folgezeit bestimmend wurde, verdeutlichen auch John Henry Mackays Publikation Arma parata fero (1886), die er mit dem Untertitel „Ein soziales Gedicht“ versah, und sein Gedichtband Sturm (1888). Die inhaltlichen und formalen Muster, die hier und in vergleichbaren Textsammlungen aufgegriffen werden, entstammen klar der politischen Dichtung des Vormärz. Neben Gedichten von Heine sind es vor allem Texte von Ferdinand Freiligrath, Anastasius Grün, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Georg Herwegh und Georg Weerth, die als Vorbilder gedient haben. So wurde etwa Maurice Reinhold von Stern von Zeitgenossen als „geistiger Erbe und unmittelbarer Nachfolger Herweghs“ (Beetschen 1890, 1728) angesehen.
Distanzierung und Rückzug
Allerdings legten die meisten Naturalisten ab Beginn der neunziger Jahre ihre lyrische Produktion wieder stärker individualistisch und subjektbezogen an. Karl Henckell denunzierte seine lyrischen Anfänge später sogar als „Litfaßkunst“ (Henckell 1894, 11) und erklärte apodiktisch: „Volksführer? Nein! die Toga paßt mir nicht./Ich bin zu schüchtern, Politik zu treiben./[…]/Aus Mitgefühl sing‘ ich mein Lied der Not,/[…]/Doch dem Parteigetriebe bin ich tot –“ (Henckell 1894, 9). Auch Bruno Willes mit einem Vorwort von Julius Hart versehener Gedichtband Einsiedler und Genosse (1891) ist das Dokument einer Distanzierung vom Modell einer vorrangig auf Tagesaktualität ausgerichteten operativen Dichtung. Für diese zuerst im Bereich der Lyrik erkennbare Neuorientierung gibt es vor allem zwei Gründe: Zum einen wurden ab 1890 Stimmen laut, die nicht zuletzt unter Berufung auf die seit jeher als Domäne der Lyrik angesehenen „états d’âme“ („Seelen[zu]stände“) eine „Überwindung des Naturalismus“ (Hermann Bahr) forderten, zum anderen führte die Aufhebung der Sozialistengesetze dazu, dass engagierte Dichtung nun in den Sog der Parteipolitik geriet. Was über das Jahr 1890 hinaus an ‚sozialer Lyrik‘ veröffentlicht wurde, bewegt sich deshalb unweigerlich in starker Nähe zur parteinahen politischen Dichtung der sozialdemokratischen Bewegung. Deshalb lässt sich „das von Karl Henckell im Auftrag der Sozialdemokratischen Partei 1893 herausgegebene Buch der Freiheit als das zeitlich späteste Dokument naturalistischer Bemühungen um die Lyrik ansehen“ (Schutte 1976, 16). Als Anthologie politischer Dichtung des 19. Jahrhunderts bilanziert es die wichtigsten Belegtexte der ‚sozialen Lyrik‘ des Naturalismus.
Verlagerung der Gattungspräferenz
In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre verlagerte sich die Gattungspräferenz der Naturalisten erkennbar von der Lyrik zur Erzählprosa. Den Anstoß zu dieser ästhetischen Neuorientierung gab Karl Bleibtreu, der die Ansicht vertrat, dass „die Enge der lyrischen Form sie untauglich macht, den ungeheuren Zeitfragen zu dienen“ (Bleibtreu 1973, 67), und stattdessen den „socialen Roman“ als „höchste Gattung des Realismus“ (Bleibtreu 1973, 36) ausrief. Fortan verstärkte sich nicht nur die Zola-Rezeption, parallel dazu erfolgte auch eine Rückbesinnung auf die vormärzliche Tradition des sozialen Romans. Max Kretzer ist – neben Wolfgang Kirchbach – der einzige Schriftsteller, der sich schon Anfang der achtziger Jahre der Erzählprosa zugewandt hat. 1880 erschien sein erster Roman Die beiden Genossen, und seit dieser Zeit erwarb sich der Autor einen Namen als Romancier und Novellist, dessen Stoffe in der Gegenwart angesiedelt sind und der in seinen Texten bis dato tabuisierte Themen aufgreift. Bleibtreu bezeichnete ihn deshalb nicht nur als „Realist par excellence“, sondern erklärte ihn sogar zum „ebenbürtigen Jünger Zola’s“ (Bleibtreu 1973, 36). Kretzer selbst nimmt eine Sonderstellung innerhalb des deutschen Naturalismus ein. Er gehört keinem der Zirkel dieser Bewegung an und hat sich auch in deren Programmdebatten kaum zu Wort gemeldet. Auch ist sein Verhältnis zu Zola von einer gewissen Ambivalenz geprägt: Einerseits greift er fraglos Themenfelder seines französischen Kollegen auf (was bis zur Übernahme einzelner Motive geht), andererseits lehnt er die von ihm propagierte nüchtern-unparteiische Darstellungstechnik ab. In seinem Aufsatz Meine Stellung zum Naturalismus beispielsweise wendet er sich explizit gegen dessen Erzählweise, die er mit einem „kalten Seziermesser“ (zit. nach Keil 1928, 105) vergleicht. Aus diesem Grund revitalisiert Kretzer das Textmodell des sozialen Romans, das ihm als gestalterische Alternative zum unpersönlich-szientistischen Konzept des Experimentalromans dient. Ein anschaulicher Beleg dafür ist Meister Timpe, der sechste und bekannteste Roman Max Kretzers, dessen Inhalt Erich Schmidt folgendermaßen charakterisiert:
Ein grosser socialer Process spiegelt sich hier in einem besonderen Menschenschicksal ab, der ohnmächtige Kampf des Kleingewerbes – hier […] eines wackeren Drechslers – gegen die Fabriken, deren Kolosse die bescheidene Nachbarschaft mit brutaler Kraft erdrücken und deren rücksichtslose Concurrenz die Lebensmühe vieler Meister tötet. (Schmidt 1888, 1468)
Inhaltsangabe
Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Berliner Drechslermeister Johannes Timpe. Er bewohnt gemeinsam mit Frau, Vater und Sohn ein Haus, das der Großvater einst im Osten der Stadt errichtet hat und das nach wie vor als Fertigungsstätte für die eigenen Handwerksarbeiten dient. Sein Nachbar ist der „Industrielle“ (52) Ferdinand Friedrich Urban, mit dem er persönlich in einem gespannten Verhältnis steht. Gleichwohl gestattet Johannes Timpe dem Sohn Franz, in dessen Unternehmen seine Lehre zu absolvieren, damit er einmal „was Großes“ (15) werde. Urban, der einen sprechenden Namen trägt – er denkt und verhält sich urban, d.h. weltstädtisch gewandt, aber eben auch entsprechend abgebrüht und rücksichtslos –, wird als egoistischer und auf Profit bedachter Unternehmer geschildert. Genau wie sein Lehrling und Angestellter Franz Timpe will er sozial aufsteigen. Um dies zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. Aussprüche wie „Wir machen alle tot“ (60) und „Stirb du, damit ich lebe!“ (138) weisen ihn klar als Vertreter eines unbarmherzigen Sozialdarwinismus aus, dem mit Johannes Timpe der Typus des ehrlichen und aufrechten, zugleich aber auch starrsinnigen Handwerkers gegenübersteht.
Franz nun ist gewissermaßen eine transitorische Figur zwischen zwei sozialen Sphären. Er wird, da er als einziges von drei Kindern überlebt hat, von seinen Eltern verhätschelt, und nicht zuletzt weil er deren Wünsche nach sozialem Aufstieg erfüllen soll, orientiert er sich an seinem Arbeitgeber, zu dessen Prokuristen und später sogar Teilhaber er wird. Als Urban ihn eines Tages dazu überredet, ihm doch einige gedrechselte Modelle aus der Werkstatt seines Vaters zu zeigen – was Franz aus Naivität auch tut –, setzt zwischen den benachbarten Familien ein erbitterter Verdrängungswettbewerb ein, denn Urban kopiert nun maschinell die handwerklich hergestellten Erzeugnisse Johannes Timpes und beschleunigt durch diese billige Serienproduktion den ökonomischen Niedergang des Rivalen. Der Nachbarschaftskonflikt spitzt sich weiter zu, da Franz eine Heirat mit Urbans Stieftochter Emma anstrebt und so als dessen potentieller Schwiegersohn vollends in dessen Einflussbereich gerät. Wenig später errichtet Urban eine Fabrik auf dem Nebengrundstück und bietet Timpe an, dessen Anwesen aufzukaufen, was dieser jedoch ablehnt, wodurch die Abneigung vollends in persönliche Feindschaft umschlägt.
Franz zieht aus dem elterlichen Haus aus. Weil Urban spürt, dass Johannes Timpes Sohn ein ihm selbst verwandter Charakter ist, weigert er sich zunächst, ihm seine Zustimmung zur Heirat mit Emma zu geben. Um seine Loyalität auf die Probe zu stellen, verlangt er von ihm, er solle das bestverkäufliche Modell seines Vaters stehlen. Franz tut es, wird dabei aber von seinem Großvater ertappt, der daraufhin einen Anfall erleidet; bevor er stirbt, sagt er seinem Sohn Johannes noch, dass Franz der Dieb war. Timpe ist fortan „ein an Körper und Seele gebrochener Mensch“ (176f.), der zum „Einsiedler“ (228) und „Sonderling“ (237) wird. Er muss mehrere seiner Mitarbeiter entlassen und beginnt zu trinken. Franz seinerseits entfremdet sich gänzlich von seiner Herkunftsfamilie; er heiratet schließlich, ohne seine Eltern zur Hochzeit einzuladen. Emma aber unternimmt einen finalen Rettungsversuch: Als sie vom Niedergang der Nachbarwerkstatt erfährt, bietet sie, um ihrem Schwiegervater zu helfen, das Doppelte des Wertes für dessen Haus; Johannes Timpe aber fasst dies als weiteren Übernahmeversuch auf und schlägt das Angebot hochmütig aus. Der unerwartete Tod seiner Frau Karoline – in symbolischem Kontrast dazu bekommt Emma ein Kind – raubt Timpe den letzten Halt und besiegelt den vollständigen Niedergang des Unternehmens. Die Hypothek auf das Haus wird gekündigt, so dass Timpe sich hoch verschulden muss, und zwar – ohne es zu wissen – bei Urban. Als dann kurz darauf auch die neue Hypothek gekündigt wird, empfindet Timpe nur noch „Ekel vor der Welt“ und „Haß gegen die bestehende Ordnung im Staate“ (239). In seiner Verzweiflung folgt er seinem Altgesellen Thomas Beyer auf eine Wahlveranstaltung der Sozialdemokraten und predigt im Affekt Aufruhr. Er wird „wegen Aufreizung zum Klassenhaß“ (279) polizeilich angeklagt, und das Haus soll zwangsversteigert werden. Timpe bricht nun alle Brücken zur Umwelt ab, verbarrikadiert das Haus, flüchtet in einen Winkel des Kellers und zündet es an – das Gebäude brennt zu einem Teil nieder, und man trägt den Drechslermeister tot heraus. Parallel dazu findet die Einweihung einer neuen Stadtbahntrasse statt, die bezeichnenderweise am timpeschen Grundstück vorbeiführt.
Gattungsbezeichnung „sozialer Roman“
Wie der Untertitel „sozialer Roman“ zeigt, stellt Kretzer seinen Text in eine konkrete Gattungstradition. Er bedient sich eines besonders im Vormärz erprobten Erzählmodells, das er freilich um Elemente anderer Genres anreichert. Die Grundkonstruktion etwa weist durchaus Parallelen zum Muster des „roman expérimental“ auf. Dies lässt sich vor allem daran erkennen, dass Kretzer in Meister Timpe Motive von Zolas Roman Au bonheur des dames (1883;dt. 1883: Paradies der Damen bzw. Zum Glück der Damen) – dem elften Band des Zyklus Les Rougon-Macquart – übernimmt, in dem die Geschichte eines Warenhauses im Mittelpunkt steht. Die Parallelen zwischen beiden Texten sind dabei mit Händen zu greifen:
Timpes Haus wird […] von der Fabrik Urbans erdrückt, so wie das Häuschen des Handwerkers Bourras von dem ständig wachsenden Warenhaus; die industriellen Lieferanten des Kaufhauses ahmen die Erfindungen des alten Handwerkers nach und nehmen ihm die Kundschaft; der Handwerker Zolas will sich wie Meister Timpe um keinen Preis sein Geschäft abkaufen lassen. (293)
Freilich ist die Haltung beider Autoren zu dem geschilderten Geschehen eine ganz unterschiedliche. Zola befürwortet die gezeigte Entwicklung emphatisch und erweist sich als Parteigänger des gesellschaftlichen und Fortschritts. So heißt es in einer Entwurfsnotiz zum Roman:
Comme intrigue d’argent, j’ai mon idée première d’un grand magasin absorbant, écrasant tout le petit commerce d’un quartier. Je prendrai les parents de Mme Hédouin, un mercier, une lingère, un bonnetier, et je les montrerai ruinés, conduits à la faillite. Mais je ne pleurerai pas sur eux, au contraire, car je veux montrer le triomphe de l’activité moderne; ils ne sont plus de leur temps, tant pis! ils sont écrasés par le colosse. (Zola [1928], 468)
Der Handwerker Bourras wird denn auch von Zola mit einer Haltung kühler und distanzierter Teilnahmslosigkeit vorgeführt. Für Kretzer dagegen ist der sich vollziehende Modernisierungsprozess zwar gleichfalls eine unausweichliche Entwicklung, der Autor bilanziert freilich sehr deutlich die Verluste. Es verwundert deshalb nicht, wenn den beiden zentralen Protagonisten der „neuen Zeit“, Ferdinand Friedrich Urban und Franz Timpe, fast durchweg negative Charaktereigenschaften zugeschrieben werden.
Sozialgeschichte einer Berliner Handwerkerdynastie
Anders als Zola, der in seinem 20-bändigen Romanzyklus Les Rougon-Macquart ein gewaltiges Figurentableau entwirft und dieses in aller Breite entfaltet, beschränkt sich Kretzer in Meister Timpe auf wenige, obendrein eher typenhafte Personen und drängt die Handlung zeitlich stark zusammen. Gleichwohl wird beide Male das Schicksal einer Familie und ihrer Nachkommen vor dem Hintergrund der Zeit vor dem Leser ausgebreitet. Liefert Zola die „Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second empire“, so bietet Kretzer die Sozialgeschichte einer Berliner Handwerkerdynastie während der Gründerzeit. Auch wenn sich die erzählte Zeit im Text selbst nur über einen Zeitraum von knapp acht Jahren – nämlich von Frühjahr 1872 bis Winter 1879/80 – erstreckt, bemüht sich Kretzer doch darum, einen Gesamtüberblick über die jüngere nationale Historie zu geben. Dies geschieht dergestalt, dass er mit Ulrich Gottfried, Johannes und Franz Timpe Vertreter von „drei Generationen“ (so die Überschrift des zweiten Kapitels) auftreten lässt, die stellvertretend für einzelne Stationen der Entwicklungsgeschichte des 19. Jahrhunderts stehen:
Großvater, Vater und Sohn bildeten in ihren Anschauungen den Typus dreier Generationen. Der dreiundachtzigjährige Greis vertrat eine längst vergangene Epoche: jene Zeit nach den Befreiungskriegen, wo […] das Handwerk wieder zu Ehren gekommen war […].
Johannes Timpe hatte in den Märztagen Barrikaden bauen helfen. Er war gleichsam das revoltierende Element, das den Bürger als vornehmste Stütze des Staates direkt hinter den Thron stellte und die Privilegien des Handwerks gewahrt wissen wollte. Und sein Sohn vertrat die neue Generation der beginnenden Gründerjahre, welche nur darnach trachtet, auf leichte Art Geld zu erwerben und die Gewohnheiten des schlichten Bürgertums dem Moloch des Genusses zu opfern.
Der Greis stellte die Vergangenheit vor, der Mann die Gegenwart und der Jüngling die Zukunft. Der erste verkörperte die Naivität, der zweite die biedere Geradheit des Handwerkmannes […] und der dritte die große Lüge unserer Zeit, welche die Geistesbildung über die Herzensbildung und den Schein über das Sein stellt. (S. 20f.)
Generationen- und Familienroman
Zeitlich zusätzlich nach vorne und nach hinten verlängert wird diese Generationenlinie durch zwei weitere, im Text allerdings nur erwähnte und nicht als handelnd gezeigte Personen: den Urgroßvater Franz David Timpe und den namentlich nicht genannten Sohn Franz Timpes. Meister Timpe ist also im Kern der Roman einer Familie und als solcher auch Zeit-, Kultur- und Gesellschaftsdiagnose. Doch anders als in den meisten Texten des Naturalismus, wird Familie hier nicht als genealogischer Determinationszusammenhang begriffen. Das Thema Vererbung spielt bei Kretzer keine nennenswerte Rolle. Stattdessen wird das Augenmerk auf den Aspekt der Sozialisation gerichtet. Die Figur des Franz Timpe etwa dient dazu vorzuführen, „was die Erziehung macht“ (101); ihre negativen Charakterzüge werden vom Erzähler explizit als „Resultat einer falschen Erziehung“ (104) gewertet. Offensichtlich greift Kretzer aus der soziologischen Theoriebildung des 19. Jahrhunderts nur einzelne Elemente heraus und lenkt dabei den Blick vorrangig auf „le milieu et le moment“ und nicht auf „la race“. Dass sich der Berliner Autor grundsätzlich aber schon an den einschlägigen Stichwortgebern des Naturalismus orientiert, zeigt der Umstand, dass sich in seinem Roman diverse Schlagworte aus den zeitgenössischen Debatten finden. So rekurriert die Parole vom „Lebenskampf“ (282) unverkennbar auf darwin-haeckelsche Vorstellungen und transponiert sie in die Sphäre des Sozialen. Und an einer Stelle heißt es in direkter Anlehnung an Taine: „jeder Mensch ist das Produkt seiner Verhältnisse“ (183). Zu den überindividuellen Faktoren, die Verhalten und Mentalität der dargestellten Figuren prägen, zählen demnach neben familiärer Erziehung vor allem die sozialen und geschichtlichen Rahmenbedingungen. Insofern muss der Text auch als Zeitroman begriffen werden. Er thematisiert die unmittelbar zurückliegenden Jahrzehnte der deutschen Geschichte und beleuchtet deren wichtigste Phasen und politische Ereignisse: die Befreiungskriege 1812–15, die am Anfang einer langen Periode der Restauration stehen, die Revolutionen der Jahre 1848/49 und der sich anschließende Nachmärz, schließlich die Reichsgründung 1871 und die darauf folgende Gründerzeit.
Modellstudie
Schon diese Konstellation zeigt, dass es Kretzer um eine modellhafte Studie der Situation des Handwerks im 19. Jahrhundert geht. Im Lauf der Handlung wird die rapide um sich greifende Industrialisierung geschildert, die das Stadtbild Berlins verändert, immer mehr Lohnarbeiter dazu zwingt, für geringen Lohn in den großen Fabriken zu arbeiten, und das traditionelle Handwerk an den Rand der Existenzkrise führt. Zu den Begleiterscheinungen der Modernisierung gehören also der Reichtum einzelner und die Proletarisierung weiter Schichten der Bevölkerung. Johannes Timpe wird ebenfalls von dieser Entwicklungsdynamik erfasst; dass er schließlich ihr Opfer wird, daran trägt er freilich selbst erhebliche Mitschuld. Gewinner des historischen Umwälzungsprozesses ist Sohn Franz, der frühzeitig die Zeichen der Zeit erkennt und die Fronten wechselt. Die Grundlage hierfür haben indes die Eltern gelegt, die ihre eigenen sozialen Aufstiegswünsche auf ihn projiziert und entschieden haben, dass er nicht Drechsler, sondern Kaufmann werden soll. In Kretzers Text sind mithin die Themen Industrialisierung, Niedergang des Handwerks, ökonomischer Verdrängungswettbewerb und sozialer Aufstieg miteinander verwoben. Abgebildet auf den Konflikt der Generationen verhandelt er das Verhältnis von Tradition und Innovation.
Als Indikator für die stattfindenden Veränderungen und zugleich als eine Art Dingsymbol für den Stellenwert des Handwerks in der modernen Welt fungiert das Haus der Timpes. Zum Zeitpunkt seiner Errichtung befand es sich weit außerhalb des Zentrums an der äußersten Peripherie Berlins. Nach und nach wurde das Haus dann umbaut – und zwar so, dass es nun buchstäblich quer zu den seitdem angelegten Gebäuden und Straßenzügen steht:
Was dem Hause als eine besonderes Merkmal anhaftete, war seine außergewöhnliche Lage. Es stand mit der Front schräg hinter der Straße, so daß vor seinen Fenstern zwischen der Flucht des Trottoirs und der Seitenwand des Nachbarhauses ein spitzwinkliger Vorderhof entstanden war […]. Man hätte das ganze Häuschen wie einen steinernen, nach Fertigstellung der Straße in dieselbe hineingetriebenen Keil betrachten können, wenn nicht sein Alter dem widersprochen haben würde. (12)
Das timpesche Haus erscheint damit als Fremdkörper in der Topographie des modernen Berlin; es ist ein Relikt aus vergangener Zeit. Als dann die Stadtbahn quer durch Berlin errichtet wird und die steinernen Viadukte, auf denen die Züge fahren, in unmittelbarer Nähe des Anwesens gebaut werden, verliert das Gebäude rapide an Wert. Dadurch, dass er sich weigert, es an seinen Kontrahenten zu verkaufen, beschleunigt Johannes Timpe ungewollt seinen eigenen Ruin und trägt entscheidend dazu bei, dass die Tradition, die er aufrechtzuerhalten sucht, ihr Ende findet. Wenn am Ende des Romans, als Meister Timpe stirbt, die neue Stadtbahn eingeweiht wird, stehen sich „die alte und die neue Welt“ (186) noch einmal plakativ gegenüber. Nicht zufällig wählt Kretzer mit der Eisenbahn gerade jenes Verkehrsmittel, das im 19. Jahrhundert als Kollektivsymbol für Akzeleration und Fortschritt fungiert.
Strukturschema der Moritat
In Aufbau und Handlungsführung ähnelt der Roman einer Moritat; er führt in einzelnen Bildern die Stationen des Niedergangs eines Handwerkermeisters vor, der durch gesellschaftliche Verhältnisse, persönliche Intrigen und eigenen Starrsinn in den Ruin getrieben wird. Moritatenhaft wirken dabei besonders die vergleichsweise kleinteilige Parzellierung des Erzählgeschehens in insgesamt 19 Abschnitte und die leserlenkende, zuweilen auch sensationsheischende bzw. kolportagehaft klingende Betitelung der einzelnen Kapitel: „Schlimmer Verdacht“, „Ein entarteter Sohn“, „Der Meister predigt Aufruhr“ oder „Unter Trümmern“. Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, wenn man Kretzers Roman einfach als kulturkritisches Lamento deuten würde, das wortreich den Verlust der guten „alten Zeit“ (13) betrauert. Zwar hat eine solche romantisierend-verklärende Sicht auf die vermeintlich heile Welt des Handwerks in der Literatur des 19. Jahrhunderts eine lange Tradition. Bei Kretzer allerdings trägt diese Utopie nicht mehr; er zeigt denn auch deutlich „das Schwankende, Ambivalente in Timpes Denken und Handeln“ (Mayer 1980, 353).
Tradition der Handwerkerfigur
„Im Grunde verrät Timpe die Ideale seines Standes selbst, weil er seinem Sohn rät, sich einen Beruf in der Kaufmannswelt […] zu suchen“ (Mayer 1980, 352), und so dessen Ehrgeiz allererst entfacht. Mehr noch: Zwischenzeitlich „spielt der Handwerker selbst mit dem Gedanken, seinen zunächst noch florierenden Betrieb zu einer Fabrik umzugestalten“ (Mayer 1980, 352). Die Vorstellungen, die ihm diesbezüglich im Kopf herumgehen, unterscheiden sich genau betrachtet kaum von denen Urbans. Im Verlauf des Romans übernimmt Johannes Timpe dann aber immer stärker die traditionsverhaftete Position seines Vaters Gottfried. Am deutlichsten zeigt sich dies darin, dass er sich einen von dessen Aussprüchen aneignet. So hatte der Großvater zu Beginn des Textes lamentiert: „Ja, ja, das waren noch andere Zeiten … damals! Das Handwerk hatte einen goldenen Boden … Die Schornsteine müssen gestürzt werden, denn sie verpesten die Luft“. (28f.) Diese larmoyante Klage, die vom Erzähler explizit als „alte Litanei des Greises“ (28) charakterisiert wird, übernimmt Johannes Timpe im letzten und vorletzten Kapitel des Romans (vgl. S. 274), ja im Suff und in der äußersten Erbitterung kippt die dadurch zum Ausdruck kommende rückwärtsgewandte Haltung sogar in eine Rhetorik aufrührerischer Maschinenstürmerei um; so fordert Timpe auf einer Versammlung sozialdemokratischer Arbeiter: „Die Schornsteine müssen gestürzt werden, denn sie verpesten die Luft … Schleift die Fabriken … zerbrecht die Maschinen .…„(260) Er verursacht dadurch nicht nur einen Tumult, sondern zieht sich auch eine polizeiliche Anklage wegen Volksverhetzung zu. Auch wenn der Autor das Familienleben Timpes und den Umgang des Meisters mit seinen Gesellen und Lehrlingen bei der Ausübung seines Berufes überaus harmonisch und mit idyllisierender Tendenz schildert, ändert dies nichts an der Tatsache, dass der Titelheld letztlich als zwar „beklagenswerte, aber […] uneinsichtige, zunehmend egozentrisch denkende und handelnde“ Person erscheint und damit als Romanfigur präsentiert wird, „welcher der Leser mit Bedauern und Befremden zugleich begegnet“ (Mayer 1980, 356). Damit nicht genug: Johannes Timpe fungiert im Gegensatz zu E.T. A. Hoffmanns Meister Martin oder zu Ludwig Tiecks jungem Tischlermeister nicht mehr als Sympathieträger, sondern gehört ob seiner verzerrten Sicht der Wirklichkeit vielmehr in die lange Reihe der Sonderlingsgestalten, die die Literatur des 19. Jahrhunderts aufweist.
Naturalistische Elemente
Der naturalistischen Ästhetik entspricht Meister Timpe vor allem im Hinblick auf die Situierung der Handlung, die Thematisierung sozialer Konflikte und die Einbeziehung aktueller populärwissenschaftlicher Diskurse. Auch die Wahl einer Familie als personeller Rahmen des Geschehens und die Akzentuierung von Klassengegensätzen entspricht weitgehend den Forderungen der Naturalisten. Andererseits ist der Erzähler des Romans alles andere als ein nüchterner Registrator, er bewertet ständig das Verhalten der Figuren und lenkt so das Leserinteresse massiv. Nicht selten konstelliert er den Handlungsverlauf sentimental und rührselig, so dass man sich an zeitgenössische Kitschromane erinnert fühlt. Zugleich nimmt er aber auch wiederholt Korrekturen an stereotypen Figuren- und Handlungsmustern vor. Während in den meisten sozialen Romanen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei Liebende geschildert werden, die aus unterschiedlichen Gesellschaftsklassen stammen und durch ihre Verbindung einen Klassenausgleich herstellen, durchkreuzt Kretzer dieses Schema, indem er Franz sozialdarwinistisch handeln und zur ökonomisch erfolgreicheren Nachbarfamilie überlaufen lässt. Auch gelingt es ihm, indem er „das Figurenensemble […] durch die […] Gestalt eines Arbeiters ergänzt“, „drei verschiedene Arbeits-, Lebens- und Denkweisen einander gegenüberzustellen und zu zeigen, wie sie aus den Besitzverhältnissen entspringen“ (Voigt 1983, 165f.).
Intertextuelle Bezüge
In jedem Fall orientiert sich Kretzer in hohem Maß an Vorbildern. Meister Timpe weist nicht nur zahlreiche Ähnlichkeiten mit Zolas Au bonheur des dames auf, sondern übernimmt auch Handlungselemente von Alphonse Daudets Roman Fromont jeune et Risler ainé (1876). Darüber hinaus existieren motivische Parallelen u.a. zu Goethes Werther, zu Bettine von Arnims Günderode und zu Ludwig Tiecks Des Lebens Überfluß, intertextuelle Bezüge finden sich zum berühmten Loreley-Gedicht Heines „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten …“ (vgl. 63), zum Kirchenlied „Ein feste Burg ist unser Gott …“ (vgl. 284), aber auch zum Schluss von Büchners Drama Dantons Tod (vgl. 285: „Es lebe der Kaiser … Hoch lebe der Kaiser!“). All dies verweist klar auf Kretzers starke Bindung an die literarische Tradition und belegt einmal mehr den Kompromisscharakter der naturalistischen Romanproduktion in Deutschland. Auf jüngere Autoren wirkte Meister Timpe dann freilich selbst wieder vorbildhaft. Verwiesen sei hier nur auf Wilhelm von Polenz‘ Roman Der Büttnerbauer (1895), der „den gleichen Konflikt nach dem gleichen Muster im ländlichen Milieu“ (Voigt 1983, 166) gestaltet.
Hinwendung zu narrativen Formen
Auch Arno Holz und Johannes Schlaf folgten der von Karl Bleibtreu ausgesprochenen Empfehlung, sich der Erzählprosa zuzuwenden. So ging Holz nach der Publikation seiner Gedichtsammlung Buch der Zeit (1886) an ein Romanprojekt, das die Überschrift Goldene Zeiten trug und die „einfache, tatsachenschlichte ‚Geschichte eines Kindes‘“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 41) enthalten sollte. Allerdings blieb dieses Vorhaben genau wie ein „Verlorene Illusionen betitelter Berliner Roman“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 332) unvollendet. Schlaf wiederum arbeitete Mitte der achtziger Jahre an einem Roman, dem seine „Hallenser Studentenerlebnisse“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 332) zugrundelagen. Ein Nicht die Rechte überschriebener Romantext von ihm wurde unter dem Pseudonym Hans Bertram dann 1889 mit erheblicher zeitlicher Verspätung in der Zeitschrift Schorers Familienblatt abgedruckt. Doch Holz und Schlaf erkannten bald, dass weder der Gattungstyp ‚sozialer Roman‘ noch das von Zola propagierte Modell des Experimentalromans grundlegende neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffneten. Aus der Überlegung heraus, dass „man […] eine Kunst […] nur [revolutioniert], indem man ihre Mittel revolutioniert“, „oder vielmehr, da ja auch diese Mittel stets die gleichen bleiben, indem man […] deren Handhabung revolutioniert“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 490), gelangten sie zu der Einsicht, eine zeitgemäße Erneuerung der Erzählprosa könne nicht auf inhaltlichem – über die „Stoffwahl“ –, sondern nur auf formalem Weg – über die „Darstellungsart“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 271) – erreicht werden. Eine veränderte Präsentations-„Methode“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 271 und 490) aber ließ sich kaum im Rahmen der narrativen Großform erproben. Deshalb verlagerten Holz und Schlaf ihre schriftstellerische Produktion zunächst auf die Kleine Prosa.
Zur Wahl des Pseudonyms
Das Ergebnis dieser Bemühungen ist der unter dem Pseudonym Bjarne P. Holmsen veröffentlichte Band Papa Hamlet, der im Januar 1889 erschien und neben der titelgebenden Erzählung noch zwei weitere kurze narrative Texte, Ein Tod und „Der erste Schultag“ (ein überarbeitetes Kapitel aus dem Romanfragment Goldene Zeiten), enthält. Die Wahl des zumindest teilweise durchsichtigen Decknamens – BjARNe P. HOLmsen erweist sich auf Grund der übereinstimmenden Buchstabenfolge als „kaum verschlüsseltes Kryptonym“ (Scheuer 1971, 132) von ARNo HOLz – stellt dabei eine Reaktion dar auf die Skandinavienbegeisterung der damaligen Zeit, galt doch die nordische Literatur den Vertretern der jungen Autorengeneration in Deutschland als Inbegriff der realistisch getönten Moderne. Nicht zufällig wird in der Vorrede u.a. auf die „Erfolge Ibsens“ (15) und die Bedeutung „Björnsons“ (18) hingewiesen, mithin auf Schriftsteller, die eine „Vorliebe für die nackte Realität der Dinge“ (16) an den Tag legen. Die mit der Schaffung des Pseudonyms einhergehende „Mystifikation“ (6) reicht freilich weiter: Holz und Schlaf nämlich statten die hier in einem literarischen „Experiment“ (6) (der – leicht ironische – Bezug auf Zola ist offenkundig) fingierte Person nicht nur mit einem Namen, sondern auch mit einer eigenen Biographie aus, deren wichtigste Stationen in der „Vorrede des Übersetzers“ rekapituliert werden. Die eigentliche Pointe von Holmsens Lebensgeschichte nun besteht darin, dass der erfundene norwegische Schriftsteller seine prägenden Erfahrungen nicht etwa in der „Heimat“ macht, sondern seine „Entwicklung dem Auslande [zu] verdanken“ (17) hat. Damit verweisen Holz und Schlaf zum einen auf die künstlerischen Anregungen, die skandinavische Autoren aus der europäischen Kultur bezogen haben (der Norweger Henrik Ibsen etwa lebte in Deutschland), und ironisieren zum anderen die naive deutsche Begeisterung für Literatur aus fremden Ländern, die vergessen lässt, welche bemerkenswerten schriftstellerischen Erzeugnisse gegenwärtig in der Muttersprache entstehen.
Demontage des Werkbegriffs
Lässt man ihre polemischen Untertöne einmal beiseite, dann muss die „Vorrede des Übersetzers“ vor allem als ästhetischer Programmtext gelesen werden. Indem die Tätigkeit des Dichters ausdrücklich mit der eines „Anatomen“ verglichen wird, bekennen sich Holz und Schlaf zu einer nüchternsachlichen und rücksichtslosen, weil „vor keiner Konsequenz zurückschreckenden“ Präzision in der „Darstellungsweise“ (17), die erkennbar über die bekannten Erzählmuster hinausgeht. Doch auch konventionelle narrative Aufbauformen wie sie beispielsweise im ‚sozialen Roman‘ weiterhin zur Anwendung gelangen, werden radikal infrage gestellt. Holz und Schlaf formulieren hier eine Ästhetik des Skizzenhaften, die den traditionellen Werkbegriff verabschiedet und an seine Stelle die ‚kleine Form‘ treten lässt, welche nur Wirklichkeitsausschnitte erfassen will und sich obendrein dem Prinzip der Vorläufigkeit verschreibt. Wie sehr es den beiden Autoren dabei um eine Demontage der klassischen Dyade von Schöpfer und Werk ging, verdeutlicht der Umstand, dass die in Papa Hamlet enthaltenen Texte allesamt in Gemeinschaftsarbeit entstanden sind. Nach der Enttarnung des Pseudonyms erklärten Holz und Schlaf in einem offenen Brief dann mit Nachdruck, dass es „durchaus ungerechtfertigt“ sei, „einem von uns eine Beteiligung ‚ersten‘ oder ‚zweiten‘ Grades zuzumessen“ (15). Die kollektive Autorschaft muss dabei als Ausdruck einer experimentellen Grundhaltung gewertet werden. Anders als noch in der Romantik ist nun aber nicht mehr Sympoesie – verstanden als Steigerungsform poetischer Tätigkeit – das Ziel, vielmehr geht es um ein Zurücktreten der Autorsubjekte hinter eine überindividuelle Versuchsanordnung. Alles in allem läuft die Kollektivierung schriftstellerischer Tätigkeit bei Holz und Schlaf fraglos auf eine „Entwertung der Genievorstellung“ (Markwardt 1967, 95) des Frühnaturalismus hinaus.
Verhältnis zur Vorlage
Die Erzählung Papa Hamlet selbst ist Ergebnis der Umarbeitung einer „novellistischen Skizze“ von Johannes Schlaf mit dem Titel Ein Dachstubenidyll (vgl. Holz/Schlaf 1982, 83–102). Obwohl einzelne Personen andere Namen tragen, ist die Grundkonstellation in beiden Texten, die passagenweise sogar wörtliche Übereinstimmungen aufweisen, die gleiche: Im Mittelpunkt steht jeweils ein arbeitsscheuer, verwahrloster Schauspieler, der mit seiner Frau in einem schäbigen Mansardenzimmer zur Untermiete wohnt und dessen jüngstes Kind im Lauf der Handlung stirbt. Auch die ironische Art, mit der das Geschehen geschildert wird, findet sich hier wie dort. Papa Hamlet und Ein Dachstubenidyll unterscheiden sich allerdings eklatant in Aufbau und Sprachgestaltung sowie in der Handhabung intertextueller Bezüge. So ist Papa Hamlet keine lakonisch und zügig erzählte „Skizze“ (102) mehr, sondern ein in insgesamt sieben Abschnitte unterteilter Text mit episodischer Struktur, der den Niedergang einer Familie in einzelnen, die Spanne eines Jahres abdeckenden Momentaufnahmen festhält. Durch diese Anordnung erhält die Erzählung eine Finalität, die dem Geschehen den Charakter der Zwangsläufigkeit verleiht. Ihren Höhepunkt findet die Handlung an einem besonders symbolträchtigen Datum, nämlich dem Jahreswechsel. Da die Familie am bevorstehenden Neujahrstag aus ihrer Unterkunft ausziehen muss, weil sie seit längerem mit der Miete in Rückstand ist, betrinkt sich die Hauptfigur Niels Thienwiebel in der Sylvesternacht noch einmal und erstickt in stark alkoholisiertem Zustand versehentlich den Säugling. Acht Tage später wird sie, „erfroren durch Suff“ (63), in der Gosse aufgefunden.
Dialoggestaltung
Gleichfalls merklich verändert ist der Sprachduktus des Textes. Während Ein Dachstubenidyll noch von Erzählernarration dominiert wird, haben in Papa Hamlet Gesprächspassagen die Oberhand gewonnen und den erzählerischen Anteil zurückgedrängt. Zwar ist die Dialoggestaltung erst ansatzweise auf eine möglichst exakte Nachbildung mündlicher Rede gerichtet – die einzelnen Personen sprechen im Wesentlichen durch umgangssprachliche und mundartliche Wendungen angereichertes Schriftdeutsch –, doch werden bei manchen Figuren bereits gewisse individuelle Sprecheigentümlichkeiten angedeutet. Außerdem suchen Holz und Schlaf Geräusche klanglich zu imitieren, etwa wenn vorsprachliche Babylaute wiedergegeben werden: „Grrr . . . grrr . . . grrr . . . äh! Grrr . . . äh!“ (45)
Fremdtextbezug
Der deutlichste Unterschied zwischen beiden Narrationen aber zeigt sich im Bereich des Fremdtextbezugs. Während Ein Dachstubenidyll, das von seiner Thematik her an Goethes Dramolett Des Künstlers Erdewallen (1774) erinnert, fast ganz ohne markierte intertextuelle Verweise auskommt, drängt Papa Hamlet den Goethe-Bezug in den Hintergrund und bietet sich stattdessen als Pastiche von Shakespeare-Zitaten dar. Motiviert wird der massive Einsatz geborgter Sprache durch den Beruf des Protagonisten. Anders als der in Ein Dachstubenidyll auftretende „Held“ (102) namens Kraft, der nur ganz allgemein als Typus eines Provinzschauspielers geschildert wird, ist Niels Thienwiebel – zumindest nach eigener Meinung – eine herausgehobene Künstlerpersönlichkeit, nämlich „der große unübertroffene Hamlet aus Trondhjem“ (19). Diese besondere Stellung nun erlaubt, obgleich sie angemaßt ist, nicht nur eine extensive Verwendung shakespearescher Diktion, sondern auch ein ironisches In-Beziehung-Setzen des passionierten Hamlet-Darstellers mit seiner zentralen Rollenfigur. Zwischen Thienwiebel und seiner ehemaligen Paraderolle jedenfalls besteht ein äußerst spannungsvolles Verhältnis von Kongruenz und Inkongruenz. Shakespeares Hamlet ist ja im Zuge der Rezeptionsgeschichte „zu einem Sinnbild des enttäuschten Idealisten, des witzigen Zynikers“ (Cowen 31973, 150), aber auch des in einer realitätsfernen Vorstellungswelt lebenden Zauderers geworden. Thienwiebel nun teilt mit der shakespeareschen Dramenfigur ein Stück weit das Illusionäre seiner Existenz, vor allem aber das sprachliche Pathos. Während freilich Hamlets Klagen noch weitgehend als der Figur angemessener Ausdruck von Weltekel erscheinen, verrutscht Thienwiebels geborgte sprachliche Pose gänzlich ins Maulheldenhafte. Genau besehen leistet der schneidende Kontrast zwischen der ständig im Munde geführten erhabenen Ausdrucksweise Shakespeares (in der ‚klassisch‘ gewordenen deutschen Übersetzung von August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck) und der schnoddrigen Alltagssprache der aktuellen Gegenwart zweierlei. Indem „die sogenannte alltägliche […] gegen die alte dramatische Sprache“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 372) gesetzt wird und beide zur kalkulierten Kollision gebracht werden, entlarven Holz und Schlaf zum einen die aufgeblasene Hohlheit der herkömmlichen Bühnenrede. Zum anderen führt die Diskrepanz zwischen der heroischen Welt der elisabethanischen Tragödie und den armseligen, nur noch entfernt an eine Bohèmeexistenz erinnernden Lebensbedingungen eines kleinbürgerlichen Hinterhofhaushalts vor, wie lächerlich Thienwiebels inhaltsleer gewordene Ambition eigentlich ist, die sich mit einer nurmehr zitathaft präsent gehaltenen Erinnerung an bessere Tage verbindet und in theatralischem Gebaren, wie etwa „melodramatischen“ (30) Gesten, ihren Ausdruck findet. Nicht zuletzt ob der Monomanie, mit der er immer wieder den einen Bezugstext deklamiert, stellt sich kein Mitgefühl mit dem arbeitslosen „Schmierenkomödianten“ (Martini 1954, 104) ein.
Papa Hamlet als humoristische Groteske
Holz‘ und Schlafs Papa Hamlet ist denn auch weniger eine im Medium der Literatur entworfene soziologische „Studie“, sondern mutet vielmehr auf weite Strecken an wie eine humoristische Groteske mit einem „clownesken“ (Sprengel 1984, 29) Helden. Schon der Titel muss ja als „Paradox“ (Cowen 31973, 152) angesehen werden, findet hier doch eine „Verkittung von heroischem Namen und familialer Anrede“ (Sprengel 1984, 26) sowie eine gewaltsame Überblendung des Familienvaters Thienwiebel mit dem Junggesellen Hamlet statt, was ausgesprochen komische Effekte zeitigt. Insofern bietet sich der Text als „eine Übung im Ironischen“ (Cowen 31973, 151) dar. Besonders deutlich zeigt sich das in der distanzierten und zuweilen bis zu offenem Sarkasmus gehenden Stellung des Erzählers zu seinen Figuren. Der heruntergekommene und zur Gewalttätigkeit neigende Protagonist wird mit nachgerade ostentativem Spott andauernd als der „große Thienwiebel“ bezeichnet und seine kränkliche und ungepflegte Frau Amalie – „Hamlet“ zitierend – „reizende Ophelia“ genannt. Seine eigentliche Pointe erhält dieser parodistische Darstellungsgestus durch den Umstand, dass in Shakespeares Drama bereits Hamlet selbst eine Haltung zynischer Ironie zu seiner Umwelt einnimmt. Er erscheint dort als eine Art Schauspieler, der seine wahre Meinung vor den als intrigant eingeschätzten Mitmenschen zu verbergen trachtet und dabei sogar soweit geht, sich als Wahnsinniger zu gerieren. All diese Motive nun werden in Papa Hamlet aufgegriffen, allerdings jeweils durch „Brechung“ (Sprengel 1984, 25) verfremdet. Die Autoren Arno Holz und Johannes Schlaf betreiben mithin ein raffiniertes Spiel mit der berühmten Vorlage, und erst diese intertextuelle Komponente verleiht der Erzählung den Charakter einer Sprachetüde.
Milieustudie
Dennoch erfüllt der Text zumindest in Teilen auch die Anforderungen einer Milieustudie. Interessanterweise verliert sich im Lauf des sechsten Abschnitts nämlich der Sarkasmus in der Darstellung, so dass die Schlusspassage des Textes (mit Ausnahme der letzten Zeilen) eine soziale Elendsschilderung gibt, wie sie für den Naturalismus typisch ist. Die Klage etwa: „Man wird ganz zum Vieh bei solchem Leben!“ (60) wird in keiner Weise relativiert oder ironisiert. An einer Stelle heißt es über den heruntergekommenen Schauspieler Thienwiebel sogar, abermals Shakespeare zitierend: „Die ganze Wirtschaft bei ihm zu Hause war der Spiegel und die abgekürzte Chronik des Zeitalters.“ (53) So redegewaltig der Protagonist der Erzählung auf den ersten Blick zu sein scheint, in Wirklichkeit ist er doch alles andere als sprachmächtig. Seine Gedanken und Empfindungen jedenfalls kann er nur in einer Redeweise ausdrücken, die geborgt ist. Insofern reiht sich auch Thienwiebel in die lange Reihe von Figuren in der Literatur des Naturalismus ein, die sich auf Grund ihrer Herkunft und ihres sozialen Milieus in akuten Verständigungsnöten befinden und denen die Sprache keinen adäquaten Artikulationsmodus mehr bietet.
Montagetechnik
Über die virtuose Montagetechnik hinaus stößt Papa Hamlet aber auch auf dem Gebiet der erzählerischen Darbietungsweise in Neuland vor. Zwischen die Dialogpartien sind nämlich immer wieder Abschnitte eingeschoben, in denen winzige, nebensächlich wirkende Realitätselemente detailgetreu geschildert werden:
Das Lämpchen auf dem Tisch hatte jetzt leise zu zittern angefangen, die hellen, langgezogenen Kringel, die sein Wasser oben quer über die Decke und ein Stück Tapete weg gelegt hatte, schaukelten. Das Geschirr und das Glas hob sich schwarz aus ihnen ab. Die Kaffeekanne reichte bis über die Decke. […]
Das Nachtlämpchen auf dem Tisch hatte jetzt zu zittern aufgehört.
Die beschlagene, blaue Karaffe davor war von unzähligen Lichtpünktchen wie übersät. Eine Seite aus dem Buch hatte sich schräg gegen das Glas aufgeblättert. Mitten auf dem vergilbten Papier hob sich deutlich die fette Schrift ab: „Ein Sommernachtstraum“. Hinten auf der Wand, übers Sofa weg, warf die kleine, glitzernde Photographie ihren schwarzen, rechteckigen Schatten. (57 und 59)
„Sekundenstil“
Hanstein hat diese Darstellungstechnik „Sekundenstil“ genannt, weil hier „Sekunde für Sekunde“ die Zustände und Veränderungen einzelner Aspekte der Wirklichkeit in „Zeit und Raum geschildert werden“ (Hanstein 1901, 157). Wie Heinrich Hart in seinen Erinnerungen berichtet, habe Holz Spezifik und Intention des Verfahrens folgendermaßen beschrieben:
Er entwickelte seine Ansicht am Beispiel eines vom Baum fallenden Blattes. Die alte Kunst hat von dem fallenden Blatt weiter nichts zu melden gewußt, als daß es im Wirbel sich drehend zu Boden sinkt. Die neue Kunst schildert diesen Vorgang von Sekunde zu Sekunde; sie schildert, wie das Blatt, jetzt auf dieser Seite vom Licht beglänzt, rötlich aufleuchtet, auf der andern schattengrau erscheint, in der nächsten Sekunde ist die Sache umgekehrt, sie schildert, wie das Blatt erst senkrecht fällt, dann zur Seite getrieben wird, dann wieder lotrecht sinkt […]. Eine Kette von einzelnen ausgeführten, minutiösen Zustandschilderungen, geschildert in einer Prosasprache, die unter Verzicht auf jede rhythmische oder stilistische Wirkung der Wirklichkeit sich fest anzuschmiegen sucht, in treuer Wiedergabe jeden Lauts, jeden Hauchs, jeder Pause – das war es, worauf die neue Technik abzielte. (Hart/Hart 2006, 50f.)
Auf diese Weise werden mit einem Mal Wirklichkeitsbereiche erkennbar, die sich vordem entweder der Aufmerksamkeit entzogen haben oder doch nicht als aufzeichnenswert befunden worden sind. Literaturgeschichtlich ist „dieses Eingehen auf die Intimitäten der Erscheinungswelt […] etwas schlechthin Neues“ (Lamprecht 1902, 212). Viele Zeitgenossen reagierten allerdings mit Befremden auf die minutiöse erzählerische Wiedergabe scheinbar belangloser Details. Karl Henckell etwa kritisierte die „bis zur völligen Unverständlichkeit gesteigerte Verworrenheit der Darstellung“ und warf gar die Frage auf, ob Papa Hamlet möglicherweise „eine gutgemeinte Parodie“ (Henckell 1889, 106) sei.
Verselbständigung des Wortmaterials
Es liegt auf der Hand, dass der mikroskopisch angelegte Blick auf Einzelheiten eine irritierende Wirkung ausübt, weil er eingefahrene literarische Wahrnehmungsroutinen unterläuft. Durch den Sekundenstil geht nicht nur der souveräne Überblick über das Ganze verloren, die von Holz und Schlaf vorgenommene Verlagerung des Wahrnehmungsfokus auf die kleinen und scheinbar nebensächlichen Dinge kassiert auch die Distanz zum Dargestellten: „by bringing us so close to objects they deprive us of reassuring familiarity“ (Osborne 1971, 46). Überdies befreite die Entwicklung dieser Darstellungstechnik die Literatur von der Fixierung auf plot und erzählerische Sukzession. Geleitet von dem Ziel, die Umstände eines zu berichtenden Vorgangs möglichst genau zu bestimmen und so die Determinanten naturgesetzlicher Abläufe offenzulegen, koppelten Holz und Schlaf die literarische Darstellung vom Zwang fortschreitender Mitteilung ab. Die Sprache blieb zwar noch im Dienst der Beschreibung, doch verselbständigte sie sich gewissermaßen unter der Hand, weil sie nur noch der Deskription selbst, aber nicht mehr narrativen Gesetzmäßigkeiten gehorchte. Von hier aus war es dann nur noch ein Schritt bis zur völligen Abkoppelung des Wortgebrauchs vom Dienst der Mitteilung und zur Verselbständigung des zum Einsatz kommenden Wortmaterials.
Wirkung
Wie groß die Wirkung von Holz‘/Schlafs Erzählexperiment auf die literarische Öffentlichkeit war, zeigt Samuel Lublinskis Feststellung, Papa Hamlet habe seinerzeit „förmlich wie eine Bombe“ (Lublinski 1974, 86) eingeschlagen. In der Tat wurde die eminente literaturgeschichtliche Bedeutung der Textsammlung von den Zeitgenossen früh erfasst. So bekannte Gerhart Hauptmann, dass er von ihr „das Bilden der Sprache“ (Hauptmann 1963, 197) übernommen habe. Und Max Halbe äußerte in seinen Erinnerungen über Papa Hamlet: „Dieses Büchlein ist gleichsam die Magna Charta des ‚konsequenten Naturalismus‘ geworden, wie die Bewegung von da ab hieß.“ (Halbe 1940, 360)
Die Familie Selicke
Die von Hauptmann und Halbe gegebenen Hinweise auf die Art und Weise der Sprachverwendung im Bereich der Figurenrede zeigen sehr deutlich, was als das eigentlich Neue der Kurzprosa von Holz und Schlaf empfunden wurde. Und tatsächlich haben die Studien der Sammlung Papa Hamlet gemeinsam, dass sie zentral „vom Dialog“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 329) ausgehen. In einem Brief von Holz an Schlaf aus den späten achtziger Jahren heißt es denn auch programmatisch: „Keine Verse mehr, keine Romane mehr, für uns existiert nur noch die offene, lebendige Szene!!!“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 330) Schlaf stimmte der Einschätzung seines Freundes zu – „Dramen müßten wir schreiben, das wäre das ‚Allerbeste!‘“ – und erläutert in seiner Antwort die Vorteile der auf direkter Rede aufbauenden Gestaltungstechnik folgendermaßen: „Sehr oft wird die Wiedergabe und die Erinnerung der Milieus dadurch ganz wesentlich erleichtert und bekommt auch eine weit größere Wirkung.“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 330) In der schriftstellerischen Praxis lässt sich die Fokusverlagerung von stark mit Dialogen durchsetzter Narrativik zur Bühnendramatik modellhaft an einem Text beobachten. Im Sommer oder Herbst 1889 ging das Autorenduo nämlich daran, Johannes Schlafs in der zweiten Februarhälfte entstandene Erzählung Eine Mainacht in einen auf Aufführung hin angelegten szenisch-dramatischen Text umzuarbeiten. Das Ergebnis dieses Umformungsprozesses ist das Stück Die Familie Selicke, das Anfang 1890 im Druck erschien und am 7. April vom Berliner Theaterverein ‚Freie Bühne‘ uraufgeführt wurde.
Entstehung
Die Entstehung der Familie Selicke vollzog sich in enger Wechselwirkung mit dem befreundeten Kollegen Gerhart Hauptmann. Kurz nachdem Holz und Schlaf ihm im Januar 1889 aus der Sammlung Papa Hamlet vorgelesen hatten, die großen Eindruck auf ihn machte, schlugen sie ihm vor, doch gemeinsam ein Drama zu verfassen. Hauptmann war anfangs durchaus bereit, auf diesen Vorschlag einzugehen, doch reifte ein eigener „Dramenplan“ (zit. nach Berthold 1967, 229) dann schneller als sich die verabredete Kooperation in die Tat umsetzen ließ. In den Frühjahrsmonaten des Jahres 1889 verfolgten Holz und Schlaf so die Niederschrift von Vor Sonnenaufgang aus nächster Nähe, das sie übereinstimmend für „das beste Drama, das jemals in deutscher Sprache geschrieben worden ist“ (Hauptmann 1962, 52), erachteten. Die zügige Fertigstellung des Textes brachte sie nun allerdings selbst in Zugzwang, da sie natürlich nicht hinter Hauptmann zurückstehen wollten. Die Verwirklichung des eigenen Projekts vollzog sich mithin in gewisser Konkurrenz zu Vor Sonnenaufgang. Im Endeffekt führte die zeitlich unmittelbar benachbarte Entstehung der zwei Dramen jedenfalls zu gewissen Parallelen in Figurenzeichnung, Motiveinsatz und Sprachverwendung. So erinnert nicht nur das verhinderte Liebespaar Gustav Wendt/Toni Selicke (in Eine Mainacht fehlt die Figur Wendts noch) an die Konstellation von Alfred Loth und Helene Krause, auch die Thematisierung des Phänomens Alkoholismus und seiner Folgen ähnelt sich in beiden Stücken. Erkennbare Übereinstimmungen lassen sich darüber hinaus im extensiven Gebrauch von Dialektsprache und in der starken Ausweitung von Regiebemerkungen erkennen. Freilich sind auch Unterschiede nicht zu übersehen. In der Familie Selicke wird eher „Armutsalkoholismus“ statt „Wohlstandstrinkerei“ (Scheuer 1988, 92) vorgeführt, und die Gründe sozialer und psychischer Verrohung werden ausschließlich in den „Umständen“ (195), d.h. dem Milieu, und nicht in erblichen Faktoren gesucht. Dementsprechend beschreiben Holz und Schlaf vorwiegend das räumliche Ambiente der Handlung in den Bühnenanweisungen, während Hauptmann hier sehr viel stärker Physiognomik und Habitus der Figuren schildert. Auch kommt der Vorgeschichte in der Familie Selicke eine weit geringere Rolle zu, so dass die Struktur des analytischen Enthüllungsdramas einer weitgehend präsentischen Zustandsschilderung weicht.
Inhaltsangabe
Das Stück spielt an einem Weihnachtsabend der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts in der ärmlich-kleinbürgerlichen Wohnung der Selickes im Berliner Norden. Frau Selicke, kränkelnd, wehleidig und vergrämt, schickt ihre beiden Söhne dem trunksüchtigen Vater entgegen. Sie hofft, ihn auf diese Weise dazu bewegen zu können, wenigstens am Heiligen Abend nach der Arbeit „auf’m Comptoir“ (186) nach Hause zu kommen, zumal sich der Gesundheitszustand der achtjährigen, an Schwindsucht leidenden Tochter Lina zusehends verschlechtert. Nacheinander werden nun die weiteren dramatis personae eingeführt: der mit der Familie befreundete Nachbar namens Kopelke – ein arbeitsloser Schuster, der durch allerlei Gelegenheitstätigkeiten seinen Lebensunterhalt bestreitet –, die erwachsene Tochter Toni und der angehende Theologe Gustav Wendt, der als Untermieter bei Selickes ein Zimmer bewohnt. Wendt hat eben seine Berufung auf eine vakante Stelle als Pastor in einem kleinen Dorf erhalten und bittet Toni, seine Frau zu werden und ihm dorthin zu folgen. Diese erwidert seine Zuneigung zwar, zögert aber, den Heiratsantrag anzunehmen, da sie ihre Eltern, die sich während ihrer Ehe völlig voneinander entfremdet haben, und die Geschwister nicht im Stich lassen will. Das quälende Warten auf den Vater dauert an, der erst spät in der Nacht in betrunkenem Zustand erscheint. Als Linchen wenig später stirbt, bricht er zusammen. Am Morgen löst Toni ihre Verbindung mit Wendt, um den fragilen Familienzusammenhalt nicht vollends zu zerstören. Wendt erkennt ihre Selbstaufopferung für die Familie widerstrebend an und stellt am Ende sogar in Aussicht wiederzukommen, wobei diese Zusicherung offenbar der beklemmenden Situation bei der Verabschiedung entspringt.
Technik der Momentaufnahme
Die Handlung des Dramas, das die aristotelischen Einheiten der Zeit, des Ortes und der Handlung strikt wahrt, ist auf drei Akte verteilt. Durch die geringfügigen zeitlichen Sprünge zwischen den einzelnen Aufzügen wird die Zerrüttung einer Familie in Momentaufnahmen vorgeführt. Die Konzentration auf das familiäre Wohnzimmer als Handlungsraum und die Begrenzung der Zeit auf etwas mehr als einen halben Tag sorgen dabei für jene Beobachtungsbedingungen, die Zola für den Experimentalroman gefordert hat. Hier wird tatsächlich ein Ausschnitt künstlerisch imitierter Realität vorgeführt, mit dessen Hilfe sich eine Situation in quälender Direktheit beobachten lässt. Die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen spiegeln sich im Verhalten der Figuren freilich nur indirekt. Deshalb kann Die Familie Selicke nicht oder nur sehr bedingt dem Typus des sozialen Dramas zugeordnet werden. Zwar fehlt es nicht an Verweisen auf „de Umstände“ (195), doch wird bei Holz und Schlaf „das Soziale […] nicht mehr als Konflikt der Individuen mit der politischen-gesellschaftlichen Situation, sondern […] als innerfamiliärer Kampf gestaltet“ (Scheuer 1988, 90). Die Kommunikation zwischen den Ehepartnern ist so fundamental gestört, dass Eduard Selicke lieber mit dem Kanarienvogel spricht als mit seiner Frau; ausgerechnet ihn behandelt er, „als wenn er ein Mensch wär‘“ (198). Die Trunksucht des Familienoberhaupts entspringt denn auch nurmehr teilweise der Verzweiflung über soziale Not, sondern wird vielmehr als Reaktion auf eine zerrüttete private Situation geschildert. Gerade hier, in der Motivierung des für die Literatur des Naturalismus zentralen Problemkomplexes Alkoholismus, wird eine aufschlussreiche Akzentverschiebung gegenüber prominenten Vorgängertexten wie Tolstois Macht der Finsternis und Hauptmanns Vor Sonnenaufgang erkennbar: „In the former case […] the causes were seen as social and moral – drunkenness was one form of corruption by money – and in the latter they were lergely hereditary. Here [in Die Familie Selicke] […] the reasons are personal and private.“ (Turner 1969, 199) Die Intimisierung des Dargestellten geht dabei durchweg einher mit einer Psychologisierung, wobei „das Seelische als Chiffre für das Soziale“ (Scheuer 1988, 91) erscheint.
Elemente der Kontrafaktur
Wie die bei der Umarbeitung vorgenommene, signifikante Verschiebung der Handlungszeit von Mai zu Dezember zeigt, stellt Holz‘ und Schlafs „Drama eine Kontrafaktur zu den Vorgängen in der heiligen Nacht“ (Scheuer 1988, 99) dar. Der Text entlarvt damit religiöse Tröstungsangebote als falsche Versprechungen. Mit besonderem Nachdruck wird der Verlust aller Hoffnungen auf Heil und Erlösung in der modernen Welt anhand der Figur des Kandidaten der Theologie, Gustav Wendt, vorgeführt. Die Erfahrungen, die er während seines Studiums in der Großstadt gemacht hat, haben die Basis seines Glaubens soweit ausgehöhlt, dass er sein Vertrauen in die Menschheit und damit allen Halt verloren hat:
Die Menschen sind nicht mehr das, wofür ich sie hielt! Sie sind selbstsüchtig! Sie sind nichts weiter als Tiere, raffinierte Bestien, wandelnde Triebe, die gegeneinander kämpfen, sich blindlings zur Geltung bringen bis zur gegenseitigen Vernichtung! Alle die schönen Ideen, die sie sich zurechtgeträumt haben, von Gott, Liebe und … eh! das ist ja alles Blödsinn! Blödsinn! Man … tappt nur so hin. Man ist die reine Maschine! Man … eh! es ist ja alles lächerlich! (208)
Zur Funktion von Sentimentalität
Angesichts dieser ausweglosen Situation bleiben den Figuren nur kompensatorische Akte. Sie können etwa eskapistisch sein wie bei den männlichen Figuren (der Versuch, eine beschauliche Liebesidylle auf dem Land zu schaffen, bei Wendt, die Flucht ins Dandytum beim ältesten Sohn Walter, der Griff zur Flasche beim Vater) oder tendenziell selbstzerstörerisch wie bei den weiblichen Figuren (der verbissen-freudlose Pflichtheroismus bei Toni, das theatralische Selbstmitleid bei der Mutter). Da das Stück ausschließlich im Rückzugsraum der Familie spielt und die traditionell weiblich dominierte Handlungssphäre des Privaten nie verlässt, prägen insbesondere die wehleidige Larmoyanz von Frau Selicke und der Jammer um das kranke Lienchen auf weite Strecken das Bühnengeschehen. Von einigen Zeitgenossen wurde das Drama deshalb auch spöttisch „Familie Rührselicke“ (H.[arden] 1890, 254) genannt. Die seitdem vielfach konstatierte Sentimentalität einzelner Handlungselemente dient indes nicht so sehr der Rührung des Publikums, vielmehr wird von Holz und Schlaf ein Affekt erzeugt, der in der zitathaften Weise, in der er aufgerufen wird, ein Wirkungsschema bürgerlicher Dramatik erkennbar werden lässt. Am deutlichsten wird dies, wenn man den Text mit dem Trauerspiel des 18. Jahrhunderts vergleicht. Zielte die Entbindung von Emotionen dort noch auf Katharsis, hat ein solcher Effekt im späten 19. Jahrhundert seine ursprüngliche Funktion längst eingebüßt und ist eine abgenutzte Theaterkonvention geworden. Rührseligkeit wird von Holz und Schlaf vorrangig deshalb erzeugt, um zur Schau gestellt zu werden. Sie verkörpert ebenso ein Relikt vergeblicher symbolischer Orientierung an bildungsbürgerlichen Werten wie die „vergilbten Gipsstatuetten“ Goethes und Schillers bzw. der „bekannte Kaulbachsche Stahlstich ‚Lotte, Brot schneidend‘“ (185), die über dem Sofa der Selickes angebracht sind. Insofern müssen die rührenden Szenen immer auch als sarkastischer Kommentar auf pathetisch beschworene Familienwerte und den Gefühlshaushalt des wohlsituierten Bürgertums verstanden werden. Tatsächlich aber ist die dargestellte Situation so deprimierend, dass jede Art von Tröstung daran zerschellt. Toni erscheint in diesem Zusammenhang nachgerade als eine tragikomische Lotte rediviva, die sich unbewusst an einem längst obsolet gewordenen weiblichen Rollenmodell orientiert und deren mitfühlend-barmherzige Haltung in emotionale Selbstverstümmelung umkippt. Handlungselemente und Motive der Literatur des 18. Jahrhunderts werden also in Die Familie Selicke gezielt aufgegriffen, allerdings erscheinen sie vielfach entstellt oder werden ihrer angestammten Funktion beraubt. So zitiert etwa das Liebesverhältnis zwischen Gustav Wendt und Toni Selicke unverkennbar die geläufige Konstellation der unerfüllbaren Liebe über Standesschranken oder familiäre Hindernisse hinweg, wobei bei Holz/Schlaf jeglicher dramatische Konflikt gänzlich wegfällt und der eigensinnige Verzicht einer der beiden Figuren das Verhältnis beendet. Überhaupt liefern die Verhaltensweisen der gezeigten Personen keine Handlungsanleitung mehr für den Zuschauer. Selbst der Rühreffekt läuft völlig ins Leere, weshalb sich Die Familie Selicke auch als eine Art Abgesang auf das bürgerliche Trauerspiel verstehen lässt. Whitinger kann deshalb im Hinblick auf Die Familie Selicke und andere häufig als dramentechnisch konventionell und wirkungsästhetisch sentimental eingestufte Stücke feststellen: „By the time these plays make their alleged retreats into convention, their metapoetic elements have long since encouraged a skeptical look at such flight into idealistic illusions or emotional catharsis.“ (Whitinger 1990, 84)
Das ästhetische Potential des ansonsten wenig bühnentauglichen Textes klar erkannt hat Theodor Fontane. In seiner Besprechung der Uraufführung schreibt er:
Die gestrige Vorstellung der ‚Freien Bühne‘ brachte das dreiaktige Drama der Herren Arno Holz und Johannes Schlaf: Die Familie Selicke. Diese Vorstellung wuchs insoweit über alle vorhergegangenen an Interesse hinaus, als wir hier eigentlichstes Neuland haben. Hier scheiden sich die Wege, hier trennt sich alt und neu. […] Das Stück beobachtet das Berliner Leben und trifft den Berliner Ton in einer Weise, daß auch das Beste, was wir auf diesem Gebiete haben, daneben verschwindet. (Fontane 1969, Bd. 2, 845f.)
Realitätsgetreue Nachbildung mündlicher Rede
Der Hinweis auf den „Berliner Ton“ und die Konstatierung einer „photographischen Treue“ (Fontane 1969, Bd. 2, 846) bei der Realitätswiedergabe lenken den Blick auf jene Besonderheit des Textes, die von den Zeitgenossen als besonders innovativ wahrgenommen wurde, nämlich die spezifische Art und Weise, Sprache einzusetzen. Julius Hillebrand hatte ja schon 1886 gefordert, dass der konventionelle Bühnenjargon durch „die Sprache des Lebens“ (Hillebrand 1886, 236) ersetzt werden soll. Die realitätsgetreue Nachbildung mündlicher Rede verfolgt dabei das Ziel, den inneren und äußeren Zustand einer Person so vollständig wie möglich und unter Verzicht auf unglaubwürdig wirkende Kunstgriffe wie Monologe oder Beiseitesprechen zu offenbaren. Getragen von der Überzeugung, dass sich in der Art und Weise, wie sich ein Mensch verbal artikuliert – seinem Sprechtempo, seiner Phrasierung, seiner dialektalen Färbung, seinen individuellen Redegewohnheiten –, nicht nur sein sozialer Stand und seine Herkunft, sondern auch seine psychische Verfassung und seine emotionale Gestimmtheit niederschlagen, sollten Bühnenfiguren von nun an vorrangig mithilfe gesprochener Sprache – und damit lediglich zu einem Teil durch den Inhalt und stärker durch das Wie des Gesagten – charakterisiert werden:
„The distinctive concern of Holz and Schlaf to make the language of the drama the mirror of everyday speech was not in the end shaped by any mechanical veristic aim but by the belief that such casual and intimate conversation was laden with psychological significance: that it was in fact the most sensitive and incisive means by which the drama as a personative form could illuminate the recesses of the individual consciousness.“ (McInnes 1976, 128)
Aufwertung nonverbalen Ausdrucks
Indem nun dergestalt „die sogenannte alltägliche […] gegen die alte dramatische Sprache“ (Holz 1924/25, Bd. 10, 372) gesetzt wurde, konnte die überkommene Theaterdiktion überwunden werden. Ein Nebeneffekt dieser Gestaltungstechnik war, dass unartikulierte Laute wie Ächzen, Seufzen, Stöhnen und Murren sowie Geräusche enorm an Bedeutung gewannen. Die zeitgenössische Kritik hat deshalb Holz‘ und Schlafs Drama abfällig als „Thierlautkomödie“ (zit. nach Holz 1924/25, Bd. 10, 110) bezeichnet. Hermann Bahr dagegen würdigte die Bedeutung des Stücks unvoreingenommen und bemerkte rückblickend über Die Familie Selicke: „Sie schuf die Sprache des deutschen Theaters für die nächsten fünfzehn Jahre.“ (Bahr 1921, 83)
Zur Rolle von Arno Holz und Johannes Schlaf
In der Widmung, mit der die Erstauflage von Vor Sonnenaufgang versehen ist, hat Gerhart Hauptmann in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass sich die „entscheidende Anregung“ (Münchow 1970, Bd. 1, 236), die zur Abfassung seines Dramas geführt hat, der Prosasammlung Papa Hamlet seiner Kollegen Holz und Schlaf verdanke. Was genau ihn daran beeindruckt hat, geht aus einer späteren Bemerkung hervor:
Da nun Papa Hamlet einen Versuch bedeutete, die Sprechgepflogenheiten der Menschen minutiös nachzubilden durch unartikulierte, unvollendete Sätze, monologische Partien, kurz, den Sprecher, wie er stammelt, sich räuspert, spuckt, in früher unbemerkten Einzelheiten darzustellen, und dadurch in der Tat etwas überraschend Neues zutage trat, fand ich mich stark […] angeregt. (Hauptmann 1962–74, Bd. 11, 495)
In gewisser Weise markiert die hier konstatierte Übertragung einer in narrativem Zusammenhang entwickelten Technik der Sprachverwendung auf die szenische Darstellungsform den für die weitere Entwicklung des Naturalismus so bedeutsamen „Schnittpunkt zwischen Prosa und Drama“ (Mahal 1975, 28), und die Praktikabilität dieser Verfahrensweise leitete bei den naturalistischen Autoren dann rasch den zweiten einschneidenden Wechsel in der Gattungspräferenz ein. Wie sehr Hauptmann sich tatsächlich an der sprachlichen Gestaltung von Papa Hamlet orientiert hat, mag ein unscheinbar wirkendes Detail verdeutlichen. Während Niels Thienwiebels Redeweise dadurch charakterisiert ist, dass er in seine Äußerungen ständig die Floskel „– e –“ einflicht, zeichnet sich in Vor Sonnenaufgang Frau Spiller, die Gesellschafterin Frau Krauses, durch folgende Artikulationseigentümlichkeit aus: „ihr Ausatmen geschieht jedesmal mit einem leisen Stöhnen, welches auch, wenn sie redet, regelmäßig wie ‚m‘ hörbar wird“ (24). Dieser in den Dialogpartien, in denen Frau Spiller zu Wort kommt, vielfach wiederkehrende Laut kann geradezu als direkte Reverenzgeste gegenüber den Kollegen Holz und Schlaf angesehen werden.
Titelgebung
Der Einfluss der beiden schlägt sich aber auch in der Titelgebung nieder. So wurde die ursprünglich von Hauptmann vorgesehene Überschrift „Der Säemann“ auf Anregung von Holz geändert. Damit geht eine gewisse Verschiebung des Wahrnehmungsfokus einher, die einem Strukturmuster naturalistischer Texte entspricht. Wie sich zeigt, vermeiden nämlich viele Dramen des Naturalismus „den Individualtitel: Familie Selicke, Einsame Menschen, Freie Liebe, Jugend“, aber auch Die Ehre (Hermann Sudermann), Friedensfest (Gerhart Hauptmann), Eisgang (Max Halbe) oder Dämmerung (Elsa Bernstein);mehr noch: „Dort wo ursprünglich ein Titel gewählt war, der eine Gestalt hervorhob, wird er geändert: ‚Der Sämann‘ → Vor Sonnenaufgang, ‚Friedensengel‘ → Friedensfest ([vgl.] Kauermann [1933,] 68).“ (Praschek 1957, 77) Dies ist eine direkte Konsequenz der von den Naturalisten betriebenen Depotenzierung des Subjekts, die zu einer nachhaltigen „Relativierung des Individualbegriffes“ (Hamann/Hermand 1959, 207) führt. Die Literatur des Naturalismus entwirft auf weite Strecken das Bild einer „Wirklichkeit, in der der einzelne nur noch als unpersönliches Geschehen eingebettet ist, wo nicht mehr sein ‚Ich‘ agiert, sondern wo ‚Es‘ über ihn verfügt“ (Hamann/Hermand 1959, 210).
Inhaltsangabe
Die Frage, welche Faktoren das Handeln des Menschen bestimmen und inwieweit er fremdgesteuert ist, steht auch im Zentrum von Vor Sonnenaufgang. Der Inhalt des Stückes ist rasch skizziert: Der Protagonist Alfred
Loth, der als Opfer des Bismarckschen Sozialistengesetzes eine Gefängnisstrafe verbüßt hat und nunmehr Redakteur einer Arbeiterzeitung ist, hat eine Reise in die schlesischen Kohlendistrikte unternommen, um dort Material zu sammeln für eine Studie über Arbeitsbedingungen und soziale Lage der Bergleute. Im Ort Witzdorf trifft er seinen Jugendfreund Hoffmann, der eine wohlhabende Bauerntochter geheiratet hat und durch skrupellose Geschäftspraktiken einer der einflußreichsten Grubenbesitzer des Reviers geworden ist. Hoffmann hält sich im Hause seines Schwiegervaters auf, um dort die Niederkunft seiner Frau Martha abzuwarten. Diese ist schwer alkoholsüchtig, und ihr Vater ist ein im Delirium tremens befindlicher Alkoholiker. Das ganze Milieu ist geprägt durch Luxus, Völlerei, Suff und sexuelle Ausschweifung. Helene, die zweite Tochter des Bauern Krause, ist in einer Herrnhuter Pension erzogen worden und leidet unter der Verkommenheit dieser Umgebung. Während Hoffmann versucht, Loth so schnell wie möglich loszuwerden, bemüht sie sich, den bewunderten Mann zu halten […]. Loth erklärt mehrfach, daß er mit Rücksicht auf die Nachkommen nur eine körperlich und geistig gesunde Frau heiraten will; er ist von den erbschädigenden Wirkungen des Alkoholismus überzeugt. Da ihm – im Gegensatz zu den Zuschauern – das Familienübel verborgen bleibt, erwidert er Helenes Gefühle. Dann jedoch klärt der anläßlich der Entbindung ins Haus gerufene Arzt [Dr. Schimmelpfennig, ein ehemaliger Studienkollege,] Loth über die ‚Alkoholpest‘ der Familie auf. Dieser entschließt sich, das Haus sofort zu verlassen […]. Helene betritt die Szene mit der Nachricht von der Totgeburt des Kindes ihrer Schwester, findet Lothas Abschiedsbillet und nimmt sich in einem Akt der Verzweiflung das Leben. (Bellmann 1988, 9f.)
Vorbilder
In thematischer und stofflicher Hinsicht lassen sich mehrere literarische Vorbilder für Hauptmanns Stück benennen. Als Dramentext hat fraglos vor allem Tolstois Die Macht der Finsternis prägend auf Vor Sonnenaufgang gewirkt, geht es dort doch ebenfalls um die Korrumpierung einer Bauernfamilie durch Profitgier und Wohlstand, was geradewegs zu Alkoholismus und moralischer Verkommenheit führt. Hauptmann hat denn auch Tolstoi als den „großen Paten“ (Hauptmann 1962–74, Bd. 6, 800) seines dramatischen Erstlingswerks bezeichnet. In narrativer Form begegnet das Thema Alkoholismus freilich früher schon in „Zolas Säuferroman L’Assommoir“ (Litzmann 1894, 162), und Fragen der Heredität stehen auch im Zentrum des Rougon-Macquart-Zyklus. Die dortige Behandlung des Sujets Vererbung „geht zweifellos auf Cesare Lombroso (1836–1909) zurück, der in seiner Studie L’uomo delinquento (1876) erstmalig das Verbrechen aus der physiologischen Veranlagung des Täters zu erklären versucht hat“ (Schmidt 1974, 110). Auf Grund der Ähnlichkeit der familiären Verfallsgeschichten haben Zeitgenossen Vor Sonnenaufgang auch als „Rougon-Macquarts in Duodez“ (Arnold 1908, 192) bezeichnet.
Heredität und Determinismus
Alles in allem behandelt Hauptmann den Problemkomplex Determinismus aber in sehr differenzierter Form. In seiner Haltung zu diesem Thema schlagen sich u.a. Erfahrungen nieder, die er 1888 während eines längeren Aufenthalts in Zürich gemacht hat. Dort kam er in Kontakt mit dem Psychiater Auguste Forel, in dessen Heilanstalt er nicht nur mit zahlreichen psychischen Krankheitsformen konfrontiert wurde, sondern durch den er auch von den degenerativen Folgen übermäßigen Alkoholgenusses erfuhr. Hauptmann machte sich im folgenden Forels These „von den erbgutschädigenden Wirkungen des Alkoholmißbrauchs“ zu eigen und begann dessen Überzeugung zu teilen, dass zwar „nicht die Trunksucht an sich vererbbar sei, wohl aber die Resistenzunfähigkeit gegen den Alkohol“ (Bellmann 1988, 15). Nach Berlin zurückgekehrt, trat Hauptmann dann als „ausgesprochener Natur- und Gesundheitsapostel“ (Hart/Hart 2006, 147) auf, trug sog. Reformkleidung, ernährte sich vegetarisch und verzichtete gänzlich auf alkoholische Getränke. In dieser Haltung ähnelte er natürlich bis zu einem gewissen Grad der männlichen Hauptfigur in Vor Sonnenaufgang.
Charakterprofil Alfred Loths
Allerdings sind auch die Unterschiede zwischen beiden nicht zu übersehen. So ist Hauptmann anders als Loth beileibe kein mittelloser idealistischer „Agitator“ (Bab 1922, 42). Auch werden die problematischen Seiten dieser Dramengestalt vom Autor mit aller Deutlichkeit herausgearbeitet. Zwar muss man ihn nicht gleich zum „jämmerlichen Ideologen“ (Mayer 1967, 36) oder „entmenschlichten Fanatiker“ (Cowen 1973, S. 163) erklären, doch zeigt der Verlauf des Stücks unverkennbar, dass es Loth letztlich nicht gelingt, sein Privatleben mit seinem sozialen und politischen Engagement zu vereinbaren. Schimmelpfennig hält ihm deshalb vor, er sei von einer „unglücklichen Ehemanie“ besessen, die in Kontrast zu seinen „theoretischen“ (85) Anschauungen stehe. Obwohl er vorgibt, einen „Kampf um das Glück aller“ (41) zu führen und das Wohl seiner Mitmenschen stets über sein eigenes zu stellen, überlässt er seine „Liebste“ (84) „kaltblütig“ (73) ihren bedrückenden Lebensumständen. Auch rückt der Autor den Protagonisten seines Dramas in ein ungünstiges Licht, indem er den prinzipientreuen Weltverbesserer, der so stolz auf seine wissenschaftliche Bildung ist, vieles, was um ihn herum vorgeht, entweder ganz übersehen oder falsch deuten lässt. Nicht nur die Anspielungen darauf, dass es sich bei dem verwahrlosten Trinker, dem er in der Dorfkneipe begegnet ist, um den reichen Bauer Krause handelt, entgehen ihm, selbst von der lautstarken nächtlichen Episode, in der Helene ihren Vater ins Haus zu bringen versucht, bekommt er nichts mit. Klarsicht geht bei Loth also mit partieller Blindheit einher: „As an observer of the social scene he appears as a sensitive and farsighted individual whose statements often seem to acquire a nearchoric authority. In his dealings with the Krauses, on the other hand, he seems remarkably imperceptive and at times downright obtuse.“ (McInnes 1976, 126) Loth wird von Hauptmann vorgeführt als Sozialreformer, dessen Idealismus utilitaristisch verbogen ist – Möbius spricht von einem „Mittel-Zweck-Verhalten“ (Möbius 1982, S. 102) – und der die Erreichung eines abstrakt gedachten Gemeinwohls bedenkenlos individueller Not überordnet. Dass er „Liebe und Menschlichkeit nur als allgemeinen Begriff und Ziel versteht, dass er sie nicht als lebendige Aufgabe hier und jetzt zu ergreifen den Mut hat, dies spricht ihm in den Augen des Autors das Urteil“ (Mennemeier 1985, 228). Als „Reformapostel“ (Zimmermann 1995, S. 496) steht er im Übrigen in der Reihe jener problematischen „Menschheitsbeglücker“ (Mennemeier 1985, 228), die Hauptmann in seinem Frühwerk mehrfach dargestellt hat.
Typenlehre enttäuschten Idealismus
Sein widersprüchliches Charakterprofil tritt noch klarer hervor, wenn man es mit zwei anderen Dramenfiguren vergleicht. Stellt man Loth nämlich neben die Studienfreunde Hoffmann und Schimmelpfennig, dann erweist sich der Werdegang der drei als Typenlehre, was aus jugendlichem Idealismus im Lauf der Zeit werden kann. Während der Sozialdemokrat Loth für seine Überzeugung ins Gefängnis gegangen ist und seine jugendlich revolutionäre Gesinnung nie abgelegt hat, ist Hoffmann durch seine Heirat in die Familie Krause ein arrivierter ausbeuterischer Geschäftsmann geworden, der sich lediglich verbal noch zu einigen seiner früheren Überzeugungen bekennt, im Endeffekt aber anders handelt als er spricht. Schimmelpfennig haben die schwer änderbaren sozialen Gegebenheiten zum Zyniker werden lassen. Er ist ein „eigentümlicher Mischmasch von Härte und Sentimentalität“ (53) geworden. Während er Hoffmann „kalt“ (47) und mit einer Haltung voller „Sarkasmus“ (45) begegnet, gibt er zugleich Medizin kostenlos an Bedürftige ab. Was Hauptmann hier umrisshaft entwirft, sind drei biografische Entwicklungsverläufe, die als Resultate der enttäuschten Reformhoffnungen der studentischen Jugend in der Gründerzeit verstanden werden können. Der soziale Aufstieg ist nur Hoffmann geglückt, der ins Lager der Bourgeoisie wechseln konnte und nun seine Profite zulasten anderer macht. Schimmelpfennig versucht an seinen Idealen insofern festzuhalten, als er den Reichtum der Profiteure nutzt, um soziale Härten zu mildern und in kleinem Maßstab gesellschaftliche Umverteilung zu betreiben. Loth schließlich ist faktisch mittellos – er pumpt denn auch Hoffmann gleich zu Beginn des Stücks um Geld an –, aber bereit, für seine Ideale einzutreten. Er macht sich – im Verzicht auf Alkohol, Tabak und üppiges Essen – geradezu zum Muster für andere, allerdings ist seine praktische Wirksamkeit gering. In gewisser Weise haben alle drei – wenn auch mit sehr unterschiedlicher Ausprägung und deutlich divergierenden Folgen – keine „moralischen Skrupel“ (52): Hoffmann geht es um Profit, Loth um die Verfolgung seiner hehren Ziele, und Schimmelpfennig arrangiert sich mit der Situation, indem er sich, sie verachtend und vermeintlich subvertierend, faktisch zu ihrem Nutznießer macht.
Ästhetische Positionen im Stück
Wie immer man Loth im einzelnen auch einschätzen mag, in keinem Fall kann man ihn umstandslos als „naturalistischen Programmatiker“ (Mennemeier 1985, 228) oder als „Sprachrohr naturalistischer Doktrinen“ (Elm 2004, 167) ansehen. Zwar teilt er mit den Vertretern des Naturalismus gewisse wissenschaftliche Überzeugungen und die grundsätzliche politische Haltung, doch decken sich seine ästhetischen Ansichten mit denen der naturalistischen Bewegung in keiner Weise. Zola und Ibsen etwa spricht er rundheraus den Dichterstatus ab und etikettiert ihre literarischen Hervorbringungen – in Übernahme gängiger gegen sie erhobener Vorwürfe – als eine Form von „Spitalpoesie“ (Brahm 1913, Bd. 1, 450). Das Grundprinzip des Realismus/Naturalismus, Dinge so darzustellen, „wie sie sind“ (40), lehnt er rundheraus ab. Statt dessen möchte er, dass die Kunst „vernünftigen Zwecken“ dient, „vorbildlich“ wirkt und „Menschen“ zeigt, „wie sie einmal werden sollen“ (40). Dies freilich ist nichts anderes als ein Plädoyer für einen didaktisch akzentuierten Idealismus.
Insgesamt ordnet Hauptmann mit Loth, Hoffmann und Helene Krause drei Figuren ästhetische Positionen zu. Helene Krause wird als Leserin des Werther (1774) vorgeführt, ein Text, der für das idealistisch grundierte, goethezeitliche Modell autonomieästhetischer Literatur steht, in der – wie die Pathographie des empfindsamen und unglücklich liebenden Jünglings Werther zeigt – die Grenzen des Darstellbaren bereits stark ausgeweitet sind, die aber krasse Härten in der Darstellung vermeidet und in der Sprachgebung bei aller versuchter Simulation mündlicher Rede einer gewählten Diktion verpflichtet bleibt. Loth lehnt (ebenso wie Helenes Stiefmutter) dieses fest in der bürgerlichen Bildungstradition verankerte Werk vehement ab und bezeichnet es despektierlich als „Buch für Schwächlinge“ (40), offenbar weil es keinen nachahmenswerten Helden hat und keinen Tatheroismus verbreitet. Stattdessen empfiehlt er Helene Felix Dahns Kampf um Rom (1876), einen damals weitverbreiteten historischen Roman mit zeitgeschichtlichen Anspielungen, der mit Blick auf die Gegenwart des neugegründeten deutschen Kaiserreichs legitimatorisch einen heldenhaften Germanenmythos entwirft. Der Umstand, dass der Jurist Dahn als Vertreter der epigonalen Gründerzeitliteratur gelten muss, disqualifiziert ihn aus naturalistischer Sicht von vornherein. Hoffmann schließlich liest überhaupt nur zum Zeitvertreib, weil ihm neben seinen Geschäften kaum Muße für andere Beschäftigungen bleibt. Literatur dient ihm ausschließlich zur Unterhaltung: „Ich will von der Kunst erheitert sein“ (12), äußert er gegenüber Loth. Auf seinem Beistelltischchen liegt ein opulent illustriertes „Prachtwerk“ mit dem Titel „Die Abenteuer des Grafen Sandor“ (58). Gemeint sind damit die Reit-, Fahr- und Jagd-Ereignisse aus dem Leben des Grafen Moritz Sándor (1868), drei jeweils aufwendig mit Goldschnitt, einer Ornamentbordüre und einer Schließe ausgestattete Quartbände mit je 50 aufgezogenen Fotos und kurzem Begleittext von Johann Erdmann Gottlieb Prestel, deren Inhalt Hoffmann selbst als „Unsinn“ (58) bezeichnet. Dieses Werk fungiert als Beispiel für die repräsentativ aufgemachten, inhaltsleeren Luxusbücher der Gründerzeit, die seinerzeit als Statussymbol beliebt waren. Damit sind nun drei unterschiedliche Typen von Literatur (bzw. des Umgangs damit) markiert, die dem von den Naturalisten geforderten Gegenwarts- und Realitätsbezug allesamt nicht gerecht werden, weil sie rückwärtsgewandt und nicht mehr zeitgemäß sind: teure, aber triviale Repräsentationsobjekte, bei denen die Illustrationen den Text zur belanglosen Nebensache degradieren, mit Bildungsgut aufpolierte, vergangenheitsorientierte Werke für das Bürgertum und kanonisierte klassische Texte, die inzwischen Lesestoff für Frauen gehobener Schichten geworden sind. Hauptmanns eigener ästhetischer Ansatz hat also im Text keine Fürsprecher.
Orientierung am ‚klassischen‘ Dramenmodell
Dabei hat sich der Autor sehr darum bemüht, sein Stück, von dem zu erwarten war, dass es beim Publikum Anstoß erregen würde, an die dramatische Tradition rückzubinden. So wird die von Aristoteles geforderte Einheit der Zeit strikt eingehalten, und auch bei den Parametern Ort und Handlung gibt es nur geringfügige Abweichungen vom ‚klassischen‘ Dramenmodell. Selbst die fünfaktige Bauform wird übernommen. Konkret dient das von Ibsen revitalisierte Muster des bereits in der Antike entwickelten analytischen Dramas Hauptmann als Vorbild. Als Familiendrama knüpft es zudem an einen Traditionszusammenhang an, den das bürgerliche Trauerspiel einst begründet hatte. Daneben erhebt das Stück – wie der Untertitel zeigt – aber auch den Anspruch, ein „soziales Drama“ zu sein und nimmt damit jenen Impuls auf, der im 19. Jahrhundert von Büchner über Hebbel bis zu Anzengruber weitergetragen worden ist.
Intertextualität
Über Strukturmuster und Formzitate hinaus trägt zur Kohärenz des Ganzen schließlich der ausgeprägte intertextuelle Charakter des Textes bei. Für die Personenkonzeption der männlichen Hauptgestalt etwa spielen biblische Bezüge eine wichtige Rolle. So verweist die Figur des Loth überdeutlich auf den Lot des Alten Testaments (1. Mos. 19), und das „moralisch verkommene Witzdorf“, das er zu Studienzwecken besucht, erscheint als ein „neues Sodom“ (Zimmermann 1995, 495). Allerdings lassen sich auch zahlreiche Unterschiede erkennen: Loth ist ein Bote aus der Fremde, der sich nur kurzzeitig in Witzdorf aufhält und damit gerade nicht der einzige Gerechte aus der Stadt Sodom selbst (obgleich auch der biblische Lot ein Fremder ist). Zudem verlässt er den Ort „nicht wie der biblische Lot, ‚als die Morgenröte aufging‘, sondern [bereits] vor Sonnenaufgang“ (Zimmermann 1995, 496), und er wendet sich im Augenblick des Abschieds gerade noch einmal um – ganz so, wie es in der biblischen Erzählung Lots Frau tut, die dann zur Salzsäule erstarrt. Kurz: Die partiellen Inkongruenzen der beiden Figuren sind unübersehbar, ja es gibt einen regelrechten „gap between the Old Testament hero and his modern poseur“ (Whitinger 1990, 85). Hauptmanns Loth ist demnach eine weitaus problematischere Person als sein alttestamentarischer Namensvetter, insgesamt gesehen erscheint er „als moralisch in sich widersprüchliche, bei aller Anmaßung persönlich hilflose dramatische Figur“ (Delbrück 1995, 529). Man kann deshalb sagen, dass aus der „biblischen Vorbildgestalt“ (Delbrück 1995, 514, Anm. 4) ein „ambiguous hero“ (Coupe) geworden ist.
Milieustudie
In der anhand einer schlesischen Bauernfamilie vorgenommenen Analyse der korrumpierenden und de-moralisierenden Folgen plötzlichen Reichtums ist Vor Sonnenaufgang einerseits eine genaue Milieustudie, wie sie von der naturalistischen Theorie gefordert wird, gestaltet Hauptmann hier doch
[…] das letzte Stadium des Verfallsprozesses einer neureichen, verbürgerlichten Bauernfamilie, deren Zustand über sich hinausweist auf gesellschaftliche Zustände. Die „Alkoholpest“ der Familie Krause-Hoffmann, die daraus resultierende physische, geistige und moralische Zerrüttung erscheinen als Syndrom, als Krankheitsbild der bestehenden sozialen und ökonomischen Verhältnisse. (Bellmann 1988, 37)
„Tragödie menschlicher Blindheit“
In seinem erkennbaren Bemühen, an die Dramentradition und an die aristotelische Poetik anzuknüpfen, entpuppt sich der Text andererseits aber auch als „Tragödie menschlicher Blindheit“ (Zimmermann 1995), in der gezeigt wird, welche Konsequenzen Unwissenheit und Fehleinschätzungen im zwischenmenschlichen Bereich haben können. Aus dem wechselseitigen Verkennen Alfred Loths und Helene Krauses jedenfalls resultiert schließlich das „doppelte Leiden“ (Zimmermann 1995, 510) beider, das dem Zuschauer mit wirkungsästhetischem Anspruch vorgeführt wird.
Die Mehrdimensionalität des Stücks verkennt denn auch, wer es als bloßes Hereditätsdrama in der Nachfolge von Ibsens Gespenstern sieht. Zwar setzt Hauptmann in Übereinstimmung mit Forel die erbgutschädigende Wirkung übertriebenen Alkoholgenusses voraus, doch tangiert dies letztlich nur die Möglichkeit einer Verbindung zwischen Alfred Loth und Helene Krause, nicht aber das Problem der Willensfreiheit. Niemand muss zum Trinker werden, auch wenn die entsprechende genetische Disposition dafür vorhanden ist. So gibt der Arzt Dr. Schimmelpfennig ausdrücklich zu bedenken, „daß Fälle bekannt sind, wo solche vererbte Übel unterdrückt worden sind“, und zwar mithilfe eines entsprechenden Milieus und einer sorgfältigen „Erziehung“ (88). Des Weiteren weist er darauf hin, dass man „auch einen Trieb niederkämpfen“ (85) könne. Helene vertritt im Übrigen die gleiche Meinung: „Nein –! ich sehe nicht ein, wer mich zwingen kann, durchaus schlecht zu werden.“ (49) Wenn hier Lessings im Nathan geäußertes Credo: „Niemand muß müssen“ anklingt, dann zeigt dies, dass auch Hauptmann durchaus kein streng deterministisches Weltbild vertritt. Zusätzliche Tragik stellt sich gerade dadurch ein, dass die Liebenden ihre Handlungsautonomie beweisen, indem einerseits Loth die Verbindung zu Helene löst und abreist und andererseits Helene den Freitod wählt.
Werther-Bezüge
Mehrfach hat die Hauptmann-Forschung auf Parallelen zwischen Vor Sonnenaufgang und den Leiden des jungen Werthers hingewiesen, doch erweist sich Helene genau betrachtet eben gerade nicht als weibliches Pendant und moderne Wiedergängerin von Goethes Romanfigur, weil sie weder das Deutungskonstrukt einer ‚Krankheit zum Tode‘ noch Werthers Selbststilisierungsgestus übernimmt. Anstatt den eigenen Selbstmord detailliert zu planen, handelt sie aus dem Affekt heraus. Loth wiederum, der sich von der Gestalt Werthers so vehement distanziert, ist ihm in einem Punkt ähnlicher als er denkt, bezieht er doch ein Gefühl der Stärke aus dem Bewusstsein, den eigenen Tod bewusst „in der Hand zu haben“: „Man kann sich dadurch über alles mögliche hinwegheben, Vergangenes – und Zukünftiges …“ (69) Mit dieser stolzen Versicherung menschlicher Handlungsautonomie aber vermittelt er der gut pietistisch zu christlicher Demut erzogenen Helene allererst den Gedanken radikaler Selbstbestimmung.
Dramaturgie sich relativierender Widersprüche
So oszilliert der Text beständig zwischen einander sich scheinbar ausschließenden Positionen: Er schärft einerseits den Blick für die Determiniertheit des Menschen durch Vererbung und Milieu, zeigt andererseits zugleich Beispiele freier Willensentscheidungen. Er führt die Dialektik sozialen Reformertums vor, welches das Wohl aller im Auge hat und für einen strikten Altruismus eintritt, dabei aber nächstliegendes Unglück übersieht und von Egoismus durchaus nicht frei ist. Er verhandelt ästhetische Konzepte, denen er selbst nicht entspricht. Und er präsentiert psychologisch konsistente, charakterlich jedoch höchst ambivalente Figuren. Dies freilich ist weniger Ausdruck einer „Dramaturgie der Parteilosigkeit“ (Müller-Salget 1974) als vielmehr Merkmal eines poetischen Verfahrens, das Gegensätze zu benennen versucht, auf ihre Schlichtung oder Auflösung aber bewusst verzichtet. Hauptmann stellt durchweg „Zwitter“ (83) als Figuren auf die Bühne, die widersprüchlichen Handlungsimpulsen folgen, und erzeugt so ein Fluidum beständiger Ironie, ohne jedoch den Ernst der im Stück erörterten Themen zu relativieren.
Durchbruch des Bühnennaturalismus
Literaturgeschichtlich betrachtet markiert Vor Sonnenaufgang indes vorrangig den Durchbruch des Bühnennaturalismus. Gleichwohl war die Berliner Uraufführung des Stücks, die am 20. Oktober 1889 stattfand, zunächst Anlass eines handfesten Theaterskandals. In jenem Exemplar der zweiten Auflage der Buchausgabe, das er Otto Brahm widmete, spricht Hauptmann denn auch rückblickend von der „Schlacht im Lessing-Theater“ (zit. nach Bellmann 1988, 7). Der Aufruhr, den Vor Sonnenaufgang auslöste, bezog sich zwar auf das Stück, gewann allerdings seine eigentliche Dynamik aus dem Umstand, dass das Werk als Musterbeispiel einer neuen Ästhetik verstanden wurde. Deshalb veranlasste der „tumultuarische Verlauf“ der Premiere auch „zeitgenössische Kritiker zu einem Vergleich mit der großen Schlacht […], die im Jahre 1830 anlässlich der Premiere von Victor Hugos ‚Hernani‘ zwischen Klassikern und Romantikern ausgefochten wurde“ (Bellmann 1988, 7). Ähnlich wie diese einer neuen literarischen Strömung zum Sieg verholfen hatte, verschaffte die umstrittene Aufführung von Vor Sonnenaufgang dem Naturalismus endgültig Akzeptanz.
Wirkung
Die überragende Bedeutung von Hauptmanns Drama für den Naturalismus wurde von den meisten Kollegen umgehend erkannt. Es kann deshalb nicht verwundern, dass das Stück eine Vielzahl von Autoren im Umkreis dieser Bewegung beeinflusste. So hatte Vor Sonnenaufgang, um nur zwei Beispiele zu nennen, direkte Rückwirkungen auf Handlungsführung und Figurenzeichnung der Familie Selicke und regte indirekt das dramatische Schaffen Elsa Bernsteins an. Daneben rief es mindestens zwei literarische Texte hervor, die dezidiert als Gegenentwürfe verstanden werden müssen. Als eine Art generelle Abrechnung mit den Dramen des ‚konsequenten‘ Naturalismus schrieb Conrad Alberti eine „Dramenparodie“ (Möbius 1982, 103) mit dem Titel Im Suff. Naturalistische Spitalkatastrophe (1890), und als direkte Kontrafaktur zu Hauptmanns Erstlingsdrama legte ein unbekannter Verfasser, der sich hinter dem Pseudonym Erhart Glaubtmann verbarg, die „Parodie in 1 Act“ Nach Sonnenaufgang (1889) vor. Besonders die umstrittene These von der Erblichkeit des Alkoholismus gab den Zeitgenossen Anlass zu satirischen Kommentaren. Otto Erich Hartleben beispielsweise verfasste einen satirischen Text mit dem Titel Kollege Crampton, Vier Akt, in dem die Figur Max Straehler aus Hauptmanns gleichnamigen Drama nach dem Besuch einer Aufführung von Vor Sonnenaufgang erklärt, dass er Cramptons Tochter Gertrud nicht heiraten könne, weil diese möglicherweise die Alkoholabhängigkeit ihres Vaters geerbt hat. Hauptmann selbst war sich der Bedeutung seines dramatischen Erstlings für seinen Status als Autor wohl bewusst. Es ist deshalb auch als – obgleich von einem Korrektur- und Überbietungsgestus begleiteter – Reverenzakt gegenüber dem eigenen Jugendwerk zu werten, wenn er später daran anknüpfte und mit über vierzigjährigem Abstand ein Drama mit dem leicht variierten Titel Vor Sonnenuntergang versah, das im Goethe-Jubiläumsjahr 1932 zur Uraufführung kam.
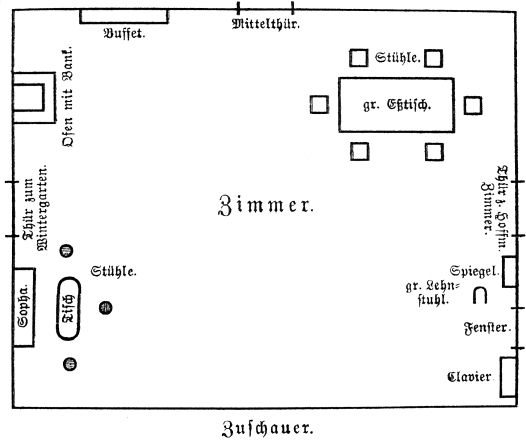
Abbildung: Bühnenbildskizze zu Beginn des 1. Akts im Erstdruck von Gerhart Hauptmanns Drama Vor Sonnenaufgang (1889).
„Soziales Drama“
Hatte Hauptmann in Vor Sonnenaufgang zwar den Schauplatz des Stücks an einem sozialen Brennpunkt – nämlich der schlesischen Kohlebergbauregion – angesiedelt, die Situation der Bergarbeiter selbst aber nur beiher thematisiert, wandte er sich in De Waber/Die Weber nun direkt den Existenzbedingungen des Vierten Standes zu. Brecht bemerkt denn auch über das Stück: „Der Proletarier betritt die Bühne, und er betritt sie als Masse.“ (Brecht 1968, 207) Hauptmann entsprach damit dem Postulat seines Kollegen Leo Berg aus dem Berliner Naturalistenverein ‚Durch!‘, der programmatisch erklärt hatte: „die moderne [Literatur] ist die Muse des vierten Standes, fast kann man sagen: des Arbeiterstandes, sie ist tendenziös und hochpolitisch“ (Berg 1892, 129). Schon allein aus diesem Grund verdienen De Waber/Die Weber in weit höherem Maß als das so untertitelte Vor Sonnenaufgang die Bezeichnung „Soziales Drama“.
Der Weber-Stoff
Der Autor greift hier einen Stoff auf, der in der Literatur des 19. Jahrhunderts bereits vielfach Gestaltung gefunden hat. Geschichtlicher Hintergrund ist ein konkretes geschichtliches Ereignis: Die durch die zunehmende Mechanisierung der Textilindustrie bewirkte extreme Verarmung der technisch rückständigen schlesischen Spinner und Weber endlud sich in den Tagen vom 4. bis zum 6. Juni 1844 in einem regionalen Arbeiteraufstand, in dessen Gefolge es u.a. zu Plünderungen, zur Zerstörung von Maschinen und vereinzelt auch zu Gewalt gegen Personen kam. Unmittelbar darauf wurde die Erhebung vom preußischen Militär blutig niedergeschlagen, ohne dass die Ursachen der Armut in der Folgezeit beseitigt worden wären. Dies war der Auslöser für eine wahre „Flut von Weberliteratur und Webermalerei“ (Sprengel 1984, 77).
Zeitgeschichtliche Komponente
Hauptmanns Stück ist demnach – und das ist reichlich untypisch für den Naturalismus – ein historisches Drama, das eine Begebenheit aufgreift, die immerhin rund ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Allerdings weist es durchaus auch eine zeitgeschichtliche Komponente auf. In den Jahren 1890/91 spitzte sich nämlich die schlechte ökonomische Lage der schlesischen Weber abermals zu. Infolge einer allgemeinen Wirtschaftskrise erlitt das schlesische Leinengewerbe eine Absatzminderung um 27 %, so dass die Weber des Eulengebirges im Juni 1890 diesbezüglich sogar eine Petition an den Kaiser richteten. Es kann nicht verwundern, dass sich nun auch die Literatur erneut des Themas annahm. So verfasste etwa Bruno Wille 1891 ein Agitationsstück mit dem Titel Durch Kampf zur Freiheit, das 1891 von der ‚Freien Volksbühne‘ aufgeführt wurde. Hauptmanns „Schauspiel aus den vierziger Jahren“ (wie der Untertitel der Weber lautet) ist damit von vornherein eine Auseinandersetzung mit Gegenwart und Vergangenheit zugleich.
Der Typus des historischen Dramas
Die Frage, ob naturalistische Texte sich außer mit tagesaktuellen Problemen auch mit historischen Themen beschäftigen dürfen und ob es legitim sei, das dargestellte Geschehen aus der Zeitgeschichte herauszurücken und es in frühere Epochen zurückzuverlegen, ist in den ästhetischen Programmdebatten der achtziger Jahre mehrfach erörtert worden. Auch wenn dieses Problem durchaus kontrovers diskutiert wurde, bildete sich doch bald ein Konsens darüber heraus, dass ein solcher gestalterischer Rückgriff auf geschichtliche Ereignisse grundsätzlich nicht ausgeschlossen sei, dass der Naturalismus als künstlerisches Programm aber aktuelle Sujets bevorzuge.
„Experimentaldrama“
Letztlich gibt es vielfältige Gründe dafür, weshalb Hauptmann in seinem Drama ein historisches Ereignis dargestellt hat und die Handlung nicht in der unmittelbaren Gegenwart spielen ließ. Zunächst darf nicht vergessen werden, dass die zeitgenössische Theaterzensur es untersagte, „Persönlichkeiten des Tages auf die Bühne zu bringen“ (Alberti 1887, 42). So konstatiert Alberti 1887 in aller Offenheit: „Heute streicht die Censur unweigerlich jeden Vers, der nur ein wenig an Politik oder nicht ganz liebsame Vorgänge in der Oeffentlichkeit anklingt“. (Alberti 1887, 45) Die Transponierung des Geschehens in eine nicht weit zurückliegende Vergangenheit diente also fraglos dem Schutz vor sofortigem Zugriff der staatlichen Behörden. Gleichwohl ermöglichte der indirekte Bezug auf jüngst vorgefallene Ereignisse eine beständige Diaphanie zwischen Gestern und Heute. In ästhetischer Hinsicht dürfte freilich der Umstand eine entscheidende Rolle gespielt haben, dass nur durch die temporale Abgeschlossenheit der Handlung eine analytische Struktur entstehen konnte, die es gestattet, die determinierenden Rahmenbedingungen des Geschehens präzise zu bestimmen. In gewisser Weise löst Hauptmann so die von Zola erhobene Forderung nach einer experimentellen Versuchsanordnung ein, untersucht er doch die Verhaltensweisen einer Gruppe von Personen unter genau festgelegten historischen Rahmenbedingungen. Zola jedenfalls war davon überzeugt, dass diese „Methode […] überall, auf dem Theater und sogar in der Poesie triumphieren wird“ (Zola 1904, 62). Max Halbe hat in diesem Zusammenhang denn auch das Entstehen eines „Experimentaldramas“ (Halbe 1889, 1180) prognostiziert. Hauptmann nun führt eine solche Verkettung „kausaler Zusammenhänge“ nachgerade modellhaft vor: „Die ‚Ursachen‘ Ausbeutung, Verelendung, Hunger zeitigen die ‚Wirkung‘ Revolte.“ (Huber 1996, 11) Huber hat in diesem Zusammenhang die „forensischen Qualitäten des Dramas“ hervorgehoben und darauf aufmerksam gemacht, dass „sich die Weber […] auch als ‚Gerichtsspiel‘ lesen“ (Huber 1996, 18) lassen.
Vorabrecherchen
Voraussetzung für diese vergegenwärtigende Form der Rekonstruktion von Geschichte mit literarischen Mitteln war eine genaue Recherche der historischen Ereignisse, der ökonomischen Wirkungsfaktoren und der zutage tretenden sozialpsychologischen Mechanismen. Hauptmann hat diese Arbeit in umfassender Weise geleistet: Er hat zahlreiche zeitgenössische Quellen und rückblickend-summarische Darstellungen zum Thema studiert, und er hat im Frühjahr 1891 zwei „Studienfahrten“ (zit. nach Schwab-Felisch 1963, 176) in die Region am Fuß des Eulengebirges unternommen, die Orte des einstigen Geschehens besucht und mit Augenzeugen des Aufstands von 1844 gesprochen. Gestützt auf eine Fülle von „historischen, ökonomischen und psychologischen Informationen sowie die Kenntnis von Lebensart und Lokalkolorit“ der dargestellten Personen, also mit „quasi-wissenschaftlichen Grundlagen“ hat Hauptmann dann eine fiktionale „Reproduktion der historischen Wirklichkeit“ unternommen – in dem Bewusstsein: „Wenn nur die Verweise auf Vergangenes innerhalb der Handlung weitgehend vermieden werden, scheinen die historischen Abläufe ‚gegenwärtig‘ zu sein.“ (Möbius 1982, 110)
Referenztexte
Neben den eigentlichen Quellen, die der Autor in seinem Stück z.T. sogar wörtlich zitiert, gibt es noch eine Reihe weiterer literarischer Referenztexte. „Als literarisches, die Sozialthematik gestaltendes Vorbild ist Émile Zolas im Bergarbeitermilieu angesiedelter Roman Germinal von 1885 bedeutsam, der auf einer realen Begebenheit aus dem Vorjahr, dem gewaltsam niedergeschlagenen Streik im nordfranzösischen Kohlerevier vor Anzin, basiert.“ (Huber 1996, 5) Das Modell des historischen Dramas mit Gegenwartsbezug übernahm Hauptmann dagegen von Dantons Tod, während der Blick auf das geknechtete Individuum sich stark an Woyzeck orientiert. (1887 hatte Hauptmann im Berliner Naturalistenverein ‚Durch!‘ einen stark beachteten Vortrag über Büchner gehalten.) Eine gewisse Rolle dürfte des Weiteren Grabbe gespielt haben, der seinerzeit mit Napoleon das „erste Massendrama der deutschen Literatur“ (Huber 1996, 5) vorgelegt hat. Die Tatsache, dass Hauptmann sein Stück zuerst in einer stark dialektalen Fassung niederschrieb – sie trägt den Titel De Waber –, verweist im Übrigen wieder auf den Einfluss von Holz und Schlaf. Der Autor selbst hat später bemerkt, er habe „dem Dialekt seine Würde zurückgeben“ (Hauptmann 1993, 721) wollen. Er tut dies, indem er die regional geprägte Mundart zum Ausdrucksmedium „tiefsten kreatürlichen Leidens“ (Meixner 1961, 145) macht, so dass der Dialekt stärker als in allen anderen Texten zur „Sprache der Geknechteten und Enterbten“ (Meixner 1961, 144) wird. Tatsächlich stellt die Radikalität, mit der hier oraler Dialektgebrauch nachbildet wird, alles bisher Dagewesene in den Schatten. Zwei Beispiele aus dem 5. Akt mögen dies illustrieren. Nachdem der von Dorf zu Dorf umherziehende Lumpensammler Hornig die Plünderung des Anwesens des Textilfabrikanten Dreißiger miterlebt hat, berichtet er den Vorfall folgendermaßen:
Nee nee, iich soa reene Woahrheet. Se honn a heilich furtgejoat. Gesten oobend iis a no Reechenbach kumma. […] Do hoan s’a doch ni irscht amool wullt behaaln – aus Forcht ver a Wabern – do hoot a doch plutze wider furtgemußt uuf Schweinz nei. […] Geteemliert hoann se’n Fabrikanta sei Haus, un vun Kaller uuf biis uba ruff under de Daachreiter. Aus a Koschbern hoann se’n Porzlan geschmissa – immer iebersch Daach nunder. (80f.)
In der überarbeiteten Version hört sich das dann so an:
Nee, nee, ich sag’ reene Wahrheet. Se haben’n heilig fortgejagt. Gestern abend is a nach Reechenbach kommen. […] Da han s’n doch ni erscht amal wolln behalt’n – aus Furcht vor a Webern – da hat er doch plutze wieder fortgemußt uf Schweidnitz nein. […] Gedemoliert haben se’n Fabrikanten sei Haus, unten vom Keller uf bis oben ruf unter de Dachreiter. Aus a Dachfenstern haben se’s Porzlan geschmissen – immer iebersch Dach nunten. (350f.)
Dialektgebrauch
Die Veränderungen tasten also die Semantik nicht an, verändern gleichwohl den Eindruck des Ganzen enorm. Manches wird für den nicht aus der Gegend stammenden Leser bzw. Zuschauer erst in der überarbeiteten Fassung verständlich: So werden spezifisch regionale Ausdrücke, die es im Hochdeutschen so nicht gibt, zuweilen regelrecht übersetzt: aus „Koschbern“ etwa wird „Dachfenstern“. Und auch ursprünglich fremdsprachige Wörter, die dialektal vereinnahmt worden sind, werden durch die Annäherung an das Schriftdeutsch allererst wieder verständlich: Was „geteemliert“ bedeutet, wird kaum jemandem außerhalb Schlesiens bekannt sein, das umgangssprachliche „gedemoliert“ dagegen lässt den Ursprung des Wortes wieder hervortreten. Diese Eingriffe erzeugen aber nun – wenn man es genau nimmt – eine neue Kunstsprache, die so nirgendwo praktiziert wird. Manche Wendungen klingen in der überarbeiteten Fassung regelrecht berlinerisch, und stellenweise meint man zu hören, dass das raue Schlesisch in ein milderes Sächsisch übergeht. Was sich hier abzeichnet, ist im Grunde ein Zielkonflikt zwischen Realitätsmimesis und Verständlichkeit: Die möglichst genaue Nachbildung einer konkreten, soziologisch aussagekräftigen dialektalen Sprachform mindert stark die Rezipierbarkeit und damit das Wirkungspotential eines Textes, Zugeständnisse an das Gebot intersubjektiver Verständlichkeit bewirken aber, dass die sprachliche Milieuschilderung an Präzision verliert und damit die angestrebte Wiedergabe von ‚Natur‘ ungenau wird – eine Aporie, deren Unauflösbarkeit die Grenzen des ‚konsequenten‘ Naturalismus vor Augen führt.
Verabschiedung der zentralen Heldengestalt
Was Hauptmanns Stück neben dem weit getriebenen Dialektgebrauch in literaturgeschichtlicher Hinsicht besonders auszeichnet, ist der Umstand, dass es keine zentrale Heldengestalt mehr kennt: Der Fabrikant Dreißiger steht ebensowenig im Mittelpunkt der Handlung wie eine bestimmte herausgehobene Person aus dem Webermilieu. Letztlich gilt: „Jeder Akt der Weber spielt an einem anderen Schauplatz und wird von anderen Figuren beherrscht.“ (Sprengel 1984, 84) Gleichwohl prallen zwei soziale Schichten aufeinander, die im Verhältnis von Herr und Knecht zueinander stehen. Um diesen Gegensatz zu betonen, hat der Autor in der ersten Fassung des Stücks die im 1. Akt auftretenden Figuren sogar auf zwei Personengruppen aufgeteilt; die „Fabrikantengruppe“ und die „Webergruppe“ (6), wodurch die Individuen einerseits zu größeren sozialen Einheiten zusammengefasst werden und andererseits die Kluft angedeutet wird, die beide voneinander trennt. Die Leistung Hauptmanns besteht also vor allem darin, ein „Drama ohne Helden bzw. mit dem Volk selbst als Helden“ (Sprengel 1984, 83) vorgelegt zu haben. Hauptfigur ist – wie es der Titel schon andeutet – die Gruppe der hungernden und schließlich aufbegehrenden webenden Lohnarbeiter.
Der „Held“ dieses Dramas ist ein Kollektiv, welches von Hauptmann jedoch weitgehend individualisiert wird und deshalb als eine Summe von Einzelschicksalen erscheint. Ihre Gemeinschaft liegt nicht allein in der Teilhabe am selben Milieu, am selben Stand und in der Gleichzeitigkeit begründet, sondern beruht darauf, daß Not, Armut und Hunger einen kreatürlichen Menschentypus prägen, dem jeder einzelne sich zwangsläufig angleicht. (Meixner 1961, 142)
Das Volk nimmt demnach bei Hauptmann eine gänzlich neue Rolle ein und wird von einer „patriotischen“ (wie in Schillers Wilhelm Tell) zu einer „soziologischen Kategorie“ (Sprengel 1984, 83).
Summationsprinzip
Ähnlich wie der erste Akt, der in vielfacher Wiederholung vorführt, wie die Weber ihre Ware beim Fabrikanten abliefern, wie das von ihnen mühsam Hergestellte taxiert wird und wie Leute mager entlohnt und ansonsten rüde abgespeist werden, ist übrigens das ganze Drama strukturiert. So wie dort die Abfertigung der wartenden Lohnarbeiter aneinandergereiht ist, so reiht Hauptmann im gesamten Text auch einander analoge Vorfälle zu einer Spannungskurve aneinander. Die „Summation […] [ähnlicher] Episoden“, die „Wiederkehr des Immergleichen, ist das fundamentale Bauprinzip dieses Dramas“ (Sprengel 1984, 83). Dementsprechend hat der Text auch kein festkonturiertes Ende, sondern einen offenen Schluss; es entspricht daher eindeutig der sog. offenen Dramenform. Damit lässt Hauptmann das Strukturmuster der Familie Selicke deutlich hinter sich. Während Holz und Schlaf zwar in ihren Prosaexperimenten auf einen geradlinigen Handlungsverlauf mit klarem Anfang und eindeutigem Schluss verzichtet haben, folgen sie in ihrem Stück doch zu einem Gutteil noch den üblichen dramatischen Gepflogenheiten und lassen beispielsweise den Text an einem markanten Punkt enden.
Aufsplitterung der Handlung
Hauptmann dagegen splittert die Bühnenhandlung auf verschiedene Schauplätze und einzelne Handlungsstränge auf und verzichtet, obwohl der historische Ausgang des Geschehens ja feststeht, völlig auf ein markantes Ende. „Die ‚Geschichte‘ wird von […] [ihm] im fünften Akt angehalten, um die Unabgeschlossenheit des Problems […] zu betonen.“ (Möbius 1982, 116) Er folgt darin erkennbar der Dramaturgie Büchners, der das Prinzip des Stationendramas entwickelt und in Deutschland eingeführt hat. Büchner war es im Übrigen auch, der sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, inwieweit sich das Volk auf die Bühne bringen lässt. Sein bekanntestes Drama, Dantons Tod, thematisiert ganz ähnlich wie Hauptmann ein erst einige Jahrzehnte zurückliegendes Ereignis der Geschichte: die Französische Revolution nämlich. Es ist deshalb kein Zufall, wenn die Französische Revolution als das Urbild eines Volkaufaufstandes zum Bezugspunkt auch des Weberaufstandes wird. So weist der Schmied Wittig mit Blick auf den Verlauf des revolutionären Geschehens in Frankreich auf die Kosten bzw. Folgen eines gewaltsamen Umsturzes hin. Er zieht aus der Geschichte die Lehre, dass eine gütliche Einigung der widerstreitenden Interessen und sozialen Gruppen nicht zu erwarten und auch nicht zu erreichen sei:
Wo wär’ aso was im guden gangen? Is etwa ei Frankreich im guden gangen? Hat etwa d’r Robspier a Reichen de Patschel gestreechelt? Da hiß bloß: Alle schaff fort! Immer nuf uf de Giljotine! Das muß gehn, allong sangfang. De gebratnen Gänse kommen een ni ins Maul geflog’n. (329)
„Revolution als Rausch“
In den einzelnen Akten zeichnet Hauptmann das Entstehen des Aufstandes nach. Er führt dessen Zustandekommen vor als einerseits unausweichliches Geschehen, das andererseits aber eben doch vom Handeln einzelner Individuen bestimmt wird. Sobald die Massenbewegung aber einmal eine bestimmte Dynamik erreicht hat, verselbständigt sie sich. Die Ambivalenz von blindem Zufall, gezielter Aktion und nachgerade unbeeinflussbarer Notwendigkeit fängt Hauptmann ein, indem er die „Revolution als Rausch“ (Sprengel 1984, 84) zeigt. Die Weberfinden zu sich, indem sie außer sich geraten; ihre Revolte stellt „eine Ekstase im genauen Sinn des Wortes“ (Sprengel 1984, 85) dar, bei der auch der Alkohol eine nicht unwichtige Rolle spielt. Der Aufstand ist demnach „kein Ergebnis von Reflexion im Sinne rationaler Bewußtheit […], sondern resultiert aus einer emotionalen Erregung, die eher als Verschleierung des Bewußtseins“ (Sprengel 1984, S. 85) erscheint. So geht, bevor man sich zusammenschließt, die Branntweinflasche um. Das Thema Alkoholismus wird in De Waber/Die Weber aber weniger unter eugenischen Aspekten aufgegriffen, wie noch in Vor Sonnenaufgang; der Alkohol befördert – und indiziert – hier eher einen bestimmten Stand von Enthemmung, von Verlust rationaler Selbstkontrolle, der allererst das vorher Undenkbare möglich macht. Die unabwendbare Verselbständigung der Revolte wird im Stück selbst als Akt der „Tollheet“ (S. 76 und 347) problematisiert. Der Chirurgus Schmidt benennt die Folgen des zwar in seinen Motiven verständlichen, faktisch aber völlig unkontrollierten Handelns: „Was in drei Teiwels Namen is denn in die Menschen gefahren […]? Wüten da wie’n Rudel Welfe. Machen Revolution, Rebellion; werden renitent, plündern und marodieren . […] Der reine Weltuntergang. Unheimlich!“ (354) Im Vergleich der Aufständischen mit einem „Rudel Welfe“ klingt natürlich die durch Thomas Hobbes berühmt gewordene Formel ‚homo homini lupus‘ an, die den Rückfall von der Zivilisation in den Naturzustand benennt.
Das „Weberlied“
Neben dem Alkohol gibt es aber noch ein weiteres Mittel, ohne das die Weber nicht mobilisierbar gewesen wären: die Literatur nämlich. Ähnlich wie in Vor Sonnenaufgang führt Hauptmann auch in den Webern einen Aspekt der Wirkung von Dichtung vor. Als nämlich der Soldat Moritz Jäger das Gedicht „Blutgericht“, auch „Weberlied“ (327, 336, 358) oder „Dreißigerlied“ (332) genannt, vorliest, wird die gesamte Zuhörerschaft unmittelbar ergriffen. Hier wird erkennbar, wie groß das wirkungsästhetische Potential sozialer Dichtung sein kann. Im vorliegenden Fall wird sie zum Medium der Mobilisierung der hungernden Massen. Hauptmann hält sich hier übrigens durchaus an die historische Realität, denn es ist verbürgt, dass „das in [insgesamt] 25 Strophen überlieferte anonyme Gedicht eine bedeutende Rolle bei der Auslösung des Aufstands von 1844“ (Sprengel 1984, 85) gespielt hat. Der Autor trägt dem Rechnung, indem er dem „Lied eine zentrale Rolle“ im Text einräumt und es „in leitmotivischer Wiederkehr an wichtigen Stellen rezitieren (II) oder auf der Bühne (III) und im Hintergrund (IV, V) singen läßt“ (Sprengel 1984, 85). Hauptmanns dramatische Reflexion über das Zustandekommen revolutionärer Prozesse und ihre Legitimation verhandelt also zugleich die Rolle mit, die der Literatur bei der Umgestaltung sozialer Verhältnisse zukommt. Von hier aus erklärt sich auch die Zueignung des Textes an den Vater:
Meinem Vater Robert Hauptmann widme ich dieses Drama. […] Deine Erzählung vom Großvater, der in jungen Jahren, ein armer Weber, wie die Geschilderten hinterm Webstuhl gesessen, ist der Keim meiner Dichtung geworden, die ob sie nun lebenskräftig oder morsch im Innern sein mag, doch das Beste ist, was ‚ein armer Mann wie Hamlet ist‘ zu geben hat. (5)
Zur Widmung
Hauptmann verknüpft die eigene Familiengeschichte mit dem Schicksal der Weber und signalisiert so seine eigene Betroffenheit. Indem er aber darüber hinaus sich selbst mit der Hauptfigur von Shakespeares Drama Hamlet vergleicht, weist er zugleich auf seine spezifische Art hin, auf soziales Elend zu antworten. Hamlet zeichnet sich bekanntlich dadurch aus, dass er „tatenarm und gedankenvoll“ (Hölderlin) ist. Und genau dies ist letztlich auch der Reaktionsmodus des Schriftstellers, dessen Aufgabe darin besteht, genau zu beobachten. Er handelt mithin nicht selbst, sondern entwickelt allenfalls literarische Reflexionsmodelle, wie gegebenenfalls zu handeln wäre. Indem er dies tut, erweist er sich freilich als sozial verantwortliche Persönlichkeit.
Aufführungsgeschichte
Ähnlich wie Vor Sonnenaufgang polarisierten auch die „Weber“ die Zeitgenossen stark. So wurde die auf den 3. März 1892 angesetzte Uraufführung der Dialektfassung De Waber im Deutschen Theater Berlin polizeilich untersagt, weil man dadurch die öffentliche Ordnung in Gefahr sah. In der Begründung des Verbots ist zu lesen:
Es steht zu befürchten, daß die kraftvollen Schilderungen des Dramas, die zweifellos durch die schauspielerische Darstellung erheblich an Leben und Eindruck gewinnen würden, in der Tagespresse mit Enthusiasmus besprochen, einen Anziehungspunkt für den zu Demonstrationen geneigten sozialdemokratischen Theil der Bevölkerung Berlins bieten würden, für deren Lehren und Klagen über die Unterdrückung und Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten das Stück durch seine einseitige tendenziöse Charakterisierung hervorragende Propaganda macht. (Zit. nach Brauneck 1974, 51)
Der Text konnte deshalb zunächst nur in gedruckter Form erscheinen. In der Folgezeit erarbeitete Hauptmann eine zweite Fassung seines Dramas, Die Weber, in der er die Mundartpartien, die den Großteil der Dialoge einnehmen, abschwächte und sie in ein dialektal gefärbtes Bühnendeutsch transformierte, das von einem größeren Publikum verstanden werden konnte. Auch diese Version erschien im Lauf des Jahres 1892 als Buchausgabe. Die Vorbehalte der Öffentlichkeit gegen den Text wurden dadurch freilich nicht schwächer. So vertrat der Publizist Theophil Zolling die Ansicht: „Die Weber sind das gefährlichste und aufreizendste Schauspiel, das je in deutscher Sprache gedichtet worden ist. Hinter sieben Türen und sieben Schlössern müßte es eine besonnene und staatskluge Censur verwahren.“ (Zit. nach Jaron/Möhrmann/Müller 1986, 257)
Ein knappes Jahr nach dem Aufführungsverbot wagte das Deutsche Theater dann mit der zweiten Fassung einen erneuten Vorstoß, das Drama auf die Bühne zu bringen. Doch auch diese Aufführung, die für den 4. Januar 1893 geplant war, wurde von den Behörden untersagt. Darauf wurde kurzerhand der Verein ‚Freie Bühne‘, der seine Aktivitäten weitgehend eingestellt hatte, wiederbelebt, und das Stück wurde am 26. Februar in einer geschlossenen Veranstaltung erstmals gegeben. Zugleich legten Autor und Theaterleitung gegen das Verbot Beschwerde ein. Hauptmanns Anwalt beteuerte, dass es seinem Mandanten „völlig ferngelegen habe, mit den Webern eine socialdemokratische Parteischrift zu verfassen […]; nur die christliche und allgemein menschliche Empfindung, die man Mitleid nennt, habe ihn sein Drama schaffen“ (zit. nach Brauneck 1974, 57) lassen. Außerdem wies die Direktion darauf hin, daß das Deutsche Theater „vorwiegend nur von Mitgliedern derjenigen Gesellschaftskreise besucht wird, die nicht zu Gewaltthätigkeiten oder anderweitiger Störung der öffentlichen Ordnung geneigt sind“ (zit. nach Praschek 1957, 277). Der Grund dafür sei, dass „die Plätze im Allgemeinen“ für Angehörige unterer Gesellschaftsschichten zu „theuer und […] die Zahl der weniger theueren Plätze verhältnißmäßig […] gering“ (zit. nach Praschek 1957, 277) seien. Mit dieser Argumentation hatte man Erfolg; das Stück wurde schließlich am 2. Oktober 1893 vom Preußischen Oberverwaltungsgericht zur Aufführung am Deutschen Theater freigegeben. Nach dem Urteil gestattete Hauptmann umgehend auch den Theatervereinen ‚Freie Volksbühne‘ und ‚Neue Freie Volksbühne‘ die Aufführung; dort wurden Die Weber am 15. Oktober und am 3. Dezember 1893 gespielt. Da der Zulauf zu diesen geschlossenen Inszenierungen enorm war, hatten bereits mehr als 1000 Arbeiter das Stück besucht, bevor es am 25. September 1894 dann erstmals im Deutschen Theater zu sehen war. Auf Grund der Vorgeschichte hatte diese erste öffentliche Aufführung natürlich Sensationswert. Und tatsächlich reagierte das Publikum begeistert auf Hauptmanns Drama. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. freilich kündigte darauf aus Protest seine Loge.
Anregerfunktion von Holz und Schlaf
Ähnlich wie Gerhart Hauptmann ist auch Max Halbe in seinem dramatischen Schaffen anfangs stark von Arno Holz und Johannes Schlaf beeinflusst worden. So weist er in seinen Lebenserinnerungen selbst darauf hin, dass auf ihn die Textsammlung Papa Hamlet „namentlich im Handwerklichen, im Technischen, im Formalen des dramatischen Dialogs, revolutionierend gewirkt“ (Halbe 1940, 360) habe. Über sein Stück Freie Liebe (1890) äußert er gar: „Die Technik fußte auf der von Papa Hamlet übernommenden Formel möglichster Wirklichkeitsnähe“ (Halbe 1940, 367). Die von Holz und Schlaf im Bereich der Erzählprosa entwickelte und von Hauptmann dann auf das Drama übertragene Darstellungsart der minutiösen Nachbildung mündlicher Rede findet sich auch in Halbes „modernem Schauspiel in vier Aufzügen“ Eisgang, in dem der ostpreußische Dialekt zumindest passagenweise ähnlich stark zum Einsatz kommt wie die schlesische Mundart in De Waber.
Inhaltsangabe
Die Handlung des Stücks ist auf einem nahe der „untern Weichsel“ (101) gelegenen Landgut angesiedelt. Da die Mechanisierung der Agrarwirtschaft auch diese Region mittlerweile erfasst hat, kommt es zu zunehmenden sozialen Spannungen zwischen den Grundbesitzern und den Landarbeitern. Erstere erwirtschaften durch die zunehmende Anbieterkonkurrenz auf dem Markt und die durch die Industrialisierung fallenden Erzeugerpreise immer weniger Gewinn, bei letzteren lockert sich wegen des niedrigen Verdienstes die Bindung an die heimatliche Scholle. Viele Knechte versprechen sich deshalb andernorts bessere Arbeitsbedingungen. Das staatlicherseits betriebene Vorhaben einer Kanalisierung der Weichsel, das die Region künftig vor weiteren Überschwemmungen bewahren und damit die Ernten stabilisieren soll, treibt die Auflösung der alten ständischen Ordnung weiter voran, weil es zusätzlich Arbeiter von der Landwirtschaft abzieht. In diese Situation des ökonomischen und sozialen Umbruchs unvermittelt hineingestellt ist Hugo, der Sohn des Gutsbesitzers Eduard Tetzlaff, der sein Studium der Mathematik abgebrochen hat, um seinem durch den frühen Tod der Ehefrau und angesichts der steigenden Unzufriedenheit der Landarbeiter handlungsunfähig gewordenen Vater beizustehen und den elterlichen Betrieb aufrecht zu erhalten.
Charakterprofil des Protagonisten
Im Gegensatz zu Vor Sonnenaufgang, wo die „soziale Desorientierung“ (Elm 2004, 157) und moralische Verwahrlosung thematisiert werden, die sich durch plötzlichen Reichtum im ländlichen Raum ergeben, führt Eisgang den durch die zunehmende Industrialisierung bewirkten Niedergang des traditionellen Sozialgefüges im Bereich der Landwirtschaft vor. Gleichwohl ähnelt der Protagonist von Halbes Drama in manchem der Figur des Alfred Loth in Hauptmanns Stück. Wie dieser ist auch Hugo Tetzlaff ein idealistischer junger Mann, der einen klaren Blick für die sozialen Ungerechtigkeiten seiner Zeit hat, und wie dieser möchte auch er gesellschaftliche Reformen im Sinne der Sozialdemokratie einleiten. Vorübergehend spielt er sogar mit dem Gedanken, sich politisch zu betätigen und so direkt für das „Volk“ (107) zu wirken. Anders als Loth aber ist Hugo Tetzlaff nicht ungebunden, sondern sieht sich seiner Familie verpflichtet, was einen Lebensentwurf, der seinen „Idealen“ (107) entspricht, unmöglich macht. Außerdem gehört er nicht zur Schicht der besitzlosen Intelligenz, sondern ist selbst (Groß-)Grundbesitzer. Dadurch gerät er in ein unauflösliches Spannungsverhältnis, erkennt er doch, dass die ökonomische Entwicklung zu einer Umschichtung der bisherigen Macht- und Eigentumsverhältnisse führen und auf absehbare Zeit seine eigene Position untergraben wird. Seine Art, mit dieser Diskrepanz umzugehen, besteht darin, das seiner Ansicht nach Unausweichliche zu bejahen. Als Schwahn, der erste Knecht der Tetzlaffs, nach 23-jährigem Dienst das Gut verlässt, entspinnt sich folgender Dialog zwischen Hugo und seiner Schwester Grethe:
Grethe setzt sich zu Hugo ans Fenster: Ich kann mir gar nicht denken, daß Schwahn wirklich geht. Was ihm nur in den Kopf gefahren ist. Er hat doch wie zur Familie gehört. […] So ins Blaue sein sicheres Brot aufzugeben … Nach Amerika …!
Hugo: Der Mann will keines anderen Mannes Knecht mehr sein. Der Mann hat recht!
Grethe: Ja! aber was soll dann werden? Wer soll dann arbeiten? Das muß doch zum vollständigen Ruin für uns führen.
Hugo triumphierend: Für uns! Siehst du? Da haben wir’s! Das ist der Punkt! Weißt du jetzt, mein Schwesterchen, warum unsere Situation unhaltbar ist? […] Machen wir uns keine Illusionen! Unsre Sache steht absolut hoffnungslos. Wir werden zermalmt werden … und das wollen wir auch wünschen. (121f.)
Hugo Tetzlaffals tragikomische Figur
Auf diese Weise freilich wird Hugo Tetzlaff zur tragikomischen Figur. In der Rolle erst des Grundbesitzersohnes und Erben, nach dem Tod des Vaters dann des verschuldeten Grundbesitzers sieht er sich dazu genötigt, seine egalitären „Ideale“ zu verleugnen und „gegen“ (122) seine Überzeugungen zu handeln. Obwohl er ihre Existenzbedingungen zu verbessern sucht, muss er, um das väterliche Gut zu erhalten, seine Arbeiter doch weiterhin ausbeuten. Er verfährt zwar milder als andere Grundbesitzer, perpetuiert aber die bestehende Kluft zwischen Herr und Knecht. Der Zwiespalt vertieft sich noch, da er von Schuldgefühlen getrieben ist und sich aufgerufen fühlt, durch seine praktische Tätigkeit die „Sünden der Vergangenheit“ (111 und 174) zu sühnen und die von den eigenen Vorfahren einst betriebene „Knechtung“ (171) der Leibeigenen wieder „gutzumachen“ (108). Weil sich dies aber in seiner gegenwärtigen Situation nicht leisten lässt, verfällt Hugo Tetzlaff in Melancholie und Selbstironie.
Kluft zwischen Theorie und Praxis
In seiner „Mischung von Sarkasmus und Phlegma“ (100) ähnelt er dem berühmtesten Zauderer der Literaturgeschichte. Halbe hat denn auch im Vorwort zu einer späteren Ausgabe seines Dramas den Protagonisten als „gutshöfischen Hamlet von naturalistischem Kleiderschnitt“ (Halbe 1917–23, Bd. 3, 9) charakterisiert. Der Hinweis auf die Figur des Hamlet zielt dabei in zwei Richtungen: Zum einen wird die latente Todessehnsucht von Shakespeares Dänenprinz aufgegriffen, der gleichfalls von den Untaten seiner Vorfahren umgetrieben wird, zum anderen stellt die Kläglichkeit, mit der Hugo Tetzlaff an der Kluft zwischen Theorie und Praxis scheitert, einen Bezug zu Holz‘/Schlafs Papa Hamlet her. Es ist indes nicht nur eine individuelle Charaktereigentümlichkeit, welche die Zentralgestalt von Halbes Stück zu einem zeitgenössischen Hamlet macht. Die als quälend empfundene Verschränkung von sozialem Veränderungsbestreben und gleichzeitiger Handlungshemmung resultiert nämlich auch aus der hochgradig widersprüchlichen Situation des modernen Subjekts. Die Wissenschaft hat dem Menschen ein Instrumentarium in die Hand gegeben, mit dem er die eigene Situation präzise erkennen kann, ihre theoretischen Prämissen machen aber jede Hoffnung auf eine dauerhafte Verbesserung des gegenwärtigen Elends wieder zunichte. Hugo Tetzlaff wird genau von diesem Widerspruch zerrieben. Als akademisch Gebildeter teilt er völlig selbstverständlich das deterministische Weltbild der zeitgenössischen Naturwissenschaft; mit Nachdruck erklärt er deshalb seiner Schwester: „Die Menschen haben keinen freien Willen“. (106)
Im Gegensatz zu dem alten Tetzlaff ist der junge […] ein Kind der Blütezeit wissenschaftlich-technisch-industriellen Fortschritts am Ende des 19. Jahrhunderts, hinlänglich in materialistischer Weltanschauung ausgebildet, um die Vergeblichkeit menschlichen Wollens in einer Welt zu legitimieren, die eine vom Handeln der Menschen unabhängige prozessuale Eigengesetztlichkeit entfaltet. (Kalcher 1980, 84)
Gegensatz von Determinismus und Reformbestreben
Zugleich möchte Tetzlaff aber als Sozialreformer wirken, was freilich voraussetzt, dass jedes Individuum einen Gestaltungspielraum hat. Der ständig neu genährte Zweifel daran untergräbt nach und nach seinen Handlungsantrieb und lässt ihn zu einer gespaltenen Persönlichkeit werden. Da er sich schließlich als „einen Eingemauerten“ (139) sieht, kommt bei ihm die ohnehin latent vorhandene „Familienschwermut“ (100) zum Ausbruch, die in letzter Konsequenz auch zu seinem Tod führt. Als es nämlich bei einem winterlichen Eisgang der Weichsel zu einer lokalen Stauung der Eisschollen kommt, wodurch die Gefahr besteht, dass der Fluss über die Deiche tritt und sich ein neues Bett sucht, reitet Tetzlaff zu der betreffenden Stelle und stürzt sich mitsamt seinem Pferd in die Fluten. Obwohl es anfangs den Anschein hat, damit sei die Gefahr gebannt, weil der Pegelstand sinkt, stellt sich sehr bald heraus, dass die Weichsel bereits an einer anderen Stelle den Damm überspült und auf diese Weise die kurz vor der Umsetzung befindlichen Kanalisierungsmaßnahmen zunichte gemacht hat. Das heroische Selbstopfer des Protagonisten – in der Motivik greift Halbe übrigens frühere literarische Gestaltungen einer solchen Naturkatastrophe auf – erweist sich am Ende als sinnlos.
Abschwächung des Hereditätsdiskurses
Halbes Stück ist damit weniger ein soziales Drama und schon gar nicht eine Art „Vorspiel zu den Webern“ (Müller/Schlien 1962, 21), dessen Ende den „Ausbruch der sozialistischen Revolution“ (Hamann/Hermand 1959, 273) vorwegnimmt, sondern ein Stück, das zentrale Ideologeme der naturalistischen Bewegung verhandelt. Das deterministische Dogma beispielsweise wird nicht nur durch den zwar ökonomisch motivierten, aber letztlich aus freien Stücken erfolgten Fortgang einzelner Arbeiter in Frage gestellt, auch Hugo Tetzlaffs spektakuläre Selbstaufgabe entspringt – wenn man sie nicht als zwingende Folge eines familiären Erbübels oder als bloßen Unfall deuten will – einem Akt bewusster Willensentscheidung. Halbe greift demnach zwar den Hereditätsdiskurs seiner Vorbilder und Kollegen auf, schwächt ihn aber merklich ab. Anders als Zola zeigt er den einzelnen nicht als Sklaven seiner Erbanlagen. Der Hang zur Schwermut, der sich bei allen Mitgliedern der Tetzlaffs zeigt, wird zwar durchaus als von Generation zu Generation weitergegebenes Charaktermerkmal betont, aber unter Anspielung auf aktuelle medizinische Debatten zugleich von Hugo selbst sarkastisch als „Fall von Rassendegeneration“ (172) ironisiert. „It is this tendency to invoke a determinist hypothesis, while at the same time challenging its deepest assumptions which is above all characteristic of Eisgang“. (McInnes 1976, S. 171)
Konkurrierende Weltdeutungsmuster
Überhaupt scheint es Halbe darum zu gehen, konkurrierende Welterklärungsmuster im Text gegeneinander in Position zu bringen. So stellt er beispielsweise dem desillusionierten Hugo Tetzlaff, der sich in seiner fatalistischen „Schwarzseherei“ (170) wohlig eingerichtet hat, als „Kontrastfigur“ (Kalcher 1980, 89) den optimistischen jungen Arzt Doktor Lange, der an die Wirkungsmacht der Wissenschaft glaubt, an die Seite. (Diese figurale Konstellation erinnert übrigens an das Modell Alfred Loth/Dr. Schimmelpfennig in Vor Sonnenaufgang.) Lange jedenfalls geht davon aus, dass viele körperliche Leiden als Produkte von „Einbildung“ und „krankhafter Überreizung“ (172) angesehen werden müssten, und folgert, dass sie deshalb prinzipiell kurierbar seien. Optimismus wird also mit Pessimismus konfrontiert, Wissenschaftsgläubigkeit mit genereller Lebensskepsis. Letztlich wohnt der Zwiespalt aber in Hugo Tetzlaff selbst. In seinem Studium hat er gelernt, die Dinge logisch zu begreifen. In dem Appell: „Seien wir Mathematiker“ (106), „seien wir vernünftig“ (159) kommt jedenfalls überdeutlich seine am wissenschaftlichen Ideal der Objektivität orientierte, auf das Erkennen von Gesetzmäßigkeiten ausgerichtete Weltsicht zum Ausdruck. Allerdings muss er an sich selbst erfahren, dass sich viele Aspekte der Wirklichkeit nicht ‚more geometrico‘ behandeln lassen. Auch wenn er es anfangs nicht wahrhaben will, verspürt er – genau wie seine Schwester –, die unheimliche, lähmend wirkende Atmosphäre des elterlichen Hauses. Bezeichnenderweise konstatiert Grethe mit deutlichem Bezug auf Ibsens Drama Gespenster, das sich ja gleichfalls um die Verfehlungen der Vorfahren und das Fortwirken der Vergangenheit auf die Gegenwart dreht: „hier gehen die Geister bei hellem Tag spazieren“ (137).
Die Grenzen der Rationalität
Schon der intertextuelle Verweis auf Ibsen zeigt an, dass in Eisgang gewisse Phänomene begegnen, die rational kaum erfasst werden können. So deutet der Kuhhirte Siech das eine ganze Nacht lang andauernde Geheul seines Hundes Box als Signal, dass bald ein Mensch sterben wird – was dann auch tatsächlich geschieht. Im instinktgeleiteten Handeln der Kreatur kommt demnach eine Vorahnung zum Ausdruck, die mit wissenschaftlichen Mitteln nicht erklärbar ist. Überhaupt treten anscheinend immer dann, wenn rationale Begründungen versagen, andere, vorwissenschaftliche Deutungsmuster erneut in Kraft. Am klarsten greifbar wird dies bei der im vierten Akt erzählten, an Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter (1888) – die ihrerseits auf eine Erzählung mit dem Titel Der gespenstige Reiter bzw. Der Deichgeschworene zu Güttland (1838) rekurriert – angelehnten „Sage vom Deichhauptmann“ (166). Diese dreht sich darum, dass „vor Jahrhunderten“ (166) einmal „der damalige Deichhauptmann in einer Wachtbude gesessen, Karten gespielt und darüber die Eiswacht vergessen habe“ und danach bei seinem verspäteteten Kontrollritt vom Strom „mitsamt seinem Schimmel verschlungen“ worden sei: „Beide jedoch sollen bis heute noch leben, und wenn irgendwo beim Eisgang ein Durchbruch bevorsteht, so soll der Deichhauptmann auf seinem […] Schimmel in der Gegend vorbeireiten und den Durchbruch anzeigen.“ (167) Der Umstand, dass zum Zeitpunkt des gegenwärtigen Wasserhöchststandes Augenzeugen den „alten Herrn Tetzlaff“ (168) auf seinem Pferd vorbeireiten zu sehen meinen, wirft die Frage nach Reichweite und Geltungskraft der exakten Wissenschaft auf. Natürlich könnte die Erscheinung als Sinnestäuschung abgetan werden, da ja der seinem Vater physiognomisch ähnliche junge Tetzlaff in der Tat auf dem Damm unterwegs ist, doch beantwortet auch dies nicht alle Fragen. Zumindest bleibt es in der Schwebe, ob hier Imagination und Kolportagebereitschaft am Werk sind oder ob Hugo möglicherweise ein literarisch vermitteltes Vorbild imitiert. In jedem Fall öffnet sich ein Verstehensvakuum, in das Phantasie und – vermeintlicher – „Aberglaube“ (168) einströmen. Indem aber solche Erklärungsmuster ausdrücklich als „Auffassung des Volkes“ (167) bezeichnet werden, erfahren sie eine prinzipielle Legitimierung. Im Zeichen der vom Naturalismus betriebenen Aufwertung der unteren Stände findet so eine Relativierung des vom ihm propagierten Wissenschaftsethos statt.
Natur al allumfassendes dynamisch-vitales Wirkprinzip
Deshalb kann auch die Gestalt des alles in allem sehr positiv gezeichneten Doktor Lange, der wie ein Gegenbild zu Dr. Schimmelpfennig wirkt, nicht einfach als Vorbildfigur angesehen werden. Dazu ist sein Optimismus zu ungebrochen; widerlegt wird das von ihm an den Tag gelegte ostentative Vertrauen in die Zukunft im Übrigen durch Hugo Tetzlaff, bei dem seine ärztliche Kunst letztlich nichts auszurichten vermag. Zwar verfügt Lange, was medizinische Belange angeht, durchaus über gewisse prognostische Fähigkeiten, doch sieht er den Tod Eduard Tetzlaffs eben nicht voraus. Dies bleibt dem Hund Box vorbehalten, von dem sein Herr behauptet: „Dä weht mehr, ass alle Doktors topnohme!“ (125) Mit der Infragestellung der Geltungskraft der exakten Wissenschaft aber geraten die Grenzen des naturalistischen Programms einer „Szientifizierung der Kunst“ (Borchmeyer 1980, 166) insgesamt in den Blick. Immerhin bietet hier die ab 1890 verstärkt zu bemerkende, u.a. auf Erich Haeckel zurückgehende monistische Erweiterung des Naturbegriffs einen Ausweg, die das Konzept eines geschlossenen, determinierten Kausalzusammenhangs hinter sich lässt und – zusätzlich angeregt von Nietzsches Lebensphilosophie – Natur positiv als allumfassendes dynamisch-vitales Wirkprinzip deutet. Auf diese Weise kann Wissenschaft dann zum „Glauben“ und so zum „Religions“-Ersatz (172) werden. Bei Doktor Lange zeichnet sich diese Neuakzentuierung schon ab. Damit eröffnet sich die Möglichkeit zu einer Überwindung der an Hugo exemplifizierten, epistemologisch induzierten Zerrissenheit. In einer den darwinschen Entwicklungsgedanken monistisch verallgemeinernden Sichtweise nämlich reduziert sich der Tod zur „reinen Formveränderung“ (164). Wenn tatsächlich gesichert ist, dass „kein Atom […] verloren“ geht, lässt sich schließlich sogar eine Art von „wissenschaftlichem“ „Jenseits“ (135) begründen. Indem Halbe in seinem „modernen Schauspiel“ das Naturverständnis über die vom Positivismus gezogenen Grenzen hinaus erweitert und Raum für das Mystische schafft, öffnet er auch die Konzeption des Naturalismus für zusätzliche Darstellungsbereiche. Offenbleibt indes, wie Hugo Tetzlaffs Tod zu deuten ist: als resignative Aufgabe oder als konsequente Umsetzung des von ihm betriebenen Kampfes für die Unterprivilegierten, als symbolisches Zerdrücktwerden von den gesellschaftlichen Antagonismen oder als vorbildhaftes Opfer für das Gemeinwesen, als Eintauchen in die Fluten einer monistisch gedachten All-Natur oder als klägliches Eingeständnis des Scheiterns eines Idealisten.
Soziales Drama
Die Zeitgenossen haben Eisgang überwiegend als ‚soziales Drama‘ rezipiert. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die Uraufführung, die am 7. Februar 1892 stattfand, von der ‚Freien Volksbühne‘ veranstaltet wurde. Beim „Arbeiterpublikum“ jedenfalls fand das Stück nachweislich „lebhaften Beifall“ (Mehring 1929, Bd. 2, 203). Doch auch die Thematik des Textes, der kurz darauf auch in der ‚Freien Bühne‘ und dann als Buchausgabe erschien, war natürlich dazu angetan, unmittelbare Bezüge zur gesellschaftlichen Wirklichkeit herzustellen. Max Halbe selbst bekundete später, seine Absicht sei gewesen, die „agrarisch soziale Frage“ (Halbe 1917–23, Bd. 3, 9) in den Mittelpunkt seines Dramas zu stellen. Des weiteren trug der Umstand, dass der Autor Angehörige des vierten Standes auf die Bühne brachte, dazu bei, dass das Stück Aufsehen erregte. Besonders von Vertretern der sozialdemokratischen Partei wurden die darin vorkommenden westpreußischen Landarbeiter als „Träger des für eine wahrhaft menschliche Kultur entscheidendsten Emanzipationskampfes“ (Mehring 1929, Bd. 2, 203) gewertet. Aber selbst in späterer Zeit noch zählten manche Forscher Eisgang zu den „wenigen gehaltvollen Beispielen der sozialistischen Literatur dieser Jahre“ (Hamann/Hermand 1959, 273). Dies geschah freilich um den Preis, dass die monistischen Tendenzen des Textes übersehen wurden. Interessanterweise hat Halbe selbst einer politisch verkürzten Deutung Vorschub geleistet, indem er erklärte:
Dieser verheerende Eisgang ist natürlich nicht als ein zufälliges, äußerliches, bedeutungsloses Ereignis aufzufassen. […] Die Verwüstungen, welche der Strom anrichtet, sind die Ergebnisse derselben Verwahrlosung, die sich im Volke bereits so grausig und schier unheilbar bekundet hat. (Zit. nach Mehring 1929, Bd. 2, 202)
Erst eine solche, den titelgebenden Naturvorgang allegorisch aufladende Deutung machte es möglich, „den Eisgang als Symbol einer sich anbahnenden proletarischen Revolution zu verstehen“ (Kalcher 1980, 122). Dass die Weichsel im Stück letztlich aber weit eher als „Symbol des vitalen, nicht festzustellenden, sich seine eigene Bahn brechenden Lebens“ (Kalcher 1980, 122) fungiert, zeigt unmissverständlich Halbes späteres Drama Der Strom (1904), in dem der Fluss ganz in monistischem Sinn personifiziert und mythisiert wird.