ICH GLAUB, MICH TRITT EIN KAMEL! TIERE MACHEN SACHEN
Ach ja, unsere geliebten Tiere! Egal, ob es um klassische Haustiere wie Hund, Katze oder Kaninchen geht oder um Tiere mit so lustigen Namen wie Axolotl, Bartagamen und Dikdiks. Oder aber um die großen, wilden Tiere wie Elefanten, Glaskopfhirsche, Kamele und den Mishmi-Takin - sie alle sind auf ihre eigene Art und Weise faszinierend.
Keine Sorge, das hier ist keine Tierdoku auf n-tv. Wir beschäftigen uns also nicht mit dem Balzverhalten des Seidenlaubenvogels. Wir gehen kuriosen Rechtsfragen nach, die die Tierwelt so mit sich bringt. Wie wir gleich sehen werden, gibt es nichts, was es im Tierreich nicht gibt!
Kann man Tieren den Prozess machen? Ich glaub’, mich tritt ein Pferd - war es wirklich erlaubt, über Tiere die Todesstrafe zu verhängen?! Oder wurde doch eher aus einer Mücke ein Elefant gemacht? Was haben Tierhalter zu befürchten, wenn ihr Kamel Schabernack treibt? Dürften geliebte Haustiere gepfändet werden, oder hatten die dafür Verantwortlichen einen Vogel? Wir beleuchten nicht nur die Fälle der herkömmlichen Haustiere, sondern auch Geschichten und Tiere, die bekannt sind wie ein bunter Hund: Grumpy Cat, Kryptohamster Mr. Goxx, Promihuhn Sieglinde oder Selfieaffe Naruto. Also alle bitte bereit machen, es wird tierisch interessant.
§ WARUM ES WICHTIG ZU KLÄREN IST, OB KAMELE NÜTZLICHE HAUSTIERE SIND
Schon mal darüber nachgedacht, ob Kamele nützliche Haustiere in Deutschland sind? Nein? Warum auch ... Doch genau diese Frage musste das Oberlandesgericht Stuttgart im Jahr 2018 beantworten. Wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass in Deutschland ohnehin gefühlt alles irgendwie geregelt wird. Doch was ist genau passiert und wieso spielt es überhaupt eine Rolle, ob Kamele Haustiere sind oder nicht?
Eine damals 27-Jährige und ihre Mutter nahmen 2012 an einem Kamelritt teil. Der Halter führte beide Tiere an einer Kette und lief selbst zwischen den Kamelen. Plötzlich erschraken die Tiere, und eines der beiden machte eine ruckartige Bewegung, die die Mutter aus fast 1,90 Metern zu Fall brachte. Sie trug keinen Helm und zog sich schwere Verletzungen zu. Danach konnte sie nur noch eingeschränkt arbeiten.
Jetzt kommen wir wieder zur Ausgangsfrage. Um direkt für Klarheit zu sorgen: Ja, es macht für die Haftung des Halters bei einem Unfall tatsächlich einen Unterschied, ob es sich bei seinen Tieren um nützliche Haustiere handelt oder nicht. Denn unsere tierischen Freunde können uns in große Schwierigkeiten mit dem Gesetz bringen. Das passiert gar nicht mal so selten, schließlich können unsere Vierbeiner schnell großes Unheil anrichten und teilweise auch zur Gefahr für andere Menschen, Tiere oder Gegenstände werden. Das muss selbstverständlich - wie alles in Deutschland - gesetzlich geregelt werden. Es wäre schließlich für die Katz, wenn der Geschädigte leer ausgehen würde, weil ein Tier und nicht ein Mensch den Schaden verursacht hat. Daher führte der Gesetzgeber den § 833 BGB ein. Der besagt, dass die Halter haften müssen, wenn die eigenen Tiere Blödsinn anrichten. Logisch, schließlich können die Hunde und Katzen dieser Welt nicht selbst in den eigenen Geldbeutel greifen, um einen Schaden auszugleichen. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Laut § 833 S. 2 BGB gilt die Haftung nicht, wenn es sich bei dem Tier um ein »nützliches Haustier« handelt, also wenn das Tier »dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist«. Der Tierhalter selbst argumentierte damit, dass er mit den Kamelen Geld verdiene, sie also der Erwerbstätigkeit dienten.
Gerichte wenden in solchen Fällen einen raffinierten Trick an. Sie stellen stets auf die sogenannte inländische Verkehrsauffassung ab, um zu prüfen, ob die Tiere als nützliche Haustiere zählen können. Das bedeutet, dass sich die Richter die folgende Frage stellen: Handelt es sich bei dem Tier um ein für Deutschland übliches Haustier? Die Antwort hier: Nein! Folglich sind Kamele keine Haustiere (wenn, dann »Luxustiere«) und der Halter muss für Unfälle haften. Und das sogar unabhängig davon, ob er selbst für den Unfall verantwortlich ist.
Die Richter sprachen der Reiterin schließlich 70 000 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz für den Verdienstausfall in Höhe von 21 000 Euro zu. Dabei wurde noch die Frage diskutiert, ob die Frau ein Mitverschulden traf, da sie keinen Helm trug. Sollte ein Mitverschulden vorliegen, würde das Schmerzensgeld gekürzt werden. Allerdings wurde das hier abgelehnt, weil der Kamelhalter von einem Helm abgeraten hatte. Darüber hinaus urteilten die Stuttgarter Richter auch, dass der Halter nicht beide Kamele gleichzeitig hätte führen dürfen. So habe er nämlich nicht ausreichend auf die Kamele einwirken können, um die Reiterin vor der Schreckreaktion zu schützen.
Fazit: Wer überlegt hat, sich ein Kamel in den Garten zu stellen, sollte das noch einmal überdenken. Das ist nämlich nicht nur nicht artgerecht, sondern es kann auch wirklich teuer werden, sollte das Kamel dann Unheil anrichten.
Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom 07.06.2018, Az. 13 U 194/17
§ WILDER HUND BEISST PROMIHUHN SIEGLINDE TOT
Der 04.06.2017 war kein Tag wie jeder andere auf dem Hof: Huhn Sieglinde pickte friedlich vor sich hin, während ihre Halterin den Stall ausmistete. Plötzlich kam ein nicht angeleinter Hund und biss das Huhn zu Tode. Sieglinde war nicht irgendjemand, sie war ein Star - spielte sogar im ARD-Film Wir sind doch Schwestern mit. Was ein talentiertes Huhn ausmacht? Es ist ruhiger und daher besser für Dreharbeiten geeignet. Sieglinde wurde sogar trainiert und ausgebildet. Ein trauriger Tag für die deutsche TV-Welt. Der Schmerz für die Halterin (und natürlich für alle Fans des talentierten Vogels) saß tief. So tief, dass er, zumindest für die Halterin, nur durch 4000 Euro Schadensersatz kompensiert werden konnte. Der Hundehalter sah das nicht ein und bot für den Schaden »einen Zehner« an. Eine Einigung kam nicht zustande, also ab vors Gericht!
Machen wir doch ein Quiz aus diesem skurrilen Fall. Was hat die Halterin für Sieglinde bekommen?
A: Tatsächlich nur einen Zehner, weil das der Wert eines Huhns ist.
B: 615 Euro, weil das die Kosten für die Filmkarriere des Huhns deckt.
C: 4000 Euro, weil das der Marktwert Sieglindes war.
4000 Euro Schadensersatz sind doch etwas viel, empfand das Amtsgericht Geldern. Die Richter ordneten eine Zahlung von 600 Euro als Ersatz der Ausbildungskosten für Sieglinde an (ja, eine Ausbildung zum TV-Star kostet in der Welt der Hühner 600 Euro) sowie eine Zahlung von 15 Euro, was den Kosten der Anschaffung eines neuen Huhns entspricht. Diese 615 Euro wurden dann halbiert, da Sieglindes Halterin ein Mitverschulden zugesprochen wurde. Sie hätte laut Ansicht der Richter nämlich dafür Sorge tragen sollen, dass das Huhn nicht allein herumläuft und sich so Gefahren aussetzt.
Wie jetzt?! Die Hälfte von 615 Euro, also 307,50 Euro, stand beim Quiz gar nicht zur Auswahl! Keine Sorge, die Halterin ging in Revision. Das Landgericht Kleve konnte kein Mitverschulden der Halterin feststellen. Sieglinde befand sich nämlich zum Zeitpunkt der Tötung auf deren Grundstück. Es könne ihr nicht zugemutet werden, ihre Tiere gegen nicht angeleinte Hunde schützen zu müssen, die sich unbefugten Zugang zu ihrem Hof verschaffen. Die Halbierung des Schadensersatzes lehnte das Gericht in Kleve also ab, ansonsten stimmten die Richter den Kollegen aus Geldern jedoch zu.
Aber wieso musste der Halter nur 615 Euro zahlen, wenn die Halterin behauptet, Sieglinde sei 4000 Euro wert? Simpel: Das Gericht wusste, wie hoch die Ausbildungskosten für Sieglinde waren, und orientierte sich daran. Sieglinde war in naher Zukunft auch nicht fix für weitere Dreharbeiten gebucht. Außerdem gibt es (man möge es kaum glauben) keinen verlässlichen Marktwert für TV-Hühner. Kurz gesagt: Die Richter sahen keinen Grund, den Schaden auf mehr als die Ausgaben für das Huhn zu bemessen.
So richtig zufrieden war mit dem Urteil wohl keine der Parteien. Der Hundehalter hätte nie gedacht, dass er mal über 600 Euro für ein Huhn zahlen müsste. Währenddessen trauert Sieglindes Halterin noch immer, zum einen über den Verlust ihres geliebten und talentierten Huhns und zum anderen darüber, dass ihr »nur« 615 Euro zugesprochen wurden. Schließlich können für Hühner wie Sieglinde hohe dreistellige Beträge für einzelne Drehtage verlangt werden. Ein kleiner Trost: Der Richter räumte ein, dass es nicht selbstverständlich sei, ein Huhn wie Sieglinde zu finden. »Es gibt keine Tierhandlung für Filmstars«, sagte er. So kann die teure Ausbildung zum TV-Huhn auch erfolglos bleiben. Kaufen kann sich die ehemalige Halterin von dieser Anerkennung allerdings nichts.
Landgericht Kleve, Urteil vom 17.01.2020, Az. 5 S 25/19
§ VOM EIGENEN HUND GEBISSEN - SCHMERZENSGELD VON DER STADT
Zugegeben: Von einem Hund gebissen zu werden, ist kein Wunschszenario, selbst wenn man nicht Sieglinde heißt (Ruhe in Frieden). Vom eigenen Hund gebissen zu werden, ist für viele Halter unvorstellbar. Doch genau das ist einer Frau 1997 passiert. Aber jetzt kommt der Dreh an der Geschichte: Die Frau wurde von ihrem eigenen Hund gebissen, zahlen musste dafür aber die Stadt. Konkret sprach 1997 das Landgericht Bückeburg der Hundehalterin des bissigen Vierbeiners ein Schmerzensgeld in Höhe von 1000 DM zu, weil sie schwere Verletzungen davongetragen hatte. Klingt unlogisch, war aber so!
Aus welchem Grund sollte denn die Stadt dafür zahlen? Noch mal von vorn. Die Frau ging an einem regnerischen Tag mit ihrer Hündin spazieren, als diese sich plötzlich auf den Boden schmiss und jaulte. Als die Frau ihr geliebtes Haustier beruhigen wollte, biss die Hündin zu. Bei der Frage, warum das passierte, kam dann die Stadt ins Spiel. Denn: Beim Biss stand nicht nur die Halterin unter Strom, die Hündin selbst tat das nämlich auch - und zwar wortwörtlich! Eine von der Dame beauftragte Überprüfung ergab, dass ein Stromschlag zum unerklärlichen Verhalten der Hündin geführt haben musste - der Boden war wohl elektrisiert gewesen. Die Stadt hat deshalb behauptet, die Hündin der Halterin habe den Stromschlag schließlich nur erlitten, weil sie gegen einen Strommast gepinkelt habe. Tatsächlich hatten sich aber mehrere ähnliche Vorfälle am selben Tag ereignet. Vor Gericht stellte sich heraus, dass ein am Boden liegendes Stromkabel seit 20 Jahren nicht gewartet worden war. Die Weihnachtsbeleuchtung war von diesen Kabeln mit einer Spannung von 220 Volt betrieben worden. Das Gericht sah es als eine Verletzung der Sorgfaltspflicht an, dass die Kabel solch eine lange Zeit nicht auf Schwachstellen überprüft worden waren. Darum also musste die Stadt für den Hundebiss zahlen. Am Ende doch nicht so unlogisch.
Landgericht Bückeburg, Urteil vom 24.04.1997, Az. 2 O 277/96
§ ZOOBESUCHER AUFS ÜBELSTE BESCHIMPFT: STRAFE FÜR PAPAGEIEN-GANG?
Folgendes Szenario: Ein Zoobesuch mit der Familie, alles läuft harmonisch. Aus dem Nichts wird man aber beleidigt und ausgelacht. Die Schuldigen? Fünf Papageien! 2020 wurde dieses Quintett aus dem Lincolnshire Wildlife Park in Großbritannien sogar richtig berühmt. Die fünf Graupapageien Billy, Elsie, Eric, Jade und Tyson wurden von den Zoomitarbeitern aus einem Safaripark adoptiert und zunächst zu fünft in einer Station gehalten. In ihrem gemeinsamen Käfig fingen sie dann an, sich gegenseitig Schimpfwörter beizubringen, die sie bereits gelernt hatten. Als die Mitarbeiter die verdorbenen Worte hörten, mussten sie natürlich lachen. Das schauten sich die Vögel dann auch ab. Und als die Vögel in ein Freigehege gelassen wurden, fingen sie an, die Besucher zu beleidigen und sich so gegenseitig hochzuschaukeln. Am häufigsten sagten sie den Menschen wohl, dass sie sich doch bitte verpissen sollten. Immer, wenn ein Papagei anfing zu schimpfen, lachten die anderen herzhaft.
Nur, was tun, wenn man davon als Zoobesucher not amused ist? Zurückzubeleidigen ist wohl keine Option. Die Vögel verstehen einen schließlich nicht, sondern plappern nur nach, was andere ihnen vorgesprochen haben. Außerdem will man den eigenen Kindern ein Vorbild sein. Was bleibt also einem anständigen britischen Bürger? Vielleicht, den Zoo auf Schadensersatz zu verklagen? Wie wir gelernt haben, stehen schließlich die Halter in der Verantwortung, wenn die eigenen Tiere Schäden anrichten. Einfache Sache, oder?
Schauen wir uns mal an, wie die Rechtslage in Deutschland zu dieser zugegebenermaßen unterhaltsamen Thematik aussähe: Laut dem StGB können Beleidigungen mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder aber einer Geldstrafe geahndet werden. Zwei Probleme: Zum einen sind die Vögel schon eingesperrt. Und kaum zu glauben für die Tierhalter, aber unsere geliebten pelzigen Freunde werden zivilrechtlich nicht wie Menschen, sondern wie Sachen behandelt (§ 90a BGB). Folglich können sie sich nicht strafbar machen.
Kann also der Tierhalter belangt werden? Nicht wirklich. Eine Anzeige wegen Beleidigung fällt flach, da der Tierhalter selbst niemanden beleidigt hat und ihm zumindest nicht nachzuweisen ist, dass die Tierchen gezielt darauf trainiert wurden, solche Beleidigungen auszusprechen. Eine zivilrechtliche Haftung ist ebenfalls unwahrscheinlich. Nach § 833 S. 1 BGB haftet der Halter dann, wenn seine Tiere einen Menschen töten, dessen Körper oder Gesundheit schädigen oder eine Sache zerstören. Beleidigungen sind davon aber nicht umfasst. Das bedeutet also tatsächlich, dass Schimpfattacken durch ein Tier straffrei bleiben. Irgendwie logisch, wenn man bedenkt, dass Papageien eigentlich nicht wissen, was sie da sagen. Heißt also: Sollte es tatsächlich solch einen Fall in Deutschland geben, würde niemand rechtlich belangt werden, und Schmerzensgeld würde es für den Beleidigten wohl auch nicht geben.
Und im Originalfall in England? Da hatte das Spektakel auch keine juristischen Konsequenzen. Es gab nicht mal eine Klage, und wie heißt es so schön: Wo kein Kläger, da kein Richter. Die Zoobesucher amüsierten sich eher über die Äußerungen der Papageien, als dass sie sich ernsthaft gekränkt fühlten. Ganz ohne Folgen waren die Schimpftiraden dann aber doch nicht. Die Mitarbeiter des Zoos entschieden sich dazu, die fünf Vögel voneinander zu trennen. Man hatte die Hoffnung, dass die Beleidigungen dann ein Ende nehmen würden. Hoffen wir mal für den Zoo, dass die Rechnung aufgeht. Nicht dass die fünf Papageien ihren neuen Kollegen in den anderen Gehegen dann ihr Vokabular beibringen und am Ende alle Vögel im Zoo zu Beleidigungen ansetzen. Irgendwann hört schließlich jeder Spaß mal auf. Auch wenn das die Besucherzahlen bestimmt steigen lassen würde ...
§ TIERE VOR GERICHT - ICH GLAUBE, MEIN SCHWEIN PFEIFT!
Ein Elefant, der von einem Gericht zum Tode verurteilt wurde? Wie kann das sein, wenn Tiere doch wie Sachen zu behandeln sind? Tatsächlich kam es in der Vergangenheit oft zu Fällen, in denen Tieren der Prozess gemacht wurde ... Blicken wir mal auf einige davon zurück.
Insbesondere im Mittelalter galten - gelinde gesagt - bizarre Regeln. Ein Schwein auf der Anklagebank war nicht unüblich. So wurde im Jahr 1266 ein Schwein in Paris verbrannt, weil es über ein Kind hergefallen war. Die Prozesse waren oftmals überraschend förmlich. Den Tieren wurde ein Rechtsbeistand gewährt, Zeugen wurden vernommen, und auch die Anklageschrift wurde vorgelesen, als würde da ein Mensch sitzen. Auch für die tierischen Angeklagten galt übrigens, dass diese im Zweifel freizulassen seien. Die Vollstreckungsmethoden der Strafen waren dabei nicht weniger grausam als bei Menschen. So wurde (schon wieder) ein Schwein im 16. Jahrhundert auf ein Rad geflochten, nachdem ihm die Knochen gebrochen worden waren - die Tiere hatten es damals echt nicht leicht ... Und es wird noch abstruser: Wieder in Frankreich und wieder Schweine, und diesmal wurde sogar eine ganze Herde in Untersuchungshaft genommen, weil sie einen Menschen getötet haben soll. Was Tiere in der U-Haft wohl den ganzen Tag über so machen? Am Ende wurde nur das kriminellste Schwein der Herde verurteilt - wahrscheinlich hat die U-Haft die Bande kleingekriegt und ein schwaches Schwein dazu gebracht, den Kollegen zu verpfeifen ...
Apropos Schweine und Pfeifen: Die Redewendung »Mein Schwein pfeift« ist auf das Berlin der Zwanzigerjahre zurückzuführen. Der Slang bezog sich auf runde Wasserkochkessel, die aussehen wie Sparschweine und pfeifen, wenn das Wasser kocht. Gern geschehen, falls diese Frage mal in einem Pub-Quiz vorkommt. ;)
Zurück zum Thema, denn auch zivilrechtlich haben sich unsere Vorfahren den einen oder anderen Kniff gegen Tiere einfallen lassen. Eine Kirche kam auf die Idee, Unterlassungsklagen gegen Ratten zu erheben. Die Hoffnung war, dass dann keine Schäden mehr an der Kirche entstehen würden. Anscheinend bekamen jedoch die Nager das Memo nicht, wirklich was gebracht hat die Klage nämlich nicht - welch Überraschung!
Keine Sorge, das war es noch nicht an Albernheiten. Bis vor knapp 200 Jahren galt nämlich noch, dass ein Mensch, der sich sexuell an einem Tier verging, eine Prügelstrafe bekam, während der unschuldige Vierbeiner exekutiert werden musste (die Schande der Tat sollte beseitigt werden). Die Logik dahinter muss erst mal verstanden werden ...
Bei all diesen Geschichten drängt sich die übergeordnete Frage des »Warum?!« in den Vordergrund. Und tatsächlich wird darüber heute noch diskutiert. Manche nehmen an, die Prozesse galten der Belustigung des Volkes (der Humor zu Mittelalterzeiten bleibt wohl für immer ein Rätsel). Andere glauben, dass Juristen die Prozesse sehr ernst nahmen und ihre Macht ausüben wollten. Wie dem auch sei, wirklich verstehen kann das Vorgehen heute wohl niemand mehr. Man stelle sich vor, es hätte damals schon PETA gegeben - die Aktivisten wären vor Wut geplatzt. Wobei, wenn man sich so manche Praktik der modernen Zeit anschaut, die noch bis vor Kurzem erlaubt war (zum Beispiel das Kükenschreddern oder betäubungslose Ferkelkastration), dann sieht man, dass wir uns im Hinblick auf Tierrechte letztlich nur wenig vom Mittelalter entfernt haben. Und das, obwohl sich die Tiere nichts haben zuschulden kommen lassen.
Auch im letzten Jahrhundert wurden nicht nur Menschen zum Tode verurteilt. In den USA (wo auch sonst) wurde murderous Mary im Jahr 1916 der Prozess gemacht. Ein Pfleger hatte Elefant Mary in Panik versetzt, und die hatte ihn daraufhin zerquetscht. Leider konnte Mary sich nicht auf Notwehr berufen und wurde tatsächlich an einem Kran erhängt. 3000 sensationsgeile Amerikaner sahen dabei zu, wie der Elefant, der in Panik geraten war, ein unwürdiges Ende fand.
Einmal erging jedoch Gnade vor Recht. 1994 (kein Witz, vor nicht mal 30 Jahren) wurde in den Vereinigten Staaten ein Hund nach 36 Monaten Haft kurz vor Vollstreckung des Todesurteils begnadigt. Grund für die Strafe: Er hatte einem Mädchen in die Lippe gebissen.
Heute werden wir in Deutschland allerdings sicherlich keinen Fall mehr sehen, in dem beispielsweise eine Giraffe angeklagt wird, weil sie dem bösen Nachbarn die Blätter vom Baum frisst. Wenn unsere tierischen Freunde Schäden anrichten, haftet der Halter - wie beispielsweise im Fall des totgebissenen Huhns Sieglinde. In diesem Fall ist es für die Tiere einmal von Vorteil, dass sie nach dem BGB Sachen gleichgestellt sind.
§ AFFENSELFIE - COPYRIGHT FÜR NARUTO?
Wenn wir eines in den vergangenen Jahren gelernt haben, dann, dass sich Fotos und Videos von Tieren im Internet schneller verbreiten als die News, dass Bibi und Julienco getrennt sind. Erst recht, wenn der Fotograf kein anderer ist als das Tier selbst: Breit in die Kamera grinsend schoss der Makake Naruto aus Indonesien ein Selfie, das in kurzer Zeit zu einem der bekanntesten Fotos der Jahre 2014 und 2015 wurde. Viele erfreuen sich an dem Bild, nur nicht der Mann, der es inszeniert hatte. Das war der Brite David Slater im Jahr 2011. Im Rahmen eines Experiments hatte er auf der indonesischen Insel Sulawesi eine Kamera installiert. Die Idee lag darin, Tiere mit Futter anzulocken, in der Hoffnung, dass sie den Auslöser der Kamera betätigen - mit Erfolg! Der Brite staunte wohl nicht schlecht, als der Affe mehrere Selbstporträts mit der aufgestellten Kamera schoss, auf denen er grinste, als hätte er eben ein echtes Einhorn oder David Hasselhoff in Baywatch-Montur gesehen.
Wahrscheinlich grinste Slater selbst nicht weniger breit, denn er verkaufte die Bilder an einen Verlag, der diese dann in einem Band veröffentlichte - Naruto (der Name des Makaken) selbst wird er dafür allerdings nicht um Erlaubnis gebeten haben.
Wo wir wieder beim Thema Rechte der Tiere sind. Und wer setzt sich für diese ein? Richtig: PETA, die weltweit größte Tierschutzorganisation. Die waren weniger erfreut über die Kommerzialisierung des Selfies und klagten deshalb sowohl den Fotografen als auch den Verlag an. Die Klage stützte sich darauf, dass die Rechte der Bilder bei keinem anderen als dem Affen Naruto selbst liegen würden. PETA schlug daher vor, dass die Einnahmen zukünftig dem Artenschutz der Makaken zugutekommen.
Und ehe sich der Fotograf versah, landete er aufgrund des Affenfotos vor einem US-Gericht. Slater beteuerte dort, dass er durch die Verbreitung des Bildes im Internet große finanzielle Einbuße gehabt habe. Seiner Meinung nach war er selbst nach wie vor der Urheber der Selfies, schließlich war er es, der die Kameras aufgestellt hatte. Und wer sollte sonst das Copyright haben, wenn nicht er? Ein Affe?! Sicher nicht (so seine Argumentation).
Zumindest in Deutschland hätte Naruto keine Urheberrechte an dem Foto gehabt. Ob der Fotograf hier jedoch die Rechte besäße, ist eher schwierig zu beantworten. Dafür ist nämlich der Ablauf der Aktion entscheidend. Kurz gesagt kommt es darauf an, ob das Selfie Produkt einer detaillierten Planung Slaters war oder ob Naruto selbst derartige Akzente gesetzt hat, dass das Foto nicht mehr genug auf der Planung des Briten beruhte.
Tatsächlich gab das amerikanische Gericht Slater in dieser Hinsicht recht: Tiere haben keine eigenen Rechte, geschweige denn Urheberrechte - etwas, was PETA hätte wissen müssen. Daher wurde die Klage vom Gericht sogar als »unseriös« abgestempelt. Das Gericht warf der Organisation vor, nur im eigenen Interesse und nicht in dem des Affen zu handeln. Naruto selbst wird wohl nicht bei der Tierschutzorganisation angerufen und darum gebeten haben, Slater zu verklagen ...
Nicht mal das Prädikat »netter Versuch« gab es für die Tierschützer. Zwar gewann Slater, jedoch kam ihn der Prozess zunächst teuer zu stehen. Durch die Verfahrenskosten war er zwischenzeitlich finanziell ruiniert. Am Ende des Streits konnte der Fotograf nicht einmal mehr zu den Verhandlungen kommen, weil ihm das Geld für die Flüge fehlte. Schlussendlich konnte Slater aber aufatmen: PETA wurden die Anwaltskosten des Fotografen auferlegt, was in den Vereinigten Staaten eher unüblich ist. Fast wäre es sogar zu einem außergerichtlichen Vergleich gekommen. Die beiden Parteien einigten sich nämlich darauf, dass der Brite ein Viertel der mit dem Bild generierten Einnahmen spenden sollte. Das Gericht schob dem jedoch einen Riegel vor. PETA sollte nämlich nicht durch solches Taktieren einen Gewinn für die eigenen Interessen herausschlagen.
Ende gut, alles gut für Slater? Irgendwie schon, zumindest ein bisschen. Schließlich bekam der Fotograf die Urheberrechte zugesprochen und darüber hinaus das Recht, Verletzungen gegen diese einzuklagen. Somit sollte er fortan auch gegen unerlaubte Verbreitungen im Internet vorgehen können. Vielleicht kann er so einen Teil des Geldes wieder reinholen, das ihm bislang flöten ging.
§ SIEG VOR GERICHT - EIN GRUND ZUM LÄCHELN FÜR GRUMPY CAT?
Für diesen Fall blicken wir nicht auf ein breites Affengrinsen, sondern auf einen wahren Miesepeter. In den Vereinigten Staaten erhielt eine Katze mindestens 710 000 Dollar Schadensersatz. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Katze: Nein, es geht um Grumpy Cat. Für alle, denen Grumpy Cat kein Begriff ist: Die Katze war beziehungsweise ist ein Internethit. 2012 tauchte ein Foto des Stubentigers auf der Plattform Reddit auf, ehe ein YouTube-Video folgte, und prompt war ein Star geboren. Dass die Katze überhaupt so berühmt ist, liegt an ihren mürrischen Gesichtszügen (leider litt Grumpy Cat, mit richtigem Namen Tardar Sauce, auch an Kleinwuchs). Grumpy Cats Besitzerin machte ihr Haustier zu einer Marke und gründete die Firma Grumpy Cat Limited, um mit dem Kätzchen so richtig viel Asche, äh, Katzenstreu, zu machen. Und so hat die wahrscheinlich berühmteste Katze der Welt auch nach ihrem bedauerlichen Ableben noch fast 9 Millionen Fans auf Facebook sowie 2,6 Millionen auf Instagram. Darüber hinaus hat Grumpy Cat sogar eine Wachsfigur im Madame Tussauds in San Francisco (wer kann das schon von sich behaupten?).
Ein amerikanischer Kaffeehersteller namens Grenade wollte von dem Hype profitieren und bot einen »Grumppuccino« an. Das Recht, Kaffees mit diesem Namen zu verkaufen, ließ sich das Unternehmen nicht gerade wenig Geld kosten: 150 000 US-Dollar wurden für die Nutzungsrechte gezahlt. Ein witziges Motiv für T-Shirts, dachte sich das Unternehmen wohl irgendwann. Problem: Vertraglich war es nicht festgelegt, dass das Motiv der Katze für T-Shirts und Kaffeebohnenverpackungen genutzt werden darf.
Das war Grumpy Cats Besitzerin Tabatha Bundesen ein Dorn im Auge, um es milde auszudrücken. Sie ging juristisch wegen der Verletzung von Marken- und Urheberrechten gegen das Kaffeeunternehmen vor. Auf offene Arme ist sie mit ihrer Klage logischerweise nicht gestoßen. Die Anwälte von Grenade hielten der Klage nämlich entgegen, dass Bundesen sich selbst nicht an einige vertragliche Vereinbarungen gehalten haben soll. Zum Beispiel sei der Kaffee des Unternehmens nicht ausreichend auf Grumpy Cats Social-Media-Kanälen beworben worden. Darüber hinaus, haltet euch fest, habe die Halterin versprochen, dass die mürrische Katze bald Teil eines Hollywoodfilms mit Will Ferrell und Jack Black werden sollte, wovon sich das Unternehmen steigende Verkaufszahlen versprochen hatte. Diese Abmachung wurde jedoch nicht in die Tat umgesetzt.
Ein Gericht in Kalifornien musste über den Fall entscheiden, insgesamt wurde eine Woche lang verhandelt. Am Ende bekam die Katze, die sogar höchstpersönlich vor Gericht erschien, in zwei von fünf Punkten den Zuspruch von den Richtern. Insgesamt wurden Grumpy Cat Limited 480 000 US-Dollar wegen der Verletzung von Markenrechten (Trademark) und 230 000 US-Dollar wegen der Verletzung von Urheberrechten (Copyright) zugesprochen. In Summe somit 710 000 US-Dollar für Grumpy Cat.
Das wurde also teuer für das Kaffeeunternehmen. Leider weilt Grumpy Cat nicht mehr unter uns, seine Legende lebt aber weiter. Auch heute werden noch aktiv Fotos der Katze auf den sozialen Medien gepostet, wahrscheinlich sind die meisten von uns sogar irgendwann mal einem Meme der Berühmtheit begegnet. Denn wie heißt es so schön: Das Internet vergisst nie! Erst recht keine Katze mit mürrischem Gesicht.
§ SPEKULATIONEN AUF DEM HAMSTERRAD: WIE ERFOLGREICH WAR DER HAMSTERBROKER MR. GOXX?
Wer mit Krypto handelt, braucht ein gewisses Know-how (und oft eine Menge Glück), um damit Erfolge einzufahren, oder? Tatsächlich reicht manchmal auch ein gutes Bauchgefühl - auch, wenn der Bauch flauschig und mit Fell bedeckt ist ...
Dass Tiere besondere Fähigkeiten haben, ist nichts Neues. Schaut man sich mal auf Plattformen wie YouTube um, könnte man meinen, dass manche Tiere verkleidete Menschen sind. Sportliche, musizierende oder anderweitig talentierte Vierbeiner sind da nichts Besonderes mehr (mein Favorit sind Volleyball spielende Hunde ... mittlerweile reichlich auf YouTube zu finden). Aber ein Hamster, der mit Krypto handelt? Das scheint dann doch eher ungewöhnlich. Achtung, anschnallen: Der Kryptohamster hat zwischenzeitlich mit einer Kurssteigerung von fast 50 Prozent mehr Gewinne eingefahren als beispielsweise Starinvestor Warren Buffet (zumindest prozentual gesehen).
Wie kam es zu dieser steilen Karriere? Der Hamster gehörte dem Twitter-User Mr. Goxx. Das Tier selbst hieß gleich wie sein Besitzer und »handelte« mit Kryptowährungen. Und der Hamster hatte Fans! Über Streamingplattformen konnten Anleger die Investmentstrategien verfolgen und sich womöglich auch was abgucken. Jetzt zum Ablauf: Der deutsche Besitzer des Hamsters baute seinem Haustier ein Büro, die sogenannte Goxx-Box. In der Box hatte der kreative Halter zwei Röhren eingebaut, die zum Hamsterrad führten. Lief der Hamster durch die linke Röhre, sollte Mr. Goxx kaufen, lief er durch die rechte Röhre, stand ein Verkauf an. Durch das sich drehende Hamsterrad wurde dann eine von 30 möglichen Währungen gehandelt. Ein installierter Computer hielt jede Handlung des Hamsters fest und setzte diese in eine Transaktion um - auf die Idee muss man erst mal kommen.
Gehandelt wurde übrigens in Schritten von 20 Euro, das Startkapital waren 330 Euro. Mit der Kurssteigerung von fast 50 Prozent stand der Hamster vorübergehend bei 490 Euro - Hut ab.
Wer denkt, dass sich der Hamster von den Gewinnen neue Spielzeuge kaufen kann (oder irgendwas anderes - wofür auch immer Hamster ihr Geld ausgeben), der täuscht sich. Auf Tiere sind die Vorschriften über Sachen anzuwenden, die Gewinne landen also beim Besitzer - Mr. Goxx selbst. Allerdings muss er die Kryptogewinne ab einem gewissen Betrag versteuern (wir sind hier immer noch in Deutschland).
Doch wie konnte das Ganze überhaupt passieren? Hatte der Hamster wirklich versteckte Talente und konnte die Börsenentwicklung vorhersehen? Wer weiß, vielleicht hat auch euer Haustier versteckte Talente? Womöglich hören wir bald von einer Flöte spielenden Katze, einer pokernden Schildkröte oder zwei Axolotl, die gemeinsam synchronschwimmen? Oder - was wohl weitaus wahrscheinlicher war - es handelte sich um puren Zufall. Für den Hamster war schließlich alles wie immer: Er vergnügte sich mit Rädern, Röhren und anderem Spielzeug. Für die Zufallsvariante spricht auch, dass der Kurs leider wieder einbrach. Trotzdem war diese Geschichte sehr unterhaltsam und auch für Außenstehende über Twitch, YouTube und Co. schön mitzuverfolgen. Aber bevor die Leser nun auf falsche Ideen kommen: Zufälliges und schnelles Handeln ist langfristig keine erfolgversprechende Taktik. Zwar kam eine Studie 2019 tatsächlich zu dem Ergebnis, dass sich eine zufällige Aufstellung des Depots für Neulinge nicht selten auszahlt. Nichtsdestotrotz: Obacht beim Investieren!
Übrigens: Leider weilt der Hamster nicht mehr unter uns. Seinen Fans und seinem Besitzer wird er aber immer in Erinnerung bleiben.
§ STADT PFÄNDET MOPS EDDA - UND VERKAUFT DIE HÜNDIN BEI EBAY
Dass ein Insolvenzverfahren kein Zuckerschlecken ist, müsste bekannt sein. Man muss dabei sein wirklich letztes Hab und Gut abgeben, das man nicht unbedingt zum Leben braucht, um so viele Schulden wie möglich begleichen zu können. Nicht einmal vor Wimbledon-Pokalen wird haltgemacht, wie Boris Becker am eigenen Leib erfahren musste. Aber was hat ein Insolvenzverfahren mit Tieren zu tun? Na ja, nicht nur wird der Reichsadler auf dem Pfandsiegel gern Kuckuck genannt, dieser wird auch auf echten Haustieren angebracht. Was, das wäre doch eine Grenzüberschreitung, oder?!
Es klingt wie ein schlechter Scherz, für eine Ahlener Familie wurde es aber Realität. Sie schuldeten der Stadt Ahlen Geld, also pfändeten und verkauften Zwangsvollstrecker einfach deren geliebten Mops Edda. Herzlos? Absolut! Und es kommt noch schlimmer! Tiere sind ja Sachen, dachten sich die Verantwortlichen - und inserierten das arme entführte Hündchen einfach bei eBay, als wäre es ein Staubsauger oder eine alte Mikrowelle. Abgesehen davon, dass Versteigerungen über eBay im Insolvenzverfahren generell nicht rechtens sind (üblich wäre eine Versteigerung durch einen Auktionator) - durfte der Mops überhaupt gepfändet werden?
Die Antwort lautet in diesem Fall wohl Jein mit einer Tendenz zum Nein. Wie wir bereits gelernt haben, handelt es sich bei Tieren zivilrechtlich um Sachen. Laut der Zivilprozessordnung dürfen alle Sachen, die im Besitz des Schuldners stehen, gepfändet werden. Aber es gibt eine Ausnahme: Tiere, die dem Lebensunterhalt dienen (beispielsweise Kühe oder Schafe), und auch Haustiere sind davon ausgenommen. Beim Pfändungsverbot für Haustiere steht insbesondere das Tierwohl im Vordergrund. Edda selbst dürfte wenig Interesse daran gehabt haben, über eBay an eine neue Familie verscherbelt zu werden.
Aber Achtung, jetzt folgt die Ausnahme der Ausnahme: Sollten die Einnahmen durch das Haustier so hoch sein, dass das Tierwohl und das Leid der Familie hintangestellt werden können, dann darf im Zweifel auch dessen Pfändung erfolgen. Irgendwie traurig, oder? Ob die Einnahmen (690 Euro) das Interesse des Tieres und der Familie hier wirklich überwiegen, ist sehr stark anzuzweifeln. Es wurde zwar nicht richterlich festgestellt (es kam hierüber nicht zu einer Verhandlung), aber die Pfändung war wohl nicht rechtens. Dazu trägt auch die Versteigerung über eBay bei.
Der Verkauf bei eBay wird dennoch nicht rückgängig gemacht werden. Denn der Fall ging weiter - sogar die New York Times hat darüber berichtet. Als wäre das alles nicht genug, hat die Stadt der eBay-Käuferin und neuen Besitzerin der Hündin großen Ärger eingebracht. Der Fall landete vor dem Landgericht Münster. Die Stadt hatte den Mops als gesundes Tier auf eBay inseriert, obwohl Edda eventuell krank war. Edda, die mittlerweile übrigens Wilma heißt, hatte laut Angaben der späteren Käuferin nämlich eine Augenreizung sowie weitere Krankheiten. Leider war sogar eine Operation notwendig, die die neue Halterin mehrere Tausend Euro kostete. Das Gericht konnte später jedoch nicht eindeutig feststellen, dass Edda zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht gesund war. Und selbst wenn, konnte nicht ermittelt werden, dass diejenigen, die die Anzeige auf eBay stellten, von einer möglichen Krankheit gewusst und diese verheimlicht hatten. Das Gericht stellt lediglich fest, dass eine Impfung fehlte. Statt den geforderten 19 000 Euro gab es also nur ein paar Hundert.
Hier hat der Vierbeiner der Stadt 690 Euro eingebracht. Doch was sind die eingenommenen knapp 700 Euro im Verhältnis zu der Lücke, die in die ohnehin schon leidende Familie gerissen wurde? Edda wird laut Aussage der Mutter sehr von der Familie vermisst. Scheint wohl, als hätten die Verantwortlichen bei der Stadt kein geliebtes Haustier, sonst hätten sie so etwas wohl kaum übers Herz gebracht.
Landgericht Münster, Urteil vom 05.04.2023, Az. 02 O 376/19.
§ RENTNERIN SOLL 12 000 EURO ZAHLEN - FÜRS TAUBENFÜTTERN!
Na, wer von euch konnte bisher der Versuchung widerstehen, irgendwelche fremden Vögel aus dem Park zu füttern, wenn diese auf das letzte Stück Brezel in eurer Hand geiern? Jeder? Glück gehabt! Unter Umständen kann das nämlich teuer werden. Insbesondere dann, wenn Verbote zum Füttern der Tiere ignoriert werden. Übrigens meine ich hier nicht teuer im Sinne von 100 Euro, sondern eher mehr als das Hundertfache ...
Das Taubenfüttern ist nicht grundsätzlich in ganz Deutschland verboten - in Fulda aber schon. Doch was soll man neben den Skat- und Bingoabenden sonst tun, dachte sich eine Rentnerin und missachtete das Verbot mehr als nur einmal. Um genau zu sein: zwölfmal. Die Stadt fand das alles andere als lustig und ließ ihr für jeden Verstoß einen Bußgeldbescheid zukommen. Die damals 66-Jährige erhob gegen jeden Bescheid einen Einspruch. Ihr Argument: Die Tauben seien auf ihr artgerechtes Futter angewiesen, um überleben zu können. Die Frau wollte nicht zahlen, also fand sie sich vor dem Amtsgericht Fulda wieder.
Jetzt kommen wir zur Summe: Wer Tauben im Park füttert, erhält ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro. Wer es danach erneut tut, kann sich auf ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro einstellen, und so weiter. So summieren sich dann recht schnell die beachtlichen 12 000 Euro, die von der tierlieben Rentnerin verlangt wurden.
Doch ist das wirklich im Interesse der Stadt, eine alte Frau, die schließlich nichts Böses im Sinn hatte, um diese Summe zu erleichtern? Wahrscheinlich nicht. Man möge sich nur den medialen Druck und die Proteste vorstellen, hätte das Amtsgericht Fulda das wirklich durchgezogen. Darüber hinaus versicherte die Dame, das Füttern zukünftig zu unterlassen, und gab an, es ohnehin schon seit zwei Jahren nicht mehr getan zu haben. Das Gericht war also gnädig und verurteilte die Frau nur in zwei Fällen und somit zu einer Zahlung von insgesamt 265 Euro.
Der Anwalt der Rentnerin betonte übrigens immer wieder die guten Absichten der Frau und gab sogar an, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen. Ein Fütterungsverbot grenze nämlich die allgemeine Handlungsfreiheit ein. Kleiner Exkurs - denn hierzu nahmen die Karlsruher Richter bereits 1980 Stellung. Der damalige Tenor: Ja, die allgemeine Handlungsfreiheit werde durch solche Verbote eingeschränkt. Jedoch sei das in Ordnung, solange das Verbot einen gewissen Zweck verfolge. Ein Beispiel für einen verfolgten Zweck ist, wenn eine Gemeinde Tauben fernhalten will. Dann sei es nicht zielführend, dass viele Menschen die Tauben füttern und die Vögel deshalb immer wiederkommen. Exkurs Ende.
Ob das Auto des Richters nach dem Urteil voller »vogelartiger Rückstände« war? Wenn ja, waren die Tauben wohl weniger erfreut darüber, dass sie ihre alte Freundin fortan seltener zu Gesicht bekommen würden.
Amtsgericht Fulda, u.a. Az. 25 Owi 332 Js 3035/18
Zum Exkurs: Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 23.05.1980, Az. 2 BvR 854/79

WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN? DA IST MAN SCHLIESSLICH »»AUSLÄNDER«« ...
Ich packe meinen Koffer und nehme mit ... Probleme am Flughafen, dreiste Hotelinhaber, Affenbisse und jodelnde Kreuzfahrtschiffstouristen. Das Reiserecht ist so divers, wie es die verschiedenen Reiseziele sind.
Bereits Christoph Kolumbus hat eine Reise nach Indien gebucht, aber eine nach Amerika bekommen. Zum Glück für die damaligen Gerichte erkannte er zeitlebens nicht, dass er einen neuen Kontinent entdeckt hatte. Kolumbus war aber auch Reisender und Reiseunternehmen zugleich. Anders sieht es da für den Otto-Normal-Pauschalreisenden aus.
Der Sommerurlaub ist für viele das Highlight des Jahres. Lange spart man, um Sonne, Sand und Meer zumindest für einige Zeit hautnah zu erleben. Aber in anderen Ländern herrschen auch andere Sitten. Neben der wunderschönen Landschaft bietet jedes Reiseziel eine einzigartige Kultur. Die Leute, das Essen, die Bräuche - das alles sollte zu jedem Urlaub dazugehören. Für die meisten tut es das zumindest - andere wollen einfach nur einen Ortswechsel: »Deutschland in warm.« Mallorca ist das perfekte Beispiel dafür. Aber das ist manchen schon zu »deutsch«. So geht es ab nach Mauritius, in die Karibik oder nach Kenia. Zum Leidwesen der Gerichte erleiden dann viele einen Kulturschock - wer hätte auch ahnen können, dass es keine Weißwürste mit Brezeln am Buffet gibt? Reiserechtsklagen gibt es wie Sand am Meer. Manchmal sind sie gerechtfertigt, manchmal eine verkürzte Wahrheit, und manchmal sind sie so abstrus, dass selbst erfahrene Richter erst mal Urlaub brauchen. Schnallt euch an, wir gehen auf eine Reise ...
§ BORDEAUX ODER PORTO - EGAL, HAUPTSACHE, ITALIEN
Bevor es in den Flieger zum wohlverdienten Strandurlaub geht, muss der Urlaub erst gebucht werden. Auf zahlreichen Internetseiten kann man den Trip mittlerweile fast im Voraus erleben, indem man sich durch die Tausenden Strand- und Poolbilder klickt. Für manch einen ist das schon zu viel Urlaub vor dem Urlaub, da er sich lieber vor Ort überraschen lassen will. Bleibt nur der Besuch beim altmodischen Reisebüro, oder? Aber selbst dort wird man vermutlich ein paar Blicke auf den Reiseprospekt erhaschen. Deshalb kommt nur eines infrage: der klassische Anruf - anrufen, buchen, hinfahren und sich von den überraschenden Eindrücken vor Ort überwältigen lassen. Klingt toll? Ist es bestimmt auch, aber nur, wenn man auch an dem Ort landet, den man sehen will.
Wo das Problem liegt, fragt ihr euch? Nicht jeder hat den Duden mit Löffeln gegessen. Vor allem, wenn es um die richtige Aussprache geht. Über die Hälfte der Deutschen sprechen regelmäßig Dialekt. Eine aus Sachsen stammende Frau buchte in einem schwäbischen Reisebüro einen Urlaub ... So könnte ein schlechter Witz anfangen. Das tut er auch, zumindest wenn man die Sächsin nach der Pointe fragt. Diese rief bei dem Reiseunternehmen an, um einen Flug nach »Bordöo« zu buchen. Wer mal mit einem Sachsen länger als zehn Minuten in einem Raum war, weiß: Die Frau will nach Portugal, genauer gesagt nach Porto. Die Dame im Reisebüro ging jedoch davon aus, dass die Kundin beim Urlaubsort eine kurze Pause vom Dialekt machte. Zweimal fragte sie nach, ob das gewünschte Reiseziel Bordeaux sei. Einen Unterschied erkannte die Sächsin natürlich nicht, auch wenn sie bestimmt verwundert war, warum die Schwäbin plötzlich so gut Sächsisch sprach.
So bestätigte sie die Buchung, und es kam sogleich die Überraschung: Als die Reiseunterlagen eintrafen, gab es keine Verwechslungsgefahr mehr. Mit keinem Dialekt der Welt klingt Frankreich wie Portugal. Die Frau war sich nun sicher, sie war einem Irrtum unterlegen. Und bei einem Irrtum muss das ursprünglich Gemeinte zählen und ich kann andernfalls den Vertrag für ungültig erklären, oder?
Das musste das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt klären. »Mist!«, dachte die Sächsin. Heimvorteil für das Reisebüro also. Nicht ohne Grund gehört der Fall zu den Zivilrechtsklassikern einer jeden Uni: Ein Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Übereinstimmend heißt, beide Parteien müssen sich im Klaren sein, was der andere mit seiner Aussage meint.
Indem die Mitarbeiterin des Reisebüros mehrmals in korrektem Hochdeutsch Bordeaux als Reiseziel angab und sogar die Flugroute beschrieb, war der Sächsin genug Möglichkeit gegeben, den Irrtum klarzustellen.
Ein Vertrag kam also über den französischen Urlaubsort zustande. Diesen hätte sie anfechten können, was sie wahrscheinlich wegen einer Verfristung nicht tat.
Also Pech gehabt: Ob sie wollte oder nicht, ihr Flieger ging nach Frankreich, mit ihr oder ohne sie. Ob die Sächsin die fast 300 Euro teuren Flugtickets verfallen ließ, das war ihre Sache.
Aber es hätte die Frau auch schlimmer treffen können: Zum Glück befand sich das buddhistische italienische Bergdorf »Bordo« nicht unter den Urlaubszielen des Stuttgarter Reisebüros. Zwar ist Italien auch nicht weit weg. Ein isoliertes Dorf auf 750 Metern, das nur zu Fuß erreichbar ist, hätte wahrscheinlich aber noch weniger der Vorliebe der sächsischen Dame für europäische Städte entsprochen.
Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt, Urteil vom 16.03.2012,
Az. 12 C 3263/11
§ ZU VIEL GEFUTTERT - ZU SCHWER FÜR DEN FLUG
Hundebesitzer wissen: Dem traurigen Blick der treuherzigen Racker können die wenigsten widerstehen - insbesondere wenn es ums Futtern geht. Wenn der kleine Begleiter dann jaulend vor dem Futternapf steht, obwohl er erst vor zwei Stunden seine letzte Ration bekam, werden manche Herzen schwach und man erbarmt sich, doch noch ein kleines Leckerli hinzuschmeißen.
Ein paar Schmackofatz zu viel hatte der Mischlingshund Pinoia einer deutschen Familie. Den Trick mit den Kulleraugen hat er wohl bei allen Familienmitgliedern angewandt. Eine Oscar-reife Leistung! Diese ist aber spätestens am Flughafen Düsseldorf aufgefallen. Es war nicht die erste Reise der Familie mit dem Hund. Immer durfte der Vierbeiner in der Passagierkabine mitfliegen. Als die Familie jedoch am Terminal neben dem Koffer auch den Hund wiegen musste, kam das böse Erwachen: Der Mischling hatte zu viel Speck auf den Hüften. Er überschritt das Kabinenhöchstgewicht bei Weitem. Natürlich hatte die Familie keine Frachtbox dabei, sodass der Vater mit dem Taxi zum anderen Ende des Flughafens fahren musste, um eine zu besorgen. Just in dem Moment, als er mit der rettenden Box heraneilte, schloss jedoch das Terminal. Die Folge: Kein Flug nach Portugal. Der alte vierrädrige Karren musste für die Strecke herhalten. Die über 900 Euro teuren Flugtickets waren hinüber.
Der erste Schritt nach dem Urlaub war für die Familie selbstverständlich: eine Klage vor Gericht, allein der Ehre ihres geliebten Bellos zuliebe. Die Familienmitglieder bestritten vehement, dass ihr Hund fett geworden sei. Er habe allenfalls ein wenig zugelegt.
Wer hingegen nicht bestreitet, ein paar Kilo über dem Durchschnitt zu haben, ist das brasilianische Plus-Size-Model Juliana Nehme. Immerhin ist das Gewicht der Influencerin, die sich gegen Bodyshaming einsetzt, gewissermaßen ihr Markenzeichen. Was sie jedoch mit Pinoia teilt: einen längeren Flughafenaufenthalt als ursprünglich geplant. Der Brasilianerin wurde der Zugang verwehrt, als sie aus dem Libanon nach Hause fliegen wollte. Der Grund? Sie sei laut Mitarbeiterin der Fluggesellschaft »zu fett« für die Economy Class. Aber auch einen Ausweg bot die Mitarbeiterin an. Das XXL-Model könne ja ein Ticket der ersten Klasse für schlappe 3000 Euro erwerben, da dort die Sitze breiter seien. Ob das Verhalten der Airline den seinerzeit über 150 000 Followern auf Instagram von Juliana Nehme gefiel? Das könnt ihr euch selbst denken. Jedenfalls war die Einzige, die irgendein Ticket erwarb, wohl die Mitarbeiterin - und zwar ein kostenloses Ticket für den Gerichtsprozess in erster Reihe direkt auf dem Zeugenstuhl.
Wir haben also zwei Fälle von »zu viel gefuttert für das Flugzeug« (zumindest laut Airline). Aber auf welcher Seite stehen die Richter - sind sie für gutes leckeres Essen oder für die Freiheit der Fluggesellschaften, die dann bestimmen dürfen, wo die Obergrenze an zulässigem Bauchspeck liegt?
In Juliana Nehmes Fall gab ihr das Gericht in erster Instanz Recht. Etwa 3500 Euro Entschädigungszahlung soll die Abweisung der Fluggesellschaft kosten. Das entspricht einem Jahr Therapiekosten, »um das belastende und traumatische Ereignis zu überwinden«.
Ein traumatisches Ereignis musste Pinoia wahrscheinlich nicht überwinden. Die Frage ist eher, ob er von den Geschehnissen am Flughafen überhaupt etwas mitbekommen hat oder nur an seinen nächsten saftigen Kauknochen dachte.
Im Fall des wohlgenährten Vierbeinigen konnte der Richter der Airline keine Willkür nachweisen, bot den beiden Parteien aber einen Vergleich an. Wahrscheinlich war der Wonneproppen mit im Gerichtssaal und ließ seinen besten Dackelblick walten. Die Fluggesellschaft stimmte dem Vergleich zu und erstattete immerhin die Hälfte der Flugtickets.
Bevor es in den nächsten Urlaub geht, gibt es für Pinoia bestimmt nur streng rationiertes Trockenfutter und Wasser. Da hilft auch der beste Dackelblick nichts mehr. Und Juliana Nehme? Sie hat ein neues Paradebeispiel für Bodyshaming, das sie auf ihrer Instagram-Seite teilen kann.
§ BOMBENSTIMMUNG AM FLUGHAFEN
Wer bereits in die USA geflogen ist, kennt die strenge Sicherheitsbefragung der Grenzbeamten. Ähnlich einem Kreuzverhör bei der CIA wird man über Reisezweck, Reisedauer, persönliche Beziehungen und noch einiges mehr ausgehorcht. Fehlt nur die Frage, welche Farbe die getragene Unterhose hat. Gefühlt werden alle privaten Details der Urlaubsreise auf Herz und Nieren geprüft. Natürlich dient dies dem Sicherheitsinteresse. Trotzdem fühlt man sich an die Supermarktsituation erinnert, bei der man aufgrund des ausverkauften Angebots ohne Waren durch den Kassenbereich geht. Eigentlich hat man nichts Falsches gemacht, fühlt sich aber trotzdem wie ein Schwerverbrecher.
Jeder geht mit Druck anders um, und so rutscht manchmal ein Wort raus, das eher nicht zuträglich für die Gesamtsituation ist - um es mal neutral auszudrücken. Wie beim Erklären eines Wortes bei dem Spiel Tabu sollte man aber am Flughafen eine Liste an Wörtern lieber nicht in den Mund nehmen.
Für seine Beschreibung des Reisezwecks erhält ein Deutscher im Flughafen Düsseldorf wohl keine Punkte von den Beamten. Auf die Frage, was er in Florida zu suchen habe, antwortete er nämlich: Er plane in Amerika »einen bombigen Urlaub«. Autsch! Das ist schon kein Fettnäpfchen mehr, in das der Mann trat, sondern eher ein fetter fettiger Fettnapf. Wenig überraschend fanden die Mitarbeiter dessen Antwort nicht so bombastisch. Trotz mehrfachen Beteuerns des Urlaubers, dass er »bombig« im Sinne von »großartig« meinte, war der Argwohn der Sicherheitskräfte zu groß. Vielleicht auch, um ihn vor der erneuten Befragung in Amerika zu bewahren, wurde ihm der Start versagt.
Nach dieser Nachricht war seine Vorfreude auf den Trip geplatzt. Aber war das Verhalten der Security rechtens? Macht sich ein Passagier verdächtig, wenn er etwas »bombig« findet? Damit trat der Mann an das Amtsgericht Düsseldorf heran. Dieses sah die Formulierung zwar als missglückt an, jedoch nicht als unverständlich. Die falsch ausgedrückte Vorfreude sei kein Grund, den Reisenden komplett vom Flug auszuschließen.
Dass die Fluggesellschaft bei Verkündung des Urteils vor Wut explodierte - davor musste niemand im Gerichtssaal Angst haben. Zum Prozess erschien kein Vertreter. Vielleicht wussten sie bereits, dass sie etwas überreagiert hatten. Der Mann erhielt also 1400 Euro Entschädigung auf dem Wege eines Versäumnisurteils.
Bis zu seinem nächsten Urlaub sollte der zurückgelassene Fluggast ein paar Wörter aus seinem Wortschatz streichen. Zumindest wenn er gerade im Sicherheitscheck ist. Als kleine Starthilfe: Der Urlaub kann nicht nur »bombig«, sondern auch: fabelhaft, grandios, vorzüglich, primissima, dufte, knorke oder einfach toll werden.
Amtsgericht Düsseldorf, Urteil vom 19.03.2019, Az. 42 C 310/18
§ IM AUSLAND BIST DU DER AUSLÄNDER
Arbeitskollege: »Und wie war dein Urlaub?«
Urlaubsrückkehrer: »Ganz okay, am Buffet waren zu viele Fliegen, und es gab zu viele Ausländer am Strand.«
Arbeitskollege: »Oh, das mit den Fliegen ist blöd, und ich finde zu viele Touris an den Urlaubsorten auch bedenklich, da bekommt man ja kaum mehr was von der einheimischen Kultur mit!«
Urlaubsrückkehrer: »Nein, ich meinte keine Touristen, ich meine die Einheimischen!«
Arbeitskollege, du und ich: »Was?«
So könnte das Gespräch eines deutschen Urlaubers nach seiner Rückkehr mit seinem Arbeitskollegen stattgefunden haben. Wer nach dem letzten Satz nicht fassungslos »Was?« gerufen hat, kennt bestimmt schon den Mann, der keine »Ausländer« im Ausland erwartet hat. Vielleicht sollte ihm mal jemand erklären, dass er dort der Ausländer ist?
Der Mann verbrachte seinen Urlaub mit seiner Frau in dem ostafrikanischen Mauritius. Dort erwartete er wahrscheinlich deutsche Urlauber mit Socken in den Sandalen, welche farblich zum Deutschlandtrikot passen. Anders als am Ballermann fand er aber dort tatsächlich Einheimische vor, welch eine Überraschung. Diese waren so dreist, dass sie sogar ihre eigenen Strände nutzten und dort ihr traditionelles Volksfest feierten.
Das ließ das Ehepaar nicht auf sich sitzen und erhob aufgrund des Kulturschocks Klage vor dem Amtsgericht Aschaffenburg. Dort bemängelten sie neben den Einheimischen und Fliegen auch noch das »ekelerregende« Abendessen des Hotels.
Der vorsitzende Richter, wer hätte es gedacht, wies die Klage kurzerhand ab. Zu Recht erinnerte er daran, dass in der Reisebeschreibung kein Strand zur Alleinbenutzung angeboten wurde. Warum das Ehepaar davon ausgegangen sei, dass Einheimische ihren Strand nicht benutzten, werde das Geheimnis der beiden bleiben, führte er aus. Denn wer Fernreisen unternehme, sei normalerweise bemüht, andere Leute und Länder kennenzulernen. Zu den Fliegen am Buffet erteilte der Richter dann noch eine kleine Unterrichtseinheit in Allgemeinwissen: Da in der Reiseausschreibung von einem »offenen Restaurant« gesprochen wurde, habe das Restaurant offensichtlich keine Wände, sodass ein verständiger Leser damit rechnen müsse, dass Fliegen dorthin gelangen könnten. Zum Essen führte er aus, dass es so schlecht nicht gewesen sein könne, immerhin habe der Mann keine Probleme damit gehabt, sich den Magen vollzuschlagen. Dass seine Frau Magenprobleme bekam, müsse also nicht zwingend am Essen gelegen haben.
Geld bekam das Ehepaar also nicht zurück. Der nächste Urlaub geht bestimmt wieder ins 17. Bundesland, Mallorca. Dort trifft man immerhin nicht auf diese »lästigen Ausländer«.
Amtsgericht Aschaffenburg, Urteil vom 19.12.1996, Az. 13 C 3517/95
§ KARIBISCHE KLÄNGE MAL ANDERS
Urlaub ist für viele die einzige Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Endlich mal wieder die Batterien aufladen und dem Stress entkommen. Wenn man dann noch auf seiner Liege etwas von der Welt sehen will, ist ein Kreuzfahrtschiff der perfekte Urlaubsort. Auch wenn die wenigsten ihren Entspannungsurlaub detailliert planen, sah der Urlaubskalender zweier deutscher Urlauber vor der Abreise wohl so aus:
| 10.00-12.00 Uhr | Liegestuhl |
| 12.00 Uhr | Essen |
| 13.00-19.00 Uhr | Liegestuhl |
| 20.00 Uhr | Essen |
Stattdessen sah ein gewöhnliches Tagesprogramm laut Bordzeitung aber so aus:
| 9.30 Uhr | Trachtentanz in der Galaxi Disco auf dem Sun Deck |
| 10.00 Uhr | Kapelle E beim Schwimmbad |
| 10.30 Uhr | Folklorechoerli in der Galaxi Disco auf dem Sun Deck, vorn |
| 20.15 Uhr | Rassige Unterhaltung mit Dorfspatzen Oberaegeri beim Schwimmbad auf dem Jerusalem Deck, hinten |
| 20.15 Uhr | Tanz mit der Kapelle E im Mayfair Ballsaal auf dem Athens Deck, hinten |
| 22.00 Uhr | Kapelle H M in der Rendezvous Bar |
| 22.00 Uhr | Gemütlicher Folkloreabend im Mayfair Ballsaal auf dem Athens Deck |
»Bist du deppert!«, dachten sich die beiden Reisenden. Ein klassisches Beispiel für »Zur falschen Zeit am richtigen Ort«, denn was die beiden Deutschen nicht wussten: Zu den etwa 560 Reisegästen zählten neben 60 anderen Deutschen auch noch 500 Schweizer. Und die waren nicht zufällig dort. Sie bildeten eine einheitliche Reisegruppe eines Schweizer Folklorevereins.
Folklore bedeutet in etwa Volkskunde. Und was schweizerische Volkskunde so mit sich bringt, kann man sich denken: Trachtentänze, Jodeln, Alphornblasen und Chörli-Gesänge. Alle diese Festlichkeiten begleiteten die Urlauber nun auf der knapp dreiwöchigen Kreuzfahrt. Und dann wurde sogar noch fast jede Aktivität in Schwyzerdütsch schwungvoll angepriesen.
Nur verständlich ist es deshalb, dass die beiden ihr Geld zurückforderten. Ein Urlaub in der Schweiz wäre schließlich viel günstiger und auch nicht so weit weg gewesen. Aber was sagte das Landgericht Frankfurt dazu? Durften die Urlauber südamerikanische Rhythmen statt Schweizer Käse und Kuhglocken erwarten? Ja, sagte das Gericht. Schweizer Jodeln sei ein Reisemangel. Zumindest, wenn man sich gerade auf einem Schiff in der Karibik befinde und keine Alpenüberquerung geplant habe. Zwar war im Reiseprospekt angedeutet, dass es vereinzelte Folkloreveranstaltungen gibt. Diese sollten aber vorwiegend abends in einem abgetrennten Raum stattfinden und nicht ganztägig auf dem ganzen Schiff. Die Gaudi entsprach also in keiner Weise dem beworbenen Programm und auch nicht den geografischen Gegebenheiten, die in der Karibik erwartet werden durften.
Na, hoffentlich sind die deutschen Urlauber um ein paar mehr Redewendungen reicher. Aber das ist bestimmt unausweichlich, wenn man über zwei Wochen jeden Tag nur hört: »S’git nüt, wos nöd git« oder »Das schläckt kei Geiss wäg«.
Landgericht Frankfurt, Urteil vom 19.04.1993, Az. 2/24 S 341/92
§ DIE BOURGEOISIE TRIFFT AUF DIE SCHMATZENDEN RÜLPSER
Kleider machen Leute. Und Leute machen Luxushotels. Also aus dem Weg, Geringverdiener! Das meinte zumindest eine Familie aus Hamburg. Fast 6000 Mark zahlten sie für einen zweiwöchigen Trip nach Tunesien. Eigentlich ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass man zum Sternezählen nicht in den Nachthimmel blicken muss, sondern einfach am Hoteleingang vorbeigehen kann. Fünf Sterne konnte man da zählen! Einen eigenen rund um die Uhr zugewiesenen Hotelpagen erwarteten sie zwar nicht, dafür aber Klasse - und zwar von den anderen Gästen. Teure Pelzmäntel, Rolex-Uhren oder einen Prada-Anzug aus Kaschmir - das war die Vorstellung der ein- und ausgehenden High Class. Dem machte das Nachbarhotel aber einen Strich durch die Rechnung. Wegen einer Überbuchung waren nicht Unternehmer und Adlige das Klientel, sondern »Billigtouristen« und »Pöbel«. Das andere Hotel hatte nämlich nur drei Sterne und musste seine Gäste auf eigene Kosten in das teurere Fünfsternehotel einweisen.
Demnach hätten die Gäste des Nachbarhotels laut Familie »ein einfach strukturiertes Niveau gehabt und sich in Auftreten und Benehmen unangenehm vom gehobenen Standard der übrigen Gäste unterschieden«. Das äußerte sich unter anderem darin, dass sie in nasser Kleidung und Badelatschen im Restaurant saßen und sogar gerülpst hätten. Na prost Mahlzeit! Die Gäste des »Billighotels« sollen obendrein noch gerochen haben. Und zwar nicht nach der von Jeremy Fragrance beworbenen Flakonflasche des L’Homme-Prada-Parfums! Igitt!
Als aber dann das prunkvolle Casino des Hotels - welches nach Angaben der Familie nur wegen der Spielbank aus dem Katalog ausgewählt wurde - zu der Urlaubszeit geschlossen war, brach der Himmel komplett über ihnen zusammen. Man konnte den Bourgeoisie-Status nicht einmal im hoteleigenen Casino wieder verspielen. Was eine Frechheit!
Aber was sagte das Amtsgericht Hamburg dazu? Habe ich ein Recht darauf, meinen in Trüffel eingelegten Hummer mit Kaviar ohne die Anwesenheit von rülpsenden Touris zu genießen? Achtung, jetzt nicht am Champagner verschlucken! Nein, sagte der Richter. »Rülpsende Mitreisende« sind kein Reisemangel. Es gebe keinen Anspruch auf ein bestimmtes Publikum in Luxushotels. In Zeiten von Massentourismus müsse man auch in einem gehobenen Hotel mit allen Bevölkerungsschichten rechnen. Weiterhin seien Körpergeruch und Badekleidung in Strandhotels eine hinzunehmende Erscheinung im Rahmen des menschlichen Zusammenlebens. Dann haute der vorsitzende Richter in seinem Urteil noch einen kleinen »Diss« raus. Dies solle insbesondere dort, wo 14 Tage inklusive Flug und Halbpension »nur« 2000 Mark pro Person kosten, gelten. Entweder er wollte die Familie von ihrem hohen Ross holen oder er war erschüttert, dass ein 6000-Mark-Trip als Luxusreise betitelt wurde. Wenn man sich die Besoldungsgruppe für Amtsrichter anschaut, dann eher Ersteres. Auch das geschlossene Casino sei kein Grund für eine Minderung, schließlich können Sonderangebote von der Katalogbeschreibung abweichen.
Vielleicht war dieser spezielle Urlaub ganz gut für die Familie, denn eine lange Nacht im Casino hätte durchaus dafür sorgen können, dass sie bei ihrem nächsten Urlaub die Armen gewesen wären. Wobei sie dann wenigstens mal die andere Seite hätten nachempfinden können.
Amtsgericht Hamburg, Urteil vom 07.03.1995, Az. 9 C 2334/94
§ ALLGEMEINES LEBENSRISIKO
»Man gönnt sich ja sonst nichts.« So mancher hat mit diesem Satz schon einen teuren Kauf vor sich selbst gerechtfertigt. Zum Beispiel, wenn man gerade die lang ersehnte Pauschalreise in ein Fünfsternehotel gebucht hat, weil die Fahrradtour mit anschließendem Camping doch zu ordinär schien. Aber ist teurer auch immer besser? Weint es sich wirklich besser im Ferrari als im Dacia Sandero? Manchmal ist man froh über die Investition, manchmal bereut man den Kauf nach wenigen Minuten.
Bei einem Ehepaar aus Deutschland kam die Reue wohl direkt, als sie aus dem Flughafen heraustraten. Sie hatten sich eine dreiwöchige Pauschalreise nach Mauritius gegönnt (mhh, schon wieder Mauritius-Reisende, die sich über Nichtigkeiten beschweren?). Diese war ihnen 12 604 Euro wert - zumindest vor der Reise. Nach der Reise waren ihnen die Erfahrungen keinen Cent mehr wert - im Gegenteil, sie wollten sogar noch Geld von der Reisefirma zurückerstattet haben. Fast doppelt so viel, wie die Reise gekostet hatte (24 750 Euro) wollte das Ehepaar über Schadensersatz und Schmerzensgeld einklagen. Aber wie schlimm muss ein Urlaub sein, um danach nicht 12 000 Euro ärmer, sondern 12 000 Euro reicher sein zu wollen? Und was sagte das Gericht dazu?
Das Landgericht Köln wies die Klage nach Anhörung des Ehemanns in der mündlichen Verhandlung ab. Was?! Bei einer solch hohen Schadensersatzforderung muss doch etwas an den Forderungen dran sein, schließlich hätte das sonst bestimmt kein Anwalt angenommen! Nur die Anwesenden wissen natürlich, wie sich das Ganze wirklich abgespielt hat - aber wer Menschen kennt, weiß auch, dass sie zu Übertreibungen neigen. So könnte das Ehepaar also seine Seite der Geschichte dem beauftragten Anwalt erzählt haben:
»Bereits als wir im Hotel ankamen, wurden wir abgewiesen. Den ganzen Tag konnten wir das Hotel nicht betreten. Nicht einmal etwas Ordentliches zu essen gab es während der Warterei. Dann kamen wir endlich in das Zimmer, und es wurde eine Flasche Rum zerstört. Sapperlot! Überall lagen Scherben, und alle weigerten sich, diese zu entfernen. Und dann der Oberhammer: Auf dem Hotelgelände wurde ich von einem wilden Tier attackiert, sodass ich ärztlich behandelt werden musste. Trotz all dieser Vorkommnisse versuchten wir natürlich, den Urlaub irgendwie zu genießen, und nahmen an den angebotenen Ausflügen des Hotels teil. Bei einer Fahrradtour gab man mir ein manipuliertes Fahrrad. Ich dachte, die haben es auf mich abgesehen, als plötzlich die Kette riss. Und dann der Kracher: Als wir an dem organisierten Schnorchelausflug des Hotels teilnahmen, wurden wir gezwungen, über eine riesige Distanz das Boot wieder zu verlassen. Natürlich war das nicht möglich, sodass ich beim Versuch ausrutschte und mir das Handgelenk brach.«
Nach der Geschichte ist es doch unverständlich, wie das Gericht die Klage abweisen konnte, oder? Schließlich wirkt der Aufenthalt im Hotel nach der Darstellung wie der reinste Spießrutenlauf.
Schauen wir mal, was laut Gericht der wirkliche Sachverhalt war: Der Check-in war ursprünglich um 14.30 Uhr geplant gewesen, verschob sich aber auf 15.00, dafür bot das Hotel als Entschuldigung ein amerikanisches Frühstück an.
Die Rumflasche hat das Ehepaar selbst zerstört. Anstatt die Scherben selbst wegzufegen, musste eine Putzkraft nach Mitternacht noch das Zimmer reinigen.
Das wilde Tier war eine Wespe, welche die Ehefrau stach. Die Kette des Rads riss tatsächlich, jedoch waren die Fahrräder ein Gratis-Angebot des Hotels.
Bei der Rückkehr von dem Schnorchelausflug verweigerte die Ehefrau jegliche Hilfe beim Aussteigen aus dem Boot und überschätzte die lange Distanz, sodass sie ausrutschte.
Jetzt wird klar, warum die Klageabweisung wohl keine lange Zeit beansprucht hat. Bei den »Reisemängeln« handelte es sich lediglich um Unannehmlichkeiten. Der Rest der Geschichte wurde unter einem Begriff abgespeist: »allgemeines Lebensrisiko«, dem fachlichen Ausdruck für »selbst schuld« oder »persönliches Pech«. Ob das Ehepaar also wirklich glaubte, ihnen stünden die ca. 24 000 Euro zu, oder ob sie lediglich ihren teuren Pauschalurlaub etwas im Preis drücken wollten, bleibt ein Geheimnis. Der nächste Urlaub geht dann wohl wieder in den Pfälzer Wald. Wobei dort auch die Gefahren des »allgemeinen Lebensrisikos« lauern, Stolperwurzeln, herunterfallende Kastanien und wilde Bienen ... Nur, dann ist kein Reiseveranstalter dafür verantwortlich zu machen!
Landgericht Köln, Urteil vom 08.03.2022, Az. 31 0 334/20
§ AFFENBISS IN KENIA
»Don’t feed the monkeys. If you do, you’ll see.« Wenn wir schon beim allgemeinen Lebensrisiko sind ... Jedes Schild hat seine Geschichte. Und wehe denen, die aus der Geschichte nichts lernen. Das musste ein Mann aus Nordrhein-Westfahlen am eigenen Zeigefinger erfahren. Die Angst, von einem Affen gebissen zu werden, war wohl nicht größer als die Neugierde, zu erfahren, was denn wohl bei der Fütterung passiert. Zugegebenermaßen, das Schild ist für neugierige Personen sehr provokant formuliert.
Der Tourist hatte eine Safarireise in Afrika gebucht. Bereits bei Ankunft gab es eine Informationsveranstaltung zum Umgang mit den freilaufenden Affen. Im Speisesaal war zudem ein Schild mit dem Hinweis angebracht, keine Nahrung aus dem Restaurant zu bringen. Und an dem Pool befand sich das besagte »Don’t feed the monkeys«- Schild. Noch aufdringlicher kann die Message wohl nicht sein - außer, wenn mein Browser fragt, ob ich die Cookies akzeptieren will. Direkt am zweiten Tag der Reise kam der deutsche Urlauber dann auf die glorreiche Idee, aus dem Frühstücksraum noch etwas Proviant mitzunehmen. Und da ist doch klar, auf was man Lust hat, wenn man an jeder Ecke vor den Gefahren der Affen gewarnt wird: ein krummes Ding. Dieses hat der Deutsche nicht nur gedreht, indem er unerlaubt Essen mitnahm, sondern hielt es auch tatsächlich in der Hand - in Form einer Banane -, als er aus dem Speiseraum stolzierte. Die Affen hätten sich bestimmt auch mit einem Apfel zufriedengegeben. Für ihre Leibspeise war ihnen jedoch jedes Mittel recht. Ohne Vorwarnung sprang ein Affe den Mann an. Ob Zeigefinger oder Banane war dem Primaten egal. Zum Leid des Attackierten wurde es der Zeigefinger - zumindest so lange, bis der Mann die Banane fallen ließ.
Und die Folgen der Bananen-Attacke? Ein stark blutender Zeigefinger mit höllischen Schmerzen, fünf Impfungen gegen Tollwut, einen Urlaub im Hotelzimmer und das Wichtigste: Eine Lehre, die der Mann wohl nie vergisst - wer nicht hören (oder lesen) will, muss fühlen.
Aber gefüttert hat der Urlauber den Affen ja eigentlich nicht - immerhin nicht freiwillig. Hätte das Hotel ihn also noch expliziter auf die Gefahren der Bananen-Entführung hinweisen sollen?
Nach Meinung des Amtsgerichts Köln war der Mann durch mehrere Hinweise »ausreichend darüber informiert, dass von den Affen, die sich wild auf dem Hotelgelände aufhielten, Gefahren ausgingen, die in Zusammenhang mit Nahrungsmitteln standen.« Denn auch als Deutscher, der höchstens wilde Straßenhunde und - katzen kennt, muss man damit rechnen, dass ein Affe beim Erspähen einer Banane diese auch ergattern will.
Und die Moral von der Geschicht’? Wilde Affen und Zeigefinger vertragen sich nicht.
Amtsgericht Köln, Urteil vom 18.11.2010, Az. 138 C 379/10
§ URLAUB IM ROTLICHTVIERTEL
Weißer Sandstrand, traumhaftes blaues Meerwasser, eine Safari mit Elefanten und Giraffen, faule Nachmittage am Hotelpool gefolgt von einem ausgiebigen Abendessen im Hotelrestaurant - und der Schlummercocktail vor dem Schlafengehen darf natürlich auch nicht fehlen. Das hatte eine deutsche Urlauberin von einem Kenia-Urlaub erwartet. Was sie bekam: ein Laufhaus von Matrosen, die das Hotel wohl mit einem Bordell verwechselten. Eine Woche lang durfte die Frau die US-Marine-Soldaten beobachten, wie diese sich außerhalb ihres Flugzeugträgers - wahrscheinlich ohne Aufsicht der Offiziere - verhielten. Man kann nur vermuten, wie lang der Einsatz auf hoher See gedauert hatte. So intensiv wie die Matrosen den Landgang feierten, war der letzte menschliche Kontakt außerhalb der Kajüte wohl schon länger her. Bis in die Morgenstunden seien Soldaten mit Prostituierten ein- und ausgegangen. Und dabei war das Vergnügen lautstark zu vernehmen. Bei jedem Toilettengang auf einer zimmerfremden Hoteltoilette habe laut der Urlauberin die Gefahr bestanden, diese mit einer Geschlechtskrankheit wieder zu verlassen. Strandhotel oder Reeperbahn? Einen großen Unterschied gab es in dieser Woche wohl nicht. Nur das Rotlicht fehlte.
Zu dem ganzen Schlamassel kamen obendrauf noch die Bauarbeiten des Hotels - am Swimmingpool konnte man nämlich liegen, aber nicht schwimmen. Das ist so, als würde man teure Kinotickets kaufen, nur um dann zwei Stunden in den bequemen Stühlen zu sitzen, weil die Leinwand defekt ist. Unter diesen Umständen gab es für die Reisenden wohl mehr Frust als Entspannung.
Aber wie ist das rechtlich? Des einen Freud, des anderen Leid? Die US-Soldaten hatten augenscheinlich einen tollen Urlaub. Musste das Hotel den Spaß unterbinden, um allen Urlaubern einen ruhigen Aufenthalt zu gewähren?
Ja! Sagte jedenfalls das Oberlandesgericht Frankfurt. Die Reise sollte vor allem der Erholung dienen. So wurde das Hotel auch beworben. Nicht nur durch die Bauarbeiten, sondern auch durch die betrunkenen amerikanischen Soldaten sei der Erholungswert des Urlaubs nicht existent gewesen. Von den damals etwa 5000 Mark Reisekosten für zwei Personen erkannte das Gericht eine Minderung in Höhe von etwa 3000 Mark an.
Einen schönen Urlaub hatte die Frau mit ihrer Begleitung zwar nicht, dafür aber einen kostengünstigen. Ob ihr das die damaligen 2000 Mark wert waren, steht auf einem anderen Blatt.
Zum Mitreisen: Oberlandesgericht Frankfurt,
Urteil vom 29.02. 1988, Az. 16 U 187/87
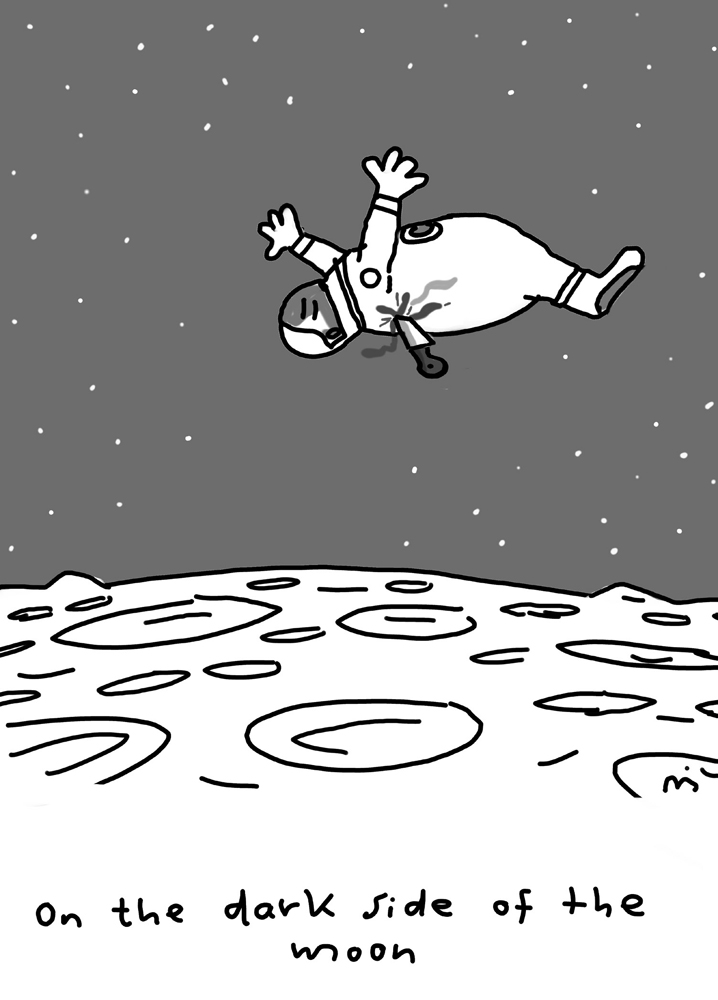
WELCHES RECHT GILT DENN HIER?
»Solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst, gelten meine Regeln!« Wer kennt den Spruch nicht? Oftmals ist es glasklar, woran man sich zu halten hat. Aber was ist, wenn der Tisch sich in einer Rakete zum Mars befindet?
Spätestens 8000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, als die Menschen sesshaft wurden, gab es bereits klare Regeln und Grenzen. Wo es Regeln gibt, gibt es auch Konflikte. Und das nicht immer ohne Grund. Denn wer bestimmt überhaupt, dass ein Grundstück genau an diesem Baum aufhört oder dass die Arktis zu ... Warte, zu welchem Land gehört eigentlich die Arktis?
Der Fortschritt der Menschheit schreitet schnell voran. Größer, weiter, höher. 6300 vor Christus soll es das erste Schiff gegeben haben. 1903 flog das erste motorisierte Flugzeug ganze zwölf Sekunden in der Luft - ein Hopser für das Fluggerät, aber ein Riesenschwung für die Menschheit! 1961 war der erste Mensch im Weltall und 2040 soll die erste bemannte Mars-Mission stattfinden. Globalisierung und Technik bringen also nicht nur TikTok-Tänze, sondern immer mehr historische Ereignisse mit sich. Wie soll denn da das Recht hinterherkommen?
In Deutschland gibt es fast 2000 Bundesgesetze mit 50 000 Paragrafen. Nach welchem Landesrecht werde ich verurteilt, wenn ich über die Grenze zweier Länder jemanden erschieße? Und welches Recht gilt auf hoher See? Was passiert, wenn ich in zehn Kilometern Höhe im Flugzeug eine Straftat begehe? Und was ist, wenn ein Astronaut auf dem Mond den perfekten Mord begeht? Dazu das richtige Gesetz zu finden - falls es überhaupt eines gibt - ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich habe das Ganze für euch übernommen. Von relevanten Fragen, die jeden betreffen, bis zu verrückten Streitigkeiten und exotischen Gedankenexperimenten.
§ ONLINESPIELE: WER VIRTUELLES LAND VERMIETET, MUSS STEUER ZAHLEN
Glück im Spiel, Pech im Leben?
Morgens um sechs Uhr klingelt der Wecker. Nach dem zehnten Mal Snoozedrücken rafft ihr euch aus dem Bett. Hilft ja alles nichts. Zähneputzend hockt man auf dem Klo, während die Kaffeemaschine langsam anläuft. Dann schnell die warme Koffeinbrühe auf ex, während man sich das Croissant mal wieder ohne Marmelade reinbuttert. Die Bauarbeiten auf der Autobahn dauern noch weitere zwei Monate an, sodass ihr schon morgens im Stau steht. Dann 9 to 5, und im Dunkeln geht es wieder zurück, nur um diesmal im Feierabendverkehr im Stau zu stehen. Aber einen Lichtblick habt ihr jeden Tag: Die Ausflucht in die virtuelle Welt. Je näher ihr eurem Haus kommt, umso größer wird euer Grinsen im Gesicht. Mittlerweile freudestrahlend überlegt ihr euch - während ihr den Schlüssel im Schloss umdreht - was ihr heute machen sollt. Vielleicht das Haus in Minecraft fertigstellen? Eventuell mit den Freunden die Rangliste von eurem »Lieblingsmoba« League of Legends erklimmen? Vielleicht auch einfach gemütlich auf die Couch und ein paar Candy-Crush-Level bestreiten oder mit dem Lebenspartner das Koop-Spiel It Takes Two beenden? Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Ihr schnappt euch noch schnell die Briefe aus dem Briefkasten und öffnet sie, während der PC hochfährt. Dann wie ein Schlag ins Gesicht: Das Finanzamt will nicht nur an euer reales Geld, sondern auch an euer virtuell Verdientes ran.
Ihr denkt, das ist ein Witz? *Buzzer-Geräusch* Falsch! Umsätze, die bei der Vermietung von virtuellem Land erzielt werden, sind umsatzsteuerpflichtig. Das entschied der Bundesfinanzhof in einem Urteil. Der betroffene Gamer zockte das Spiel Second Life, welches, wie der Name schon verrät, eine 3-D-Weltsimulation ist. Darin kann man mit seinem eigenen Avatar die Welt gestalten und mit anderen agieren. Wie das echte Leben, nur virtuell eben. Warum sollte ich das ingame machen, wenn ich das Gleiche auch in echt erleben kann, fragt ihr euch? Genau kann ich es auch nicht sagen, aber es hat wohl seinen Grund, dass Mark Zuckerberg in sein Kronjuwel Metaverse bereits zweistellige Milliardenbeträge gepumpt hat, denn das folgt in etwa dem gleichen Prinzip wie das Videospiel Second Life. Die virtuell verdiente Währung, die der Gamer als Mieteinnahmen von den Grundstücken einnahm, tauschte er dann - als kleine Aufbesserung des Taschengelds - in der spieleigenen Tauschbörse gegen Echtgeld ein. Und da lag das rechtliche Problem. Zwar standen die Server in den USA, die virtuellen Mieter kamen jedoch mehrheitlich aus Deutschland, sodass dort der Leistungsort war. Wie ein echter Vermieter war der Mann als Gewerbetreibender beziehungsweise Selbstständiger anzusehen, der einen »Leistungsaustausch gegen Entgelt« erbracht hatte - und darauf ganz normal Steuern zahlen musste.
Der Tag war für den Mann bestimmt ruiniert. Jetzt hatte es das echte Leben doch in die virtuelle Welt geschafft. Wer hätte aber auch ahnen können, dass Angela Merkel ihren Spruch »Das Internet ist Neuland« wortwörtlich meint? Was kommt als Nächstes? Punkte in Flensburg für Rotlichtverstöße in Grand Theft Auto ? Haustiersteuer für meine Pokémon? Grundsteuer für mein Hotel in Monopoly à la: »Gehen Sie ins Finanzamt. Gehe nicht über Los und zahle 1000 Euro pro Grundstück!«
Na, wenn der Staat mir so kommt, dann will ich für meine Kinder in Sims auch Kindergeld und für meinen Einkauf im Supermarkt zahle ich nicht mehr als fünf Gold- und zehn Silbertaler, Inflation hin oder her!
Wenn man Zuckerbergs Zukunftsvisionen teilt, wird dies bestimmt nicht das letzte Urteil der Art bleiben. Bis dahin merkt euch also: Überall, wo echtes Geld im Spiel ist, ist auch der Staat im Spiel. Steuerberater müssen aber ihre Zielgruppenwerbung anpassen: »So verfasst du die Steuererklärung für dein Haus in Minecraft!« Das wird die Werbeabteilung bei YouTube bestimmt freuen - oder auch nicht. Die neuen Anfragen müssen schließlich auch bearbeitet werden.
Finanzgericht Köln, Urt. v. 13.08.2019, Az. 8 K 1565/18
§ BAYXIT STATT BREXIT? KANN SICH DER FREISTAAT BAYERN FREI VON DER BRD MACHEN?
»Ich verlasse dich!« Ein Satz, den wahrscheinlich einige von uns schon mal zu hören bekommen oder selbst ausgesprochen haben. Will ein Partner den anderen verlassen, ist das sein gutes Recht, und er/sie kann nicht daran gehindert werden. So ist es zumindest bei Menschen. Was, wenn aber ein Bundesland auf Deutschland zukommt und diesen Satz sagt? Wobei in diesem Fall der Satz eher nach »I mog di nit mehr, i verloass di« klingen würde. Können sich tatsächlich einzelne Bundesländer einfach von Deutschland abspalten wie England von der Europäischen Union?
Wer hätte es gedacht, aber das Bundesverfassungsgericht musste sich bereits mit dieser Konstellation beschäftigen. Es ging, wie sollte es anders sein, um den Freistaat Bayern. Dabei wurde nicht der Austritt selbst beantragt, sondern lediglich, dass eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit im Bundesland durchgeführt werden dürfte. Die Bayernpartei warb 2016 mit der Initiative »Freiheit für Bayern« für einen Austritt aus der Bundesrepublik.
Das Bundesverfassungsgericht verkündete kurz und knapp in einem Beschluss, dass das schlichtweg nicht möglich sei. Dabei wurde auf das Grundgesetz verwiesen. Dieses biete nämlich keinen rechtlichen Anhaltspunkt für Separatismus. Einen Bayxit ganz nach dem Vorbild des Brexits kann es nicht geben (das gilt selbstverständlich für alle Bundesländer, aber das Saarland hätte uns sowieso keiner abgenommen). Das hängt auch stark damit zusammen, dass die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union unterschiedlich konstruiert sind. In der Präambel (der Einleitung) unseres Grundgesetzes sind alle Bundesländer namentlich aufgezählt. Ein Austritt durch eine einseitige Erklärung (frei nach dem Motto: »Schleich di!«) ist nicht vorgesehen und kann daher auch nicht erfolgen. Alle Bundesländer sind dem Zentralstaat Deutschland untergeordnet und verfügen nicht mehr über ihre eigene Souveränität. Sofern also unser Grundgesetz nicht gewaltsam außer Kraft gesetzt wird, wird es keine Abspaltungen geben. Also hier geblieben, liebe Bayern! Und sorry, liebe Bayernpartei!
Wir aber sind froh, dass alles so bleibt, wie es ist. Wäre doch schade (und auch sehr kompliziert), wenn deutsche Staatsbürger bald ein Visum für die Wiesn bräuchten.
Ein Gutes hätte eine Abspaltung des Freistaats aber: Der Meisterkampf in der Bundesliga wäre endlich wieder spannend ...
Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 16.12.2016, Az. 2 BvR 349/16
§ DESIGNATED SURVIVOR: DER LETZTE ÜBERLEBENDE
Ausnahmestimmung: Auf jedem Fernsehsender der Welt läuft dieselbe Nachricht. Jedes soziale Netzwerk zeigt nur eine Meldung. Die NASA hat den ersten bestätigten Fall von Aliens bekannt gegeben, und das Raumschiff ist nur noch wenige Stunden von der Erdatmosphäre entfernt. Sämtliche Regierungen rufen eine Notsitzung aus. Jeder Abgeordnete wird aus dem Bett geklingelt. Bis auf einen ... den »Designated Survivor«. Dieser befindet sich schon lange in einem Sicherheitsbunker, dessen Standort nur dem Präsidenten bekannt ist. Schließlich darf das Land, sollte die ganze Regierung von Aliens eliminiert werden, nicht ins Chaos der Anarchie stürzen.
»Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Falsch, sie ist frei erfunden.« Wer auch immer gespannt bei X-Factor: Das Unfassbare mit Jonathan Frakes mitgefiebert hat, kennt diese Worte. Dennoch ist diese Geschichte näher an der Realität, als mancher glauben mag. Die außerirdischen Raumschiffe lassen bislang noch auf sich warten, die Nachfolge des Präsidenten der Vereinigten Staaten sieht aber tatsächlich einen Notfallüberlebenden im Bunker vor. Zwar sind die grünen Marsmännchen nicht der angegebene Grund, Terroranschläge oder große Katastrophen muss man jedoch auch auf dem Schirm haben. Seit 1971 gibt es immer einen Abgeordneten, der bei der Rede zur Lage der Nation nicht den Worten des Präsidenten lauscht, sondern sich weitab von Washington versteckt. Der Vorteil? Fürs Nichtstun Geld bekommen. Der Nachteil? In einem Bunker gibt es wahrscheinlich keinen Fernsehanschluss. Aber wer würde nicht die eine oder andere Stunde mit Daumendrehen verbringen, um sich »Designated Survivor« nennen zu dürfen?
Gibt es in Deutschland auch Vorbereitungen für so einen Ernstfall? Was passiert, wenn die gesamte Regierung stirbt?
Und nun sagt mir bitte nicht, wir haben die Sache nicht bedacht. Ein Land, das selbst die Raumtemperatur von Büroklos gesetzlich geregelt hat. Der selbst ernannte Bürokratieweltmeister hat doch bestimmt die Regierungsnachfolge im Notfall geregelt, oder? Darüber könnte ein Blick in das Grundgesetz Aufschluss geben. Im Kapitel zur Bundesregierung steht, dass der Vizekanzler, also momentan Robert Habeck, vertretungsberechtigt ist. Falls die Aliens aber nur am Austausch von Rohstoffen interessiert sind, muss der Wirtschaftsminister bei der Krisensitzung anwesend sein. Wenn der Vizekanzler also nicht unser demokratischer Nachfolger ist, wer ist es dann? Der Vertreter vom Vertreter ist gesetzlich der Dienstälteste. Das trifft sich doch gut - vielleicht trägt dieser beim Schlafen sein Hörgerät nicht und hat die lauten Anrufe seiner Kollegen überhört. Ist er also unser Notfallüberlebender?
Nicht wirklich. In Deutschland ist nicht mal ganz klar, wer überhaupt das höchste Amt hat. Zwar ist offiziell der Bundespräsident das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik, dieser hat aber mittlerweile eine - wie sagen wir es freundlich - untergeordnete Rolle.
Wir sind nicht wie zum Beispiel die USA auf eine Person angewiesen. Zwar kann der Bundestag gemäß Art. 115a GG den Verteidigungsfall ausrufen, sodass wir handlungsfähig bleiben. Einen Designated Survivor haben wir aber nicht. Es gibt zahlreiche Beispiele von gemeinsamen Sitzungen, bei denen alle wichtigen Personen anwesend waren. Angst vor feindseligen Aliens hat Olaf Scholz demnach nicht.
§ ÜBER DIE GRENZE ZWEIER LÄNDER JEMANDEN ERSCHIESSEN - DER PERFEKTE MORD?
Mal eine kleine Black Story zum Mitraten: Was würde passieren, wenn jemand in Deutschland einen Schuss abfeuert, der die Grenze zu den Niederlanden überquert und dort nicht nur jemanden trifft, sondern sogar tötet? Das wäre der perfekte Mord, oder? Die Polizei würde sich bis in alle Ewigkeit um die Zuständigkeit streiten, nach dem Motto: »Klärt ihr das doch auf!« - und der Schütze wäre fein aus der Sache raus, richtig? Zugegeben: Das ist kein einfacher Fall. Wird der Schütze nach dem deutschen Strafrecht belangt? Oder doch nach dem niederländischen? Oder nach beiden? Vielleicht sogar nach keinem? Kleiner Spoiler vorab: Straffrei bleibt der Täter in solch einer Fallkonstellation nicht!
In Deutschland gilt nach § 3 StGB, dass Täter für Taten bestraft werden, die im Inland begangen werden. Hier feuert der Bösewicht den Schuss aus Deutschland ab, der »Erfolg«, wie man im Strafrecht sagt, realisiert sich aber erst in den Niederlanden. Nichtsdestotrotz fand die entscheidende Handlung innerhalb unserer Landesgrenze statt, also findet hier das deutsche Strafrecht Anwendung.
Das eine Strafrecht soll das andere aber grundsätzlich nicht ausschließen. Eine Strafbarkeit nach niederländischem Recht käme ebenfalls in Betracht. Also sitzt der Täter erst in Deutschland eine Strafe ab und wird dann zu den Nachbarn verfrachtet, wo er noch mal hinter Gitter muss?
Nein! Denn nach der europäischen Grundrechtecharta darf eine Tat nicht von zwei Ländern der Union verurteilt werden. Eine Doppelbestrafung fiele also flach.
Jetzt wird es besonders knifflig: Was, wenn der Täter kein EU-Bürger ist? Könnte er dann zusätzlich noch von seinem Heimatland bestraft werden? Das ist schwer zu sagen, hier kommt es immer auf die Gesetzeslage des jeweiligen Landes an.
Wenn aber ein Deutscher im Nicht-EU-Ausland eine Straftat begeht, kann er auch hier belangt werden, solange die Tat am Tatort auch unter Strafe steht. Der Grundsatz der Doppelbestrafung gilt nämlich nicht weltweit - also gibt es keine Regelung, die besagt, dass eine Verurteilung in Deutschland für einen Deutschen nicht mehr erfolgen darf, nachdem dieser beispielsweise in Südamerika schon für die Tat verurteilt wurde. Jedoch würde die andere Bestrafung hier berücksichtigt werden.
Also die Auflösung für die Ausgangsfrage: Nein, natürlich bleibt der Täter in einem solchen Fall nicht straffrei - also handelt es sich nicht um den perfekten Mord. Wenn überhaupt, dann bringt diese Art der Strafbegehung im schlimmsten Fall eine doppelte Strafe in zwei Ländern mit sich.
Schön zu sehen, dass unser Rechtssystem auch solch knifflige Fälle abdeckt! Werden wir in diesem Kapitel noch den perfekten Mord finden?
§ BELEIDIGUNG IN LUFTIGEN HÖHEN - WELCHES RECHT GILT IN EINEM FLUGZEUG?
Wer kennt es nicht: Ihr seid zwei Stunden vor dem Boarding am Flughafen, checkt die Koffer ein, nur um anschließend zu erfahren, dass der Flieger eine Stunde Verspätung hat. Nachdem ihr dann endlich im Flugzeug sitzt, habt ihr zu allem Überdruss neben dem heulenden Baby hinter euch noch diesen nervigen Sitznachbarn, der natürlich nicht von der Erfindung des Kopfhörers gehört hat. Wenn dieser dann beim Versuch, die Schuhe auszuziehen, seinen frischen heißen Kaffee mit dem Ellbogen auf eure Beine umstößt, ist es menschlich nachvollziehbar, wenigstens kurz daran zu denken, wie hoch die Strafe für eine saftige Beleidigung wäre und ob ihr diese angesichts des angestauten Frusts in Kauf nehmen solltet. Während ihr grübelt, welches Schimpfwort der Situation angemessen wäre, schaut ihr aus dem Fenster und bemerkt, dass ihr schon weit über die Landesgrenzen von Deutschland hinweg seid. Nun fragt ihr euch, ob die Genugtuung, dem Sitznachbar einen Kraftausdruck an den Kopf zu werfen, es auch nach dem Strafgesetzbuch der USA wert wäre. Doch halt - welches Recht gilt hier überhaupt?
Wenn ihr deutscher Staatsbürger in einem deutschen Flugzeug seid, ist es einfach. Es findet § 4 StGB Anwendung. Danach gilt das deutsche Strafrecht unabhängig vom Recht des Tatorts in Flugzeugen (auf juristisch: »Luftfahrzeugen«), die berechtigt sind, die Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland zu führen. Dabei ist auch egal, ob ihr gerade über ein fremdes Land oder internationale Gewässer fliegt.
Komplizierter wird es natürlich, wenn ihr euch gerade in einem ausländischen Flugzeug befindet. Sofern die Maschine sich noch in Deutschland befindet, zählt eine an Bord ausgeübte Straftat nach § 3 StGB trotzdem noch als Inlandstat und damit gilt das deutsche Strafrecht.
Dagegen gilt deutsches Strafrecht bei Auslandstaten nur in den ganz besonderen Fällen der §§ 5 bis 7 StGB, sofern euer Flieger nicht unter deutscher Staatsangehörigkeit fliegt: zum Beispiel bei Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder dem Kapern des Flugzeugs. Eine einfache Körperverletzung oder Beleidigung ist nicht schwerwiegend genug.
Ansonsten hat das Chicagoer Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt von 1944 die Lufthoheit eines jeden Staates anerkannt. Das bedeutet, kein Flugzeug ist ein »fliegendes Territorium« und es gilt die Gerichtsbarkeit des jeweiligen Landes. Kurz gesagt: Ein spanischer Flieger über den Schweizer Alpen hat eine spanische Hausordnung, aber eine schweizerische Strafrechtsordnung. Dabei agiert der Pilot als Polizei-Ersatz und kann neben Durchsuchungen sogar Zwangsmittel einsetzen.
Wenn man also nicht gerade ein Luftrechtsexperte ist und zusätzlich noch perfekt beim Erdkundeunterricht in der Schule aufgepasst hat, sollte man zur Beruhigung seines Gemüts vielleicht doch lieber tief durchatmen und »Ohmmmmm ...« summen - obwohl man dann natürlich Gefahr läuft, vom Esoterik-feindlichen Sitznachbarn einen Boxer in die Rippen zu bekommen.
§ MORD AUF HOHER SEE, UM ZU ÜBERLEBEN - IST DAS STRAFBAR?
Es ist endlich so weit, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt wird 2030 getauft. Cinatit heißt das deutsche Flaggschiff mit modernster Technologie. Über 50 Meter große Wellen sollen kein Problem darstellen. Zur Einweihungsfahrt wird keine geringere Strecke befahren als das von Kaventsmännern oder Monsterwellen überzogene Gebiet des Nordatlantiks. Das Auslaufen der Cinatit wird von Tausenden in Bremerhaven bejubelt und noch mal von Tausenden, die sich auf dem Schiff selbst befinden. Auch wenn eine Kajüte an Bord den Monatslohn der meisten weitaus übersteigt, wollte sich keiner die historische Fahrt nehmen lassen. Auf dem Weg in die USA wird das nordatlantische Gebiet direkt angesteuert. Tiefdruckgebiete, die in Richtung Osten ziehen, bewirken eine lange Anlaufzeit für die Wellen im riesigen Ozean. Doch das Schiff trotzt den Gezeiten. Der Sturm wird immer dichter. Die Cinatit fährt Steuerbord gerade in den schwarzen Orkan. Entgegen aller Ratschläge ist das Letzte, was im Logbuch steht: »Ein Schiff im Hafen ist sicher, doch dafür wurde es nicht gebaut, Kurs halten!« Mehrere Tausend Todesnachrichten begleiten über Wochen jede Tageszeitung. »Keine Überlebenden« heißt es nach einem halben Jahr. Nach einem weiteren dann das Unglaubliche: Ein Deutscher kommt mit einem Rettungsboot in Bermuda an. Schnell wird er versorgt und nach Deutschland gebracht. Dort wird er von den Ermittlungsbehörden nach allen Details befragt. Nach dem Gespräch liest man nur: »Angeklagt wegen Mordes und Störung der Totenruhe: So überlebte der schiffbrüchige Kannibale von Bermuda.«
Zwar nicht so romantisch wie die Titanic, aber mindestens genauso realistisch ist die fiktive Geschichte rund um den Namensvetter Cinatit. Denn im 18. Jahrhundert soll eine »Sitte der See« sogar vorgesehen haben, welche Regeln die Seeleute im Ernstfall befolgen sollten. Ein Tabuthema, das sich durch alle Zeitepochen zieht: Der Überlebenskannibalismus. Doch wie ist es, wenn ein Schiffbrüchiger seine Schicksalsgenossen mit oder ohne deren Einwilligung verspeist? Ist das strafbar, und wenn ja, nach welchem Recht überhaupt?
Ein internationales Seerechtsübereinkommen regelt seit 1994 als eine Art »Verfassung der Meere« verbindlich, was zuvor über mehrere Jahre bei der UN-Seerechtskonferenz 1982 festgelegt wurde: Dabei wurde das Meer in verschiedene Zonen aufgeteilt. Wie bei einem Kuchen erhält jeder seinen Teil. Da die begehrte Kirsche auf der Mitte der Torte jeden anlächelt, soll diese jedem und keinem zugleich gehören. Damit ist natürlich die »hohe See« gemeint. Nach der »Zwölf-Seemeilen-Zone«, also dem Küstenmeer, folgt die »Wirtschaftszone«. Erst danach folgt das »Niemandsland« oder besser gesagt das »rechtliche Niemandswasser«. Dieses fängt also erst zwischen 200 bis 350 Seemeilen an. Davor gehört sämtliches Land und Wasser dem jeweiligen angrenzenden Land. Ab dem Zeitpunkt, als die Cinatit aus der deutschen Wirtschaftszone raustuckert, befindet sie sich also auf hoher See. Doch was gilt da? Wie in Flugzeugen ist in diesen hoheitsfreien Gebieten das Flaggenprinzip entscheidend. Danach gelten Schiffe als der Flagge ihres Heimathafens angehörig. Das Rettungsboot der Überlebenden ist Zubehör des Kreuzfahrtschiffs und somit auch deutschem Recht unterlegen. Man kann sich Schiffe auf hoher See als »treibendes Staatsgebiet« des jeweiligen Landes vorstellen. Es gilt damit also deutsches Recht. Deutsche Gerichte können wie gewohnt das heimische Strafgesetzbuch anwenden.
Wie ist das aber nun mit der Strafbarkeit unseres Überlebenden? Schließlich wurde bis zum 19. Jahrhundert noch angenommen, dass Kannibalismus eine Art menschlicher Instinkt sei, wenn man unter Extrembedingungen mit dem Leben kämpft. Wenn alle anderen Ressourcen ausgeschöpft waren, dann sollte ein solches Verhalten nach den »Gesetzen der See« entschuldbar sein. Doch diese Rechtsauffassung hat sich mittlerweile geändert: So standen Ende des 19. Jahrhunderts im englischen Exeter drei Seeleute vor Gericht, die nach mehreren Wochen im Rettungsboot ihren Vorrat an Rüben verbraucht hatten. Weil der 17-jährige Schiffsjunge Meerwasser trank und dadurch krank wurde, beschlossen die Seeleute - weil niemand den unverheirateten Jüngling vermissen würde - ihn zu töten. Eine Woche später wurden sie gerettet und waren sich keiner Schuld bewusst. Laut posaunend erzählten sie jedem ihre Überlebensstory, wohl wissend, dass noch nie jemand für solche Taten verurteilt worden war. Doch die damalige Strafbehörde klagte die Männer wegen Mordes an. Todesstrafe hieß der Schuldspruch, doch dazu kam es nie. Der Innenminister wandelte die Strafe in eine sechsmonatige Haft um. Na hoffentlich wurden sie dort mit Nahrung versorgt.
Einen deutschen Richter interessiert aber kein »Gesetz der See«, und unser Innenminister kann auch keine Begnadigungen aussprechen. Wie ist also die heutige deutsche Rechtslage? Natürlich ist das Töten, um jemanden zu essen, strafbar. Der »Kannibale von Rotenburg« hat lebenslänglich für seine schrecklichen Taten bekommen. Wer sich aber in einer absoluten Notsituation auf hoher See befindet und nach wochenlangem Hungern vor der Entscheidung steht: Entweder überlebe ich oder keiner, der kann ausnahmsweise nach dem entschuldigenden Notstand des § 35 StGB ohne Schuld gehandelt haben. Es müssen aber alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden - und das wird fast nie der Fall sein. Falls sich die zu verspeisende Person jedoch freiwillig opfert, könnte sich der Kannibale nur der Tötung auf Verlangen gemäß § 216 StGB strafbar gemacht haben. Dann müsste die Person den Tod aber ernsthaft und ausdrücklich gewollt haben. Und welcher Schiffbrüchige will denn nicht so lange wie möglich überleben? Wie sich also unser fiktiver »Kannibale von Bermuda« strafbar gemacht hat, entscheiden die imaginären Gerichte daran, wie aussichtslos die Lage war.
§ SEINE EIGENE INSEL AUFSCHÜTTEN UND EINEN STAAT GRÜNDEN, ODER: AUF SEINEM MISTHAUFEN IST DER HAHN KÖNIG
Mikronationen wie Sealand, Kugelmugel und Christiania sind auf der ganzen Welt verteilt. Mittlerweile gibt es so viele davon, dass man sie sogar mithilfe eines Reiseführers bereisen kann: The Lonely Planet Guide to Home-Made Nations. Doch Vorsicht! Nicht alle sind so touristenfreundlich wie Christiania, das für seinen progressiven und freien Lebensstil bekannt ist. So wurde Dominion of Melchizedek nur gegründet, um Geldwäsche zu betreiben. Ein dortiger Besuch könnte euch bestimmt schnell auf die Verdächtigenliste der amerikanischen Börsenaufsicht befördern. Viele Fantasiestaaten werden erst gar nicht ernst genommen, manche werden immerhin geduldet, aber eines haben die Zwergstaaten gemeinsam: Keiner von ihnen ist offiziell anerkannt. Doch warum nicht? Gut, man kann sich vielleicht denken, dass das Land, in dem sich das vermeintlich eigene Hoheitsgebiet befindet, etwas dagegen haben könnte. Aber was wäre, wenn ihr auf hoher See eine Insel aufschüttet und einen neuen Staat ausruft? Seid ihr dann automatisch König eurer frischgebackenen neuen Insel?
Was zur hohen See zählt und was nicht, wisst ihr jetzt schon. Da diese keiner in Anspruch nehmen darf, ist die Frage doch klar, denkt ihr euch. Natürlich darf man dort nicht einfach eine neue Insel errichten. Falsch! In Art. 87 des Seerechtsübereinkommens ist das sogar klipp und klar erlaubt. Außerdem heißt es in Art. 89, dass nur kein Staat einen Teil der hohen See seiner Souveränität unterstellen darf. Ich bin aber eine Privatperson! Doch bevor ihr euch jetzt aufmacht und einen Bagger mietet, um in sämtlichen Kindergärten eurer Nähe in einer Nacht- und Nebelaktion die Sandkästen zu leeren, lest noch kurz weiter: Erstens kann man Sand auch ohne weinende Kinderaugen am Morgen besorgen. Und zweitens gehört zu einer Staatsgründung etwas mehr, als nur Sand ins Wasser zu kippen. Drei Elemente braucht es dafür. Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt.
Mindestens eines davon soll dem berühmten Sealand laut einem deutschen Gericht fehlen, weswegen ihr von der Geschichte des britischen Ex-Soldaten Paddy Roy Bates zumindest lernen könnt, wie es nicht geht: Auf einer ehemaligen Militärplattform, knapp außerhalb des damaligen britischen Hoheitsgewässers, wurde 1967 Sealand ausgerufen. Bis heute lebt die Familie Bates auf den Betonpfeilern und musste schon Putschversuche, Brände und Schießereien in den sealandischen Geschichtsbüchern vermerken. Auch wenn die Seefestung von Großbritannien weitestgehend ignoriert wird - wahrscheinlich in der Hoffnung, dass die Sealander doch mal seekrank werden -, wird sie nicht als Staat anerkannt. Das musste auch ein Deutscher - oder nach seinen Vorstellungen ehemaliger Deutscher - vor dem Verwaltungsgericht Köln feststellen. Dieser wollte seine Staatsbürgerschaft wechseln und künftig in der Nordsee auf Sealand leben. Das Gericht urteilte: Die künstliche Plattform sei kein Landgebiet, weil ein Stück Erdboden erforderlich sei, schließlich steht die Plattform nur auf zwei Betonpfeilern. Außerdem fehle es an der »Schicksalsgemeinschaft« des Staatsvolkes, da die sogenannten Sealander sich überwiegend außerhalb aufhalten.
Also halten wir fest: Ihr braucht einen Ort, der so weit von jedem Staat entfernt ist, dass ihn keiner bereits beansprucht hat. Ihr dürft, anders als Robinson Crusoe oder Tom Hanks in Cast Away, nicht allein auf der Insel sein und sie euer nennen, denn ihr braucht auch ein Staatsvolk. Gewisse Regeln muss es auch geben, nach denen dann alle leben. Wenn ihr das Unmögliche geschafft habt, fehlt nur noch eine Sache: die Anerkennung durch andere.
Nun habt ihr ein paar verrückte Abenteuerlustige gefunden und das mit der Verfassung macht ihr einfach wie in der 9. Klasse, von anderen abschreiben - schließlich gibt es kein Urheberrecht auf Gesetze. Die Idee, kleinen Kindern Sand zu klauen, geht euch aber gegen den Strich. Bei eurer Google-Suche nach alternativen Sandquellen seid ihr angesichts der Wucherpreise für etwas Dreck an dem Punkt, an dem jeder schon mal war: Ihr wartet, bis es von selbst passiert. Der 9. Klasse sind schließlich nicht nur die Abschreibkenntnisse zu verdanken, sondern auch die Chemie-Basics.
Vielleicht kommt das Wissen auch aus Minecraft, das ihr beim Schulschwänzen gezockt habt, aber egal: Wasser plus Lava ergibt Stein - also einfach auf den nächsten Vulkanausbruch warten und schnell sein, lautet die Devise. Wenn dann der Ausbruch nicht wie 2021 in La Palma zu nah am Ballermann (nein, das gehört nicht zu Deutschland, sondern zu Spanien) ist, um ein ruhiges Dasein als König zu führen, dann heißt es Schwimmflügel an und losschwimmen. Eurem neuen Staat steht nichts mehr entgegen. Aber auch wenn euer Stück Land alle Staatsvoraussetzungen erfüllt - die Vergangenheit hat gezeigt: Ein Staat ist nichts wert, wenn er von keinem als Staat angesehen wird. Dass Existenzprobleme sogar im kleineren Rahmen schon schwierig sind, verdeutlicht ein Gespräch mit einer Person aus Bielefeld. Also, wenn euch das zu viel Aufwand ist, verbringt eure Zeit lieber sinnvoller: Zum Beispiel könnt ihr euch über den sealandischen Putschversuch informieren oder ihr lest einfach weiter. Denn die nächste verrückte Geschichte ist keine Seite entfernt.
Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 03.05.1978, Az. 9 K 2565/77
§ KAMPF MIT WHISKEY UM INSEL HANS: DER FRIEDLICHSTE KRIEG DER WELT!
Apropos verrückte Geschichte, was ist wohl verrückter als ein friedlicher Krieg?! Dieser Besatzungskrieg fand die letzten Jahrzehnte zwischen Dänemark und Kanada statt. In der Hauptrolle: Dänen, Kanadier, die Insel Hans und Whiskey-Flaschen. Klingt wild? Ist es auch.
Es geht um die unbewohnte Insel Hans. Tatsächlich wurde die Insel, die übrigens keine Vegetation hat, 1933 vom Völkerbund Dänemark zugesprochen. Da der Völkerbund aber später aufgelöst wurde, war diese Zuordnung nicht mehr gültig. 1973 wurde die Insel bei der offiziellen Grenzziehung zwischen Grönland und Kanada ausgelassen. Es bestand daher Uneinigkeit darüber, wem der steinige Felsen nun gehörte.
Und so startete der Whiskey-Krieg. Den Anfang machten 1984 die Dänen, als deren Minister für Grönland die Hans-Insel zu einem Teil Dänemarks erklärte. Und das mit einer Flasche Whiskey und einem Schild mit einer passenden Aufschrift. Das ließ Kanada nicht lang auf sich sitzen und konterte in gleicher Weise. Wirklich lang wehte jedoch keine Fahne dort. Immer, wenn die Dänen ihre hissten, kamen die Kanadier und ersetzten die andere Flagge durch die eigene - und umgekehrt. Ein Hin und Her, das Jahrzehnte lang anhielt.
Ist zwar alles ganz witzig, aber ewig so weitergehen konnte das Ganze nicht - dachten sich zumindest die Länder. Daher starteten Verhandlungen zwischen Vertretern beider Nationen darüber, wie mit der Insel verfahren werden sollte. Dann, Mitte Juni 2022, konnte die Sensation vermeldet werden: Der Whiskey-Krieg war vorbei! Nicht, weil einem Land der Alkohol ausging, sondern weil sich die beiden einigen konnten: Die 1,3 Quadratkilometer große Insel wurde unterteilt, indem eine Landesgrenze gezogen wurde. So zeigte sich: Zumindest halb ernste Whiskeykriege kann man durch diplomatische Verhandlungen und kooperative Lösungen auch im Jahr 2022 wunderbar beenden.
Als den »freundlichsten aller Kriege« bezeichnete die kanadische Außenministerin Mélanie Joly den Konflikt um Hans. Den Streit um die Insel, wenn es denn überhaupt einer war, überlebten ganze 26 kanadische Außenminister und Außenministerinnen. Bei einer feierlichen Zeremonie tauschten die beiden Vertreter der Länder ein letztes Mal ihre feinen Tropfen aus, passend zu den Ereignissen der letzten Jahre.
Eine Frage bleibt aber wohl für immer offen: Was ist mit den ganzen Flaschen passiert, die auf der Insel hinterlassen wurden?
§ PRINZ CHRISTIAN ZU SOLMECKE - DARF ICH MIR EINEN ADELSTITEL KAUFEN?
Im Zug wird mir nach der Ticketkontrolle plötzlich die erste Klasse angeboten, das Hotelzimmer, ohne mein Zutun, auf die Luxussuite hochgestuft. Und sogar der beste Kinoplatz wird für mich freigemacht, nachdem der Saal eigentlich ausgebucht war. Zumindest träumen kann man davon, einen Tag lang wie eine Berühmtheit behandelt zu werden. Aber machen wir uns nichts vor, so viele kennen meine YouTube-Videos nun auch wieder nicht. Zwar ist der Kanal WBS.LEGAL mit fast einer Million Abonnenten der größte Rechtskanal Europas, solch eine Bevorzugung ist dennoch nur Hollywoodstars und vielleicht dem König von England (Das klingt immer noch komisch, nach 70 Jahren Queen Elizabeth) vorbehalten. Apropos König, darf ich eigentlich legal Adelstitel kaufen und mir so einfach meinen eigenen roten Teppich ausrollen?
Seit Ende des Kaiserreichs 1919 sind alle Bürger vor dem Gesetz gleichgestellt. Sämtliche Adelsbezeichnungen waren von nun an nur noch ein Name, der an die Zeit der Blaublütler erinnert. Da kann man noch so viele Drachen töten und Jungfrauen retten, man ist trotzdem nicht adliger als der Schuster von nebenan. Auch wenn man wie Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg heißt - und ja, das ist sein wirklich offizieller Name -, erhält man bei Plagiatsvorwürfen seiner Doktorarbeit kein Sonderrecht.
Na gut, rechtliche Vorzüge bekommt man als Baron nicht mehr, aber manchmal reicht es ja, sich besonders zu fühlen, um besonders behandelt zu werden. Welche Möglichkeiten habe ich denn, dass wenigstens mein Name nach Oberschicht klingt? Die erste Möglichkeit ist natürlich, direkt als Graf geboren zu werden. Der Zug ist jedoch für die meisten Leser abgefahren. Bleibt also noch die Heirat. So kann ich, wie im Märchen, echte Prinzessin werden. Dazu brauche ich aber keinen Frosch, sondern einen echten Prinzen. Und wenn man sieht, welche Prinzen in der Öffentlichkeit so auftreten, dann gehört man lieber weiter dem Proletariat an.
Aber auch Prinz Marcus von Anhalt war nicht seit Geburt adlig. Wie hat es denn der »Protzprinz« geschafft, der erst wegen Steuerhinterziehung einsitzen musste? Nun ja, er tat es seinem Adoptivvater gleich und ließ sich im Erwachsenenalter adoptieren. Ob jetzt die Liebe zu seinem neuen Sohn oder die über eine Million Euro ausschlaggebend waren, wird für immer das Geheimnis von Prinz Frédéric von Anhalt sein. Dass die deutschen Gerichte bei so einer Summe kein gesundes Eltern-Kind-Verhältnis gesehen hätten, wussten auch die von Anhalts. Wahrscheinlicher ist es, dass ein Gericht in Los Angeles, am Wohnort von Frédéric, dafür verantwortlich war und die Adoption in Deutschland anerkannt wurde. Einen genaueren Einblick in ihre neue Familienbeziehung gaben die beiden jedoch nicht.
Wem aber gesunde soziale menschliche Beziehungen zu führen oder nach Los Angeles zu jetten zu anstrengend ist, der fragt sich bestimmt, was es mit den »Billig«-Titeln im Internet auf sich hat. »Baron de Burgund«, »Lord of Kerry« oder »Lady of Glencoe« klingen doch erst mal nicht schlecht, oder? Die angebotenen Adelsgeschlechter haben jedoch keine lebenden Nachkommen mehr. Meist sind es eingetragene Marken, die höchstens als Zusatz zum echten Namen verwendet werden dürfen.
Falls ihr jetzt traurig nach Mondgrundstücken sucht, um eure Sehnsucht nach Individualität zu stillen, haltet schnell inne. Eine letzte Möglichkeit gibt es noch, und die macht euch wirklich besonders! Ihr könnt euch einfach einen Künstlernamen in euren Ausweis eintragen lassen. Ein winzig kleines Opfer müsst ihr natürlich bringen: Ihr müsst auch unter diesem auftreten. Also ölt die Stimmbänder, stimmt eure Gitarren oder kauft euch einen Wasserfarbkasten. Eurem Prinzendasein steht nichts mehr im Wege. Wobei die Fußstapfen des Musikers Prince wahrscheinlich zu groß sind, aber nicht schlimm, es gibt noch zahlreiche andere Titel.
§ DAS ERSTE WELTRAUMBABY - NATIONALITÄT: ALIEN?
Was steht im Pass eines Kindes, das im Weltall geboren wurde? Vielleicht »Alien«? Alien bedeutet schließlich außerirdisches Leben. Außerirdisches Leben ist eine Bezeichnung für alle Lebensformen, die nicht auf der Erde entstanden sind. Ist also vielleicht ein verheimlichtes NASA-Weltraumbaby gemeint, wenn es heißt: Die Aliens weilen unter uns? Doch kann es überhaupt eine Geburt im Makrokosmos geben?
Schließt man Science-Fiction wie Generationenschiffe oder von Robotern aufgezogene Tiefkühl-Embryonen aus, gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie die Frage überhaupt relevant werden könnte. Den Storch, der sich etwas in der Höhe vertut, lassen wir auch mal außen vor.
Erstens: Der Blick aus der Raumkapsel sorgt für romantische Gefühle. Vielleicht schafft man es dann sogar, in der Schwerelosigkeit das Kamasutra selbst zu testen, anstatt sich nur vorzustellen, wie denn das Bein hinters Ohr kommen soll. Nicht mal so unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass es einen »Mile High Club« für alle gibt, denen das Flugzeugklo geräumig genug war. Gerüchten zufolge soll es sogar schon Sex im kosmischen Raum gegeben haben. Das Problem: Raumfahrtmissionen dauern normalerweise maximal sechs Monate. Da fehlen noch drei für unser Weltraumbaby.
Damit bleibt nur noch Möglichkeit zwei: Eine Astronautin ist bereits schwanger, während sie in die Rakete steigt. Doch auch das erscheint maximal unwahrscheinlich - schließlich werden alle Astronauten etlichen medizinischen Tests unterzogen. Ganz ungefährlich wird der Flug ins All auch nicht sein. Immerhin wird das über Dreifache des Gewichts mit aller Macht in die Sitze gedrückt, nachdem der Countdown »3, 2, 1 and Lift-Off« das Letzte ist, was die Astronauten noch mit genügend Blut im Kopf hören können. Allein der Gedanke einer Schwangeren im Cockpit löst ein unbeschreibliches Gefühl von Unbehagen aus. Und dann ist noch nicht geklärt, wie sich ein Fötus im Bauch ohne Gravitation entwickelt.
Nummer zwei scheidet also auch eher aus. Warum sollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das sowieso nie eintritt? »Nicht so schnell, hold my Spacebaby, dachte sich die niederländische Biotech-Firma SpaceLifeOrigin. Diese hat nur eine Mission: das Überleben der Menschheit zu sichern, und zwar um jeden Preis. Das Unternehmen will nicht nur Samen und Eizellen auf Satelliten ins All schicken, sie wollen auch 2024 die erste Geburt eines Babys im Weltraum durchführen. Durch immer weiter drängende Gefahren wie die kontinuierliche Erderwärmung, Riesenasteroiden oder künstliche Intelligenz seien unsere letzten Tage auf der Erde gezählt. Doch aus reiner Liebe zur Menschheit läuft das Ganze nun doch nicht: Schließlich kosten die Spermiensatelliten bestimmt nicht wenig. Bis zu 125 000 Dollar soll der Transport ins All für die Privatperson kosten. Eine künstliche Befruchtung im Space Embryo Incubator sogar bis zu 5 Millionen. Und sollte es dann in Zukunft wirklich zu der Geburt kommen, stehen die Preise noch aus. Ein kleiner Tipp meinerseits: Eine Geburt im Krankenhaus wird weniger kosten.
Also kommen wir nicht darum herum, uns anzuschauen, welche Nationalität ein Neugeborenes im All hätte: In den vielen Weltraumverträgen findet sich dazu keine besondere Regelung. Aber wir haben doch gelernt, dass zum Beispiel auf der ISS das Recht des jeweiligen Moduls der Raumkapsel zählt - vielleicht hilft das weiter? Falls also doch eine Raumfahrtmission mal länger als sechs Monate dauert und es zu Beginn ein Techtelmechtel zwischen zwei lüsternen Raumfahrern gab, erfolgt die Geburt im amerikanischen Modul dann auf amerikanischem Staatsgebiet? Ganz so einfach ist es leider nicht, denn das Raumschiff zählt nicht als Gebietserweiterung für das jeweilige Land. Das würde nämlich den Mondvertrag vollständig hinfällig machen, der besagt, dass keiner ein Aneignungsrecht an Himmelskörpern hat. Dennoch wäre das Kind laut Vereinten Nationen dann Amerikaner. Aber jedes Land hat seine eigenen Regeln, und die gehen denen der UN vor.
Doch nach welchen Regeln wird das entschieden? Dazu müssen wir auf die herkömmlichen Methoden zurückgreifen: Rechtlich unterscheiden wir zwischen dem »Geburtsortprinzip« und dem »Abstammungsprinzip«. Nach dem Geburtsortsprinzip erhält jedes Kind automatisch die Staatsangehörigkeit des Landes, auf dessen Staatsgebiet es geboren wird. In den meisten Ländern gilt primär Zweiteres, auch »Blutsrecht« genannt. Danach hat ein Kind die Nationalität der Eltern.
Wenn also eine Deutsche im Weltall ein Kind gebärt, kann Deutschland mit dem ersten Alienbaby angeben. Sobald die Eltern jedoch unterschiedliche Nationalitäten haben, kommt es ganz darauf an, ob die beiden Länder eine doppelte Staatsangehörigkeit erlauben. Auch wenn das erst mal nicht kompliziert klingt, wären die deutschen Behörden ziemlich überfordert. Denn der Geburtsort muss trotzdem eingetragen werden. Bei Flugzeuggeburten über dem Meer trägt man bislang einfach Längen- und Breitengrade ein. Aber was wäre im Weltall? Geboren im Alpha-Quadrant?
Für Fälle, in denen beide Eltern eines Kindes aus einem Land mit dem Geburtsortprinzip kommen, wäre es tatsächlich staatenlos. Aber das reine Geburtsortprinzip gibt es meinen Recherchen nach überhaupt nicht, sondern nur Kombinationen mit dem zweiten Modell - so wie etwa in den USA. Hier reicht es in der Regel, wenn ein Elternteil Amerikaner ist und ein paar weitere Voraussetzungen vorliegen. Daher ist ein staatenloses Baby eigentlich kaum denkbar.
Wenn man die Zukunftsvisionen von SpaceLifeOrigin teilt, wird es aber irgendwann sowieso keine Nationalitäten mehr geben. Dann existieren entweder Marsianer oder Terraner. Wer also gerade in der Kinderplanung ist und ein theoretisches Alien aufziehen will, der hat noch bis 2024 Zeit, sich das Ganze durch den Kopf gehen zu lassen. Eine Einschränkung sieht das Unternehmen jedoch vor: Ihr müsst bereits zwei Geburten ohne Komplikationen hinter euch haben.
§ WIE MACHT MAN DEN MANN IM MOND ZUM NACHBARN?
Die Mietpreise steigen immer weiter. Die Nebenkostenabrechnung am Ende des Jahres hat wieder mehr Schreckpotenzial als das Fernsehprogramm am 31. Oktober. Wie wäre es mit einem Grundstück für einen Schnäppchenpreis von 20 Euro? Und das Beste: kein lästiger Besuch beim Grundbuchamt, kein teurer Notar. Einfach ein Klick im Internet, und in 24 Stunden ist die Urkunde in euren Händen. Ein 90-tägiges Rückgaberecht habt ihr dazu auch noch! Klingt zu gut? Na ja, ein kleines Detail habe ich verschwiegen, das Grundstück befindet sich auf dem Mond. Und verfügbare Strom-, Internet- und Wasseranbieter müsst ihr auch noch suchen. Aber wenn die Infrastruktur etwas besser aussieht, dann lohnt es sich doch trotzdem, jetzt zuzuschlagen und sich einen Platz auf dem Erdtrabanten zu sichern, oder? Was ist dran an den berühmten Mondgrundstücken?
Ein Name taucht dabei immer auf: Dennis Hope. Er gibt an, Eigentümer des Mondes zu sein. Doch wie soll man Inhaber eines großen Gesteinsbrockens ohne Atmosphäre werden, wenn man selbst nicht mal dort war? Na ja, das basiert auf seiner rechtlichen Auslegung des Weltraumvertrages von 1967 und den kalifornischen Grundbuchämtern. In dem Vertrag steht: Der Weltraum, also auch der Mond, unterliegt nicht nationaler Aneignung. »Perfekt!«, dachte sich Hope. »Ich bin ja kein Staat, sondern eine Privatperson.« Diese angebliche Gesetzeslücke nutzte Dennis, um sich einfach als Eigentümer einzutragen. Moment mal! Kann ich mich einfach so als Eigentümer eines nicht besiedelten Grundstücks eintragen lassen? In Amerika ist die Zeit des Wilden Westens wohl noch nicht beendet! Seit 1862 gibt es den »Homestead Act«, der es ermöglicht, ein freies Stück Land für sich zu beanspruchen. Weil niemand innerhalb einer bestimmten Zeit Widerspruch erhoben hat, wurde Hope laut den kalifornischen Behörden zum Space-Cowboy und der Mond zu seiner Ranch.
Seit jeher verkauft er 0,4 Hektar für 20 Dollar. Über mehr als vier Millionen Grundstücke hat er so schon verkauft. Über 80 Millionen für einen kleinen Gang zum Grundbuchamt, durchaus lukrativ.
Aber bin ich dann wirklich Eigentümer, wenn ich die Urkunde kaufe? Juristisch gesehen ist das natürlich Blödsinn, das weiß selbst der Gründer des Unternehmens Lunar Embassy Mission. Wenn keine Staaten sich Himmelskörper aneignen können, dann dürfen das auch keine Privatpersonen, die dem nationalen Recht unterworfen sind. Schließlich gehört der Mond uns allen. Das ist sogar rechtlich im Mondvertrag festgelegt.
Warum sollte ich dann etwas kaufen, was eh schon mir gehört? Zugegebenermaßen ist es schon ein außergewöhnliches Geschenk. Meist enthält das Mondgrundstück ein personalisiertes Zertifikat und ein gratis »Gimmick« wie einen Swarovski-Stern. Ob das eine gute Investition ist, muss jeder selbst entscheiden. Das macht zum Beispiel der deutsche Nachahmer von Dennis Hopes Geschäftsidee aber wahrscheinlich nur, um einer Strafbarkeit wegen Betruges zu entgehen und einen realen Gegenwert anzubieten. So steht auf der Website unter »Rechtliche Hinweise«: »Der Besitz eines Mondgrundstücks ist eine symbolische Geschenkidee ohne derzeit gültigen Besitzanspruch des erworbenen Grundstücks.«
Aber der Amerikaner war mit seinem Schildbürgerstreich nicht allein in der Geschichte: So klappte Martin Jürgens, einem Rentner aus Nordrhein-Westfalen, die Kinnlade runter, als er von den Machenschaften des Mondmade-Millionärs erfuhr. »Er kann doch nicht einfach mein Erbe verhökern«, ärgerte er sich am Küchentisch und verfasste einen Brief nach Übersee, der ganz sicher nicht »Mit freundlichen Grüßen« endete. Der Mann aus Westfalen ist nämlich der Vorfahre eines Wunderheilers des preußischen Königs Friedrich der Große. Dieser vermachte am 15. Juli 1756, in einer Urkunde festgehalten, dem alten Jürgens »als Zeichen höchster Hochachtung und Dankbarkeit« den Himmelskörper. Doch auch der Rentner muss enttäuscht werden. Selbst ein König hat kein Recht, den Mond zu verschenken - auch wenn es damals noch keine Weltraumverträge oder Vereinte Nationen gab.
Wenn ihr also auf der Suche nach einem extravaganten Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk seid und im Internet auf den Erwerb von Mondgrundstücken stoßt, sagt euren Beschenkten, sie können mit der Urkunde nicht die von der NASA geparkte Rakete von dem Grundstück abschleppen lassen. Vielmehr hat die Urkunde nur symbolischen Wert und macht sich höchstens nett an der Wand.
§ »HOUSTON, WIR HABEN EIN PROBLEM!« - WELCHES RECHT GILT BEI MORD IM WELTRAUM?
Ein weißer Handschuh, der von der unendlichen Schwärze aufgefressen wird. Ein Schlag, ein Stoß, ein Schrei. Stille ... Die letzten aufgezeichneten Worte des Rundfunkgeräts waren: »Mayday, Mayday ...«
Überdramatisiert geht es darum, was passiert, wenn ein Astronaut den perfekten Mord begeht oder einfach der erste Mensch sein will, der auf dem Mond eine Schlägerei anzettelt. Kann er dafür belangt werden, oder ist das All nicht nur ein unendlicher, sondern auch ein rechtsfreier Raum? Welche Gesetze gelten im Weltall? Und nein, damit sind nicht die Gesetze der Physik gemeint. Dass diese auch außerhalb der Erde bestehen, ist selbst denen bekannt, die wirklich hinter dem Mond leben.
Über die Frage des anwendbaren Rechts könnte der »Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper« - oder kurz »Weltraumvertrag von 1967« - Aufschluss geben. Keine Angst, der Inhalt ist nicht so kompliziert wie der Titel. Der Vertrag verbietet nur, Gegenstände mit Atomwaffen oder Massenvernichtungswaffen in die Umlaufbahn der Erde zu bringen oder auf Himmelskörpern zu installieren. Wer sich jetzt auch eine Google-Suche ersparen will und sich fragt, ob Star Wars auf dem Weltraumvertrag basiert oder umgekehrt: Star Wars erschien 1977.
Doch wie sieht es mit Verbrechen von Astronauten aus? Fehlanzeige. Die Bestrafung von Raumfahrern findet keinerlei Erwähnung, weder in dem Weltraumvertrag noch in den weiteren Abkommen. Aber kann es wirklich sein, dass Strafrecht auf dem Mond nicht nur im tatsächlichen, sondern auch im sprichwörtlich luftleeren Raum stattfindet? Ohne jetzt bestimmte Tatanreize schaffen zu wollen: Bekanntlich gibt es auf dem Mond keine Luft und Schallwellen, sodass ein Täter keine Angst vor den Hilferufen des Opfers haben müsste. Vielleicht ist es aber schon Abschreckung genug, dass die Fußabdrücke bei der Tatbegehung durch die fehlenden Winde ewig zurückbleiben?
Zumindest auf der ISS-Raumstation gibt es dafür eine Regelung: Es gelten die nationalen Rechtsordnungen, je nachdem, welchem Land das zugehörige Modul der Raumkapsel gehört. Wie in einer Art Patchwork-Staat kann man also mit einem einminütigen Spaziergang das geltende Recht verändern.
Dies musste eine NASA-Astronautin am eigenen Leib erfahren. Sie könnte die vermutlich erste Straftat im Weltraum begangen haben. Dabei soll die US-Raumpilotin verbotenerweise auf das Bankkonto ihrer ehemaligen Freundin zugegriffen haben. Den Internetzugriff stellte die USA, sodass sie wegen Identitätsdiebstahls nach amerikanischem Recht angeklagt wurde.
Bei der theoretischen Frage, was denn nun passiert, wenn sich im europäischen Modul ein russischer und ein amerikanischer Astronaut auf die Nase hauen (was bei der Enge nicht völlig fernliegend ist), können die dann zuständigen Juristen nur hoffen, dass die NASA-Ausbildung viel Wert auf soziales Teambuilding legt. Denn eine eindeutige Antwort gibt es darauf nicht.
Genauso wenig gibt es eine klare Antwort, wie es sich mit Straftaten außerhalb der Raumkapsel verhält. Zwar gibt es einen Mondvertrag, der seit 1979 den Erdtrabanten wie die hohe See als internationalen Gemeinschaftsraum festlegt, an dem kein Staat ein Aneignungsrecht hat und dessen Ziel eine friedliche Nutzung ist. Dieser wurde aber durch kaum einen Staat ratifiziert.
Aber zurück zu dem perfekten Mord: Wenn also ein Verbrechen auf dem Mond geschieht, soll das nach jetziger Rechtsauffassung nach dem Strafgesetz des Heimatlandes des Astronauten behandelt werden. Man nimmt sein Recht quasi im Raumanzug mit. Da man als einer der wenigen, die das Privileg haben, den großen weiten Weltraum mit eigenen Augen sehen zu dürfen, wahrscheinlich andere Sorgen hat, als sich gegenseitig den Kopf einzuschlagen, bleibt dies hoffentlich nur ein theoretisches Problem.
Diese juristische Unsicherheit nahm Kanada jedoch trotzdem zum Anlass, um für die Artemis-II-Mission 2024 zur Mondumrundung Klarheit zu schaffen: Mit dem Änderungsentwurf vom April 2022 soll die Strafgerichtsbarkeit des kanadischen Strafgesetzbuches auf den Mond ausgeweitet werden. Dabei stoßen sie als erstes Land mit einer solchen Änderung auf einige Hürden, die mit zunehmenden Weltraumprojekten auch bald Deutschland treffen könnten. Was ist eigentlich Weltall? Ab wie vielen Kilometern fängt es an? Wie ist die Definition von »Mond«? Wie die konkrete Ausgestaltung dann aussieht, steht in den Sternen.
Klar ist nur eines, wenn es um Strafrecht im All geht: Das Sprichwort »Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand« muss definitiv um das Wort Weltraum ergänzt werden.
§ NACHWORT
Nachdem Der Taschenanwalt bei euch so gut ankam, musste einfach ein zweites Werk her, das ist ja klar! Diesmal sollte das Buch euch nicht bei rechtlichen Alltagsfragen unterstützen, sondern einfach unterhalten - auch wenn man aus vielen Geschichten einige (rechtliche) Lehren ziehen kann.
Danke, dass ihr auch dieses Buch gelesen habt! Und falls ihr den Taschenanwalt nicht kennt: Das nächste Weihnachten kommt bestimmt, und dann habt ihr vielleicht eine Geschenkidee für den Tannenbaum.
Eines kann ich euch sagen: Es war gar nicht so einfach, die Auswahl von Urteilen, Gesetzen und Rechtsfragen zu treffen. Überall wimmelt es nur so von skurrilem Recht. Da soll noch mal einer sagen, der Job eines Juristen sei langweilig. Das kann er zwar auch manchmal sein, aber das Gute ist, dass man sich ein Rechtsgebiet aussuchen kann, das man gern mag. Derjenige, der sich für besondere KI-Rechte einsetzen will, findet seinen Platz ... Wenn er nicht zuvor von künstlicher Intelligenz irgendwann ersetzt wird. Aber das soll natürlich keine Werbung für ein Jurastudium sein - mir geht es darum, euch da draußen einen Einblick in den wirklich unterhaltsamen Teil meiner Welt zu gewähren. Ich hoffe, das ist mir gelungen.
Wer von skurrilen Geschichten jetzt noch nicht genug hat oder einfach mehr Jura erfahren will - in fast jedem sozialen Netzwerk, in dem ihr seid, bin ich auch:
YouTube: »WBS.LEGAL«
Instagram: »recht2go«
Facebook: »wbs.legal«
TikTok: »recht2go«
Twitter: »@solmecke«
Und welches Thema interessiert euch am meisten? Welche verrückte Story habt ihr vermisst? Schreibt mir gern.
Euer Christian Solmecke
§ ÜBER DEN AUTOR

Christian Solmecke ist Deutschlands wohl bekanntester Rechtsanwalt. Ob es um skurrile oder ernste Rechtsfragen geht - auf der Suche nach einem auch für Nichtjuristen verständlich erklärten Rechtsthema führt kein Weg an ihm vorbei. Doch wie kam es überhaupt dazu? Solmecke studierte Jura in Köln und Bochum, absolvierte anschließend einen Master of Laws und spezialisierte sich dann als Rechtsanwalt auf die Beratung der Internet- und IT-Branche. Seit 2010 ist er Partner der Kölner Medienrechtskanzlei WBS.LEGAL. »Nebenbei« hat er mehrere Unternehmen gegründet und mit Legalvisio eine neue Software für Anwaltskanzleien ins Leben gerufen. Darüber hinaus ist er ehemaliger Radiomoderator und freier Journalist. Er weiß, wie man die Menschen sogar mit dem vermeintlich trockenen Recht gut unterhält und auch ernste Rechtsfragen vor einem Mikrofon und einer Kamera verständlich beantwortet. Deshalb wird er häufig um seine Einschätzung gebeten. Für viele ist das Allround-Talent jedoch vor allem eines: der »You-Tube-Anwalt«, der die aktuell knapp eine Million Abonnenten seines Kanals WBS.LEGAL über die neuesten Rechtsthemen informiert. Dabei beleuchtet er neben höchstrichterlichen Urteilen und neuen Gesetzen auch mal (kriminelle) Prominente oder eben skurrile juristische Fälle. Solmecke weiß, was die Menschen bewegt. Als Wahlkölner lebt er nicht nur den rheinischen Frohsinn aus, sondern kennt als Vater eines Teenagers zudem stets das aktuelle Jugendwort des Jahres.