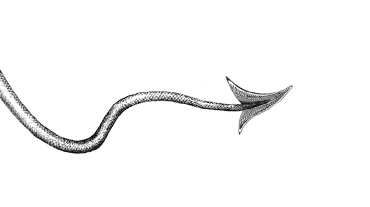
»Seit einer Million Jahre bin ich die Frau des grossen Teufels«, erklärte eine Wäscherin dem Psychiater Jean-Étienne Esquirol Anfang des 19. Jahrhunderts. Seit eines ihrer Kinder in ihren Armen gestorben war, glaubte sie, vom Teufel besessen zu sein. Er »schläft bei mir«, meinte sie, »und sagt mir unaufhörlich, dass er der Vater meiner Kinder sei. Ich habe Schmerzen im Uterus. Mein Körper ist ein aus der Haut des Teufels gemachter Sack, der voll von Kröten, Schlangen und anderen unflätigen Thieren ist, die Teufel sind.« Sie behauptete, dass der Teufel ihr zuflüsterte, sie solle Fremde schlagen und ihre Kinder erdrosseln.
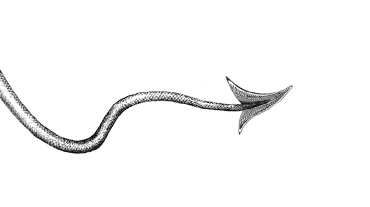
Eine weitere von Esquirols Patientinnen war davon überzeugt, dass sich zwei Dämonen(1) in ihren Hüften eingenistet hatten. Sie kämen als Katzen über ihre Ohren heraus. Eine sei weiß und gelb, die andere schwarz. Um sie am Herauskommen zu hindern, schmierte sie sich Fett in die Ohren.
Für Esquirol handelte es sich bei beiden nicht um Besessene, die von einem fremden Geist ergriffen worden waren, sondern um Opfer einer psychiatrischen Erkrankung: der Dämonomanie (abgeleitet vom griechischen Wort daimōn). Obwohl es in der Vergangenheit epidemische Ausbrüche von Dämonomanie gegeben hatte – im 14. Jahrhundert in den Niederlanden, Belgien und Deutschland, Mitte des 16. Jahrhunderts in Rom –, trete diese Krankheit selten auf. »Ich habe unter mehr als 20 000 Geisteskranken kaum nur Einen gesehen, der von dieser Krankheit befallen war […]«, schrieb Esquirol 1838 in Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medizin und Staatsarzneikunde. Er begründete das damit, dass der religiöse Fanatismus abgenommen habe. Ein Kranker, »dessen Delirium sich ehemals um Zauberei, Hexerei, um die Hölle gedreht hatte, deliriert heute, indem er sich von der Polizei bedroht und verfolgt glaubt.« Die Häscher des Teufels waren also durch die des Staates ersetzt worden.
Allerdings hatte Esquirol das Ende der Dämonomanie zu früh eingeläutet. Denn zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung seines bahnbrechenden Buchs über die maladies mentales brach in dem Städtchen Morzine in den Alpen eine epidemische Form von Dämonomanie aus. Der Ort liegt in der Region der Hochsavoyen und grenzt an die Schweiz und Italien an. Von 1857 bis in die Mitte der 1860er Jahre hinein glaubte die Hälfte der dort lebenden Frauen sowie viele Männer und Kinder, besessen zu sein.
Zuerst traf es eine Zehnjährige. Als Péronne Tavernier an einem Frühlingsmorgen im Jahr 1857 die Kirche verließ, sah sie, wie ein halbtotes Kind aus dem Fluss gezogen wurde. Später am selben Tag fiel Péronne in Ohnmacht und erwachte erst wieder nach einigen Stunden. In den folgenden Wochen erlitt sie immer wieder solche Anfälle oder fiel in Trance; als sie eines Tages zusammen mit ihrer Freundin Marie Plagnat Ziegen hütete, verloren beide Mädchen gleichzeitig das Bewusstsein. Bald darauf wurden beide von Halluzinationen heimgesucht. Marie sagte voraus, Péronnes Vater werde krank werden und sterben, woraufhin er und später auch sein Vieh mysteriösen Krankheiten erlagen. Auch Maries Geschwister begannen, sich ungewöhnlich zu verhalten: Ihre jüngere Schwester verdrehte die Augen, die ältere Schwester klagte, sie habe Dämonen im Körper, während man sah, wie ihr Bruder merkwürdig behände einen Baum emporkletterte.
Innerhalb weniger Monate litten einhundert Stadtbewohner unter Zuckungen, Halluzinationen und Eingebungen, bei einigen bildete sich Schaum vor dem Mund, sie redeten in Zungen und vollführten akrobatische Verrenkungen. Ein Jahr später baten die Familien der Betroffenen den Priester des Orts um einen öffentlichen Exorzismus. Die Veranstaltung endete allerdings im Chaos: Die Versammelten fluchten, zuckten, schlugen auf die Kirchenbänke ein und schrien schreckliche Verwünschungen. Der Priester erklärte sich anschließend bereit, im Privaten einige Exorzismen durchzuführen. Während dieser Sitzungen sprachen wohl Geister aus den Betroffenen und gestanden Sünden, die sie zu Lebzeiten begangen hatten. 1860 verkündete der Priester allerdings, dass die Menschen in Morzine nicht besessen seien, seiner Meinung nach seien sie schlichtweg krank. Bei dieser Verlautbarung stürzten sich einige seiner Gemeindemitglieder auf ihn und die Polizei musste einschreiten. Im folgenden Jahr entsandte man den Generalinspekteur für die psychiatrischen Anstalten der Gegend zusammen mit einer Truppe Soldaten nach Morzine, um dort die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Der Inspekteur verteilte die Erkrankten auf verschiedene Krankenhäuser, wo sie voneinander getrennt behandelt werden sollten.
Für eine Weile kehrte in der kleinen Gemeinde wieder Frieden ein. Im Jahr 1864 waren viele der Bewohner aus den Kliniken entlassen worden und nach Hause zurückgekehrt, woraufhin die Epidemie von Neuem begann. Im Mai besuchte ein Bischof den Ort. Auf dem Friedhof und in der Kirche lagen Dutzende zuckender Frauen. Als er auf den Altar zuging, griffen ihn einige an, beschimpften ihn, zerrissen ihre eigenen Kleider, bespuckten ihn und versuchten ihn zu beißen.
Wieder einmal mussten die weltlichen Autoritäten eingreifen. Man versuchte die Bewohner zu beruhigen, indem man sie mit Konzerten und Tanzveranstaltungen ablenkte, es wurde eine Bücherei eröffnet, noch einmal wies man die Betroffenen in Anstalten ein. Derweil beschränkte man die religiösen Aktivitäten auf ein Minimum. Diese Maßnahmen hatten Erfolg. Im Jahr 1868 zeigten nur noch wenige Frauen Anzeichen von Besessenheit; in den Augen ihrer Nachbarn waren diese nun aber einfach krank, schwachsinnig oder sie simulierten. Der Soziologe Robert Bartholomew schreibt über diesen Fall: »Vielleicht war genau diese Neueinordnung der ausschlaggebende Punkt; sie wurden nun nach den Methoden der Wissenschaft bewertet, nicht mehr nach den alten Maßstäben der Kirche und der Zauberei. Die Krankheit betraf nicht länger die Gemeinschaft als Ganze, sondern einzelne Individuen.« An den Ereignissen von Morzine lässt sich der Umschwung von einer religiösen zu einer wissenschaftlichen Weltanschauung ablesen, aus dem kommunalen wird ein individueller Zusammenbruch. Esquirols Definition von Dämonomanie als einer mentalen Krankheit hatte sich bestätigt.
Als erste Historikerin befasste sich Catherine-Laurence Maire mit den Vorkommnissen in Morzine. Ihrer Ansicht nach war es die plötzliche Konfrontation mit der Moderne, der säkularen Welt, die zu dem Ausbruch von Dämonomanie führte. Über Jahrhunderte hinweg hatten die Menschen dort sehr zurückgezogen gelebt, eingeschlossen von Bergen, hatten sie an Traditionen festgehalten, an ihrem Glauben an Magie, den Teufel und an die Lehren der katholischen Kirche. Sie wussten wenig von der Welt, die sich jenseits der Berge befand – von 2000 Bewohnern konnten nur zehn Prozent lesen. Während der 1850er Jahre begann sich die Region langsam zu öffnen. Mehr als die Hälfte der Männer in Morzine arbeiteten nun in Genf oder Lausanne und kamen nur zu Weihnachten nach Hause. Übrig blieben die Ehefrauen und ihre Kinder, die sich um das Vieh und das Land kümmern mussten.
In dieser Phase des sozialen und demographischen Umbruchs erlagen die Frauen von Morzine der Dämonomanie. Sie nutzten »möglichst extreme Sprache und Gestik, um die Schmerzen und Sehnsüchte auszudrücken, die einer Kultur zugrunde lagen, die sich im Zustand der Auflösung befand«, schrieb der amerikanische Autor Allen S. Weiss. Die Anfälle von Dämonomanie in Morzine waren die letzten Zuckungen des ausgehenden Mittelalters.
• Siehe auch: Beatlemanie, Choreomanie, Kajakphobie, Lachmanie
Im Jahr 1889 verwendete der französische Dermatologe Louis-Anne-Jean Brocq erstmals den Begriff Dermatillomanie, um eine seiner jungen Patientinnen zu charakterisieren. Die Jugendliche knibbelte zwanghaft an ihrer Akne herum. Dermatillomanie setzt sich aus dem griechischen Wort für Haut(1) (derma) und dem Verb für herausziehen oder zupfen (tillo) zusammen. Gängige Bezeichnungen sind außerdem: neurotische Exkoriation oder Skin-Picking-Störung. »Es handelt sich um eine Angewohnheit, die sich nicht kontrollieren lässt«, schrieb George Miller MacKee 1920, »und die Betroffenen sind kaum oder überhaupt nicht in der Lage, das Bearbeiten von schuppigen Hautstellen, Follikelpfropfen, Komedonen, Haarstoppeln, Akneläsionen, Milien, Schorf usw. zu vermeiden«.
Seit 2013 wird Dermatillomanie im Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen (DSM-5) der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft aufgelistet. Wie Trichotillomanie, zwanghaftes Herausziehen von Haaren, und Onychotillomanie, das Ziehen und Beißen von Nägeln und der Nagelhaut, gehört auch die Dermatillomanie zur Klasse der Impulskontrollstörungen. Mitunter wird sie der Zwangsspektrumsstörung zugeordnet oder abnormen Gewohnheiten, die den Körper betreffen.
Die meisten Betroffenen nutzen ihre Fingernägel für das Zupfen und Quetschen ihrer Haut, mitunter werden jedoch auch Zähne, Pinzetten, Nadeln und Messer verwendet. Eigentlich ist die Dermatillomanie recht verbreitet, Schätzungen zufolge sind in etwa drei Prozent der Weltbevölkerung betroffen, allerdings lassen sich nur zwanzig Prozent der Betroffenen ärztlich behandeln. In der Regel beginnt das Verhalten in der Pubertät mit dem Ziel, das Hautbild durch Kratzen, Pulen, Drücken oder Reiben ebenmäßiger erscheinen zu lassen. Dermatillomanen achten besonders auf Flecken, Knötchen, Schorf, Narben und Insektenstiche. Viele konzentrieren ihre Tätigkeit auf das Gesicht, während andere alle Bereiche des eigenen Körpers untersuchen, die sie erreichen können – die Zone zwischen den Schulterblättern ist manchmal der einzige Bereich, der verschont bleibt.
Dermatillomanie kann durch Hautkrankheiten wie Schuppenflechte oder Krätze ausgelöst werden oder von Krankheiten, die zu Hautkribbeln führen, wie Diabetes oder Erkrankungen der Leber. In der Regel hat sie aber eine psychologische Ursache und kann mit Medikamenten oder Verhaltenstherapie behandelt werden. In seltenen Fällen wird das Pulen sogar gefährlich. Eine Studie von 1999 beschrieb eine Frau, die so zwanghaft an ihrem Nacken kratzte, dass sie ihre Halsschlagader freilegte. Eine weitere verletzte ihre Hände derart schlimm, dass die Ärzte eine Amputation in Erwägung zogen.
Das Herumknibbeln an der eigenen Haut kann, vor allem wenn es mit Absicht geschieht und sich auf eine bestimmte Stelle konzentriert, eine Form von Selbstbestrafung sein. Genauso kann es sich aber auch um eine Gewohnheit handeln, die gar nicht zur Kenntnis genommen wird. Die Finger von Dermatillomanen arbeiten instinktiv und verschaffen ihnen so eine Art der Befriedigung. Das Zupfen und Quetschen kann sowohl aufreibend als auch beruhigend wirken – es entsteht eine Art Rückkopplungsschleife, in der der Körper mit sich selbst in einen intimen Austausch tritt, er dreht sich nun nur noch um sich selbst. Wie benebelt schiebt der Kratzende die Außenwelt und das eigene Bewusstsein beiseite, indem er sich ganz auf seine Tätigkeit konzentriert.
»Herr Doktor, Sie wissen, dass ich eine Pulerin bin«, meinte eine Patientin einmal ihrem Dermatologen Michael Brodin gegenüber. »›Meine Mutter hat gepult, ich pule und meine Tochter pult ebenfalls.‹ Sie stellte das mit derselben Selbstverständlichkeit fest«, erklärte Brodin 2010 im Journal of the American Academy of Dermatology, »als hätte sie mir gerade eröffnet, sie seien alle stolze Republikanerinnen.«
• Siehe auch: Akarophobie, Haphemanie, Onychotillomanie, Trichotillomanie
Im 19. Jahrhundert verwendete man den Begriff Dipsomanie (vom griechischen Wort dipsa – Durst), um die krankhafte Sucht nach Alkohol(1) und den vom Alkohol verursachten Rausch zu benennen. Erstmals eingeführt wurde der Begriff von dem deutschen Arzt Christoph Wilhelm Hufeland.
In jener Zeit herrschte in Bezug auf exzessive Trinker und ihr Tun nach wie vor eine gewisse Begriffsvielfalt (beispielsweise Trunkenbold, Zecher, Gewohnheitstrinker, Saufbold, die Trunksucht oder die Branntweinpest). Britische Ärzte nutzten in der Regel den Begriff Dipsomanie. Die Bezeichnung verlieh diesem Verhalten einen wissenschaftlichen Anstrich, nun galt es als Krankheit und nicht mehr nur als moralische Verfehlung. Als sich um 1882 im medizinischen Diskurs der Begriff Alkoholismus durchzusetzen begann, verschob sich die Bedeutung des Wortes Dipsomanie. Es beschrieb nun das periodische Auftreten von Trunksucht. Beim Dipsomanen handelte es sich um einen »Quartalssäufer«, zwischen nüchternen Episoden kam es bei ihm zu regelrechten Trinkanfällen. Der Seelenarzt Daniel Hack Tuke beschrieb die Dipsomanie 1892 als unwiderstehlichen Drang zu trinken, der die Patienten anfallartig überkomme. Währenddessen befänden sie sich in einem Zustand der Willenlosigkeit, in welchem sie großes Leid über sich brächten.

Der Psychiater Pierre Janet berichtete um 1900 von einer Dreißigjährigen aus gutem Hause, die seit ihrem neunzehnten Lebensjahr immer wieder dem Whisky verfiel. Für Janet war sie das Paradebeispiel einer Dipsomanin. Die Ausfälle begannen jedes Mal mit einem Nippen, da sie ja wusste, wie gefährlich das Getränk für sie werden konnte. Bevor sie sich versah, folgte ein kräftiger Schluck, darauf ein zweiter und so fort. Unglücklich und voller Scham trank sie dann heimlich immer weiter. Sie leerte eine halbe Flasche pro Tag, und wenn sie nach einem Rausch wieder zu sich kam, fühlte sie sich schrecklich. »Sie spricht von Selbstmord und kann sich nur schwer beruhigen, indem sie feierlich Besserung gelobt.«

War ein solcher Anfall vorbei, trank die Frau über mehrere Wochen oder Monate hinweg nur Wasser, bis sich ihre Stimmung wieder verschlechterte. Das geschah zunächst langsam, bis sich plötzlich ein »Schleier der Traurigkeit über alles legte, eine Mutlosigkeit, eine Abneigung gegen alles, ein allumfassender Weltschmerz«. Befand sie sich einmal in diesem Zustand, ging es ihr wie folgt: »Ich bin der ganzen Welt überdrüssig. Nichts ist irgendeiner Mühe wert. Ich kann noch nicht einmal mehr wütend werden, da nichts es wert ist, wütend darauf zu sein. Ich frage mich, wie andere Menschen den Mut aufbringen sich zu ärgern.« Sie meinte, dass sie sich weder froh noch traurig fühlte, nichts interessiere sie. »Sie können sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn sich nach und nach ein Schatten über das ganze Leben legt wie bei einer Sonnenfinsternis.«
Janets Patientin fühlte sich so trostlos, so ganz ohne Liebe, selbst für ihren Mann und ihre Kinder (»Es ist schrecklich, alle liebevollen Gefühle zu verlieren!«), dass sie keinen Grund sah, weshalb sie weiterleben sollte. Also suchte sie Zuflucht im Whisky. »Nachdem ich getrunken habe, bekommt alles wieder Farbe, die Dinge werden wieder interessant«, erklärte sie. »Ich fühle mich nicht mehr stumpfsinnig; ich kann dann sehen, lesen, reden und handeln. Es gibt dem Leben wieder Sinn, es verleiht ihm einen scheinbaren Wert.« Sie wusste, dass ein solches Stimmungshoch, ausgelöst durch Alkohol, trügerisch war, genauso war ihr klar, dass sie sich danach furchtbar fühlen würde, aber manchmal war es das Einzige, wofür sie sich noch begeistern konnte.
• Siehe auch: Kleptomanie, Lypemanie, Nymphomanie, Pyromanie
Im Jahr 1897 dokumentierte der amerikanische Psychologe Granville Stanley Hall 111 Fälle von »Fell-Aversion«. Er fasste sie unter dem Begriff Doraphobie zusammen – nach dem griechischen Wort dora für Fell oder Tierhaut. Die meisten Doraphobiker konnten nicht ausstehen, wie sich Fell(1) auf der eigenen Haut anfühlte. Dabei war es egal, ob es sich um einen weichen Nerz, die borstigen Haare eines Terriers oder das ölig-grobe Fell einer Ratte handelte. Eine Vierzehnjährige fürchtete sich besonders vor Fell, durch das man die darunterliegende Haut sehen konnte, wenn man es zur Seite strich oder wenn der Wind hindurchfuhr.
In den Vereinigten Staaten führten die Verhaltenspsychologen John Broadus Watson und Rosalie Rayner 1919 ein Experiment durch, das berühmt werden sollte. Sie wollten zeigen, dass eine Phobie künstlich erzeugt werden kann. Inspiriert hatten sie die Arbeiten des russischen Physiologen Iwan Pawlow. Er hatte in den 1890er Jahren gezeigt, dass Tieren eine physische Reaktion auf einen konditionierten Stimulus antrainiert werden konnte. Bekanntes Beispiel waren die Hunde, die beim Ticken eines Metronoms sabberten, da sie gelernt hatten, das Geräusch mit Futter zu assoziieren.
Watson und Rayner wollten ein Baby dazu bringen, Angst vor Ratten zu empfinden. Gegenstand des Experiments war »Albert B.«, das »behäbige und emotionslose« Kind einer Amme, die an der Johns Hopkins Universitätsklinik in Baltimore, Maryland, angestellt war. In der ersten Sitzung zeigten Watson und Rayner dem neun Monate alten Baby in ihrem Labor eine weiße Ratte, einen Hasen, einen Hund, einen Affen, Masken und Watte. Albert zeigte keinerlei Anzeichen von Angst. Allerdings reagierte er stark darauf, als sie hinter ihm mit einem Hammer auf eine Stahlstange schlugen. Bei dem Geräusch erstarrte das Baby vor Schreck und brach in Tränen aus.
Zwei Monate später versuchten die Forscher während der zweiten Sitzung, Albert dazu zu bringen, das Geräusch mit einer weißen Ratte in Zusammenhang zu bringen. Jedes Mal, wenn Albert die Hand nach der Ratte ausstreckte, schlugen sie mit dem Hammer auf die Stange. Nach einer Woche zeigten sie Albert die Ratte erneut. Diesmal zögerte er. Obwohl er seinen linken Zeigefinger vorsichtig nach dem Tier ausstreckte, hielt er kurz vor einer Berührung inne. Den Tag über zeigten die Psychologen dem Jungen immer wieder die Ratte und schlugen jedes Mal mit dem Hammer auf die Stange. Am Ende der Sitzung geriet Albert beim Anblick der Ratte in Panik.
»Sobald man ihm die Ratte zeigte, begann der Säugling zu weinen«, notierten Watson und Rayner. »Beinahe sofort drehte er sich nach links, fiel auf die linke Seite, richtete sich wieder auf und krabbelte auf allen vieren so schnell er konnte weg, sodass es schwer war, ihn einzuholen, bevor er die Tischkante erreichte.« Das Experiment war erfolgreich gewesen. Einen überzeugenderen Fall einer vollkommen konditionierten Angst hätten sie sich nicht vorstellen können, schrieben die Experten.
Nach einer weiteren Woche reagierte Albert mit Angst auf einen Hasen, einen Hund und einen Robbenpelzmantel. Offensichtlich hatte sich seine Angst vor der Ratte auf andere pelzige Dinge übertragen. Bald darauf gab Alberts Mutter ihren Job im Krankenhaus auf und die Experimente wurden nicht fortgesetzt. Watson folgerte aus dem Experiment, dass Ängste nicht in uns angelegt, sondern erlernt seien; Gleiches gelte für die meisten menschlichen Eigenschaften. »Man gebe mir ein Dutzend gesunder Säuglinge – wohl gewachsen – und meine eigene spezifische Welt, in der ich sie großziehen kann, und ich garantiere Ihnen, dass ich jeden von ihnen zu einem Spezialisten für ein zufällig gewähltes Gebiet ausbilden kann – Arzt, Anwalt, Künstler, Händler, Anführer, ja, sogar Bettler und Dieb, unabhängig von seinen Talenten, Neigungen, Anlagen, Fähigkeiten und der Rasse seiner Vorfahren«, verkündete er 1930. Watsons behavioristische Theorie war zu seiner Zeit eine Alternative zur Eugenetik, die sich auf die Bedeutung der Vererbung in der menschlichen Psyche konzentrierte, und zu Freuds Betonung der Rolle verdrängter sexueller Begierden. Watson witzelte, sollte Albert B. sich später einmal einer Psychoanalyse unterziehen, so würden seine Therapeuten, verunsichert durch seine Angst vor Pelzmänteln, ihm bestimmt einen Traumbericht aus der Nase ziehen, »aus dem sie dann herausanalysieren könnten, dass Albert im Alter von drei Jahren versuchte, mit den Schamhaaren seiner Mutter zu spielen, woraufhin er schlimm ausgeschimpft wurde«.
Watson und Rayner behaupteten, dass ihre Versuche dem Jungen keinen großen Schaden zugefügt hätten: Sie argumentierten, dass die Schrecken, denen sie ihn ausgesetzt hatten, denen ähnelten, die auch andere Säuglinge erfahren könnten. Hätten sie die Gelegenheit gehabt, meinten sie, hätten sie versucht, die Ängste des Jungen wieder abzubauen. Sie hatten vor, ihm beim Anblick der Ratte Süßigkeiten zu geben, um seine Konditionierung aufzulösen, alternativ hätten sie seine erogenen Zonen stimuliert: »Wir würden es zuerst mit den Lippen, dann den Brustwarzen und als letzte Möglichkeit mit den Genitalien probieren.« Baby Albert war dem Schlimmsten wohl noch entgangen: Die Wissenschaftler hatten ihn erfolgreich in Angst und Schrecken versetzt, aber immerhin hatten sie keine Gelegenheit bekommen, ihn sexuell zu missbrauchen.
2014 wurde Albert B. eindeutig als Albert Barger identifiziert, als unehelicher Sohn einer jungen Frau, die an der Johns Hopkins Uniklinik gearbeitet hatte. Seine Nichte erzählte Journalisten, er sei 2007 verstorben, ohne je von den Experimenten erfahren zu haben. Sie berichtete, er habe ein glückliches Leben geführt, allerdings habe er Tiere nie gemocht. Wenn er sie besuchte, hatte sie ihre Hunde immer weggesperrt.
• Siehe auch: Ailurophobie, Kynophobie, Musophobie, Phonophobie, Pteronophobie, Zoophobie
Zwanghaftes Weglaufen(1) wurde vom französischen Arzt Emmanuel Régis 1894 als Dromomanie (vom griechischen Wort dromos – Lauf) bezeichnet. Diese Form der Manie breitete sich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in Frankreich aus. Man sprach von krankhaftem Tourismus, Wanderlust oder Vagabondage. Mitunter waren sich die Wandernden ihres Tuns nicht bewusst, sie litten unter temporärer Amnesie oder befanden sich im Zustand dissoziativer Fugue. Eine harmlose Form solchen Verhaltens legte der Flâneur an den Tag, wenn er durch die Straßen schlenderte, ein Stadtwanderer.
Im 18. und 19. Jahrhundert hatte man ausgiebiges Laufen als etwas Positives angesehen. 1809 verdiente sich der hochgeschätzte Fußgänger Captain Robert Barclay tausend englische Pfund, weil er in tausend aufeinanderfolgenden Stunden jeweils eine Meile pro Stunde gelaufen war. Viele Künstler und Philosophen blühten erst beim Laufen richtig auf. »In dem Wandern liegt etwas, das meine Gedanken weckt und belebt; verharre ich auf der Stelle, so bin ich fast nicht im Stande zu denken; mein Körper muß in Bewegung sein, damit mein Geist in ihn hineintritt«, schreibt Rousseau in seinen Bekenntnissen (1789). Während Friedrich Nietzsche Der Wanderer und sein Schatten (1880) schrieb, ging er jeden Tag acht Stunden zu Fuß. In Ecce Homo empfiehlt er seinen Lesern: »So wenig als möglich sitzen; keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Alle Vorurtheile kommen aus den Eingeweiden.« In diesen Fällen lag dem Laufen allerdings eine bewusste Entscheidung zugrunde. Für die Schriftsteller stellte es eine Möglichkeit dar, mit sich selbst und der Natur in Verbindung zu treten. Ganz anders erging es Menschen, die mit dem Laufen nicht mehr aufhören konnten; in den 1890er Jahren gab es offenbar eine regelrechte Lauf-Epidemie.
Der erste weithin bekannte Fall von Dromomanie betraf Jean-Albert Dadas, einen Gasmonteur aus Bordeaux. In seinem Buch Mad Travellers (1998) setzt sich Ian Hacking im Detail mit dem Fall auseinander. 1898 war Dadas im Alter von acht Jahren von einem Baum gefallen und hatte sich eine Kopfverletzung zugezogen. Vier Jahre später erlebte er seine erste Wanderepisode, als er unversehens aus der Gasfabrik verschwand, in der er in die Lehre ging. Man fand ihn schließlich in einer benachbarten Stadt, wo er als Assistent eines reisenden Schirmverkäufers arbeitete. Anscheinend konnte er sich nicht erinnern, wie er dorthin gekommen war. In seinem Leben überkamen ihn, wie er erzählte, immer wieder Zustände von dissoziativer Fugue – plötzlichem, ziellosen Weglaufen – und wenn er schließlich wieder zu sich kam, musste er verwirrt feststellen, dass er sich ganz woanders befand: auf einer Parkbank in Paris, Töpfe schrubbend in Algerien oder auf offenem Feld in der Provence. 1881 floh er in Mons aus der französischen Armee, lief nach Berlin und von dort weiter nach Moskau, wo er festgenommen und nach Konstantinopel deportiert wurde. Als man ihn 1886 nach Bordeaux zurückbrachte, begab er sich bei dem jungen Neuropsychiater Philippe Tissié in Behandlung, dessen Bericht über Dadas’ Abenteuer die Krankheit erst bekannt machte. Während der folgenden zwei Jahrzehnte wurden zahlreiche Fälle von Dromomanie diagnostiziert, einige davon durch Militärärzte, die Deserteure vor der Todesstrafe retten wollten.
1906 beschrieb der Psychiater Pierre Janet einen 51 Jahre alten Dromomanen namens H. dessen zwanghafte »Spaziergänge« zu einem 225 Kilometer langen Marsch von Paris nach Lille ausufern konnten. Bevor er zu einer seiner überbordenden Wanderungen aufbrach, ging es ihm wie folgt: »Ich spüre einen verborgenen Kummer, eine tödliche Langeweile, ein unbekanntes Grauen […] alles bedrückt mich, alles bereitet mir Unbehagen, alles wirkt eintönig, die ganze Welt scheint nichts wert zu sein und ich, der ich auf ihr lebe, am allerwenigsten. Dann fühle ich den Drang, mich zu bewegen, mich selbst aufzurütteln.« Um sich von seinen Wanderungen abzuhalten, schloss H. regelmäßig seine Haustür von innen ab und warf den Schlüssel aus dem Fenster. Am Ende siegte aber dann doch seine Manie. »Ich breche die Tür auf und renne los, ohne es zu merken. Ich komme erst wieder zu mir, wenn ich schon unterwegs bin.«
Janet traf eine junge Frau, die an einer ähnlichen Rastlosigkeit litt und wiederholt aus den Heimen ausbrach, in die sie eingewiesen worden war. »Sie muss sich bewegen«, schrieb er, »und für sie ist es unbedingt nötig, dass sie jeden Tag, ohne Ausnahme, vierzig oder fünfzig Kilometer auf einer Landstraße läuft.« Sie kam nicht zur Ruhe, bevor sie nicht 46 Kilometermarkierungen entlang der Straße gezählt hatte. »Manchmal wird sie von einer Kutsche begleitet«, schrieb Janet, »aber sie steigt nie ein, sie läuft neben der Kutsche und dem trabenden Pferd her.« Dieses »manische Laufen«, so Janet, »erscheint sehr seltsam; es tritt jedoch häufiger auf, als man es annehmen möchte. In Paris gibt es bedauerliche Menschen, die in ihren Höfen eine Zementbahn angelegt haben, auf der sie auf und ab laufen, wenn sie keine Strecke auf der Straße zurücklegen können.«
Der Drang zu laufen wurde von manchen als das Wiederaufleben uralter Impulse interpretiert; als ein Atavismus aus der Zeit, als die Menschen als Nomaden lebten, noch vor Aufkommen der Agrarkultur. Besonders wandernde Frauen sorgten für Aufregung, da sie ihre häusliche Berufung zu verleugnen schienen. Charlotte Brontës Jane Eyre (1847) formuliert es im gleichnamigen Roman so: »Ich konnte jedoch nichts dafür; die Ruhelosigkeit lag in meiner Natur und oft quälte sie mich aufs Äußerste.«
Vermutlich kann nur eine Gesellschaft, die ein häusliches und familiäres Leben idealisiert, das Bedürfnis zu wandern als Krankheit einstufen. Als Frauen im Ersten Weltkrieg zur Arbeit in Fabriken aufgefordert wurden, während die Männer an der Front für ihr Land kämpften, verschwand die Diagnose Dromomanie. Mittlerweile schätzen wir das Laufen wieder – im Jahr 2020 sammelte der 99-jährige Captain Tom Moore während der Covid-19-Krise mit einer Spendenaktion über dreißig Millionen Pfund für den British National Health Service: Vor seinem hundertsten Geburtstag lief er seinen Garten hundert Mal ab. Für dieses Verdienst wurde er zum Ritter geschlagen.
• Siehe auch: Monomanie