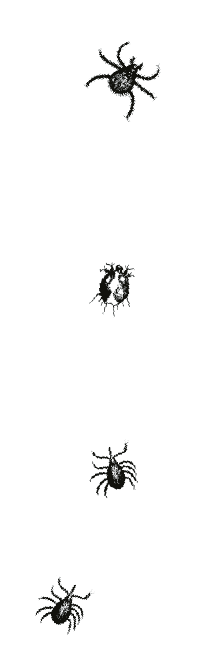
Der englische Kritiker William Sidney Walker verwendete 1825 erstmals das Wort Egomanie, um in einem Brief eine »obsessive Ichbezogenheit(1)« zu beschreiben. Sowohl im Lateinischen als auch auf Griechisch steht ego für »Ich«. In Großbritannien fand der Begriff durch die Übersetzung von Max Nordaus Entartung (Degeneration), die 1895 erschien, Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch. Nordau verurteilte die Avantgardekünstler seiner Generation als Egomanen, die so auf sich selbst fixiert seien, dass es einer Wahnvorstellung gleichkomme. Der Egomane, oder Ich-Süchtige, ging laut Nordau dabei nicht davon aus, dass er besser als alle anderen sei. Vielmehr »sieht [er] die Welt gar nicht. Die anderen Menschen bestehen einfach nicht für ihn. […] er ist eben allein in der Welt, ja er ist allein die Welt […]«.
• Siehe auch: Graphomanie, Megalomanie
Die übertriebene Angst vor Palindromen(1) – Wörtern, die vorwärts wie rückwärts gelesen werden können – geht auf die begriffliche Spielerei des Liverpooler Folksängers und Informatikers Stan Kelly-Bootle zurück, der sie in seinem Wörterbuch The Devil’s DP Dictionary (1981) verwendet. Bei der Eibohphobie handelt es sich zwar nicht um eine anerkannte psychologische Störung, dafür aber um ein Palindrom.
• Siehe auch: Hippopotomonstrosesquippedaliophobie, Onomatomanie
Emetophobie beschreibt eine intensive und anhaltende Angst vor dem Erbrechen (abgeleitet vom griechischen eméein – erbrechen). Die Betroffenen fürchten einerseits den Kontrollverlust, den Erbrechen mit sich bringt, andererseits haben sie Angst vor dem Ekel, den Erbrechen(1) oder Erbrochenes(1) in ihnen und anderen auslösen kann. Deshalb meiden sie alle Situationen, in denen sie Erbrochenem oder Erbrechen ausgesetzt sein könnten: die Nähe kleiner Kinder oder Betrunkener, Kranker, Schwangerer (sie vermeiden sogar eigene Schwangerschaften); sie gehen weder auf Partys noch in Krankenhäuser, reisen nicht in fremde Länder, trinken keinen Alkohol, nehmen keine Drogen, besteigen keine Schiffe, Flugzeuge, Züge oder Achterbahnen.
Diese spezifische Phobie tritt wesentlich häufiger bei Frauen als bei Männern auf – das Verhältnis liegt beinahe bei fünf zu eins. Oft wird sie nicht diagnostiziert, da sie mit einer Essstörung, einer Zwangsstörung oder einer generellen Angst um die eigene Gesundheit einhergeht. Bereits die Angst vor dem Erbrechen sorgt bei den Betroffenen für ständige Unruhe. Sie wollen Erbrechen auf jeden Fall vermeiden, weil sie fürchten, dass sie sich blamieren, sich vor sich selbst ekeln oder vor anderen enthüllen, wie ekelhaft sie sind. Schließlich kann eine heftige Brechattacke sich anfühlen, als hätte man sein Innerstes nach außen gekehrt, als sei man leer und verletzlich.
2018 wurde eine vergleichende Analyse der bisher (spärlichen) Forschungserkenntnisse zur Emetophobie durchgeführt. Die Untersuchung ergab, dass 80 Prozent der Probanden unter Intrusionen in Bezug auf Erbrechen litten, 31 Prozent von ihnen erlebten immer wieder Flashbacks, die sie in frühere Brecherlebnisse zurückversetzten. Auf die Frage, welche Aspekte des Erbrechens besonders gefürchtet wurden, antworteten vier Fünftel mit Würgen, mehr als die Hälfte fürchtete sich vor Krankheitserregern, ein Drittel hatte Angst, sie könnten einen Herzinfarkt oder eine Panikattacke erleiden, ersticken oder sich blamieren, mehr als zwei Drittel fürchteten sich vor dem Anblick, dem Geruch und dem Geräusch des Erbrechens und ein Zwanzigstel fürchtete sich vor dem Geschmack des Erbrochenen.
Emetophobe ekeln sich in der Regel schneller als andere. Das führt dazu, dass sie besonders genau auf Veränderungen in ihrem Verdauungssystem achten und so wahrscheinlich eher Gefahr laufen, solche inneren Vorgänge falsch zu interpretieren und ihre Empfindungen als Anzeichen für drohende Gefahr einzuordnen. Vielen ist beinahe täglich übel. Die Betroffenen vermeiden Essengehen (besonders Buffets oder Salattheken) und misstrauen bestimmtem Essen (beispielsweise Muscheln, Eiern, unbekannten Gerichten). Um dem Erbrechen vorzubeugen, kann es passieren, dass sie mehrmals das Verfallsdatum von Speisen kontrollieren, Gemüse und Obst wiederholt waschen und strikten Essensplänen folgen.
Bei einer britischen Studie aus dem Jahr 2013 wurden Menschen mit Emetophobie nach ihren genauen Erinnerungen in Bezug auf Erbrechen gefragt. Viele erinnerten sich, dass andere mit Ärger, Hohn oder Ekel reagiert hatten: »Mein Vater wurde wütend und schrie«; »Meine Schwester und ein anderes Kind lachten mich aus«; »Reaktionen von Verwandten – der reine Horror«. Bei einigen hatte das Übergeben große Angst ausgelöst: »Ich bin danach zusammengebrochen«; »Ich dachte, ich müsste sterben«. Wieder andere verbanden Erbrechen mit einem schlimmen Erlebnis: »Ich war bestürzt, als ich von der Krebserkrankung meines Bruders erfuhr, er war noch ein Teenager.«; »Meine Großmutter nahm mich zum Geschäft meines Vaters mit, als wir ankamen, war eines der Fenster eingeschlagen, in der Nacht zuvor hatte es einen erfolglosen Brandanschlag gegeben.« Viele der Befragten konnten sich auch daran erinnern, dass sie andere Personen gesehen hatten, die sich übergaben – unter Emetophoben erinnerten sich 87 Prozent an ein solches Ereignis, während sich nur 23 Prozent einer Kontrollgruppe an entsprechende Erlebnisse erinnerten. Ob diese Erinnerungen den Betroffenen aufgrund ihrer Phobie im Gedächtnis geblieben waren oder ob sie die Phobie direkt ausgelöst hatten, konnte nicht festgestellt werden.
Emetophobie lässt sich nur schwer behandeln. Es kann helfen, die Betroffenen schrittweise mit angstbehafteten Bildern und Situationen zu konfrontieren, allerdings stellte eine Studie von 2001 fest, dass nur sechs Prozent der Emetophoben bereit seien, sich einem solchen Prozess zu unterziehen. 2012 berichtete Ad de Jongh an der Universiteit van Amsterdam von einer emetophoben Patientin – Debbie –, die er mithilfe von EMDR-Therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) behandelt hatte. EMDR wird als Technik bereits seit 1987 bei der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt. Dabei soll durch Augenbewegungen eine Desensibilisierung und Aufarbeitung erreicht werden. Die Patienten sollen eine belastende Erinnerung aufrufen, während sie bilateral stimuliert werden. Sie konzentrieren sich also während des Erinnerns auf einen äußeren Ton oder eine Bewegung, das kann beispielsweise das rhythmische Hin-und-Her-Bewegen der Finger des Therapeuten sein. Dahinter steht die Überlegung, dass die Patienten ihre kognitiven Kapazitäten auslasten, wenn sie sich während des Erinnerns auf einen ablenkenden Reiz konzentrieren. Dadurch büßen die Erinnerungen ihre emotionale Kraft ein, sie werden weniger lebhaft. Schlimme Erinnerungen werden in diesem Prozess reorganisiert und können sich dadurch sogar verändern.
Bei Debbie handelte es sich um eine 46-jährige Büroangestellte, die seit sie denken konnte unter Emetophobie litt. Ihre Angst ließ sie Krankenhäuser, Fernsehfilme, Reisen und noch vieles mehr meiden. »Ihre Welt war deutlich kleiner geworden«, schrieb de Jongh.
Als sie nach Kindheitserinnerungen in Bezug auf Erbrechen gefragt wurde, erinnerte sich Debbie, dass sie im Kindergarten erlebt hatte, wie sich ein anderes Kind auf einen Tisch erbrach. De Jongh bat sie, während der EMDR-Sitzung an diese Erinnerung zu denken. Debbie setzte also Kopfhörer auf und konzentrierte sich auf die Klicks, die von einem Ohr zum anderen wechselten, während sie den schrecklichen Schlamassel auf dem Kindergartentisch beschrieb. »Das löste in Debbie einen intensiven Gedankenstrom aus. Als ihr klar wurde, wie viel sie verpasst hatte, weil sie als Kind so ängstlich gewesen war, brach sie plötzlich in Tränen aus«, berichtete de Jongh.
Während des nächsten Durchgangs berichtete Debbie, dass sich ihre Erinnerung an den bespritzten Tisch veränderte, ihr innerer Blick weitete sich und ließ von den Details ab. Nach einer weiteren Wiederholung wirkte sie wesentlich ruhiger und meinte: »Das Bild, das ich in meinem Kopf davon hatte, scheint zu verschwinden.« Sie erinnerte sich an andere Einzelheiten, ganz so, als würde sie aus der Szene herauszoomen, die bei ihr für so viel Leid gesorgt hatte: Sie erinnerte sich nun an einige Gläser, die sie gern mit Leim gefüllt hatte, und an das liebe Lächeln der Erzieherin. Dann überkam sie eine neue Erinnerung, diesmal war es ihr Bruder, der sich in der Küche übergab, während sie auf ihn aufpasste. Ihr Vater war heimgekommen, hatte alles geputzt und war dann wieder gegangen. Debbie fühlte sich alleingelassen: »Niemand hat meine Angst bemerkt«, meinte sie. »Nicht gehört, nicht gesehen. Ich bin gar nicht da.«
Während der folgenden drei Sitzungen erinnerte sich Debbie an weitere Situationen, in denen sie mit Erbrochenem konfrontiert worden war. Jede ihrer Erinnerungen schien durch die EDMR-Techniken abgeschwächt zu werden. In der letzten Sitzung berichtete sie de Jongh, dass sie es mittlerweile ertragen konnte, wenn sie ihren Mann würgen hörte, und dass sie bald eine Busreise machen wollte – bis vor Kurzem hätte sie allein die Vorstellung in Angst und Schrecken versetzt. Mittlerweile stand sie auch auf der Arbeit mehr für sich ein, erzählte sie. Es schien ganz so, als ob sie selbstbewusster geworden sei, seit sie den Mut gehabt hatte, sich ihren Ängsten zu stellen. Die Behandlung wurde erfolgreich beendet.
Drei Jahre später schrieb de Jongh Debbie eine Mail, um sich zu erkundigen, wie es ihr ging. »Ich mag es nach wie vor nicht, wenn ich jemanden brechen sehe, aber die schlimme Panik bleibt aus«, schrieb sie zurück. Außerdem erzählte sie, dass sie ihre Arbeit gewechselt habe, sie arbeitete nun für einen Bestatter. Dort musste sie oft die Verstorbenen waschen. »Sie sind nicht immer frisch und oft läuft ihnen etwas aus dem Mund«, berichtete sie. Zwar schien sie sich nicht so recht überwinden zu können, das Wort »Erbrochenes« zu verwenden, aber sie konnte offensichtlich mit allem umgehen, was da über die Lippen der Leichen kam. »Ich bin richtig von mir selbst beeindruckt, dass ich das kann!«, schrieb sie, verständlicherweise stolz darauf, wie weit sie es gebracht hatte.
• Siehe auch: Aerophobie, Agoraphobie, Mysophobie, Osmophobie, Pnigophobie, Tokophobie
Salvador Dalí litt unter einer so starken Form von Entomophobie – vom griechischen entoma – Insekten(2) – dass er behauptete, er fürchte manche Insekten mehr als den Tod. »Stünde ich am Rande eines Abgrunds und mir flöge ein großer Grashüpfer ins Gesicht, würde ich mich eher hinunterstürzen, als dieses ›Ding‹ auf mir zu ertragen«, sagte er 1942. Die Schauspielerin Scarlett Johansson gestand 2008 einem Journalisten, sie habe schreckliche Angst vor Kakerlaken, seit sie als Kind davon aufgewacht sei, dass ihr eine übers Gesicht krabbelte. Auch Dalí konnte seine Angst auf ein Erlebnis in seiner Kindheit zurückführen. Als er noch ein Junge war, zerquetschte eine seiner Cousinen einen Grashüpfer unter seinem Hemdkragen: »Obwohl ihm die Eingeweide herausquollen und eine widerliche Flüssigkeit ihn ganz klebrig machte, bewegte er sich immer noch, halb zerquetscht, zwischen meinem Kragen und meinem Fleisch und seine stacheligen Beine klammerten sich an meinem Hals fest.«
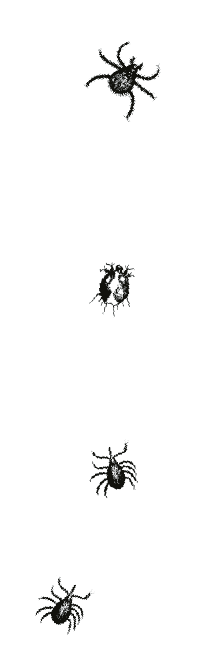
Der englische Arzt Millais Culpin war davon überzeugt, dass die Aversion gegenüber Insekten zu den konditionierten Ängsten gehörte, anerzogen durch verstörende Erfahrungen. 1922 beschrieb er im Lancet die Behandlung eines Veteranen, Träger einer Tapferkeitsmedaille, der während des Ersten Weltkriegs eine Phobie gegenüber Fliegen und Bienen entwickelt hatte. Bevor der ehemalige Soldat das Behandlungszimmer betrat, hatte Culpin das Fenster geschlossen und absichtlich eine Biene im Raum eingesperrt. »Als das Insekt gegen das Fenster flog und daran entlang summte, kauerte sich der Patient, der im Feld großen Mut bewiesen hatte, in seinem Stuhl zusammen, ihm brach vor Angst der Schweiß aus. Sein Zustand war so bemitleidenswert, dass ich sofort das Fenster öffnete. Sein Vertrauen erlangte ich erst wieder, nachdem ich ihm überzeugend versichert hatte, dass ich seine Angst unterschätzt hatte.« Culpin führte die Angst des Mannes vor Bienen auf unterdrückte Erinnerungen an das Brummen deutscher Flieger über den Schützengräben an der Front zurück.
Die Entomophobie könnte auch evolutionäre Ursachen haben: Maden werden mit Verwesung in Verbindung gebracht, Kakerlaken und Zecken übertragen Krankheiten, Schnecken und Würmer erinnern an schleimigen Auswurf und Exkremente. Wir schrecken vor diesen Kreaturen zurück, um uns selbst vor infektiösen, giftigen und verwesenden Dingen zu schützen. Wenn wir uns abwenden, dann typischerweise mit einer klassischen Geste des Ekels: Wir verziehen die Oberlippe, unsere Brauen bewegen sich aufeinander zu, wir rümpfen unsere Nase und strecken die Zunge aus dem Mund. Diese Reaktion ist Teil unseres »Verhaltensimmunsystems«, das unseren Körper vor Krankheitserregern schützen will. Bei denjenigen, die sich besonders schnell ekeln, können auch Insekten, die normalerweise keine Gefahr für unsere Gesundheit darstellen, zum Beispiel Käfer oder Grillen, Ängste vor einer Infektion auslösen.
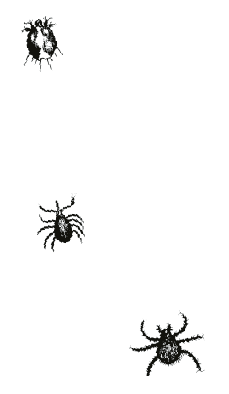
Der aus Budapest stammende Philosoph Aurel Kolnai ging davon aus, dass Entomophobie teilweise auf existenziellen Bedrohungen basiert. In seinem Artikel Der Ekel (1929) schreibt er von einer »ruhelosen, nervösen, sich windenden, zuckenden Vitalität«, die von schwärmenden Insekten ausgeht, sinnloses und formloses Wogen, in dem ein unaufhörliches, richtungsloses Sprießen und Vermehren stattfindet. Kolnai sprach davon, dass uns die gedankenlose Fruchtbarkeit von Insekten abstößt: Sie scheinen immer auch den Tod in sich zu tragen, in ihnen pulsieren Wiederherstellung und Verfall zugleich. Wir fürchten uns nicht nur davor, dass sie unseren Körper befallen, sondern auch, dass sie unsere symbolischen Grenzen zur Natur aufheben könnten. Sie führen uns unsere eigene Endlichkeit vor Augen und zeigen uns unsere abstoßenden Seiten. Ähnlich argumentierten 2006 auch Mick Smith und Joyce Davidson: Wir fühlen uns von Insekten bedroht, »nicht weil sie für uns eine physische Gefahr darstellen (evolutionärer Naturalismus), auch nicht, weil wir sie mit den infektiösen Eigenschaften von menschlichen Ausscheidungen in Verbindung bringen (psychoanalytischer Naturalismus), sondern weil sie uns auf die Natur an sich hinweisen, sie überschreiten grundlegend die symbolische Ordnung, die unserer modernen Gesellschaft und unserer Identität zugrunde liegt.«
Smith und Davidson gehen davon aus, dass die phobischen Objekte, die sich eine Gesellschaft aussucht, etwas über ihre kollektiven Bedürfnisse und Albträume aussagt. Vielleicht fürchten wir uns vor bestimmten Lebewesen, weil sie unseren Anspruch, die Natur zu beherrschen, infrage stellen. »Diese Phobien decken möglicherweise ein ernsthaftes Problem in der kulturellen Logik unserer Moderne auf. Wir denken, dass wir die Natur unterdrückt und überwunden hätten, allerdings droht sie auf vielfältige, unkontrollierbare Weise wieder zurückzukommen.« Nach Smith und Davidson bricht sich in der Entomophobie unser Unbehagen darüber Bahn, wie wir die Natur bisher behandelt haben.
Einige Forscher gehen davon aus, dass wir uns insgeheim zu den Kreaturen hingezogen fühlen, vor denen wir uns ekeln. Kolnai meint, unsere Abneigung gegenüber einem ekligen Objekt liege darin begründet, dass im Ekel ein Schatten des Verlangens zurückbliebe, sich mit eben diesem Objekt vereinigen zu wollen. Culpin stellte fest: »Angst und Verlangen, Phobie und Obsession sind zwei Seiten derselben Medaille.« Der Entomologe Jeffrey A. Lockwood spricht davon, dass die physiologischen Aspekte von Schrecken – schweres Atmen, erhöhter Puls – denen von sexueller Erregung gleichen, beispielsweise fänden es manche Menschen aufregend, Ameisen oder Spinnen im erotischen Vorspiel einzusetzen.
William Ian Miller schreibt in seinem Buch The Anatomy of Disgust (1997), Ekel verweise auf unsere »unbewussten Sehnsüchte, Faszinationen, die wir uns kaum selbst eingestehen können, oder unsere klammheimliche Neugier«. Ekel ist seiner Meinung nach engstens mit unseren Sinnen verbunden: »Es geht darum, wie sich die Berührung von etwas Bestimmtem anfühlt, was wir empfinden, wenn wir es sehen, schmecken, riechen, manchmal sogar hören.« Ausgelöst wird der Ekel zum Beispiel vom Rascheln und Zischen einer Kakerlake, dem schmatzenden Geräusch einer Schnecke, dem federleichten Kitzeln von Ameisenbeinen auf unserer Haut oder den pudrigen Flügeln einer Motte.
2002 bewilligte das amerikanische Justizministerium der CIA den Einsatz von Insekten bei der Befragung des Gefangenen Abu Zubaydah. Der in Saudi-Arabien geborene Palästinenser litt unter Entomophobie und weigerte sich, über seine Verbindungen zu Al-Qaida auszusagen. Die CIA verhörte Zubaydah an verschiedenen geheimen Orten in Thailand, Polen und Litauen, wobei sie »erweiterte Verhörmethoden« anwandte, eine Art Sammelbegriff für Waterboarding, Schlafentzug, Schläge, Lärm, extreme Temperaturen und eben den Einsatz von Insekten. Sie sperrten den Gefangenen zunächst mit einer Raupe in eine sargartige »confinement box«, später wiederholten sie das »Verhör« mit einem ganzen Schwarm Kakerlaken, alles mit dem Ziel, dem Mann in seiner Verzweiflung Geheimnisse abzupressen. Es existieren widersprüchliche Aussagen darüber, ob diese Methoden erfolgreich waren. Da die CIA 2005 die relevanten Videoaufnahmen zerstörte, lassen sie sich nicht überprüfen. Zubaydah wurde nie offiziell angeklagt, dennoch verlegte man ihn 2006 nach Guantanamo, wo er auch jetzt noch, 17 Jahre später, festgehalten wird.
• Siehe auch: Akarophobie, Arachnophobie, Trypophobie, Zoophobie
Ergophobie, die Angst vor der Arbeit(1) (auf Griechisch ergon), wurde 1905 von dem Chirurgen William Dunnet Spanton aus Staffordshire im British Medical Journal beschrieben. Er führte diese neue Erscheinung auf den »Workmen’s Compensation Act« zurück, ein Gesetz von 1897, wonach Arbeitgeber ihren Arbeitern weiterhin Lohn zahlen mussten, wenn diese wegen eines Unfalls am Arbeitsplatz ausfielen. Spanton beschrieb den Ergophoben als jemanden, der nichts lieber tat, als zu rauchen, Fußball zu schauen und bis spätnachts unterwegs zu sein; er bleibe über Wochen der Arbeit fern, obwohl er nur eine geringfügige Verletzung habe, zum Beispiel einen zerquetschten Finger. Die Zeitungen verstanden sofort, was Spanton andeutete: Die Baltimore Sun sprach von Ergophobie als neuem »Begriff für Faulheit«. Die Londoner Zeitung The Bystander veröffentlichte im Juni dazu sogar ein Gedicht:
You feel a bit tired in the morning,
You’ve a disinclination to rise,
And the knock on your door is a bit of a bore,
For you really can’t open your eyes …
You feel that you’re fitted for nothing
But to lie on the flat of your back;
If your symptoms are these, then you’ve got a disease,
You’re an Ergophobiac.
Der Morgen fühlt sich ein wenig müde an
Der Gedanke ans Aufstehen macht dich benommen,
Und das Klopfen an der Tür, langweilt dich über Gebühr,
Denn deine Augen kannst du wirklich nicht aufbekommen …
Du fühlst dich nutzlos, kannst nichts meistern,
Nur flach liegen kann dich begeistern;
Hast du solche Symptome, stellt dich eine Krankheit auf die Probe,
Denn du bist ein Ergophobe.
• Siehe auch: Gebomanie, Siderodromophobie
Erotomanie (abgeleitet vom griechischen Wort eros, leidenschaftliche Liebe) bezeichnete ursprünglich die wahnsinnige Verzweiflung, die unerwiderte Liebe mit sich bringen kann. Im 18. Jahrhundert verwendete man den Terminus für ein übertriebenes sexuelles Verlangen und mittlerweile für die Wahnvorstellung(1), eine andere Person sei insgeheim in einen verliebt. Dieser Zustand wird auch als Clérambault-Syndrom bezeichnet – benannt nach dem französischen Psychiater Gatian de Clérambault, der diesen 1921 erstmals beschrieb. Grundlage dafür war der Fall der 53-jährigen Hutmacherin Léa-Anna B. aus Paris, die überzeugt war, dass George V. sich in sie verliebt hatte. Auf ihren zahlreichen Reisen nach London stand sie stundenlang an den Toren des Buckingham Palace und wartete darauf, dass der König ihr mithilfe seiner Vorhänge Signale sandte.
Clérambault führte aus, dass die berauschenden Anfänge einer erotomanischen Fixierung oft in Phasen der Frustration und Verbitterung umschlugen. Er stellte drei Phasen des Syndroms fest: Hoffnung, Verdruss, Groll. Frauen sollen häufiger unter dieser Manie leiden als Männer, wobei der Zustand bei Männern eher in Gewalt umschlägt – entweder gegen die geliebte Person oder gegen jemanden, der der Liebe im Weg zu stehen scheint. Dementsprechend tauchen männliche Erotomanen häufiger in Polizeiakten oder psychiatrischen Patientenkarteien auf, weswegen ihre Geschichten eher erzählt werden.
Im Jahr 1838 berichtete Jean-Étienne Esquirol von einem Patienten, der unter dieser »krankhaften Einbildung« litt. Es handelte sich um einen kleinen schwarzhaarigen Büroangestellten von 36 Jahren, der im Süden Frankreichs lebte. Bei einem Besuch in Paris überkam ihn eine große Leidenschaft für eine Schauspielerin. Bei jedem Wetter stand er vor ihrem Haus, lungerte am Hintereingang ihres Theaters herum und verfolgte sie, wenn sie mit einer Kutsche unterwegs war. Einmal kletterte er sogar auf das Dach einer Droschke, um durch ein Fenster einen Blick auf sie zu erhaschen. Der Ehemann der Schauspielerin und ihre Freunde setzten alles daran, ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen – sie »behandeln diesen Unglücklichen schimpflich«, schrieb Esquirol, »sie stoßen ihn zurück, beleidigen und misshandeln ihn.« Der Angestellte zeigte sich von alledem unbeirrt. Er war überzeugt, dass man seine Angebetete davon abhielt, ihre wahren Gefühle für ihn zu zeigen. »Jedesmal wenn Mad. spielt, geht er ins Theater, nimmt der Bühne gegenüber Platz, und erscheint die Schauspielerin, so zeigt er ein weisses Schnupftuch, um sich bemerkbar zu machen.« Sie sehe ihn dann immer mit geröteten Wangen und glänzenden Augen an, behauptete der Angestellte.
Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit dem Ehemann der Frau wies man den Verliebten in eine Krankenanstalt ein, wo Esquirol ihn befragte. Dem Psychiater erschien der Mann im Großen und Ganzen rational zugänglich, weshalb er versuchte, ganz offen mit ihm über die Schauspielerin zu sprechen.
»›Wie können Sie wohl glauben, dass Sie geliebt werden. Sie haben nichts Verführerisches, besonders für eine Schauspielerin, Ihre Figur ist nicht hübsch, Sie haben keinen ausgezeichneten Rang in der Welt, und sind ohne Vermögen.‹ – ›Das ist Alles wahr, aber die Liebe vernünftelt nicht, und man hat mir zu gut gezeigt, dass ich geliebt werde, als dass ich daran zweifeln könnte.‹«
Im London der 1850er Jahre brachte es ein Fall von weiblicher Erotomanie sogar vor das damals noch neue englische Scheidungsgericht. Ein wohlhabender Ingenieur namens Henry Robinson beantragte im Sommer 1858 die Auflösung seiner Ehe; als Beweis legte er die Tagebücher seiner Frau Isabella vor, in denen sie eine Affäre mit dem bekannten Arzt Dr. Edward Lane niedergeschrieben hatte. Mrs. Robinsons Anwälte gaben an, ihre Mandantin leide unter Erotomanie: Sie sei dem Irrglauben erlegen, Dr. Lane sei in sie verliebt, doch ihre Tagebucheinträge seien reine Phantasterei. Isabella Robinson gewann den Prozess gegen ihren Ehemann, allerdings lassen ihre privaten Korrespondenzen vermuten, dass sie alles nur inszeniert hatte, um den Ruf des jungen Arztes zu retten. Sie hatte die Erotomanin gemimt, um ihren Liebhaber zu schützen.
Manchmal entwickeln Erotomanen gleich mehrere Fixierungen. Im Jahr 2020 umriss ein Team portugiesischer Psychiater den Fall von Mr. X. Dieser war 51 Jahre alt, arbeitslos und lebte mit seiner verwitweten Mutter zusammen in einem kleinen Dorf im Süden Portugals. Mr. X. gelangte zu der Überzeugung, dass eine verheiratete Frau, die oft sein Stammcafé besuchte (Frau A.), sich in ihn verliebt hatte: Er meinte, dass sie ihm Zeichen gab und ihn sehnsuchtsvoll anstarrte. Als er begann, ihr überallhin zu folgen, wurde er ihr so lästig, dass sie ihn tätlich angriff. Diesen Vorfall erklärte sich Mr. X. wie folgt: Die Besitzerin des Cafés (Frau B.) war ebenfalls in ihn verliebt und hatte ihn aus Eifersucht bei Frau A. schlechtgemacht. Mr. X. ärgerte sich über Frau A., weil sie Frau B. geglaubt hatte und aus seiner Sicht nicht genug Mumm hatte, um ihren Mann zu verlassen.

Bald darauf erkrankte die Mutter von Mr. X. und musste in ein Pflegeheim eingewiesen werden. Währenddessen kam Mr. X. zu dem Schluss, dass auch Frau C., ebenfalls Stammgast im Café, sich in ihn verliebt hatte. Sie wies seine Avancen ab, allerdings nur, so seine Überzeugung, weil sie verheiratet war und sich für ihre Gefühle ihm gegenüber schämte. X. begann Frau C. zu stalken und bezichtigte sie der Hexerei. Sie halte ihn mit Zaubersprüchen vom Schlafen ab und lasse seine Genitalien schrumpfen. Um sie dazu zu bringen, ihre Verwünschungen rückgängig zu machen, bedrohte er sie sogar mit einem Messer. Frau C. zeigte ihn an und Mr. X. wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die ihm dort verschriebenen anti-psychotischen Medikamente sorgten zwar dafür, dass sein Verfolgungswahn verschwand, allerdings glaubte er nach wie vor, dass ihm alle drei Frauen verfallen seien, außerdem blieb er seiner ersten Liebe, Frau A., treu.
Erotomane schaffen sich ihre eigene Welt. In Ian McEwans Roman Liebeswahn (1997) ist der erotomanische Anti-Held davon überzeugt, dass der Protagonist heimlich in ihn verliebt ist. Überall, wo er hinschaut, findet er geheime Zeichen dieser Leidenschaft. »Seine Welt wurde von seinem Inneren bestimmt«, schreibt McEwan, »von privater Notwendigkeit […]. Er erhellte die Welt mit seinen Gefühlen, und die Welt bestätigte ihn in jeder Wendung, die seine Gefühle nahmen.«
• Siehe auch: Egomanie, Megalomanie, Monomanie, Nymphomanie
Erythrophobie beschrieb im späten 19. Jahrhundert eine krankhafte Intoleranz gegenüber roten Dingen (erythros heißt auf Griechisch rot). Ärzten war aufgefallen, dass einige Patienten, denen man chirurgisch Katarakte entfernt hatte, eine Aversion gegenüber dieser Farbe entwickelten. Seit dem frühen 20. Jahrhundert wird der Begriff für eine pathologische Angst vor dem Erröten(1) verwendet.
Bei der Erythrophobie handelt es sich um ein selbsterfüllendes Syndrom, denn sie löst genau die körperliche Reaktion aus, vor der sich der Betroffene fürchtet. Das Gefühl, dass man gleich rot werden wird, ruft das Erröten erst hervor; während die Haut heiß wird, nimmt auch die Scham zu, die Hitze verstärkt sich und breitet sich immer weiter aus. Dieses Leiden kann extrem belastend sein. Der deutsche Arzt Johann Ludwig Casper beschrieb 1846 den Fall eines jungen Patienten, der im Alter von 13 Jahren begonnen hatte, unkontrolliert zu erröten; mit 21 litt er so sehr unter seiner Angst, dass er sogar seinen besten Freund mied. Im selben Jahr nahm er sich das Leben.
Menschen werden rot, wenn sie das Gefühl haben, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, sei es nun aufgrund von Bewunderung, Hohn oder Tadel. Wenn andere sie auf ihr Erröten hinweisen, glüht ihre Haut nur noch stärker. Die Rötung zeigt sich dort, wo die Venen dicht unter der Haut liegen – auf den Wangen und der Stirn, den Ohren, im Nacken und im oberen Bereich des Oberkörpers. Bei blassen Menschen ist das Phänomen besonders gut sichtbar, weswegen diese Gruppe auch eher zur Erythrophobie neigt.
»Erröten ist die eigentümlichste und menschlichste aller Ausdrucksformen«, schrieb Charles Darwin 1872. »Es sind dies Schüchternheit, Scham und Bescheidenheit, deren wesentlichen Bestandteil die Selbstbeobachtung bildet. […] Nicht das einfache Nachdenken über unsere Erscheinung, sondern der Gedanke, was andere von uns denken, ruft ein Erröten hervor.« In der Literatur kann das Rotwerden die versteckten Gefühle einer Figur verraten. Der literarische Essayist Mark Axelrod zählte in Leo Tolstois Anna Karenina (1878) insgesamt 66 Fälle von Erröten. Anna wird immer wieder rot, wenn sie den Namen ihres geliebten Vronsky hört. Wenn sie mit ihrer Freundin Kitty spricht, werden die beiden abwechselnd rot, ganz so als würden in ihnen Scham, Unterwerfung, Sittsamkeit und Lust immer wieder wie ein Leuchtfeuer aufblitzen. Der reiche Großgrundbesitzer Konstantin Levin errötet, als man ihm zu seinem schicken neuen Anzug beglückwünscht, »doch er errötete nicht so, wie die erwachsenen Leute, also flüchtig, und ohne daß man selbst davon Notiz nimmt, sondern so wie Knaben erröten, welche fühlen, daß sie in ihrer Befangenheit lächerlich werden, und die infolge davon mehr und mehr Scham empfinden, röter und röter werden, und fast in Thränen ausbrechen.« Ihm ist sein Erröten so unangenehm, dass er rot wird. Der Psychiater Pierre Janet meinte 1921: »Die Angst vor dem Erröten ist, ganz so wie die Angst, eine Deformität aufzuweisen oder sich selbst der Lächerlichkeit preiszugeben, eine Form von pathologischer Schüchternheit. Ihr liegt die Angst davor zugrunde, sich zeigen, mit anderen sprechen, sich der Wertung anderer aussetzen zu müssen.« Wir erröten auch dann, wenn wir allein sind oder wenn ein Gespräch das streift, was uns persönlich beschäftigt, wenn beispielsweise der Name der Person fällt, zu der wir uns heimlich hingezogen fühlen. Diese Reaktion rührt vielleicht von unserer Sorge her, jemand könnte unser Geheimnis erraten. Freudianer würden genau das Gegenteil annehmen, nämlich dass wir uns heimlich wünschen, man möge unser Geheimnis entdecken und dass wir deswegen rot werden. Der österreichisch-amerikanische Psychoanalytiker Edmund Bergler schrieb 1944 dazu: »Durch das Erröten tritt der Erythrophobe klar in Erscheinung.« Bergler ging davon aus, dass der Wunsch, von anderen bemerkt zu werden, in Erythrophoben so stark verdrängt wird, dass er sich unterbewusst Bahn bricht und die Betroffenen durch eine körperliche Reaktion ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.
Biologen zerbrechen sich schon lang den Kopf über den evolutionären Sinn des Errötens. Einige gehen davon aus, dass diese ungewollte Reaktion, die schlecht gemimt werden kann, eine soziale Funktion erfüllt: Sie zeigt, dass eine Person fähig ist, sich zu schämen, und dass sie sich wünscht, Teil der Gruppe zu sein; damit beugt das Erröten Täuschungen vor und hilft beim Aufbau von Vertrauen. 1914 behauptete Granville Stanley Hall, dass Erröten immer aus Angst geschehe: »Genereller Auslöser scheint eine plötzliche Änderung, real oder angenommen, darin zu sein, wie andere uns wahrnehmen. Ein zu freimütiges Kompliment, der Gedanke, dass wir etwas preisgegeben haben, was wir lieber verborgen hätten, und uns dadurch Kritik oder Tadel droht.« Er stellte fest, dass Frauen weit öfter erröten als Männer und dass männliche Aufmerksamkeit einen regelrechten »Sturm an Schamesröte« auslösen konnte. »Seit Ewigkeiten war das Anstarren durch einen Mann für Frauen ein Vorbote von Gewalt«, fügte er hinzu. »Selbst wenn es ein Kompliment ist, das die Röte ins Gesicht treibt, hängt das wahrscheinlich mit der Tatsache zusammen, dass Verehrung früher mit Gefahr assoziiert wurde.«
Viele Betroffene leiden unter weiteren sozialen Phobien. Entweder erröten sie, weil sie krankhaft schüchtern sind oder aber sie fürchten sich vor sozialer Interaktion, weil sie schnell erröten. Der chilenische Psychiater Enrique Jadresic war sich sicher, dass sein Rotwerden physiologische Gründe hatte. Er ging davon aus, dass Menschen, die chronisch erröten, ein überaktives sympathisches Nervensystem haben, weswegen Brust und Gesicht so schnell die Farbe ändern können. Als Professor an der Universität war es ihm extrem unangenehm, wenn er unvorbereitet Kollegen oder Studenten traf und dabei rot wurde. »Da werden Sie schon wieder so rot wie eine Tomate, Doktor«, witzelte eine Frau in seiner Abteilung.
Irgendwann war Jadresic es leid, immerzu Situationen zu meiden, in denen er rot werden könnte. Nachdem er verschiedene Behandlungsmöglichkeiten ausprobiert hatte, sowohl Psychotherapie als auch Medikamente, beschloss er, sich den Nerv kappen zu lassen, der für das Erröten zuständig ist. Dieser zieht sich vom Bauchnabel bis zum Nacken, ist auch für die Schweißproduktion verantwortlich und über die Achsel zugänglich. Viele, die sich einer solchen Operation unterziehen, leiden später unter Schmerzen in der Brust und im oberen Rücken, außerdem gleicht ihr Körper die verminderte Schweißproduktion im Bereich des Oberkörpers an anderen Stellen aus. Obwohl Jadresic anschließend unter einigen dieser Nebenwirkungen litt, war er überglücklich, dass ihn keine Schamesröte mehr überkommen konnte.
2001 berichtete das Journal of Abnormal Psychology von einem Experiment, bei dem sich herausstellte, dass Erythrophobe nicht häufiger rot werden als andere. Die Forscher rekrutierten für ihr Experiment 44 Probanden – 15 sozial phobische Menschen mit Angst vor dem Rotwerden, 15 sozial phobische Menschen ohne eine solche Angst und 14 Personen ohne soziale Phobie. Unter den erythrophobischen Probanden befand sich eine Anwältin, die ihren Beruf aufgeben musste, weil sie im Gerichtssaal so oft errötete. Die Forscher stellten allen Teilnehmenden drei Aufgaben. Sie mussten ein peinliches Video von sich selbst anschauen, bei dem sie ein Kinderlied sangen, fünf Minuten lang mit einem Fremden sprechen und einen kurzen Vortrag halten. Während der Aufgaben maß eine Infrarotsonde die Intensität des Errötens und ein EKG zeichnete die zugehörigen Herzströme auf.

Überrascht mussten die Forscher feststellen, dass die erythrophoben Probanden weder intensiver noch häufiger erröteten als die sozial phobischen Teilnehmer oder die Mitglieder der Kontrollgruppe. Während der Gesprächs-Aufgabe erröteten die Kontrollprobanden beispielsweise genauso oft wie alle anderen, nahmen dies aber gar nicht wahr. Sie hatten überhaupt nicht bemerkt, wie ihre Haut sich rot färbte. Die Gruppe der Erythrophobiker verzeichnete während der Tests einen höheren Puls. Daraufhin fragten sich die Forscher, ob sozial phobischen Personen, wenn sie an sich einen schnelleren Herzschlag feststellten, umgehend auch andere körperliche Vorgänge wahrnahmen, besonders solche – wie Schwitzen und Erröten – von denen sie dachten, dass andere sie besonders leicht sehen können. Sie waren vielleicht so besorgt, dass man ihre Angst erkennen könnte, dass sie ihr Herzklopfen mit dem schnellen Aufheizen der Haut verwechselten.
• Siehe auch: Agoraphobie, Gelotophobie, Glossophobie, Urinophobie, Soziale Phobie