
Der Begriff Megalomanie – nach dem griechischen Wort mega, groß – wird häufig mit Machtgier(1) oder dem Wunsch nach vollständiger Kontrolle gleichgesetzt, doch wurde er im Jahr 1866 in Frankreich geprägt, um geisteskranken Größenwahn(1) zu beschreiben. Wahnvorstellungen kommen bei Psychosen häufig vor. Die Hälfte der Menschen, die unter Schizophrenie leiden, erleben sie, ebenso zwei Drittel aller bipolar Erkrankten, oft in Zusammenhang mit einem manischen Zustand von Hyperaktivität, Euphorie, Rededrang, rasenden Gedanken und plötzlichen Stimmungsschwankungen.
Während eines Familienurlaubs in Innsbruck im Jahr 2018 war der britische Autor Horatio Clare mit einem Mal überzeugt, er sei ein in eine internationale Spionageaffäre zur Rettung der Welt verwickelter MI6-Agent mit dem Auftrag, den Popstar Kylie Minogue zu heiraten. »Wahnsinn dieser Art ist wie ein Sonnenaufgang des eigenen Ich«, schreibt Clare in Heavy Light (2020), »eine Flut von Licht, das die Schatten des Relativen, der Perspektive vertreibt […] Ich fühle mich durchdrungen von diesem Licht, das sich anfühlt wie Erkenntnis und Macht und Bedeutung; ein Licht, das greifbar erscheint und, gemessen daran, wie sie mich ansehen, beinahe auch für andere sichtbar […] Es ist berauschend, und es ist anstrengend.«
Im 19. Jahrhundert hielten sich Menschen mit dieser Form der Manie für Gestalten wie Napoleon, Johanna von Orleans oder Jesus Christus. 2005 erzählte ein britischer Megalomane Forschern, er sei ein Vetter des damaligen Premierministers Tony Blair, während ein anderer angab: »Ich bin Gott. Ich habe das Weltall erschaffen, und ich bin ein Sohn von Prinz Philip. Außerdem bin ich ein berühmter DJ. Ich habe Supermann-Kräfte.« Ein Dritter sah sich als naturwissenschaftliches Genie: »Ich spuckte auf eine Glühbirne«, gab er zu Protokoll, »und dachte, wenn ich den Speichel brennen sähe, die verschiedenen Farben und Formen, könnte ich das Heilmittel gegen Krebs finden.« Ganz vereinzelt artet Megalomanie auch in Gewalt aus. Der Millionär und Philanthrop John du Pont, der 1996 seinen Freund Dave Schultz tötete, hielt sich abwechselnd für den Dalai Lama, einen CIA-Agenten und den letzten russischen Zaren.
• Siehe auch: Egomanie, Erotomanie, Mythomanie, Plutomanie
Bis zum Jahr 1899 hat sich der Begriff Mikromanie (abgeleitet vom griechischen Wort mikros, klein) zur Beschreibung einer geistesgestörten Herabsetzung der eigenen Person durchgesetzt. Ursprünglich wurde er jedoch 1879 als Bezeichnung einer Erkrankung eingeführt, bei der Menschen glaubten, sie – oder ein Teil von ihnen – seien geschrumpft. Der französische Präsident Paul Deschanel wollte sich ab 1920 partout nicht mehr im Freien sehen lassen, weil er überzeugt war, dass sein Kopf auf die Größe einer Apfelsine eingelaufen war.
In Lewis Carrolls Roman Alice im Wunderland von 1865 scheint Alice zu schrumpfen(1), nachdem sie aus einer Flasche mit der Aufschrift »Trinke mich« getrunken hat. »Ich gehe gewiss zu wie ein Teleskop«, denkt sie, und schon ist sie nur noch zehn Zoll groß. Sie wächst um ein Vielfaches, als sie an einem Kuchen knabbert, auf dem die Worte »Iss mich« stehen, schrumpft nach einem Bissen von einem Pilz, den die blaue Raupe ihr empfiehlt, aber schlagartig wieder zusammen: »Ihr Kinn war […] dicht an ihren Fuß gerückt.«
Der amerikanische Neurologe Caro Lippman warf die Frage auf, ob Lewis Carrolls Migräneanfälle nicht vielleicht der Ausgangspunkt für seine Schilderungen der schrumpfenden (und sich wieder vergrößernden) Alice gewesen sein könnten. Lippman hatte bei mehreren seiner Patienten durch Migräne verursachte Halluzinationen beobachtet. Eine Frau berichtete, dass sie vor oder während einer schweren Kopfschmerzattacke überzeugt war, nur noch etwa dreißig Zentimeter groß zu sein, und sich nur vom Gegenteil überzeugen konnte, indem sie sich im Spiegel betrachtete.
• Siehe auch: Megalomanie
Edgar Allan Poe war der Erste, der den Begriff Monomanie in der Erzählliteratur verwendete. Der Ich-Erzähler seiner Kurzgeschichte »Berenice« (1835) ist mit einer solchen Monomanie auf die Zähne seiner Verlobten fixiert, dass er sie ihr, nachdem er sie lebendig begraben hat, aus dem Mund bricht. Seine Manie, so erklärt er, packte ihn mit wilder Raserei: »[…] und ich rang vergebens an gegen ihren unerhörten und unwiderstehlichen Einfluss. Unter all den minutiösen Tausendfältigkeiten der Außenwelt fand ich keinen anderen Gedanken, als nur den an ihre Zähne. Nach ihnen verzehrte ich mich in phrenetischem Verlangen.«
Der Psychiater Jean-Étienne Esquirol führte das Wort Monomanie um 1810 ein, um Personen zu kennzeichnen, die von einem einzelnen wahnhaften Zwang besessen sind (im Griechischen bedeutet monos allein, einzig(1)). Ansonsten seien sie absolut vernünftige Menschen, so Esquirol, deren partielle und schwer fassbare Geistesgestörtheit nur für das geschulte Auge erkennbar sein dürfte. Vor Gericht entwickelte sich die Diagnose Monomanie zu einer beliebten Verteidigungsstrategie für alle möglichen Verbrechen. Eine Karikatur von Honoré Daumier im Magazin Le Charivari von 1846 zeigt einen an die Wand seiner Zelle gekauerten Häftling und daneben seinen Anwalt. »Was mir wirklich zu schaffen macht«, sagt der niedergeschlagene Gauner, »ist, dass mir zwölf Raubüberfälle zur Last gelegt werden.« »Zwölf?«, sinniert der Anwalt. »Umso besser. Ich werde auf Monomanie plädieren […]«
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Esquirols Fachterminus in der Presse bereits als billige Ausrede für Brandstiftung, Mord, Diebstahl, Ehebruch und Trunkenheit verhöhnt. Nichtsdestotrotz hatte sich die Vorstellung im öffentlichen Bewusstsein etabliert und wurde häufig in Romanen heraufbeschworen, wie Lindsay Stewart in einer Studie aufzeigt. In Emily Brontës Sturmhöhe (1847) wird Heathcliff eine monomanische Liebe zu Cathy vorgeworfen. In Herman Melvilles Moby-Dick (1851) treibt Kapitän Ahab ein monomanisches Verlangen, sich an einem Wal zu rächen. In Anthony Trollopes He Knew He Was Right (1869) entwickelt der Protagonist Trevelyan eine monomanische Eifersucht auf die Freundschaft seiner Frau mit einem anderen Mann.
Der Verdacht, an Monomanie zu leiden, entwickelte sich zu einer qualvollen Form des Selbstzweifels. In Lady Audley’s Secret (1862) schildert Mary Elizabeth Braddon einen Mann, der davon besessen ist zu beweisen, dass die junge Frau seines Onkels einen Mord begangen hat. »War es eine Mahnung oder Monomanie?«, fragt er sich. »Was, wenn ich mich am Ende doch irre? Was, wenn diese Beweiskette, die ich mir Glied für Glied zusammengestrickt habe, aus meiner eigenen Torheit gestrickt ist? […] Oh, mein Gott, wenn nun das ganze Elend in mir selbst gründet.« Braddon griff bei ihrer Darstellung auf das Leben des echten Scotland-Yard-Inspektors Jack Whicher zurück, der 1860 den Mord an einem dreijährigen Jungen in Wiltshire aufzuklären versuchte. Whicher war so fixiert auf den Fall, dass er einen Nervenzusammenbruch erlitt und 1864 vorzeitig aus dem Polizeidienst ausschied aufgrund der Diagnose »Hirnstau«.
Monomanie ist als Diagnose inzwischen in Misskredit geraten, einerseits, weil sich nur schwer zwischen einer weitgehend normalen fixen Idee und einer pathologischen unterscheiden lässt, und andererseits, weil sich Geisteskrankheiten selten in einzelnen Symptomen manifestieren. Ein paar spezielle Monomanien werden allerdings noch als solche diagnostiziert, zum Beispiel die Kleptomanie und die Pyromanie, die in der Regel als Zwangsstörungen oder als Impulskontrollstörungen eingestuft werden.
Möglicherweise war das Konzept der Monomanie ja deshalb so reizvoll, weil es der klassischen literarischen Vorstellung, eine tragische Charakterschwäche könne den Untergang eines Menschen bedeuten, sozusagen eine medizinische Legitimation verlieh. Stewart rechnet es Esquirol als Verdienst an, dass er mit seiner Wortschöpfung die Psychologie populär machte. »Nachdem sie bis dahin der exklusive Kompetenzbereich von Priestern und Ärzten gewesen war«, schreibt sie, »wurde die seelische Gesundheit Gesprächsthema für jedermann, und, begünstigt durch eine Printkultur mit immer größerer Verbreitung, machte das Schlagwort Monomanie den Weg frei für eine neue Generation von Laien-Psychologen.« Mit der Vorstellung der Monomanie hatte Esquirol die Möglichkeit eröffnet, dass auch Menschen im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte von Verrücktheit angehaucht sein mochten. Mit seinem Begriff ließen sich verzehrende Liebe, zerstörerischer Neid, unbewusster Zwang, pathologisches Grübeln – kurz, die vielen Verrücktheiten der geistig Gesunden – trefflich beschreiben.
• Siehe auch: Bibliomanie, Dämonomanie, Dermatillomanie, Dipsomanie, Erotomanie, Mord-Monomanie, Kleptomanie, Lypemanie, Nymphomanie, Oniomanie, Pyromanie, Trichomanie, Trichotillomanie
Monophobie beziehungsweise die Angst vor dem Alleinsein(1) wurde im Jahr 1880 von George Miller Beard als spezifische Phobie eingestuft. 1897 diagnostizierte Granville Stanley Hall die Erkrankung bei einer Frau, der es zuwider war, allein zu Hause zu sein. Alles erschien ihr düster und furchtbar, so schilderte sie die Situation, in der die Stille in ihrem Bauernhaus nur vom lauten Ticken einer Standuhr unterbrochen wurde. »Es fühlte sich an, als wären alle gestorben. Ich fing an zu singen und machte die ausgefallensten Sachen, beobachtete die Uhr, sah zu, wie es langsam Nacht wurde, mir graute vor den absonderlichsten Unfällen, ich suchte die Gesellschaft der Tiere im Stall und selbst die der Blumen im Garten.«
• Siehe auch: Lypemanie, Nyktophobie, Sedatephobie
Jean-Étienne Esquirol definierte 1810 eine Person, die unter Mord-Monomanie leidet, als sonst geistig gesunden Menschen, den plötzlich ein unwiderstehlicher Drang zu töten(1) überkommt. Esquirols Ausführungen erweiterten die Möglichkeiten, sich vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit zu berufen: Vollkommen rational wirkende Mörder konnten nun vor Gericht behaupten, sie seien einem mörderischen Zwang zum Opfer gefallen, einem spezifischen und oft vorübergehenden Wahnsinn, weswegen sie eher als psychisch Kranke und nicht als Kriminelle verurteilt werden sollten. Wenn ein Mensch von der Mord-Monomanie ergriffen werde, schrieb der Psychiater Isaac Ray 1838, »dann werden seine Fähigkeiten zur Reflektion ausgehebelt, seine Bewegungen sind einzig und allein das Ergebnis von blinden, automatischen Impulsen. Diese Bewegungen sind genauso weit von der Vernunft entfernt wie die Bewegungen eines neugeborenen Säuglings.« Ray fügte hinzu, dass ein Individuum mit einem solchen Leiden nicht dafür bestraft werden sollte, wenn es jemanden töte.

In einem bahnbrechenden Fall sprach ein britisches Gericht 1843 den schottischen Drechsler Daniel M’Naghten von der Anklage des Mordes frei. M’Naghten habe den Beamten Edward Drummond mit dem Premierminister Robert Peel – dessen Privatsekretär er war – verwechselt und ihn in einem Anfall von »Mord-Monomanie« erschossen. M’Naghten wurde nicht gehängt, sondern in das Bethlem Royal Hospital in London eingewiesen, das damals eine Anstalt für psychisch kranke Straftäter war. Die Diagnose rettete ihm zwar das Leben, allerdings verstellte sie auch den Blick auf seine politischen Beweggründe: Statt als gewalttätiger politischer Gegner der aristokratischen Herrschaft der Torys ging M’Naghten als Verrückter in die Geschichte ein.
Ein mörderischer Monomane, so Esquirol, schien in der Regel nach der Tat wieder zu sich zu kommen. » Ist die Handlung vollführt«, schrieb er, »so scheint der Anfall beendet, und die Kranken fühlen sich von ihrer grossen Aufregung und Angst, die ihnen sehr peinlich war, entledigt, sind ruhig, haben keine Gewissensbisse und keine Furcht. Sie betrachten ihre Schlachtopfer mit Kaltblütigkeit, ja manchmal auch mit Zufriedenheit.« Der Akt des Tötens schien den Wahnsinn auszulöschen.
Bei einem Vortrag in Toronto wies Michel Foucault 1977 darauf hin, dass Esquirols Überlegungen den Kriminellen in einen Verrückten verwandelten, dessen einzige Krankheit es war, Straftaten zu begehen. Er meinte, dass die Psychiatrie des 19. Jahrhunderts »eine vollkommen fiktive Entität« geschaffen habe, »ein Verbrechen, das Wahnsinn ist, ein Verbrechen, das nichts anderes ist als Wahnsinn, einen Wahnsinn, der nichts anderes ist als ein Verbrechen«.
Obwohl die Diagnose »Mord-Monomanie« bereits in den 1860er Jahren in psychiatrischen Kreisen an Rückhalt verlor, wurde sie dennoch gern vor Gericht eingesetzt. Zwischen 1857 und 1913 brachte die Verteidigung die Diagnose »Mord-Monomanie« in 43 Mordprozessen im Old Bailey in London vor. Im Fall des dreizehnjährigen Robert Coombes, der 1895 seine Mutter im Osten der Stadt erstochen hatte, befand die Staatsanwaltschaft die Behauptung, der Junge leide unter Mord-Monomanie, für lachhaft: schließlich hatte er das Messer, mit dem er seine Mutter erstach, extra gekauft und versteckt, erinnerten die Anwälte der Krone die Jury. Die Geschworenen entschieden sich dennoch dafür, die Diagnose anzuerkennen, sie befanden den Angeklagten für schuldig, aber psychisch krank.

Coombes wurde nach Broadmoor, einer Anstalt für psychisch gestörte Straftäter, gebracht, wo man ihn zusammen mit anderen Verurteilten festhielt, die eine gütige Jury ebenfalls vor der Todesstrafe bewahrt hatte. Bei den meisten Gefangenen im Frauenflügel (und ebenfalls einige in der Abteilung der Männer) war eine Mord-Monomanie diagnostiziert worden, nachdem sie ihre eigenen Kinder getötet hatten. Dies war oft in Anfällen von Panik oder Verzweiflung geschehen. Robert Coombes wurde im Alter von dreißig Jahren aus der Anstalt entlassen. Drei Jahre später erhielt er eine militärische Auszeichnung für seinen ruhigen Mut, den er als Krankenträger in Gallipoli gezeigt hatte. Zwanzig Jahre später, er war mittlerweile Bauer in Australien, rettete er einen Elfjährigen aus seinem gewalttätigen Elternhaus auf der Nachbarfarm. Sein Zwang zum Töten, wenn es ihn denn je gegeben hatte, trat nie wieder auf.
• Siehe auch: Kleptomanie, Monomanie, Pyromanie

Eine panische Angst vor Ratten(1) und Mäusen(1), genannt Musophobie (nach dem griechischen Wort mus für Maus), könnte von unserem angeborenen Argwohn vor Tieren herrühren, die Nahrungsmittel verunreinigen und Krankheiten übertragen. Häufig wird sie durch einen Schock im frühen Kindesalter ausgelöst – dem Anblick eines kleinen pelzigen Körpers, der über den Boden huscht – und verstärkt durch kulturelle Einstellungen. In der mittelalterlichen Sage vom Rattenfänger von Hameln sind die Ratten Todesboten. Wenn in Zeichentrickfilmen Mäuse auftauchen, springen die anderen Figuren auf und kreischen. In einem berühmten Fall analysierte Sigmund Freud 1909 einen jungen Anwalt. Der hatte die Phobie entwickelt, nachdem er von einer »schauderhaften chinesischen Foltermethode« hörte, bei der eine Ratte an das Gesäß eines Mannes geschnallt wurde, damit sie sich durch seinen Anus nagen konnte.

George Orwell wurde von Ratten belästigt, als er im spanischen Bürgerkrieg kämpfte. In einer Scheune, in der er 1937 schlief, strömten, wie er in Mein Katalonien schrieb, »[die] schmutzigen Kreaturen […] an allen Ecken und Enden aus dem Boden«. Eines Tages erschrak er so sehr über eine Ratte, die neben ihm im Schützengraben auftauchte, dass er seinen Revolver zog und das Tier erschoss. Sowohl die republikanischen als auch die nationalistischen Soldaten hielten den Knall für den Beginn eines Angriffs der Gegner und schlugen sofort zurück. Bei dem folgenden Scharmützel wurden die Kantine seiner Miliz und zwei Busse zerstört, mit denen Truppen an die Front befördert wurden.
Eine Variation der chinesischen Rattenfolter findet sich in Orwells Roman 1984 aus dem Jahr 1948. Der Held der Geschichte, Winston Smith, weigert sich, seine Freundin Julia, zu verraten, selbst als er verprügelt und mit Stromschlägen gequält wird. Doch seine Folterknechte wissen, wie sie ihn kleinkriegen. »Haben Sie schon einmal eine Ratte durch die Luft springen sehen?«, fragt sein Peiniger in Zimmer 101, während er einen Käfig mit zwei der Nager schwingt. »Sie werden Ihnen ins Gesicht springen und sich sofort hineinbohren. Manchmal stürzen sie sich zuerst auf die Augen. Manchmal graben sie sich durch die Wangen und fressen die Zunge.« Als Winston den »Modergestank der Bestien« riecht und spürt, wie der Draht des Käfigs seine Wange streift, liefert er die geliebte Frau schließlich doch aus. »Macht es mit Julia!«, ruft er voller Entsetzen aus. »Macht es mit Julia! Nicht mit mir! Mit Julia! Macht mit ihr, was ihr wollt, es ist mir egal. Zieht ihr die Haut vom Gesicht, schneidet ihr das Fleisch von den Knochen. Macht das nicht mit mir! Mit Julia! Nicht mit mir!«
• Siehe auch: Doraphobie, Zoophobie
»Unter dem Namen Mysophobie«, schrieb der amerikanische Neurologe William Alexander Hammond im Jahr 1879, »möchte ich eine Form der Geistesgestörtheit beschreiben, […] die gekennzeichnet ist von einer krankhaften, übermächtigen Angst vor Verunreinigung oder Verseuchung.« Hammond griff für seine Wortschöpfung auf das altgriechische Substantiv mysos, Unsauberkeit, zurück. Während des vorangegangenen Jahrzehnts, so erläuterte er, hatte er zehn Patienten mit dem Syndrom behandelt.
»M. G.«, eine vermögende Witwe von dreißig Jahren, konsultierte Hammond im Jahr 1877. Sechs Monate zuvor, so berichtete sie, hatte sie einen Zeitungsartikel über einen Mann gelesen, der sich die Pocken zugezogen hatte, als er verseuchte Banknoten anfasste. »Das Vorkommnis hinterließ bei mir einen tiefen Eindruck«, erklärte sie, »und da ich erst kurz vorher eine ziemliche Menge an Geldscheinen gezählt hatte, kam mir der Gedanke, dass sie ja auch eine Person mit irgendeiner ansteckenden Krankheit in der Hand gehabt haben mochte.« Sie hatte sich zwar nach dem Zählen die Hände gewaschen, wusch sie sich daraufhin aber noch einmal und ging mit einem mulmigen Gefühl zu Bett. Am nächsten Morgen reinigte sie ihre Hände mit äußerster Sorgfalt. Als ihr einfiel, dass die Geldscheine in derselben Schublade ihrer Frisierkommode lagen wie ihre Unterwäsche, gab sie die Wäsche in die Reinigung und zog Sachen aus einer anderen Schublade an. Sie zog Handschuhe über, legte die Geldscheine in einen Umschlag und bat eine Bedienstete, die Kommodenschublade gründlich mit Wasser und Seife zu reinigen.
Dann kam ihr der Gedanke, dass sie nach den Banknoten ja noch viele weitere Dinge angefasst hatte. Jedes einzelne davon mochte sie infiziert haben. »Ich war immer noch in Gefahr.« Sie zog ihr Kleid aus, das sie am Vortag getragen hatte, und zog ein neues an. »Danach«, sagte sie, »kam eins zum anderen. Es nahm kein Ende. Ich wusch alles, was ich gewöhnlich anfasste, und dann wusch ich mir die Hände. Sogar das Wasser war eine Quelle der Verunreinigung. Denn egal, wie gründlich ich mir nach dem Waschen die Hände abtrocknete, etwas blieb noch haften und musste abgewaschen werden und dann wieder die Hände.«
M. G. las nicht mehr aus Angst, die Seiten eines Buches oder einer Zeitung könnten sie vergiften, und Hände schüttelte sie nur noch, wenn sie Handschuhe trug – »und in letzter Zeit scheinen mir nicht einmal mehr Handschuhe einen umfassenden Schutz zu bieten«, bekannte sie Hammond gegenüber. »Ich weiß, dass sie durchlässig sind.« Hammond fiel auf, dass sie während des Gesprächs ein wachsames Auge auf ihre Hände hatte und sie immer wieder rieb, um verunreinigende Teilchen loszuwerden. Nachdem er ihr den Puls gefühlt hatte, nahm sie ein Taschentuch aus ihrer Jacke, befeuchtete es mit einem Tropfen Eau de Cologne und wischte die Stelle ab, die sein Finger berührt hatte. Dann steckte sie das Taschentuch in eine andere Jackentasche, die schmutzigen Sachen vorbehalten war. M. G. erklärte, dass sie sich vor keiner speziellen Krankheit fürchte. Es sei einfach »ein übermächtiges Gefühl, ich würde auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise besudelt, das mich bedrängt«.
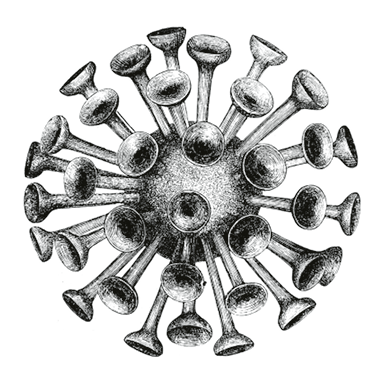
Eine andere Patientin Hammonds – »Miss F.«, eine schlanke junge Frau von 18 Jahren – wurde nach einem starken Befall von Kopfläusen im Jahr 1877 Mysophobikerin. »Ganz allmählich«, beschrieb Hammond den Fall, »setzte sich der Gedanke in ihr fest, dass sie den Quellen der Verunreinigung nicht entkommen könne, dass andere Menschen sie auf die eine oder andere Art besudeln würden und dass die verschiedenen Gegenstände um sie herum eine ähnliche Macht besitzen mochten«. Als sie 1879 endlich Hammond konsultierte, beherrschte die Phobie bereits ihr gesamtes Dasein: »Ihr ganzes Leben ist ein fortwährender Kreislauf aus Problemen, Sorge und Angst«, so Hammonds Befund. »Sie misstraut allem und jedem.« Auf der Straße pflegte sie den Rock hochzuraffen, damit er niemanden streifte. Sie verbrachte Stunden damit, ihre Kämme und Bürsten unter die Lupe zu nehmen und zu reinigen, wusch sich mehr als 200-mal am Tag die Hände und zog sich am Abend aus, ohne ihre Kleider anzufassen – nachdem ein Dienstmädchen die Verschlüsse gelöst hatte, ließ sie alles zu Boden fallen, von wo aus es geradewegs in die Reinigung ging. In der Reinigung, das wusste sie, würden ihre Kleider mit denen anderer in Kontakt kommen. »Sie erkennt keine praktikable Lösung für diesen Umstand«, schrieb Hammond in seine Unterlagen, was sie »sehr unglücklich macht.«
Wie M. G. konnte auch Miss F. nicht genau benennen, wovor sie sich eigentlich fürchtete. »Sie stellte es sich als etwas vor, das ihr auf fast unmerkliche Art und Weise körperlichen Schaden zuzufügen vermochte, indem es über ihre Hände oder andere Körperteile in ihren Organismus eindrang.«
Die Furcht vor Schmutz(1) war nicht neu. In den 1830er Jahren hatte Esquirol bereits eine »Mademoiselle F.« behandelt, eine hochgewachsene 34-jährige Frau mit kastanienbraunem Haar und blauen Augen, die es tunlichst vermied, irgendetwas mit den Händen oder ihrer Kleidung zu berühren, sich ständig die Finger rieb oder wusch, Bücher und Handarbeiten ausschüttelte, um mögliche Schmutzpartikel zu entfernen, und sich von einem Dienstmädchen mit dem Löffel füttern ließ. Wie den Damen, die bei Hammond in Behandlung waren, war auch ihr vollkommen bewusst, dass ihr Verhalten irrational war. »Meine Unruhe ist dumm und lächerlich«, bekannte sie, »aber ich kann mich derselben nicht erwehren.«
Als schließlich wissenschaftlich erwiesen wurde, dass Krankheiten durch unsichtbare Mikroben verbreitet werden können, trat die Furcht vor Verseuchung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch sehr viel häufiger auf, und an diesem Punkt stufte Hammond sie als eindeutige psychische Störung ein. Die Welt schien mit einem Mal voll verborgener Infektionserreger zu sein, vermerkte Don James McLaughlin in seiner Dissertation, und die Furcht vor diesen Erregern schien ebenso rasch um sich zu greifen wie die Mikroben selbst. Auch die Namen für die Erkrankung vervielfachten sich: Neben Mysophobie wurden Germophobie, Germaphobie, Verminophobie, Bakteriophobie und Bazillophobie geläufig.

Seelische Not unterschiedlichster Art konnte sich mittels der Schmutzphobie Bahn brechen. So behandelte im Jahr 1880 Dr. Ira Russell einen 47-jährigen Junggesellen, der selbst in Harvard Medizin studiert hatte und den das »Dreck-Grauen« gepackt hatte, nachdem sein Bruder in seinen Armen gestorben war. Russells Patient vermied es, Türklinken, Stühle und andere Möbelstücke anzufassen, und seine nächtlichen Säuberungsrituale dauerten Stunden. In den 1890er Jahren hatte Freud eine Patientin, die sich permanent die Hände wusch und Türklinken nur mit dem Ellbogen berührte. »Es ist der Fall der Lady Macbeth«, erläuterte er. »Die Waschungen waren symbolisch, dazu gedacht, die moralische Reinheit, deren Verlust sie bereute, durch die körperliche Reinheit zu ersetzen. Sie quälte sich mit Schuldgefühlen über eine eheliche Untreue, deren Erinnerung sie aus ihrem Gedächtnis zu verbannen suchte.«

Freud macht deutlich, warum es so schwer ist, einem Menschen diese rituellen Verhaltensweisen abzugewöhnen: »Wenn wir sie an der Ausführung ihrer Zwangshandlung, ihres Waschens, ihres Zeremoniells zu hindern versuchen, oder wenn sie selbst den Versuch wagen, einen ihrer Zwänge aufzugeben, so werden sie durch eine entsetzliche Angst zur Gefügigkeit gegen den Zwang genötigt. Wir verstehen, dass die Angst durch die Zwangshandlung gedeckt war, und dass diese nur ausgeführt wurde, um die Angst zu ersparen.« Derartige Zwänge, argumentiert Freud, seien Symptome magischen Denkens. Mysophobiker fürchteten, ihre Wünsche und Gefühle würden versickern und äußere Einflüsse eindringen. Die Waschrituale seien darauf angelegt, diese Kontamination, die Durchbrechung der porösen Ich-Grenze, zu verhindern.
Hammond behandelte seine mysophoben Patienten mit Bromiden, einer Form des Sedativums, während Freud sie zu heilen versuchte, indem er ihre unterbewussten Fantasien erforschte. Im späteren 20. Jahrhundert experimentierten Psychologen mit Verhaltenstherapien. 1975 wurde der britische Psychiater Isaak Marks von einer Frau konsultiert, die sich mindestens fünfzigmal am Tag die Hände wusch und jede Woche sieben Großpackungen Seifenflocken verbrauchte. Sie warf »verseuchte« Kleidung weg, obwohl sie sich eigentlich keine neue leisten konnte, und zog innerhalb von drei Jahren fünfmal um, auf der Flucht vor »infizierten« Umgebungen. Viele Orte waren für sie gleichbedeutend mit Verschmutzung, berichtet Marks, ganz besonders die englische Stadt Basingstoke: »Die bloße Erwähnung des Wortes beschwor schon Waschrituale herauf.« Im Zuge der Behandlung fuhr Marks mit ihr in die gefürchtete Stadt, ein Ausflug, der »in einem Gefühl völliger Besudelung, schwerer Depression und der Drohung, Hand an sich zu legen, endete«. Doch die Depression legte sich nach 24 Stunden wieder, und die Frau setzte die Behandlung fort, bis sie sich am Ende imstande fühlte, gänzlich ohne ihre Reinigungsrituale auszukommen.
Die Künstlerin Cassandre Greenberg ließ sich Mitte des Jahres 2019 in einer psychiatrischen Klinik im Norden Londons auf eine Konfrontationstherapie ein, um ihre panische Angst vor der Verseuchung und vor dem Erbrechen sowie ihren Reinlichkeitswahn zu behandeln. Doch im Februar 2020 wurde die Therapie unvermittelt abgebrochen. Das Covid-19-Virus hatte Großbritannien erreicht, und die Krankenhäuser bekamen Weisung, nur noch Notfallpatienten zu behandeln. Gleichzeitig instruierte die Regierung die Bürger, die Art von Zwangsverhalten anzunehmen, von der sich Greenberg hatte befreien wollen.
»Das Händewaschen war mit einem Mal ein Akt zur Rettung der Nation«, schrieb sie in einem Beitrag für das Magazin White Review. »Als die Leute anfingen, die Supermärkte auf der Jagd nach antibakterieller Seife zu stürmen, wurde ausgerechnet das, was mich ›krank‹ gemacht hatte, zum Inbegriff des gesunden Lebens.« Sie beobachtete, wie Menschen danach strebten, »Verhaltensweisen und Empfindungsmuster [anzunehmen], die für mich seit Langem Anzeichen für eine Erkrankung meiner Psyche waren, meine persönlichen rituellen Beschwichtigungen einer übersteigerten Erwartung drohender Gefahr. Das zuvor noch ›Pathologische‹ gilt jetzt als das Vernünftige und Verantwortungsbewusste.« Unversehens wurde die Öffentlichkeit dazu ermuntert, eine Haltung einzunehmen, aufgrund derer man Menschen kurz zuvor noch eine Keimphobie und eine Reinlichkeitsmanie unterstellt hätte.
Dass Fälle von Mysophobie in Zeiten einer rasanten Verbreitung gefährlicher Viren zunehmen, dürfte nicht überraschen, und Studien haben bestätigt, dass während der Covid-19-Pandemie viele Zwangsstörungen verstärkt auftraten. Wie allerdings Frederick Aardema 2020 im Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders darlegte, fürchtet ein Mensch, der sich zwanghaft die Hände wäscht, gar nicht in erster Linie eine physische Erkrankung, sondern eine seelische Verwundung. Keime(1) sind Sinnbilder für Schändung. Obsessive Waschrituale »werden ausgeführt als Schutz vor Gefahren für das seelische Ich im Gegensatz zum physischen Körper«. Eine Frau mit einer Zwangsstörung berichtete Aardema, sie habe während Covid-19 nicht noch mehr Angst vor einer Ansteckung gehabt, sondern sei eher erleichtert gewesen, dass auch andere ihre Verhaltensmuster annahmen. »Es musste ihr nicht mehr peinlich sein, Schutzhandschuhe zu tragen«, so Aardema, »oder das Händeschütteln zu verweigern.«
In der Anfangsphase der Covid-19-Pandemie definierten wir – im Eilverfahren – den Begriff »rational« grundlegend neu. »Ich habe erlebt, wie sich die Ängste der Menschen in meinem Umfeld nach außen offenbarten«, berichtete Greenberg, »und das auf eine Weise, die alle meine bisherigen Vorstellungen von geistiger ›Gesundheit‹ beziehungsweise Krankheit über den Haufen warf.« Es war ein extremes Beispiel dafür, wie ein historisches Ereignis Sichtweisen ebenso wie Verhaltensweisen auf den Kopf stellen kann. Angst zu zeigen, wurde zur Normalität, sich zu fürchten hieß, sich logisch, verantwortungsbewusst, sachkundig zu verhalten. Zwanghaftigkeit war jetzt ein Mittel, für sich selbst und für andere Sorge zu tragen.
• Siehe auch: Ablutophobie, Arithmomanie, Dermatillomanie, Emetophobie, Haphephobie, Trypophobie
In einer wissenschaftlichen Abhandlung von 1905 bezeichnet der französische Psychiater Ernest Dupré den pathologischen Drang, zu übertreiben oder zu lügen, als Mythomanie – nach dem griechischen Wort für »sagenhafte Geschichte«. Echte Mythomanie, so Dupré, ist allem Anschein nach ohne eigentlichen Zweck. Mythomane glauben entweder ihre Lügen(1) selbst, oder sie wissen, dass es Lügen sind, können aber nicht aufhören, sie zu erzählen. Für gewöhnlich bewegen sie sich fließend zwischen Fantasie und Realität hin und her, pendeln wie ein Kind zwischen bewussten Lügen und Tagträumen. Der Zustand ist auch als Pseudologia phantastica bekannt (ein 1891 von Anton Delbrück geprägter Begriff) oder als pathologisches Lügen. Unter den dokumentierten Fällen ist der einer Dienstmagd, die im späten 19. Jahrhundert durch Österreich und die Schweiz wanderte und sich mal als verarmte Medizinstudentin ausgab und mal als rumänische Prinzessin. Die waghalsigen Märchen eines Franzosen gipfelten 1993 im Mord an seiner Frau, seinen Kindern und seinen Eltern.
»Der pathologische Lügner«, so die polnisch-amerikanische Psychoanalytikerin Helene Deutsch 1922, »erzählt von einem Tagtraum oder einer Fantasterei, als wären sie wirklich geschehen.« Eine ihrer Patientinnen behauptete, eine masochistische Teenageraffäre mit einem älteren Jungen gehabt zu haben, und wies auch ein Tagebuch vor, das die sexuellen Begegnungen beschrieb. Deutsch wusste, dass die Geschichte ihrer Patientin erfunden war, versuchte aber zu verstehen, warum sie darauf beharrte. Am Ende stellte sich heraus, dass ihr älterer Bruder sie sexuell missbraucht hatte, als sie etwa drei Jahre alt war. Das verdrängte Ereignis, das sich auch in einer somatischen Störung hätte niederschlagen können, war stattdessen in einer erdichteten Geschichte zum Vorschein gekommen. Im England der 1930er Jahre stellte der ungarische Geisterjäger Nandor Fodor die These auf, dass einige Frauen, die nach eigenem Bekunden übernatürliche Kräfte besaßen, sich zwanghaft Geschichten ausdachten, um verborgene Wahrheiten über ihr Leben zu vermitteln. Ein Beispiel dafür ist sicherlich die Londoner Hausfrau Alma Fielding, die Poltergeistphänomene zu erzeugen schien.
»Die Ansicht ist recht weit verbreitet«, stellt Deutsch fest, »dass Phantasie-Lügner ihre Geschichten erzählen, um bei ihren Zuhörern Bewunderung, Neid usw. hervorzurufen.« Sie habe aber festgestellt, dass Mythomane »einfach einem inneren Drang folgen, etwas mitzuteilen, ohne sich wirklich um die Reaktionen zu scheren«. Eine vorteilhafte Resonanz sei nur eine willkommene Begleiterscheinung. »Darin«, so Deutsch, »ähnelt der Phantasie-Lügner dem wahrhaft schöpferischen Autor, der ohne Rücksicht auf die Rezeption seines Werkes schreibt, und weniger dem zweitrangigen Künstler, der sein Werk dem Publikumsgeschmack anpasst.« Mythomane folgen, wie Romanciers, einem Impuls, in ausgedachten Geschichten sich selbst zu entfliehen – oder zu entdecken.
2015 machte die französische Psychoanalytikerin Michèle Bertrand die Bekanntschaft eines Patienten mit Namen Alex, eines hochgewachsenen jungen Mannes mit gebeugter Körperhaltung, der sich ihr mit den Worten vorstellte: »Madame, ich bin ein Lügner.« Schon seit seiner Schulzeit hatte er seine Legasthenie verborgen und so getan, als sei er hochgebildet, obwohl er in Wirklichkeit kaum lesen und schreiben konnte. Sobald er Gefahr lief, enttarnt zu werden, kündigte er Jobs oder beendete Liebesbeziehungen. Alex quälte sich mit Ängsten und Schuldgefühlen, fabrizierte aber eifrig weiter Geschichten. »Der Mythomane«, so Bertrand, »ist jemand, der es nicht geschafft hat, ein stimmiges Charakterbild von sich zu entwerfen. Er weiß nicht, wer er ist […] Er erfindet keine Geschichten, um zu verbergen, was er ist, sondern […] um Substanz zu erwerben, ein erfülltes Sein, Stimmigkeit. Seine Lage ist deshalb so vertrackt, weil er ohne diese Vortäuschung, der zu sein, den er ersonnen hat, in seinen eigenen Augen ein Nichts ist.«
In seinem Buch Die Frau, die nicht lieben wollte (2013) stellt der Psychoanalytiker Stephen Grosz einen Fernsehproduzenten, »Philip«, vor, der mit der Diagnose »pathologisches Lügen« an ihn überwiesen wurde. Eine von Philips ersten Lügen – im Alter von elf oder zwölf Jahren – war die seinem Schuldirektor gegenüber, er sei vom MI5 für eine Ausbildung zum Geheimagenten angeworben worden. In jüngerer Zeit hatte er seiner Frau fälschlich erzählt, er habe Lungenkrebs. Seiner Tochter hatte er weisgemacht, er spreche Französisch, und seinem Schwiegervater, er habe einmal als Reservist der Mannschaft der britischen Bogenschützen angehört. Es dauerte auch nicht lange, bis er Grosz einen Bären darüber aufband, warum er seine Rechnung noch nicht bezahlt hatte. Grosz stellten die offensichtlichen, sinnlosen und oft auch lächerlichen Märchen seines Patienten vor ein Rätsel, bis Philip eine Kindheitserinnerung preisgab. Seit er ungefähr drei Jahre alt war, so erzählte er, wachte er häufig nachts auf und stellte fest, dass er ins Bett gemacht hatte. Wenn er sich morgens anzog, stopfte er immer seinen feuchten Schlafanzug unter das Bettzeug, und am Abend fand er ihn dann, sauber und zusammengefaltet, unter dem Kopfkissen wieder. Seine Mutter hatte ihn im Lauf des Tages ohne Aufhebens weggenommen und gewaschen. Sie sprach sein Problem ihm gegenüber nie an, rügte ihn nicht und verriet auch seinem Vater nichts davon. Das stillschweigende Ritual setzte sich fort, bis Philip elf war und seine Mutter starb.
Zwar entwuchs Philip später seiner Bettnässphase, doch vermutete Grosz, dass pathologisches Lügen an seine Stelle getreten war. »Er erzählte Lügen, die Chaos verursachten«, so Grosz, »und hoffte, dass sein Zuhörer nichts sagen und, wie seine Mutter, in einer heimlichen Übereinkunft sein Komplize werden würde.« Seine Lügerei diente nicht der Täuschung, sie wollte eher ein Band der Mittäterschaft knüpfen. Es war »seine Art, die Verbundenheit von einst aufrechtzuerhalten, seine Art, seiner Mutter weiterhin nahe zu sein«.
Gelegentlich muss die Diagnose Mythomanie auch dafür herhalten, dass die Realität geleugnet wird. In der ersten Einzeldarstellung zu pathologischem Lügen, veröffentlicht 1915, stellten die Kinderpsychologen William und Mary Tenney Healy einige der zwanghaften Lügner vor, die sie in Chicago behandelt hatten. Zu ihnen gehörte auch »Bessie M.«, neun Jahre alt, die ihrer Betreuerin erzählte, sie sei von mehreren Männern sexuell missbraucht worden, unter anderem von ihrem Vater und ihrem Bruder. Ihre Pflegemutter »Mrs. S.« informierte die Polizei, die Bessies Vater und Bruder wegen Inzest verhaftete. Vor Gericht lieferte Bessie in aller Ausführlichkeit schockierende Beschreibungen der Übergriffe, doch der Richter war der Meinung, ihre Aussage erwecke »den Anschein von Unwahrheit«, und befand, das »Gebaren« insbesondere ihres Bruders entspreche »ganz und gar nicht den schwerwiegenden Beschuldigungen gegen ihn«.
Als Experten für Jugendkriminalität erstellten die Healys für das Gericht ein Gutachten über Bessie. Sie erfuhren, dass ihre Familie aus Irland nach Chicago gezogen war, als Bessie fünf Jahre alt war und nachdem ihre Mutter und mehrere Geschwister in »der alten Heimat« verstorben waren. In den vier Jahren seitdem hatte das Mädchen in vielen verschiedenen Hausgemeinschaften gewohnt und sechs Monate lang mit Vater und Bruder das Bett geteilt. Bessie behauptete, sie sei an fast allen Orten, an denen sie logiert hatte, in sexuelle Aktivitäten mit verschiedenen Männern verstrickt gewesen. Die Psychologen waren erstaunt über ihr breites sexuelles Wissen, bemerkten aber auch, dass Mrs. S., ihre derzeitige Pflegemutter, einen »Hang zum Dramatischen« in dem Mädchen gefördert hatte, indem sie sie ins Theater und zu Filmvorführungen mitnahm und sie dazu anregte, laut vorzulesen. Ein Arzt, der Bessie untersuchte, stellte fest, dass ihr Hymen unversehrt war. Die Healys zogen den Schluss, dass sie bezüglich der schwerwiegendsten Übergriffe auf sie gelogen haben musste. Das sagten sie auch vor Gericht aus.
Mrs. S. und weitere bei der Verhandlung anwesende Frauen waren außer sich, als der Richter die Klage gegen Bessies Vater und Bruder abwies. »Die erste Geschichte des Mädchens«, bemerkten die Healys, »war so gut erzählt, dass viele unwiderruflich von der vollständigen Schuld des Vaters überzeugt waren«.
Die Healys hatten das Modell des pathologischen Lügens zu Hilfe genommen, um zu erläutern, warum Bessie eine Lüge erzählt haben sollte, die ihr so wenig nutzen konnte. Inzwischen weiß man, dass der Zustand des Hymen keinen Hinweis darauf gibt, ob ein Mädchen oder eine Frau missbraucht wurde. Eine Studie zu Fällen von Kindesmissbrauch aus dem Jahr 2010 ergab, dass nur zwei Prozent der Opfer »sichtbare Läsionen« davongetragen hatten. »Eine Untersuchung des Hymen« ist, einer Abhandlung mehrerer internationaler Experten für sexuelle Gewalt von 2019 zufolge, »keine präzise beziehungsweise verlässliche Überprüfung von vorangegangenem sexuellen Verkehr, auch nicht von sexuellem Missbrauch.« Vielleicht klang Bessies Geschichte deswegen so überzeugend für Mrs. S. und die anderen Frauen, die sie kannten, weil sie nicht etwa unter Mythomanie litt, sondern weil sie die Wahrheit sagte.
• Siehe auch: Erotomanie, Megalomanie, Plutomanie