Vorwort der Herausgeber
Abb. 0.1

Abb. 0.1
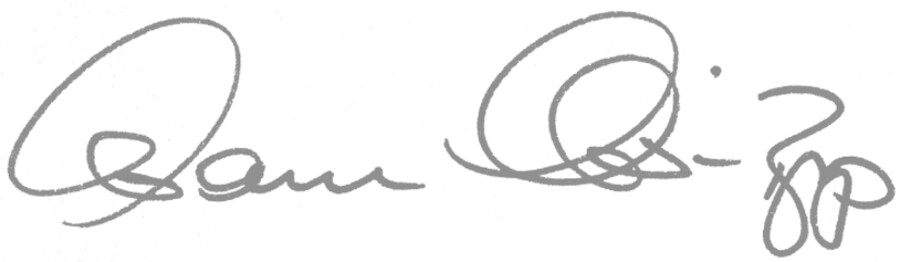
Abb. 0.1
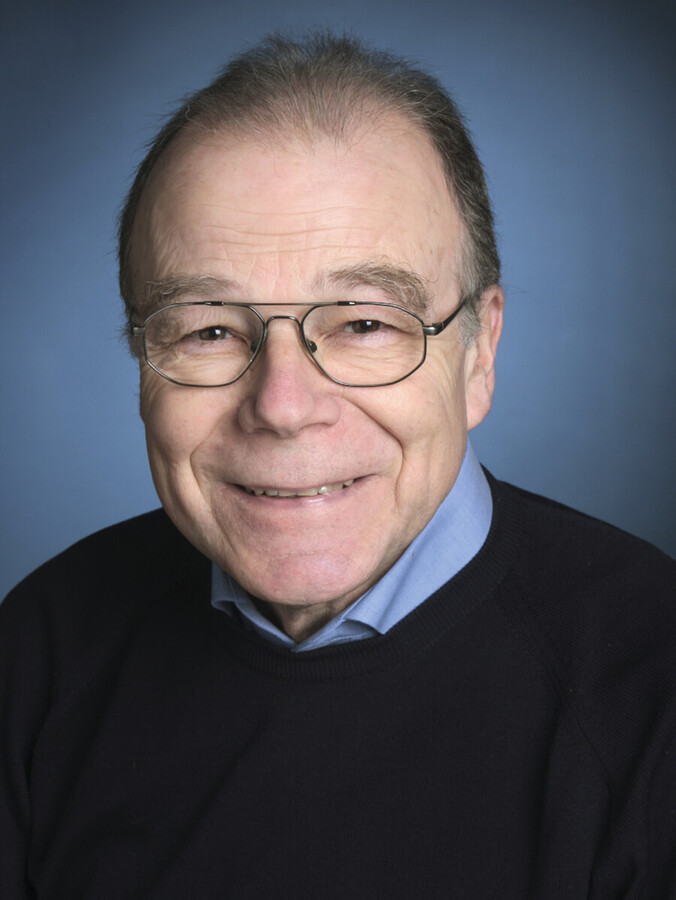
Abb. 0.1

Abb. 0.1

Abb. 0.1
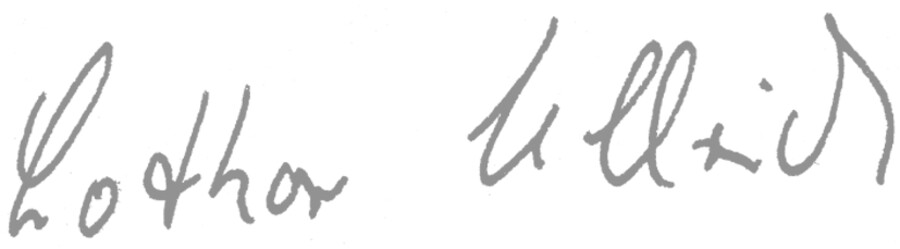
Wir begrüßen Sie herzlich als Leserinnen und Leser dieses seit den 1970er-Jahren bewährten Lehr- und Arbeitsbuches der Pflege. Bei den Bearbeitungen der Neuauflagen der letzten Jahre ließen wir uns leiten von einer Reihe von Prinzipien als Ausbildungsziele, wie sie uns in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, in der Altenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflege, die seit 2020 als generalistische Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann zusammengefasst sind, geboten erscheinen.
Prinzipien als Ausbildungsziele
Evidence-based Nursing Practice (EBNP) in Aus- und Weiterbildung Gesundheits- und Krankenpflege in jeder Lebensphase ist charakterisiert durch das Infragestellen traditionell geübter Präventionskonzepte und „Praxisrituale“ analog einem religiösen Kult. Alle Pflegehandlungen müssen kunstgerecht („lege artis“) ausgeführt werden, unter Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft, der gültigen Regeln der Technik, sowie der gesellschaftlichen und gesetzlichen Normen. Es muss dem Patienten das aktuell bestmögliche Pflegeangebot gewährleistet werden. Wir fühlen uns jedem Pflegebedürftigen in den Grundsätzen der Menschenwürde, Humanität und Solidarität verpflichtet. Angewendet werden dabei alle fundierten Erkenntnisse unter Einsatz der individuellen körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse.
So weit wie möglich müssen Grundlage aller Pflegeanliegen Ergebnisse aus wissenschaftlich anerkannten Studien und Untersuchungen (Evidence Based Nursing Practice = EBNP) sein und nicht lediglich Autoritätsgläubigkeit. Fehlen solche Daten, sollte die bestmögliche Erfahrung Pflegender miteinbezogen werden.
Dabei ist Pflegepraxis aus einem erweiterten Blickwinkel zu betrachten. Es heißt, Abschied zu nehmen von bequemer Selbstzufriedenheit und Trugschlüssen der Pflege.
EBNP schult in Kritikfähigkeit und befördert als strukturierter analytischer Ansatz in der Gesundheitsversorgung Patientenorientierung und Qualitätsverbesserungen. Dabei ist EBNP nicht lediglich ein Modul, das einem kleinteiligen Kanon eines Ausbildungsplans zusätzlich hinzugefügt werden soll, EBNP entspricht einer grundlegenden professionellen Haltung und Kompetenz.
Pflegerische Entscheidung in der Begegnung Respekt vor dem Patienten in individueller Situation verbietet jedoch, lediglich nach wissenschaftlichen Studien, unreflektiert (nach „Schema F“) bei allen Pflegebedürftigen zu arbeiten. Wir erfahren täglich, dass Patienten heute vielfach den Wunsch haben, eine aktive Rolle in ihrer Krankheitsbewältigung und bei der pflegerischen Betreuung zu übernehmen. Andere fordern Autonomie in ihren Entscheidungen über die Durchführung lebenserhaltender Maßnahmen. Dazu benötigen wir neben wesentlichen Grundlagen aus den Pflege- und Bezugswissenschaften die Partizipation des Patienten an der Entscheidungsfindung.
In der Begegnung mit dem Patienten kommt es darauf an, nicht nur Resultate der Pflegeforschung einzubeziehen, sondern gleichfalls vorhandenes Wissen und praktische Erfahrungen der Pflegenden. Ziele und Vorstellungen des Pflegebedürftigen selbst sowie seine Umgebungsbedingungen sind zu berücksichtigen. Patienten haben das Recht auf ausreichende und qualitativ gute Pflege. Das sollten auch Pflegende vertreten. Ihre „Übersetzung“ in praktisches Handeln ist schwierig. Oft erfordert pflegerisches Handeln sensible und verletzliche Tätigkeiten. Das verlangt die Bewahrung der Würde, eine gelingende Interaktion und eine Wertschätzung des Betroffenen. Bei der Anwendung von EBNP ist das Aushandeln mit dem individuellen Patienten gefordert. Dieser Anspruch und das legitimierte Recht der Patienten, über Nutzen und Schaden pflegerisch-medizinischen Handelns verständlich aufgeklärt und in Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden, sind Ihre pflegerische Aufgabe.
Pflegekonzept des „Sense of Coherence“ Neben der hoch spezialisierten akuten Versorgung sollen auch die pflegetherapeutischen Optionen der Pflegenden – insbesondere bei chronischen oder nicht heilbaren Krankheiten – erweitert werden. Das schließt als Aufgabe mit ein, den „Sense of Coherence“ in das Pflegekonzept zu integrieren. Damit ist ein andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens des Menschen in seine Fähigkeiten gemeint. Daraus entwickelt der Hilfebedürftige Sinn, Verständnis und Handhabbarkeit in seinem Krankheitsprozess.
Denn: Heilung hat nicht nur eine somatische, also auf den Körper bezogene Ebene. In einem ganzheitlichen Geschehen bindet sie obendrein salutogene Aspekte als Quellen für das Gesundsein ein. Heilung berücksichtigt neben der Leiblichkeit auch seelisch-geistige Ressourcen. Das Leiden eines Menschen ist nicht immer zu verhindern, wir können es jedoch immer mindern.
Nachhaltiges Denken Sie erlernen einen Beruf oder sind bereits in diesem Beruf tätig, der auf die Gegenwart und Zukunft gerichtet ist. Sie ermöglichen Menschen in hilfebedürftiger Lage, an das Leben von morgen zu denken. Damit ist Ihr Denken auf Nachhaltigkeit gerichtet, denn diejenigen, die morgen leben, sind unsere Kinder, Enkel und Urenkel, nicht irgendwelche abstrakten statistischen Größen.
Generalistische Ausbildungsinhalte Wir bekennen uns zu der im Jahr 2020 gestarteten generalistischen Pflegeausbildung von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen. Damit werden die bisherigen solitären Berufsausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer generalistischen Ausbildung mit dem Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“ zusammengeführt. Um Sie für die generalistische Pflegearbeit „fit“ zu machen, haben wir in diesem Buch wichtige Inhalte zu Pflegesituationen in jeder Lebensphase integriert.
Inhaltliche und didaktische Umsetzung
ATL Als wesentliche Strukturhilfe und Ausdrucksmöglichkeit pflegerischer Arbeit sehen wir weiterhin die langjährig bewährten „Aktivitäten des täglichen Lebens“ (ATL) an. Als ganzheitliches Konzept wurde es von der Begründerin dieses Buches, der katholischen Ordensschwester Liliane Juchli, entwickelt.
Struktur Die ATL sind geordnet nach:
-
Grundlagen aus Pflege- und Bezugswissenschaften
-
Pflegesituationen erkennen, erfassen und bewerten
-
Pflegemaßnahmen auswählen, durchführen und evaluieren
-
Gesundheitsförderung, Beratung und Patienteninformation
Fächerintegrierend In der inhaltlichen und didaktischen Umsetzung der ATL und auch aller anderen Schwerpunkte orientieren wir uns selbstverständlich an den aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Wir berücksichtigen dabei insbesondere ein fächerintegrierendes pädagogisch-didaktisches Verständnis, wie es sich im Lernfeldansatz ausdrückt, der Grundlage der curricularen Vorgaben in allen Bundesländern ist. Die Themenbereiche der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe sind den einzelnen Kapiteln nachvollziehbar zugeordnet.
Fallorientiert Bewusst wird ein fallorientiertes Lehr-Lernverständnis gefördert. Dadurch werden wissenschaftsbasierte Sachlogik mit realitätsnaher und qualitätssichernder Handlungslogik unmittelbar verbunden. Dabei wird die individuelle Persönlichkeit erkennbar. Systematische Gestaltungselemente ziehen sich als Orientierungs- und Lernhilfen durch alle Kapitel. Das erleichtert das Lernen und auch das Lehren.
Mehr Eigenständigkeit – mehr Eigenverantwortung
Lernen an und mit der Erkrankung Eine unerlässliche Aufgabe für Pflegende ist es, den erkrankten Menschen in den Prozessen zu unterstützen, die der Organismus selbst in der Auseinandersetzung mit der Erkrankung aufruft. Dazu müssen die erforderlichen Pflegesituationen erkannt, erfasst und bewertet (Assessment) werden. Unter diesem Gesichtspunkt bedeutet Heilung nicht nur ein Zurückdrängen der Erkrankung in geringere Manifestationsgrade und damit in eine Zeit früherer Gesundheit, sondern auch ein Lernen an und mit der Erkrankung.
Kooperation als Antwort Eine systematische Kooperation und professionelle Kommunikation aller Beteiligten „auf gleicher Augenhöhe“ mit den anderen Professionen im Gesundheitswesen ist notwendig, um auf den Gebieten der immer wichtiger werdenden Gesundheitsförderung, Beratung und Patienteninformation hilfreich wirken zu können. Aufmerksam müssen aktuelle Tendenzen einer neuen Arbeitsteilung (Stichwort: Substitution), wie die Steuerung von Prozessen und Übernahme ausgewählter ärztlicher Aufgaben durch Pflegende, beobachtet werden. Originäre pflegerische Aufgaben dürfen nicht unbegrenzt patienten- und bewohnerfernen Tätigkeiten geopfert werden. Die Profession Pflege ist kein Anhängsel im Gesundheitswesen, sondern eine eigenständige Profession.
Chance zur Weiterentwicklung Das pflegerische Handlungsfeld wird sich weiter spürbar verändern. Nicht allein die Tätigkeit im Krankenhaus macht Pflege aus, sondern bereichsübergreifende integrierte Versorgungsformen gewinnen an Bedeutung und stellen uns vor zukünftige Herausforderungen. In diesem vernetzten System kommt es auf gelungene Kommunikation, Koordination und Kooperation zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Bereichen an. Die Bedeutung der „häuslichen Pflege“, auch durch wertgeschätzte geschulte und von den Professionellen akzeptierte pflegende Angehörige, stellen wir deswegen immer wieder exemplarisch heraus.
Liebe Leserinnen und Leser, Sie haben sich für einen Beruf entschieden, dem nicht nur eine hohe gesundheitsbezogene, sondern gleichfalls eine entsprechende gesellschaftliche Bedeutung zukommt. Daher lohnt es sich auch in besonderer Art und Weise, sich aktiv in der Weiterentwicklung des Berufes zu engagieren. Das beginnt bereits in der Ausbildung und setzt sich durch die Bereitschaft, auch anschließend fachlich kontinuierlich „am Ball zu bleiben“, fort. Letztlich dient dies alles der Gewährleistung der Qualität der Patientenversorgung.
Wir wünschen Ihnen nun für Ihre Ausbildung und spätere Berufstätigkeit viel Motivation, gesellschaftliche Anerkennung und Freude.
Mainz/Berlin/Münster, Sommer 2020
Susanne Schewior-Popp
Franz Sitzmann
Lothar Ullrich