Haaf Fish – die Kegelrobbe
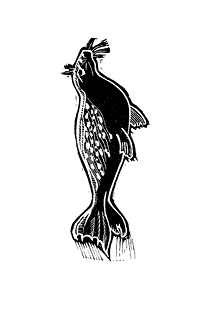
Als die Kinder nach den Herbstferien im Oktober 2020 wieder in die Schule zurückkehren, bin ich voller Sorge. Die ersten sechs Monate der Pandemie habe ich damit verbracht, sie möglichst nah bei mir zu behalten, und jetzt fällt es mir mit jedem Mal schwerer, sie wieder gehen zu lassen.
Ich warte, bis der Schulbus von unserer Auffahrt zurück auf die Straße gebogen ist, dann hole ich meine Wanderstiefel und den gepackten Rucksack und fahre mit dem Auto zu einem Küstenabschnitt, wo im Spätherbst die Kegelrobben an Land kommen und ihre Jungen zur Welt bringen. Jedes Jahr organisiert die schottische Naturschutzbehörde NatureScot eine Kegelrobbenzählung, an der sich viele Freiwillige wie ich beteiligen. Die Erfassung der angeschwemmten toten Seevögel während des Lockdowns hat mir gefehlt. Nicht nur der Strand – oder die Vögel selbst, tote wie lebende –, sondern auch der Vorgang an sich, bei dem ich den Strand abging und Daten sammelte. Es tut gut, wieder loszuziehen, auch wenn die Wanderung zu den Robben-Geos beschwerlich werden wird. Mein Körper kämpft immer noch mit den Nachwirkungen des rheumatischen Schubs, der durch Corona ausgelöst wurde. Aber immerhin bin ich allein und kann mein Tempo selbst bestimmen.
Es ist windstill und das Wasser im voe ist glatt und ruhig. Ich halte in einer Parkbucht und schaue nach Schweinswalen, sehe aber keine. Neben der Schule rennen meine beiden Kinder mit glücklichem Grinsen über den Spielplatz. Mir fällt ein kleiner Stein vom Herzen. Als ich an der Kreuzung Richtung Westen abbiege, hebt sich meine Laune bei der Aussicht auf eine Wanderung entlang der Klippen, auch wenn sich Angst unter die Vorfreude mischt. Die Klippen sind hoch. Die Robben halten sich an Stränden auf, die in die Tiefen der geos eingebettet sind, und bringen ihre Jungen zwischen Treibholz und jeder Menge Plastikmüll zur Welt.
Als die Klippen in Sicht kommen, muss ich zweimal hinschauen. Dichte Wolken salziger Gischt steigen wie Rauchsäulen in die Luft. Eigentlich ist heute ein windstiller, sonniger Tag, doch die Brandung ist enorm und wirkt ziemlich ölig. Das Meer brodelt und schäumt mächtig. Das Land scheint sich zusammenzukauern. Weit draußen auf dem Atlantik muss es einen Sturm gegeben haben. Auf den Felsvorsprüngen der Klippen hocken Eissturmvögel und haben den Kopf unter den Flügel gesteckt, als ob sie dem Donnern der Wellen entgehen wollten. Meine Haut spannt von der salzigen Gischt. Weit draußen im Westen versteckt sich die Insel Foula hinter einer tief hängenden Wolke, als ob sie das sich anbahnende Drama nicht mitbekommen will.
Das erste der beiden Robben-Geos hat eine weite Öffnung zum Atlantik. Eigentlich ist gerade Ebbe, doch der Strand wird von schäumenden Wellen überspült. Die Robben sind nicht da. Die Strahlen der Sonne reichen nicht bis zum Grund. Alles wirkt dunkel und leblos.
Das zweite geo ist kleiner und besser geschützt. Felsen bewachen den Eingang und fangen die Wucht der Wellen ab. Der Großteil des Strandes scheint trocken. Ich zähle drei trächtige Robben mit dicken Bäuchen. Vier Jungtiere mit dichtem weißem Fell liegen neben ihren grausilbern glänzenden Müttern. Leuchtend rosa Nabelschnurstümpfe ragen aus ihren Bäuchen. Sie sind gerade erst geboren. Ihre Haut ist noch schlaff und faltig, die Augen groß und dunkel. Anders als Seehundjunge, die fast sofort schwimmen können, werden Kegelrobben ohne Speckschicht geboren und können der Kälte des Meeres nicht standhalten. Sie verlieren ihr weißes Fell nach etwa zwei Wochen, wenn sie dank der Muttermilch dick und rund geworden sind. Die Robbenmutter bleibt in den ersten Wochen meist bei ihrem Jungen an Land. Während ihr Junges immer dicker wird, wird sie immer dünner.
Alles scheint gut. Die Wellen reichen nicht bis zu den Robben. Ich liege auf dem Bauch, sie können mich nicht sehen. Es ist eine Freude, sie zu beobachten. Die Mütter niesen, gähnen oder kratzen sich. Die Kleinen wirken munter und blicken staunend in die Welt.
Plötzlich hebt eine Robbenmutter abrupt den Kopf. Ich höre nichts, sie schon. Sie stemmt sich mit ihren Flossen zu einer höher gelegenen Stelle hinauf. Aber zu spät, sie ist nicht schnell genug und wird von einer großen Welle erfasst, die ins geo brandet. Als die Welle abfließt, nimmt sie das Junge mit, das an der Seite der Mutter lag. Es wird rückwärts über den Strand ins Meer gezogen, in die schäumende Brandung. Das Junge breitet die Vorderflossen aus, als versuche es irgendwo Halt zu finden. Alles geschieht innerhalb weniger Sekunden. Die Robbenmutter verharrt reglos, mit gerecktem Hals starrt sie auf die Stelle, wo eben noch ihr Junges lag. Sie starrt immer noch, als eine weitere Welle hereinrauscht und das Junge zurück an ihre Seite spült. Sie stupst mit der Schnauze in sein nasses Fell, und das Junge heult wie ein Menschenbaby.
Der Wind lässt für einen Moment nach und es herrscht eine fast unheimliche Ruhe. Kleinere Wellen kommen herein, im geo wird es wieder still. Ein Strandpieper landet auf den Kieseln und sucht zwischen den Robben nach Futter. Ein großer Robbenbulle schwimmt heran und lässt sich von der Brandung auf den Kies heben. Sein schwerer Körper ist deutlich länger und dicker als bei den weiblichen Robben. Mit seinem faltigen massigen Nacken wirkt er, als könnte er es mit der Kraft des Meeres aufnehmen. Das nasse Junge heult weiter.
Im Augenwinkel bemerke ich eine Bewegung. Ein graues Weibchen schwimmt in der Brandung hinter einem Felsvorsprung, der eine Minibucht mit Strand verbirgt. Es wirkt so menschlich, wie es den Kopf und die Schultern aus dem schäumenden Wasser reckt und sich mit weit aufgerissenen Augen umblickt. Das Weibchen atmet schnell, die Nüstern sind geweitet. Hektisch dreht es den Kopf hin und her, schwimmt einen Kreis und taucht dann unter, um nur ein kleines Stück weiter wieder hochzukommen. Ein großes Stück Treibholz schwimmt wie ein Rammbock auf einer Welle und verfehlt nur knapp seinen Kopf. Die Robbe zuckt zusammen. Ich beobachte ihre gefährliche Suche, bis ich es nicht mehr aushalte. Ihr Junges ist verloren. Ich verlasse die Klippen und fahre nach Hause.
•
Die alten Namen für Kegelrobben auf Shetland verraten, wo man sie finden kann. Der Seehund wurde früher tang fish genannt, tang bedeutet wie im Deutschen Tang, etwa der Blasentang der Gattung Fucus, der in der Brandungszone wächst. Die Kegelrobbe war wiederum als haaf fish bekannt, haaf ist das tiefe oder offene Meer. Jenseits des Meeresarms bei unserem Haus fließt ein burn (Bach) durch Sumpf- und Grasland zum Meer. Er heißt Selkieburn, obwohl dort nur Seehunde auf den Felsen liegen. Um Kegelrobben zu sehen, muss ich der Küste bis zu der Stelle folgen, wo sich der Meeresarm zum Meer wendet und sich mit dem offeneren Wasser des voe verbindet. Es wirkt fast so, als ob Kegelrobben es nicht mögen, wenn sie von Land umgeben sind, während Seehunden der Schutz einer Einfriedung zu gefallen scheint.
Auf Shetland werden Seehunde und Kegelrobben immer noch selkies genannt. Dass sich der Name gehalten hat, macht es leichter, an das selkie folk zu glauben, übernatürliche Wesen, die ihre Robbenhaut ablegen und menschliche Gestalt annehmen. Ich habe einmal drei Shetländer schüchtern gefragt, ob sie irgendwelche selkies kennen würden oder von ihnen gehört hätten. Zwei verneinten so schroff, dass klar war, wie lächerlich sie diese Frage fanden. Doch die dritte Person, eine Frau, sagte ohne zu zögern Ja. Auf ihrer Heimatinsel gab es vor einigen Generationen ein Mädchen, von dem man glaubte, es würde von einem selkie abstammen. Wenn ich jetzt eine Selkie-Geschichte lese, muss ich jedes Mal daran denken und nehme sie ein bisschen ernster als früher.
Die berühmteste Selkie-Geschichte Shetlands spielt auf der Insel Papa Stour und den Vee Skerries, die 5,6 Kilometer von Papa Stour entfernt liegen. Papa Stour ist vom Westen Mainlands durch einen Sund mit einer gefährlichen Gezeitenströmung getrennt. Auf der Insel leben weniger als zehn Bewohner. Die Vee Skerries sind kleine Felseninseln, die schon einigen Schiffen zum Verhängnis wurden. Durch die Felsen unter Wasser ist es für die meisten Boote schwierig, zu den Inselchen zu gelangen, daher werden sie selten besucht. Selbst wenn man es schafft, hinzukommen, kann der Wellengang plötzlich so zunehmen, dass es schwierig wird, sie wieder zu verlassen. Ich halte nach den Vee Skerries von einem Weg oberhalb unseres Hauses Ausschau, der in die Hügel führt. Oder genauer gesagt, halte ich nach der weiß schäumenden Brandung Ausschau, die die Inseln an den meisten Tagen vor meinem Blick verbirgt. Mir scheint es unbegreiflich, doch die Kegelrobben schaffen es, auf den Skerries an Land zu gehen und dort ihre Jungen zur Welt zu bringen.
Ich war bisher nur im Winter auf Papa Stour, zum Strandgutsammeln. Bei einem Besuch an einem trüben Märztag stand ich oberhalb des sanft abfallenden Strandes von Aisha und beobachtete die Wellen, um abzuschätzen, ob es fürs Beachcombing zu gefährlich wäre oder nicht. Am Tag zuvor hatte ein Sturm getobt. Die Wellen brausten heran, schienen aber nicht allzu weit den Strand hinaufzureichen, wo ein vielversprechender Spülsaum lockte. Eine Kegelrobbe in der Brandung beobachtete mich, als ich die niedrige Böschung hinunterkletterte.
Ich hob eine Eikapsel auf und ließ die zerfetzte Haut eines Seehasen liegen. Dann machte ich den Fehler, dem Meer den Rücken zuzukehren. Als ich die Welle hörte, war es schon zu spät. Das Wasser umspülte meine Beine, fast hätte ich den Halt verloren. Kurz war es ruhig, dann zog sich das Wasser zurück. Ich konnte mich auf den Beinen halten, doch es zog mich über den Strand ins Meer. Ich spürte wie damals bei meinem Radunfall, wie sich die Zeit verlangsamte und ich ganz ruhig und gelassen wurde. Der Sog des Meeres ließ nach, kurz bevor die Kiesbank in tieferes Wasser abfiel. Ich schleppte mich auf höheres Gelände und setzte mich ins Gras, um durchzuschnaufen, immer noch beobachtet von der Kegelrobbe.
Bei meinen späteren Besuchen gab es keine derartigen Zwischenfälle, doch ich bin hier gegenüber dem Meer stets auf der Hut. Das weiche Vulkangestein der Insel ist sichtlich von Stürmen gezeichnet. An diesem Ort kann man sich das Land als Körper vorstellen, empfindsam und verletzlich. Ich beneide die Robben, die sich mühelos in den Wellen bewegen, wenn ich an den Stränden von Papa Stour unterwegs bin.
•
In den Vierzigerjahren bereiste David Thompson, ein britischer Schriftsteller, Journalist und Produzent von Radiosendungen, die Küsten Irlands und Schottlands und sammelte Erzählungen über selkies. Seine Reisen und die dabei geführten Gespräche bilden die Grundlage für sein Buch Seehundgesang, eine Schatzkiste an Selkie-Mythen. Zuvor hatte ich immer wieder dieselbe alte Geschichte über einen Mann gehört, der die Robbenhaut einer schönen jungen Selkie-Frau stiehlt. Er hält sie in seinem Haus fest, bis sie eines Tages ihre Haut findet und zurück ins Meer flieht. Die Kinder, die sie ihm geboren hat, lässt sie zurück. Schockierend für die Zuhörer war früher nicht, dass die Selkie-Frau gefangen gehalten und vergewaltigt wurde, sondern dass sie sich für ihre Freiheit entschied, anstatt bei ihren Kindern zu bleiben.
Die Selkie-Sage, die Thomson auf Papa Stour festhielt, erzählt von einer Robbenjagd, die aus dem Ruder läuft, einer Selkie-Frau, die Erbarmen hat, und von der Läuterung eines Robbenjägers. Es gibt mehrere Versionen der Geschichte, hier meine eigene Nacherzählung:
Vor langer Zeit herrschte auf der Insel Papa Stour einen ganzen Sommer lang schlechtes Wetter. Die Männer konnten nicht zu den Vee Skerries hinausfahren, um dort auf Robbenjagd zu gehen. Als endlich gutes Wetter kam, warnten die älteren Männer, dass das Meer nicht lange so ruhig bleiben würde. Doch die jüngeren Männer lagen mit ihrer Pacht im Rückstand, und eine Bootsladung mit Robbenfellen würde bedeuten, dass die Frauen endlich Essen für die Kinder kaufen konnten. Also machten sie ein Boot fertig und ruderten in ihrer Verzweiflung hinaus, um auf Robbenjagd zu gehen.
Die beste Schäreninsel, um Robben an ihren Liegeplätzen zu überraschen, ist auch die, an der das Anlanden besonders schwierig ist. Doch die Männer schafften es, das Boot durch die Felsen zu navigieren und ohne Zwischenfall an Land zu gehen. Schweigend überquerten sie die tückischen Felsen. Es funktionierte, sie konnten sich anschleichen und viele Robben mit ihren Knüppeln erschlagen. Rasch schnitten sie die Haut vom Fleisch, bevor die Robben wieder zu sich kamen.
Eine plötzliche Windböe gemahnte die Männer an die Wolken, die sich über dem Atlantik zusammenzogen. Der Seegang hatte zugenommen und das Boot zerrte an der Vertäuung. Wenn es sich losriss, saßen sie auf der Schäre fest. Schnell rafften sie so viele Häute wie möglich zusammen und eilten zurück zum Boot. Einer der Männer stolperte, die Häute fielen ihm aus den Armen. Die anderen riefen ihm zu, die Häute liegen zu lassen. Aber er ignorierte sie. Als er alle eingesammelt hatte, waren die anderen schon im Boot und von den gefährlichen Felsen weggerudert. Dreimal versuchten sie, zu ihm zurückzukehren, doch jedes Mal wurde das Boot fast von einer Welle unter Wasser gedrückt. Also ließen sie den Mann zurück und machten sich auf den Heimweg.
Der Mann sank auf die Knie, denn er wusste nur zu gut, was geschah, wenn man auf diesen Felsen in einem Sturm festsaß. Schon bald würden ihn die Wellen wegreißen. Er weinte bei dem Gedanken daran, dass er seine Frau und seine Kinder nie wiedersehen würde. Doch dann riss ihn ein seltsames Geräusch aus seiner Verzweiflung; ein Klagelied, das über das Tosen der Wellen hinweg zu hören war. Er folgte ihm bis zu einer Wasserrinne, neben der eine Selkie-Frau saß und ihren Sohn beweinte, der in Menschengestalt dalag, verletzt durch Messerstiche und blutend, das Fleisch roh und rot.
Als sie den Mann sah, verstummte die Selkie-Frau. Sie starrten einander an, und er fürchtete schon, dass sie sich wütend auf ihn stürzen würde, doch sie blieb still. Der Ausdruck in ihren Augen wurde weicher und sie sagte: »Ich trage dich nach Hause zu deiner Familie, wenn du mir die gestohlene Haut meines Sohnes wiederbringst. Ohne sie muss er als Mensch an Land leben, und ich werde ihn nie wiedersehen.« Der Mann nickte. »Das werde ich«, sagte er, »aber die Wellen werden mich von deinem Rücken spülen. Darf ich in deine Haut schneiden, damit ich mich besser festhalten kann?« Die Selkie-Frau neigte zustimmend den Kopf und hielt still, als er mit seinem Messer tief in ihre Haut schnitt.
Sie schwamm mit dem Mann auf dem Rücken durch das tosende Meer. In den Tiefen von Ekkers Geo kamen sie an Land. Die Hände des Mannes waren taub vor Kälte, und er hatte Mühe, die steile Felswand hinaufzuklettern. Doch der Gedanke an Frau und Kinder trieb ihn an. Die Selkie-Frau musste nicht lange warten, bevor er wie versprochen wieder oben auf der Klippe auftauchte. Er warf die Haut ihres Sohnes zu ihr hinunter, und sie schwamm davon, zurück zu den Vee Skerries. Der Mann ging nie wieder auf Robbenjagd.
Nachdem David Thomson an den Klippen von Papa Stour entlanggewandert war, verfolgte ihn die Trostlosigkeit des kargen Ortes bis in seine Träume: »Auch an den Tod dachte ich dort, und nachts träumte ich einmal, ich wäre in die Akers Geo gestürzt.« Auch ich fürchte Ekkers Geo. Das Gelände neigt sich zum Klippenrand, und selbst wenn man sich hinlegt, scheint die Anziehungskraft des Abgrunds hier stark. Das Wilde, Raue des Ortes wird noch dadurch verstärkt, dass die Klippen des Geo eine Art Rahmen für den Blick auf die Vee Skerries bilden, die schon sehr lange mit dem Verlust von Menschenleben in Verbindung gebracht werden. Thomson wollte während seines Aufenthalts auf Papa Stour zu den Vee Skerries hinausfahren, doch das Wetter war zu schlecht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich diesen wilden Ort je besuchen würde, doch eines Tages war ich tatsächlich dort.
•
An einem schönen Tag im August 2017 ruft mich mein Nachbar John Anderson an und erklärt, er fahre eine kleine Gruppe mit dem Boot zu den Vee Skerries hinaus, ob ich nicht mitkommen wolle. Ich sage Ja, schlucke schnell ein paar Tabletten gegen Seekrankheit und nehme das Auto zum Jachthafen, wo John bereits die Motoren seiner Mary Ann laufen lässt. Er hilft mir an Bord und macht das Boot dann weiter fertig. Ich bin nervös, weil ich fürchte, mich vor den anderen übergeben zu müssen, aber auch, weil ich steife Gelenke habe. Die Leiter der Mary Ann hinunterzusteigen und in das kleine Metallboot zu klettern, mit dem wir das letzte Stück zu den Felsen zurücklegen werden, wird eine Herausforderung, und ich will kein Klotz am Bein sein. Andererseits weiß ich, dass sich John gut um mich kümmern wird. Er ist ein erfahrener Seemann und fährt an diesem Teil der Küste oft Leute hinaus, zum Sportangeln oder zum Sightseeing. Groß und kräftig und mit roten Haaren, wirkt er ein bisschen wie ein Wikinger.
John stellt mich Gibbie Fraser vor, der in seinem karierten Flanellhemd, Bluejeans und schicken Segel-Gummistiefeln eine gute Figur macht. Er schüttelt mir mit beträchtlicher Kraft und einem schelmischen Funkeln in den Augen die Hand, vielleicht hat er meine Nervosität bemerkt. Gibbie ist ein Hummerfischer im Ruhestand, der mit fünfzehn von der Schule abging, um als Walfänger in der Antarktis zu arbeiten. Ab November 1958 war er im britischen Überseegebiet Südgeorgien und vor den Sandwichinseln im Einsatz. Im Sommer, wenn der Himmel voller Küstenseeschwalben war, brach er von Shetland auf und traf im Südpolarmeer erneut auf die Schwalben, wo dann ebenfalls wieder Sommer war.
Als er nach Shetland zurückkehrte, gab es kaum Arbeit, daher ließ er sich ein Boot bauen, das er mit dem Geld aus dem Walfang bezahlte. Von da an lebte Gibbie vom Hummerfang, bis er in den Ruhestand ging. Die Hummerfallen brachte er manchmal auch bei den Vee Skerries aus. Er kennt die Vee Skerries besser als jeder andere und wird uns durch das Felsengewirr lotsen.
Im Ruderhaus bei Gibbie und John sind noch zwei Männer aus Lerwick, die übers Segeln und die Inseln reden, die sie besucht haben. Sie sehen beide deutlich älter aus als ich. Sie sind zwar keine alten Seebären, fühlen sich aber auf dem Meer wohl. Ich sitze draußen, um nicht seekrank zu werden, direkt neben Arthur, der gegenüber von uns, auf der anderen Seite des voe, wohnt. Er ist ebenfalls im Ruhestand und schon seit Jahrzehnten mit dem Boot im Meer um Shetland unterwegs. Arthur versichert mir zudem, dass der Wellengang heute viel zu sanft sei, um seekrank zu werden. Als wir ablegen, ist meine Vorfreude deshalb größer als die Angst. Wir verlassen den geschützten voe unter einer tiefen Wolkendecke und fahren Richtung Sonne. Die Wasseroberfläche ist gesprenkelt mit Gryllteisten und Papageientauchern. John drosselt die Geschwindigkeit, als eine Gruppe Schweinswale in hohem Tempo unseren Weg kreuzt und eine Gischtspur hinterlässt.
Arthur und ich unterhalten uns über die keltischen Mönche, die auf Papa Stour lebten und der Insel ihren Namen gaben: »große Insel der Priester«. Sie kamen in einfachen Booten aus Ochsenhaut, die über einen Holzrahmen gespannt war, von Irland herüber. Wir sind uns einig, dass wir uns in einem solchen Gefährt nicht aufs Meer wagen würden. Doch dann erzählt mir Arthur, dass er die Shetland-Inseln in einem kleinen Boot umrudert hat. Auf meine Frage, was ihn zu diesem Abenteuer veranlasst hat, antwortet er, dass er die Tour zum Gedenken an seine Frau unternahm, die an Krebs gestorben war. Danach sitzen wir eine Weile schweigend nebeneinander.
Vom Meer aus besitzen die Klippen von Papa Stour eine düstere Faszination. Große Höhlen klaffen auf und verschlucken weite Teile des Meeres. Leera Skerry und Fugla Skerry, die Schären des Atlantiksturmtauchers und anderer Vögel, erheben sich schroff und unzugänglich aus dem Wasser. Dann sehen wir einen Felsen, dessen Form an einen Menschen erinnert. In The Coastal Place Names of Papa Stour beschreibt George P. S. Peterson den Snolda Stack als »stehenden Mönch in einer Kutte, den Körper den fernen Vee Skerries zugewandt, den Kopf gebeugt, als ob er für die Seelen der armen Seeleute beten würde, die hier ihr Leben verloren«. Weiter draußen bringt die Sonne das Weiß des Vee-Skerries-Leuchtturms zum Strahlen, während Foula im Süden ausgestreckt daliegt, als ob die Insel das Vorankommen unseres kleinen Boots mit geheucheltem Desinteresse verfolgen würde.
Mit dem Näherrücken der Vee Skerries kehrt meine Angst zurück. Sie liegen so flach im Meer. Der Wellengang ist sehr sanft, dennoch kann ich den Gedanken an Monsterwellen nicht abschütteln. Gibbie lotst John an eine Stelle, wo die Mary Ann sicher ankern kann. Meine Beine zittern, als ich die Leiter hinunter ins Ruderboot steige. Gibbie rudert immer zwei von uns zur Nort Skerry. Als wir näherkommen, lassen sich Eiderenten von den Felsen ins Wasser gleiten. Wir sehen viele Kegelrobben, einige aalen sich auf den Felsen, andere schwimmen im Wasser. Sie beobachten uns, scheinen von unserer Ankunft aber nicht weiter beunruhigt. Ich komme beim Zählen schnell auf über hundert. Der aufmerksame Blick aus so vielen Augenpaaren macht mich nervös. Gibbie macht das kleine Boot an einem Felsen fest, während wir an Land kraxeln, und verabschiedet sich mit einem letzten Scherz, bevor er zurück zur Mary Ann rudert. Als ich eine Stelle finde, an der meine Füße festen Halt haben, schaue ich nach oben und sehe Seepocken auf Augenhöhe. Wir sind bei Ebbe angelandet. Bei Flut wäre dieser Teil von Nort Skerry unter Wasser. Sooth Skerry, auch bekannt als »The Clubb«, liegt ein bisschen höher, wenn auch nicht sehr viel. Auf der Landkarte ist eine Höhe von acht Metern über dem Meeresspiegel eingetragen, doch es gibt Tage, an denen die vom Sturm aufgewühlte Brandung höher reicht. Wir sind alle still und konzentriert. Die Felsen zu überqueren ist herausfordernd. Ich bleibe stehen, wo ich bin, und warte auf Gibbie.
Bei seiner Rückkehr erzählt er uns hocherfreut, dass er und John mehrere Fische gefangen hätten. Darunter ist auch ein waari, ein Kabeljau mit prächtig orangefarbener Haut, wie sie bei den Vee Skerries häufig vorkommen. Sie ernähren sich von Wirbellosen, die reich an Karotinoid-Pigmenten sind, weil sie den Seetang fressen, der das Wasser um die Felseninseln verdunkelt. Als wir Ormal erreichen, verlässt mich mein Mut. Der Leuchtturm und der kleine Kiesstrand sind von einem Ring aus zerklüfteten, scharfkantigen Felsen umgeben. Schon bald bleibe ich hinter den Männern zurück, selbst der Siebzigjährige aus Lerwick mit seinem kaputten Knie ist schneller. Ich bin wütend und frustriert. Ich will als Erste am Strand sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach war über den Winter niemand hier, womöglich findet man dort jede Menge interessanter Dinge. Doch die Männer gehen direkt zum Leuchtturm, sodass ich in aller Ruhe am Strand mit seinen blassgrauen Kieseln herumstöbern kann. Er ist kreisförmig mit einer erhöhten Mitte und drei konzentrischen Spülsäumen. Ich stehe im kleinsten Kreis und stelle mir vor, wie die Flut kommt und das Wasser um mich herum steigt, aber nicht an meine Füße herankommt. Die glatte Kuppel eines Robbenschädels liegt zwischen vertrocknetem Seetang. Ich zähle acht Plastikflaschen, eine Dose Sprühsahne und einen Behälter mit spanischem Lösungsmittel. Ein v-förmiges Stück Metall, rot vom Rost, liegt eingekeilt zwischen zwei großen Kieseln.
Als Arthur vom Leuchtturm zurückkommt, zeige ich ihm das Metallstück. Es ist eine Luftklappe aus einem Schiffsmotor, vielleicht von der Elinor Viking, einem Trawler aus Aberdeen, der 1977 in einer dunklen, stürmischen Nacht vor den Vee Skerries Schiffbruch erlitt. Die Rettungsmannschaft konnte das havarierte Schiff nicht erreichen. Die Besatzung wurde schließlich von einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht, kurz bevor der Trawler in Stücke brach. Von der Hubschrauberbesatzung war niemand für einen derartigen Einsatz ausgebildet, und der Mann, der die Winde bediente, kam nur knapp mit dem Leben davon, als ihn der Sturm gegen den Schiffsmast drückte. Der Leuchtturm auf Ormal wurde nach dieser Havarie gebaut, um die sichere Durchfahrt der Öltanker zu gewährleisten, die das neu errichtete Ölterminal von Sullom Voe anliefen.
Auch die anderen Männer gesellen sich zu uns an den Strand und suchen die Kiesel von Ormal nach Feuersteinen ab, Ballast aus jahrhundertealten Wracks. Sie sind leicht zu finden und riechen für mich stark nach Land. Vor dem Seefunk war der erste Hinweis auf ein gekentertes Schiff bei den Vee Skerries zersplittertes Holz, das noch nicht mit Salzwasser vollgesogen war und auf Papa Stour angespült wurde. Oder ein Kabeljau, der Getreide im Magen hatte. 1930 standen die Inselbewohner auf den Klippen von Papa Stour und beobachteten, wie die Männer, die am Mast eines havarierten Dampfschiffs, der Ben Doran, festgebunden waren, ins Meer gerissen wurden. Ein Sturm hatte die See so aufgewühlt, dass die Rettungsboote wieder abdrehen mussten.
Ormal wird im Shaetlan normalerweise als Plural verwendet und bedeutet »Bruchstücke« oder »Überreste«. Im Altnordischen kann ørmul auch »Ruinen« heißen. Ich fühle mich unbehaglich hier, zwischen dem Feuersteinballast, der von gekenterten Schiffen stammt, und den Bruchstücken von wahren und erfundenen Geschichten, auf Felsen, auf denen einst die reglosen Körper erschlagener Robben und ertrunkener Seeleute und Passagiere lagen. Die Fragmente schwirren durch meinen Kopf wie die Schwärme der Watvögel, die die Felsen umkreisen und sich nie lange niederlassen, bevor sie wieder auffliegen.
Schon bald ist es Zeit zu gehen. Der Seegang hat zugelegt, und im Ruderboot zurück zur Mary Ann ist Gibbie schweigsam und macht ein ernstes Gesicht. Das einzige Geräusch sind die Ruder auf der Wasseroberfläche. Doch als wir wieder an Bord sind, entspannen sich alle und freuen sich daran, etwas Waghalsiges unternommen zu haben und nun, zurückgekehrt, davon erzählen zu können. Für den Rückweg übernimmt Gibbie das Steuer, während John uns Tee macht und ein Päckchen Vollkornkekse herumreicht.
•
Fünf Tage voller Anspannung vergehen, in denen mich das Wetter davon abhält, zu den Klippen zurückzukehren, um nachzusehen, ob die neugeborenen Robben überlebt haben. Ein heftiger Sturm folgt auf den anderen, und Orkanböen mit einer Windgeschwindigkeit von fast hundert Stundenkilometern rütteln an unserem Haus und sorgen dafür, dass wir drinnen bleiben. Der erste Stromausfall des Winters trifft uns unvorbereitet, wir müssen erst einmal nach Taschenlampen und neuen Batterien suchen. Der Sturm kommt von Westen und fällt mit dem Vollmond zusammen, was für eine besonders hohe Tide sorgt. Die Westwinde drücken das Wasser noch ein Stück weiter landeinwärts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kleinen überlebt haben.
Am sechsten Tag lässt der Wind nach. Kaum ist der Schulbus mit unseren Kindern weg, brechen mein Mann und ich zur atlantikseitigen Küste auf. Das Meer wirkt gefüllt bis oben hin, und die Spülsäume liegen hoch oben im Gras, als wolle das Meer seine Macht verdeutlichen. Von den Klippen aus wirkt Foula sehr weit weg. Der Himmel ist grau, durch die Wolkenlücken fällt etwas Sonne und lässt einzelne Stellen im dunklen Meer aufleuchten. Schweigend gehen wir zum ersten Robben-Geo. Nur eine einzelne weibliche Robbe liegt am Strand; es sieht nicht so aus, als ob sie tragend wäre, ein Junges ist aber ebenso wenig zu sehen.
Bevor wir das zweite, geschützte geo erreichen, hören wir schon die Rufe der Robben durch den Lärm der Wellen. Wir beschleunigen unsere Schritte und verlangsamen sie erst wieder vor der Kliffkante. Der Wind bläst stetig zum Land hin, doch die gelegentlichen Böen machen uns vorsichtig. Wir legen uns auf den Bauch und kriechen mit der Unbeholfenheit einer Robbe an Land zur Abbruchkante.
Ein rundes weißes Junges treibt in den Wellen, lebt aber noch. Es hat auch die letzten Tage überstanden, offenbar sogar richtig gut, so wie es aussieht. Aber jetzt ist es nass und muss kämpfen, um sich über Wasser zu halten. Die Mutter schirmt es mit ihrem Körper ab, damit es nicht wegtreibt. Die hereinschwappenden Wellen überspülen beide. Bei jeder Welle gerät das Junge ins Schwimmen und wird vom Meer hin und her gerollt wie ein Fass. Fließt das Wasser ab, dreht es sich aus eigener Kraft wieder auf den Bauch und jammert.
Nach einigen Minuten beginnt die Mutter, den Strand hochzurobben, und das Junge folgt ihr langsam. Dann sehen wir, was sie davon abhält, das sichere Gelände zu erreichen: Eine andere Robbe blockiert den Weg und verteidigt die höher gelegene Stelle mit gefletschten Zähnen. Sie hat ebenfalls ein Junges. Es ist mollig und rund, mit glänzendem, trockenem Fell. Die Robbe mit den gefletschten Zähnen hievt sich Richtung Meer und greift die in der Brandung feststeckende Robbe an. Das nasse Junge wird fast zwischen den beiden erwachsenen Tieren zerquetscht, doch dann krabbelt das trockene Junge seiner Mutter hinterher und wird von einer Welle erwischt. Derart abgelenkt, zieht die Mutter sich wieder auf trockenen Boden zurück, gefolgt von ihrem durchnässten Jungen. Die Robbe, die mit ihrem Jungen in der Brandungszone festsaß, nutzt die Gelegenheit und robbt ebenfalls auf trockenes Gelände.
Nachdem das Drama ausgestanden ist, lassen wir den Blick über das restliche geo schweifen und schieben uns langsam um den Klippenvorsprung herum, um die gesamte Bucht zu überblicken. Wir zählen insgesamt sieben Junge. Erst nach einiger Zeit fällt uns die Blutspur auf den Kieseln auf. Sie beginnt am Wasser und zieht sich hinauf bis zum trockenen Gelände am Fuß der Klippen. Dort liegt eine Robbe auf der Seite. Ihre Schwanzflossen sind mit frischem Blut überzogen. Ein winziges Junges mit sauberem Fell nuckelt Milch, es ist nur Haut und Knochen, scheint aber fit und lebendig. Als sich die Mutter bewegt, lässt das Junge die Zitze los, ein kleiner weißer Milchbart ziert das Fell um die Schnauze. Ich muss an die Kegelrobbe denken, die ihr Junges in den Wellen verloren hat. Ob ihre Milch noch ins Salzwasser des Meeres sickert?