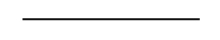
Ludwig will Chefarzt werden. Statt die Schlachten am Computer auszutragen, entwirft er nun reale strategische Pläne. Sein Chef geht in Rente, doch es gibt noch einen Konkurrenten, und den gilt es auszustechen.
Sie sind wieder komplizenhaft verbunden. Stimmung wie in einem Feldlager. Abends bringt er Hamburger mit, und sie halten Kriegsrat am Küchentisch. Doch irgendwann hat April das Gefühl, sein Beschwörungston habe sich in ihrem Kopf eingenistet. Sogar in ihren Selbstgesprächen wird sie diesen Ton nicht los, der auch Faye aufgefallen ist.
Du redest so komisch, sagt sie, übst du für ein Theaterstück?
April erzählt ihr, was gerade passiert, und Faye sagt: Männer spielen gerne Krieg. Du musst da nicht mitmachen. Oder ist es das, was du willst?
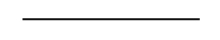
Die Besuche bei Ludwigs Eltern laufen stets ähnlich ab. Seine Mutter begrüßt ihren Sohn mit einem hämischen Blick, weil sein Hemd befleckt ist, das Tweedsakko zerknittert, die Schuhe nicht geputzt. Doch dann sagt sie versöhnlich: Ich habe dein Lieblingsgericht gemacht. Sie trägt falschen Schmuck um den tief gebräunten Hals, Stiefel, als würde sie zum Reiten gehen, ihr Haar noch heller blondiert. Der Vater nimmt sein Essen, nickt ihnen zu und verschwindet auf den Dachboden, der Fernseher ist immer eingeschaltet. Ludwigs Mutter redet mit demonstrativer Fürsorglichkeit auf ihren Enkel ein. Nach dem Essen setzt sich Ludwig vor seinen alten Computer. Es ist bedrückend im Haus, deshalb ist sie erleichtert, als Ludwigs Mutter sagt: Kommt, wir gehen raus. In dem großen, verwilderten Garten kämpfen sich Rosenbüsche durch Brennnesseln und Gestrüpp, an der alten Kastanie hängt eine Schaukel. Sam kreischt vor Vergnügen, wenn April die Schaukel anschubst und er durch die Luft fliegt. Ludwigs Mutter redet mit ihr, als wären sie enge Freundinnen, obwohl sie ihre Vertraulichkeiten vage formuliert: Riskiere nie, verlassen zu werden, und stell es schlau an, wenn du auf deine Kosten kommen willst.
Glaubst du, deine Mutter hat einen Liebhaber, fragt sie Ludwig auf der Heimfahrt.
Seine heftige Reaktion überrascht sie. Das geht uns nichts an. Jeder hat seine Leichen im Keller, und da sollen sie bleiben. Es ist besser, nicht alle Türen zu öffnen, sagt er, als würde er die Symptome einer unheilbaren Krankheit benennen.
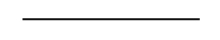
Julius äfft ihr Seufzen nach, wann immer er es wahrnimmt. Er weigert sich, mit ihnen die Familie von Ludwig zu besuchen, hat keine Lust, am Familienleben teilzunehmen. Er und sein Vater gehören zusammen, das vermittelt er ihr nachdrücklich, und sie lässt ihn in Ruhe. Julius runzelt die Stirn, wie sein Vater, bevor sie auch nur begonnen hat, einen Satz auszusprechen.
Als sie mit Ludwig über ein Wochenende verreist, bleibt Julius allein zu Hause und Sam bei seiner Großmutter. Bei ihrer Rückkehr ist Sams Gesicht rot. Blasse Haut ist völlig ungesund, sagt Ludwigs Mutter. Der Kleine musste mal unter die Sonnenbank. Julius öffnet ihnen verkatert die Tür, antwortet auf keine ihrer Fragen. April ist wütend, aber Ludwig zuckt mit den Schultern, sagt: Ist doch lustig. Sie begreift, dass ihn das alles nicht interessiert, ein kleiner Sonnenbrand, was ist das schon – er sieht die wirklich schlimmen Sachen auf seinem OP-Tisch. Julius scheint ihm egal zu sein; Ludwig plaudert mit ihm, fragt ab und an nach seinen Noten, doch sie spürt: Er hört nicht zu.
Während die Tage im Alltagstrott vergehen, sitzt ihr eine vage Unruhe in den Kniekehlen. Sam ist ein neugieriges Kind; wenn er sich unbeobachtet fühlt, plappert er vor sich hin, als würde er sich selbst Geschichten erzählen. Manchmal sieht er sie bestürzt an, als wäre er in einem menschenleeren Kosmos verloren oder dabei, verloren zu gehen – doch es ist ihr Blick. Sie fragt sich, ob ihr diese Liebe zusteht, die ihr Herz weit macht und sie zugleich ängstigt; und dann die Schuldgefühle: Es ist ungerecht für Julius, bitter, dass sie so nicht für ihn empfinden kann. Sie streiten sich oft, sogar im Kino, kaum ist der Film zu Ende. Julius vertritt den Filmhelden, der meint, aus Liebe und Würde sterben zu müssen, April zieht das Leben vor, wütend und stur verteidigt sie etwas, das sich bei ihr längst in ein Vakuum verflüchtigt hat. Julius sieht seine Mutter an, als wäre sie längst durch mit ihrem Leben. Er ist sechzehn und lebt seine Unzufriedenheit auf eine aufreizende lethargische Art. April versucht vorsichtig mit ihm umzugehen, doch es dauert nicht lange und sie betrachten sich wieder mit fremden Blicken. Er spricht mit ihr, als wäre er verschnupft, während sie seine Verletzlichkeit nicht wahrnimmt, nur seinen Spott. Sein Leben kommt ihr vor wie ein Zeittotschlagen, und diese Vorstellung macht ein Mitfühlen unmöglich; sie hat vergessen, wie es ist in diesem Alter, sie spielen nicht in einem Team, jeder Streit lässt sie mehr zu Gegnern werden.
Als Julius ihr mitteilt, dass er zu seinem Vater ziehen möchte, sind ihre Versuche, ihn umzustimmen, halbherzig. Sie lässt ihn gehen, traurig und erleichtert, ihren Sohn in der väterlichen Obhut zu wissen. Sein Vater akzeptiert ihn so, wie er ist. Sie hingegen reagiert wütend und kategorisch, wenn sie ihn beim Kiffen erwischt, beim Schulschwänzen; und manchmal weiß sie, er gleicht ihr, das macht sie noch hilfloser.
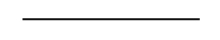
Auf dem Spielplatz lernt sie eine junge Äthiopierin kennen, ihr Sohn ist in Sams Alter. Almaz ist selbst an den trübsten Nachmittagen gut gelaunt, liebenswürdig und ironisch, gibt ihrem Sohn Cola, ohne auf die missbilligenden Blicke der anderen Mütter zu achten. Sie reden über Gott und die Welt; wenn Almaz sich verabschiedet, empfindet April ein Gefühl der Verarmung. Sie wäre gerne so wie Almaz, doch ihre Energie verpufft, sobald sie mit Ludwig zu Abend isst. Sie will ihm von Almaz erzählen, doch er spricht nur von seinem Krieg. Während er ihr seine neuen Taktiken darlegt, ist sie in den Anblick einer Motte versunken, hell und durchsichtig, wie frisch geschlüpft. Als Ludwig sagt: Um zu siegen, muss man sichtbar sein, bricht sie in Tränen aus.
Als sie Tage später den Kleiderschrank öffnet, fliegen ihr Motten entgegen, und für eine Weile, die ihr unerträglich lang vorkommt, steht sie da, erkennt, wer sie ist und wer sie sein könnte. Sie meint die Geräusche zu hören, die die Motten im Flug machen, und weicht zurück. Dann hält sie ihren Lieblingspullover gegen das Licht und entdeckt, dass er durchlöchert ist. Auch die anderen Sachen sind porös und durchsichtig, die Mottenlarven haben wie Einbrecher gearbeitet, Tunnel und Schächte hinterlassen.
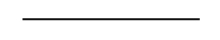
Sie besuchen Ludwigs Großmutter im Pflegeheim. April hat ihr den Namen »Fräulein Luft« gegeben, weil sie so klein und leicht ist; eine fragile Hundertjährige, die seit Monaten im Bett liegt, den Geruch nach ungelüfteter Kleidung verströmt und einem vertrockneten Vögelchen ähnelt. Auch ihr berichtet Ludwig von seinen kriegerischen Aktivitäten, Sam sitzt daneben und hält ihre Hand. Ludwig führt mit großer Geste aus, wie die Hand seiner Großmutter Bismarck berührt haben könnte und diese nun wiederum ihren Urenkel berührt: eine Verbindung über die Jahrhunderte hinweg. Dann versucht er zu scherzen, erzählt eine Geschichte, in der die Zeugen Jehovas an der Tür seiner Großmutter geklingelt haben.
Weißt du noch, fragt er sie, du hast in Pantoffeln und Morgenrock geöffnet, und als sie sagten, du kämst in den Himmel, genau so, wie du vor ihnen stehen würdest, warst du dermaßen wütend, dass du ihnen die Tür vor der Nase zugeknallt hast.
Seine Großmutter verharrt wortlos in ihrem Zwischenreich, doch beim Abschied hat April das Gefühl, sie würde ein Vögelchen umarmen, das überraschenderweise noch immer starke Flügel hat.
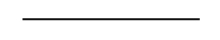
Ludwig hat keinen Bruder. Seine Mutter muss vor Lachen nach Luft ringen, so komisch findet sie die Vorstellung, noch einen Sohn zu haben, dazu einen, der bei der NATO arbeitet. Es ist eine der letzten Lügen, die April ihm hatte glauben wollen – vielleicht weil es eine der ersten war. Sie spricht ihn nicht darauf an – ihr ist klar, Lügen machen Ludwigs Leben erträglicher, vielleicht sogar freudvoller. Erstaunt ist sie nur über ihre eigene blöde Gutgläubigkeit.
Ludwig ist davon überzeugt, dass nur kostspielige Dinge Qualität haben, sogar das Toilettenpapier muss teuer sein. Es ist, als würde das Preiswerte ihn an seine Klassenherkunft erinnern. Wenn er mit Bekannten oder Kollegen spricht, lässt er seine Vergangenheit in einem gehobenen Milieu stattfinden. April empfindet keine Scham über ihre Herkunft, gleichwohl auch sie versucht, ihr zu entrinnen. Sie hat keine Lust, mit Ludwig darüber zu streiten, was gut oder schlecht ist, und so trickst auch sie ihn mit kleinen Lügen aus – überklebt die billigen Etiketten mit teuren. Was sie ihm unterjubelt, sind keine schlechten Sachen, und als sie Ludwig einmal von ihrem Betrug erzählt, lacht er laut. Auch über ihre anderen Tricks lacht er: Sie hat ein Pferdehaar durch eine Zigarette gefädelt, um Ludwig vom Rauchen abzubringen, ihm dramatisierend berichtet, die Polizei wolle ihn sprechen, weil er noch nie eine Steuererklärung abgegeben hat. Er raucht weiter, macht aber einen Termin bei der Steuerberaterin. Wenn Ludwig ein schlechtes Gewissen hat, schlägt er ihr vor, sie solle sich etwas Gutes leisten. Sie kauft sich ihre erste Handtasche, teure Kosmetik; für Ludwig kauft sie Anzüge, die er zu Hause anprobiert, April steckt den Bund und die Nähte ab, bringt die Sachen in eine Änderungsschneiderei.
April bewundert das Haar von Almaz; so dicht und glänzend. Ihre Freundin zeigt ihr einen afrikanischen Laden, in dem es Haarteile zu kaufen gibt. An einem Abend sitzt April bei einer Bekannten von Almaz in der Küche und versucht ihr mit Händen und Füßen zu erklären, wie sie aussehen will. Die Bekannte ist Friseurin und spricht nur Englisch und Französisch, ein riesiger Bob Marley mit wild fliegenden Dreadlocks ist an die Wand gemalt, im Fernsehen läuft laut MTV. Die Augen der Friseurin sind hinter einer dunklen Sonnenbrille verborgen. Während sie Aprils Haare zu zahlreichen Zöpfen flicht und resolut auf ihrem Kopf zusammensteckt, singt sie laut und falsch einen ABBA-Song. Dann näht sie die Haarteile auf die festgezurrten Zöpfe und trifft mehrmals mit der Nadel die Kopfhaut. April jault vor Schmerz auf, doch das bekümmert die Friseurin nicht, sie raucht ihren Joint, krächzt nach jedem Zug und singt weiter. April kommt es vor, als würde sie Jahre so verbringen. Als sie den Atem anhält, schießen ihr Tränen in die Augen, denn für einen Augenblick begreift sie, dass sie immer schon den Atem angehalten hat, ihr ganzes Leben lang. Die Nacht vor dem Fenster wird schwarz, die Frisöse hat ihr Werk beendet, führt sie ins Badezimmer. April weiß nicht, was sie erwartet hat, auf jeden Fall nicht das, was sie im Spiegel sieht: ein Gesicht, von dem sie nicht will, dass es ihres ist; sie ähnelt einem Musketier aus den Fünfzigerjahrefilmen, langes Haar fällt aus einem Mittelscheitel, rahmt links und rechts das schmale Gesicht, die Nase sticht heraus, der Blick verzweifelt, leicht irre. Es dauert Ewigkeiten, bis die Friseurin sämtliche Haarteile wieder abgetrennt hat, die Zöpfe entflochten sind. Ihr Stundenlohn ist exorbitant, sie ist vollkommen stoned, als April sich verabschiedet.
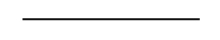
Sie sprechen darüber umzuziehen. April studiert die Immobilienanzeigen und ruft Makler an. Schon beim ersten Besichtigungstermin sagen sie zu, und diesmal mag April ihren neuen Wohnort. Eine kleine Villa in Winterhude, hohe, prachtvolle Räume, auf einer Anhöhe gelegen, in der Ferne das Wasser, die Terrasse geht auf einen parkähnlichen Garten. April kundschaftet ihre neue Umgebung aus. Sie feiern Sams Schulanfang und laden Almaz und ihren Sohn ein. Sie geht ins Kino, mit Ludwig in Restaurants, überredet ihn zu einem Picknick. Sie lernt Apfelkuchen backen und kauft einen Tortenheber.
Doch Faye erscheint auch hier, und April beginnt sofort mit ihren Klagen.
Du hast einen Vollhau, antwortet Faye. Es ist fabelhaft hier. Schau dich um.
Natürlich ist der Garten schön. Rosen, so weit das Auge reicht.
Berlin, Berlin, äfft sie April nach. Wärst du doch dageblieben!
Sie versucht es ihr zu erklären. In Berlin ist eine Frau auf dem Fahrrad eine Frau auf dem Fahrrad. In Hamburg wird die Frau auf dem Fahrrad sofort taxiert: sozialer Status, Alter, Schönheit.
Mit dir stimmt was nicht, sagt Faye, wie kann man freiwillig unsichtbar sein wollen.
Neben der Villa gibt es ein verwildertes Grundstück, auf dem Schafe grasen. April steht oft davor und versucht zu denken: Hier gefällt es mir.
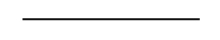
Sie haben ein kleines Haus auf Usedom gemietet. In den Tagen vor ihrer Abreise albern sie ausgelassen mit Sam herum; Ludwig versucht ihm einzureden, jeder müsse etwas in das Ferienhaus mitnehmen, Sam sei für die Badewanne verantwortlich und schlägt ihm vor, die Wanne mit Rädern hinten am Zug zu befestigen.
Im Schlafwagen erzählt sie Sam von ihrer Kindheit an der Ostsee. Nachdem er eingeschlafen ist, liegt sie noch lange wach, stellt sich ihren Bruder Alex vor, in kurzen Lederhosen, mit seinem unglücklichen Gesicht. Er hatte im Hochsommer einen Leistenbruch; wenn er losheulte, musste sie ihm in der Hitze seine Hosen hinunterziehen und die Beule in die Leiste zurückdrücken. Sie sieht sich als Kind, selbst nach all den Jahren kriecht ihr noch ein Frösteln in die Glieder; in ihrem Zuhause bedeutete ein falscher Schritt ein Schritt ins Unheil. Es gab keine verlässlichen Vorgaben, es war immer falsch, wie sie sich verhielt – das war die einzige Konstante in ihrer Kindheit.
Als sie früh am Morgen ankommen, werden sie schon von Ludwig am Bahnsteig erwartet. Er ist mit dem Auto gefahren und hat das Gepäck transportiert. Voller Vorfreude fahren sie dem Meer entgegen, sie singen laut, falsch und vergnügt so lange gegen das Blau des Himmels an, bis sich eine Wolke zeigt.
Das Haus ist gemütlich und hat eine Badewanne, wie Sam gleich feststellt. Es ist der Urlaub der Was-wäre-wenn-Geschichten. Was wäre, wenn Zwerge Riesen wären und Riesen Zwerge, fragt Sam. Als Ludwig mit einem Kollegen telefoniert, erzählt er diesem, er würde gerade in Indien durch die Provinzen fahren. April fragt sich, was wäre, wenn Ludwig nichts erfinden würde.
Es ist ein kühler September, über dem Meer nähert sich eine Gewitterfront, Ludwig stürzt sich dennoch ins Wasser. April wartet mit dem geöffneten Handtuch auf ihn. Siehst du, sagt er stolz. Die Rufe der Möwen begleiten ihre Wanderungen, sie stehen in den Dünen, sehen zu, wie die Wellen zu Gischt werden und im Sand verlaufen.
Ludwig kann sich nur schwer an die Ruhe gewöhnen, schon nach wenigen Tagen vermisst er seine Arbeit, den abklingenden Schrecken nach einer schwierigen OP, das Gefühl, davongekommen zu sein. Drei Wochen ohne Drama, wie soll ich das durchhalten, sagt er.
Sie überraschen Sam mit einer Schatzsuche. April hat funkelnden Tinnef, einen silbernen Totenschädel, bunte Ketten und Ringe, Miniaturtiere und Geister in eine verwitterte Holzkiste gepackt. Die Schatzkarte findet Sam abends unter seinem Kopfkissen. Am nächsten Morgen ziehen sie los und graben abwechselnd, bis sich die Kiste unter Sand und Steinen zeigt. Das kann Ludwig gut: sich an Sams Freude freuen.
In diesem Urlaub hat April die sprichwörtlichen Hosen an. Sie fordert Sex ein, plant ihre Unternehmungen. Sie ist es, die die Familie beschützt: Im Wald rennt ein zottliges Vieh laut bellend auf sie zu, und während Ludwig sich im Rückwärtsgang davonschleicht, bleibt sie stehen, Sam hinter sich, und weist den Hund zurecht, der ihr wundersamerweise gehorcht und sich zurückzieht.
Wenn Ludwig einen Brunnen sieht, wirft er ein Geldstück hinein und wünscht sich etwas. In Zinnowitz versteckt er eine Münze im Mund einer steinernen Figur. Ein Jahr später, als sie wiederkommen, ist die Münze immer noch da, auch im Sommer des darauf folgenden Jahres.
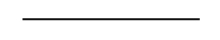
April spürt den nahenden Winter, als sie in der Dämmerung zwischen den Rosenbeeten das Unkraut zupft. Es beginnt zu regnen, Tropfen rinnen aus ihrem Haar in den Nacken.
Der Geruch vom Fluss weht herüber. Die Fenster im Haus sind hell erleuchtet. Sie sieht Sam mit seiner Ratte spielen, das neueste Haustier, nachdem seine Heuschrecken vertrocknet und die Fauchschaben den Wärmetod gestorben sind.
Sie sieht jede Einzelheit vor sich, Laub, welke Rosenblüten, das dunkle Gefieder der auffliegenden Amsel. Warum fühlt sie sich nicht geborgen?
Ich liebe dich, sagt Ludwig. Ich liebe dich so sehr, dass es mir den Atem nimmt. Du bist mein Goldstück, mein Leben. Er ist ihr derart zugewandt, dass sie ihn kaum wiedererkennt. Was soll ich tun, fragt er. Er steckt in Schwierigkeiten. Sein Konkurrent ist ebenfalls in den Kriegsmodus getreten. Die anderen Kollegen beschuldigen Ludwig der Unkollegialität. Dann die Anästhesistin, die sich geweigert hat, am späten Nachmittag ihre Arbeit bei einer großen OP zu verrichten, weil sie nicht in der Lage war, sich einen Babysitter zu besorgen. Ludwig hat sie vorgeführt, gehöhnt, sie solle sich keine Kinder anschaffen und dergleichen mehr, und dann habe diese Kuh den Personalrat informiert: Ludwig hätte sie mit seiner Herabsetzung traumatisiert. Das Schlimmste aber ist, dass Ludwig bei der OP eines Chirurgen aus dem Haus einen Fehler gemacht hatte. Wie konnte ich nur, ruft er, niemals soll ein Chirurg einen Kollegen operieren. Und niemals wird er sich bei dieser Schlampe entschuldigen. Ludwig kann keine Schwäche zeigen. Die Angst, sich selbst zu befragen, ist zu groß. Er besteht darauf, ein einfacher Mensch mit einem ganz klaren Leben zu sein. Wann immer es ihm möglich ist, geht er mit April und Sam spazieren. Zu Hause trinken sie heißen Kakao und essen Apfelkuchen. Ludwig sagt, wie sehr er sich wünsche, einen einfachen, unkomplizierten Beruf zu haben, er habe die stinkenden Organteile, die widerwärtigen Körperflüssigkeiten satt, die morgendlichen Meetings. Ohne euch würde mir das alles die Seele zerfressen, sagt er.
Die Seele, fragt sie.
Ja, sagt er, mach die Augen zu, halt still. Er legt ihr eine Perlenkette um den Hals, schiebt sie sanft vor den Spiegel.
Er ist liebevoll, aufmerksam, probiert sogar, für Sam und April zu kochen. Sauerkraut und Würstchen, das Räuber-Hotzenplotz-Essen. Er bringt Sam bei, Fahrrad zu fahren, geht mit ihm in Museen, ins Kino. Als Sams Ratte von der Tierärztin wegen eines Tumors aufgegeben wird, operiert er sie selbst. Er narkotisiert das Tier, schneidet mit einem Skalpell durch das rasierte Fellchen, entfernt den Tumor, näht die Ratte wieder zusammen – und sie überlebt, Sam ist begeistert.
In seinen Computerspielen bestellt Ludwig nun Land wie ein Bauer, bepflanzt Äcker und Felder, versorgt Hühner. Er versucht seine Feinde auf seine Seite zu ziehen, Normalität vorzutäuschen. Diese Normalität ist anstrengend für April; Gäste bevölkern plötzlich das Haus. Sie strengt sich an, eine passable Gastgeberin zu sein. Sind sie allein, will Ludwig sofort wissen: Wurde mir geglaubt, hab ich zu viel gesagt?
Warum entschuldigst du dich nicht, fragt sie.
Es ist ihm ganz und gar unmöglich. Er fühlt sich durch die geringste Kritik infrage gestellt. Sein Mantra ist: Ich habe doch gar nichts getan. Warum ausgerechnet ich? Er hält es nicht aus, über sich zu sprechen, er wird panisch, ein Nichtschwimmer auf offener See. Lieber schmiedet er Rachepläne. Der Hass auf seine Feinde hat auch physische Auswirkungen. Er steht vor ihr, als würde ein Sturm über ihn hinwegfegen, sein Herz galoppiert wie ein in die Enge getriebener Gaul, er hat Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Depressionen wechseln mit Euphorien. Er besteht darauf, ihr einen Pelzmantel zu kaufen, einem Bettler drückt er einen Fünfzigeuroschein in die Hand; er liebe die einfachen Leute, sagt er.
April findet die Briefe, als sie wie gewöhnlich seinen Schreibtisch aufräumt. Nach jedem Vortrag, den er schreibt, ähnelt sein Zimmer einem Schlachtfeld. Überfüllte Aschenbecher, leere und halb volle Flaschen Mezzo Mix, vollgekritzelte Zettel, Zeitungen, Bücher – all diese Dinge räumt sie wieder an ihren Platz. In dem Brief an April steht, dass kein Mensch sie so geliebt habe wie er, dass sie stark sein solle, auch für Sam. Es sei eine Erlösung für ihn. In den Abschiedsbriefen an die Kollegen ist zu lesen, dass er nicht als Betrüger dastehen wolle, es sei Rufmord gewesen – ein Mordversuch mit tödlichem Ausgang. Er notiert, wer nicht zu seiner Beerdigung kommen darf, und nie sollen jene vergessen werden, die ihm das angetan haben; es folgen Namen. So viel Hybris und kindliche Kränkung in den Zeilen, sie ist fast gerührt.
Sie spricht ihn darauf an und Ludwig sagt, er könne so nicht weiterleben, die Schmach sei ihm unerträglich. Obwohl er ihr so nahe ist, weiß sie nie genau, was in ihm vorgeht. Sie hat ihn beobachtet: Er wirkt niedergeschlagen, schwach, doch im nächsten Augenblick schmiedet er Urlaubspläne, spricht von Vergeltung, entwirft lustvoll seinen Rachefeldzug: Jeden einzelnen seiner Feinde wird er in den Ruin treiben. Er erinnert sie an Edmund Dantes, den Grafen von Monte Christo; sie nimmt seine Worte nicht ernst, aber seine ausdauernde Besessenheit befremdet sie. April erzählt von ihrem Vater, einem grandiosen Selbstmörder, ja, auch das. Doch diese Geschichte interessiert ihn nicht, weil sie ihn nicht betrifft.
Daran wirst du nicht sterben, sagt April und spürt, wie kraftlos sich dieser Satz anhört: obwohl sie meint, was sie sagt, sind auch ihre Worte dahingesagt; sie kann ihm genauso wenig helfen wie er ihr.