Tabelle 3: Übersicht On- und Offline-Medien.
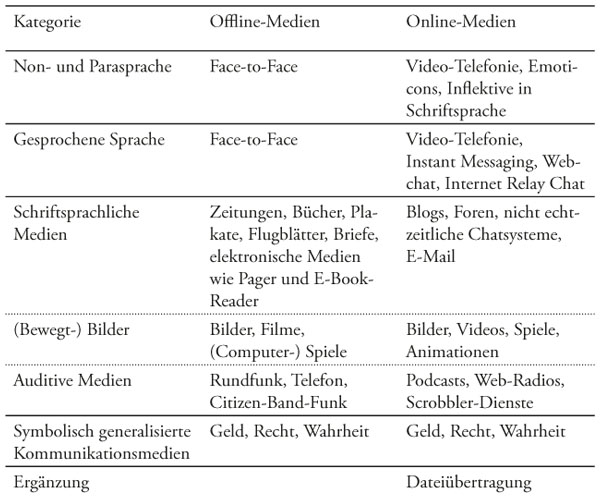
Mit Neuberger (2009: 22ff.) lassen sich die technischen Aspekte des Internets (im Sinne von Potenzialen) von den institutionellen und immer auch selektiven Aneignungen dieser Möglichkeiten unterscheiden. Im letzten Abschnitt wurden hierzu bereits wichtige Eigenschaften des Netzes vorgestellt. Das »multioptionale Potenzial« des Internets (Neuberger 2009: 22) verteilt sich (in Abgrenzung zu klassischen Medien) auf mehrere Dimensionen. Ruft man sich die eingangs vorgestellte Unterscheidung in Medien und Kommunikation nach Luhmann noch einmal in Erinnerung, ist zunächst festzuhalten, dass hier weiterhin die Medienseite von Interesse ist. Es geht also noch nicht darum, was kommuniziert wird, sondern welche medialen Möglichkeitsspielräume zur Verfügung gestellt werden. Es kann angenommen werden, dass diese Spielräume sehr groß sind, da das Internet als Plattform für verschiedene klassische Medien fungiert. Im Folgenden werden Analysedimensionen, die vor allem in den Kommunikationswissenschaften gebräuchlich sind, zu einem Raster zusammengefasst, mit dessen Hilfe klassische Medien mit ihren Online-Entsprechungen kontrastiert werden können. Die Annahme besteht nun darin, dass gerade aus der Gegenüberstellung von beiden Medien die Eigenschaften des Internets sichtbar werden.
Vor dem Hintergrund der Frage, welche Eigenschaften das Internet aufweist und wie sie den Prozess der Mediatisierung von Offline-Kommunikationen beeinflussen, zeigen sich allerdings zwei entscheidende Fehlstellen. Erstens muss analysiert werden, welche Potenziale des Internets denn tatsächlich in welchem Umfang genutzt werden und zweitens ist von Bedeutung, wie die Nutzung des Internets die Eigenschaften des Mediums beeinflusst. In Bezug auf den zweiten Aspekt muss Castells (vgl. 2004: 388) Gedanke ernst genommen werden, aus den Eigenschaften der Botschaft resultierten die Charakteristika des Mediums (vgl. Neuberger 2009: 29). Damit ist gemeint, dass beispielsweise eine Tendenz zum Videostreaming bei gleichzeitigem Rückgang der Chatnutzung Einfluss auf das Internet haben, insofern vorrangig bewegte Bilder anstelle von Zeichen übertragen werden. Jedoch handelt es sich nicht um Entweder-Oder-Alternativen, sondern um fließende Übergänge. Gleichwohl ist offensichtlich, dass das von der E-Mail- und dem WWW geprägte Internet der neunziger Jahre bis heute zahlreiche Veränderungen erfahren hat.
Die Analyse der medialen Eigenschaften des Internets ist in der Regel auf einzelne Medien der Internetkommunikation (Instant Messaging, E-Mail, Video-Telefonie) beschränkt, jedoch wurde es bisher verpasst, » […] die Nutzung von Medien im Gesamt der medialen wie nicht-medialen kommunikativen Alltagsaktivitäten zu verorten und so dem allumfassenden Charakter einer Telematisierung kommunikativen Handelns gerecht zu werden« (Gebhardt 2008a: 76). Soll nun die Gesamtheit an Kommunikationsphänomenen betrachtet werden, kommt man nicht umhin, die Einzelphänomene zu betrachten. Allerdings müssen die Einzelbefunde in einem weiteren Schritt zusammengeführt werden. Um die medialen Eigenschaften des Internets beleuchten zu können, wird eine konstrastierende Perspektive zu klassischen Medien eingenommen. Es soll also zunächst untersucht werden, wodurch klassische Medien charakterisiert sind, um dann prüfen zu können, welche Eigenschaften im Internet gebündelt, verstärkt oder auch bedeutungslos werden. Um die Innovationen des Internets nicht aus der Betrachtung auszuschließen, muss an einigen Stellen über die Grenzen der konstrastierenden Perspektive hinweg nach den Eigenschaften der Internetkommunkation gefragt werden.
Die erste Herausforderung besteht zunächst in der Zuordnung der einzelnen Medien. Während etwa die E-Mail recht deutlich eine Brieffunktionalität einnimmt, ist beispielsweise nicht klar, ob neben dem Video-Anruf auch ein Echtzeit-Chat als funktionales Äquivalent des klassischen Telefonierens angesehen werden kann. Es müssen notgedrungen Kompromisse gemacht werden, um der Crossmedialität vieler Einzeldienste gerecht zu werden. Die unterstehende Tabelle gibt zunächst einen Überblick über die Medien, die nachfolgend zu diskutieren sind. Es handelt sich dabei nicht um eine vollständige Auflistung aller Medien, die der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden können. Vielmehr wurde versucht, eine Auswahl an wichtigen Medien zu treffen.
Es können drei Kategorien von Medien unterschieden werden: Non- und parasprachliche Kommunikation wird über Mimik und Gestik realisiert und findet ihrer Online-Entsprechung in der Bewegtbildübertragungen wie in den Emoticons, in speziellen Abkürzungen und in Inflektiven. Die zweite Gruppe umfasst Kommunikationsmedien im engeren Sinne und unterscheidet schriftsprachlichen Austausch von gesprochener Sprache, von visuellen und von auditiven Medien. Die heterogene Gruppe schließt einerseits technisch gestützte Massenmedien, andererseits auch Individualkommunikation14 ein. Neue Formate, wie Podcasts, reine Web-Radios und Webseiten, die auf Basis der Vernetzung und Kompilierung individueller Vorlieben ein personalisiertes Programm bieten (sogenannte Scrobbler), stellen die Unterscheidung in Massen- und Individualkommunikation allerdings infrage. Den dritten Komplex bilden die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien. Wenngleich Luhmanns Konzeption dieser spezifischen Medien vielfach Beachtung fand, liegen bisher nur wenige weiterführende Untersuchungen dazu vor. Dementsprechend wird hier versucht, zunächst exemplarisch für drei Medien (Geld, Recht und Wahrheit) deren doppelte Mediatisierung durch das Internet zu analysieren. Die Dateiübertragung hingegen stellt ein Internetmedium dar, für das es keine Offline-Entsprechung gibt.
Entlang welcher Kriterien sollen die Medien analysiert werden? In kommunikationswissenschaftlichen Arbeiten wurde für »klassische« Medien bisher ein ganzer Kanon an Aspekten entwickelt, die der Beschreibung und auch Abgrenzung einzelner Medienarten dienlich sind. Die unten stehende Tabelle fasst die relevanten Merkmale zusammen. Die erste Zeile verweist hierbei jenseits der allgemeingültigen Kriterien auf die Relevanz medienspezifischer Eigenschaften, die die Gegenüberstellung zwischen einzelnen Off- und Onlinemedien begründet. In der letzten Spalte finden sich jeweils Themen und Ansatzunkte, die einer praxisnahen Betrachtung der Einzelmedien zugrunde gelegt werden können. Im Zuge der jeweiligen Diskussionen werden sie am Beispiel erläutert. Festzuhalten bleibt außerdem, dass nicht alle genannten Merkmalsausprägungen auf jedes Medium anwendbar sind und sie dementsprechend selektiv herangezogen werden.
Eine erste kommunikationstheoretische Differenzierung thematisiert die Akteurskonfiguration in der Sender-Empfänger-Struktur. Für die Reichweite einer Kommunikation kann hierzu zwischen drei Konstellationen differenziert werden (vgl. Misoch 2006: 55f.): one-to-one, many-to-many und one-to-many. Wie Meißelbach (2009: 40f.) und Emmer (2005: 26f.) plausibel darlegen, müssen die drei idealtypischen Konstellationen für eine praktische Anwendung noch einmal präzisiert werden. Gerade die »many«-Kategorie ist dabei zu unspezifisch. So gibt es many-to-many-Anwendungen, wie Diskussionsforen im Web, wo aber nur registrierte User Beiträge verfassen können und damit eher eine few-to-many-Konstellation vorliegt. Die Variationen üben dabei auch Einfluss auf die Hierarchien im Gefüge zwischen Senden und Empfangen aus, dessen offensichtlichstes Ergebnis in von Laien produziertem und versendetem Content besteht (vgl. Hamann 2008: 217f.).
Anknüpfend an diese Akteurskonfigurationen sind noch zwei weitere modale Optionen von Interesse: die Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Kommunikation sowie zwischen personalisierten und massenhaften Angeboten (vgl. Neuberger 2005: 76ff.). Während beide Aspekte für klassische Medien unschwer zu bestimmen sind, offenbaren sie in Bezug auf das Internet wichtige Sphären gesellschaftlicher Verhandlungen. So dreht sich die fortwährende Diskussion um den Datenschutz im Internet gerade um diese Fragen: Welche Kommunikationsinhalte sind (wie) privat? Wie umfassend sollte informationelle Selbstbestimmung sein? Wer darf die Nutzungsdaten marktwirtschaftlich verwerten? Ob sich Angebote an identifizierbare Individuen oder eine anonyme Masse richten, ist ebenfalls schwieriger zu entscheiden. Klassische Massenmedien wie das Radio können sich durch das Internet zu individuellen on-demand-Sendern wandeln.
Ein zweiter geläufiger Komplex umfasst die zeitliche Synchronität der Kommunikation. Klassischerweise wird hierbei zwischen Austausch per Brief als asynchrones und per Telefon als synchrones Medium unterschieden (vgl. Meißelbach 2009: 41f.). Bei synchroner Kommunikation sind die Akteure folglich gleichzeitig kopräsent (wenn auch nicht räumlich im engeren Sinne), asynchrone Kommunikation hingegen ist gegeben, wenn » […] ein Sender/eine Senderin eine Botschaft zu einem anderen Zeitpunkt aufstellt, als sie von den Adressat/inn/en empfangen wird« (Hartmann 2004: 675). Ergänzend hierzu zeigt Neuberger (vgl. 2005: 76ff.), dass jenseits der Echtzeit- und zeitlich entkoppelten Kommunikation weitere temporale Bedingungen aussagekräftig sind. So ist zu fragen, in welchen Abständen die Kommunikation (etwa der Inhalt einer Homepage) erneuert wird (Aktualisierbarkeit), inwiefern Kommunikationsinhalte über die Zeit hinweg noch (oder erneut) rezipiert werden können (Archivierung) und darüber hinaus, ob ältere Angebote mit neueren verknüpft werden können (Additivität).
Der dritte Merkmalskomplex besteht aus Variablen der Interaktion. Unterschieden wird, ob ein Medium eher elitär (einseitige Kommunikation) strukturiert ist oder ob es den Wechsel zwischen Senden und Empfangen ermöglicht. In Bezug auf die Analyse von Kommunikationsmedien ist das Konzept der Interaktion bisher wenig eindeutig (vgl. Meißelbach 2009: 43). Die gegenwärtige Konjunktur des Diskurses zum »interaktiven Web 2.0« hat bisher nur wenig wissenschaftliche Entsprechungen hervorgebracht.15 Gleichwohl wird angenommen, dass das Web (im Vergleich zu anderen technischen Verbreitungsmedien) ein erhöhtes Interaktionspotenzial aufweist (vgl. Bieber/Leggewie 2004). Quiring und Schweiger (2006) erarbeiten in Anbetracht des Forschungsdesiderates einen ersten systematischen Analyserahmen für Interaktivität. Der Fortschritt resultiert dabei wesentlich aus der Differenzierung von drei verschiedenen Analyseebenen: Aktion, Situationsevaluation und Bedeutungsaustausch.
Für die Aktionsebene folgern die Autoren, dass die Grundmerkmale für die Mensch-System-Interaktivität (beispielsweise die Anfrage in einer WWW-Suchmaschine) und Mensch-Mensch-Interaktion (beispielsweise eine E-Mail) sich nicht wesentlich unterscheiden, da die User ihre Aktionen in beiden Fällen ausschließlich an das System richteten. Ausschlaggebend für den Grad der Interaktivität ist dabei die Reponsiveness des Systems: Diese umfasst Optionen zur Auswahl bestimmter Inhalte (Selektion), zur Veränderung des Medienangebotes (Modifikation) und zum Input-Output-Verhältnis (Transformationsregeln).16 Die Ebene der Situationsevaluation stellt das Bindeglied zwischen den auf das System bezogenen Aktionen und dem auf den Menschen bezogenen Bedeutungsaustausch dar. Da sich die Situationsevalutation der Kommunikationsteilnehmerinnen und -teilnehmer nur bedingt an Parametern der Face-to-Face-Kommunikation (Gestik, Mimik et cetera) ausrichten kann, treten die Eigenschaften des Systems und das individuelle Situationsempfinden in den Vordergrund. Das heißt zunächst nicht viel mehr, als das für den User die Geschwindigkeit der Verarbeitung einer Eingabe einerseits und das Empfinden eines psychologischen Zustands andererseits die situative Wahrnehmung oder Deutung der Situation definieren.
Das Konzept der Immersion (vgl. Schlütz 2002: 37ff.) bündelt diese Ansätze, indem es das sprichwörtliche Eintauchen in künstliche (in der Regel medial geschaffene) Welten anhand von Wahrnehmungs- und Konzentrationstransformationen untersucht. Der Bedeutungsaustausch bildet die dritte Ebene. Interaktivität liegt dann vor, wenn der Austausch bilateral ist, also jenseits der Beschränkungen klassischer Massenmedien realisiert wird. Entscheidend hierfür ist folglich die Machtverteilung zwischen den Akteuren, wenngleich interaktive Kommunikation nicht zwangsläufig eine Egalisierung mit sich bringen muss (vgl. McMillan 2002: 169). Grundvorraussetzung für diese Art von Austausch ist die En- und Dekodierung von Bedeutungen. Das entspricht Luhmanns Modell der drei Selektionen und ist insofern nichts Neues. Von Relevanz ist allerdings, dass die Form des Bedeutungsaustausches von den Eigenschaften des konkreten Systems abhängig ist. Dementsprechend soll vorrangig die mediale, nicht die kommunikative Seite der En- und Dekodierung fokussiert werden. Wie bereits angedeutet, unterscheidet sich die Sprache beispielsweise in SMS-, E-Mail- und Telefonkommunikation deutlich voneinander (vgl. Androutsopoulos/Schmidt 2002). Zusammenfassend kann für den Merkmalskomplex der Interaktivität festgehalten werden, dass über die einzelnen Ebenen hinweg die Passgenauigkeit zwischen den Antworten des Systems auf die Eingaben der Nutzerinnen und Nutzer die Interaktivität positiv beeinflusst.17 Zudem helfen die drei genannten Ebenen, die Analyse von Interaktivität zu präzisieren.
Jenseits der inhaltsfokussierten Bilder- und vor allem Zeichensprache sind historisch vorgängige Kommunikationsformen festzustellen, die in modernen Zivilisationen bis heute vor allem lautbegleitende und -unterstützende Funktion haben.18 Diese nonverbale Kommunikation kann in zwei Bereiche unterschieden werden: parasprachliche Elemente und strikt nonverbale Kommunikationen. Parasprache meint im Allgemeinen nebensprachliche, also sprachbegleitende und damit an Laute gebundene Mittel. Dies ist der Fall, wenn während des Sprechaktes eine Pause gemacht, gelacht, geseufzt oder geflüstert wird. Vokale Einflussfaktoren bestehen demnach vor allem in der bewussten und unbewussten Anpassung von Tonhöhe, Intonation, Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit. Als nonverbale Kommunikation wird zumeist nicht nur unsprachliche, sondern Kommunikation jenseits von Zeichen und Symbolen verstanden. In diesen Bereich fallen dann Aspekte der Mimik und Gestik, der Körperhaltung, der Distanz unter Anwesenden, des Geruchs, des Impression-Managements, der Berührung oder zumeist unsteuerbarer anderer körperlicher Aktivitäten (wie etwa Erröten oder Schwitzen). Zwischen beiden gibt es Überschneidungen. So kann ein Gesichtsausdruck (Mimik) gleichermaßen eine lautsprachbegleitende Gebärde und auch ein averbaler Ausdruck von Verwunderung sein, weshalb im Folgenden keine explizite Trennung vorgenommen wird.19
Die angeführten para- und nonsprachlichen Kommunikationsformen sind in Face-to-Face-Konversationen hochgradig präsent und sogar unausweichlich. Kommunikation mit Hilfe technischer Medien hingegen findet sich gerade am anderen Ende des Kontinuums wieder, ist sie doch durch räumliche und damit körperliche Abwesenheit geprägt. Es muss also zunächst aufgeschlüsselt werden, welche Funktionen para- und nonsprachliche Aspekte in Kommunikationen einnehmen und ob – respektive wie – diese in technisch vermittelten Kommunikationszusammenhängen adäquat ersetzt werden können.
Im Detail übernimmt die nonverbale Kommunikation Funktionen, die durch die verbale Kommunikation nicht oder nur unzureichend erfüllt werden können. Das kann die Übermittlung von Stimmungslagen, das Gestalten interpersonaler Beziehungen oder die Strukturierung von Sprechhandlungen sein (vgl. Höflich 1996: 70). So wird angenommen, dass » […] die Wirkungen von Mitteilungen in der interaktionalen Kommunikation weitgehend durch nonverbale Zeichen beeinflusst werden« (Scherer 1984: 20).
Misoch (vgl. 2006: 22ff.) weist, bereits mit Blick auf Online-Kommunikation, sieben bedeutsame Bereiche nonverbaler Kommunikation aus, die im Folgenden kurz erläutert werden. Für alle Elemente gilt dabei, dass sie kulturspezifischen Variationen unterliegen, die aber bei der hiesigen Grundlegung westlicher Gesellschaften als Zentrum der Internetnutzung, als marginal eingeschätzt werden können. Erstens handelt es sich um Taktilität, die wohl ursprünglichste Form der menschlichen Kommunikation. Berührungen und Körperkontakt setzen räumliche Nähe voraus und sind intensiv sozial reguliert. Daran anknüpfend bildet die sogenannte Proximetik den zweiten Aspekt. Sie konzeptualisiert die Nähe oder Distanz zwischen Menschen im Raum. Bei Kommunikation unter der Bedingung von Kopräsenz müssen sich die Akteure in einer räumlichen Konstellation befinden, wobei diese ein Kontinuum zwischen der intimen Zone (null bis 45 Zentimeter) und der öffentlichen Zone (mehr als drei Meter) umfasst. Die Unterscheidung dieser Körperzonen (vgl. Hall 1963) beeinflusst die Nutzung der Sinneskanäle.
Die Körperhaltung hingegen kann Ausdruck des individuellen Gefühlszustandes sein (hängender Kopf versus breite Brust) und kann den relativen Status einer Person widerspiegeln. Körperhaltungen signalisieren so Desinteresse, Wut, Zufriedenheit, Unsicherheit, Unentschlossenheit, Resignation oder Erstaunen, um einige zu nennen. Ein besonderer Bereich, und der vierte nach Misoch, ist die Gestik und Mimik umfassende Pathognomik. Während es sich bei der Gestik um einen Ausdruck des Körpers und speziell der Hände handelt, zielt Mimik auf die Übermittlung eines Ausdrucks durch die Gesichtsmuskeln ab. Gesichtsausdrücke vermitteln ebenfalls Gemüts- und Stimmungslagen, Gesten hingegen offenbaren größere Freiheitsgrade. So kann zugenickt, geklatscht, gegähnt, gewunken oder achselgezuckt werden. Gestik kann auch unbewusste Gefühlszustände widerspiegeln, wenn beispielsweise ein Händezittern Nervosität zum Ausdruck bringt.
Der Blick stellt einen weiteren wichtigen Aspekt sozialer Interaktion dar, da dieser sich innerhalb des Gesichtsfeldes abspielt und sich dort die meisten Sinnesorgane und Rezeptoren befinden. So zeigen der Blick und dessen Richtung Aufmerksamkeit und Interesse an und haben darüber hinaus affiliativen Charakter: Neben dem Austausch von Informationen über die Sprache, ermöglicht das Austauschen von Blicken vor allem die Herstellung von Kontakt. Einen anderen Bereich der nonverbalen Kommunikation bildet der Tonfall. Wie schon angesprochen, bezieht sich der Tonfall zwar auf die gesprochene Sprache, betrifft aber weniger das Gesagte an sich als die Art und Weise. Durch die Tonhöhe, die Lautstärke, die Geschwindigkeit und die Klangfarbe können spezielle Aspekte des Gesagten betont und damit in ihrer Bedeutung priorisiert werden. Die letzte Kategorie bilden sogenannte Attribute. Damit sind Zeichen gemeint, die sowohl außerhalb des menschlichen Körpers als auch außerhalb der Sprache liegen. Sie umfassen etwa Kleidung, Schmuck, Autos, Möbel, Accessoires und ähnliche Artefakte. Wenn Traditionen an Einfluss verlieren, werden sozialer Status und Gruppenzugehörigkeiten verstärkt über solche Symbole (gewollt oder unintendiert) angezeigt (vgl. Sennett 1986). Diese Merkmale gehören zwar nicht unmittelbar zur Kommunikation, stellen aber eine wichtige Kontextvariable dar.
Bezieht man die Merkmale para- und nonsprachlicher Kommunikation (bei räumlicher Kopräsenz) auf die Online-Kommunikation, sind folgende Fragen zu beantworten: Welche der vier Wahrnehmungssinne20 können technisch übertragen werden. Wie verändert sich durch die Mediatisierung die Qualität der nonverbalen Informationen und inwiefern können die beschriebenen Elemente ihrer Funktion (also beispielsweise der Übertragung von Emotionen) noch gerecht werden? Zudem ist relevant, welche Kompensations- und Ausweichstrategien gegebenenfalls für die Online-Kommunikation vorzufinden sind. Diese Fragestellungen geben bereits einen Hinweis darauf, dass im Unterschied zu den übrigen Medien Online- und Offlinevariationen nicht kontrastiert werden können. Vielmehr bildet die nonsprachliche Kommunikation einen Begleithintergrund, der vor dem Ideal des Face-to-Face-Gespräches (und zunächst jenseits der obigen vier Kriteriumskomplexe) für alle Kommunikationsformen grundsätzlich einzuschätzen ist.
Die sieben genannten Bereiche lassen sich hierfür in vier Informations- beziehungsweise Rezeptionskanäle gliedern: visuelle, auditive, olfaktorische und taktile Wahrnehmung. Grundsätzlich ist das Internet ein durch die Dominanz von Textualität gekennzeichnetes Medium. Wie erläutert, sind das WWW und die E-Mail die meist genutzten Anwendungen. Aus der gegenwärtigen Nutzungsquantität sollte allerdings nicht der Kurzschluss einer Verengung auf visuelle, schriftsprachliche Wahrnehmung folgen. Häufig kranken Studien zur Internetforschung gerade daran, aus dem gegenwärtigen Stand der Technik (etwa vor dem Aufkommen der Internet-Bildtelefonie) sozialwissenschaftliche Erkenntnisse ohne Beachtung der (digitalen) Potenziale zu generalisieren. Dennoch ist zu fragen, welche Restriktionen einem Medium im Vergleich zur kopräsenten Kommunikation eigen sind. Evident ist zunächst, dass Gerüche und Berührungsreize bis auf wenige (im Grunde nicht relevante) Ausnahmen von der Online-Kommunikation ausgeschlossen sind. Während ein Brief in der Regel einen spezifischen Geruch hat, ist dies für eine E-Mail nicht erwartbar. Für den Bereich der Taktilität gibt es inzwischen erste Annäherungen: Beispielsweise bei bestimmten Ereignissen vibrierende Eingabegeräte oder Anzüge, die über aufblasbare Luftposter verfügen. Solche Geräte sind aber vorrangig für Spiele konzipiert. Die Eingabe von Informationen in Form von Druck, Berührung oder Temperatur ließe sich durch recht handliche Geräte realisieren, die Ausgabe hingegen wird längerfristig begrenzt bleiben. Aus diesem Grund haben taktile Kommunikationsformen für den Online-Bereich gegenwärtig allenfalls randständige Bedeutung.
Visuelle und auditive Informationen hingegen sind zu weiten Teilen technisch abbildbar. Vor einigen Jahren sah dies noch anders aus: »Selbst bei dem geplanten weitest entwickelten Medium der Zukunft - dem Bildtelefon - können wichtige Phänomene wie Körperabstand oder -haltung gegenüber anderen nicht übertragen werden […] « (Hermann 1989: 171). Inzwischen jedoch ermöglichen hochauflösende Kameras und Displays in Kombination mit leistungsstarken Netzen auch jenseits spezieller Videotelefonielabore die Übertragung weitestgehend realistischer (Bewegt-) Bilder. Damit können Raumkonstellationen und -situationen detailgenau übertragen werden. Ähnliches gilt für auditive Signale: Geeignete Mikrophone und Ausgabegeräte sind inzwischen ein Standard bei Neugeräten für die Internetnutzung. Darüber hinaus werden sich die Verzögerung, Qualität und Tiefe der Audiosignale dem natürlichen Erscheinungsbild weiter angleichen.
Führt man sich die sieben zentralen Funktionen nach Misoch noch einmal vor Augen, wird ersichtlich, dass das Internet abgesehen von der Taktilität und der Proximetik (aufgrund der fehlenden Kopräsenz) potenziell alle anderen Funktionen abbilden kann. Gleichwohl sind hier Einschränkungen zu konstatieren: Der Blickkontakt »durch« den Laptop wird beispielsweise nur schwerlich die Aussagekraft erreichen, die unter räumlich Anwesenden möglich ist. Im Detail sind die Körperhaltung, Mimik, Gestik und der Blick dem visuellen Kanal zuzuordnen, der über Kameras, etwa bei einem Video-Chat übertragen werden kann. Dabei ist auch ersichtlich, ob das Gegenüber sitzt oder steht, klatscht oder winkt, ungeduldig oder erstaunt wirkt, freudig oder ängstlich schaut. Ebenso ist es im Zuge der Audioübertragung möglich, die Details des Tonfalls, der Tonhöhe oder der Sprechgeschwindigkeit zu übermitteln. Hintergrund- oder Störgeräusche können gefiltert werden, sodass die sprachliche Kommunikation zunehmend besser rezipierbar ist. Damit ist davon auszugehen, dass das Internet insgesamt das Potenzial hat, den Funktionen nonsprachlicher Elemente gerecht zu werden. Allerdings wird in der Regel lediglich ein einzelner Dienst genutzt. Die beschriebene Funktionenäquivalenz trifft damit höchstens auf die Gegenüberstellung von Face-to-Face-Kommunikation und Video-Telefonie zu. Alle anderen sind gegenüber der Face-to-Face-Kommunikation immer in ihrer Ausdrucksbandbreite reduziert. Gegenwärtig sind zudem noch Qualitätsdefizite zu verzeichnen. So ist keineswegs gewährleistet, dass etwa ein Handzittern am anderen Ende der Leitung als solches erkennbar wäre.
Hinter dem Hinweis, dass die obige Analyse vor allem auf einzelne Kommunikationsarten im Netz zutrifft, nicht aber auf alle, steckt eine zweite Frage: Können nonverbale Elemente auch in anderen Arten der Online-Kommunikation genutzt werden? Mit Blick auf die noch immer hohe Bedeutung von geschriebener Sprache im Internet ist von Interesse, ob dabei Emotionen, Gefühlszustände wie auch Gesten übermittelt werden können. Diese Frage betrifft vorrangig die one-to-one-Kommunikation des Chats oder der E-Mail. Gerade beim Instant Messaging und beim Internet Relay Chat, die ja durch echtzeitliche Schriftlichkeit geprägt sind und einen ersten Hinweis auf hybride Typen bilden, finden sich spezifische Kompensationsmodi.
Die Kanalreduzierung wird partiell egalisiert durch Zeichen-Codes, die als effektiver als die Verschriftlichung von Körperzeichen (»jetzt lächele ich schüchtern«) erachtet werden (vgl. Misoch 2006: 58). Gefühle und Mimiken können beispielsweise ikonografisch dargestellt werden: Sogenannte Emoticons oder Smileys werden entweder durch Zeichenkombinationen dargestellt oder sind in der Software als (animierte) Grafiken verfügbar. Wenngleich kulturelle Unterschiede bestehen, gibt es einen festen (mehrere Dutzend Exemplare umfassenden) Satz an Zeichen, der internetweit akzeptiert und verstanden wird. Darüber hinaus haben sich Soundwörter etabliert, die die Darstellung von Geräuschen im textuellen Austausch ermöglichen. Auditive Ausdrücke müssen dazu verschriftlicht werden: »hmm«, »hihihi« oder »arghh« sind Beispiele hierfür. Es handelt sich dabei um ein lautmalerisches Prinzip, das unter anderem aus Comics bekannt ist. Mimiken und Gestiken werden weiterhin durch Aktionswörter dargestellt. Diese sind vom Infinitiv der Verbform abgeleitet und in der Regel zwischen Sternchen geschrieben: beispielsweise *zwinker*, *stöhn*, *rotwerd*, *grins* oder auch *computerausdemfensterschmeiß*. Differenzierungen in der Lautstärke werden zudem über Versalien ausgedrückt und meinen entweder eine besondere Betonung von einzelnen Wörtern oder auch Schreien. Da das Eintippen der Botschaft trotz zumeist hoher Medienkompetenz der Anwenderinnen und Anwender für echtzeitliche Kommunikation relativ lang dauert, hat sich ein System von Sonderformen herausgebildet. Dabei werden häufig gebrauchte Sätze in Akronyme transformiert. Die bekannteste Abkürzung dieser Art ist wohl LOL, das für »laughing out loud« steht. CU meint »see you«, THX! steht für »Thanks« und gr82CU heißt »great to see you«.
Wenngleich, wie beschrieben, die Kompensationsmodi darauf abzielen, viele nonverbale Kommunikationen abbilden zu können, muss dies im Detail relativiert werden. Während Mimiken und Gestiken in Face-to-Face-Kommunikationen zu gewissen Teilen gerade nicht kontrolliert und reflektiert erfolgen, geht der Ausdruck dieser in der Schriftsprache immer auf eine bewusste Aktion zurück. Es ist demnach leichter möglich, unauthentische Darstellungen von Gefühlen oder auch Gestiken zu kommunizieren, wobei das Gegenüber dies nur sehr schwer identifizieren kann. Zum zweiten bleibt kritisch anzumerken, dass die schriftliche nonverbale Kommunikation von begrenzter Komplexität ist. So gibt es zwar eine größere Anzahl von Emoticons; aber im Vergleich zur unendlichen Vielfalt möglicher Gesichtsausdrücke stellen diese lediglich grobe und überdies unpersönliche Einschätzungen dar. Dementsprechend gehen bestimmte persönliche Merkmale (Körperbau, Gesichtsform, Hautalterung, physiognomische Merkmale im Allgemeinen) nicht aus den Möglichkeiten schriftlicher Nonverbalität hervor. Es gibt zwar gewisse Zusatzfunktionalitäten, wie die Auswahl eines Nicknames, der dann als unmittelbarer Anzeigename für andere Akteure Hinweise auf persönliche Präferenzen (»travellingKlaus23«) oder Eigenschaften (»bigSimoneK«) enthalten kann oder wie die Möglichkeit, im Chat-Profil einen fortwährend änderbaren Status (»Bin gerade am Lernen«, »kurze Raucherpause«, »depressiv und allein zu Hause« oder »verliebt … «) anzugeben – diese unterliegen jedoch denselben Beschränkungen.
Was bleibt also jenseits dieser kleinteiligen, wenngleich nicht unwichtigen Befunde zur nonverbalen Kommunikation im Internet festzuhalten? Mit fortschreitender Entwicklung der Technik werden verschiedene Anwendungen des Internets (allen voran die Videotelefonie) grundsätzlich in der Lage sein, nonverbale Kommunikation verlustfrei und damit authentisch zu transportieren. Die basale Restriktionshypothese, nach der mediatisierte Kommunikation angesichts mangelhafter nonverbaler Elemente grundsätzlich defizitär und fehlerbehaftet ist, kann nicht mehr aufrecht erhalten werden. Ausgeschlossen davon bleiben mittelfristig die Kanäle der olfaktorischen und gustatorischen und auch taktilen Wahrnehmung, die aber ohnehin in ihrer Bedeutung den visuellen und auditiven Kanälen nachstehen.
Der Entkörperlichungsthese (vgl. Misoch 2006: 56) kann hier nur im Sinne der oben genannten Kanalreduzierung, nicht jedoch in generalisierter Form zugestimmt werden. Eine Beschränkung von Körper, Körperzeichen und individuellen Attributen sind das Resultat der technologischen Plattform, die sicher in permanenten Wandel befindet. Die Potenziale und die bisherige Entwicklungsdynamik verweisen aber unmissverständlich darauf, dass nonverbale Kommunikation über das Internet als nahezu ebenbürtig einzustufen ist. Eine weitere vermeintliche Einschränkung besteht in der Entkontextualisierung der Kommunikation, im Sinne des Abhandenkommens eines geteilten Settings der Kommunizierenden. Der Grund hierfür ist die räumliche Entgrenzung der Kommunikation. Es kann allerdings eingewendet werden, dass (mit den Einschränkungen der Kanalreduzierung) vielmehr eine Vervielfältigung oder Differenzierung des Kontextes festzustellen ist. Im Falle eines one-to-one-Austausches über ein Videotelefonie-Programm sind genau drei Kontexte von Bedeutung. Die beiden physisch-geographischen Räume der Akteure sowie der geteilte virtuelle Kontext. Alle drei sind relevant, weil die Kommunikanden jeweils gegenseitig wahrnehmen, ob im Hintergrund die Sonne untergeht, Kinder spielen, Verkehrslärm dröhnt oder ein Film läuft. Hinzu kommt das Moment der virtuellen Rekontextuierung, indem die Kommunikationsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf (gemeinsame) Online-Inhalte zurückgreifen können. Dies ist etwa der Fall, wenn sie gleichzeitig ein bestimmtes Video schauen, sich über eine Homepage unterhalten oder ein zuvor übermitteltes Bild betrachten.
Nachdem die Diskussion der nonverbalen Kommunikation eine Grundlage bildet, die gleichermaßen verschiedene Kommunikationsarten betrifft, soll nun erstmals der Kriterienkatalog zur Beurteilung der Kontrastierung von On- und Offlinekommunikationsarten genutzt werden. Wesentliche Eigenschaften des Face-to-Face-Austausches wurden bereits im letzten Abschnitt implizit eingeführt, sodass im Folgenden vorrangig ergänzende und dann auf die Internetentsprechung bezogene Informationen referiert werden. Gemäß der vorgestellten Aufteilung nach Funktionalitätskriterien wird der sprachlichen Face-to-Face-Kommunikation aus dem Offline-Bereich der Chat, die IP- und Video-Telefonie gegenübergestellt.
Verbalsprache funktioniert in der Regel spontan, wird trotz ihres komplexen Aufbaus von nahezu allen Menschen beherrscht und ist durch eine Rekursivität einzelner Sprechakte auf vorhergehende Kommunikate oder geteilte Wissensvorräte geprägt. Mit Hilfe von Sprache kann also etwas gesagt werden, das noch nie zuvor gesagt wurde und das trotzdem verstanden wird (vgl. Luhmann 1998: 215ff.). Sprache reicht nach Luhmann gemeinhin nicht sehr weit: Sie setzt die Anwesenheit der Sprecherinnen und Sprecher sowie der Hörer und Hörerinnen voraus: »Geformte Sätze lösen sich, sobald sie ausgesprochen sind, ins nicht-mehr-Hörbare auf.« (Luhmann 1998: 216) In umgekehrter Perspektive ermöglicht dies natürlich einen hohen Grad an Interaktion, insofern Aussagen direkt infrage gestellt und korrigiert werden können.
Mit Ehlich (vgl. 1998: 9ff.) können der Sprache als Medium, und damit auch in ihrer Eigenschaft als vokal-auditives Zeichensystem drei zentrale Funktionen zugeschrieben werden. Sie dient der Erkenntnisstiftung (gnoseologische Funktion), indem sie zur Verarbeitung, Entwicklung und zum Transfer von Wissen genutzt wird. Damit werden Erkenntnismöglichkeiten aus der unmittelbaren Praxis enthoben: Es kann grundsätzlich alles thematisiert werden. Zweitens wirkt Sprache praxisstiftend (teleologische Funktion), wenn sich Individuen im Sinne eines illokutionären Aktes über ihr Handeln abstimmen und es kollektiv organisieren. Zudem hat Sprache eine kommunitäre Funktion, sie schafft Gemeinschaft und dient der Verständigung innerhalb von Gruppen.
Die erste Funktion (Erkenntnisstiftung) war vor allem ein entwicklungsgeschichtlicher Meilenstein, gleichwohl profitieren Gesellschaften noch heute davon. Gerade in Anbetracht des Wandels zur viel beschworenen Medien- oder Informationsgesellschaft erscheint das Generieren von Erkenntnis und Wissen, von Innovation und Fortschritt als ein zukunftsträchtiges Geschäft (vgl. Reich 1997). Aus der verstärkten Nutzung der Online-Entsprechung von Face-to-Face-Kommunikation durch die vier beschriebenen Möglichkeiten resultieren auch qualitative Auswirkungen. Festzustellen ist, dass mündlicher Austausch zunehmend raumungebunden stattfindet, bisher relevante personelle Konstellationen an Bedeutung verlieren und Kommunikation sich tendenziell modularer gestaltet. Die drei Veränderungen sind dabei auf die (wenngleich heterogenen) Kommunikationsmöglichkeiten des Online-Bereichs zurückzuführen.
Während Face-to-Face-Kommunikation stets raumgebunden und klassisches Telefonieren auf auditive Wahrnehmung begrenzt war, bietet das weltweite Internet die Möglichkeit, über Distanzen hinweg »wie anwesend« zu kommunizieren. Das Medium befördert demnach die Herauslösung von sozialen Praktiken aus bisherigen Raum- und Zeitkontexten. Damit spiegelt sich dieses technische Potenzial des neuen Mediums auch in der Nutzung wider. Speziell mit Hilfe der Video-Telefonie kann verbalsprachliche Kommunikation in globalem Maßstab realisiert werden. Dies gilt nicht nur für die Frage der Erkenntnisstiftung, sondern auch für andere Bereiche.
Der zweite Punkt, ein Bedeutungsverlust von gefestigten persönlichen Beziehungen, zielt auf das modernisierungsinhärente Moment der Entbettung gesellschaftlicher Institutionen aus traditionellen Zusammenhängen ab. Zwar ist es bei Face-to-Face-Kommunikationen ebenso möglich, unbekannte Personen anzusprechen (und beispielsweise nach dem Weg zu fragen), es geschieht allerdings nur sehr selten. Die Internetkommunikation hingegen ist offener und anonymer. Dies gilt wiederum nicht pauschal, sondern in Tendenz. So tauschen sich in Chat-Channels häufig unbekannte Menschen zu den verschiedensten Themen in direkter Bezugnahme aufeinander aus. Beim Instant Messaging und der IP- sowie Videotelefonie wird hingegen vorrangig mit persönlich freigeschalteten Kontakten interagiert. Durch die Funktionalität von Weak Ties (vgl. Granovetter 1983) und der vereinfachten Verwaltung von Kontaktdaten kommt es aber auch hier zu einer Vervielfachung entsprechender Kontakte und Kommunikationen. Offline ungepflegte oder flüchtige Kontakte werden im technisch abstrahierten und damit weniger verbindlichen Online-Bereich schneller hinzugefügt und damit auch ansprechbar. Im Gegenzug können Personen, deren Kontaktdaten verfügbar sind, leichter angesprochen werden. Vertrauen, Offenheit und Hilfsbereitschaft sind wichtige Voraussetzungen zur Teilnahme an diesen Kommunikationsarten. Es mag zutreffen, dass die beschriebenen Entwicklungen vorrangig auf die Heavy User, also die Internetavantgarde zutreffen, gleichzeitig liegt aber eine Diffusion in weite Teile der Internetgemeinde empirisch nahe.
Daran knüpft die dritte Veränderung direkt an: Internet-Kommunikation ist modularer und stärker fragmentiert. Bei Chat-Anwendungen und Internettelefonie können auch sehr kurze Sequenzen funktional sein. Da die Kommunikationsaufnahme keine hohen Transaktionskosten erfordert, unvermittelt erfolgen kann und gering normiert ist, findet sich immer häufiger eine kürzere Dauer bei höherer Taktung. Während bei verbalsprachlicher Kommunikation im Offline-Bereich die Anzahl räumlich anwesender und ansprechbarer Personen gemeinhin aus rein praktischen Gründen begrenzt ist, sind online in der Regel viele Individuen erreichbar. Kontaktiert man diese, handelt es sich häufig, um »Kommunikation pur«, da rahmende Elemente, wie Begrüßungen, gemeinsame Situationsdefinitionen und Themeneinleitungen speziell bei echtzeitlich genutzter Schriftsprache stark reduziert werden oder gänzlich entfallen (vgl. Beißwenger 2007). Das Anliegen kann auf Grundlage eines interpersonellen Commitments direkt vorgetragen und ebenso umstandslos beantwortet werden.
Eine zweite wichtige Funktion bezieht sich auf die teleologische Dimension von Sprache. Anknüpfend an die Tendenz zur Globalisierung von Kommunikationszusammenhängen wirkt die Konstituierung kollektiven Handelns vor allem synchronisierend. Damit ist zunächst gemeint, dass über räumliche Distanzen hinweg »gemeinsame« Handlungen koordiniert und vollzogen werden. Dies kann einerseits im Rahmen von Online-Kollaboration geschehen; beispielsweise wenn innerhalb eines Multiplayer-Spiels gechattet wird oder gemeinsam ein Online-Dokument bearbeitet wird. Andererseits können auch Handlungen koordiniert werden, die sich außerhalb des Internets manifestieren. Dies wäre der Fall, wenn etwa per Videotelefonie zwei geographisch entfernte Unternehmensteile verabreden, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Produktion auf ein neues Produkt umzustellen. Das Element der Synchronisierung von Handlungen kommt vorrangig bei räumlicher Abwesenheit zum Tragen. In fortgeschrittenen technischen Umgebungen kann in Mehr-Personen-Video-Konferenzen Handeln so koordiniert werden, dass beispielsweise in einem Web-Workshop Instruktionen erteilt werden, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann praktisch (etwa bei der Reparatur eines Computers) umgesetzt werden. Der Unterschied zu ähnlichen Kursen auf DVD besteht hier, wie bei der Face-to-Face-Kommunikation, in der Möglichkeit zur direkten Interaktion.
Die Webwissenschaften und verwandte Disziplinen diskutieren die kommunitäre, also gemeinschaftsstiftende Funktion von Sprache an hervorgehobener Stelle.21 Es wird dabei danach gefragt, wie virtuelle Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung möglich wird, welche Einflussfaktoren dominant sind und welche Web-Dienste die Entwicklung unterstützen. Vor allem die neueren Web 2.0-Anwendungen wie Blogs, soziale Netzwerke oder Social News sind vor diesem Hintergrund besonders populär, da sie Interaktionsmöglichkeiten zwischen Usern vergrößern und den Gedanken der Vernetzung forcieren (vgl. Münker 2009). Zunächst muss auf theoretischer Ebene zwischen Vergemeinschaftung im Off- und Online-Bereich unterschieden werden. Für klassische Formen der verbalsprachlich vermittelten Bildung von Gemeinschaften ist eine unterstützende Wirkung, für Online-Gemeinschaften hingegen eher eine initiierende Wirkung anzunehmen. Bestehen wert-, norm- oder handlungsgebundene Kollektive also bereits, können sie durch direkte sprachliche Interaktion (zumindest vorübergehend) auch ohne räumliche Nähe aufrecht erhalten werden. Da Gemeinschaften, unter anderem aufgrund gestiegener Mobilität, immer schwieriger aufrecht zu erhalten sind, bedarf es einer solchen kommunikativen Unterstützung. Für die Bildung von Online-Communitys hingegen stellen die beschriebenen vier Modi der Webkommunikation lediglich einen Ausgangspunkt dar. Der sprachliche Austausch dient vor allem als Mittel zum Zweck.
Die Akteurskonfigurationen sind weniger differenziert als der vorangegangene Merkmalskomplex. Verbalsprache im Offline-Bereich ist hinsichtlich ihrer Reichweite heterogen nutzbar. Es kann sowohl unter vier Augen gesprochen, in einer Gruppe diskutiert oder eine Vorlesung gehalten werden. Das gleiche gilt für die Online-Entsprechung, wenngleich die one-to-many-Konstellation nicht an natürliche Grenzen gebunden ist. Während eine öffentliche Ansprache in ihrer Rezipientenzahl auf einige zehntausend Personen begrenzt ist, kann eine Rede via Videostreaming unendlich breit gestreut werden. Gleichwohl verwischt dann die Grenze zur massenmedialen Kommunikation, die sich fernsehähnlich gestaltet. Für die Chat-Kommunikation besteht aufgrund der Schriftlichkeit des echtzeitlichen Austauschs ein höheres Komplexitätspotenzial: Einzelne Beiträge werden in der Regel automatisch archiviert und einzelne Aussagen überlagern sich akustisch nicht. Es kann folglich auf zurückliegende Kommunikate besser Bezug genommen werden und es können mehrere Themen gleichzeitig besprochen werden.
Auch hinsichtlich der Zugangsbeschränkungen zu Informationen und zur Kommunikation insgesamt sowie hinsichtlich des Individualisierungsgrads unterscheiden sich Off- und Online nur marginal. Gleichermaßen kann mit Blick auf die Akteurskonstellation der Austausch privat oder öffentlich erfolgen. Im Internet werden allerdings auch Teilöffentlichkeiten geschaffen. So ist ein Beitrag in einem Chat-Channel zwar prinzipiell für alle sichtbar. Im Detail ist er jedoch nur für diejenigen sichtbar, die auch ein Log-in besitzen. Analog zur Offline-Kommunikation ist eine personalisierte Ansprache der Normalfall. Abgesehen vom Internet Relay Chat muss vor jeder Kontaktaufnahme der Adressat direkt ausgewählt werden. Eine spontane massenhafte Ansprache ist, im Gegensatz zu einem Ausruf auf einem öffentlichen Platz, nicht möglich.
Die zeitliche Gestaltung der Kommunikation ist zunächst durch Synchronität und damit durch eine echtzeitliche Rezeption der gesendeten Informationen gekennzeichnet. Die Online-Variante des Chats ermöglicht sowohl echtzeitliche als auch zeitlich entkoppelte Kommunikation. Echtzeitlich ist der Austausch, indem beim Chatten (je nach Anbieter) jedes eingetippte Zeichen einzeln übertragen wird. Zudem bleiben die geschriebenen Inhalte und ein Teil der Sprachnachrichten erhalten und können auch zu einem späteren Zeitpunkt gelesen oder gehört werden. Somit bietet die Online-Entsprechung hybride Möglichkeiten und ist für unterschiedliche Nutzungspraxen offen. Die Frage der Archivierung ist damit schon implizit beantwortet. Bei bestimmten Anwendungen, die dem Face-to-Face-Gespräch funktional äquivalent sind, ist eine Öffnung zur Vergangenheit festzustellen, indem Kommunikate verlustfrei zu beliebigen Zeitpunkten wiederhergestellt werden können.
Das Merkmal der Interaktivität kann sowohl auf die User-System- als auch auf die hier interessierenden User-User-Interaktionen angewendet werden, da in beiden Fällen das Internet genutzt wird. Auch bei der Video-Telefonie wird in ein Mikrofon gesprochen und akustische Signale, die vorher digital prozessiert wurden, kommen aus Lautsprechern. Das dritte Element der Aktionsebene, die Transformationsregeln, umfasst Algorithmen zur Bearbeitung von User-Inputs durch das System. Es ist für diese Mediengruppe im Gegensatz zu den ersten beiden Elementen von Relevanz. Ein Dienst wird dabei als umso interaktiver empfunden, je »natürlicher« die Eingaben und je »unverfälschter« die Ausgaben erscheinen. Im Vergleich zu den vorherigen Punkten ist dieses Kriterium nicht blind für die Qualität der mediatisierten Interaktion. Während die beiden Telefonie-Varianten, wie erläutert, in Hinsicht auf die auditive und visuelle Wahrnehmung lediglich durch mittelfristige technische Unzulänglichkeiten an Qualität verlieren, gestaltet sich dies bei den Chat-Varianten anders. Folgt man der hiesigen Argumentation konsequent, bleibt der Wechsel von gesprochener zu geschriebener Sprache problematisch. Das herausgestellte Plus an Optionen geht zu Lasten der Natürlichkeit in Hinblick auf die Kommunikationssituation. Da es gegenwärtig noch an Software-Lösungen mangelt, gesprochene Sprache fehlerfrei in Schriftsprache zu übersetzen, sind User auf hohe Fertigkeiten im Umgang mit der Tastatur angewiesen. Nur ein Bruchteil der User beherrscht allerdings das Zehnfingersystem flüssig, weshalb Gedanken oft verkürzt oder wenig dynamisch übertragen werden. Das Problem ist demnach weniger die Transformation des Systems, vom Druck auf einen Buchstaben zur Ausgabe eines Zeichens auf dem Bildschirm, als die vorab notwendige Eingabe ins System.
Die Ebene der Situationsevaluation betrachtet zur Einschätzung der Kommunikationssituation neben nonsprachlichen Merkmalen einerseits die Eigenschaften des Systems und andererseits das Situationsempfinden. Der erste Teil gleicht hierbei den Faktoren der Aktionsebene, mit dem Unterschied, dass die subjektive Sicht in den Vordergrund rückt. Es geht folglich darum, wie Selektions- und Modifikationsoptionen sowie Transformationsregeln eingeschätzt werden. Jenseits aufwendiger empirischer Erhebungen können nur idealtypische Muster solcher Einschätzungsszenarien präsentiert werden. Für die hiesige Zielstellung soll dies aber ausreichen. Die Nutzungsintensität eines Dienstes hängt dabei von der Güte der subjektiven Einschätzung ab, die sich ihrerseits an vergleichbaren Kommunikationsformen aus dem Offline-Bereich orientiert. Im Unterschied zur Gegenüberstellung von Brief und E-Mail beispielsweise ist die Face-to-Face-Kommunikation aufgrund ihrer entwicklungsgeschichtlichen Stellung hochgradig akzeptiert auf. Dementsprechend fungieren die Online-Optionen von echtzeitlichem Austausch vorrangig als Ergänzung. Das soll an dieser Stelle auch noch einmal betont sein: Wenngleich die Analysen teilweise den Schluss nahelegen, die Kommunikation im Online-Bereich böten hinsichtlich der Eigenschaften ein Plus an Vorteilen, kann daraus nicht geschlossen werden, dass sie bestehende Kommunikationsformen ablösen. Für die Merkmale der Chat- und Internet-Telefoniedienste bedeutet dies, dass sich die objektive und subjektive Einschätzung stark unterscheiden können. Bereits die Anwesenheit von Technik, also die Tatsache, dass die menschliche Stimme aus einem Lautsprecher und nicht aus einem Menschen ertönt, führt zu Defiziten gegenüber einer natürlichen Sprechsituation. Da Letztere aber die Referenzkategorie darstellt, kann entweder eine möglichst vollkommene Annäherung angestrebt werden oder aus den Abweichungen resultieren verminderte Nutzungsintensitäten.
Das persönliche Empfinden der Situation bildet den zweiten Bestandteil der Situationsevaluation. Dabei wird vor allem nach dem Grad der Immersion gefragt. Dieser beschreibt, wie ausgeprägt ein psychologischer Zustand ist, in dem virtuelle Objekte, virtuelle soziale Akteure oder die virtuelle Repräsentation des Ich (Stichwort: Avatar) als wirklich empfunden werden. Für die beschriebenen vier Web-Anwendungen ist eingängig, dass die Intensität dem »Erlebnis« der Face-to-Face-Kommunikation nicht ebenbürtig sein kann.
Als letzter Punkt ist der Bedeutungsaustausch ins Feld zu führen. Interaktivität ist dann gegeben, wenn De- und Enkodierung der Informationen möglichst natürlich und intuitiv geschehen. Es geht also letztlich darum, inwiefern die aktive Konstruktion von Bedeutung im Rahmen medienvermittelter Kommunikation und die Bedeutungszuweisung von empfangenen Botschaften harmonieren und Missverständnisse verhindert werden. Für den Bereich des echtzeitlichen sprachlichen Austauschs gilt hier die oben genannte Feststellung: Ein hoher Grad an Interaktivität, der jedoch geringer als im »Real Life« ist, kennzeichnet die Online-Entsprechungen. Begünstigt wird dies durch die fehlende Hierarchisierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie durch die Bezugnahme auf vorherige Botschaften. Damit muss für die Interaktivität der vier Online-Entsprechungen ein differenziertes Bild gezeichnet werden. Da es aber in diesem Kapitel um die Eigenschaften des Internets insgesamt geht, sollen zunächst die übrigen Anwendungen diskutiert und anschließend ein Fazit gezogen werden.
Wie bereits erwähnt, wurde vorgeschlagen, die Verbreitungs- beziehungsweise Massenmedien in drei Gruppen zu unterteilen. Das Kriterium bildet hierbei der primär genutzte Wahrnehmungskanal. Es kann demnach zwischen auditiven und visuellen Medien unterschieden werden, wobei die optische Rezeption von Informationen noch einmal zwischen schriftsprachlichen Medien und (Bewegt-) Bildern differenziert wird. Begonnen werden soll hier mit den schriftsprachlichen Medien.
Zu dieser Gruppe zählen verschiedene Printformate, wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Flugzettel, Plakate oder Transparente. Informationen können ebenso als Graffito, auf T-Shirts gedruckt oder in die Haut tätowiert transportiert werden. Neben diesen statischen gibt es noch dynamische Informationsträger, die zumeist elektronischer Natur sind. Das können Anzeigetafeln, Taschenrechner, Uhren oder Pager sein. Gemein ist ihnen die Übertragung von Informationen in Form von geschriebener Sprache. Bevor analog zur gesprochenen Sprache spezifische Merkmale und dann die ausgewählten Merkmalskomplexe für den Off- und Online-Bereich betrachtet werden, sind vorab einige Erläuterungen zu Verbreitungsmedien notwendig, die ebenso für visuelle und auditive Medien relevant sind.
Luhmann (vgl. 1998: 202ff.) zeigt, dass Verbreitungsmedien die Reichweite von Kommunikation vergrößern, indem der Kreis an Empfängerinnen und Empfängern ausgeweitet wird. Die radikalste Neuerung, zumindest in modernisierungstheoretischer Hinsicht, besteht wohl darin, dass die Übertragung von Informationen von der räumlichen Anwesenheit entkoppelt wird. Damit geht aber gleichzeitig eine Anonymisierung einher: Es ist im Einzelfall für Kommunikanden nicht mehr nachvollziehbar, wer welche Information erhalten hat. In der Folge entsteht daraus ein fortwährender Bedarf an neuen Informationen, denen die Massenmedien gerecht werden. Die Inflation der Informationen hat zur Folge, dass man nicht wissen kann, welche Kommunikationen gesellschaftsweit angenommen, abgelehnt oder überhaupt wahrgenommen werden. An diesem Problem setzen die symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien an, die im Anschluss betrachtet werden. Für die Internet-Entsprechungen der Verbreitungsmedien ist zudem relevant, dass nach Luhmann mündliche Sprache eine ungleich höhere Annahmewahrscheinlichkeit als geschriebene hat. Gerade für die hybriden Formen kann dies ein interessantes Unterscheidungsmerkmal darstellen.
Weiterhin geht Luhmann (vgl. 1998: 312f.) davon aus, dass sich die Massenmedien zu einer heterarchischen Ordnung entwickeln und dass räumliche Integration zunehmend bedeutungslos wird. Während also Gesellschaften lange Zeit auf dem Machtungleichgewicht von »oben« und »unten« gründeten, stellen die Verbreitungsmedien ein Alternativprojekt dar. Die Computertechnologie geht noch weiter, indem sie die Autorität der Expertinnen und Experten infrage stellt und deren Aussagen auf Basis von Online-Kollaborationen überprüft. Das GuttenPlag Wiki hat eindrucksvoll gezeigt, wie so etwas aussehen kann.
Evolutionsgeschichtlich kommt der Schrift große Bedeutung zu (vgl. Luhmann 1998: 249ff.): Während bei mündlicher Sprache die Vergangenheit nur so weit wie das individuelle Gedächtnis reicht, ermöglicht die Schrift so etwas wie ein soziales Gedächtnis, das von den Individuen unabhängig existiert. Damit wird die Frage des Erinnerns und Vergessens in eine objektive Kategorie überführt. Es muss anhand von Kriterien und Kontrollen entschieden werden, welche Ereignisse aufgeschrieben und somit festgehalten werden. Gleichzeitig wird bei der Verwendung von Schrift die Metakommunikation optional. Text- und Kontextverweise zum Verfasser, Adressaten oder Empfängerinnen müssen immer explizit eingeführt werden. Damit gibt es auch keine unmittelbar aktive Teilnahme und keine (direkten) sozialen Erwartungen mehr. Die Interaktion wird auf den »Austausch« von Informationen beschränkt. Ein Resultat davon ist die Entstehung von Unsicherheit in Bezug auf den gemeinten Sinn. Die Entkopplung von Mitteilen und Verstehen erfordert immer Interpretationen des Rezipienten, die im Sinne der Verfasserin oder des Verfassers sein können, aber nicht müssen (vgl. Winter/Eckert 1990: 24f.).
Als mediumsspezifische Eigenschaften sind gemäß der obigen Analyse drei Aspekte auf die Online-Entsprechungen der schriftsprachlichen Medien anzuwenden: die tendenzielle Anonymisierung der Produzentinnen und Produzenten sowie der Rezipienten der Informationen, eine Verringerung der Annahmewahrscheinlichkeit sowie die Ausbildung eines sozialen Gedächtnisses. Auf welche Web-Dienste jedoch können diese Merkmale angewendet werden? Es handelt sich vorrangig um das World Wide Web mit seinen Homepages und Blogs, Microblogging-Diensten und Internetforen, um E-Mails und um Chat-Dienste. Dazu ist noch festzuhalten, dass speziell für den Bereich der Printmedien im Vergleich von Off- und Online ein bereits im Zuge der Diskussion der mündlichen Sprache offenbartes Problem unausweichlich ist: Es steht eine weitestgehend homogene Offline-Sphäre der hybriden und überaus heterogenen Online-Kommunikation gegenüber. In Anbetracht der gewählten Merkmalskomplexe sind verstärkt Ergebnisse zu erwarten, die einer Sowohl-Als-Auch-Logik entsprechen.
Auf den ersten Blick scheint sich die tendenzielle Anonymisierung der Produzentinnen und Produzenten sowie Leser und Leserinnen im Rahmen der Online-Medien zu verstärken. Schließlich werden Mitteilen und Verstehen einer Aussage nicht nur zeitlich und räumlich, sondern auch in sachlicher Hinsicht entkoppelt (vgl. Wehner 1997: 136f.). Gerade in den letzten Jahren wurden allerdings zunehmend Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des Feedbacks geschaffen. So besteht zum Beispiel die Option, mit den Urheberinnen und Urhebern im WWW veröffentlichter Texte bei verhältnismäßig geringem Aufwand in direkten Kontakt zu treten. Einerseits werden hierzu von Homepagebetreibern immer Kontaktdaten (in der Regel die E-Mailadresse) bereitgehalten, andererseits werden öffentliche Austauschmöglichkeiten populärer. Die »Leave a Comment«-Funktion auf Nachrichtenseiten, Blogs, Produktportalen oder auch thematischen Web-Auftritten ermöglicht sowohl den Austausch zwischen den Autorinnen oder den Autoren und den Leserinnen und Lesern als auch innerhalb der Leserschaft. Zum anderen entstehen dadurch gleichermaßen neue Texte, die eventuell Korrekturen und Ergänzungen vorheriger enthalten. Jedenfalls stellt es eine Möglichkeit der Rückkopplung dar, wenngleich mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung.
Darüber hinaus wird die anonyme Leserschaft partiell sichtbar, da Kommentare in der Regel mit Namenskennung hinterlassen werden. Wenngleich mit Synonymen oder Nicknames gearbeitet wird, kann der Kolumnist eines Online-Magazins beispielsweise feststellen, dass Woche für Woche dieselben User seine Texte kommentieren. Zudem gibt es noch weiterreichende technische Lösungen: Für Blogs, Microblogs und Webseiten können Abonnements aktiviert werden. Teilweise sind die Abonnentinnen und Abonnenten anonym, es ist bloß deren Anzahl erkenntlich, teilweise sind sie aber auch mit einem entsprechenden Profil vertreten. Gemein ist ihnen, dass Mitteilende davon ausgehen können, dass ihre Informationen trotz der erhöhten Anzahl und Diffusität von Inhalten von einem bestimmten Personenkreis rezipiert werden. Gleichzeitig wird auch der gegenläufige Kommunikationsmodus technisch vereinfacht: Demnach ist es vielmals möglich, und auch gewollt, Botschaften anonym zu publizieren. Im Web ist es dabei ungleich einfacher, ein großes Publikum zu erreichen. Zum einen sind die Zugänge zu entsprechenden Medien nicht an Autoritäten gebunden, zum anderen ist eine ungleich größere Anzahl an potenziellen Rezipienten erreichbar. So wurde beispielsweise im Jahr 2009 vor und während der Wahl im Iran eine internationale oppositionelle und revolutionsnahe Protestbewegung über den Microbloggingdienst Twitter organisiert, wobei die restriktive, staatlich organisierte Verfolgung und Zensur keine effektiven Angriffspunkte hatten. Ähnliches gilt für das 2010 bekannt gewordene Web-Portal WikiLeaks. Die dahinterstehende Organisation ermöglicht es, anonym Dokumente und Daten, etwa militärische Akten, zu veröffentlichen, die normativen Kriterien entsprechend gesellschaftlich relevante Geheimnisse lüften. Es ist also festzuhalten, dass die auf der Rollentrennung basierende Anonymisierung der Offline-Massenmedien im Internet durchaus aufgehoben werden kann, aber nicht zwangsläufig muss.
An diese Ausführungen anknüpfend ist zweitens eine geringere Annahmewahrscheinlichkeit der Kommunikation zu konstatieren. Bei Face-to-Face-Interaktionen ist das Ablehnen der Botschaft oder zumindest der Kommunikation für Individuen aufgrund der Intensität der Situation sowie der damit einhergehenden sozialen Zwänge fast unmöglich. Ein Zeitungsartikel kann eher zur Seite gelegt werden als das Gespräch mit der Redakteurin abgebrochen werden kann. Bezieht man sich hier wiederum vornehmlich auf die Massenkommunikation, zeigt sich eine Verstärkung der von Luhmann diagnostizierten Tendenz. Die Ursachen liegen in der konsequenten Fortführung der Entkopplungslogik: Aufgrund der Globalität des Internets und der kostengünstigen Verteilbarkeit von Informationen geschieht Kommunikation in zunehmend unvermittelt. Die oben genannten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des Feedbacks beschränken sich vornehmlich auf die Rezipientenseite. Die Mitteilenden hingegen müssen jenseits ihrer Inhalte spezifische Lösungen finden, die Annahmenwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ein wichtiger Ansatz besteht in den Referenzierungs- und Bewertungssystemen des Internets. So sind inzwischen für spezifische Angebote Mechanismen etabliert, die es Usern erlauben, Inhalte oder Produkte nach verschiedenen Kriterien zu evaluieren. Eine Vielzahl an positiven Bewertungen steigert die Annahmewahrscheinlichkeit für andere User. Darüber hinaus kann die Annahmewahrscheinlichkeit erhöht werden, indem einzelnen Usern gezielt bestimmte Informationen offeriert werden. Dies wird inzwischen in großem Umfang genutzt. Entweder durch technische Identifizierungsmechanismen (cookies) oder auf Basis von selbst angelegten Profilen werden (vermeintliche) Vorlieben als Grundlage der Ansprache genutzt. Solche Empfehlungssysteme (Recommender Systems) kommen inzwischen in nahezu allen Bereichen des Web zum Einsatz.
Das letzte medienspezifische Charakteristikum umfasst die Bereitstellung eines überindividuellen, also sozialen Gedächtnisses. Was kann nun das Internet zu dieser bisher im Wesentlichen durch Bücher realisierten Funktion des kollektiven Gedächtnisses (vgl. Assmann 1992) beitragen? Denkbar sind zwei Argumentationsstränge: Einerseits ermöglicht das Internet eine Verstärkung der Funktion, indem (öffentliche) Texte leichter geschrieben werden können, andererseits könnte das Netz dazu beitragen, das Gedächtnis zu dysfunktionalisieren, da Inhalte immer wieder editierbar und nicht beständig sind. Der erste Strang knüpft an bisherige Erkenntnisse an. Das Internet ist demgemäß eine Technologie, die aufgrund der Digitalisierbarkeit der Inhalte sehr leistungsfähig und in der Größe unbeschränkt ist. Gerade Texte benötigten sehr wenig Speicherplatz. Da es im Grunde jedem User möglich ist, Inhalte im Web zu veröffentlichen, kann sich eine Vielzahl an Individuen an der Erstellung des kollektiven Gedächtnisses beteiligen. Gleichwohl hat diese Demokratisierung eine gewisse Beliebigkeit zur Folge. Während Druckerzeugnisse klassischerweise qualitativen Kontrollen und spezifischen Zugangsbeschränkungen unterliegen, kann jede und jeder über das Internet publizieren. Damit wird natürlich fraglich, welchen Texten Glauben geschenkt werden kann. Es gibt zudem weder Verzeichnisse noch fortlaufende Nummerierungen, im Zweifel nicht einmal eindeutige Autorenschaften, anhand derer ein Gesamtbestand definiert werden könnte.
Gleichwohl bietet der digitale Code eine neue Facette der Organisation von Wissen. So ist das Web durch Suchmaschinen oder durch spezielle Programme nach Schlagworten, nach assoziierten Themen, in chronologischer Reihenfolge, nach Sprachen, Ländern oder auch nach Beliebtheit durchsuchbar. Perspektivisch wird das gegenwärtig in Entwicklung befindliche »Semantische Web« in der Lage sein, auch die hinter den Zeichenfolgen bestehenden Bedeutungen zu rekonstruieren und zu interpretieren und wird so sehr zielgenau auf Inhalte verweisen können. Die Entscheidung, wer welche Texte veröffentlichen kann, wird dabei verstärkt abgelöst durch den Umfang der Rezeption. Das Qualitätskriterium besteht also nicht mehr in der Möglichkeit, publizieren zu dürfen, sondern im Web gefunden und vor allem gelesen zu werden. Damit User wissen, welche Inhalte in irgendeiner Form hilfreich, interessant, amüsant oder relevant sind, werden den Veröffentlichungen Meta-Daten zugeordnet. Dies kann automatisiert, in technischer Form geschehen, wenn etwa Homepages ihrer Frequentierung nach gelistet werden oder auf Basis menschlicher Bewertung, indem Web-Angebote bewertet oder rezensiert werden. Selbstredend unterliegen diese neuen Mechanismen dynamischen Veränderungen.
Aber nicht nur die Bewertungen ändern sich, auch die Informationen sind eben nicht in »Stein gemeißelt«. Während sich ein einmal gedrucktes Wort nur unter erheblichem Aufwand nachträglich ändern lässt, können digitale Inhalte verhältnismäßig einfach »aktualisiert« werden. Derselbe Link kann zu zwei verschiedenen Zeitpunkten auf zwei verschiedene Inhalte verweisen. Hat diese Variabilität nun Einfluss auf das soziale oder kollektive Gedächtnis? Zur Beantwortung muss wiederum zwischen den Potenzialen und der tatsächlichen Nutzung unterschieden werden. Grundsätzlich versucht die hiesige Betrachtung möglichst unabhängig von temporären Nutzungsweisen zu argumentieren – dies ist aber nicht in jedem Fall zielführend. So ist es durch das Internet sowohl möglich, Inhalte fortwährend zu erneuern und alte zu ersetzen, als auch Homepages unverändert über Jahre hinweg bestehen zu lassen. Sie erfüllen dann ähnliche Funktionen wie ein Buch, wenngleich der Startpunkt auch erst 20 Jahre zurückliegt. Ferner gibt es Projekte, wie das Internet Archive (vgl. 2012: online), die Teile des Internets fortwährend speichern und es damit ermöglichen, Homepages eines beliebigen zurückliegenden Datums anzuschauen. Diese zeitmaschinenähnliche Funktion ist allerdings aufgrund der Unmenge an Daten des Internets immer auf einzelne Angebote beschränkt und nicht mit Archiven oder historischen Bibliotheken zu vergleichen. In der Praxis ist das Internet jedoch ein vornehmlich dynamisches Medium, dessen Nutzerinnen und Nutzer (bisher zumindest) keinen großen Wert auf die Unveränderlichkeit von Inhalten legen. Gleichwohl bieten verschiedene Formate, wie Wikis, die Möglichkeit, alle Änderungen nachzuverfolgen.
Für die Bedeutung als soziales Gedächtnis ist aber relevant, dass das Internet gleichwohl einen spezifischen Modus an Informationskonservation bereithält: Besonders relevante, also häufiger nachgefragte Informationen werden in der Regel stärker rezipiert und auch neu gesendet. Speziell die Blogosphäre versteht es, bestehende Informationen unter einem spezifischen Blickwinkel noch einmal aufzubereiten und weiterzusenden. Der Diskurs zwischen Medienrechtlern und -rechtlerinnen dreht sich dementsprechend gegenwärtig vor allem um die Idee eines (gewünschten) Verfallsdatums für Informationen im Web und nicht um die Frage des Verlustes. Während private Homepages kommen und gehen und meist keine bleibenden Spuren hinterlassen, gilt dies für bedeutendere Inhalte nicht. Durchsucht man etwa das WWW nach der ersten Zeile der in der Einleitung bereits angesprochenen Declaration of the Independence of Cyberspace – Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind – von John Perry Barlow (vgl. 2013: online), findet man sie gegenwärtig auf über 20.000 verschiedenen Seiten. Analog zur Auflage bei Printpublikationen ist ein Selektionsmodus festzustellen, der aber stärker von den Usern ausgeht.
Als erster der drei Merkmalskomplexe soll nun die Akteurskonfiguration betrachtet werden: Wie für Offline-Medien kann zunächst zwischen Kommunikation unterschieden werden, die entweder vorrangig an einzelne Personen (wie Brief, die E-Mail und Chat-Anwendungen) oder an eine Masse von Personen (wie Zeitschriften und Büchern, Graffiti und Homepages, Blogs, Microblogging-Dienste und Foren) gerichtet ist. Im Bereich von one-to-one-Austausch unterscheidet sich die Online- nicht kategorial von der Offline-Sphäre. In jedem Fall können Zeichen oder Texte gezielt einer bestimmten Person übermittelt werden. Aufgrund der Digitalität des Internets ist allerdings eine Öffnung hin zu mehreren Empfängerinnen oder Empfängern festzustellen. Das Versenden von E-Mails mittels der CC-Funktion ist ein viel genutztes Beispiel hierfür. Diese eigentümlich an den analogen Schriftverkehr angelehnte Option des Carbon Copy adaptiert quasi den Kohlepapierdurchschlag, mit dem ein Dokument vervielfältigt werden kann. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass nicht während der Produktion des Textes durch technische Hilfen eine Replikation erfolgt, sondern dass der Text beim Verteilen eine Vervielfältigung erfährt. Im Grunde, und dies trifft auf alle digitalen Medien zu, verliert die bisher gültige Mengenlogik bei immateriellen Gütern massiv an Bedeutung. Im Internetzeitalter gibt es praktisch keine Grundlage für die Unterscheidung zwischen Ein- und Mehrzahl mehr. Während von einem Buch entweder 500 Stück oder 5000 Stück gedruckt werden können und ein Brief, unabhängig davon, wie häufig oder von wie vielen verschiedenen Personen er gelesen wird, nur einmal vorliegt, gestaltet sich dies für E-Mails anders. Zwar werden diese nur einmal geschrieben, durch den Versand aber vervielfältigt. Da das Internet ausschließlich auf der Übermittlung von einfachen Signalen oder genauer: des 0-1-Codes basiert, besteht der Prozess der Vervielfältigung egal welchen Inhaltes in einer simplen Operation. Digitale Inhalte sind also unbegrenzt vervielfältigbar. Diese Kopien bestehen auch dann fort, wenn das Original gelöscht wird. Die one-to-one-Kommunikation birgt demnach die Möglichkeit, Inhalte und Kommunikate in ihrer Quantität flexibel zu ändern.
Für die one-to-many-Kommunikation wurde hingegen schon deutlich, dass ein wesentlicher Unterschied in den Restriktionen des Zugangs zur Senderolle liegt. Hier ist eine Demokratisierung, also Verbreiterung des Zugangs festzustellen. Wie Schierl bereits 1997 (vgl. 72f.) konstatiert, ist dieser Prozess sowohl durch die Senkung der Kosten als auch der technischen Hürden begünstigt, wodurch nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen verstärkt »im« Internet präsent sind. Ob dieser Prozess dem Internet zugute kommt oder vielleicht sogar schadet, weil der Informationsgehalt oft gering ist, war damals noch nicht einzuschätzen. Inzwischen tragen verschiedene Meta-Dienste, wie Suchmaschinen oder explizite News-Sites dazu bei, aus der Unmenge an Informationen relevante Texte zu finden. Gleichwohl soll an dieser Stelle mit Wehner (1997a) noch einmal festgehalten werden, dass eine Substitution klassischer Massenkommunikation durch interaktive Dienste unwahrscheinlich ist. Denn gerade der »Ein-Weg-Kommunikation« kommt eine integrative Funktion zu, indem kollektives Wissen über die Welt verbreitet wird und verschiedene Werte geteilt werden. Many-to-many-Kommunikation ist im Offline-Bereich schriftlich schwer realisierbar, etwa in Form verschriftlichter Mündlichkeit, wie dem Transkript einer Podiumsdiskussion. Im Online-Bereich hingegen sind aufgrund der partiellen Kohärenz von gesprochener und geschriebener Sprache verschiedene Dienste in der Lage, diese Konstellation zu realisieren. Man denke etwa an Foren, Wikis oder auch Mailinglisten. Gerade die Wikipedia zeigt eindrucksvoll, wie die Zusammenarbeit der »Vielen« für eine die Internetuser von großer Bedeutung sein kann.
Die Akteurskonstellationen und Aspekte der Zugänglichkeit von Informationen bedingen sich gegenseitig. Die Antwort auf die Frage, ob Kommunikate privat oder öffentlich sind, hängt wiederum von dem genutzten Medium ab. Während Briefe zumeist privat sind, Bücher hingegen öffentlich, ist die Zuordnung für das Internet nicht so eindeutig. Homepages und Blogs sind vorwiegend an die Öffentlichkeit adressiert, Microblogs, Foren und Chats hingegen nehmen eine hybride Position ein. Einerseits kann durch sie eine anonyme Masse an Individuen angesprochen werden, andererseits erlauben sie ebenso eine Einschränkung des Adressatenkreises bis zur Privatheit. User können damit die Reichweite ihrer Kommunikation bewusst steuern. Ein Chat-Channel kann allen Internetnutzerinnen und -nutzern zugänglich sein, nur einzelnen oder auch nur handverlesenen. Damit werden verschiedene Teilöffentlichkeiten geschaffen, zu denen nur bestimmte User Zugang haben. Entsprechende Communitys variieren in der Größe von sehr wenigen Mitgliedern bis zu mehreren Millionen. Damit wird dem Aspekt der Ansprache bereits vorgegriffen.
Wie im Offline-Bereich auch kann geschriebene Sprache sowohl eine personalisierte als auch eine massenhafte Ansprache realisieren. Die Sendenden haben die Option, entsprechende Einstellungen vorzunehmen und damit relevante Aspekte der Kommunikation bewusst zu steuern. Zudem besteht die Möglichkeit, Ansprachen mit Hilfe technischer Lösungen zu automatisieren. Im Detail handelt es sich dabei um personalisierte Kommunikationsangebote, ohne dass eine menschliche Selektion notwendig ist. Erste Ansätze bestehen in Filtern, Abonnements und Empfehlungssystemen. Letztere kumulieren in Anlehnung an das Amazon-Recommendation-Prinzip Userdaten und -aktionen mittels einfacher, aber echtzeitlicher statistischer Verfahren zu Vorliebenkomplexen, die den Usern dann als personalisiertes Angebot erscheinen. Ein großes Spektrum an verschiedenen Inhalten und eine ausreichende Menge an Userdaten ist hierfür die Voraussetzung (vgl. Wehner 2010: 183ff.). In der Praxis kann jedem User automatisiert, auf Basis eigener zurückliegender Aktionen sowie der Korrelation des Online-Verhaltens einer Vielzahl anderer User, ein »individuelles« Angebot offeriert werden. Solche softwarebasierten Mechanismen sind inzwischen zum Web-Standard anvanciert und finden sich nicht nur in Konsumtionszusammenhängen, sondern auch in Web-Radios, auf Videoplattformen oder bei Suchmaschinen.
Bezogen auf die Zeitlichkeit unterscheidet sich Online-Schriftlichkeit von der Offline-Sphäre durch das Potenzial zur synchronen Kommunikation. Während schriftliche Kommunikation klassischerweise aufgrund von Restriktionen in der Produktion und im Transport nur asynchron funktionieren kann, ermöglicht das Internet echtzeitlichen Austausch mittels Schrift. Gleichermaßen können Inhalte ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt konsumiert werden, da sie in der Regel nicht bloß kurzfristig angezeigt werden, sondern erhalten bleiben. Gerade für den Bereich der Massenmedien ist aber die Aktualisierbarkeit hochgradig relevant. Regelmäßig erscheinende Printmedien erreichen maximal eine Aktualität von zwölf Stunden (bei Morgen- und Abendausgaben von Zeitungen) und gegenstandsbezogene Medien, wie Flugblätter sind zwar mittels moderner Desktop-Publishing-Systeme binnen weniger Stunden zu produzieren, erreichen aber nur wenige Menschen. Da die Produktions-, Veröffentlichungs- und Verbreitungsphase im Internet weitestgehend zusammenfallen, kann eine bisher für unmöglich gehaltene Aktualisierungsrate realisiert werden. An beliebigen Orten auftretende Ereignisse sind wenige Minuten später über das Internet bereits weltweit verfügbar. Das Internet ist dabei immer live. Verantwortlich hierfür sind nicht primär professionelle Akteure aus dem Bereich des Journalismus, sondern zumeist Amateure, die bloggen, twittern oder einen Ticker betreiben. Zudem ermöglichen die mobilen Endgeräte Berichterstattung außerhalb von Redaktionen und Büros.
Das Merkmal der Additivität hat Bezugnahmen und damit das Maß an möglicher Komplexität zum Thema. Mittels geschriebener Sprache kann klassischerweise auf vorgängige Publikationen durch Zitation oder Referenzierung Bezug genommen werden. Für das Internet bringt vor allem die Hyperlinkstruktur zwei Vorteile mit sich. Zum einen beziehen sich die Links immer auf aktuell im Netz verfügbare Informationen, zum anderen können sie auf ganz verschiedene Inhalte verweisen. Während die Referenzierung von gedruckten Texten und Ähnlichem es zwar erlaubt, Inhalte zu benennen, ist das Original jedoch nicht verfügbar. Sind weiterführende Informationen erforderlich, bleibt nur der Gang ins Archiv, in die Bibliothek oder in ähnliche Institutionen. Verlinkte Inhalte hingegen befinden sich innerhalb des Internets und sind deshalb mit einem Klick erreichbar. Hierdurch verlieren sie ihren externen Status zu Teilen, da den Beteiligten bewusst ist, dass die entsprechenden Informationen abrufbar sind. Zudem kann nicht nur auf andere Texte verwiesen werden, sondern auf multimediale Inhalte. Handelt es sich beispielsweise um eine Kritik zu einem neuen Album, könnte an den entsprechenden Stellen auf eine Audio- oder Videodatei verwiesen werden, die gewissermaßen den Text bereichert. Damit werden hypertextfähige digitale Dokumente vielgestaltig, assoziativ und komplex. Es entsteht eine Pluralität unterschiedlicher Pfade und Verweisungen, die Lesende individuell beschreiten und gestalten können (vgl. Sandbothe 1997: 152). Bei Print-Publikationen hingegen können nur Bilder eingebunden werden. Diese Argumente deuten auf ein gesteigertes Komplexitätspotenzial hin: Nicht schriftbasierte Medieninhalte können nicht nur erwähnt, sondern direkt eingebettet werden. Dies gilt auch für im gleichen Medium publizierte Texte. Indem sie verlinkt werden, bilden sie automatisch eine strukturelle Einheit mit anderen Informationen. Im Ergebnis ist dann ein riesiges Netz an Daten, Texten und Informationen vorzufinden, dessen Gesamtstruktur zwar hochgradig komplex, aber gleichzeitig simpel im Aufbau ist. Werden Verlinkungen konsequent genutzt und gepflegt, entsteht zwangsläufig ein System von Informationen, die aufeinander aufbauen und in diesem Sinne additiv sind.
Damit bleibt noch die Frage der Interaktivität im Rahmen von geschriebener Sprache im Off- und Online-Bereich zu erörtern: Während Aspekte des Selektierens und Transformierens für die gesprochene Sprache noch bedeutungslos waren, trifft dies auf geschriebene Sprache nicht zu. Interaktiv im Sinne der Selektion ist ein Medium dann, wenn User aufgrund ihrer Aktionen aus bestimmten Inhalten auswählen können. Im Offline-Bereich ist dies nur schwer umzusetzen; die Alternative zu Lesen besteht schlicht in Nicht-Lesen. Bei weitestgehend personalisiert genutzten Kommunikationen im Web ist dies ähnlich. Entweder man liest die Chat-Nachricht beziehungsweise eine E-Mail oder eben nicht. Für vorrangig massenhaft genutzte Kommunikation hingegen gestaltet sich dies anders. Es stehen verschiedene Auswahlmechanismen bereit, die sich entweder an Inhaltsverzeichnissen von Büchern und Zeitschriften orientieren oder aber komplexere Auswahlmethoden nutzen. Bedeutsam sind dabei Verschlagwortungsdienste, die auf Homepages und Blogs anwendbar sind, Suchmaschinen, die nach verschiedenen Kriterien das Web durchforsten können, Stichwortsuchen oder auch Selektionsmechanismen, die auf Userverhalten basieren. Das Web ist insofern interaktiv, als es auf die Eingaben der User (wenn auch nach festgelegten Regeln) reagiert. Da Suchmaschinen auch weitergehende Faktoren (geographische Standorte und vorherige Suchanfragen) einbeziehen, können Suchergebnisse sehr verschieden ausfallen. Auf einer Online-Nachrichtenseite können zudem einzelne Artikel entsprechend der Häufigkeit, in der sie gelesen wurden, entsprechend ihrer Bewertung durch User oder zeitlich sortiert angezeigt werden. Für gedruckte Zeitungen ist dies natürlich nicht möglich. Dieser Teil der Internetmedien weist eine hohe Interaktivität und damit auch Selektivität innerhalb der Medienrezeption auf.
Daran schließt das Merkmal der Modifikation an. Für den Offline-Bereich ist aufgrund der zeitlichen Trennung von Produktion und Konsumtion der Medien eine Veränderung der Inhalte nicht wahrscheinlich. Dies wäre bloß im Rahmen von Ausnahmeaktionen, etwa dem Überschreiben von Botschaften, realistisch. Davon abgesehen existiert eine Vielzahl von Angeboten, die (bisher) konsumierende User zu Produzentinnen und Produzenten von Inhalten machen. Diese durchaus verschieden interpretierbare Entwicklung (vgl. kritisch Voß/Rieder 2007 und für das Internet Papsdorf 2009) führt zu einer fortwährenden Modifikation und Erweiterung digitaler Inhalte. Da Blogeinträge kommentiert und in Wikis Inhalte eingetragen werden können, beeinflussen Individuen aktiv die Inhalte des Internets. Offline kam ihnen bisher vorrangig die Rezipientenrolle zu. Dieses zentrale Moment des Web 2.0 entspricht demnach in der Tat einem erhöhten Maß an Interaktivität. Hinsichtlich der Transformationsregeln sind zwischen beiden Sphären keine bedeutsamen Unterschiede festzustellen.
Als zweites Element der Interaktivität steht die Situationsevaluation im Kriteriumskatalog. Sie umfasst zum einen wiederum die subjektive Empfindung der technischen Systemmerkmale und zum anderen das Situationsempfinden im Sinne technischer Immersion. Die Kontrastierung von Off- und Online-Schriftlichkeit deutet dabei auf ein gänzlich anderes Verhältnis als in der Gegenüberstellung von mündlichem Austausch hin. Wie bereits gezeigt wurde, sind Printmedien oder auch handgeschriebene Botschaften nicht sonderlich interaktiv. Im Online-Bereich sieht das vor allem aufgrund der erläuterten Zeitlichkeit und der gewandelten Rollenstruktur grundlegend anders aus. Nun ist dieser Aspekt aber dergestalt angelegt, nicht Potenziale und objektive Argumente, sondern das subjektive Empfinden zu thematisieren. Hierfür sind mindestens zwei Entwicklungen auffällig: Die Veränderungen im Bereich der schriftbasierten Massenmedien hin zum Web 2.0 und die Digitalisierung personalisierter Kommunikation. Der bereits angesprochene erste Prozess des Paradigmenwechsels gründet wesentlich in der verstärkten Nutzung von neuen Web-Medien (wie Blogs) und auch in der Bereitstellung von Content durch User. Geht man von einem Zusammenhang zwischen der positiven Einschätzung der technischen Merkmale und der Nutzung aus, so verweist die zunehmende Anzahl an privaten Blogs oder an Artikeln, die von Amateuren geschrieben werden, tendenziell auf eine Zustimmung.
Speziell vor dem Hintergrund des Interaktionspotenzials bieten digitale Formen des Austauschs Vorteile, da ihr Pendant ebenfalls auf technische Artefakte angewiesen ist. Die sich bereits etymologisch recht nahen Medien Brief und E-Mail verbindet die Frage, ob der Brief von der E-Mail abgelöst wird. Wenngleich hier eine eindeutige Kausalität schwer nachzuweisen ist, deuten die sinkende Anzahl an versendeten Briefen sowie der stark gestiegene E-Mail-Verkehr darauf hin. Dass die Deutsche Post beispielsweise inzwischen einen E-Postbrief, was als eine »sicher« versendete E-Mail beworben wird, anbietet, zeigt einen (wenn auch vorsichtigen) Wandel an. Hinsichtlich des Situationsempfindens kann vor dem Hintergrund der gewissermaßen beteiligungsarmen analogen Schrift zumindest Variabilität diagnostiziert werden. Eine E-Mail kann wie ein Brief, eine Homepage wie ein Buch, ein Blog wie ein Tagebuch und so fort genutzt werden. Sie können aber auch deutlich intensiver und hochfrequentiert genutzt werden. Betrachtet man die Chat-Kommunikationsformen mit, zeigt sich das Potenzial zum »Sense of Place« oder zur »Social Presence« durch digitale Medien. Immersion hängt demnach stark von der individuellen Nutzungsweise ab. Diese kategorische Offenheit erschwert zwar die Einschätzung der Eigenschaften des Mediums, stellt aber gleichwohl selbst ein zentrales Merkmal dar, das sich von der Plattformfunktionalität noch einmal unterscheidet, indem es auf einer tieferen Ebenen, nämlich den einzelnen Anwendungen ansetzt.
Schließlich bildet der Bedeutungsaustausch den letzten Aspekt der Interaktivität und damit der Betrachtung von geschriebener Sprache im Internet insgesamt. Für die Schriftlichkeit ist der Aspekt wenig problematisch: Das Interaktionspotenzial in dieser Hinsicht entspricht dem des Offline-Bereichs, da gleichermaßen die Möglichkeiten und Restriktionen der Schrift dominant sind. Die genannten Rückkopplungs- und Bezugnahmemechanismen allerdings ermöglichen es, Unverständlichkeiten oder Fehler zeitnah zu thematisieren und unterstützen damit die De-Kodierung von gesendeten Zeichen. Entsprechend den obigen Ausführungen zur Interaktivität unterscheiden sich Off- und Online-Variante der geschriebenen Sprache nur marginal. Die graduellen Unterschiede liegen vorrangig in der Zeitlichkeit und in der veränderten Rollenverteilung begründet und entsprechen damit einer Ausgestaltung der Eigenschaften des Internets als technisches System.
Im Folgenden geht es um nonsprachliche, visuelle Medien. Im Unterschied zu den vorangegangenen Kontrastierungen ist speziell für Filmmedien sowie für Animationen vorab festzustellen, dass sie aufgrund ihrer zumeist (elektronischen) technischen Basis weitreichende Ähnlichkeiten mit ihren Online-Entsprechungen aufweisen. Bis vor wenigen Jahren galt dies nicht für Bilder. Die Dominanz digitaler Fotografie in jüngster Zeit hingegen lässt die Eigenschaften von Bildern im Off- und Online-Bereich konvergieren. Bei visuellen Medien handelt es sich klassischerweise um Bilder, die als Fotografie, Zeichnung, Gemälde oder anderweitig künstlerisch realisiert sind. Außerdem gehören auch Bewegtbilder, im Sinne verschiedenster Film- und Fernsehformate oder (computer-)animierter Bilder, dazu. Diese sind filmisch konsumierbar oder auch in Videospiele eingebettet. Für das Internet sind ähnliche Medien festzustellen: Bilder, wenngleich nur in digitaler, dafür animierbarer Form, Bewegtbilder, die Eigenschaften von Kino-, Fernseh- oder auch Privatproduktionen aufweisen oder Spiele, die entweder online gespielt oder von Internetfunktionen unterstützt werden. Zusätzlich erlangen mit der Benutzung von Computern und dem Internet sogenannte Icons, also grafische Symbole an Bedeutung. Sie existieren offline beispielsweise als Ideo- und Piktogramme und haben vor allem in speziellen Kontexten wie dem Straßenverkehr Bedeutung.
Drei Spezifika der (bewegt-) bildlichen Online-Kommunikation sind beachtenswert: Erstens wurde das Video in den letzten Jahrzehnten als Primärtechnologie durch digitale Speicher- und Übertragungsmöglichkeiten abgelöst. Videokameras und -rekorder sind der technischen Entwicklung entsprechend in diesem Zuge gleichermaßen günstiger, leistungsfähiger und kompakter geworden. Mit der konsequenten Digitalisierung der Bewegtbildtechnologie eröffnen sich unzählige Schnittstellen zum Internet (vgl. Postel 2001: 29ff.). Daraus resultiert zweitens ein epochaler struktureller Wandel. Gerade mit dem Internet haben für den Video-, aber auch Bildbereich vor allem Plattform-Modelle an Bedeutung gewonnen. Auf diesen können User eigene Filme oder auch nur kurze Sequenzen einstellen. Im Umkehrschluss werden Konsumentinnen und Konsumenten unabhängiger von zeitlich gebundenen Programmen oder Sendungen. Neben diesen User-Content-Plattformen ermöglicht es auch ein Großteil von TV-Sendern, die ohnehin digital produzierten Inhalte online zu schauen. Ein Teil des Programms ist somit »on demand«, also auf Nachfrage verfügbar. Hinzu kommt eine Vielzahl an Angeboten, die Inhalte gegen Gebühr konsumierbar machen. Drittens sind Podcasts gegenwärtig sehr populär. Sie können sowohl Video- als auch Audiomaterial enthalten und sind vor allem deshalb interessant, weil sie abonniert werden können. So ist es beispielsweise möglich, die Tagesthemen auf jedes moderne Smartphone zu laden und auf dem Weg zur Arbeit anzuschauen. Das Gerät synchronisiert sich nachts automatisch mit der ARD-Mediathek und löscht bereits gesehene Ausgaben (vgl. Niemann 2007: 13ff.). Charakteristisch ist damit für Filme im Internet ein gesteigerter Variantenreichtum in Bezug auf die Distribution in Form von Verbreitungsmedien (vgl. Weber 2008: 28ff.).
Die Ikonografie oder die Medienanalyse des Bildlichen blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück. Jenseits der vorrangig philosophischen Debatte zum Iconic oder auch Pictoral Turn (vgl. Mitchell 2008) sind hier die Merkmale bildlicher Medien zu diskutieren, die sie von Schrift und Sprache unterscheiden. Im Detail sind dabei vor allem drei Aspekte interessant: die Aufmerksamkeitsbindung, die Unmittelbarkeit sowie der (hohe) Informationsgehalt. Sie treffen auf statische und noch stärker auf bewegte Bilder zu. Schelske (vgl. 1999: 244ff.) geht davon aus, dass Bilder ihr kommunikatives Potenzial durch das Erwecken von Aufmerksamkeit erlangen. Aufmerksamkeit wird immer dann in erhöhtem Maß gebündelt, wenn vertraute Erwartungen durchbrochen werden. Gleichwohl bedarf es immer eines gewissen Maßes an Kulturvertrautheit, da andernfalls eher eine schockierende als informierende Wirkung einträte. Um nun Aufmerksamkeit zu erlangen, was in der Regel mit dem Veröffentlichen von Bildern intendiert ist, können entweder Darstellungskonventionen (Format, Farbe und andere) gestört werden oder ein bedeutsamer Inhalt liegt vor.
Darüber hinaus besteht eine besondere Eigenschaft von Bildern in ihrer Unmittelbarkeit. Aus diesem zumeist als vorteilhaft (in der Konkurrenz zu anderen Medien) interpretierten Charakteristikum resultiert nach Sachs-Hombach und Schira (2009: 409ff.) die Eignung zur schnellen Erfassung von komplexen Sachverhalten durch die Rezipienten, zur Erzeugung erlebnisnaher Illusionen sowie zur emphatischen und affektbetonten Rezeption. Bilder sind zudem konkret, spezifisch und sie besitzen zahlreiche Darstellungsoptionen. Damit sind die Anordnung von Einzelelementen, Farben, Größen, Linien, Formate und Ähnlichem gemeint. Während etwa räumliche Konstellationen durch Bilder sehr präzise beschrieben werden können, gilt dies für zeitliche Zusammenhänge oder Konditionale in keiner Weise. An anderer Stelle verweist Sachs-Hombach (vgl. 2003: 88ff.) auf die Wahrnehmungsnähe ikonografischer Medien, aufgrund dieser Bilder so unmittelbar rezipiert werden können. Damit ist gemeint, dass im Unterschied zur Interpretation arbiträrer Zeichen der Rekurs auf Wahrnehmungskompetenzen und die Struktur der Bildträger Hinweise auf die Bildbedeutung enthalten.
In der Gegenüberstellung zu Text und Sprache diagnostiziert Bruhn (2009: 17ff.) Bildern eine hohe Informationsdichte. Diese Potenz von Bildern ist dabei weniger bild-, als vielmehr sehspezifisch, da sie auf jede Form der direkten visuellen Wahrnehmung zutrifft. Bilder sind in dieser Argumentation wiederum dann verstärkt »aussagekräftig«, wenn es etwa um die Darstellungen von Form und Raum geht. So ist beispielsweise eine präzise sprachliche Beschreibung eines neuen Autodesigns ebenso schwer zu realisieren wie die visuelle Darstellung einer Gesetzesnovelle. Der hohe Informationsgehalt von Bildern basiert nicht unwesentlich auf der Verwandtschaft zur realen Welt, die primär visuell wahrgenommen wird. Durch Bilder ist es möglich, die Flüchtigkeit des Moments zwar nicht verlustfrei, aber weitestgehend realistisch und ausdrucksstark festzuhalten. Den Anfang dieser Entwicklung bildeten die ersten Fotografien um 1850 und das vorläufige Ende besteht in der permanenten Anwesenheit von fotografiefähigen Geräten. Neben den blitzlichtartigen Momentaufnahmen erlangten die Aufnahme und Wiedergabe von Bewegungen große Bedeutung. Bewegte Bilder lassen sich wiederum in einzelne Bilder dekonstruieren und dann im Detail betrachten. Durch sie ist Realität gewissermaßen konservierbar und im Umkehrschluss entsteht ein hochgradig informatives Medium (vgl. Winter/Eckert 1990: 88ff.).
Was lässt sich mit Hilfe dieser drei Merkmale über das Internet lernen? Zunächst zur Aufmerksamkeitsbindung: Die hohe Anziehungskraft von Bildern resultiert wesentlich aus der augenblicklichen Wahrnehmbarkeit (Unmittelbarkeit) und aus der Innovativität in der Darstellung. Die Idee einer Ökonomie der Aufmerksamkeit (vgl. Franck 1998) ist für das Internet von großer Bedeutung. In dezentralen und gewissermaßen inputstarken Kontexten, wie den Massenmedien, besteht das verbindende Moment in Aufmerksamkeit. Setzt man eine Nutzung des Internets als Kommunikationsmedium voraus und ruft zudem die Relevanz als one-to-many-Medium in Erinnerung, wird ein konstitutiver Bedarf an Aufmerksamkeitszuwendung augenscheinlich: Homepages, Blogs oder Tweets, die nicht rezipiert werden, sind schlicht hinfällig. Vor diesem Hintergrund ist der Einsatz multimedialer, aber speziell bildlicher Inhalte plausibel. Sie dienen dazu, User zu motivieren, bestimmte Webangebote zu nutzen. So ist es auch verständlich, warum die Web-Präsenzen namenhafter Tages- und Wochenzeitschriften ausnahmslos Bildergalerien und Videobeiträge zu den entsprechenden Nachrichten produzieren. Die Eroberung der Printmedien durch Bilder erfährt im Internet eine konsequente Fortführung. Der zweite relevante Aspekt liegt in der grafischen Gestaltung. Hier sollten entsprechend unerwartete Varianten in Farbe, Form oder Anordnung die Aufmerksamkeit binden. Das Internet ist dabei allerdings in seinen Möglichkeiten reduziert: Die Aus- respektive Wiedergabe ist an die Eigenschaften der Displays gebunden. Sie sind zweidimensional, basieren auf Pixeln und können nur im Dreifarbmodus RGB darstellen. Daraus folgt, dass zentrale Kenngrößen, wie etwa das Farbspektrum, die Plastizität oder der Detailgrad, in ihrer Qualität negativ beeinflusst werden. Es handelt sich im Internet deshalb immer um reduzierte Bilder, die zumeist aus Gründen der Trafficreduktion zudem komprimiert sind.
Es ist demnach von einer verringerten Aufmerksamkeitsbindung auszugehen, die allerdings zu Teilen technisch kompensiert wird. Hierfür gibt es verschiedene Strategien: Es kann ein Mehr an Inhalten geboten werden, es können Inhalte assoziiert werden oder Bilder in multimediale Inhalte transformiert werden. Beginnend mit Letzterem rekurriert diese Erweiterung auf die Konvergenz von Bild und Film. Anfänglich wurden dafür .gif-Dateien eingesetzt, darauf folgten Flash-Animationen, jüngst etabliert sich der HTML5-Standard. Ihnen gemein ist die Möglichkeit zur Animation. Die Bildpunkte (Pixel) können also während des Betrachtens wechseln. So ist es etwa möglich, einen beliebigen Bildausschnitt durch »Berühren« mit dem Mauszeiger zu vergrößern. Bei sogenannten Werbebannern, dies sind zumeist kleine in Seiten eingebettete Grafiken, zeigt sich die Entwicklung in Perfektion. Zum einen sind sie unmittelbar auf Aufmerksamkeit angewiesen, geht es doch um die Generierung von Klicks auf verlinkte Angebote, zum anderen folgt daraus eine hohe Experimentierfreude: von blinkenden, über grelle bis hin zu aufpoppenden Bannern wird eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten getestet. Speziell bei diesen Bannern ist der Erfolg direkt evaluierbar, weil für jeden Klick auf das Banner der oder die Inserierende zahlen muss, was letztlich ein effektives Zählsystem voraussetzt. Damit zeigt sich, dass die Aufmerksamkeitsbindung, die Unmittelbarkeit und die hohe Informationsdichte in einem engen Zusammenhang stehen. Die beiden Letztgenannten sind für das Web noch einmal von großer Bedeutung, da aufgrund der Informationsvielfalt für die einzelnen Angebote nur sehr kurze Rezeptionszeiten vorliegen. Wenn man als durch das Web surft, werden Blogs oder Homepages in der Regel nur wenige Augenblicke lang »gescannt«. Dementsprechend sind eingängige und aussagekräftige Bilder wichtig für die Gewinnung von Aufmerksamkeit. Der WWW beispielsweise hat einmal an Popularität gewonnen als zu Beginn der 1990er Texte vermehrt durch Bilder ergänzt wurden und ein zweites Mal als Mitte der 2010er Jahre Videos eine weite Verbreitung fanden.
Hinsichtlich ikonografischer Medien im Netz gilt an vielen Stellen dasselbe wie für die geschriebene Sprache und für die Verbreitungsmedien insgesamt, etwa in Bezug auf die Akteurskonfigurationen. So wird über die Plattformmodelle das gewissermaßen unprofessionelle Thematisieren und Einbeziehen der eigenen Person als Regisseur und oder Produzentin, das bisher nur im Gonzo-Journalismus von Hunter S. Thompson (vgl. Seymore 2007) und ähnlichen Exoten geläufig war, wird massentauglich, wenn User für User produzieren. Inwiefern dies ein Zugewinn für die Pluralität des Mediensystems oder eine Bedrohung für den Qualitätsjournalismus ist, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Für Spiele und Animationen ist dieser Prozess derzeit nicht so weit fortgeschritten; hier ist noch immer eine ausbildungsintensive Expertise unumgänglich. Gleichwohl zeigen verschiedene Open Source-, aber auch Crowdsourcing-Projekte (etwa der animierte und rein von Usern geschaffene Film »A Swarm of Angels«), dass vereinzelte Projekte über das Internet organisiert werden und jenseits professioneller Studios und damit auch jenseits großer Budgets Erfolg haben können. Ein weiteres Beispiel hierfür sind die für Apple Inc. geschaffenen Spiele und Anwendungen (»apps«), die nicht mehr vom Konzern selbst, sondern von Tausenden »Developern« programmiert werden. Wenngleich sich der Computerhersteller vorbehält, einzelne Inhalte und Programme zu zensieren, wurde der exklusive Kreis an Produzentinnen und Produzenten nachhaltig geöffnet.
Gleich den textbasierten Medien finden die Extreme der personalisierten und massenhaften Ansprache im Internet geradezu harmonisch zusammen. Beides ist möglich und überdies gezielt steuer- und einsetzbar. Hinsichtlich der zeitlichen Struktur ähneln statische Bilder textbasierten Medien, bewegte Bilder hingegen ermöglichen sowohl asynchrone als auch echtzeitliche Kommunikation. Letztere ist dabei in einem doppelten Sinne relevant: So können Bewegtbilder live oder programmgebunden ausgestrahlt werden. Ersteres ist bei einer Ausstrahlung ohne vorhergehende Aufzeichnung und Bearbeitung der Fall, zweiteres wenn Filme und Ähnliches einen spezifischen zeitlichen Slot (Sendezeit) zugewiesen bekommen und auch nur dann konsumiert werden können. Durch die Möglichkeiten des Internets ergeben sich zwei entscheidende Veränderungen: Da das Angebot nicht auf limitierte Sendekanäle beschränkt ist, können unzählige Live-Übertragungen parallel angeboten werden. Wer über eine Kamera und einen Internetanschluss verfügt, kann rund um die Uhr live senden. Damit öffnet sich ein ganz neues Fenster zur Welt, indem über den Bildschirm echtzeitlich geschaut werden kann, was gerade in Rio de Janeiro, Los Angeles, Nairobi, Tokio oder Moskau passiert. Zum anderen bietet das Internet in seiner Funktion als Speichermedium auch für filmische Inhalte die Möglichkeit, diese asynchron zu konsumieren. Während man via Fernsehen die Hauptausgabe der Tagesschau eben nur punkt 20 Uhr empfangen kann, ist sie auf der Homepage (www.tagesschau.de) zu beliebigen Zeiten abrufbar. Dieser Video-on-Demand-Service wird von klassischen Fernsehsendern inzwischen zunehmend angeboten und ist bei primär im Internet verbreiteten Videos zum Standard geworden. Damit ist eine zeitliche Entkopplung in der Konsumtion bildlicher Inhalte durch das Internet festzustellen.
Aus der angesprochenen Speicherfunktion resultiert nicht nur die Möglichkeit der asynchronen Rezeption von Inhalten, sondern ebenso geht mit der Öffnung zur Vergangenheit eine neue Qualität von Additivität einher. Während in klassischen filmischen Medien Bezugnahmen vorrangig im Sinne von Querverweisen oder linear hintereinander ausgestrahlten Folgen umgesetzt werden, ermöglicht das Internet komplexere Verknüpfungen.
Aus dem Themenkomplex der Interaktivität ist hier vorrangig die Aktionsebene relevant. Diese hat zum Thema, inwiefern Nutzerinnen und Nutzer durch eigene Inputs Selektionen vornehmen können. Ähnlich wie bei klassischen Medien kann zu Beginn gewählt werden, welcher Film angeschaut werden soll. Darüber hinaus gibt es, jenseits eines Abbruchs, wenig Möglichkeiten der Einflussnahme. Bei Filmen und speziell bei Animationen im Internet hingegen können die Rezipienten den Verlauf zu Teilen mitbestimmen. Zwar beschränkt sich der Input der User auf die Wahl zwischen vorproduzierten Optionen; sind diese jedoch in ausreichender Anzahl und Kombinationsfreiheit vorhanden, kann der Eindruck der Mitbestimmung oder gar Steuerung entstehen. In animierten und programmierten virtuellen Umgebungen, die durch Second Life einem breiteren Publikum bekannt wurden, bewegen sich User uneingeschränkt innerhalb von Grenzen. Das ist radikal neu. Häufig mit Hilfe eines Avatars werden artifizielle Landschaften, Phantasie-Gegenden oder auch digitale Abbilder tatsächlicher Städte (denkt man an Googles Kartografiedienste) entdeckt. Dies ist prinzipiell auch durch Offline-Medien – verschiedenste Computerspiele sind ein Beleg hierfür – möglich, hier bleibt die Größe der Welt und damit auch der Freiheit allerdings immer an lokale Hardware und beschränkte Datenträger gebunden. Beide Restriktionen sind für das Internet nicht von Belang.
Unter auditiven Medien soll nachfolgend die Übertragung von Informationen auf Basis der akustischen Wahrnehmung verstanden werden. Sie umfassen damit im Kern die Einheit eines physikalischen Schallereignisses und des subjektiven Hörereignisses. Von (Verbreitungs-) Medien kann dann wiederum gesprochen werden, wenn die zugrundeliegenden Schallwellen durch technische Kommunikationsmittel übertragen werden. Für die Zeit vor dem Internet waren nacheinander die Schellack-, später Venylplatte, die Kassette und die Compact Disk sowie in jüngerer Vergangenheit Flash-Speicher (wie in mp3-Playern) die wesentlichen Datenträger. Daneben sind Audio-Files fast ausnahmslos in allen filmischen Medien vertreten. Während die genannten Vertreter vorrangig zu Zwecken der asynchronen Kommunikation verwendet werden, sind echtzeitliche Austauschmedien mindestens von gleichrangiger Bedeutung. Den populärsten Dienst bildet hierbei der Hörfunk, der das erste elektronische Massenmedium überhaupt war. Seitens der one-to-one-Kommunikation sind Mobil- wie auch klassische Festnetztelefone und Jedermannsfunkanwendungen (etwa CB-Funk) viel genutzte Entsprechungen rein auditiver Kommunikation. Gemein ist ihnen die Überwindung des Raums und damit die Möglichkeit zur dezentralen Kommunikation, was eine große Innovation bedeutete (vgl. Winter/Eckert 1990: 58ff.).
Weniger bekannt hingegen sind die Internet-Entsprechungen. In Bezug auf Broadcasting, das der one-to-many-Kommunikation im Internet entspricht, ist analog zu den Video-Diensten zwischen Live- und On-Demand-Streaming zu unterscheiden. Das Live-Streaming gleicht klassischen Radiosendern, allerdings mit dem Unterschied, dass Frequenzen, Zugänge und damit auch Inhalte nicht begrenzt sind. Ein Großteil klassischer Radiosender nutzt das Internet, um die offline gesendeten Formate einem größeren (respektive weltweiten) Publikum zugänglich zu machen. Ebenso existiert eine Vielzahl an Internetradiosendern, die Inhalte ausschließlich über das Netz verbreiten. Die Formate werden dabei sowohl professionell als auch auf Amateurniveau produziert. In Deutschland sind circa 80 Prozent aller Webradios Internet-Only-Angebote, während der Rest im Wesentlichen als Live-Stream klassischer Sender (Simulcast) realisiert wird (vgl. Goldhammer/Schmid/Link 2010: 9). On-Demand-Streaming entspricht hingegen (abgesehen von der Kanalreduktion) dem Bereithalten von Videos im Internet auf entsprechenden Servern. Dabei kann zwischen Push- und Pull-Modellen gewählt werden, die entweder auf Basis vorangegangener Selektionen einzelne Formate automatisiert auf das Endgerät übertragen (im Sinne von Podcast-Abonnements oder Netcasting-Diensten) oder bei denen User jeweils Inhalte auswählen und dann konsumieren (beispielsweise nach dem Broadcatch-Prinzip).
Für die Internettelefonie hingegen sind relevante Differenzen zum Offline-Bereich festzustellen. Neben den vorrangig ökonomisch orientierten Merkmalen, wie etwa der Kostenfreiheit auch über Ländergrenzen hinweg, und der Kompatibilität zum herkömmlichen Telefonnetz sind neue Freiheitsgrade von Interesse. Die »Internettelefonnummer« entspricht dabei nicht viel mehr als einer beliebigen, aber eindeutigen Zahlen- oder Zeichenfolge. Sie ist nicht an ein spezifisches Gerät oder an einen geographischen Ort gebunden. In der Regel sind User, insofern sie sich auf einem technisch adäquaten Internetgerät eingeloggt und authentifiziert haben, überall erreichbar. Diese der Brief-E-Mail-Konstellation ähnliche qualitative Entwicklung ermöglicht eine Entbettung der Erreichbarkeit mündlicher Kommunikation aus bisher weitestgehend unhinterfragten Raumzusammenhängen. Die Telekommunikation ist damit ausschließlich an die Person (geht man von der beschriebenen tendenziellen Ubiquität des Internets aus) gebunden. Sie folgt dem Prozess einer gesteigerten Raumunabhängigkeit des Mobilfunks, geht allerdings darüber hinaus, insofern kein spezifisches, also nummer- oder personengebundenes Gerät mehr benötigt wird.
Im Kontext der technischen Spezifika von rein auditiver Kommunikation wurde in den letzten Abschnitten bereits deutlich, dass hier die Anwendung des erarbeiteten Kriteriumskataloges wenig neue Erkenntnisse zu Tage fördert. Die Gründe dafür liegen in der bereits ausführlichen Diskussion der (strukturähnlichen) textbasierten und ikonografischen Verbreitungsmedien sowie der identischen Kanalnutzung (akustische Wahrnehmung) im Zuge gesprochener Sprache und der Tonspur bei bewegten Bildern. Jenseits der festgelegten Merkmalskomplexe bietet die Frage nach jeweils mediumsspezifischen Charakteristika Raum für gewissermaßen offene Antworten. Dieser soll im Folgenden noch einmal für den Hörfunk genutzt werden.
Während das »Radio« lange Zeit als das schnellste Medium angesehen wurde, hat das Internet in der Vielfalt seiner Dienste hinsichtlich der Aktualisierungsraten unwiderruflich aufgeholt, es sogar überholt. Aus einer mit quali- und quantitativen Daten arbeitenden Studie (vgl. Mende 2010) können weitere Eigenschaften der Rundfunks abgeleitet werden, die primär aus Nutzungspraktiken resultieren und somit jenseits einer rein formalistischen Beschreibung aufschlussreich sind. Im Detail handelt es sich dabei um ein geringes Involvement, um eine habitualisierte Nutzung und um regional- und millieuspezifische Informationen. Der Grad der geringen Einbindung ermöglicht im Unterschied zu vielen anderen Formen von Verbreitungsmedien eine beiläufige Nutzung. Das Programm kann passiv, ohne eine Entscheidung treffen zu müssen und linear gehört werden. Damit gewinnt gerade ein geringes Interaktivitätspotenzial für die Nutzung an Attraktivität. Im Kontext der habitualisierten Konsumtion wird das Medium in Alltagsroutinen integriert: Ob beim Autofahren, unter der Dusche oder zum morgendlichen Munterwerden – Radiosendungen sind an vielen Stellen mit alltäglichen Praxen eng verwoben und zudem funktional, indem sie zur Stimulation eigener Emotionen eingesetzt werden. Radio soll die Hörerinnen und Hörer aufheitern, anregen, entspannen, entlasten oder auch harmonisieren (vgl. Mende 2010: 375). Das letzte Merkmal gründet weniger im Verhalten der Rezipienten als in den Anbieterstrukturen. Ein regional oder gar lokal geprägtes Programm vieler Radiosender hat nicht vorrangig technische Ursachen. Vielmehr gelingt es dadurch, ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. Die Hörerinnen und Hörer genießen alltagsnahe und ortsbezogene Informationen (und dies meint nicht nur Staumeldungen) mit hoher Aktualität.
Das erste Kriterium, geringes Involvement, kann nicht gerade als eine Stärke des Internets bezeichnet werden, da dieses zumeist als (inter-) aktives Medium beschrieben und genutzt wird. In der Gegenperspektive ist eine beiläufige Nutzung aber nicht per se ausgeschlossen. So kann mittels der beschriebenen Live-Streaming-Dienste ein Programm konsumiert werden, dass unabhängig von Usereingaben bereitgehalten wird. Die Vielzahl von Web-Radios sind ein Beispiel hierfür. Wenngleich es technisch möglich ist, radio-adäquate Medienangebote über das Internet anzubieten und mobile Endgeräte immer weiter in den Alltag vordringen, bleibt das Internet noch immer durch ein erhöhtes Maß an Komplexität und Voraussetzungen gekennzeichnet. Abgesehen von der notwendigen Hardware, die einen Bildschirm und ein Eingabegerät (die wenigen speziellen WLAN-Radiogeräte sollen hier unberücksichtigt bleiben) umfasst, braucht es auch entsprechende Kompetenzen. So müssen spezielle Dienste oder Programme im Internet aufgespürt, aus Tausenden von Sendern gewählt werden und dann auch noch funktionieren. Das geht natürlich nur mit einer Internetverbindung, die einigermaßen stabil und leistungsfähig ist. Im Unterschied zu den ubiquitären Radio-Wellen ist die Nutzungsfreundlichkeit des Internet-Radios also eher gering. Gleich den anderen Medienarten bietet das Web zwar aufgrund der Digitalität und der Netzwerkhaftigkeit ein vergleichsweise riesiges Angebot an Sendern, was aber für beiläufiges Hören untergeordnete Priorität besitzt. In Bezug auf bestimmte Nutzungspraktiken muss also davon ausgegangen werden, dass mediale Konvergenzentwicklungen nicht ausschließlich Verbesserungen im Sinne größerer Verfügbarkeit oder einfacherer Zugänge bedeuten, sondern immer auch eine Rückseite haben.
Der zweite Aspekt, die habitualisierte Nutzung, knüpft hier unmittelbar an. Die Verwobenheit des Mediums mit alltäglichen Strukturen, Rhythmen und Vorlieben basiert zentral auf routinehaften Mustern und sich regelmäßig wiederholenden Abläufen. Definitorisch sind hierbei innovative Elemente im Nachteil, da sie sich gegenüber etablierten Strukturen quasi-evolutionär durchsetzen müssen. So gilt auch für das Internet, dass es als sehr junge Medientechnologie nicht allein aufgrund seiner Technizität als unbändiges Hypermedium gelten kann, sondern an vielen Stellen neben (oder auch: hinter) bewährten Medien steht. Für die Erforschung der Eigenschaften des Internets verweisen die habitualisierten Nutzungsweisen in Bezug auf Medien auf eine tatsächliche Gestaltungsoffenheit. Wie Individuen Medien im Detail nutzen, inwiefern diese in den Alltag integriert werden oder auf bestimmte Lebensbereiche beschränkt bleiben, resultiert einzig aus dem Verhalten der Mediennutzerinnen und -nutzer. Speziell das Internet weist aufgrund seiner Neuartigkeit in historischer wie in technischer Hinsicht hier hohe Handlungsspielräume aus. Dementsprechend bleibt es nicht nur in seinen Funktionen, sondern auch in der individuellen Rezeption dieser offen. Erste Untersuchungen zu dem Thema zeigen in Kontrast zum klassischen Radio vorrangig komplementäre Einbettungen in Alltagspraxen. So weist der Webradiomonitor (vgl. Goldhammer/Schmid/Link 2010:10) für 2010 beispielsweise aus, dass UKW-Sender hauptsächlich morgens, Webradios hingegen hauptsächlich abends konsumiert werden.
Ein letzter relevanter Aspekt besteht in der Orts- und Millieugebundenheit von Informationen. Radiosender orientieren sich im Sinne einer Spezialisierung am lokalen Geschehen. Daraus resultieren zwei direkte Anschlussfragen: Wie steht es im Internet um die Konkurrenz zwischen Informationsangeboten gleicher, aber auch verschiedener Typen und inwiefern sind lokalspezifische Information zu finden? Der zweite Aspekt ist gerade hinsichtlich der festgestellten raumzeitlichen Entbettung von Kommunikation interessant. Gibt es so etwas wie realweltliche Raumkomponenten im virtuellen Internet oder ist (geographische) Nähe zu einer antiquierten Variable verkommen? Doch zunächst zur ersten Frage: Im Unterschied zu Offline-Medien werden für Online-Formate keine entsprechenden quotenbasierten Gelder ausgeschüttet. Werbeeinnahmen stellen stattdessen den primären Modus der Finanzakquise dar. Abgesehen von einer nicht zu vernachlässigenden Zahl an tatsächlich explizit antikommerziellen Web-Radios, bündelt sich die Konkurrenz in den Klick-Raten auf beigeschaltete Werbe-Banner und Ähnliches. Damit ist zwischen einer reinen Reputationslogik und einer direkten Verquickung von Aufmerksamkeit mit Werbeeinnahmen zu unterscheiden. Interessanterweise stehen sich die einzelnen Sender, aber auch Web-Formate insgesamt auf einem nahezu idealtypischen Markt gegenüber. Es gibt nur geringe rechtliche Restriktionen, kollektive Interessensvertretungen und -verbände sind genau wie Konsortien und Absprachen nicht vorfindlich.22 Die Gründe hierfür liegen unter anderem in der räumlichen Entgrenzung sowie der historischen Neuheit des Marktes. Gepaart mit wiederum nur sehr moderaten Werbemöglichkeiten der Sender (im Sinne von Eigenwerbung) hängt der Erfolg zentral von der Qualität des Programms ab.
Bezogen auf die Frage regionalspezifischer Informationen allerdings unterscheiden sich Webradios stark von herkömmlichen Formaten. Während Letztere (häufig unterstützt von zentral gesteuerten Programmen) sich gerade nicht über die Musik profilieren, tritt im Web das Gegenteil ein. Klassische Radiosender versuchen im Sinne eines Begleitprogrammes, möglichst unauffällige und dem Geschmack der Masse entsprechende Musik zu senden. Die Sender grenzen sich nicht gegeneinander ab, sondern wollen eine große »Durchhörbarkeit« erreichen. Die Abgrenzung erfolgt stärker über bestimmte Inhalte, die nicht selten regionalspezifisch sind. Unter anderem aufgrund divergenter finanzieller Strukturen sind Internetradios zumeist mit sehr kleinen oder gar keinen Redaktionen ausgestattet. Dementsprechend fällt es schwer, Inhalte zu recherchieren und zu kommunizieren. Dagegen wird und muss verstärkt Wert auf die Auswahl der Musik gelegt werden: Es sind vorrangig Sender zu finden, die sich über verschiedene Musikrichtungen und -stile definieren und nicht über lokale Bezüge. In Anbetracht der einerseits großen Anzahl von Offline-Radios, die ihr Angebot auch im Netz bereitstellen und der andererseits verhältnismäßig kleinen (und überdies bisher unrentablen) Zuhörerschaft über das WWW wäre der Erfolg eines lokal orientierten Webradios unwahrscheinlich. Es besteht in mehrerer Hinsicht ein Passungs- beziehungsweise Komplementärverhältnis zwischen On- und Offlineradios.
Der zweite Teilaspekt der Frage – nach der Widerspiegelung von Offline-Raumbezügen im WWW – hat die Analyse der Kongruenz von Off- und Online-Gemeinschaften im weitesten Sinne zum Ziel. Die Antwort hängt zunächst davon ab, in welchem Maßstab lokale Gemeinschaften definiert werden. Geht man von sprachlich gebundenen Communitys aus, ist festzustellen, dass Kommunikationsteilnehmerinnen und -teilnehmer signifikant häufiger Webangebote besuchen, die in der jeweiligen Muttersprache angeboten werden (vgl. Halavais 2000: 7ff.). Die einzig bedeutsame Ausnahme bildet Englisch als Lingua franca des Internets. Hier sind dann sehr wohl Interaktionen über gesellschaftliche Grenzen des Offline-Bereichs hinweg festzustellen. Allerdings trifft dies nur auf einen sehr kleinen Teil zu. Zudem soll es um lokale Gemeinschaften gehen: Grundlegend ist festzustellen, dass ortsgebundene Informationen auch im Internet einen hohen Stellenwert haben: Die Lokalpresse hat eine in der Regel ausführliche Homepage, Stadtteilakteure betreiben Webangebote, ganze Regionen werben gezielt um Touristen, eBays riesiger Kleinanzeigenmarkt ist primär an Postleitzahlen orientiert, das soziale Netzwerk Lokalisten.de hat knapp vier Millionen Mitglieder und Suchmaschinen sind nicht nur landesspezifisch konfigurierbar, sondern auch für kleinere geographische Einheiten (wie us-amerikanische Bundesstaaten) verfügbar. Es gibt also – wenig überraschend – deutliche Hinweise auf realweltliche Ortsbezüge verschiedener Internetdienste. Trotz aller Entbettungstendenzen aus räumlichen Zusammenhängen bleiben damit bestehende Kontexte bedeutsam. Die Gründe, warum sich dies beim Webradio nicht gebührlich widerspiegelt, wurden bereits erläutert. Abstrahiert von dem konkreten Gegenstand und auf die Eigenschaften des Internets gemünzt deutet dies allerdings auf eine Erweiterung bestehender Möglichkeiten, nicht auf deren Subsumtion hin. Eigenschaften und Strukturen der Offline-Lebenswelt bleiben demnach auch im Web hochgradig relevant.
Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, wie Recht, Geld, Wahrheit, Liebe oder Kunst, stellen eine sehr spezielle Art von Medien dar. Für die mit dieser Arbeit eingenommene kommunikationstheoretische Perspektive steht im Vordergrund, dass die Mediengruppe im Stande ist, unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlicher zu machen: Kann eine Aussage auf Basis wissenschaftlicher Methoden validiert werden (Medium Wahrheit), wird sie vom Gegenüber mit größerer Wahrscheinlichkeit geteilt als eine unfundierte Behauptung. Ebenso wird man einer Vollstreckungsbeamtin (Medium Macht) oder einem zahlenden Autohändler (Medium Geld) einen Wagen eher überlassen als einem gehfaulen Passanten. Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien sind unter anderem funktional notwendig geworden, weil Kommunikationsverhältnisse aus raumzeitlich gebundenen Strukturen durch Verbreitungsmedien herausgelöst wurden. Die Verbreitungsmedien ermöglichen es zwar, auch an nicht anwesende Menschen Informationen zu adressieren – aber warum sollten diese die Kommunikation annehmen? Das Problem findet sich verstärkt im Internet, da hier sehr viele Informationen »kursieren« und Akteure sich oftmals anonym gegenüber stehen. Es besteht dementsprechend ein erhöhter Bedarf an solchen Erfolgsmedien. Fraglich ist allerdings, ob die ohnehin bereits symbolisch abstrahierten Medien durch das Internet virtualisiert werden können ohne in ihrer Funktionalität beeinträchtigt zu werden.23
Bevor dieser Aspekt genauer betrachtet werden kann, gilt es, die Gruppe der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien kurz vorzustellen. Nach Luhmann, auf den hier zentral Bezug genommen werden soll, sind diese Medien trotz ihrer scheinbaren Unterschiedlichkeit von weitestgehend gleicher Struktur und vor allem Funktion (vgl. Luhmann 1998: 332). Sie können demnach als Gruppe betrachtet werden. Neben den bereits genannten fünf, die Luhmann als besonders bedeutsam umschreibt, resultieren aus seiner Konzeption der gesellschaftlichen Funktionssysteme weitere symbolisch generalisierte Medien wie etwa Moral (Ethik), Information (Massenmedien), Macht (Politik) oder Glaube (Religion). Die symbolisch generalisierten Medien verbinden mehrere Eigenschaften, die kurz erläutert werden sollen: So benötigen sie jeweils einen einheitlichen Code, der aus mindestens zwei Werten besteht. Dabei handelt es sich um Präferenzcodes, weil der positive Wert bevorzugt wird (wahr versus unwahr für das Funktionssystem der Wissenschaft beispielsweise). Weitere Beispiele sind: reich/arm, mächtig/unmächtig oder schön/hässlich. Ein zweites Merkmal stellt die prozessuale Reflexivität symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien dar: Sie können jeweils auf sich selbst angewendet werden. So gibt es beispielsweise Forschung über Forschung und wahre Aussagen über Wahrheit. Ebenso kann man mit Geld Geld beschaffen und wirkliche Liebe erfordert das Lieben des Liebens. Interessant ist dabei, dass Resultate eines Medienbereichs nur durch Operationen desselben Mediums geändert werden können. Wahrheiten können nicht durch Geld außer Kraft gesetzt werden, sondern nur durch neue Forschung (vgl. Luhmann 1998: 359ff.).
Ein weiteres wichtiges Merkmal besteht in der Eigenschaft, Beobachtungen zweiter Ordnung, also Beobachtungen von Beobachtungen zu ermöglichen. Preise bieten beispielsweise die Möglichkeit, zu beobachten, wie andere den Markt beobachten. Zudem ist jedes Funktionssystem nicht nur durch ein Medium mit einem (binären) Code gekennzeichnet, sondern auch durch spezielle Programme. Sie geben an, welche Kommunikationen überhaupt dem Medium zuzuordnen sind und an welche Kriterien der positive Wert gebunden ist. In der Wissenschaft bilden Theorien und Methoden solche Programme, im Rechtssystem sind es Gesetze und Gerichtsentscheidungen. Während die Codierung invariant ist, können sich Gesetze oder auch wirtschaftliche Investitionsprogramme ändern. Trotz des systemtheoretischen Ansatzes ist für Luhmann klar, dass symbolisch generalisierte Medien immer von handelnden Individuen abhängig sind.
Weiterhin sind symbolisch generalisierte Medien einer eigentümlichen Gefahr unterworfen. In ihrer Funktion, die Annahmewahrscheinlichkeit von Kommunikation zu erhöhen, können sie entweder zu viel oder zu wenig genutzt werden. Dementsprechend entsteht Inflation oder Deflation. Zur Inflation kommt es, wenn ein Medium weniger Vertrauen erzeugen kann, als es voraussetzt (etwa in Bezug auf den perspektivischen Wert von Geld). Zur Deflation kommt es im umgekehrten Fall, also wenn Möglichkeiten zur Vertrauensgewinnung nicht genutzt werden. Das trifft für Kunst zu, wenn durch Modestile oder Gallerientrends Werke bestimmter Künstlerinnen oder Künstler unterschätzt werden.
Bei symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien handelt es sich um eine im Vergleich zu Verbreitungsmedien grundlegend anders strukturierte Medienart. Dementsprechend kann auch nicht auf die Kriteriumstabelle zurückgegriffen werden. Vielmehr werden die eben vorgestellten Charakteristika auf ihre Gültigkeit und Aussagekraft in Anbetracht der zusätzlichen Mediatisierung durch das Internet untersucht. Eine systematische Analyse symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien in Zusammenhang mit dem Internet hat bisher noch nicht stattgefunden. Relevante Teildisziplinen, wie beispielsweise die Medienökonomie des Internets, kommen über die bloße Beschreibung von Veränderungen (in diesem Fall die Erweiterung des Münz-, Papier- und Giralgeldes durch sogenanntes elektronisches Geld) nicht hinaus (vgl. Hofer 2000: 113ff.). Ferner lesen sich Abhandlungen, die vor der Jahrtausendwende entstanden, als ginge es um ein anderes Internet. Vitt (1997: 236ff.) zeigt trotz einer zukunftsgewandten Diskussion zum Cybergeld unfreiwillig, dass die reale Entwicklung des Internets um ein Vielfaches weitreichender als die wissenschaftliche Antizipation ist. Der Annahme, dass etwa Cybercash-Anwendungen auf dem Internet in absehbarer Zeit eng begrenzt bleiben werden, stehen inzwischen unzählige Micropayment-Dienste, das Handypayment (Near Field Communication), die digitalen Bitcoins und rapide wachsende E-Commerce-Märkte entgegen. Bei Thiedeke (vgl. 2004b: 283ff. und 2004c: 311ff.) hingegen lassen sich einige interessante Ansätze zu Geld und Eigentum im Internet als symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien finden. Wie die bisherige Analyse zeigt, geht auch Thiedeke (vgl. 2004b: 284ff.) davon aus, dass die Digitalität des Codes und damit des Internets insgesamt zentrale Bedeutung für gebräuchliche Konzepte wie Original, Kopie, Anzahl und damit automatisch auch für Besitz und Eigentum hat.
Eigentum wird im Internet fluide und in seiner Exklusivität beschränkt. Verschiedene öffentlichkeitswirksame Beispiele aus der Musikindustrie haben dies eindrucksvoll belegt. Den Ausgangspunkt dieser Entwicklung bildet die Digitalisierbarkeit bestimmter Güter und Produkte. Nach Thiedeke (vgl. 2004c: 311ff.) verliere solches digitales Eigentum an Attraktivität, da der Besitz inflationär werde. So ist zwar die Anwendungs- (Gebrauchswert-) Funktion, nicht aber die Signal- und Strukturierungsfunktion gewahrt. Immaterielle Ressourcen sind nun einmal schwer, dingfest zu machen. Damit Eigentum (und damit auch Geld) seiner Funktion als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium im Web nachkommen kann, muss es reaktualisiert werden. Die mit der Virtualisierung einhergehenden Veränderungen müssen kompensiert und die Eigentumsgrenzen müssen wieder verhärtet werden. Ein solches Vorgehen ist grundlegend problematisch, da es nichts weniger verlangte, als eine permanente Überwachung der Daten. Besser möglich ist dies hingegen in irgendwie abgeschlossenen Gemeinschaften. Ein reglementierter Zugang (zumeist durch ein verifiziertes Log-in) in Kombination mit freiwilliger Partizipation kann die benötigte Ressourcenknappheit umsetzen. Kauft man in Apples App Store ein Programm für das iPhone, so funktioniert dies nur deshalb, weil man sich zuvor einloggen muss, Bankdaten hinterlegt und verifiziert sind und die gekaufte Ware durch ein umfassendes Rechtemanagement nur auf dem eigenen Gerät zu benutzen ist und damit nicht weiterverbreitet werden kann.24
Neben dem Medium Geld finden sich in Diskussionen häufig Bezugnahmen auf Recht und Wahrheit. Auf diese beiden symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien soll im Folgenden kurz eingegangen werden. Anschließend werden die symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien in Gänze einer wiederum kontrastierenden Analyse unterzogen. Der vielmals ausgesprochenen Forderung, das Internet dürfe kein rechtsfreier Raum sein, liegt die Beobachtung zugrunde, dass Kommunikation über das Internet anscheinend anonym möglich ist und darüber hinaus staatlich gebundene Rechtsgrenzen gänzlich hinfällig werden. Letzteres stellt in der Tat eine zentrale Herausforderung für die Exekutivorgane einer politischen Einheit, aber auch deren gesetzgebenden Apparat dar. Nichtsdestotrotz gelten für die Internetnutzung alle allgemein verbindlichen Rechtsnormen und darüber hinaus gegenstandsspezifische Gesetze. Diese umfassen verschiedene Bereiche wie Medien-, Urheber-, Zivil-, Straf- oder Datenschutzrecht. Es ist demnach nicht von einem grundsätzlich unternormierten Raum auszugehen, wenngleich sich aufgrund der spezifischen technischen Eigenschaften der Internetkommunikation einzelne Regelungen nur unzureichend umsetzen lassen. Einige rechtliche Besonderheiten sollten aus diesem Grund ausgeführt werden. Exemplarisch wird das anhand der beiden bereits genannten Kristallisationspunkte geschehen: der Frage nach der Vervielfältigbarkeit und der Entbettung aus geographischen Zusammenhängen (vgl. Kröger 2003: 210).
Gleich der Betrachtung zur Virtualisierung des Geldes haben Aspekte des Eigentums auch für eine juristische Analyse des Internets große Bedeutung. Maßgeblich hierfür sind kategorische Unterschiede zwischen materiellen und immateriellen Gütern. Diese zumeist in Zusammenhang mit Open Source-Software diskutierten Unterschiede betreffen im Grunde alle über das Internet verbreiteten Inhalte. Urheberrechtsdiskussionen über Ideen, Bilder, Texte oder Musik gibt es zwar nicht erst in der jüngeren Vergangenheit (man denke an die Kampagnen gegen Radiomitschnitte im Zeitalter der Kassettenrekorder), das Internet allerdings stellt sowohl Platz für entsprechende Informationen als auch diffizile Verbreitungskanäle in massivem Ausmaß bereit. Von einem marginalen Problem kann aus diesen Gründen nicht mehr gesprochen werden.
Sowohl bei materiellen als auch bei immateriellen Gütern spielt das Eigentumskonzept eine wichtige Rolle. Grundsätzlich beschreibt Eigentum das Verhältnis zwischen Menschen bezüglich einer Sache, nicht aber Eigenschaften der Sache selbst (vgl. Heller/Nuss 2003: 397ff.). Relevant ist zudem die Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Während ersteres auf die Nutzungs- und Verwertungsrechte einer Sache hinweist, meint Besitz das tatsächliche Innehaben einer Sache (vgl. Ziebell 2005: 274). Wer sich also ein Auto mietet, besitzt dieses temporär, ist jedoch nicht die Eigentümerin oder der Eigentümer. Anhand dieser wenigen Kategorien lassen sich bereits systematische Unterschiede zwischen materiellen und immateriellen Gütern herausarbeiten. Kauft man ein immaterielles Gut, beispielsweise eine Software oder einen Film, gelangt man zwar in Besitz einer Kopie, man wird aber nicht Eigentümerin beziehungsweise Eigentümer der Software oder des Filmes. Aus diesem Grund dürfen auch keine weiteren Kopien in Umlauf gebracht werden. Darüber hinaus ist nicht eindeutig geregelt, wann überhaupt von einer Kopie gesprochen werden kann. So ist es beispielsweise möglich, Videos bestimmter Plattformen in andere Homepages einzubetten. Allerdings werden die eigentlichen Daten von der Ursprungsseite nur gestreamt (echtzeitlich übermittelt), jedoch nicht kopiert im eigentlichen Sinne.
Immaterielle, also nicht fassbare Güter, wie Ideen, Theorien und sonstige Werke des Geistes sind im Vergleich zum allgemeinen Eigentumsrecht erst in jüngerer Vergangenheit umfassend juristisch geregelt worden. Zudem existieren bis heute kulturelle Unterschiede, vergleicht man etwa das europäische Urheberrecht mit dem amerikanischen Copyright (vgl. Grassmuck 2004: 59). Materielle Güter, denen grundlegend eine (wenn auch konstruierte) Knappheit unterstellt werden kann, werden in der Regel verbraucht oder zumindest abgenutzt. Dies ist bei immateriellen Gütern nicht der Fall. Gebrauchsspuren betreffen höchstens das Trägermedium, also ein Buch oder eine CD, nicht aber den Inhalt selbst. Die Emergenz digitaler Medien und vor allem der Internetmedien trägt zu einer Verschärfung bei: Es fehlt nicht nur die Abnutzung, Kopie und Original sind auch noch von gleicher Qualität und nicht mehr unterscheidbar. Es wurde inzwischen versucht, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. So erfuhr das Urheberrecht eine Novellierung, unter anderem um unrechtmäßige Downloads von geistigem Eigentum zu kriminalisieren und ein Digital Rights Management zu institutionalisieren. Aktivistinnen und Aktivisten der Open Source-Szene hingegen haben über die Zeit, Mittel und Wege gefunden, einen dritten Weg zu beschreiten. Vor allem die Creative Commons-Lizenzen ermöglichen es, Inhalte jenseits des Copyrights und der Illegalität bereit zu stellen (vgl. Schimmang 2007).
Neben den angesprochenen rechtlichen Spezifika in der Sachdimension stellt die Transnationalität internetvermittelter Kommunikation eine zweite Herausforderung für die juristische Handhabe dar. So greifen in vielen Fällen die territorialen Grenzen nationalstaatlich geprägter Gesetzgebung nicht. Im Grunde sind hierfür zwei Faktoren verantwortlich: Zum einen kann ein Web-Angebot von jedem beliebigen Ort der Welt abgerufen werden und zum anderen kann der entsprechende Server in einem beliebigen Land platziert werden, das nicht dem der Urheberin oder des Urhebers der Daten entsprechen muss. Ein solches Vorgehen wird besonders dann praktiziert, wenn es sich um heikle (oft illegale) Inhalte handelt und das Land, in dem der Server steht, erfahrungsgemäß keine Gerichtsbarkeit anstrengt. Es ist demnach evident, dass für die einzelnen Rechtsbereiche entschieden werden muss, welches Recht gilt. Kann beispielsweise ein US-amerikanischer Webseitenbetreiber in Deutschland zur Verantwortung gezogen werden, wenn er Symboliken, die hierzulande einer Zensur unterliegen, zum Download anbietet? Für das Internet bleibt ein universell gültiges Recht unwahrscheinlich, da ein globales Medium auf je national unterschiedliches Recht trifft.
Wie erläutert, ist das Web aber kein rechtsfreier Raum, sondern ein Raum komplexer juristischer Regelungen. In den letzten Jahren entstanden vielmals internetspezifische Gesetze, die auf die neuen Herausforderungen reagieren. So regelt beispielsweise das internationale Zivilverfahrensrecht, in welchen Fällen ein nationales oder internationales Gericht zuständig ist und unter welchen Umständen Urteile ausländischer Gerichte im Inland anerkannt oder vollstreckt werden müssen. Eine international einheitliche und stringente Regelung ist allerdings in absehbarer Zeit nicht erwartbar (vgl. Hoeren 2010: 474ff.). Da für internetbasierte Straftaten kein eindeutiger Tatort angegeben werden kann, schließlich sind die Daten von allen Rechnern der Welt erreichbar, bleibt selbst bei klarer Rechtslage die Frage der Zuständigkeit ungeklärt. Um die Ausbreitung fliegender Gerichtsstände zu vermeiden, werden inzwischen Hilfskriterien konstruiert (etwa besondere Bezüge zum angerufenen Gericht), die uferlose Zuständigkeiten verhindern sollen. Neben dem Problem der Zuständigkeit erweist sich auch die Vollstreckung als schwierig. Jenseits Europas kann diese fast ausschließlich im Rahmen bilateraler Vollstreckungsübereinkünfte realisiert werden. Häufig existieren solche aber nicht (vgl. Hoeren 2010: 485ff.). Alternativen Lösungen, wie etwa Schlichtungsstellen, fehlt hingegen zumeist die Sanktionsmöglichkeit. Es deutet sich hier bereits an, dass Interaktionen über das Internet zwar durchaus juristisch determiniert sind, aber die praktische Umsetzung massive Probleme bereithält.
Während die symbolisch generalisierten Medien Eigentum und Macht sowie deren Zweitcodierungen Geld und Recht Medieneigenschaften im engeren Sinne aufweisen, etwa speicher- und teilbar sind, erfordert die Betrachtung des letzten hier interessierenden Mediums (Wahrheit) einen anderen Fokus. Wahrheit als das dem Wissenschaftssystem zugeordnete Medium tritt in der Regel vermittelt auf. Es bedarf einer Kommunikation und spricht nicht für sich selbst, weshalb folglich darauf geachtet werden muss, inwiefern die Kommunikationsmedien des Internets einen Einfluss auf die Funktion von Wahrheit nehmen.
Wahrheiten sind immer relative, vorläufige Wahrheiten. Sie bilden die Grundlage neuer Erkenntnisse, die dann alte obsolet werden lassen. Gefragt werden kann nun, inwiefern dieser Prozess durch ein neues Medium beeinflusst wird und ob sich die konkrete Anwendung von Wahrheiten zur Steigerung der Annahmemotivation ändert? Zunächst zum ersten Punkt: Wie Wahrheit erzeugt wird, ist innerhalb des Wissenschaftssystems durch bestimmte (veränderliche) Programme festgelegt. In Realität entspricht dies verschiedenen Forschungsstrategien, Methoden oder Instrumenten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelten zurecht als Early Adopters (vgl. Schenk 2007: 419) des Internets und nutzen es bis heute in überdurchschnittlichem Umfang. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Ein schneller und direkter wissenschaftlicher Austausch befördert Innovation und Erkenntnis. Die Open Innovation-Maxime (vgl. Schumpeter 1950) liegt den meisten Disziplinen zugrunde. Das Web stellt in diesem Sinne vor allem ein leistungsfähiges Austauschmedium dar. Forschungseinrichtungen, die an gleichen oder zumindest ähnlichen Themen arbeiten, können über räumliche Grenzen hinweg kommunizieren und Daten transferieren. Das Internet bewirkt eine Leistungssteigerung des Wissenschaftssystems, indem durch Kollaboration (oder offene Konkurrenz) Aussagen mit höherem Wahrheitsgehalt getroffen werden können.
Der zweite Aspekt hingegen stellt sich differenzierter dar; zwei unterschiedliche Entwicklungen zeichnen sich ab: In Bezug auf die Öffentlichkeit besteht die optimistische Annahme, dass der Informationsfluss verbessert und die Möglichkeiten der Einflussnahme vergrößert werden. Problematisch hingegen, dass bisher keine allgemeingültigen Standards für relevante Aussagen im Internet erarbeitet werden konnten. Beide Pole dieser Diskussion lassen sich gut am Wikipedia-Projekt nachvollziehen. Die positiv besetzte Lesart zielt im Kern darauf ab, dass ein zunehmend größerer Teil der Bevölkerung Zugang zu bisher vor allem von Expertinnen und Experten reglementiertem Wissen habe. So ist es Laien beispielsweise einfacher möglich, jenseits von Universitätskliniken neueste Erkenntnisse zur Krebstherapie oder außerhalb von Forschungslaboren Informationen über toxische Belastungen von Lebensmitteln zu gewinnen. Wurden lange Zeit wissenschaftliche Erkenntnisse vorwiegend in Büchern oder in einschlägigen Fachzeitschriften veröffentlicht sowie auf Tagungen oder in bestimmten Institutionen verbreitet, geschieht dies heutzutage auch über das Internet. Nahezu alle Forschungseinrichtungen und Universitäten stellen relevante Informationen auf ihre Webseiten.
Innovativ ist vor allem der erleichterte Zugang und die verbesserte Auffindbarkeit von Daten durch Suchmaschinen und ähnliche Werkzeuge. Zudem engagieren sich viele Nutzerinnen und Nutzer für die Verbreitung dieser Informationen, indem in Blogs oder auf eigenen Webpages Zusammenfassungen geliefert, Übersetzungen erarbeitet oder schlicht Kopien gepostet werden. Vorrangig über diese Dienste wird noch ein zweiter, der Wissenschaft zuträglicher Mechanismus geschaffen: Entsprechende Anwendungen stellen nicht nur Verbreitungsmedien dar, sondern bieten auch eine Plattform für Kritik. Ohne Peer-Review oder wissenschaftliches Mandat kann jeder User eine Replik oder auch nur einen Kommentar zu bestehenden Thesen oder Theorien publizieren. Inwiefern diese rezipiert und gegebenenfalls integriert werden, bleibt empirisch zu erforschen. Eine zunehmende Verknüpfung zwischen den Akteuren des Wissenschaftssystems und der öffentlichen Sphäre scheint jedoch für beiden Seiten Potenziale zu bieten. Angesichts einer weiterhin bestehenden Tendenz zur Informationsgesellschaft werden sich die Arenen der Wahrheitsdiskussion ohnehin ausweiten. Das Internet stellt hierbei ein moderates Versuchsfeld dar.
Informationen »im« Internet unterliegen aber vielmals keiner Validitätsprüfung. Aussagen des Wissenschaftssystems, die in wahr und unwahr codiert sind, sind vor allem wirksam, weil ihrer Gültigkeit vertraut werden kann. Das Vertrauen wiederum ist zurückzuführen auf bestehendes Erfahrungswissen, objektiv nachvollziehbare Methoden der Wahrheitsgenerierung und der fortwährenden Evaluierung der beteiligten Institutionen. Damit können Aussagen im Internet in der Regel nicht dienen. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn eine Kardiologin oder ein Kardiologe regelmäßigen Sport als Prävention vor Herzinfarkten empfiehlt, basiert die Maßnahme in aller Regel auf vorherigen Studien, fachlichen Diskussionen oder objektiviertem Erfahrungswissen. Wenn allerdings in einem Gesundheitsportal im Internet zur selben Problematik Laien raten, vorbeugend einen Ingwertee pro Tag zu trinken, sind die Grundlagen des Wirkungszusammenhangs nicht bekannt. Diesem zugegeben konstruierten Beispiel stehen reale Fälle entgegen. 2009 fügte ein Blogger (in nicht böswilliger Absicht) dem Wikipedia-Artikel des frisch gebackenen Wirtschaftsministers zu Guttenberg einen elften Vornamen hinzu, der sich weitestgehend unbemerkt in zahlreichen Presseorganen wiederfand. Verschiedene Manipulationsversuche der Online-Enzyklopädie seitens republikanischer Politiker in den USA zeigen die Brisanz solcher Internetinformationen. Eine gegenstandsspezifische Einschätzung ist dementsprechend unausweichlich. So hängt die Akzeptanz von regulär durch Expertensysteme legitimierten Informationen im Internet auch zentral von deren Folgenhaftigkeit ab. Internethinweisen zum verbrauchsoptimierenden Fahren von Personen mit einem Ingenieurstitel wird eher nachgekommen als solchen zur DIY-Umrüstung des Motors auf Hybridantrieb.
Auf Grundlage der oben stehenden Einführungen zu drei symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien kann nachfolgend auf die vorgestellten generellen Eigenschaften dieser Mediengruppe zurückgegriffen werden. Die markanteste Eigenschaft bildet die Operation mit einem einheitlichen, binären Code. Was geschieht nun mit der Unterscheidung wahr/unwahr, rechtmäßig/unrechtmäßig oder informativ/nicht informativ im Rahmen der Internetkommunikation? Zunächst ist eine quantitative Ausweitung des Einzugs- und damit auch des Geltungsbereichs feststellbar. Für Internetkommunikation ist demnach ebenfalls zu fragen, ob eine Mitteilung Neuigkeitswert besitzt oder nicht, ob ein Verkauf über das Internet rechtmäßig ist oder nicht und so fort. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass es bisher keine Organisationen gibt, die allgemeingültige Kriterien (in Form von Programmen) für den entteritorialisierten Bereich formulieren. Am Beispiel des Rechts wurden solche Aspekte in Ansätzen sichtbar. Das Problem besteht weiter in der Frage, für welche Kommunikation welcher Wert festzulegen ist und nicht in einer grundlegenden Nichtanwendbarkeit. Darüber hinaus besteht aber für die Nutzung der binären Codes eine viel interessantere Frage. Sie zielt gewissermaßen auf das Einsatzgebiet der einzelnen Codes ab.
In den jeweiligen Programmen ist festgelegt, welche Kommunikationen überhaupt auf den Code bezogen werden können. Zwar ist es grundsätzlich möglich, einen bestimmten Verkaufsakt neben den juristischen Aspekten des Besitzwechsels und der wirtschaftlichen Folge des Geldflusses auch als moralisch negativ einzuschätzen, insofern es sich etwa um Massenvernichtungswaffen handelt, aber nicht jeder Code kann auf diese Kommunikation bezogen werden. Demnach halten die Programme des Funktionssystems Kunst (beispielsweise Stilrichtungen), des Erziehungs- und Gesundheitssystems nur bedingt aussagekräftige Kriterien zur Einschätzung bereit und sind damit nicht »zuständig«. Die These ist nun, dass solche Geltungsbereiche durch das Internet aufgeweicht und damit unscharf werden. Für die Akteure der verschiedenen Subsysteme ist nicht mehr in der bekannten Sicherheit zu entscheiden, ob eine Kommunikation vorrangig dem einen oder anderen Code zuzuordnen ist. Im Internet finden sich hierfür diverse neuartige Phänomene, die dies verdeutlichen. So bieten Crowdsourcing-Plattformen (vgl. Papsdorf 2009: 11ff.) gleichermaßen die Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren und Geld respektive Eigentum zu transferieren.
Natürlich gab es in der Zeit vor dem Internet bereits ähnliche Verquickungen, man denke an privatwirtschaftliche Forschungsinstitute, aber jene sind weitaus eindeutiger zu verorten. Sie sind in der Regel einem abgrenzbaren Gegenstandsbereich, forschungsethischen Prinzipien, spezifischen Geldgebern und präzisen Zielen in der Ergebnisdimension verpflichtet. Demgemäß sind die Kommunikationsakte (etwa die Veröffentlichung eines Projektberichts) verschiedenen Funktionssystemen zuordenbar, aber eben nach bestimmten Mustern. Bei dem angesprochenen InnoCentive hingegen ist für das Einstellen einer Mitteilung nicht klar, ob dies vor einem wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder auch moralischen Hintergrund geschieht. Ähnliches gilt für Design-Plattformen im Internet. Geht es um Kunst oder Kommerz? Diese Unterscheidung ist oft nur den Betreiberinnen und Betreibern einsichtig. Gesundheitsportale sind ein weiteres Beispiel. Hier beraten sich Laien gegenseitig in Hinblick auf Diagnose und Therapie verschiedener Krankheiten. Die überwiegend distanzierte Haltung niedergelassener Ärztinnen und Ärzte zeigt, dass bei solchen Projekten nicht klar ist, ob es tatsächlich um Heilung oder vielleicht doch bloß um eine gute Geschäftsidee im Internet geht. Zu untersuchen bleibt, ob diese Hybridisierungstendenzen vorrangig auf eine zunehmende Ausbreitung wirtschaftlicher Aktivitäten zurückzuführen sind oder breiter angelegt sind.
Ein weiteres Kriterium stellt die prozessuale Reflexivität symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien, also ihre Anwendbarkeit auf sich selbst dar. Bekannte Beispiele sind die Berichterstattung über Presseorgane oder eine Klage vor dem Verfassungsgericht. Hierbei liegt es nahe, dass das Internet gewissermaßen als Reflexionsraum fungiert und damit der selbstbezüglichen Veränderung der Medien zuträglich ist. Die Voraussetzung bildet eine grundsätzliche Virtualisierbarkeit des symbolischen Mediums. Anhand der oben geführten Diskussion wurde deutlich, dass verallgemeinernde Aussagen zu symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien schwierig sind. So ist es in der Regel möglich, auch über das Internet Recht von Unrecht, Wahrheit von Unwahrheit und so weiter zu unterscheiden, jedoch zeigen sich an den Randbereichen jeweils gewisse Einschränkungen. Dies hat verschiedene Ursachen (einige wurden genannt) und führt schließlich zu einer »verminderten Universalität«. Eine solche Entwicklung wiederum ist hochgradig problematisch, da die Gesamtwirkung des Mediums unweigerlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Am Beispiel des Rechts konnte gezeigt werden, dass es zwar keine rechtsfreien Räume gibt, dass es aber auf Internetkommunikation nicht konsequent angewendet werden kann. Solche kleinen Lücken in der Gültigkeit haben nun den Effekt, große Löcher zu verursachen.
Napster, einer der frühen Peer-to-Peer-Dienste zum Austausch von Musik, ebnete den Weg für so etwas wie eine Kultur des Downloads. Obwohl das Netzwerk nach einem rasanten Wachstum ebenso schnell geschlossen werden musste, entfaltete es eine nachhaltige Wirkung. Die vielen Millionen User machten nämlich die Erfahrung, dass Musik über das Netz schnell, effizient und nahezu strafverfolgungsfrei geteilt werden kann. Dementsprechend wuchs die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer sowie der illegal geteilten Inhalte (Musik, Filme und proprietäre Software) auf ein Niveau an, das klassische Ladendiebstähle und Raubkopien als Marginalprobleme erscheinen ließ. Dies geht inzwischen so weit, dass eine ganze Industrie entstanden ist, die als Dienstleistung sichere und schnelle Server zum Up- beziehungsweise Download bereitstellt und User wiederum für den Download urheberrechtlich geschützter Inhalte Verträge schließen und Geld zahlen.
Der Aspekt der Generalisierung ist demnach das problematische Element. Hierfür hat sich inzwischen eine richtungsweisende Lösungsstrategie herausgestellt: Segmentierung. Diese dem Internet in seiner Grundintention gänzlich widersprüchliche und darüber hinaus gesellschaftstheoretisch nicht sehr innovative Strategie stellt ein tragfähiges Instrument dar. Durch Communitys (vgl. Schneider 2003: 95ff.), Plattformen, Portale, virtuelle Gemeinschaften oder begrenzte Marktplätze wird die Möglichkeit geschaffen, symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien ohne Einschränkungen umzusetzen. Will man Videos bei YouTube hochladen, muss vorab den allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt werden, will man auf eBay per PayPal einkaufen, muss ein verifiziertes Konto angegeben sein und einen Artikel auf www.medizin-aspekte.de kann nur veröffentlichen, wer nach wissenschaftlichen Standards forscht. Der praktizierte Ausweg liegt demnach in der Schaffung kleiner Inseln, deren Kommunikation in irgendeiner Art kontrollierbar und damit auch sanktionierbar ist. Typischerweise wird dies durch eine Authentifizierung der User garantiert, was Anonymität nur noch partiell ermöglicht. Die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien sind im Umkehrschluss nur funktional, wenn User identifizierbar werden. Das Internet kann bestimmte Leistungen nur dann bieten, wenn es in seiner Offenheit eingeschränkt wird. Unter diesen Voraussetzungen wird sowohl die Reflexivität als auch die Beobachtung zweiter Ordnung durch das Internet umgesetzt oder gar bereichert.
Während die Rolle der Organisationen hier nicht näher spezifiziert werden muss, da im Zuge der Diskussion der Programme bereits die Beschränktheit der Einflussnahme offenkundig wurde, ist ein anderes Charakteristikum hingegen von Bedeutung. Es handelt sich um die Quantität der Nutzung, die schließlich in Deflation oder Inflation des Mediums münden kann. Die auf Parsons (1980: 211f.) rückführbare Generalisierung der zunächst nur für Geld üblichen Unterscheidung verlangt ein Maß des zu geringen oder zu starken Gebrauchs. Luhmann (1998: 383) schlägt dazu vor, nicht die Deckung des Medium durch Realien (also von Geld durch Edelmetalle und Ähnliches), sondern das Vertrauen in die zukünftige Verwendung als Kriterium zu nutzen. Dies scheint plausibel, bedenkt man wie sich Aktienkurse binnen weniger Minuten aufgrund von mehr oder weniger bedeutenden Entscheidungen verändern können. Kulminiert etwa das Misstrauen hinsichtlich verschiedener Immobilienfonds wie 2009, droht die Instabilität des Geldsystems. Anstrebenswert im Sinne maximaler Funktionalität ist hingegen die Vermeidung von Deflation und Inflation, was aber als unrealistisches Projekt gelten kann. Wie bisher zu sehen war, gibt es durchaus Ansatzpunkte für eine Virtualisierung symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien. Wie wirkt sich dieser Prozess nun auf deren Stabilität aus?
Die öffentliche Diskussion sowie die Erfahrungen des E-Commerce zeigen, dass vor allem dann über das Internet gekauft wird, wenn Preisvorteile erzielt werden können. Anderen begünstigenden Faktoren, wie den unbeschränkten Öffnungszeiten oder der großen Auswahl, stehen nicht unerhebliche Einschränkungen wie die komplexere Abwicklung, fehlende Beratung, absente haptische Eindrücke oder unklare Garantiemodalitäten entgegen. Stellt sich ein erworbenes Produkt als fehlfunktional heraus oder ist von minderer Qualität, gibt es nicht immer einen direkten Ansprechpartner oder eine -partnerin und einen zufriedenstellenden Service. Um auch in Anbetracht des Risikos, Opfer eines Internetbetrugs zu werden, einen Kauf zu tätigen, muss schließlich das Preis-Leistungsverhältnis ein besonders gutes sein. Für den internetvermittelten Handel ist demnach ein Vertrauensdefizit zu vermuten. Die Nutzung von Geld erfordert mehr Vertrauen, als sie erzeugen kann, da durchaus Enttäuschungen erwartet werden. Dementsprechend wäre eine Inflation festzustellen. Die Reaktion auf eine Inflation durch Überziehen des Vertrauenspotenzials einer Kommunikation besteht in der Entwertung der Symbole und im spezifischen Fall in der Preissteigerung. Interessanterweise ist nun aber für das Internet das Gegenteil festzustellen, indem aufgrund des Vertrauensverlustes identischen Waren oder Dienstleistungen kleinere Geldmengen gegenüber stehen. Dies entspricht einer graduellen Deflation. Es handelt sich dabei nicht um einen Widerspruch. Vielmehr ist das in der Regel attraktivere Preis-Leistungs-Verhältnis gerade die (vorauseilende) ökonomische Antwort auf den Vertrauensverlust durch die anonyme und neue Interaktionssituation.
Dieses im Vergleich zu Face-to-Face-Interaktionen fehlende Vertrauen stellt ein generelles Problem mediatisierter Kommunikation dar und soll durch die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien gelöst werden. Für einen Brief mit der Aufforderung, einen beträchtlichen Teil des Ersparten in einen bestimmten Fond zu investieren, ist eine wesentliche geringere Akzeptanz zu erwarten als für eine persönliche Empfehlung des Finanzberaters oder der -beraterin der Hausbank. Im Unterschied zu klassischen Verbreitungsmedien fällt die fehlende Vertrauensdeckung in Bezug auf die gesamte Interaktion stärker ins Gewicht, da dem Internet auch Eigenschaften direkter Interaktion zugeschrieben werden müssen. Problematisch ist nun, dass symbolische Kommunikationsmedien nicht mehr per se die Annahmewahrscheinlichkeit von Kommunikationen erhöhen, sondern ihre Funktionalität wiederum gesichert werden muss. Einfache, aber nur bedingt leistungsfähige Varianten stellen die zugangsbeschränkten Communitys oder die Etablierung eines übergeordneten Reputation-Codes, der auf Peer-to-Peer-Evaluation basiert, dar.
Fraglich ist dennoch, ob dieser Befund verallgemeinerbar ist oder primär auf das Medium Geld zutrifft. Für Wahrheit gilt Ähnliches, indem eine inflationäre Tendenz zu erkennen ist, da mehr Verwendungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt werden, als sich tatsächlich realisieren lassen. Diese Tatsache stellt einen zentralen Kritikpunkt der Bottom-up-Entwicklung zum Web 2.0 dar, da wesentliche Teile der Inhalte keinen Kontrollen oder Beschränkungen mehr unterliegen und damit nicht verifizierbar sind (vgl. Keen 2007). Für das Medium Macht ist im Offline-Bereich der Politik eine Dauerinflation festzustellen, da mehr Positives in Aussicht gestellt wird, als schließlich realisiert werden kann. Für das Internet sind Inflations- und Deflationstendenzen gleichzeitig denkbar. Das Angebot von www.abgeordnetenwatch.de nimmt beispielsweise Politikerinnen und Politiker in die Pflicht und kann so der Inflation entgegenwirken. Dies ist auch für Kunst vorstellbar, indem aufgrund der digital begünstigten Reproduzierbarkeit die stabilisierende Knappheit außer Kraft gesetzt wird, gleichzeitig aber durch Geschmackstrends und Moden die Werke einiger Künstlerinnen oder Künstler überbewertet werden.
Das Ergebnis der Betrachtung der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien ist ambivalent. Für die Medien an sich bleibt festzuhalten, dass sie in ihrer bisherigen Konzeption in Anbetracht des an Bedeutung gewinnenden Internets nur bedingt ihrer Funktion nachkommen können. Grundsätzlich ist eine nochmalige Mediatisierung möglich, sie muss aber durch zusätzliche Institutionen gestützt werden. Wer Träger für eine solche Entwicklung sein kann, ist bis hierher ungewiss. Für die Eigenschaften des Internets hingegen bedeutet das zunächst ein der kategorischen Offenheit gegenüberstehendes Bedürfnis nach Schließung, das in eine sektorale Differenzierung mündet.
Die vorangegangene Betrachtung des Internets im Kontrast zu Offline-Kommunikationsmöglichkeiten führt unweigerlich zu einer Fehlstelle. Sie ist blind für Innovationen, die dem Netz entspringen. So kann zwar grundsätzlich von einer offline-abhängigen Entwicklung des Internets ausgegangen werden, internetoriginäre Kommunikationsformen sollten hierdurch aber nicht ausgeschlossen werden. Aus der Vielzahl an Diensten und Anwendungen, die auf der dezentralen Infrastruktur basieren, trifft dies vor allem auf den Dateitransfer zu. Während die anderen wichtigen Dienste bereits in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu klassischen Medien erschlossen werden konnten, finden sich für solche Nutzungsformen der Datenübertragung keine aussagekräftigen Pendants.
Der Sammelbegriff der Dateiübertragung (File Transfer) trifft im Grunde auf nahezu alle Internetanwendungen zu. Denn eine Datei ist, im Sinne des Kofferworts aus Daten und Kartei, nicht viel mehr als eine strukturierte Anhäufung von digitalen Informationen, die speicherbar ist. Sie besteht, wie alles im Internet, aus Bits und Bytes und kann in Form einer Webseite, eines Bildes, Filmes oder Musikstücks in Erscheinung treten. Des Weiteren gibt es unzählig viele Dateiformate, die durch spezielle Endungen erkennbar sind und mit zugehörigen Programmen genutzt werden können. Dazu gehören beispielsweise .dmg- oder .exe-Formate. Insgesamt ist die Anzahl an Dateiformaten potenziell unendlich, was sich an fortwährenden Kreationen für verschiedene Programme zeigt. Das Ziel besteht zumeist in der Bindung an proprietäre Software, wobei die Verbreitung offener Dateiformate den Gegenpol bildet. Die Funktionen von Dateien variieren und wirken sich auf Hard- und Software aus. So können 3D-Modelle, CNC-Fräsungen, Sport-Ergebnisse, Computer-Spiele, Ampelschaltungen oder Warenbestände übermittelt werden.
Interessant sind vorrangig jene Dateien, die über das Netz übertragen werden und nicht den klassischen Erfordernissen der visuellen oder auditiven Kommunikation entsprechen. So können Dateien übersendet werden, die verschiedene Arten von Maschinen adressieren und etwa einen 3D-Druck, eine Lackierung, eine Geldauszahlung am Automat, das Starten einer Heizung oder die Straßenbeleuchtung auslösen. Der entscheidende Unterschied besteht damit in der Tatsache, Technologien jenseits des Computers ansteuern zu können. Bis zu einem gewissen Niveau kann dies automatisiert werden, wenn beispielsweise bei drohendem Hochwasser Dämme automatisch schließen. Zunächst unabhängig von der Frage, bis zu welchem Grad der Automatisierung in Anbetracht von Agenden, Bots und eben sensorgesteuerten Aktionen von gesellschaftlicher Kommunikation gesprochen werden kann, ist evident, dass das Versenden und Empfangen von Dateien eine ganz eigene Art des Austauschs bildet. Sie bleibt beschränkt auf immaterielle Gegenstände. Eine gesendete Datei entspricht einem speziellen Werkstoff, der nur von einer bestimmten Maschine genutzt werden kann. Die Datei stellt dabei zunächst nur eine mehr oder weniger komplexe Abfolge von Zeichen dar. Erst in Kombination mit der zugehörigen Hard- und Software kann sie (sinnvoll) verwendet werden.
Für das Internet bedeutet die Möglichkeit, beliebige Dateien versenden zu können, eine Ausweitung des Gegenstandsbereichs. Es kann Austausch – natürlich unter den Bedingungen der Raum-Zeit-Entbettung und der unbeschränkten Reproduzierbarkeit – über die Grenzen menschlicher, im Speziellen: kognitiver Leistungsfähigkeit hinweg betrieben werden. Geht es beispielsweise um die Berechnung der optimalen Windschnittigkeit eines Automobils, kann die Projektdatei des Konstruktionsprogrammes durch das Internet übermittelt und dann wiedergegeben werden, wohingegen eine händige Berechnung und der nötige Austausch wesentlich aufwendiger wäre. Diese Form der Transaktion ermöglicht ein gänzlich neues Leistungsniveau, in Anbetracht dessen selbst die Bildtelefonie als informationsreichstes Medium einen vergleichsweise geringen Informationsgehalt aufweist. Gerade ausführbare Dateien ermöglichen eine Komplexität, die eben nur mikroprozessorgestützt denkbar ist. Durch den Austausch über das Web wird das Potenzial moderner Maschinen aufgrund von Synergieeffekten vervielfacht und das Internet selbst zu einem wichtigen Einflussfaktor der objektiven und nicht nur der sozialen Welt.