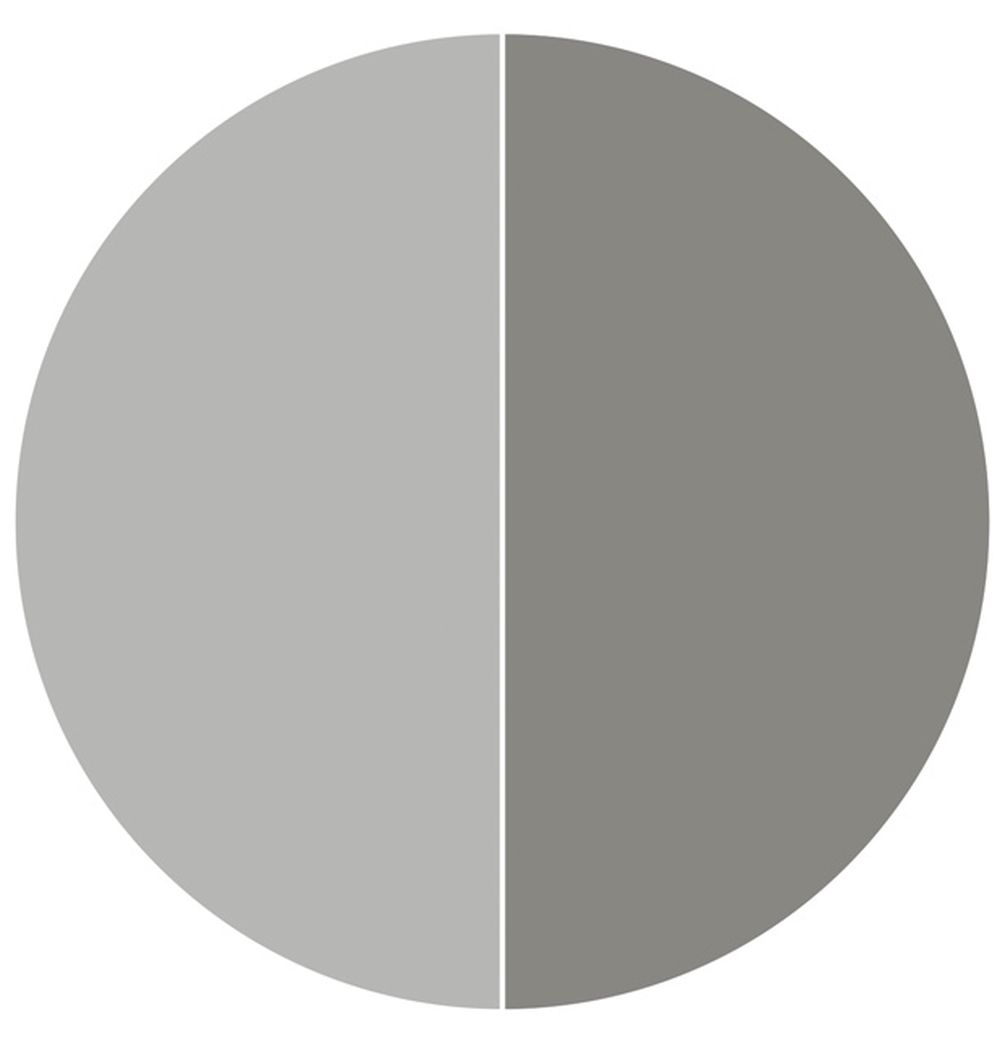
tl;dr YouTube
Videoplattformen gibt es einige im Internet, so zum Beispiel Vimeo, Twitch TV und Clipfish. Allerdings wird es eher selten vorkommen, dass Kinder sich auf einer anderen Plattform als auf YouTube aufhalten. Schon 2016 hatte YouTube rund 81 Prozent Marktanteil. 12 Tendenz steigend.
90 Prozent der 12- bis 19-Jährigen schauen sich mehrmals pro Woche Videos auf YouTube an. 13 Im Schnitt verbringt diese Altersgruppe täglich drei Stunden im Internet – den Großteil davon auf YouTube. Dabei wird die beliebte Plattform hauptsächlich mobil genutzt, also per Smartphone abgerufen.
Wie man Kinder konsequent von
Smartphones fernhalten kann
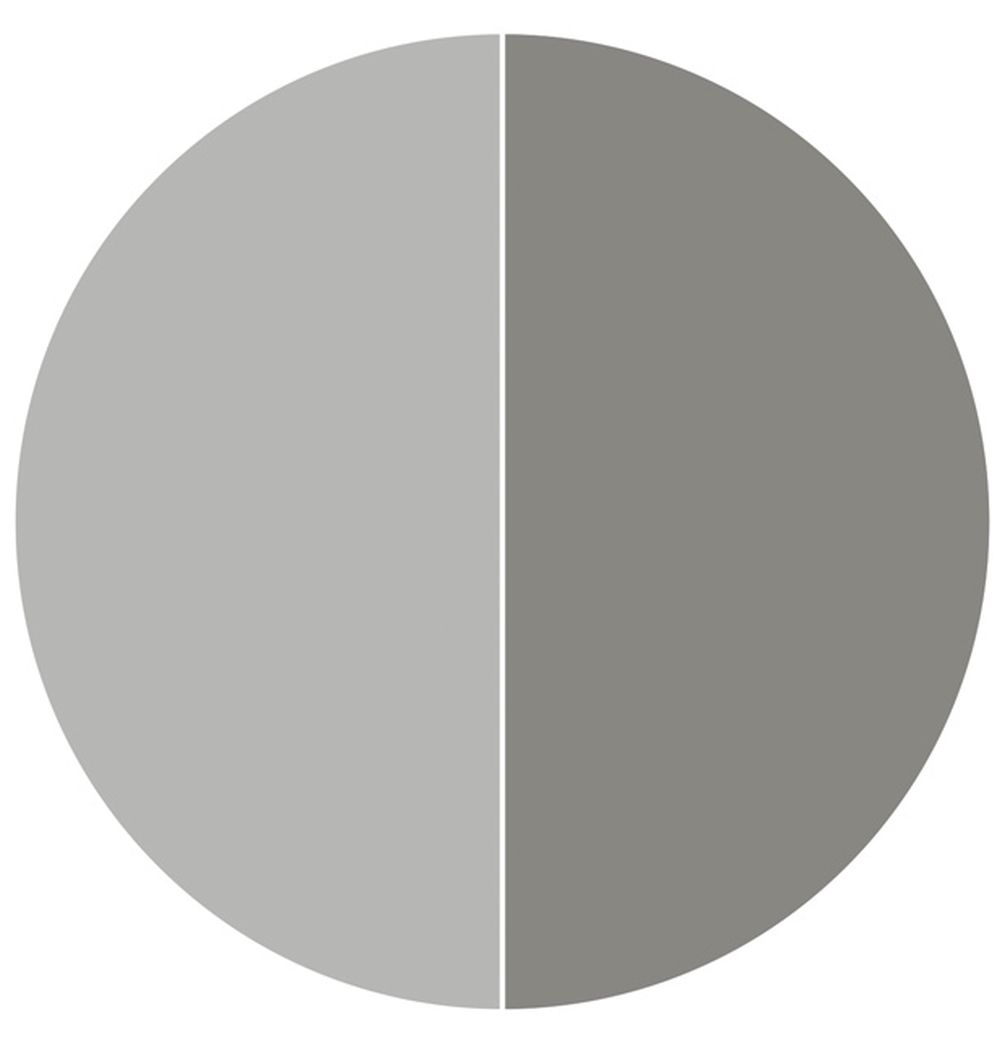
Wenn man kein Smartphone hat Wenn man keine Kinder hat
@katjaberlin für #nur30min
Würde ich gefragt, über welche Plattform ich gerne krückstockwedelnd schimpfen möchte, käme die Antwort wie aus der Pistole geschossen: YouTube!
Allerdings habe ich den festen Vorsatz, mich nicht in die Reihe der Kulturpessimisten einzureihen. Damit mir das gelingt, musste ich erst mal der Frage nachgehen, warum ich mich mit YouTube so unwohl fühle.
Die erste Teilantwort ist ganz einfach. YouTube ist einfach nicht meine Plattform. Als Jahrgang 1975 bin ich schlichtweg zu alt. Mit Computerspielen, Messengern, Chats und Blogs bin ich aufgewachsen. YouTube gibt es erst seit 2005. Doch selbst 14 Jahre später habe ich noch nie aktiv etwas auf dieser Plattform gemacht, habe noch nie kommentiert, folge dort niemandem und schaue lediglich sporadisch kurze Clips. Aktuelle Entwicklungen bekomme ich von alleine gar nicht mit. Mein Zugang sieht bildlich übersetzt so aus, dass ich im Ohrensessel sitze und dort in einer Zeitung lese, dass YouTuber*in XY gerade sehr angesagt ist, weil er oder sie drei Fantastillionen Follower*innen hat.
So war es zumindest bis 2014. 2014 ist das Jahr, in dem Simon Unge das YouTube-Netzwerk Mediakraft Networks verließ, was für unser ältestes Kind ein ernstzunehmendes Ereignis in seinem Lebensalltag darstellte. Erst jetzt wurde mir klar, welch große Vorbildwirkung YouTube-Stars haben und dass deren Inhalte auch in unserer Familie regelmäßig konsumiert werden.
Also habe ich gemacht, was ich regelmäßig empfehle: Ich fragte mein Kind, was es sonst noch so schaut und warum. Danach quälte ich mich stichprobenartig durch die Videos und fühlte mich unendlich alt: Was reden die da? Warum reden die so schnell? Wieso blinkt und wackelt alles? Und muss man wirklich alle drei Sekunden einen Schnitt machen?
Engagiert, wie ich bin, habe ich dann mal geschaut, welches die YouTuber*innen mit der größten Reichweite sind, mir exemplarisch deren Beiträge zu Gemüte geführt und mich plötzlich in längst überwunden geglaubten Klischeewelten wiedergefunden. Frauen reden über Lifestyle, gehen shoppen, zeigen dann, was sie eingekauft haben (Hauls), geben Schmink- und Stylingtipps und reden darüber, wie man die Boys klarmacht, ohne zu bitchy rüberzukommen. Große Teile der Jugendsprache musste Oma Patricia übrigens im Urban Dictionary nachschlagen.
Die Jungs wiederum erzählen ihre Heldengeschichten, stellen sich irgendwelchen haarsträubenden Herausforderungen (Challenges), verarschen sich gegenseitig (Pranks) oder unterhalten sich darüber, was an Mädchen nervt oder wie kurz der Rock sein darf.
Plötzlich wurde mir klar: Die großen YouTube-Kanäle transportieren inhaltlich eigentlich nichts anderes als früher Bravo Girl! und Mädchen, nämlich widersprüchliche Botschaften (»So kaschierst du deine Problemzonen« und »10 Regeln, damit ER dich wahrnimmt« versus »Sei ganz du selbst«) sowie widerliche Körperbilder (»Mit dieser Diät zum Beach-Body«, »Diese 5 Tricks lassen deine Cellulite verschwinden«).
Mit über vierzig weiß ich natürlich, was für ein Unsinn das alles ist. Mit 13 war das anders. Da war ich unsicher und empfänglich für solche Botschaften. Am Ende blieb das Gefühl: Ich bin auf jeden Fall falsch. Zu aktiv, zu passiv, zu dick, Nase zu groß, Haare zu zottelig, Style kacke. Die nächsten anderthalb Jahrzehnte habe ich damit verbracht, diese Komplexe zu überwinden. Dabei hat es mir sehr geholfen, keine Mädchen- bzw. Frauenmagazine mehr zu lesen und den Fernseher abzuschaffen. Denn dort wird nichts anderes vermittelt: Für Frauen zählt vor allem das Aussehen, und wenn das nicht perfekt ist, hilft es vielleicht noch, gut kochen zu können. Ansonsten sind Hopfen und Malz verloren. Allein die Werbung! Ohne Werbeeinblendungen würde ich zum Beispiel niemals die sieben Zeichen der Hautalterung kennen:
Die Werbung macht mir klar: Ich bin ein einziger Makel. Eine Schande. Der Archetyp des Unperfekten.
Genau da habe ich verstanden: YouTube ist nichts anderes als Fernsehen. Die Rückkehr der Mädchenmagazine, der Untergang des Abendlandes!
Ob die meisten Erwachsenen, die noch altmodisch Fernsehen schauen, YouTube vielleicht deshalb gar nicht so schlimm finden und sich eher um computerspielende Kinder sorgen?
Doch Moment mal! Hat da etwa Manfred Spitzer Besitz von mir ergriffen? Ich blase gerade voll in das Erwachsenenhorn: »YouTube ist dumm, oberflächlich und niveaulos!«
Die Befunde der MaLisa-Studie 2019 14 – »Weibliche Selbstinszenierung in den neuen Medien« – bestätigen diese Einschätzung auf den ersten Blick: In den Top 100 von YouTube, Instagram und Musikvideos sind feinste Genderstereotype vertreten: »Während Frauen sich überwiegend im privaten Raum zeigen, Schminktipps geben und ihre Hobbys präsentieren (Basteln, Nähen, Kochen), bedienen Männer deutlich mehr Themen: von Unterhaltung über Musik bis zu Games, Comedy und Politik.«
In den Musikvideos sieht es nicht anders aus. Frauen als Eye-Candy, sexy inszeniert, passiv. »Auch auf Instagram sind insbesondere die Frauen erfolgreich, die einem normierten Schönheitsideal entsprechen. Sie sind dünn, langhaarig und beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen Mode, Ernährung und Beauty. Weibliche Selbstinszenierung findet hier nur in einem sehr begrenzten Korridor statt.« Weil die Influencerinnen das selbst so wollen? Mitnichten. In der anschließenden Befragung einzelner YouTuberinnen gibt eine von ihnen zu Protokoll: »Eine starke eigene Meinung schmälert deinen finanziellen Wert, weil sich dann bestimmte Firmen nicht mehr mit dir zeigen wollen.« Werbepartner erwarten von Frauen also keine inhaltlichen Statements, sondern ein schön inszeniertes Bild.
Wer tiefer in das Thema »Rollenklischees auf YouTube« einsteigen möchte, dem sei der hörenswerte Beitrag von Almut Schnerring und Sascha Verlan im Deutschlandfunk empfohlen: »10 Dinge, die an Mädchen nerven. Geschlechterklischees in der YouTube-Szene«. 15
Allerdings ist YouTube nicht gleichzusetzen mit den 100 meistabonnierten Kanälen. Im Übrigen gibt es selbst unter denen Ausnahmen wie den Broadcaster LeFloid, der diese rückwärtsgewandte Entwicklung reflektiert, unter anderem in dem Beitrag »Schw*nze, Är*che & Geld – SO WIDERLICH SIND DIE YOUTUBE-TRENDS & was sonst noch so abgeht«. 16 Also bitte nichts über einen Kamm scheren!
Über die Reproduktion von Geschlechterklischees sollten sich Eltern allerdings Gedanken machen und ihre Kinder dafür sensibilisieren, damit diese nicht einfach alles für bare Münze nehmen, sondern hinterfragen. Für jene Eltern, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben und immer noch rätseln, was eigentlich so problematisch ist, wenn Mädchen Rosa mögen, hier die Erläuterung in Kürze:
Natürlich ist es überhaupt kein Problem, wenn Mädchen die Farbe Rosa, Barbies und Prinzessinnenkleider mögen oder YouTuberinnen Schminkvideos machen. Das Problem liegt in den Konnotationen, die transportiert werden (süß, niedlich, hübsch, zart, sensibel, passiv), und dass diese gegenüber den typisch männlichen Eigenschaften (durchsetzungsstark, mutig, cool, aktiv) als weniger wertvoll gelten.
Dazu ein Gedankenexperiment: Wie begegnen Menschen in der Regel einem Jungen, der als Fee verkleidet Nagellack tragen will? Und wie finden dieselben Menschen es, wenn sich ein Mädchen als Astronautin, Feuerwehrfrau oder Polizistin verkleiden will?
Der Junge wird abgewertet, weil er ein weibliches Klischee übernimmt (»Oh Gott! Wie unmännlich! Verweichlicht gar. Ist das normal?«). Das Mädchen hingegen wird aufgewertet (»Die ist ja cool! Das ist ja eine ganz Aufgeweckte!«).
Seid ihr an YouTube-Kanälen interessiert, die diese Rollenklischees nicht reproduzieren, so schaut euch zum Beispiel den Vortrag von Lilith 17 an, die auf der Tincon etwas dazu erzählt und zum Beispiel Honigball 18, Simone Giertz 19 oder Liza Koshy 20 als Alternativen empfiehlt.
Tatsächlich hat YouTube noch ein paar Dinge mehr zu bieten als ermüdende Geschlechterklischees, denn …
Wenn meine Kinder auf ein Problem stoßen, suchen sie nicht die Antwort in Suchmaschinen, sondern geben ihre Frage auf YouTube ein und erhalten Antworten in Form von Video-Tutorials. Diese sind, vor allem was komplexe Inhalte angeht, um vieles hilfreicher als ein reiner Text. Mit dieser Strategie sind meine Kinder nicht allein. Suchen Jugendliche im Internet nach bestimmten Informationen, ist die Suchmaschine Google mit 85 Prozent zwar die wichtigste Quelle, mit 61 Prozent ist YouTube aber schon dicht dran. Wikipedia folgt erst auf Platz 3. 21
Und noch ein Hinweis in diesem Zusammenhang: Viele gut gemeinte Kinderangebote sind unnütz, wenn sie sich nicht an dem tatsächlichen Verhalten von Kindern ausrichten. Für mich ist die bekannte Suchmaschine fragFINN ein solcher Fall. fragFINN wurde eigens für Kinder bis zwölf Jahre entwickelt und gibt nur von Medienpädagogen überprüfte Internetseiten als Ergebnis aus. Das ist schön, wenn die Kinder tatsächlich Suchmaschinen benutzen. Wie die Statistik oben zeigt, machen das aber sehr viele Kinder gar nicht mehr, denn auf YouTube lassen sich Tutorials zu jeder Fragestellung und zu jedem Hype finden. Was hätte ich bloß in den Hochzeiten von Loomgummis oder Fidget-Spinnern ohne YouTube gemacht? Wie würde ich mich ohne YouTube über neue Computerspiele informieren? Wer hätte mir die ganzen Pokémon-Go-Tricks verraten?
Genauso hilfreich finde ich Kanäle, die mir bei komplexen Serien mit mehreren Staffeln (an deren Inhalt ich mich kaum erinnere) Plot-Theorien erläutern. Serien wie Game of Thrones, The Leftovers oder Lost hätte ich ohne YouTube nicht ansatzweise verstanden.
Nicht zu vergessen die ganzen lustigen Katzenvideos! Was wäre die Welt ohne niedliche Tiervideos? Faultiere, Pandas und Skateboard fahrende Hunde. Dagegen kann man nun wirklich nichts haben, oder?
In puncto YouTube hilft also Differenzierung. Auch wenn ihr selbst nicht viel YouTube konsumiert: Lasst euch von euren Kindern zeigen, was sie schauen. Sprecht mit ihnen darüber, wie ihr das findet, und begründet eure Bedenken, sofern ihr welche habt.
Um der Kinder willen sollte man hier jedoch nicht allzu penetrant agieren und ab einem gewissen Alter des Kindes auch darauf vertrauen, dass die jahrelange Erziehung zu kritischem Denken bereits Wirkung zeigt. Das Schauen der Videos heißt nicht unbedingt, dass alles kritiklos hingenommen wird.
Im Übrigen hilft es oft, schneller als die Kinder zu sein. Wenn ihr euch also schon mit YouTube befasst, bevor die Kinder auf YouTube stoßen, könnt ihr ihnen gleich ein paar gute Kanäle vorschlagen. Ergiebige Quelle ist Funk.net, das Onlineangebot von ARD und ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren. Da gibt es zum Beispiel Y-Kollektiv 22, Auf Klo 23, Jäger & Sammler 24 und das Politikformat Deutschland3000 25, dessen Moderatorin Eva Schulz erst 2019 den 25 Frauen Award erhalten hat. Diese Kanäle sind übrigens auch alle auf YouTube vertreten.
Superinteressant ist die Jugendserie DRUCK a), in der es um alles geht, was im Leben von Teenagern eine wichtige Rolle spielt, um die erste Liebe, Freundschaften, Outings, Abgrenzung, Mobbing und natürlich um den Leistungsdruck in der Schule.
Auf YouTube gibt es viele spannende Wissens- und Lernkanäle, die keine Klischees bedienen, unter anderen maiLab 26, der Wissenschaftskanal der Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim, sowie DorFuchs 27, der Mathe vermittelt, indem er zum Beispiel mathematische Formeln mit leicht sächsischem Einschlag singt – und was kann es in einer Mathearbeit Hilfreicheres geben als einen nicht wegzubekommenden Ohrwurm der entsprechenden Formel?
Apropos Ohrwurm. Ich bin ein großer Fan davon, dass Formate auch einfach Spaß machen und unterhalten dürfen. 2011 habe ich wirklich Tränen über die Misheard Lyrics »Ismail YK« (Stichwort »Keks, alter Keks!«) von Coldmirror gelacht, die Kinder und Jugendliche übrigens auch wegen ihrer Harry-Potter-Neusynchronisationen lieben.

Misheard Lyrics Ismail YK
Speaking of lieben: Eltern, die sich in Sachen Medienkompetenz schlaumachen wollen, empfehle ich den YouTube-Kanal Handysektor, auf dem man sich alle für Kinder relevanten Apps und deren sinnvolle Konfiguration anschauen kann. Am besten gleich zusammen mit dem Kind. Um ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, was die Kinder und Jugendlichen gerade auf YouTube bewegt, hier noch eine letzte Empfehlung: die Wochenschau des Kanals »Ultralativ!« 28. Woche für Woche nehmen die beiden Betreiber Paul Schulte und Fynn Kröger die wesentlichen Themen der YouTube-Szene kritisch unter die Lupe.
Noch mehr Empfehlungen geben euch die Medienpädagoginnen Kim und Natascha vom Medially-Podcast in Folge 16 (»Gute YouTube-Kanäle«) und Folge 17 (»Genderstereotype in digitalen Medien«). 29
 | Nehmt euch die Zeit, die eigenen Vorurteile gegenüber YouTube abzubauen. |
Abgesehen von meinem fortgeschrittenen Alter, das mein Verhältnis zu YouTube ein wenig trübt, verspüre ich YouTube gegenüber immer so ein Gefühl von Kontrollverlust.
So denke ich jedes Mal, wenn meine Kinder mich fragen, ob sie sich etwas auf YouTube anschauen dürfen: »Hmmm na jaaaa grrrhhh uff«, und frage: »Was denn?« Antworten die Kinder dann mit Anni The Duck 30, bin ich erst mal nicht schlauer. YouTube ist so groß und unüberschaubar. Jede Minute werden 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. 31 Ändert man nichts an den Standardeinstellungen von YouTube, wird am Ende des einen Videos einfach das nächste abgespielt. Im rechten Bereich des Browserfensters wird eine unendliche Reihe weiterer Empfehlungen eingeblendet.
Will sich ein Kind im Frühling zum Beispiel über das harmlose Thema Feuerwanzen informieren, weil die überall auf dem Gehweg zu sehen sind, werden sofort Videos wie »29 erstaunliche Fakten über Katzen«, »12 Tiere, die dein Blut gefrieren lassen« und »Wenn du das siehst, renn und hol Hilfe!« angeboten.
Habe ich das Feuerwanzen-Video erlaubt, heißt das noch lange nicht, dass das Video »Wenn du das siehst, renn und hol Hilfe!« meinem Kind keine Albträume beschert.
Grundsätzlich plädiere ich dafür, dass man mit Kindern über solche Dinge redet: Warum hat man als Erwachsene/r ein ungutes Gefühl? Was ist die konkrete Bitte? (z. B.: »Bitte nicht einfach andere Videos anklicken, auch wenn sie dir interessant erscheinen«). Das setzt jedoch ein gewisses Alter bzw. eine bestimmte geistige Reife voraus. Kinder bis fünf Jahre sollte man meines Erachtens gar nicht alleine YouTube schauen lassen. Da sehe ich keinerlei Unterschied zum Fernsehen. Bis Kinder dann elf oder zwölf Jahre alt sind, kann man durchaus einige einfache technische Maßnahmen ergreifen. So gibt es in den Einstellungen auf YouTube beispielsweise die Möglichkeit, einen eingeschränkten Modus zu aktivieren. Dabei handelt es sich um einen halbwegs funktionierenden Filter, der Inhalte, die nicht jugendfrei sind, ausblendet. Der eingeschränkte Modus muss jedoch für jedes Endgerät und jeden verwendeten Browser einzeln aktiviert werden! Einen hundertprozentigen Schutz vor verstörenden Inhalten bietet ein solcher Filter allerdings nicht. Unser damals dreijähriges Kind hat zum Beispiel Videos von Haussprengungen gesehen, weil das ältere Geschwisterkind diese angeschaut hat. Das Kleinkind bekam furchtbare Angst. Es wollte umgehend die Wohnung verlassen und bat weinend darum, dass wir alle mitkommen, denn unser Haus könnte schließlich auch einstürzen.
Seine kleinkindliche Verzweiflung hat mich damals kalt erwischt. Immerhin hatte ich dem älteren Kind erlaubt, diese vermeintlich unschädlichen Videos zu schauen, und nicht daran gedacht, dass ein jüngeres Kind fast ein Trauma davontragen könnte, weil das Weltwissen »Häuser aus Stein sind stabil und können nicht einfach kaputtgehen« durcheinandergerät. Der eingeschränkte Modus hätte an dieser Stelle nicht geholfen, weil Videos von Haussprengungen nicht als jugendgefährdend eingestuft werden. Machen wir uns außerdem nichts vor: Kinder können solche Einstellungen auch wieder rückgängig machen, indem sie auf YouTube zum Beispiel »Eingeschränkten Modus ausschalten« eingeben.
Dennoch würde ich immer das »Autoplay«, also das automatische Abspielen weiterer Videos deaktivieren. Das geht vergleichsweise einfach: Neben dem eigentlichen YouTube-Video befinden sich im rechten Bildbereich die Vorschläge für weitere Videos. Darüber gibt es einen kleinen Schalter namens »Autoplay«. Beim Anklicken wechselt er in die Aus-Stellung.
Neben den Einstellungen auf YouTube selbst lassen sich bestimmte Inhalte auch per Software ausblenden. Das schützt euer Kind vielleicht in den eigenen vier Wänden an den Geräten, die ihr selbst verwaltet. Es sei denn, es ist technisch ziemlich clever, denn mit ein bisschen Recherche können Kinder solche Sperren leicht umgehen – und sollte ihnen das gelingen, dürft ihr ruhig ein wenig stolz auf die Technikkompetenz eurer Kinder sein. Auf das, was Kinder bei und mit ihren Freund*innen machen, habt ihr am Ende ohnehin keinen Einfluss. Das ist auch der Grund, warum dieses Buch kein ausführliches Kapitel zu dem Thema »Filter und technische Möglichkeiten der Kontrolle von Medieninhalten« enthält. Denn entweder hält sich euer Kind an Vereinbarungen oder nicht. Entweder ist es einsichtig und ihr sprecht offen über die verschiedenen Themen oder nicht. Software und Filter vermitteln nur Pseudosicherheit. Wie oft sitze ich mit Eltern an einem Tisch, die eine Benachrichtigung bekommen, sobald ihre Kinder sich eine App herunterladen. Sie schauen auf die Nachricht, sehen »Aha, App XY« und unterhalten sich weiter. Ein paar Mal habe ich nachgefragt, ob sie sich später mit dem Kind die App anschauen, ob darüber gesprochen wird, welche Daten die App sammelt und was sie sonst noch so tut, erntete in den allermeisten Fällen aber nur verlegenes Kopfschütteln.
Selbst wenn das Abschotten problematischer Inhalte gelänge, handelt es sich doch immer nur um eine Übergangslösung für ein gewisses Alter. Den richtigen, weil verantwortungsvollen Umgang mit Medien lernt das Kind auf diese Weise nicht.
Außerdem gibt es auf YouTube immer wieder Phänomene, die kein Filter technisch ausblenden kann. So gibt es zum Beispiel nachsynchronisierte Kinderserien. Nichtsahnend stellt ihr für euer Kind eine Folge Caillou an, die auch normal beginnt, verlasst den Raum – und entdeckt dann zufällig oder bestenfalls weil euer Kind sich meldet, dass die Folge neu synchronisiert wurde, und zwar mit Fäkalsprache, Nazi-Jargon oder irgendeinem anderen Inhalt, der garantiert nicht für euer vierjähriges Kind geeignet ist.
Mein Plädoyer an dieser Stelle lautet:
Kleine Kinder auf YouTube nichts allein machen lassen! Begleitet eure Kinder vor allem zu Anfang im besten Sinne von »die Dinge gemeinsam machen«!
Sprecht über alle Themen! Dabei die eigenen Bedenken und die daraus abgeleiteten Regeln begründen und mit Argumenten hinterlegen – und auch die Kindersicht anhören und ernst nehmen.
Hinterfragt ernsthaft, warum ihr manche Dinge nicht wollt oder warum sie euch Sorgen bereiten, und behaltet im Hinterkopf, dass eigene ästhetische Empfindungen nicht mit pädagogischer Wertigkeit gleichzusetzen sind!
Wie oft sitzen meine Kinder kichernd vor YouTube-Videos und machen mich neugierig, was sie denn da Lustiges schauen. Ich kann mich dann eine halbe Stunde danebensetzen, ohne ein einziges Mal zu lachen. Ich sitze einfach nur mit einem großen Fragezeichen im Kopf da wie eine langweilige Statue. Für über 40-Jährige gelten eben andere Unterhaltungsmaßstäbe als für Zehnjährige. Etwas ist nicht per se schlecht oder gar schädlich für mein Kind, nur weil ich es persönlich doof oder albern finde.
Oberstes Ziel muss sein, dass ein Kind nach und nach lernt, was gut für es ist und was nicht. Welche Inhalte okay sind und welche nicht. Es muss lernen, sich selbst zu schützen, indem es bestimmte Inhalte nicht anschaut, ein Video stoppt, wenn es gruselig wird oder eine unangenehme Wendung nimmt, und dass es bestimmte Inhalte auch nicht mit anderen teilt. Bereitet eure Kinder darauf vor, dass es inadäquate Inhalte gibt, und sagt ihnen, wie sie reagieren können. Im einfachsten Fall mit »Hand drauf« und das Gesehene abdecken. Ein super Tipp von Thomas Schmidt (@wapoid), der für teachtoday Vorträge zum Thema »Medienkompetenz« hält.
Kinder nicht darauf vorzubereiten, dass es problematische Inhalte gibt, zum Beispiel im blinden Vertrauen auf technische Filter, ist auch deshalb schwierig, weil ein Kind viel geschockter ist, wenn es dann tatsächlich mal etwas Unangemessenes sieht, als wenn es vorher schon weiß, dass es solche Inhalte gibt und wie es damit umgehen soll. Ein harmloses Video ist eben manchmal nur wenige Klicks von einem wirklich schrecklichen Video entfernt – und letztlich können wir Erwachsenen gar nicht einschätzen, was bei Kindern Angst auslöst und was nicht.
Ich habe als Kind sehr viel allein fernsehen dürfen. Doch sobald die Musik bedrohlich wurde und andeutete, dass gleich etwas passieren wird, habe ich das Fernsehgerät ausgeschaltet. Alles, was ich als Kind gesehen habe und was mich mehr oder minder traumatisiert hat, habe ich bei anderen Kindern zu Hause gesehen. Dort wollte ich nie uncool wirken und habe dann einfach weitergeschaut, obwohl ich ein unangenehmes Gefühl dabei hatte. Nein zu sagen fällt mir bis heute schwer. Auch wenn ich genau weiß, dass Nein die richtige Antwort ist. Unsere Kinder können wir im Neinsagen unterstützen, indem wir ein Nein auch im normalen Alltag zulassen. Wenn sie zu Hause in ihren Bedürfnissen und Einschätzungen ernst genommen werden, fällt es ihnen leichter, in Situationen, in denen sie sozialem Druck ausgesetzt sind, Nein zu sagen.
 | Am Ende ist es vor allem wichtig, dass ein Kind seine Eltern als Vertrauenspersonen wahrnimmt, an die es sich mit allen Fragen, Empfindungen und Unsicherheiten wenden kann. |
Im Jahr 2015 sollen die YouTube-Umsätze nach Schätzungen von Evercore ISI bereits bei 9 Milliarden Dollar gelegen haben.
Laut Forbes 32 war Ryan ToysReview 33 2018 der bestbezahlte YouTube-Kanal mit 22 Millionen Dollar Jahresumsatz. Dahinter verbirgt sich ein siebenjähriger Junge mit 19 Millionen Abonnenten. Doch nur ein geringer Teil des Geldes kommt direkt von YouTube. Haupteinnahmequelle sind Sponsorings, Produktwerbungen und Merchandising. Auch in Deutschland liegt der Umsatz der Top 10 inzwischen mindestens im sechsstelligen Bereich.
Sensibilisiert eure Kinder deshalb auch für das Thema »Werbung und Authentizität«. Letztere dürfte bei den reichweitenstarken YouTuber*innen vermutlich irgendwann nur noch zu einem gewissen Maße vorhanden sein. Denn wo viel Geld fließt – und das ist ab einer gewissen Zahl an Follower*innen beinahe zwangsläufig der Fall –, da stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Authentizität abnimmt, weil die dahinterstehende Vermarktungsmaschinerie eigene Interessen verfolgt.
Ich habe lange überlegt, warum es für mich gefühlt gar nicht soooo schlimm ist, wenn bestimmte Computerspiele Geschlechterklischees reproduzieren (der starke, handelnde Actionheld und die zu rettende sexy Frau, die nicht redet), ich aber ein ganz anderes Gefühl habe, wenn es um YouTube geht. Meine Antwort: Bei Computerspielen habe ich (auch schon als Kind und Jugendliche) einen ganz anderen Abstand zu den Charakteren; mir ist jederzeit voll und ganz bewusst, dass es sich um Fiktion handelt.
Anders sieht es aus bei den nahbar erscheinenden YouTube-Stars. Das sind letztlich einfache Menschen, die (vorgeblich) authentisch über ihr Leben berichten. Sie haben ein ganz anderes Identifikationspotenzial.
Auch in dem bereits erwähnten Feature von Almut Schnerring und Sascha Verlan geht es um das Thema Authentizität: »YouTube verspricht Authentizität. (…) Und viele Videos verdanken ihren Erfolg allein diesem Authentizitäts-Versprechen. (…) Allerdings investiert das Unternehmen Millionen in die Förderung und Beratung seiner aktuellen und zukünftigen Stars und richtet weltweit YouTube-Spaces ein mit Büros, Studios, Video-Schnittplätzen und kostenlosen Fortbildungsangeboten, in denen Interessierte lernen können, wie man erfolgreiche Videos dreht.« 34
Dass die Sache mit der Authentizität am Ende eine Illusion ist, ist vielleicht nicht jedem Fan und jeder Followerin klar. Wurde diese Differenzierung jedoch deutlich gemacht ebenso wie der Wirtschaftsfaktor, der hinter den großen Formaten steht, dann ist YouTube wie alle anderen digitalen Medien kein Teufelszeug mehr – und auch ich kann meinen Krückstock wieder einpacken und meine Kinder YouTube-Videos schauen lassen.
Zugegeben, die Überschrift ist ein bisschen reißerisch. Schließlich habe ich ja schon festgestellt, dass YouTube nicht unbedingt zu verteufeln ist. Jedoch möchte ich an dieser Stelle ergänzen, dass es – in gewissem Rahmen – sinnvoller ist, die Kinder »fernsehen« zu lassen. Das gilt natürlich nicht für die Kanäle der YouTube-Stars und die Tutorials, aber für die (nachsynchronisierten!) Serien und Kinderunterhaltung (bis ca. 8 Jahre). Ich habe fernsehen übrigens in Anführungszeichen gesetzt, weil ich nicht das klassische Fernsehprogramm meine, sondern werbefreie Streaming-Portale.
Wir schauen kaum lineares Fernsehen, was in erster Linie daran liegt, dass wir seit Jahren keinen Fernseher mehr besitzen. Ich kann mich nicht mal erinnern, ob wir nach der Geburt des ersten Kindes jemals einen hatten. Die Idee, dass man genau dann schaut, wenn etwas ausgestrahlt wird, passt überhaupt nicht zu unserem Familienalltag, und sehr selten machen wir Gebrauch von den Mediatheken.
Meine eigene Fernsehkarriere sah wie folgt aus: Im zarten Alter von ca. 14 Jahren (1988) bekam ich von meinem Großvater, seines Zeichens Radio- und Fernsehtechniker, einen Fernseher geschenkt. Den habe ich angeschaltet und gefühlt erst 1999 wieder ausgemacht. Bis dahin hatte ich im Sommer von Sendebeginn bis Sendeschluss das ZDF-Ferienprogramm angeschaut und Weihnachten natürlich die Serien des ZDF-Weihnachtsprogramms (Anna, Silas, Die rote Zora, Timm Thaler …). Aber ich guckte auch den schlimmsten Schund. Germany’s Next Topmodel, Popstars, Big Brother, alle möglichen Talkshows und sämtliche entsetzlichen Realityshows der Privatsender. Nennt eine – ich hab sie gesehen.
Tatsächlich brauchte ich das als Mentalhygiene. Ein wunderbarer Ausgleich. Denn parallel dazu machte ich ein Einserabi und verbesserte den Schnitt im Diplom sogar noch ein bisschen – und trotz des exzessiven Fernsehkonsums meiner frühen Adoleszenz gelang es mir schließlich, einen guten Job zu finden und eine Familie zu gründen. Fernsehen macht wohl doch nicht allzu dumm.
Dennoch habe ich das lineare Fernsehen irgendwann aus meinem Leben verbannt. In erster Linie weil mir die Werbeunterbrechungen kolossal auf die Nerven gingen.
Da soll man sich mal beschweren, dass Twitter und Co. kurze Aufmerksamkeitsspannen bescheren. Werbeunterbrechungen finde ich viel (ver-)störender. Da kreischt, grölt, glitzert alles, und es werden Bedürfnisse geweckt, auf die ich gerne verzichte. Außerdem gibt es nicht wie früher drei TV-Sender, sondern je nach Satellitenanlage Hunderte, die zu jeder Tages- und Nachtzeit den größten Blödsinn ausstrahlen, auch die furchtbarsten, für Kinder gänzlich unpassenden Sendeformate. In diesen Dingen steht YouTube dem linearen Fernsehen in nichts nach.
Deswegen ein Hoch auf die Streaming-Dienste! Zudem ermöglichen sie es, Inhalte für Erwachsene per PIN für Kinder zu sperren. Auch gibt es hier weder schrecklich nachsynchronisierte Fassungen von Kinderserien noch so etwas wie die Momo Challenge, ein Phänomen, das von WhatsApp auf YouTube übergeschwappt ist. Momo ist ein gruselig aussehendes Wesen, das Kinder zum Suizid aufruft oder sie dazu auffordert, den Herd anzustellen, wenn die Erwachsenen schlafen. 35
Wenn wir zu Hause streamen, dann meist Tier- und Naturdokus. Was ich mittlerweile über seltene Tierarten und seltsame Gesteinsformationen gelernt habe, ist ganz erstaunlich. Manchmal gucken wir natürlich auch Filme oder Kinderserien.
Regelmäßig wird bei uns jedoch nichts geschaut. Kein Sandmännchen und auch sonst kein ritualisiertes »Fernsehen«.
Sind die Kinder allerdings krank und müssen ruhig liegen bleiben, dann wird auch schon mal ein bisschen mehr geglotzt. (Die Kinderärztin hat uns das empfohlen, ich schwöre!)
Offenbar stellt unsere Familie eine Ausnahme dar. In der Broschüre »Geflimmer im Zimmer« des Bundesministeriums für Familie heißt es: »Das Fernsehen spielt in den bundesdeutschen Familien immer noch eine herausragende Rolle. In vielen Familien sorgt es für Information und Unterhaltung, zudem bietet es eine Kulisse für familiäre Zusammenkunft. Jeder bundesdeutsche Haushalt besitzt durchschnittlich ein Fernsehgerät. Dazu kommt, dass in fast jedem zweiten Kinderzimmer und in etwas mehr als der Hälfte der Jugendzimmer heute ein Fernsehgerät steht. Obwohl Computer und Internet zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist das Fernsehen für Kinder nach wie vor das Medium Nummer eins und bleibt auch für die meisten Jugendlichen noch sehr wichtig.« 36
Von den durchschnittlichen Fernsehzeiten pro Tag – drei- bis dreizehnjährige Kinder schauen im Schnitt 90 Minuten täglich fern – sind wir Lichtjahre entfernt. Wenn wir zusammen fernsehen, merke ich immer wieder, dass die Grundschulkinder noch sehr sensibel sind, was Inhalte angeht. Habe ich sie im Alter zwischen drei und fünf frei wählen lassen, wollten sie nicht selten dieselbe Folge einer Serie immer und immer wieder sehen. Die Biene-Maja-Folge »Maja bei den Ameisen« habe ich inzwischen gefühlte zwei Millionen Mal gesehen, knapp gefolgt von Bob der Baumeister und seinem »Abenteuer auf der Ritterburg«. (Es fällt mir schon schwer, die Serientitel zu schreiben, eigentlich möchte ich mich am liebsten auf dem Boden einrollen und »Nein, nein, nein« wimmern.) So oder so: Wir haben keinen Bedarf, Fernseh- bzw. Streaming-Zeiten zu regulieren.
Ich weiß aber, dass das Fernsehthema in vielen Familien ein Dauerzankapfel ist, und möchte deswegen einige Anregungen geben, die mir in solchen Fällen helfen:
Seit Ende 2017 gibt es YouTube Kids. Hierbei handelt es sich um eine App für Smartphones und Tablets, die die Inhalte der YouTube-Plattform speziell für Kinder bis 13 Jahre einschränkt. Mitte 2018 wurden die Kontrollmöglichkeiten für Eltern weiter differenziert: Eltern haben unter anderem die Möglichkeit, die Angebote und Themen, die ihre Kinder sehen dürfen, selbst auszuwählen und per Timer festzulegen, wie lange sie schauen dürfen, und können die Suche bei Bedarf komplett deaktivieren.
Solltet ihr für euer Kind einen Google-Account angelegt haben, in dem ihr das echte Geburtsjahr hinterlegt habt, kommt es bis zu seinem 13. Geburtstag nur an YouTube Kids. Wahrscheinlich gibt es für Kinder zwischen acht und 13 wenig Frustrierenderes. Denn viele Kinder schauen spätestens ab acht Jahren begeistert die Kanäle von YouTuber*innen wie Joey’s Jungle und Paluten. Die meisten YouTube-Stars sind aber nicht auf YouTube Kids. Was also sehr wahrscheinlich passieren wird, ist Folgendes: Irgendwann wird euer Kind herausbekommen, wie es das normale YouTube anschauen kann. Bei meinem Großen hat es fünf Minuten gedauert. Man installiere die DuckDuckGo-App und gebe dort einfach »YouTube« ins Suchfenster ein. Fertig.
Für kleinere Kinder (bis sechs Jahre) ist YouTube Kids aber eine ähnlich gute Alternative wie Streaming-Dienste.
Seit 1997 verbringe ich sehr viel Zeit im Internet. Und seit 2004 habe ich mein eigenes Blog als Plattform. Bis auf eine bedauerliche Ausnahme, bei der es sich aber um einen mir persönlich bekannten Menschen handelt, habe ich noch keine schlimmen Erfahrungen in Sachen Beleidigungen, Anschuldigungen oder Hate-Speech gemacht. Daher hat mich Anne Wizoreks Vortrag »Ihr wollt also wissen, was #Aufschrei gebracht hat?«, den sie auf der re:publica 2013 gehalten hat, völlig unvorbereitet getroffen. Mir war bekannt, dass es um die Kommunikationskultur mancherorts nichts besonders gut steht, dass es aber so übel ist, war mir tatsächlich nicht klar. Als Anne Wizorek Ausschnitte einiger Hass-Mails zeigte, die sie im Laufe der Zeit bekommen hat, kamen mir die Tränen. Aus vielen Gründen. Weil es mich unendlich traurig macht und schockiert, dass es Menschen gibt, die so viel Hass in sich tragen. Weil sie sowas ertragen muss (und ich spreche hier nicht nur von Beleidigung, sondern von grauenhaften, brutalen und detaillierten Drohungen). Weil ich begriff, dass so viele Frauen öffentlich nicht sichtbar sein wollen, weil sie sich genau vor solchen Angriffen fürchten.
Seitdem setze ich mich mit dem, was anderen Frauen widerfährt, mehr auseinander. Inzwischen könnte ich ohne Probleme eine lange Reihe von Frauen aufzählen, für die es Alltag ist, Hass ausgesetzt zu sein. Das betrifft übrigens sowohl die Frauen meiner Altersgruppe als auch jüngere Frauen wie Sophie Passmann. Sie selbst brachte während ihres Vortrags »Ich war ein Jahr ohne Pause im Internet, und das habe ich gelernt« auf der Tincon 2019 einen wichtigen Punkt zur Sprache: »Es gibt keinen Hass im Netz. Es gibt nur Hass.« Es ist lächerlich, so zu tun, als wären Beleidigungen und Bedrohungen, die im Internet stattfinden, die in Kommentaren stehen oder per E-Mail verschickt werden, eine eigene Kategorie, die weniger verletzend oder beängstigend für die Adressat*innen ist. Menschen, die sich so benehmen und andere angreifen, tragen den Hass in sich. Sie zeigen ihn vielleicht mehr im Internet, aber das ändert nichts an ihrem schlechten Charakter, an den unsäglichen Umgangsformen und den zum Teil menschenverachtenden Haltungen. Die Kommentare auf Facebook und Co. kommen von echten Menschen. Von Menschen aus Fleisch und Blut. Der Hass ist real. Aussagen, das sei ja bloß ein Internetkommentar, bagatellisieren das Problem des Hasses im Netz. Wer es aushält und sich ein wenig in die dunkle Seite der Kommentarkultur vertiefen möchte, der sollte mal einen Blick auf die Seite Hatr.org werfen. Dort ist zu lesen, was normalerweise wegmoderiert wird.
 | Sprecht mit euren Kindern über angemessene, respektvolle Kommunikationskultur im Internet und über Hate-Speech. |
Hate-Speech betrifft natürlich nicht nur Frauen, sondern Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, Religion, ihrer sozialen Zugehörigkeit, wegen einer Behinderung oder wegen ihres Geschlechts einer Minderheit angehören. Da Hate-Speech ein politischer Begriff ist, wird die genaue Definition stark diskutiert. Im Kontext dieses Buches halte ich es nicht für zielführend, sich an einer solchen Definition abzukämpfen. Hier möchte ich vor allem dafür sensibilisieren, dass es Hasskommentare, Beleidigungen, Bedrohungen und alle Facetten von ekelhaften Kommentaren im Netz gibt.
Die forsa-Umfrage der Landesanstalt für Medien NRW 2018 37 zeigt, dass es viel Hate-Speech, aber glücklicherweise wenige Hassredner*innen im Netz gibt. Was zudem erfreulich ist: Rund 26 Prozent derjenigen, die Hate-Speech wahrgenommen haben, haben gleichzeitig Kommentare als Hate-Speech gemeldet. Gegenüber der Untersuchung des Vorjahres ist das immerhin ein Prozent mehr an Menschen, die sich aktiv gegen Hate-Speech engagieren. Laut JIM b)-Studie 2018 kommt rund jeder fünfte der 12- bis 19-Jährigen häufig mit Hate-Speech in Kontakt. Aber immerhin 35 Prozent geben an, dass sie bisher noch nie mit Hass im Internet konfrontiert wurden. 38
Im Kapitel über (Cyber-)Mobbing werden wir ausführlich darüber sprechen, was zu tun ist, wenn man von Angriffen dieser Art betroffen ist (Kommentare auf der entsprechenden Plattform melden, Täterprofile blocken, ggf. zur Anzeige bringen). Wichtig ist allerdings, dass jene, die nicht selbst betroffen sind, hinschauen und im Idealfall Verteidiger*in werden, insbesondere wenn jemand, den man persönlich kennt, Hate-Speech-Attacken ausgesetzt ist. Das nennt man Counter-Speech: Ergreift Partei, stellt klar, dass der Täter bzw. die Täterin mit seiner Ausdrucksweise und Meinung nicht toleriert wird. Was genau unternommen werden kann, ist unter anderem auf der Seite No-Hate-Speech.de nachzulesen. Sehr wichtig ist es auch, Hasskommentare zu melden. Extreme Fälle können sogar zur Anzeige gebracht werden. Damit das klappt, müssen Beweise gesichert werden. Dabei ist auf folgende Details zu achten:
Sollten die Kommentare also so heftig sein, dass sie strafrechtlich relevant sind, scheut euch nicht, sie zu melden, zum Beispiel beim Demokratiezentrum Baden-Württemberg 39, wo ihr auch Unterstützung erhaltet.
Bei einem Verstoß gegen deutsches Recht verlangt die Meldestelle respect! vom Netzwerkbetreiber die Löschung des Beitrags und zeigt Fälle wie Volksverhetzung konsequent an.
HateAid.org wiederum bietet Hilfe in Form kostenloser Opferberatung. Je nach Schwere des Falls können auch Therapeut*innen oder Anwält*innen hinzugezogen werden. HateAid geht spendenfinanziert gegen potenzielle Täterinnen und Täter vor und trägt im Fall der Fälle sogar die Gerichtskosten. Wird erfolgreich Schadenersatz oder Schmerzensgeld erstritten, wird es für das nächste Opfer verwendet bzw. in die dort entstehenden Kosten investiert.
Sollten eure Kinder selbst Inhalte erstellen, auf die sie Hasskommentare bekommen, macht ihnen klar, dass sie diese Kommentare rigoros löschen und die Verfasser*innen blocken können. Auch wenn es vielleicht ein wenig altmodisch erscheint: Erarbeitet mit euren Kindern eine sogenannte Netiquette zur Orientierung. Macht ihnen klar, dass einfach ausgeschlossen werden kann, wer gegen diese Netiquette verstößt. Es ist weder Zensur noch Einschränkung von Meinungsfreiheit, wenn man Hasskommentare löscht.
Unterstützt eure Kinder, und wendet euch an die genannten Stellen, um gegen die Täter*innen vorzugehen. Kinder wie Jugendliche sind überfordert, wenn es zu solchen Attacken kommt. Sie brauchen eure Unterstützung.
Was ist das nun schon wieder? Mit Victim-Blaming oder auch Täter-Opfer-Umkehr ist gemeint, dass die Verantwortung für eine Straftat dem Opfer in die Schuhe geschoben wird. Ich selbst kenne den Begriff erst seit einigen Jahren und musste feststellen, dass ich in der Vergangenheit oft leichtfertig Dinge gesagt habe, die unter Victim-Blaming fallen. Einiges davon habe ich sogar für wahr und richtig gehalten, so zum Beispiel, dass Frau sich einfach nicht so aufreizend anziehen sollte, weil sie sonst im Grunde sexuelle Übergriffe provoziert. Ich schäme mich heute zutiefst für das, was ich gedacht und gesagt habe, weil ich mit dem einen oder anderen witzig gemeinten Spruch dazu beigetragen habe, dass bestimmte Haltungen Normalität werden. Es ist nämlich nicht witzig, zu den Eltern eines kleinen Mädchens zu sagen: »Die ist so hübsch, die müsst ihr später bestimmt wegsperren.«
Ich könnte ein ganzes Buch damit füllen, wie das Internet meine Einstellung zu vielen Themen verändert hat. Was ich definitiv gelernt habe: Wenn jemand im Internet bedroht oder beleidigt wird, dann ist er oder sie nicht schuld.
Ich erwähne Victim-Blaming an dieser Stelle, weil ich immer wieder lese, dass XY doch selbst schuld sei, wenn sie ihr Leben so im Internet ausbreitet, dass Eltern doch selbst schuld seien, wenn ihren Kindern etwas passiert, weil sie ja deren Fotos gepostet haben, dass XY selbst schuld sei, weil er oder sie Fotos von sich in Unterwäsche gemacht hat.
Das ist in allen Fällen falsch. Schuld ist der Täter oder die Täterin. Schuld ist derjenige, der Hasskommentare schreibt und andere bedroht. Schuld ist diejenige, die andere beleidigt. Schuld sind die, die private Fotos anderer in Messenger-Diensten verbreiten.
Weil das Thema nicht unmittelbar mit Medienerziehung zu tun hat, möchte ich es hier nicht vertiefen. Ich möchte lediglich den Anstoß gegeben haben, über bestimmte Formulierungen nachzudenken, sie nicht zu verwenden und andere anzusprechen, wenn sie sich auf eine Art äußern, die das Täter-Opfer-Verhältnis umkehrt. Bringt das auch euren Kindern bei.
Kinder bis 3 Jahre
Kleinkinder sind oft auch mit anderen Dingen als (YouTube)-Videos zufriedenzustellen. Das gilt insbesondere für Kinder, die keine älteren Geschwister haben, und für Kinder, deren Eltern in ihrer Gegenwart kaum Videos schauen. Hängen die Erwachsenen ständig am Tablet oder Smartphone, ist es auch für kleine Kinder naheliegend, dass sich in diesen Geräten höchst spannende Dinge abspielen.
Wenn es aber nicht anders geht – und Situationen gibt es genug, ich denke da zum Beispiel an den Fall, dass ein alleinerziehender Elternteil krank ist oder man ein kränkelndes Kind hat und unbedingt geschäftlich telefonieren muss –, solltet ihr den Kindern Inhalte vorsetzen, die ihr kennt und gut kontrollieren könnt (Film auf DVD z. B.). Ansonsten gilt: Kleinkinder beim Videoschauen begleiten.
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren
In dieser Zeit würde ich auf YouTube Kids, auf DVDs und das Angebot von Streaming-Portalen zurückgreifen, sofern der Alltag es erfordert, dass die Kinder ohne Erwachsene Videos anschauen. Ab jetzt würde ich mit Kindern auch über Inhalte sprechen. Was ist gut und was nicht? Was ist altersgemäß und was nicht? Wie sind die persönlichen Empfindungen des Kindes? Was denkt es selbst? Eltern sollten sich unbedingt mit den reichweitestärksten Kanälen auf YouTube vertraut machen und sich schon mal Formate suchen, die für die Kinder später interessant sein könnten.
Kinder zwischen 7 und 12 Jahren
Es sollte eine Vereinbarung geben, was die Kinder ohne Rücksprache schauen dürfen. Wir Eltern haben uns von den Kindern eine Liste mit Kanälen erstellen lassen, die sie schauen möchten. Jeden Kanal haben wir dann stichprobenartig geprüft, indem wir vier bis fünf Videos angeschaut haben. Danach haben wir den Kanal jeweils freigegeben oder darüber gesprochen, warum wir den Kanal nicht gut finden und ihn noch nicht freigeben. Die Liste kann jederzeit erweitert werden, wenn die Kinder Kanäle oder Themen entdecken, die sie interessieren.
Möchten die Kinder etwas anderes schauen, als freigegeben ist, müssen sie jedes Mal fragen. Die Kinder sagen: »Das nervt!« Das glaube ich sofort. Ich finde es auch anstrengend, YouTube-Kanäle anschauen und beurteilen zu müssen, deren Zielgruppe ich nicht bin. Jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Kinder ab 13 Jahren
Die Kinder können frei entscheiden, was sie schauen, sofern es sich um altersgemäße Inhalte handelt. Ich verlasse mich darauf, dass sich zwischen uns eine Kommunikationskultur entwickelt hat, die es erlaubt, bei Unsicherheiten auf uns Eltern zuzukommen. Ich weiß außerdem, dass sie nur schauen, was ihnen tatsächlich altersgemäß erscheint – entweder weil es eine Kennzeichnung gibt oder weil sie selbst nach wenigen Minuten eine Einschätzung gewonnen haben.
Außerdem sprechen wir über die Kommentarkultur unter den Videos und über einen respektvollen Umgang miteinander im Internet. Die Kinder haben jetzt verstanden, dass sie selbst Teil dieser Kultur sind, wenn sie zum Beispiel kommentieren.
Kulturoptimist*innen schauen auf YouTube und sehen …
a) DRUCK ist die deutsche Adaption der norwegischen Erfolgsserie SKAM.
b) Jugend, Information, Medien