Die Jahreszeit der Rückkehr:
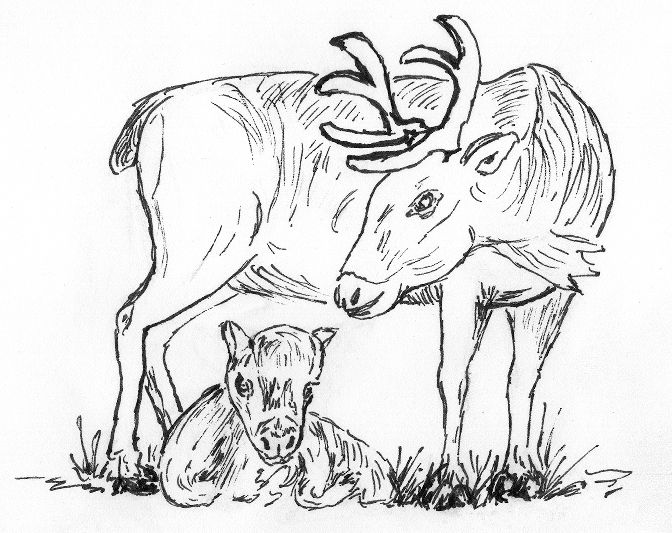
Frühling, Gijrra
circa Ende April bis Ende Mai
»Willst du mitkommen auf eine Schärgartentour zur Insel Getskär und dort in einer Stuga übernachten?«, fragt mich Niklas. Und ob ich will! Es ist fünf vor Eisschmelze und jetzt, Ende April, könnte jeder Schneemobilausflug aufs Eis der letzte der Saison sein. »Dieses Jahr hält das Eis ungewöhnlich lange«, berichtet Niklas, während er in seinen Overall schlüpft und die Stiefel schnürt. Es ist achtzehn Uhr an einem Donnerstag – after work auf Lappländisch. Man verkrümelt sich nicht in die Kneipe, sondern zieht sich warm an und belädt das Schneemobil mit Futter und Getränken fürs abendliche Grillen am Eis. Der Schnee ist zu einer nassen Masse degradiert, wir bleiben schon auf Niklas’ Grundstück mit dem Schneemobil stecken. Ich steige ab, während er im Stehen am Lenker zerrt, bis das Gefährt heulend wieder in die Spur kommt.
Ganz geheuer ist mir das Eis nicht mehr, doch Niklas beruhigt mich: »Man sieht ihm an, ob es noch tragfähig ist. Die dunklen Stellen zeigen, dass es dort nasser ist und schneller schmilzt.« Für meinen Geschmack halten wir auf sehr viele schwarze Löcher zu, doch bald entspanne ich mich. Genieße. Den Fahrtwind, der nicht mehr so gnadenlos in meine Wangen schneidet wie bei unserem Ausflug nach Rånön im Januar. Das Gefühl der Freiheit, das mich trotz aller Skepsis den benzinschleudernden Schneemobilen gegenüber packt, wenn ich auf einem sitze und in die weiße Welt hinausflitze. Den flüchtigen Blick auf eins der seltenen Rehe, das in der Ferne Zuflucht auf einem Inselchen sucht. Das Schwanenpaar, das von der Sonne angestrahlt vorbeifliegt. Das auf einem Baumwipfel sitzende Birkhuhn. Ich fühle mich, als säße ich vor einer riesigen Leinwand, auf der großes Naturkino spielt. Doch der Fahrtwind und der unter meinem Po vibrierende Scooter verraten, dass ich mittendrin bin.
Niklas’ kleines Tourismusunternehmen vermietet seit wenigen Wochen eine Stuga auf Getskär, einer der 25 Inseln des Naturreservats Litskär. Als wir die Insel anfahren, hebt sich das rote Häuschen mit Plumpsklo nebenan von der Waldkulisse ab. »Jetzt hackst du Holz, damit du den Ofen drinnen anwerfen kannst«, fordert mich Niklas auf. Er macht es vor – setzt die Axt an ein dickes Stück Brennholz, spaltet oben, dreht es um, spaltet unten. Nächstes Stück. Innerhalb einer Minute sind vier Brennholzbrocken gespalten. »Damit das Holz Feuer fängt, brauchst du kleinere Stücke.« Kein Problem. Ich stelle das Brennholz hochkant auf den Baumstumpf, gehe leicht in die Knie und schwinge die Axt. Volltreffer auf den Stumpf, das Holz kippt unberührt zur Seite. Niklas schweigt, wie schon im Januar bei meiner Langlaufskitortur. Neuer Versuch. Ich treffe das Brennholz an der Kante, ein paar Millimeter splittern ab. Perfekt, der hat doch was von kleinen Stücken erzählt! Ich mache hoch motiviert weiter. Um den Baumstumpf sammelt sich ein Haufen aus winzigen, kleinen und mittelgroßen Brennholzstücken, und unter meinen Thermoschichten rinnt mir der Schweiß am Körper runter. Sicher gehe ich beim Holzhacken genauso unelegant zur Sache wie beim Laufen in Tiefschnee, aber was spielt das für eine Rolle, wenn ich trotzdem zum Ziel komme?
Bevor wir das klein gehackte Holz im Ofen anzünden, empfiehlt Niklas, Birkenborke zum Brennen zu bringen und dann die kleinsten Brennholzstücke in die züngelnden Flammen zu geben. Erst wenn alles ordentlich Feuer gefangen hat, sind auch größere Scheite erlaubt. »Zum Abendessen fahren wir raus zu einer kleinen Steininsel. Ich habe dort neulich eine Nacht gezeltet«, bestimmt Niklas. Es geht also weiter raus aufs Meer mit seinem zerfahrenen Eis. Niklas hält auf eine Art Steinbank zu, umgeben von Minieisbergen. »Jetzt darfst du noch mal Feuer machen!«
Wie bestellt liegen verschieden große Stöcke und Zweige überall verteilt. Wir machen eine Art Bett aus parallel zueinander liegenden Holzstücken und grenzen die Feuerstelle rechts und links mit den dicksten Hölzern ab. »Jetzt die kleineren Äste obendrauf. Am besten die ohne viel Rinde, die ist oft zu feucht. Aber keine Vogelfedern, die stinken, wenn sie brennen!« Niklas zieht sämtliche Federn, die ich versehentlich unter das Holz gemischt habe, raus. Ich halte das Feuerzeug an die Zweige. Eine Flamme glimmt auf, erlöscht. Und jetzt? Niklas schnappt sich ein Bündel Zweige, hält es hoch und lässt es mich von unten anzünden. Feuer! Was für eine Kunst!
Niklas sucht weiteres Holz zusammen, während ich es mir auf der ausgerollten Yogamatte gemütlich mache. Als Vorspeise gibt es dünn geschnittene, geräucherte Rentierwurst, als Hauptgang gegrillte Sandwiches mit Käse und Schinken. Dafür hat Niklas ein Sandwich-Grilleisen mit langem Stil und Elchkopfmuster innen, worin er das Sandwich übers Feuer hält. Über dem Festland macht sich die in Rot-Orange gekleidete Sonne zum Untergehen bereit, hinter uns nimmt der Himmel den winter-rosalichen Farbton an, den ich schon verloren glaubte. Doch hier draußen im Archipel, über dem noch winterverschlafenen Meer, könnte man meinen, es wäre wieder Januar. Wenn es nicht gut zwanzig Grad wärmer und die Sonne schon bis 21 Uhr bleibfreudig wäre. Licht und Wärme, die Vorreiter des Frühlings. Je tiefer die Sonne sinkt, desto bunter bemalen ihre letzten Strahlen die Flauschwolken am Himmel. Ich schaue ins Feuer, das vor dem Sonnenuntergang flackert. Spüre den salzigen Geschmack warmer, gegrillter Sandwiches. Sauge den Feuerduft auf, der wieder in Haare und Klamotten einzieht. »Sekundenglück«, würde Herbert Grönemeyer singen.
Erst als der Wind auffrischt, ziehe ich den Schal enger und krame die Handschuhe hervor. Niklas will fahren, bevor die Dunkelheit alles schwarz färbt. »Bei diesem Eiszustand ist es besser, man sieht genau, wo man fährt.« Nachdem er mich vor der Stuga auf Getskär abgesetzt hat und davongebraust ist, bin ich der einzige Mensch auf der Insel. Ständige Bewohner gibt es nicht, die wenigen Stuga-Besitzer sind nicht da. Zum ersten Mal im Leben habe ich eine Nacht lang eine Insel für mich allein. Ich weiß, was meine deutschen Freunde fragen würden: Hast du keine Angst? Ich schmunzle. Wovor? Dass mich ein wild gewordener Elch überfällt? Dass sich ein Axtmörder ins Naturreservat verirrt hat und darauf wartet, dass ich mich bei unabgeschlossener Tür schlafen lege? Beim Abendessen habe ich Niklas erzählt, dass viele Menschen in meiner alten Heimat Angst vorm Alleinsein haben. Oder vielmehr vor der Einsamkeit, die sie damit verbinden. Er runzelte nur die Stirn. In einem Teil der Welt, wo Menschen Mangelware sind und die Distanzen riesig, gibt es keine Wahl. Oft und auch länger allein zu sein gehört zum Leben. Irgendwann schlummere ich auf meiner einsamen Insel ein, während der Wind an den Fensterläden rüttelt und die Holzscheite im Ofen knacken.
Am nächsten Morgen schlage ich schon um sechs Uhr die Augen auf, wie laut Niklas viele Vierbeiner und Vögel auch. Die Sonne ist schon seit vier Uhr fleißig. Nachdem das mitgebrachte Frühstück verputzt ist, schnalle ich meine Schneeschuhe unter und mache mich auf den Weg um die Insel. Am südöstlichen Ende liegt ein Fischerdorf, dessen ungefähr zehn Häuser heute als Stugor dienen und das laut Informationstafel aus dem 18. Jahrhundert stammt, samt Überresten einer Schärenkapelle. Dort sollen sich einst Fischer und Robbenjäger angesiedelt haben. Von allen Seiten piept und zwitschert es, ansonsten gehört die Insel meiner guten Freundin, der Stille. Ich setze das Fernglas an die Augen, um möglicherweise Seehunde, die sich hier draußen tummeln sollen, zu erspähen. Nichts, dafür sehe ich die sich kräuselnden Wellen des offenen Meeres. Wollte ich ein Bad nehmen, müsste ich allerdings doppelt so lange laufen wie bei Ebbe am Wattenmeer. Eine Weile sitze ich auf einem Stein, spüre, wie die Sonne mein Gesicht sommerverdächtig aufheizt.
Die Hälfte der Insel habe ich innerhalb kürzester Zeit auf dem Eis umrundet – für den Rückweg will ich es mit dem Nassschnee aufnehmen und durch den Wald stiefeln. Eine sportliche Entscheidung. Rote Linien oder Punkte an Bäumen und Steinen markieren einen Wanderweg, doch der Schnee hat ihn sich einverleibt. Immer tiefer sinken meine Beine trotz Schneeschuhen ein. Ich falle, fluche, rappele mich auf. Doch die Strapaze lohnt sich: Es gibt alle paar Meter Rentierhufspuren, Rentierkorinthen auf dem Weiß und am Schluss einen Hügel, von dem aus sich der Bootsanleger unten im Minihafen zeigt. Dort picknicke ich auf einer Bank, in Begleitung der Vogelgesänge, mit Erster-Reihe-Blick über das Langschläfereis und auf andere Inselchen, deren noch nackte Bäume im Licht baden. Würde mir jemand in diesem Augenblick erzählen, ich wäre der einzige Mensch auf der Welt, würde ich es glauben. Als Niklas mich eine Stunde später abholt, möchte ich ihn am liebsten wegschicken und sagen, dass ich bleibe. Für unbestimmte Zeit.

Es ist Ende April, als es 2022 in Båtskärsnäs zum ersten Mal regnet. Ich strecke mein Gesicht dem Himmel entgegen, spüre das unerwartet milde Nass und sauge den Duft auf. Den Duft von feuchter Erde, den ich immer mit dem Sommer verbunden habe. Allerdings nicht lange, denn wie meine Dorffreunde prophezeit haben, regnet es im Frühling an der Küste selten. Tatsächlich warnt die Wetter-App bald vor Grasbrandgefahr, und das Feuermachen im Freien wird bereits zum Risiko, wenn manches Gras den Schnee noch nicht ganz abgeschüttelt hat. Doch der Frühling versteht den Startschuss und ab den letzten April- und ersten Maitagen keinen Spaß mehr mit teils noch nass und schwer vom Himmel fallenden Schneeflocken.
Am 30. April ist Walpurgisnacht, wenn der Winter mit Feuern vertrieben wird. Natürlich wäre ein Feuer in Schweden kein Feuer, wenn man keine Wurst darüber grillen würde. Deshalb wird schon am Nachmittag in Baskeri ein kleines Feuer am Hafen entzündet, und einige Dörfler kommen mit Taschen voller Falukorv zusammen, der wohl beliebtesten schwedischen Wurst. Sie spitzen herumliegende Äste an, spießen jeweils ein Wurststück auf und lassen es von den Flammen braun brutzeln. Noch hält das Eis auf dem Meer dicht, doch Schneemobile fahren nicht mehr darauf, zu groß ist nun die Gefahr einzubrechen. »Jetzt ist bald Islossning«, sind sich alle einig, und auf den Gesichtern zeichnet sich mehr Vorfreude als Nostalgie ab. Islossning! Ich erinnere mich an den Begriff, der bedeutet, Seen, Flüsse und Meer werden das Eis langsam los. Eine Zeit, die gleichbedeutend mit Frühling ist.
Das Wurstgrillen gegen den Winter funktioniert: Als würde der Geruch von Falukorv Eis und Schnee in die Flucht schlagen, öffnen sich schon zwei Tage später die ersten Stellen auf dem Meer. Ich schaue flach atmend zu, wie ein älteres Paar einen lebensgefährlichen Versuch unternimmt, vollgepackte Einkaufstaschen auf Schlitten über die brechende Eisschicht bis zu der vor Baskeri liegenden Insel Risön zu ziehen. »Geh nicht mehr aufs Eis, wenn du nicht unbedingt musst«, warnt mich die Frau, bevor sie ihrem Mann folgt, der einen Stab in der Hand hält, um die Festigkeit des Eises provisorisch vor jedem Schritt zu prüfen. Alle paar Sekunden sacken beide ein. Mein Herzschlag beruhigt sich erst, als sie auf der Insel angekommen sind. Susanne und Eric von der Huskyfarm auf Hindersön haben mir ja schon von dem teils wochenlangen Ausharren erzählt und dass die Insulaner erst dann wieder ans Festland kommen, wenn das Eis Platz für Boote macht. Wie fern lagen mir zu Beginn die Strapazen, die das Alltagsleben der Menschen hier begleiten können und die mir die zuckerfeine Märchenwinterwelt erst nach und nach offenbart hat. Dennoch habe ich noch nie jemanden klagen hören. »Det kommer att lösa sig«, lautet das Mantra bei allem und für alles. Alles wird sich geben.
Kaum sind der Rauch der Walpurgisnachtfeuer und der Duft von Falukorv vom Winde verweht, gehört die Luft den Möwen, als hätten sie mit dem ersten Wellensäuseln ihr Direktflugticket ans Meer gebucht. Sie sind es, die den letzten Rest Frühlingswinter aus dem Weg kreischen und ihre gefiederten Freunde zur Strandparty herbeirufen, darunter Wildgänse. Als Peter lackfressende schwarze Vogelkacke auf meinem Auto entdeckt, freut er sich: »Das ist Wacholderdrosselkacke, die kommen zu Frühlingsbeginn in Massen, kacken alles voll und sind genauso schnell wieder weg.« Ich freue mich auch. Was für eine Ehre, ein Frühlingsbeweis schwarz auf silber auf dem Auto!
Der lokale Radiosender bringt stündliche Meldungen, auf welchem Fluss in Norrbotten schon Islossning spielt – der Torneälv an der Grenze zwischen Schweden und Finnland gewinnt das Rennen, auf dem Kalixälv läuft noch der Countdown: Auf dem Eis steht ein Bötchen bereit, das die Wellen forttragen werden, sobald der Winter sie freilässt. Das Ganze lässt sich sogar via Webcam verfolgen. Am 7. Mai ist es endlich so weit: Das Eis lässt los, das Boot ist frei. Die Vögel kreischen vor Begeisterung, als wollten sie auch die Bäume, die noch die Schlummertaste drücken, aus dem Winterschlaf reißen. Denn während Moos und Gräser unter dem schmelzenden Schnee grünen, halten die Äste ihre Knospen noch verschlossen – bis auf Weidenkätzchen, deren flauschiges Weiß sich hervorwagt. »Die Natur muss sich beeilen, sie weiß, dass sie nicht viel Zeit hat«, sagt Andrea.
Nachbar Gunnar hat seine Schneeschaufel weggepackt und fängt an, im Garten zu pflanzen. »Ich war gestern beim Torneälv, manchmal war das Islossning dort richtig laut, wenn die Eisschollen aufeinandertreffen, aber dieses Jahr gab es schnell offenes Wasser«, bedauert er. Auch ins Radioprogramm schafft es der Torneälv immer wieder. Geben die Verkehrsnachrichten in Deutschland oft durch, wenn auf einer Autobahn ein Hund läuft, so berichtet P4 Norrbotten, dass eine Elchkuh bei der Kleinstadt Pajala mit ihrem Jungen aufs brechende Eis des Flusses gegangen sei, sich beide aber in letzter Sekunde hätten retten können.
Dem Torneälv und dem Kalixälv folgt das Meer. Nun verstehe auch ich, was die Einheimischen mit den Zuflüssen meinten, wo das Eis am schnellsten schmelze. Täglich schaue ich zu, wo sich die Kraft der Wellen die meisten Eisschollen einverleibt. Nach der Stille des Eises ist das Plätschern und Rauschen laut, aber willkommen. Der große Wandel, den ich gefürchtet habe, ist auf einmal genauso aufregend wie jeder kleine zuvor. Bald kann ich das Meer sogar riechen. Als ich in Italien am Mittelmeer wohnte, sagten die Menschen, im Winter rieche das Meer nicht und man erkenne den Frühling am Salzduft in der Luft. Bilde ich es mir ein, weil das Wasser des Bottnischen Meerbusens kaum Salz enthält, oder breitet sich tatsächlich ein Hauch von Meersalz über Baskeri aus? Ganz genau kann ich es nicht erschnuppern, denn alles wird überlagert vom Duft von Gegrilltem, der aus sämtlichen Gärten wabert. Sobald Plusgrade herrschen, und wenn es nur zwei oder fünf sind, haben die Home-Grills Saisonstart. Nicht nur das Leben ist kurz, sondern auch der lappländische Frühling und Sommer – also bloß keine Zeit verlieren!

Der über den Winter zusammengeschobene Schneehaufen vor meinem Haus nimmt ab wie einer auf Nulldiät, und in sämtlichen Gärten und Vorgärten kommt Krempel zum Vorschein, den man unter dem Schnee nicht einmal erahnte, sogar von Rost zerfressene Autos, die aussehen, als wären sie das letzte Mal in den 80er-Jahren angesprungen. Was machen Farbeimer neben meiner Einfahrt, waren die schon immer dort? Faszinierend, was der Winter verbirgt und der Frühling wieder ans Licht zerrt. Daneben entdecke ich immer neue Wege im Dorf, die der Schnee verborgen hat – während andere, die ich im Winter gegangen bin, eigentlich keine Wege sind! Welche Freiheit sich die Natur doch erlaubt, die menschengemachten Eingrenzungen still und leise umzukehren.
Es sind nicht allein die Vögel und Aromen aus den Heimgrills, die den Frühling ankündigen – es ist vor allem das Licht. Zwar geht die Sonne noch immer unter – Mitte Mai gegen 22 Uhr – und etwa drei Stunden später wieder auf, doch sein schwarzes Kleid hat der Himmel in die Winterklamottenkiste gepackt. Selbst in den Stunden, nachdem die Sonne hinterm Horizont verschwunden ist, bleibt der Himmel taghell-blau oder zeigen sich rosa- und orangefarbene Streifen am Horizont.
Es ist, als würde sich das arktische Leben Anfang Mai mit einer Sause aus Licht, Vogelgesängen und Wasser im Fluss und Überfluss selbst feiern, ein Sieg über Kälte, Dunkelheit und Eis. Dieses Fest reißt jeden Menschen, jedes Tier, jedes Insekt mit. Fliegen summen durchs Haus, draußen krabbeln Ameisen über die Fliesen und schleppen Krümel an geheime Orte, im Wald tanzen Schmetterlinge über noch winterfaulen Büschen, und über den Kalixälv gleiten Enten mit ihren Küken. Wo waren die im Winter? Wohl in Südschweden. Bisher wusste ich nicht einmal, dass stinknormale Enten, wie sie auch in Deutschland auf Seen und Flüssen dümpeln, Zugvögel sind. »Die Zeit der Rückkehr« – schon der Maibeginn beansprucht die samische Beschreibung des Frühlings für sich.
Die durch meinen Garten hoppelnden Schneehasen sehen nun so verschmuddelt aus wie die an Straßenrändern oder in Gärten verendenden Schneereste. Gesicht und Rücken sind bereits braun gescheckt, bald bekommt der im Winter elegante weiße Pelz die Farbe des Sommerwaldgeästs. Auch die Tierspuren, die ich so gerne im Schnee gelesen habe, verschwinden, selbst jede Art von Losung vermischt sich mit Erde und Schlamm, doch dafür knackt wieder altes Laub unter den Sohlen. Das habe ich vermisst. Kleinigkeiten, die daheim normal waren, sind nach dem arktischen Winter besonders, das Gefühl des Lebendigseins ein Geschenk. Ob ich es mir bewahren kann, während die Natur um mich herum monatelang aus dem Vollen schöpft?

Mitte Mai treibt mir die Sonne erstmals Schweißperlen auf die Stirn und fordert mich dazu heraus, das felsige Ufer in Båtskärsnäs hinabzuklettern, Schuhe und Socken abzustreifen und meine Füße in die Ostsee zu stecken. Sollte ich meinen Bikini rauskramen und ein erstes Bad wagen? Millionen kleiner Messer piksen meine Haut, es prickelt und kribbelt, bis ich nach wenigen Sekunden fast nichts mehr spüre. Ich ziehe die bläulichen Füße aus dem Wasser und lege sie auf einer von Erde besudelten Eisscholle ab, die vor den Felsen schwimmt. Zugegeben, ich habe mir das mittelmeerblau schimmernde Wasser milder vorgestellt, die noch immer auf der Oberfläche treibenden Eisschollen aus dem Blickfeld verdrängt.
Mein Traum vom ersten Meeresbad des Frühlings bleibt auf Eis liegen, aber was geht stattdessen? Der Zufall will es, dass der samische Sänger Jon Henrik Fjällgren im vierzig Kilometer entfernten Haparanda an der finnischen Grenze ein Konzert gibt. Schon lange wollte ich mir samischen Joik-Gesang anhören, der dem Jodeln verwandt sein soll und den die Samen entwickelt haben, um Natur, Tiere und Menschen zu besingen. Zwar habe ich dabei eher an einen joikenden Samen vor einer Kulisse aus Bergen und Rentierherden gedacht, aber mittlerweile ist klar, dass meine Bestellungen beim Universum so einwandfrei ankommen wie eine Nachricht beim letzten Mitspieler von Stille Post.
Der 35-Jährige trägt Samentracht, allerdings statt in den traditionell blau-roten Farben discoreif schillernd mit weißer Hose und hell-glitzernden Nutukas, den typisch samischen Schuhen, die normalerweise aus Rentierhaut bestehen. Er und seine Band heizen dem Joik ein. Die Melodien, Bässe und Kraft der Lieder erfüllen mich mit unerwarteter Freude. Oder nein, da klingt ebenso Schwermut mit, nicht zuletzt Sehnsucht. Ohne ein Wort der samischen Texte zu verstehen, habe ich Ureinwohner vor Augen, die ihre Rentierherden vor Wintereinbruch in den Bergen zusammentreiben, dabei von Schneestürmen überrumpelt werden, aber auch grüne Bergtäler, in denen sich die Tiere während der Stippvisite des Sommers dickfuttern. Zwischen den Liedern erzählt Jon Henrik – von seiner Rentierherde, von einem Schneemobilausflug in die Berge bei Schneesturm, der ihn fast das Leben gekostet hätte, von seiner Liebe und seinem Respekt für die Natur. Seine Geschichten erinnern mich an den Dokumentarfilm »Arvet och tystnaden«, »Das Erbe und die Stille«, den ich kürzlich im schwedischen Fernsehen geschaut habe, über das Erbe der Samen und deren Kampf, die Rentierzüchterexistenz für kommende Generationen zu bewahren. Über die vom Klimawandel aufgezwungenen Anpassungen der acht Jahreszeiten und die Anstrengungen, die Rentiere den Winter über am Leben zu halten. Ich denke an die Samin Katarina, die im März ebenfalls von der ständigen Neudefinition der acht Jahreszeiten berichtete.
Die Lieder, die Jon Henrik teils mit geschlossenen Augen ins Mikrofon haucht, vermitteln die Angst und die Bemühungen der Hirten um ihre Tiere. Doch wenige Minuten später erklingt der nächste Titel, mit vollen Bässen sowie einem Rhythmus, der viele Zuschauerfüße zum Tappen bringt. Ich denke an Andreas oft beschworene zwei Seiten, und für mich beschreibt der Joik genau das. Zukunftsbangen und Klimafrust gegenüber der Leidenschaft für ein seit Jahrhunderten überliefertes Erbe. Nach dem Konzert lade ich mir viele von Jon Henriks Liedern runter, denn sie sollen zu treuen Begleitern auf Roadtrips durch die Weite Lapplands werden. Um dabei mein Herz stets weiter zu öffnen für die Extreme dieses Weltendes, die mal weit auseinanderklaffen, dann wieder aufeinander zutanzen wie zwei launische Liebende, die doch nicht ohneeinander können. Dunkle Winter, helle Sommer. Monatelanges Stillhalten, dann eine Explosion an Leben.
Wie jetzt im Mai, dem Kälbermonat, wie er bei den Samen heißt, weil die Rentierkälber zur Welt kommen. »Der Mai ist das samische Neujahr«, erzählt mir der Rentierzüchter Ber-Joná Labba, ein fast gleichaltriger Freund Jon Henriks. Er kommt aus dem Samendorf Könkämä, Schwedens nördlichster Samengemeinschaft, und hat bereits mit elf Jahren das Kälbermarkieren von seinem Vater gelernt. »Zuerst haben wir es lange mit Birkenstücken probiert, bis ich mich an ein Tier gewagt habe«, gibt er zu, und dass er erst nach etwa einem Jahr sicherer geworden sei. »Die Kälber werden ungefähr um den 19. Mai geboren, und wir freuen uns riesig darauf. Mein achtzehnjähriger Bruder hat sogar entschieden, keine Ausbildung zu machen und nicht zu studieren, obwohl er hochintelligent ist. Er will sich der Rentierzucht widmen.«
Im Gegensatz zu vielen Samen seiner Generation sind Ber-Joná und seine Geschwister mit Nordsamisch als Muttersprache aufgewachsen, das Schwedische habe er erst mit sechs Jahren gelernt. Das Sommerweideland seiner Rentiere erstrecke sich bis in die norwegische Bergregion, berichtet er, wobei Rentiere immer denselben Ort aufsuchten, um ihre Kälber zu gebären, und höher gelegenes Terrain vorzögen, um Raubtiere leichter zu erspähen. »Andererseits kann es dort windig und kalt sein. Wir bangen um das Wetter im Mai. Kommt Schneesturm auf, ist das ganz schlecht, zu kalt auch, dann erfrieren die Kälber. Am besten ist Nebel, damit Adler die Jungtiere nicht so gut sehen.«
Als ich einige Tage später auf dem Weg nach Jokkmokk Rentiere am Straßenrand bemerke, fallen mir große Geweihe auf den meisten Häuptern auf. Wie war das noch? Die Männchen werfen ihr Geweih im Herbst ab, während die Weibchen ihres behalten, solange sie trächtig sind. Ich schaue genauer hin. Sind das nun Männchen, deren Geweihe schon nachgewachsen sind? Dann haben die alle Bierbäuche! Wahrscheinlicher ist, dass das trächtige Kühe sind, denn die Geburt der Kälber steht kurz bevor. Die Vorfreude der Samen greift auf mich über, und ich begreife, warum die Kälbergeburt für die Ureinwohner eine Art Neujahr ist.

Bevor sich das Eis ganz verflüssigt, möchte ich wie viele Norrbottener eine Bootsfahrt unternehmen und erleben, wie man die kleinen Eisschollen dabei vor sich herschiebt. Im Internet kursieren Fotos von Leuten, die vom Boot auf eine Eisscholle hüpfen und sich darauf ablichten lassen. Das will ich auch und stelle mir schon vor, mit was für tollen Bildern ich meine Social-Media-Kanäle bestücken werde. Niklas, der sein Schneemobil gegen ein Boot eingetauscht hat, nimmt mich auf eine Morgenrunde mit. Und dann? Die Natur hat keine Lust auf Social-Media-Quatsch. Das Eis ist weg! Tiefblau und ruhig breitet sich der Bottnische Meerbusen vor uns aus, das Boot flitzt über die sommerlich in der Sonne schillernde Wasseroberfläche. Niklas sieht mich entschuldigend an. »Es war zu viel Wind, der hat das Eis weggeblasen.« Das schöne Eis – vom Winde verweht. Von einem Tag auf den anderen. Ich bin entsetzt. »Geht das immer so schnell?« Niklas zuckt mit den Achseln. Manchmal blieben die Eisschollen gut zwei Wochen liegen, dann wieder verschwänden sie ruckzuck. Ein Zusammenspiel von Wind und Temperaturen. Keine Frage, der Frühling Lapplands kommt mit Zeitrafferfunktion, ohne Erbarmen für alle, die nicht heute leben, sondern erst morgen damit anfangen wollen.
Niklas versucht, die Sache mit dem verschollenen Eis wiedergutzumachen und steuert eine unbewohnte Schärengarteninsel an, die kaum 300 Meter lang und 100 Meter breit sein dürfte, mit steinigem Ufer und knorrigen Bäumen. Er hat zwei Seehundköpfe im Meer davor gesichtet, doch die Tiere lassen sich nur durchs Fernglas ausmachen. An Land entdecke ich mehrere Haufen mit Schokoladeneiern am Boden, die auf den ersten Blick zum Naschen einladen. »Das ist Elchlosung! Wenn das Meer vereist ist, spazieren die Elche von Insel zu Insel«, erklärt Niklas, und ich stelle mir einen Elch vor, der wie ich im Winter Inselhopping unternimmt.
Niklas will prüfen, ob sich meine Feuermachkünste seit der Lektion auf Getskär verbessert haben. Gemeinsam sammeln wir Borke und trockene Äste und suchen uns eine Stelle zwischen den Steinen, wo das Feuer nicht zu nah an Gräser und Bäume herankommt. Mein Feuerlehrer klopft mit einem dicken Ast auf die Steine. »So stellst du fest, ob das Holz hart oder weich ist. Wenn es hart ist, ist es auch trocken und eignet sich gut als Brennholz. Wenn es weich ist und dumpf klingt, ist es feucht.«
Ich zünde das trockene Geäst an und lege schnell größere Stücke nach, damit sich meine Bemühungen nicht sofort in Rauch auflösen. »Schichte das feuchtere Holz dort auf, wohin der Wind bläst, dann fängt auch das Feuer«, erklärt Niklas und bringt die dumpf klingenden Äste. Während er Tomaten und Zwiebeln für die Hamburger aufschneidet, sehe ich auf den Wellen treibenden Kanadagänsen nach und schaue dem Flug der Küstenseeschwalben über uns zu. »Das sind die Zugvögel, die die längste Strecke zurücklegen, denn sie verbringen den Winter am Südpol.« Ich weiß nicht, was ich mehr genieße – in den saftigen Hamburger zu beißen oder mich diesen Wildvögeln nahe zu fühlen. Diesen Nomaden des Himmels, die anders als Rentiere, Elche und andere bodenständige Tiere Jahr für Jahr weit reisen, um zu überleben. Sie erwecken erstmals in über vier Monaten einen Funken der ansonsten fest in mir verankerten Reiselust.

Wenn sie erst einmal aufflammt, meine Lust auf Reisen, dann lege ich auch da schnell Scheite nach. Deshalb steht das Auto schon am Abend nach der Bootstour beladen mit Zelt und Schlafsack, Matratze und Rentierfell, warmen Klamotten, jeder Menge Essen und Wasserkanistern bereit. Am nächsten Morgen geht es los – in das Bergdorf Ammarnäs in der Region Sorsele, im tiefen Westen Schwedisch-Lapplands. Wie mir alle gesagt haben, ist es für mögliche Wanderungen in den bergigen Nationalparks Sarek oder Padjelanta noch zu früh, überall liege noch Schnee, und wenn der schmelze, entstünden eine Menge teils unpassierbarer Flüsse. Doch ich möchte raus, mein neues Zelt testen. Mich einen Schritt weiter in die Natur Lapplands hineinwagen.
Ich bin nicht mit Camping- oder Wanderurlauben groß geworden, habe erstmals mit 22 Jahren in einem Zelt geschlafen und war erst mit 26 auf einem Berg von 2962 Meter Höhe – per Lift zur Zugspitze. Obwohl ich als auf Naturthemen spezialisierte Reisejournalistin viel dazulernte, an Expeditionen in die Wildnis teilnahm und das Wander- und Zeltleben lieben lernte, habe ich riesigen Respekt vor der Natur und übe mich seit Januar darin, mich ihr Stück für Stück zu nähern. Ich möchte nicht mir und anderen beweisen, wie resistent ich bin, verfolge vielmehr das Ziel, meine Komfortzone im Einklang mit meiner eigenen Natur zu erweitern. Das heißt auch, sie muss nicht gleich vom Nord- zum Südpol reichen. Ich peile drei Nächte im Zelt an, bei starkem Regen auch im Kombi.
Etwa 435 Kilometer sind es von meinem Dorf bis in das noch kleinere Ammarnäs mit gut hundert Einwohnern, etwa sechs Stunden brauche ich. Immer wieder bremsen mich Rentiere an der Straße aus. Eigentlich sollten die Tiere längst in die Berge gezogen oder von ihren Besitzern dorthin gebracht worden sein, aber einige scheinen sich der Routine Jahr für Jahr zu entziehen. Oder sie ziehen später um. Ob sie ihre Kälber auch in tieferen Lagen gebären? Ich erinnere mich, dass die Kälberzeit für Rentierkühe die sensibelste Periode des Jahres ist und sie Ruhe brauchen. Selbst ihre Besitzer geben ihnen Zeit, bevor sie die Tiere erneut im Frühlingssommer oder Sommer zusammentreiben und die Kälber so weit schon möglich markieren.
Ich nehme mir Zeit, die Rentiere zu beobachten, zuzuschauen, wie sie sich mit den Hinterhufen kratzen und Ballen ihres Winterfells auf die Straße segeln. In Letzterem sahen sie attraktiver aus als mit dem Frühlingsfell voller Kahlstellen dort, wo es wohl zu viel gejuckt hat. Die Schneehasen sehen ähnlich aus. Die Schönheit des Winters verflüchtigt sich nicht nur in Form von Schnee und Eis, sondern auch mit dem Fell der Tiere. Flauschig und dicht ist gerade nicht mehr in.
Ammarnäs begrüßt seine Besucher mit einem großen Välkommen-Schild über der Straße und dem Fluss Vindelälv, der die Farbe des Himmels nachahmt und sich durch Weiden windet, die vor Wasserüberschuss strotzen. Dörfler sitzen vor dem Minisupermarkt auf Bänken und schlürfen Kaffee aus Pappbechern, während sich das Kaffeearoma in der Luft mit dem Holzduft der Kirche vermischt. Dabei ist die Holzkirche, die in der Sonne glänzt, als wäre sie gestern neu gestrichen worden, nicht einmal die Hauptattraktion des Dorfes. Das ist der Potatisbacken, der Kartoffelhügel. Auf dessen Südseite werden seit Mitte des 19. Jahrhunderts Kartoffeln angebaut, da sie dort nicht so schnell erfrieren, wie ein cleverer Dörfler herausfand. Über einen schmalen Weg besteige ich den Hügel, wo zwei Grillstellen mit Weitsicht über Dorf, Fluss und verschneite Berge zum Auspacken von Hamburgern oder Würsten einladen. Aber noch nicht, ich möchte erst noch etwas weiterfahren.
Das schwedische Jedermannsrecht erlaubt es unter anderem, auf nicht landwirtschaftlich genutztem Boden und jenseits der unmittelbaren Nähe zu einem Haus zu zelten – das möchte ich ausprobieren. Doch wie findet man einen schönen wilden Zeltplatz? Für meine erste Nacht beantwortet sich die Frage von selbst, als ich auf die Karte von Ammarnäs schaue. Vom Dorf führt eine meist einspurige Straße bis zu einem See, dem Tjulträsk. Ich träume davon, dort auf ein Stück Gras zu stoßen, wo ich mein Nachtlager aufschlagen kann. Ob mein Wunsch dieses Mal beim Universum ankommt?
Auf den neun Kilometern werde ich abgelenkt von Stromschnellen des Vindelälv, die beidseitig einer kleinen Brücke frühlingsfreudig sprudeln. Und von einem Reh, das über die Leitplanke lugt. Das Tier schaut nach links und rechts wie ein in Verkehrssicherheit gut erzogenes Kind, dann steigt es über die Abtrennung und läuft die Straße hinab. Wenige Meter weiter ist die Landschaft wieder weiß. Das gibt es doch nicht! Nur plätschernde Bäche weisen darauf hin, dass auch hier der Frühling seinen Einzug vorbereitet. Dann bin ich am Ende der Welt. Zumindest am Ende der Straße. Auf einem Parkplatz stehen zwei verwaiste Autos und Schneemobile, weiter unten muss der Tjulträsk sein. Ich gehe zum Wasser. Das erhoffte Seebad kann ich vergessen – mich erwartet eine Eisschicht. Doch wie bestellt findet sich am Ufer ein Grasstreifen samt Picknickbänken, Tisch und sogar einer Grillstelle. Mein Herz hüpft. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Die Natur macht mir den Einstieg ins frühlingshafte Outdoorleben leicht. Ich schleppe Zelt, Schlafsack, Rentierfell und alles, was ich für meine erste Nacht im Freien brauche, runter an den See, baue das Zelt auf und ziehe Jacke und Pulli aus, so sehr heizt mir die Sonne ein.
Wie gerne würde ich auf den Aussichtshügel hinterm See wandern, aber schon auf dem ersten Meter verleibt sich der Matschschnee meinen Unterkörper ein. Egal. Die Natur mag mir in den Bergen wieder die Bewegungsfreiheit rauben, aber sie schenkt mir Zeit. Zum Nichtstun. Den Actionmodus des Frühlings kurz runterdrehen. Ich liege dumm auf meinem Rentierfell rum und grinse die Berge an, die mich an den Nationalpark Stora Sjöfallet erinnern und hinter denen sich die Sonne langsam verkriecht – ohne ihren Lichtvorrat jedoch ganz mitzunehmen. Als der Magen knurrt, heißt es Äste zusammensuchen und Feuer machen. Ich versuche, Niklas’ Lektionen zu beherzigen, trotzdem entsteht viel Rauch um nichts. Was habe ich falsch gemacht? Waren die Äste doch zu feucht? Ich sammle trockenes Gras. Das Burgerfleisch über der Glut pappt am rostigen Grilleisen fest, und ich kratze es aufs Brot. Tatar-Burger am Tjulträsk. Jeder grillerfahrene Schwede würde den Kopf schütteln.
Kalte Füße und Hände zwingen mich, es nochmals mit den feuchten Ästen und Zweigen aufzunehmen. »Wenn das Feuer nicht groß ist, ist man keine richtige Frau«, sporne ich mich in Erinnerung an Niklas’ Worte im Januar an, auch wenn es in seinem Satz um einen Kerl ging. Als die Flammen endlich Appetit auf den Haufen an Holzzeugs bekommen, entledige ich mich meiner Schuhe und strecke Füße und Finger gen Feuer aus. Wenn ich doch auch in der Stadt mehr anpacken und weniger grübeln würde. Hier ist es leicht – mir ist kalt, ein Feuer muss her. Da druckse ich nicht rum, ob das geht oder nicht, ob ich es auf morgen verschiebe oder generell zu blöd dazu bin. Ich mache weiter, bis es klappt. Aufgeben geht nicht, sonst bleiben die Füße kalt, und kalte Füße sind doof. Wenn die Flammen schwächeln, blase ich in die Glut. Das Feuer und ich spielen ein Spiel: Immer wenn es die Lust verliert, schenke ich ihm frischen Wind. Solange da noch etwas glimmt, können sich die Flammen jederzeit neu entfachen.
Mit vollem Bauch und warmen Füßen plumpse ich aufs Rentierfell vor dem Zelt. Schaue in den Himmel und vernehme neben meinem ebenmäßigen Atem das Zwitschern der Vögel. Als wollte jeder von ihnen die Frühlingsfreude seiner Kumpels übertönen. Gerne würde ich diesen Augenblick mit jemandem teilen. Nicht so sehr, weil mir Begleitung fehlt, sondern weil ich mein eigenes Glück in den Augen eines Menschen, den ich liebe, widergespiegelt sehen möchte. Ich atme den Moment mit jedem Atemzug ein und lasse ihn nur zögerlich wieder raus. Freiheit! Diese Natur, die mich nicht herausfordert, sondern anfängergerecht gewähren lässt. Dieses Gefühl, genug zu haben. Genug Kleidung, Wasser, Essen, Wärme. Sogar ein Kunststoffdach über dem Kopf, das ich da aufbauen kann, wo es mir gefällt. Ich könnte schreien vor Glück. Nein, ich könnte nicht. Ich tue es!
Gegen 23 Uhr mache ich Schluss mit dem Tag, streife Thermounterwäsche und Schlafanzug über und verkrümele mich in meinen Schlafsack mit Minimaltemperatur von minus sechs Grad und unter zwei Wolldecken. Das Rentierfell liegt als zusätzliche Isolierschicht unter der aufblasbaren Campingmatratze. Herrlich, nur durch Plastikwände von der Natur getrennt in den Bergen herumzuliegen. Mich von Vögeln, die bei fast Dauerhelligkeit wohl nicht mehr schlafen, in die Träume singen zu lassen. Ich schlummere weg.
»Quak, quak!« Meine Güte, was ist das? Ich schiebe die Schlafmaske hoch. Ein Uhr. »Quak, quak!« Von rechts neben dem Zelt. Eine Ente. Steht da nicht die Tüte mit den Haferflocken fürs Frühstück? Ich bin müde, soll die Ente doch reinhauen und still sein. Was sie auch ist. Eine Minute lang. »Quak, quak!« Die will bestimmt ins Zelt, aber darin friere ich mittlerweile genauso wie die Ente wohl draußen. Ich streife Skihose und Fleecepulli über und schlüpfe zurück in den Schlafsack. Doch ganz schön kalt mit so hauchdünnen Wänden. Ich bibbere mich zurück in den Schlaf. »Quak, quak!« Die Ente ist auf die andere Seite gewatschelt. Verdammtes Vieh! Das macht die extra, um mich zu ärgern! Zehn weitere quakerfüllte Minuten später verstehe ich, warum viele Norrbottener so jagdversessen sind, vor allem auf Vögel. Das hat ganz sicher mit jemandem begonnen, der im Frühling an einem See zeltete. Bevor es zu Handgreiflichkeiten am Tjulträsk kommt, krame ich Ohropax aus dem Rucksack. Peinlich, erste Nacht in der Natur mit Ohropax, weil die Vögel zu laut sind. Aber ich bin vom Winter stilleverwöhnt, muss mein Gehör erst an die Dauerkonzerte des Frühlings gewöhnen.
Übermüdet wache ich gegen sieben Uhr auf. Die Sonne strahlt von hinten aufs Zelt, wärmt meine noch nachtfröstelnden Glieder. Das Frühstückmachen wird zu einem Akt der Langsam- und Achtsamkeit. Zum ersten Mal nehme ich meinen winzigen Campinggaskocher in Betrieb. Doch warum kokelt der Tisch und kocht nicht das Wasser im Kessel? Huch, falsch herum aufgestellt! Bald kocht das Wasser, und ich schlürfe meinen ersten Tee zu Müsli mit Obst und Haferflocken, die die Ente mir großzügigerweise gelassen hat. Jetzt, wo ich bereit wäre zum Austausch mit ihr, lässt sie sich nicht blicken. Sonnenstrahlen streicheln meinen Rücken. Seit einem Wochenende in einem Schweizer Luxushotel vor Jahren habe ich nicht mehr mit so feinem Erste-Reihe-Bergblick gefrühstückt. Nur dass er dieses Mal keinen Cent kostet.

Als alles wieder im Auto verstaut ist, geht es gut drei Stunden weiter Richtung Arjeplog. Ob der Schnee dort bereits geschmolzen ist und ich einen der an die 700 Meter hohen Aussichtsberge erklimmen kann? Wieder fährt mein Blick über Flüsse und zahllose Seen, über Wasserfälle, die sich von Felsen stürzen, über stark nach Sommerfell aussehende Rentiere am Straßenrand und vereinzelte Häuser, die sogenannte Straßendörfer bilden. Ich lausche Jon Henrik Fjällgrens Joiks und fühle mich nicht, als würde ich fahren, sondern vielmehr fliegen.
Schaut man auf die Karte, ist Arjeplog eine der wasserreichsten Regionen Schwedisch-Lapplands. Kleine und große Seen wechseln sich ab, und einige Autofirmen nutzen die im Winter zugefrorenen Seen, um Fahrzeuge oder -teile auf ihre Wintertauglichkeit zu testen. Das Städtchen mit seiner rosafarbenen Kirche begrüßt mich bei fünfzehn Grad und Sonne, die Kälte der vergangenen Nacht ist eine ferne Erinnerung. Erst Stunden später, als es an der Zeit ist, mir einen weiteren schönen Ort zum Campen zu suchen, raufen sich schwarze Wolken über dem Ort zusammen. Wieder hilft die Methode der ersten Nacht – ich studiere eine Karte von Arjeplog und Umgebung auf Wege, die im Nichts enden. Oder an einem See. Bingo! Wenige Kilometer außerhalb endet ein schlaglochgesegneter Pfad an einem Parkplatz, wieder steht eine Grillstelle bereit, wieder will auf einem Stück Rasen ein Zelt aufgebaut werden. So weit, so perfekt. Im Rhythmus des Windes, der mir in den Rücken und die Wolken in meine Richtung bläst, baue ich das Zelt auf und entfache ein Feuer, um mir etwas Warmes zum Abendessen zu machen. Kalte Sandwiches oder Schokoriegel? Nicht in Lappland! Ohne ordentliches Feuer und etwas, das darüber brutzelt, läuft nichts mehr!
Die Flammen schießen bei der steifen Brise so begeistert in die Höhe, dass das Schilf nebenan beinahe mit abgefackelt wird, und der Huhn-Käse-Tortilla-Wrap ist so schnell warm, dass es an diesem Tag um 17:30 Uhr Abendessen gibt, also zu typisch schwedischer Zeit. Kaum ist das Gegrillte verputzt, sind auch die Wolken weg.
Obwohl meine Augen nach der »Entennacht«, wie ich sie fortan nenne, zufallen, kann ich mich nicht trennen. Von einem Stein am Seeufer, auf dem mich um 22 Uhr die noch hoch am Himmel lachende Sonne verwöhnt. Wieder sind es Vögel, die die Stille mit ihren vor Freude strotzenden Stimmen durchbrechen. Wie gerne würde ich den Tieren ein wenig ihrer Energie rauben, wie gerne würde auch ich nicht mehr schlafen, um jede Sekunde des Lichtüberschusses aufzusaugen. Aber mein Körper besteht auf seinen sieben bis acht Stunden Ruhe. Also verschwinde ich gemeinsam mit der ersten Mücke ins Zelt und schlafe dieses Mal durch, bis es in den Morgenstunden auf mein Zelt klopft. Nein, es trommelt. Der für den vergangenen Abend angekündigte Regen hat sich wie vieles in Norrbotten verspätet. Ich bleibe liegen. Schaue zu, wie sich Mücken über meinem Innenzelt absetzen und auf Frühstücksblut warten. Lausche einem Kuckuck, der prahlt, wie topfit er schon ist. Und dem üblichen Kanon der Vögel, bei dem die meisten Sänger ihr Notenblatt verloren haben. Bei dem schrägen Gesang ergreift sogar der Regen die Flucht.
Was soll ich mit dem Tag anstellen? Doch den Versuch unternehmen, zumindest einen halben Aussichtshügel zu erklimmen? Auf der Fahrt in Richtung des Naturreservats Akkelis mit einem 784 Meter hohen Berglein habe ich längst entschieden, es nochmals mit dem Schnee aufzunehmen. Mit ein wenig ihrer Power haben die Vögel mich angesteckt. Ich will raus, weiter rein in die erwachende Natur. Nicht auf die höchsten Gipfel, lieber tiefer hinein statt hoch hinauf, um zu spüren, zu beobachten. Das ist für mich der Rhythmus der Natur. Der Pfad verspricht viel – der Schnee ist weg! Auf den ersten zehn Metern. Dann erwartet er mich in der vertrauten weiß-erdigen Schmuddelfarbe mitten auf dem Wanderweg. Zunächst weiche ich ihm aus, springe sogar über einen aus Schmelzschnee geborenen, kräftig rauschenden Bach. Plötzlich verschwinden auch noch die roten Baummarkierungen, die den Weg nach oben weisen. Ich verlaufe mich zwischen den Bäumen, sinke wieder potief ein und spüre, wie sich der Schnee in meine Wanderstiefel arbeitet. Wenn etwas in der Natur das Loslassen noch lernen muss, ist das dieser Schnee!
Eine Lichtung ist erreicht, von dort geht es einen Schneehügel steil nach oben. Ich schnaufe durch. Der Schnee kann mich mal, ein Stück schaffe ich noch! Und tatsächlich komme ich bis knapp über die Baumgrenze, aber dann geht gar nichts mehr – vor mir wälzt sich ein Teppich aus blickdichtem Matschschnee den Hügel hoch, der andernfalls in wenigen Minuten erklommen wäre. Immerhin habe ich mir einen Blick über die Seen erarbeitet – und fahre zusammen: Wolken so schwarz wie der lappländische Dezemberhimmel haben sich über Arjeplog versammelt und ein klares Ziel: mich. Ich stöhne, hätte so gerne mit ein wenig Weitblick meinen Lunch vertilgt und Tee getrunken. Nichts da. Der Wind pustet, und ich weiß, was das bedeutet.
Wind und Regen treiben mich mit knurrendem Magen vom Berg hinunter, zurück in den Klammerschnee, der immer lauter in meinen Wanderstiefeln schmatzt. Ein kurzes, schneefreies Stück, das ich glaube, hochgekommen zu sein, endet in Gestrüpp. Die Technik muss helfen. Ob ich es irgendwann ohne schaffe? Ich klicke auf die Norrbotten-App mit Wanderwegen, finde dank ihr zurück zu einem Punkt, ab dem ich meinen eigenen Spuren im Schnee folgen kann. Und der Losung von Tieren, den anscheinend Einzigen, die sich in den letzten Monaten hergetraut haben. Elch- und Rentierhinterlassenschaften kann ich mittlerweile identifizieren, dazu kommen Hirsch, Fuchs, Hasel- und Birkhuhn, wie mir Niklas später erklärt.
Irgendwann sitze ich im Auto. Selbst die Unterwäsche ist klamm. Habe ich einen Gipfel erklommen? Nein. War ich zu ungeduldig und habe dem Frühling zu viel abverlangt? Vielleicht. Aber ich bin nicht enttäuscht, nicht einmal vom durch die Wolken versauten Picknick. Gebe mich stattdessen zufrieden mit dem, was ging. Ein schönes Gefühl. Und so beschließe ich, auf eine weitere Zeltnacht zu verzichten, da sich auch die anderen Berge der Umgebung noch schneestörrisch zeigen werden. Genug für die erste Freiluft-Full-Immersion des Frühlings.
Ich gebe meine Adresse ins Navi ein. Manch einer würde sagen, dass ich gescheitert bin, weil ich meinen Plan nicht durchgezogen habe. Ich sage, dass ich mir etwas gönne – Freiheit. Und Geduld. Mit der Natur, mit mir. Denn wenn mir mein Bauchgefühl sagt, dass es an der Zeit ist heimzufahren, dann gehört auch das zur Natur. Meiner Natur. In deren Rhythmus ich hier immer öfter lebe, anstatt dem gewohnten Motto zu verfallen: »Jetzt bin ich schon mal hier, also muss ich auch so viel wie möglich machen.« Dem folge ich in der Stadt. Ich bin eine Meisterin des Zeitmanagements und kann hochwirksam arbeiten, einkaufen und all das verbinden, was auf der Strecke liegt, um keine Minute zu verschenken. Egal, wenn mir nicht danach ist, ich lieber einen Abstecher einlegen, vom Hamsterrad abspringen würde. Doch in Lappland habe ich viele Routinen zurückgeschraubt. Um mich mit der Strömung dessen zu bewegen, was möglich ist und wonach meine Sinne streben.
Je näher die Küste kommt, desto grüner sind die Bäume. Innerhalb von drei Tagen haben sich alle Knospen geöffnet, strecken sich hellgrüne Blättchen der Sonne entgegen. Keine Sekunde zu früh, keine zu spät. Ich fand die Bäume lahmarschig, doch sie wissen schon, was sie tun. Haben die letzten kalten Nächte abgewartet, damit ihr zartes Grün nicht sofort erfriert. Klimawandel hin oder her, meist weiß die Natur am besten, wann die Zeit für was gekommen ist.

Nicht nur die Bäume überbieten sich nun gegenseitig an Grün, auch das bisher stille Dorfleben von Baskeri erblüht: Wo zuvor Schneehaufen lagen, stehen Motorboote startbereit in den Gärten. Nun verstehe ich, warum die Autos im Winter vor den Garagen zugeschneit wurden: Drinnen war kein Platz, sie waren von Booten besetzt. Boot vor Auto, Luxus vor Gebrauchsgegenstand. Denn so viel Rost, wie manche der vierrädrigen Fahrzeuge angesetzt haben, weist kein Boot auf. Die Autos finden auch in den wärmeren Jahreszeiten keinen Platz im Garageninneren, denn darin sind nun die Schneemobile verstaut. Fast vermisse ich ihr Geknatter schon. Außerdem fehlt mir etwas, das ich nicht erwartet habe: ein wenig Dunkelheit! Nicht nur, dass mir ohne Blick auf die Uhr unklar ist, wann ich ins Bett soll, ich vermisse auch den Nachthimmel. Einen grell leuchtenden Mond. Und Sterne! Im Winter habe ich den wenigen Stunden Tageslicht entgegengefiebert, nun sehne ich etwas Schwärze am Himmel herbei, freue mich, wenn es abends bewölkt ist und eine Illusion von Dämmerung aufkommt. Ich spüre, dass in mir die Sehnsucht nach Dunkelheit genauso verankert ist wie die Liebe zum Licht. Fallen beide zu lange aus dem Gleichgewicht, werde ich anscheinend unruhig. Ob es mir im Herbst mit der Dunkelheit genauso ergehen wird?
»Der Frühling ist die beste Zeit, die Häuser neu zu streichen, er ist am trockensten«, erklären die Dörfler. »Geh mal morgens mit Socken übers Gras, du wirst sehen, sie werden nicht feucht. Aber wenn du das nach Mittsommer tust, bekommst du nasse Füße.« Ich probiere es aus. Die Socken bleiben trocken. Doch es sind nicht nur Gerüste, die an manchem Haus hochgezogen werden – auch Mückennetze zieren Fenster und Eingangstüren. Kaum sitze ich an einem mit dreizehn Grad besonders warmen und windstillen Abend auf der Veranda, summt es. Ich grinse, als die Mücke, die aussieht, als hätte sie mindestens fünf der mir aus Hamburg bekannten Mückchen verspeist, an dem mit Magneten selbstschließenden Netz vor meiner Haustür abprallt. Pech gehabt! Ich allerdings auch, denn später zieren trotz aller vorbeugenden Maßnahmen juckende Beulen meine Beine und Füße. Wann die Samen den Frühlingssommer in diesem Jahr einläuten, weiß ich nicht, aber für mich ist die Sache klar: Er beginnt am 24. Mai, mit dem Einzug der Mücken. Der Klang des davonziehenden Frühlingswinters, das Prickeln des in der Sonne schmelzenden Eises, war eindeutig romantischer als das Surren. Doch so penetrant mich die Mücken anzapfen, so bringen sie auch eine Erkenntnis mit: Ich bin wieder drin. Im Kreis des Lebens, der sich fortwährend dreht. Ich nehme mir vor, die Dunkelheit nicht mehr herbeizusehnen, weil sie ohnehin zurückkehren wird, das ist so sicher wie Falukorv im Grillgepäck eines Schweden. Also öffne ich mich für das immerwährende Licht der kommenden Wochen, auf dass es mich mit ähnlicher Energie erfüllen möge wie meine Nachbarn und die Vögel. Wie manche Quasselente. Der ich nach einer Mütze voll guten Schlafs vergebe.