– Was habt ihr euch angesehen
fragt Mutter.
Mutter sitzt in einem Schaukelstuhl. Ich erzähle, dass ich Kanonen gesehen habe, aufgereiht auf einer Festungsmauer. Wenn sie losgehen, werden sie garantiert die ganze Stadt erschüttern. Es waren schwarze Kanonen, sage ich. Obwohl wir Sommer haben und wir mittags dort waren, fühlten sich die warmen Kanonen angenehm an, wie schlafende Vulkane. Im Inneren des Vulkans brodelt Lava, aber der Vulkan schläft.
Mutter hat andere Kanonen kennengelernt, die waren nicht warm, sondern brennend heiß. Sie waren auch keine schlafenden Vulkane, sondern hellwach. Diese Kanonen sprengten wannengroße Krater in das Olympiastadion. Diese Kanonen steckten ein ganzes Feld Pfirsichblüten in Brand. Am Bahnhof lagen überall verstreut einzelne Schuhe auf dem Boden (wer über den Südbahnhof ankam, kannte das).

Eine Mutter rief nach ihrem Kind. Das Kind trug seinen eigenen Stoffbeutel, mit seinen eigenen Anziehsachen darin und Essen für ein paar Tage. Auf dem Mantel des Kindes war ein Stück weißer Stoff aufgenäht, auf dem in schwarzer Tinte Namen standen. Der Name des Kindes, die Namen der Eltern. Außerdem stand da das Geburtsdatum Jahr Monat Tag, Geburtsort und eine Adresse, deren Schicksal niemand kennt (wer über den Südbahnhof ankam, kannte das).
– Hast du den Sonnenaufgang gesehen
fragt Mutter.
Habe ich nicht. Ich bin nicht auf den Berg gestiegen, um den Sonnenaufgang zu sehen. Weil der Himmel sich verdunkelte. Ich werde niemals in der Lage sein, mein Schicksal vorherzusagen. Als wir die Festung verließen und den Kanonen Auf Wiedersehen sagten, stiegen wir einen anderen Hügel hinauf. Wir wanderten noch einmal vier Stunden lang. Es fing an zu regnen, Nieselregen, der wie ein nasses Netz über unseren Köpfen hing. Wegen des Regens stiegen wir nicht auf einen höheren Berg, um uns den Sonnenaufgang anzusehen.
Den Sonnenaufgang betrachten heißt nach Hoffnung suchen, sagt Mutter. Wer den Sonnenaufgang sehen will, steht kurz nach drei Uhr auf. Ringsum herrscht endlose Leere. Man drängt sich in Gruppen zusammen und folgt, mit der Taschenlampe in der Hand, dem Führer den Berg hinauf. Obwohl alle warm angezogen sind, klagen sie: Oh, ist das kalt. Dabei haben wir August, es ist mitten im Sommer.
Alle warten oben auf dem Gipfel, ein Gipfel umgeben von Bergketten. Zuerst erhellen sich die fernen Wolken, man könnte meinen, es sind Abendwolken. Dann, wenn die Wolken in leuchtenden Farben erstrahlen, taucht plötzlich die Sonne auf, schwebt über einem Bergsattel.
Niemand kann sagen, welche Form die Sonne hat, ob sie rund oder eckig ist, ihre Strahlen blenden so sehr, dass man nicht genauer hinsehen kann. Man bekommt nur eine vage Vorstellung vom Aussehen der Sonne, sie erinnert an ein mit enormer Geschwindigkeit rotierendes Farbenspektrum.
Mutter liebt den Sonnenaufgang am Meer; am frühen Morgen am Ufer sitzen und in den weißen Himmel starren, so weiß, dass er beinahe durchsichtig ist. Es dämmerte bereits, es war etwa sechs Uhr früh. In der Ferne stieg ein weißer Ball aus dem Meer auf. Mit einem Mal schoss er aus dem Wasser heraus, als hätte er sich seinen Weg aus den Tiefen gebahnt, und verursachte dabei hoch aufspritzende Fontänen. Etwa so, wie wenn jemand ein Reisklößchen aus einer Suppenschüssel herausfischt. Der weiße Ball war alles andere als glänzend, wie ein Schneeball, wie ein frisch gekneteter Fladen, bevor er in den Ofen kommt. Der weiße Ball erinnerte an den Mond, der langsam aus dem Meeresspiegel emporsteigt, wie eine endlose Serienaufnahme des Mondaufgangs. Der weiße Ball am Horizont wirkte so zart, so blass; aber dann plötzlich sendete er blendende Strahlen aus, und kein Auge konnte ihn mehr sehen.
Ich habe den Sonnenaufgang nicht gesehen. Wir zelteten auf einer Ebene auf dem Gipfel. An diesem Tag kochten wir Gemüse, das wir auf den Feldern gepflückt hatten, an denen wir vorbeigekommen waren. Wir pflückten auch Papayas. Es nieselte, und wir streunten ein bisschen herum. Auf den Teeplantagen in der Nähe reckten die Teesträucher ihre vielen kleinen Triebe, und die jungen Teeblätter wirkten im Regen so frisch und grün wie Blattgemüse; die alten Teeblätter waren dagegen sehr dunkel.
– Was hast du noch gesehen
fragt Mutter.
Sachte fächert sie sich mit ihrem Strohfächer Luft zu. Ich erzähle ihr, dass ich Strafgefangene gesehen habe, in dunkelblauen Hemden und Shorts, manche mit nacktem Oberkörper. Sie arbeiteten auf der Straße, und ich sah, wie sie Bäume pflanzten; sie gruben Löcher und setzten die jungen Bäume in die Erde. Ich sah, wie sie eine Straße befestigten, eine Schubkarre mit zwei Griffen schoben.
Als wir vom Berg herunterkamen, liefen wir am Kanal entlang bis zu einem Aufforstungsgebiet; im Wald gab es keine Wege, und wir hätten uns beinahe verlaufen. Es gab so viele Baumarten, dass man mit den Blättern ein dickes Blattartenalbum machen konnte.
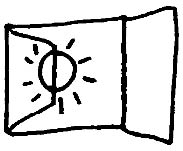
Ich weiß nicht mehr, wie wir aus dem Wald wieder herausfanden, er war wie ein Irrgarten, aber wunderschön. Ich hätte es bestimmt nicht bereut, wenn wir für immer dortgeblieben wären. Aber irgendwann entdeckten wir doch einen Ausgang, und schon waren wir draußen. Wir kamen an einem Gefängnis vorbei, einem Gefängnis ohne Außenmauern. Die Gefangenen arbeiteten in der Nähe des Kanals. Als wir stehen blieben und ihnen zusahen, fragten sie: Habt ihr Zigaretten? Diejenigen mit Zigaretten gaben ihnen, was sie in ihren Taschen fanden, und die Gefangenenarbeiter zündeten sich gleich eine an. Sie sagten: Danke.
Mutter erinnert sich an zwei Gesichter. Sie kam aus einer Bäckerei, mit einer Stange Brot in der Hand. Noch vor der nächsten Straßenecke tauchte plötzlich eine dunkle Hand vor ihren Augen auf, schnappte sich das Brot und war weg. Wie benommen starrte sie auf die leere Brottüte in ihrer Hand. Erst dann sah sie sich nach der Hand um, die das Brot genommen hatte, und erblickte den kleinen, dünnen Mann neben der Straßenlaterne direkt vor ihr. Er trug eine Mütze, die sein wirres Haar und die Hälfte seines Gesichts bedeckte. Ein paar schwarze Augen, die gleich herauszufallen drohten, lugten darunter hervor und starrten Mutter an.
Dieser Mensch rannte nicht fort. Er stand einfach unter der Straßenlaterne und stopfte sich ununterbrochen Brot in den Mund, das er hastig verschlang. Das weiße Brot ließ seine Augen noch schwärzer aussehen. Mit dem Rest des Brots in der Hand stand er da und sah sie an. (Wer über den Südbahnhof ankam, wusste, was Hunger heißt.)
Das andere Gesicht gehörte einem hageren Mann an einer Straßenecke. Als Mutter an ihm vorbeiging, sagte er: Geld her. Und die Hand, in der sie eben noch ihre Geldbörse gehalten hatte, war plötzlich leer. Und wovon soll ich leben, fragte sie. Der hagere Mann nahm ihr ganzes Geld aus der Börse. Sie sah ihm ins Gesicht, das die Farbe eines sehr stark gebrauchten Essstäbchens hatte, ein faltiges Gesicht. Seine Augenbrauen und sein Mund sahen aus wie auf dem Kopf stehende Korbsiebe.
Wovon soll ich leben, ich habe selbst nicht genug, sagte Mutter. Er sah sie an, sein verzweifeltes Gesicht wurde noch faltiger. Er nahm zwei Scheine von dem Geld, steckte den Rest zurück in die Geldbörse, gab sie ihr wieder und eilte davon. (Wer über den Südbahnhof ankam, wusste, was Armut ist.)
Wer einmal im Fischerhafen gelebt hat, wusste, was Gewalt war. Ein junger Mann, kaugummikauend, sagte: Was, nicht mehr als die paar Kröten? Mach Bekanntschaft mit meinem Messer.
– Hast du den Tempel gesehen?
fragt Mutter.
Mutter hat Tempel gesehen. Dieser eine Tempel, erzählt sie, hatte keine Balken, seine Architektur hatte eine eigenartige Schönheit. Er war von unten bis oben aus Stein, und das Dach war gebogen wie eine Brücke. Kein einziger Balken. Über dir gab es nur Rundbögen, einen neben dem anderen. Sah man von der Mitte der Halle aus nach oben, gab es dort ein Oberlicht, eine runde Öffnung.
Es gab einen Tempel, der direkt vor einer Felswand stand. Vor der steilen Felswand gurgelte fröhlich ein Bach, und in der Felswand gab es eine Menge Buddhastatuen. Es hieß, der Berg sei von einem anderen Ort aus herbeigeflogen gekommen. Über Nacht war er da, mit all den Buddhastatuen in der Felswand und dem gurgelnden Bach zu seinen Füßen.
Die Besucher des Bergs gingen gern in die Höhle und sahen zu der kleinen Öffnung an der Decke hinauf, durch die das Sonnenlicht von werweißwoher einfiel, aus der Höhle konnte man ein Stück vom Himmel sehen.

Ich habe den Tempel gesehen. Als wir frühmorgens aufstanden, nieselte es noch immer. Wir packten unsere Zelte zusammen, aßen Feldrationen zum Frühstück und dann gingen wir zum Tempel. Der Tempel rauchte. Im Räuchergefäß steckten zahlreiche Bündel Räucherstäbchen. Ringsum gab es viele Stände, die Dufthölzer mit Heilwirkungen, Rosenkränze und essbare Sojabohnen verkauften.
Asha sagte, wie wär’s, wenn wir das Schicksal befragen. Wie aus dem Nichts hatte er auf einmal ein Bündel Räucherstäbchen in den Händen und steckte es in den Räucheraltar. Dann umfasste er mit beiden Händen das Gefäß mit den Bambusstäbchen und kniete sich auf das Gebetskissen. Er schüttelte das klappernde Kissen, und gleich darauf fielen Bambusstäbchen heraus. Zuerst zwei. Asha hob sie auf, steckte sie wieder in das Gefäß und schüttelte noch einmal. Diesmal schüttelte er nur ein Bambusstäbchen heraus.
– Worum hast du gebeten?
fragten wir ihn.
– Der Himmel beschütze meine Stadt
antwortete er.