Warum Sie sich vor Menschen hüten sollten, die Ihnen einen rosenholzfarbenen Lippenstift verkaufen wollen
Die Ankündigung in der Tageszeitung versprach ein Fernseh-Highlight: Am Samstagabend würde eine Folge der Serie »Wilsberg« gezeigt, mit dabei sei eine Schauspielerin, die man schon lange nicht mehr gesehen hätte. Sie hatte Ende der 80er-Jahre in vielen wichtigen deutschen Filmen mitgespielt, müsste inzwischen auch um die 50 Jahre alt sein. Kein Mainstream-Typ, ein Star mit unverwechselbarem Gesicht und einer besonderen, femininen Aura. Man freute sich aufs Wiedersehen. Doch als sie schließlich auftauchte, starrte man sie fassungslos an.
Ihr Körper war immer noch schlank und wohlproportioniert, doch ihr Gesicht erschien seltsam rund, die Mundpartie verfremdet, die Lippen wölbten sich unnatürlich prall nach vorn. Sie war ganz offensichtlich einem Beauty-Doktor in die Hände gefallen. Man sah sie an und empfand Mitleid: Was für ein Druck musste auf ihr lasten, was für eine Verzweiflung musste sie geschüttelt haben, dass sie sich so hatte zurichten lassen?
Der Botox-Wahn: Wie Hautärzte zu Millionären wurden und Frauen ihr Gesicht verloren
Schon immer nahmen Menschen allerlei auf sich, um schöner auszusehen, als sie von Natur aus sind. Cleopatra badete in Eselsmilch, bereits im alten Rom wurden Haare gefärbt und Falten geglättet. Wir alle arbeiten mit Zahnbürste, Kamm, Kosmetik und Garderobe jeden Morgen darauf hin, unseren Mitmenschen ein angenehmer Anblick zu sein. Doch das, was der Schauspielerin angetan worden war, erfüllte den Tatbestand der Körperverletzung. Was ist da bloß passiert?
Als ich in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre bei einem Boulevard-Magazin arbeitete, konnte ich live mitverfolgen, wie die Pioniere unter den Hautärzten entdeckten, dass man mit Botox und Hyaluronsäure fantastische Geschäfte machen kann. Ich wollte mir damals einen Abszess am Rücken entfernen lassen. Eine Kollegin riet: »Geh doch mal zu Doktor X, er hat eine hübsch eingerichtete Praxis am Münchner Gärtnerplatz.« In einer drei Minuten dauernden Kurz-Sprechstunde machte Dr. X mir schnell klar, dass das Entfernen dieser Hautwucherung unter seiner Würde sei. Man müsse einen Operationstermin ausmachen. Die betroffene Stelle würde vermutlich nie wieder ganz glatt werden. Ich könne ja mal mit seiner Sprechstundenhilfe einen Termin ausmachen. Aber in den nächsten Monaten wäre da vermutlich wenig zu machen.
Später begriff ich auch, warum Dr. X an der Versorgung von Abszessen wenig Interesse hatte. Damals herrschte Goldgräberstimmung unter Münchner Dermatologen. Das neue Wundermittel Botox, ein Nervengift, mit dem man die Stirnmuskeln lähmen und auf diese Weise Falten glätten kann, wurde langsam populär. Lange Zeit hatten es sich nur ein paar unerschrockene Avantgardistinnen spritzen lassen. Jetzt trauten sich immer mehr Frauen, es auszuprobieren.
Die Wirkung hält nur wenige Wochen an, die Behandlung muss danach wiederholt werden – was dieses Business für Ärzte besonders unwiderstehlich macht. Was schert sie der Hippokratische Eid und das öde dermatologische Tagesgeschäft der Psoriasis-Behandlung und des Muttermal-Screenings? Mit Botox und den zur gleichen Zeit in Mode gekommenen Faltenauffüllern wie Hyaluronsäure ließ sich richtig gut Geld verdienen.
Schnell sprach sich herum, dass mein Münchner Abszess-Phobiker sich neuerdings in einer interessanten Marktlücke tummelte. Innerhalb weniger Jahre wurde er – auch dank der Mitwirkung begeisterter Journalistinnen – zum Beauty-Guru hochgejazzt. Viele Nachfolger kopierten sein Geschäftsmodell.
Die Auswirkungen dieses Booms sieht man inzwischen in jeder deutschen Provinzstadt, besonders deutlich aber im Straßenbild der Metropolen München und Berlin. Die Gesichter eines bestimmten Typs Dame sind nach dem gleichen, typischen Idealbild modelliert: glatte Stirnen, pralle Wangen, leicht vorgewölbte Entenschnabel-Lippen, die Köpfe gerahmt von aufwendig geföhntem, meist blondiertem Haar.
Die Sprache hat bereits ein schönes Wort für das hervorgebracht, was einem auffällt, wenn man Fotos von Madonna, Nicole Kidman und Carla Bruni betrachtet: Pillow Face. Weil die Wangenpartie durch Injektionen von Hyaluronsäure oder Eigenfett aufgepolstert wird, sieht die Haut in den entsprechenden Bereichen zwar wieder straff aus – allerdings erinnern diese Bäckchen aus der Nähe betrachtet an etwas zu dick gefüllte Sofakissen.
|
Schöne Aussichten Die Zukunftsforscherin Europa Bendig berät Kosmetikkonzerne und erkundet mit den Mitarbeitern ihrer Hamburger Agentur »Sturm und Drang«, welche Phänomene unser Konsumverhalten beeinflussen. Eine sympathische Erkenntnis, die dabei herauskam: »Schönheit berührt uns besonders dann, wenn sie einen Makel hat.« Bendig glaubt, allzu Glattes und Perfektes wird künftig nicht mehr gefragt sein. Wir weinen Barbie keine Träne nach. |
Lebensziel: ein perfekter Körper. Wie der Kapitalismus die Beziehung zu uns selbst verändert
Nirgendwo ist das Phänomen der Pillow Faces so verbreitet wie im Showbusiness. »Oft kommt es vor, dass ich eine Frau schminke, die ich ein paar Jahre nicht gesehen habe. Und ich registriere, dass die Lippen extrem aufgeworfen sind. Die Partie um den Mund herum ist molliger. Das Gesicht wirkt wie aufgepumpt«, berichtet ein New Yorker Starvisagist, der Schauspielerinnen vor ihren Auftritten verschönert. »Ich nenne es Fillorexia.« Schon warnt einer der besten plastischen Chirurgen in New York, Dr. Sherrell Aston, vor den Folgen dieser neuen Mode: »Das Gefährliche an dieser Prozedur: Hat man erst einmal eine Überdosis Filler im Gesicht, kann man nicht mehr zum natürlichen Zustand zurück.«
Man kann die Sucht nach dem glatten Gesicht als oberflächliches Phänomen belächeln – aber auch als Anzeichen eines kulturellen Wandels sehen. Die israelische Soziologin Eva Illouz hat in ihrem Buch »Warum Liebe weh tut« gezeigt, wie sehr die Mechanismen des Spätkapitalismus auch unsere Beziehungen zu den Menschen in unserem Umfeld prägen. Der Boom des Botox-Business ist ein Hinweis darauf, dass der Kapitalismus auch unsere Beziehung zu uns selbst verändert. Je stärker die Gesellschaft in Splittergruppen zerfällt, je unaufhaltsamer der Wohlstand zerbröselt, desto straffer werden Bäuche und Gesichter. Der Mensch muss sich auf dem Markt wie eine Ware anbieten. Dabei wurden in den letzten Jahrzehnten die Qualitätsstandards immer mehr in die Höhe geschraubt.
Die Figuren vieler Stars, die in den 50er- und 60er-Jahren das Publikum begeisterten, würden den heutigen ästhetischen Standards nicht mehr genügen. Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida und Sophia Loren bekämen von ihren Agenten eine Diät verordnet, vermutlich würde ihnen auch nahegelegt, täglich zu joggen, um etwas gegen ihre Cellulite zu tun.
»Forever faltenfrei« lautet der neue ästhetische Imperativ
Wer im Showgeschäft überleben will, muss sich gnadenlos kasteien, bis er sich als perfektes, medienkompatibles Produkt präsentieren kann. Inzwischen wird das aber auch von denen verlangt, die in einem ganz normalen Job noch ein paar Jährchen mitmachen wollen. »Wer heute nicht mindestens fünf, zehn Jahre frischer wirkt, als er laut Personalausweis müsste, der ist aus dem Spiel«, schreibt Ulrike Posche in einem stern-Artikel über neue Methoden der Faltenreduzierung. »Das Zeitalter der Globalisierung hat uns nämlich nicht nur eine Menge Internetfreunde, Desperate Housewives und hawaiianisches Tafelwasser gebracht. Es hat uns vor allem die ›Ökonomisierung des Sozialen‹ beschert.« So nennen das Wissenschaftler. Alle Bereiche würden davon erfasst, bis in die »private parts«, bis ins Intime. Gerade sind wir dabei, auch unsere Gesichter zu Profitcentern zu machen. Denn wir werden in unseren Jobs alt und älter werden. Doch niemand wird die Jahresringe an unseren Hälsen sehen wollen. »Forever Young« – das wird künftig nicht bloß ein Song von Bob Dylan sein. Nein, es wird unser Auftrag. Ein gesellschaftlicher Imperativ: »Work long, stay young.«
Mehr als Männer müssen Frauen sich anstrengen, den immer gnadenloseren Standards zu genügen. »Männer dürfen moderieren, bis ihnen die Zähne ausfallen und sie scheintot aus dem Studio getragen werden. Bei uns Frauen wird es Anfang, Mitte 50 ein bisschen schwieriger«, beobachtet die Autorin und Fernsehmoderatorin Amelie Fried.
Wohin aber führt es, wenn wir uns jetzt alle die Gesichter und Körper nach fragwürdigen Idealen modellieren (lassen)? Sind es überhaupt unsere eigenen Ideale? Und finden wir das Ergebnis wirklich schön?
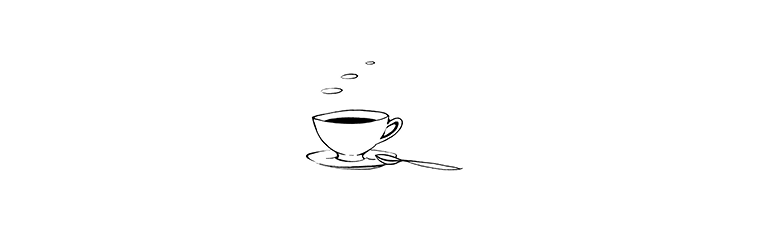
Das Individuum in der Normierungsfalle: Kate Winslet ist jetzt dünn und platinblond
Nach einem Gespräch mit der Schauspielerin Kate Winslet hatte ich viel Zeit, über solche Fragen nachzudenken. Winslet hatte in Zusammenarbeit mit einem Kosmetikkonzern eine Make-up-Linie entwickelt. Aus diesem Anlass wurden in Madrid Interviews mit ihr arrangiert. Wir Journalisten warteten in einem Vorraum zu ihrer Suite. Um uns einzustimmen, wurde auf einem Flachbildschirm der Werbefilm für Kate Winslets Lippenstifte und Nagellacke gezeigt. Darin räkelte sie sich dezent nackt zwischen weißen Bettlaken, ihr Haar war extrem blondiert, sie war sehr schlank. Und in ihrem Gesicht konnte man den Star aus »Titanic« kaum wiedererkennen. Sie sah unfassbar schön aus – aber überhaupt nicht wie Kate Winslet. Eher wie ein Mix aus Marilyn Monroe, Grace Kelly, Gwyneth Paltrow, Michelle Williams und January Jones. Sie sah aus wie der Prototyp einer Hollywood-Blondine. Ihr Gesicht war ausdrucksvoll und ebenmäßig, aber – verwandelt durch die Künste eines Make-up-Experten – völlig entindividualisiert.
Egal, ob es um ein Körpertraining geht, um einen chirurgischen Eingriff oder um eine Make-up-Beratung: Sollten Maßnahmen, die zu unserer Verschönerung dienen, nicht eher die Merkmale hervorheben, die uns von anderen unterscheiden, die uns wiedererkennbar machen? Tatsächlich aber, so scheint es, geht es bei solchen Eingriffen eher darum, Individuen auf Norm zu trimmen. Das geht so weit, dass Frauenzeitschriften allen nicht mehr ganz jungen Leserinnen unisono zu einer Lippenstiftfarbe raten: Rosenholz.
Mit diesem unauffälligen Passepartout-Ton, so wird suggeriert, geht eine Frau mittleren Alters auf Nummer sicher. Allerdings stellt sich auch hier die gleiche prinzipielle Frage: Warum soll eine Frau, die ihr Leben lang knallige Töne liebte, plötzlich optisch auf Tauchstation gehen? Warum soll, was der Lady optimal steht, auch für die Exzentrikerin das Richtige sein? Warum soll eine Individualistin, die mehrere Jahrzehnte damit zugebracht hat, sich selbst zu behaupten und sich von anderen abzugrenzen, plötzlich mit der gleichen Lippenfarbe durch die Straßen ihrer Stadt laufen wie ihre Nachbarin?
|
»Ich will keinen flotten Kurzhaarschnitt« Etwa um die Zeit der Wahl des amerikanischen Präsidenten Anfang November 2012 war in der Süddeutschen Zeitung ein Foto von Hillary Clinton abgedruckt. Sie trug einen blauen Blazer über einer hübschen blauen Rüschenbluse. Viel interessanter jedoch war ihre Frisur: Ihr blondes Haar war aus dem Gesicht gekämmt, es fiel glatt bis über ihre Schultern. Wie so viele Frauen, so erinnerte ich mich, war auch Clinton in früheren Jahren nicht immer im Reinen mit ihren Haaren gewesen, hatte sogar öffentlich zugegeben, sie sei »ihr Leben lang auf der Suche nach der richtigen Frisur gewesen«. Sie scheint sie gefunden zu haben. Die glatten langen Haare sehen gut aus. Und dennoch ist es heutzutage ein Akt des zivilen Ungehorsams, als Frau über 40 die Haare lang zu tragen. Selbst gute Friseure betrachten so viel Eigensinn als Beleidigung ihrer Zunft, hat die mit taillenlangen Haaren gesegnete Kollegin Susanne Schäfer in der Zeitschrift Donna festgestellt. »Gerade die angesagtesten Style-Gurus verbreiten die mottigsten Sprüche à la ›lange Haare machen alt‹ und legen ihren Kundinnen nahe, auf etwas ›Pfiffiges‹, ›Pflegeleichtes‹ umzusteigen.« Die Kollegin revanchiert sich mit einer sehr subtilen Rachestrategie: Alle acht bis neun Monate trägt sie ihre Prachtmähne zum angesagtesten Coiffeur der Stadt. Dort fordert sie vom konsternierten Meister: »Einmal Spitzen schneiden, bitte.« Manchmal sind eben drastische Maßnahmen nötig, um ein fest gefügtes Weltbild zu erschüttern. Und dem Friseur die Augen zu öffnen für eine einfache Wahrheit: Ein Short Cut kann mit 25 toll wirken. Und mit 65 tantig. Oder umgekehrt, je nach Typ. |
Das Geheimnis von Stil: wesentlich werden
Welches Bild der älter werdenden Frau verbirgt sich hinter diesen Empfehlungen? Erklingt da am Ende gar der stille Befehl: Werde unsichtbar? Was wäre eine angemessene Form, sich der Standardisierung zu entziehen? Wie leistet man auf elegante Weise Widerstand?
Wie jedes wahre Abenteuer beginnt auch dieses im Kopf: Es geht darum, den Fokus unserer Aufmerksamkeit zu verschieben. Statt darüber nachzugrübeln »Wie werde ich angeschaut?«, könnte man sein Interesse auf die Frage lenken: »Wie fühle ich mich?«
Was dann passieren würde, hat die britische Feministin Laurie Penny recht eindrucksvoll beschrieben: »Wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen.«
Statt sich über die Unzulänglichkeiten ihrer Gesichtsarchitektur zu grämen, könnten Frauen Themen besetzen und an die Öffentlichkeit gehen. Sie könnten einen echten Willen zur Macht entwickeln. Ein Vorbild für diese Strategie haben wir täglich vor Augen: Angela Merkel. Zu Beginn ihrer Karriere amüsierten sich alle über die Frisur und die Figur der Politikerin. Sie machte einfach weiter ihre Arbeit. Frisur und Figur sind heute in der Öffentlichkeit kein Thema mehr.
Bei dem Versuch, auf individuelle Weise gut auszusehen und dabei fröhlich seinen Nonkonformismus zu pflegen, darf man also sein Gesicht ruhig gemäßigt altern lassen. Man sollte auf seine Intelligenz vertrauen. Und auf einen weiteren Komplizen: die Mode. In einem Essay auf elle.de plädiert die Designerin Gabriele Strehle dafür, sich bei der Entwicklung des eigenen Stils ruhig weit vom Mainstream zu entfernen – um schließlich bei sich selbst anzukommen.
»Als meine große Schwester ein Abitur-Kleid brauchte, war ich Teenager und konnte nichts außer nähen – und hinschauen. Ich habe bemerkt, dass ihr – weil sie nicht gerade ein Schmalreh war, ein sehr vitales Gesicht und einen kräftigen Teint hatte – das Einfachste am besten stand, und habe ihr, in der Provinz der späten 60er-Jahre nahezu ein Skandal – ein ganz schlichtes schwarzes Kleid genäht. Stil kümmert sich nicht um das, was andere denken. Stilsicherheit fängt meistens mit Unsicherheit an, auch bei mir war das so.
Ich habe alles um mich her aufgenommen und registriert. Allmählich kam ich dahinter, was den Leuten, die für mich keinen Stil hatten, gemeinsam war: An ihnen war etwas zu viel. Ich glaube, wesentlich zu werden, also auf das zu kommen, was dem eigenen Wesen entspricht, wie bei mir die grauen Haare, ist das Geheimnis von Stil.«