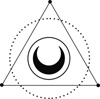
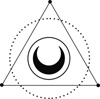
Zwei Tage später landeten wir abends um sechs in Budapest. Eher hatten wir keinen Flug bekommen, und wenn ich ehrlich war, hatte der Tag Pause nicht nur meinem Körper gutgetan, sondern auch unserer Zweisamkeit. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir gerne noch ein wenig mehr Zeit für uns allein haben können. Selbst der Flug war kein echter Anreiz für mich gewesen, unser Zimmer zu verlassen. Es war erstaunlich, wie schnell ich mich ans Fliegen gewöhnt hatte. Aufgeregt war ich deswegen jedenfalls nicht mehr.
Unser Hotel lag im Süden des fünften Bezirks. Nachdem wir uns ein wenig frisch gemacht hatten, gingen wir los, um noch etwas zu essen. Schnell landeten wir am Donauufer. Es war kalt, die Temperaturen lagen nur knapp über null Grad, trotzdem war die Promenade gut besucht. Der Grund dafür war offensichtlich.
Diese Stadt war atemberaubend schön. Am gegenüberliegenden Ufer erhob sich auf dem Gipfel des Burgbergs majestätisch der wunderschön beleuchtete Burgpalast, rechts von uns führte die Kettenbrücke über den Fluss. Ich konnte lediglich erahnen, was die Stadt alles zu bieten hatte.
Bei dem Versuch, den Anblick zu genießen, wurde mir schwer ums Herz. Wir waren nicht als Touristen hier. Vermutlich würden wir von der Schönheit der Stadt nicht viel zu sehen bekommen, weil unser Fokus auf einen kleinen runden Stein gerichtet war, der übrigens bislang nicht den geringsten Schimmer von sich gegeben hatte. Der Himmelsstein in meinen Händen, den meine Mutter mir hinterlassen hatte, sollte uns zum Stein der Hölle führen. Sie gehörten zusammen, waren untrennbar miteinander verbunden. In Slowenien hatte das Ding uns zwischenzeitlich in den Wahnsinn getrieben, denn dummerweise hatte uns niemand eine Gebrauchsanleitung dafür an die Hand gegeben. Inzwischen glaubte ich aber, seine Regeln zu kennen. Der Himmelsstein leuchtete nur, wenn ich ihn trug, und er wurde heller, je näher wir dem Stein der Hölle kamen. Aber ganz offensichtlich waren wir ihm momentan nicht nahe.
Ich beneidete die Menschen, die hier fröhlich schwatzend oder ehrfürchtig staunend flanierten, die hinter den Scheiben in gemütlich aussehenden Kneipen und Restaurants saßen und lachten, diskutierten oder sich verliebt in die Augen schauten. Sie wussten nichts von einer dunklen Prophezeiung, sie ahnten nichts vom möglichen Untergang der Menschheit. Sie waren sorglos und glücklich.
Caelum stellte sich hinter mich, schlang seine Arme um meinen Brustkorb und vergrub sein Gesicht in meinem dicken Schal. »Wir kommen noch mal her, Würmchen. Wenn alles vorbei ist.« Er schob den Schal ein wenig zur Seite, gab mir einen Kuss und sog meinen Geruch ein. »Dann kannst du die Stadt so kennenlernen, wie man es bei einer schönen Stadt tun sollte. Wir werden uns jede einzelne Sehenswürdigkeit anschauen und peinliche Selfies machen, wir werden shoppen und wir werden jede Menge Bars aufsuchen und Palinka trinken, bis du rosa Elefanten siehst.«
»Was ist Palinka?«
Er lachte in meine Halsbeuge. »Schnaps.«
Ich drehte mich in seiner Umarmung, damit ich ihn ansehen konnte. »Darf ich auch was anderes trinken?«, fragte ich vorsichtig.
Er grinste mich an und zog mich erneut eng an sich. »Was immer du willst, Würmchen. Aber probieren solltest du ihn.«
Ich musste schmunzeln. Gleichzeitig musste ich jedoch aufpassen, dass mich meine Emotionen nicht völlig übermannten. Die Schönheit der Stadt machte mich seltsamerweise traurig. Erinnerungen an meine Mom schoben sich an die Oberfläche. Wir waren so viel umhergezogen, hatten Nordamerika allerdings niemals verlassen. Sie hätte diese Stadt mit all den vielen Lichtern und dem bunten Treiben der Menschen geliebt. Sie hätte ihre Schönheit zu würdigen gewusst. Plötzlich konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten.
Caelum schob sanft eine Hand unter mein Kinn und hob es an. »Hey, was ist?«
Ich rang um Fassung und um Worte. »Ich ... es ist nur, weil ... meine Mom ... Es hätte ihr hier gefallen.«
Er vergrub eine Hand in meinen Haaren und zog mich mit der anderen an seine Brust. »Ach, Würmchen.«
Minutenlang standen wir einfach nur da, eine traurige und verzweifelte Insel in einem Meer aus fröhlichen Menschen. Irgendwann schaffte es seine Woge aus Liebe und Trost, meine Mauer der Traurigkeit zu durchbrechen. Es wurde besser.
Ich hob den Kopf, um ihm zu zeigen, dass es wieder gut war. »Wir kommen bestimmt wieder, okay?«
Er nickte. »Versprochen.«
»Und ich werde Schnaps trinken«, versicherte ich ihm, wobei ich mich an einem Lächeln versuchte.
Das Lächeln kam prompt zurück. »Und ich werde dich pflegen und verwöhnen, wenn der gemeine Kater am nächsten Tag von dir Besitz ergriffen hat.«
»Das könnte in Intensivpflege ausarten«, wies ich ihn auf das Offensichtliche hin.
Er gab mir einen letzten kleinen Kuss auf meine Stirn, dann nahm er meine Hand. »Nichts lieber als das. Aber jetzt sollten wir zu Kieron gehen, bevor der verhungert.«
Kieron hatte sich während meines emotionalen Ausbruchs netterweise zur nächsten Bank begeben, wo er mit einem Bier in der Hand auf uns wartete. Wenigstens konnte er die Verzögerung auf seine Weise etwas genießen.
Bei der Wahl eines Restaurants entschieden wir uns letzten Endes für eine Pizzeria ein paar Straßen weiter. Landestypisches Essen hoben wir uns in stillem Einverständnis für den nächsten Besuch auf.

Als wir uns zu Fuß auf den Rückweg zum Hotel machten, war abseits des Ufers um die Zeit nicht mehr viel los. Die paar Menschen, die uns begegneten, steuerten dick eingemummelt und mit schnellen Schritten auf ein warmes Wohnzimmer oder ein kuscheliges Bett zu.
Nach einem solchen sehnte ich mich auch. Obwohl der Flug nicht besonders lang und anstrengend gewesen war, war ich ziemlich müde. In meinen Gedanken lag ich schon fest in Caelums Armen unter einer dicken Daunendecke. Trotzdem spürte ich sie sofort.
Verflucht, wir waren hier mitten in einer Wohngegend! Wie konnten sie es wagen, uns hier aufzulauern?
Ich sah mich um. Wir befanden uns in einer schmalen Gasse, nur aus wenigen Fenstern schien Licht. Während ich noch versuchte, sie zu orten, traten sie bereits aus einem Hauseingang hervor.
Es waren sechs. Zwei von ihnen waren übergroße Verwandte der Fledermäuse. Rauchdämonen. Mühsam kämpfte ich die Panik nieder – mit ihnen gingen die schlimmsten Erinnerungen meines Lebens einher. Wegen ihnen war meine Mom tot, und der Anblick der Rauchsäule, in die sie sich aufgelöst hatte, verfolgte mich noch heute – und das nicht bloß in meinen Träumen. Die anderen vier waren einfach eklig. Sie sahen aus wie eine Mischung aus Wasserleiche und Gollum. Lange, fisselige und strähnige Haare, eine bleiche, gräuliche Haut und fast weiße Augen. Ihre Oberkörper waren nackt und ihre fahle Haut schimmerte im Schein der Laternen. Die ersten Meter bewegten sie sich auf allen vieren, dann richteten sie sich auf. Das einzig Erfreuliche an ihnen war, dass sie keine Krallen hatten. Mir war dennoch nicht nach einem Tänzchen zumute.
Caelum schob mich hinter sich, während ich bereits nach meinem Messer griff. Unter anderen Umständen hätten meine beiden Hohedämonen die sechs mit ein bisschen Feuer in Sekundenschnelle beseitigt. Hier in dieser ruhigen Wohngegend mussten sie leise und vorsichtig sein, auf herkömmliche Art und Weise kämpfen. Ich wusste, dass sie auch das besser beherrschten als alle anderen, trotzdem bereiteten mir die Rauchdämonen Sorge.
Als sie nur noch wenige Meter entfernt waren, meldete sich Kieron zu Wort. »Letzte Chance zum Rückzug, Leute. Jetzt verpissen oder gar nicht mehr.«
Ein ekelerregendes Grinsen der vier Wasserleichen war die Antwort. Leider entblößte das bei jedem von ihnen eine Zahnreihe, die der eines weißen Hais würdig gewesen wäre. Irgendein blödes Feature hatten die aber auch alle.
Kieron zuckte mit den Schultern. »War ja nur ’n Angebot.«
Dann griffen er und Caelum an. Die beiden nahmen sich verständlicherweise als Erstes die Rauchdämonen vor, wobei sie unfassbar schnell agierten. Die anderen allerdings auch. Zwei der Bleichgesichter schossen auf mich zu. Ich duckte mich unter ihrem ersten Angriff hinweg, drehte mich sofort wieder zu ihnen um und versuchte dabei, etwas Abstand zwischen uns zu bringen.
Für einen kleinen Moment scannten wir uns gegenseitig, versuchten einzuschätzen, mit welchem Gegner wir es zu tun hatten. Sie besaßen keine Waffen, und so wässrig, wie sie aussahen, hoffte ich mal, dass sie sich nicht noch als Feuerdämonen entpuppten. Ohne Waffen mussten sie sich mir also nähern, um mich zu verletzen.
Ich hingegen hatte zwei Messer. Eins davon steckte noch in meinem Hosenbund, aber wenn ich schnell genug war, könnte ich es schaffen. Aus dem Augenwinkel registrierte ich, dass meine beiden Begleiter mir die anderen vom Leib hielten. Also holte ich aus und zielte.
Für den Bruchteil einer Sekunde war ich stolz, das Messer blieb mitten im Hals des rechten Wassermanns stecken. Er ging mit gurgelnden Geräuschen zu Boden. In dem Moment, in dem mein zweites Messer meine Hand verließ, hörte ich hinter mir ein schrilles Kreischen, das weder menschlich klang noch von meinen Begleitern stammte. Ich zuckte zusammen, woraufhin mein Wurf meterweit an Nummer zwei vorbeischoss und er auf mich zu. Ich schmiss gerade noch die Arme hoch, um mein Gesicht zu schützen, als ich auch schon den reißenden Schmerz in meinem rechten Oberarm spürte. Ich schrie auf, viel zu laut für diese ruhige Gegend. Dann zog mich das Biest runter auf die Knie.
Unmittelbar darauf registrierte ich, wie sich seine Zähne schlaff aus meinem Fleisch lösten und mich starke Arme auf die Füße hoben. Dann rannten wir. Caelum zog mich unerbittlich hinter sich her, ich hatte beinahe das Gefühl zu fliegen, so schnell war er.
Ein paar Straßen weiter blieben wir in der Nähe einer Straßenlaterne endlich stehen. Caelum nahm vorsichtig meinen Arm und betrachtete ihn kurz. Seine Wut donnerte völlig unvermittelt wie ein Gewitter auf mich nieder.
Er sah mir fest in die Augen. »Ist das die einzige Stelle?«
Ich nickte. Plötzlich keimte Angst in mir auf. Selbst ich hörte, wie panisch ich klang. »Es ist nur ein Biss, oder? Er ist nicht giftig oder so? Bitte, Caelum. Bitte sag, dass es nur ein einfacher Biss ist.«
Er zog mich vorsichtig in seine Arme und hielt meinen Kopf. »Das ist es, Würmchen. Keine Angst. Es ist ein Biss. Aber das ›nur‹ würde ich an der Stelle gerne streichen.«
Ich atmete erleichtert auf. Caelum nahm mein Gesicht in seine Hände. Ein Hauch von Schuld wehte zu mir herüber. Ich schüttelte den Kopf. »Nicht deine und nicht meine Schuld. Die Monster waren eindeutig die anderen.«
Er lächelte mich dankbar an und gab mir einen Kuss. »Komm, wir müssen das versorgen.«

Zwanzig Minuten später saß ich im Bad unseres Hotels auf dem geschlossenen Klodeckel, während Caelum mich unendlich vorsichtig Schicht für Schicht aus meinen Sachen schälte. Trotzdem war jede Bewegung die Hölle. Irgendwann hatte er mich endlich von allen Oberteilen befreit und der Blick auf die Wunde lag offen. Ich drehte meinen Kopf, um sie zu betrachten.
»Nicht hingucken.«
Die Ansage kam leider zu spät. Mein Arm präsentierte mir eine kreisrunde, völlig zerfetzte Fleischwunde von der Größe eines Bierdeckels. Ich begann zu zittern. Caelum legte eine Hand so an mein Gesicht, dass ich die Wunde nicht mehr im Blickfeld hatte, aber das Bild war bereits in meinem Kopf. Mir wurde schlecht.
Blitzschnell rutschte ich von dem Klodeckel, drehte mich um und hob ihn an. Dann erbrach ich eine komplette Thunfischpizza. Caelum kniete neben mir, hielt meine Haare aus dem Gesicht und strich mir beruhigend über den Rücken.
Ich schüttelte vorsichtig den Kopf. »Selber ›nicht hingucken‹.«
Er lachte kurz auf. »Ich hab schon Schlimmeres gesehen.«
Erst Minuten später gab mein Magen Ruhe. Caelum half mir hoch und blieb auch dann noch dicht hinter mir, als ich mir am Waschbecken den Mund ausspülte.
»Geht es wieder?«, fragte er besorgt.
Ich nickte. »Ich denke ja, ’tschuldigung.«
Er sah mich kurz vorwurfsvoll an, ich sollte das mit dem Entschuldigen vielleicht wirklich mal in den Griff kriegen. In dem Moment klopfte es an der Tür. Caelum setzte mich vorsichtig wieder auf dem Klodeckel ab und öffnete. Es war Kieron, der offensichtlich in der Zwischenzeit eine Apotheke oder ein Krankenhaus überfallen hatte.
Nachdem er seine Beute an Caelum übergeben hatte, lehnte er sich an die Dusche und betrachtete meinen Arm. »Specki, da fand dich ja mal einer richtig zum Anbeißen, was?«
Ich hatte schon bessere Witze in meinem Leben gehört, aber es half mir immerhin, die Sache nicht mehr so dramatisch zu sehen. Caelum hingegen hätte ihn vermutlich am liebsten erwürgt.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte Kieron beschwichtigend.
»Erst mal nicht.«
Kieron nickte. »Dann bin ich nebenan.«
Caelum bedachte mich mit einem viel zu mitleidigen Blick.
Ich zog die Augenbrauen zusammen. »Guck nicht so, sonst fange ich gleich an zu heulen.«
Behutsam strich er mir über die Wange. »Du hättest allen Grund dazu.« Er hatte es noch nie schlimm gefunden, wenn ich weinte.
Als Erstes betäubte er den Arm und ich war dankbar, dass wenigstens diese Art von Betäubung bei mir normal funktionierte. Direkt im Anschluss gab er mir Schmerztabletten.
»Wofür sind die jetzt noch?«, wollte ich wissen.
»Für später. Wenn die oberflächliche Betäubung nachlässt, wird es erneut wehtun. Dann bist du schon mal versorgt und musst nicht wieder so lange warten.«
»Danke.«
Er nickte ernst, dann legte er los. Dieses Mal war ich schlauer und sah nicht hin. Ich hatte keine Ahnung, was er genau tat, aber ich war mir sicher, dass ich es auch nicht wissen wollte.
Es dauerte ziemlich lange, bis er endlich fertig war und mir einen Verband anlegte. Schweigend räumte er den Müll weg. Schließlich kniete er sich vor mich und schaute mir in die Augen, als ob er prüfen wollte, wie es mir ging. Ich lächelte ihn an, um ihm zu zeigen, dass alles okay war, wobei er ohnehin spürte, dass das nicht stimmte.
Schließlich seufzte er. »Ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist, aber ich hatte trotzdem gehofft, dass so was nicht so schnell passiert.«
»Ich weiß.«
Er strich mir eine Strähne aus dem Gesicht und klemmte sie hinter mein Ohr. Dann stand er auf. »Ich hole dir ein paar frische Sachen.«
Eine Minute später war er mit einem seiner T-Shirts zurück. Ich schmunzelte. Wenn er die Klamottenwahl in der Hand hatte, waren es immer seine T-Shirts. Anschließend half er mir aus meiner dreckigen Jeans und meinem BH und zog mir sein Shirt über. Gemeinsam gingen wir nach nebenan und setzten uns zu Kieron aufs Bett.
Es sollte das Letzte sein, was ich heute tat. Die Schmerzmittel begannen zu wirken, das Adrenalin war verschwunden und die Erschöpfung holte mich mit voller Wucht ein. Und so war es das zweite Mal innerhalb von drei Tagen, dass ich auf Caelums Schoß einschlief.