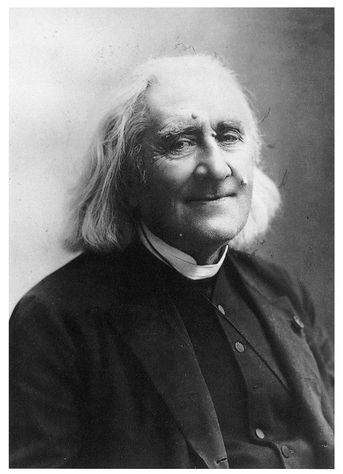
Paris, März 1886.
LA VIE TRIFURQUÉE
(1869 – 1886)
In der Hofgärtnerei
Mit nächstem Jahr aber dürfte ein ziemlicher Wechsel in meiner äusseren Existenz stattfinden, der mich Deutschland wieder näherrückt. Wie sich dies letzte Kapitel meiner Lebensbahn gestalten wird, errathe ich noch nicht.«1 Als Franz Liszt diese Zeilen im Juni 1868 schrieb, liefen die Vorbereitungen für seine Ankunft in Weimar bereits auf Hochtouren. Carl Alexander hatte seit Liszts Weggang nach Rom unentwegt für die Rückkehr des berühmten Musikers geworben, der Großherzog sprach in diesem Zusammenhang sogar von einer »Notwendigkeit«. Jetzt – gut sieben Jahre nachdem Liszt die Stadt Goethes und Schillers verlassen hatte – gab er dem Drängen seines aristokratischen Freundes nach. Er tat dies sehr gerne, wofür es verschiedene Gründe gab. Der römische Aufenthalt hatte sich insgesamt als ein Irrtum erwiesen, konstatierte der Liszt-Forscher Serge Gut.2 Eine Karriere im Umfeld des Vatikans, die Liszt eine Zeit lang wünschenswert erschienen war, ließ immer noch auf sich warten. Auch kompositorisch blieb er hinter seinen eigenen Erwartungen zurück: Zwar schuf er in jenen Jahren viel religiöse Musik, deren Qualität jedoch nur selten überzeugen konnte. Liszt hatte zunächst in der Via Felice gewohnt, dann war er in das Kloster Madonna del Rosario übersiedelt, es folgte eine Station im Vatikan, bevor er in das Kloster Santa Francesca Romana zog. Diese vielen Umzüge gaben seinem Dasein in der Ewigen Stadt etwas Improvisatorisches und trugen dazu bei, dass er sich nie ganz heimisch fühlte. Und nicht zuletzt war er seit seiner Tour nach Karlsruhe im August 1864 wieder mit dem Reisefieber infiziert. »Man würde mich auf Deutsch recht gut so charakterisieren«, erklärte er einmal der Fürstin: »›Zu einer Hälfte Zigeuner, zur andern Franziskaner!‹«3 Der Zigeuner in ihm schien nun wieder den Ton anzugeben.

Franz Liszt im Juni 1884 in der Hofgärtnerei, die ihm der Großherzog Carl Alexander als Wohnung zur Verfügung gestellt hatte. In Weimar hielt sich Liszt alljährlich im Frühjahr und Sommer auf. Im Salon empfing er auch seine Schülerinnen und Schüler. Links steht der große Bechstein-Flügel, rechts der kleine Tisch, auf dem diese die Noten der Werke ablegten, die sie mit Liszt studieren wollten.
Liszt wollte Rom aber keinesfalls für immer verlassen. Er fühlte sich der Fürstin nach wie vor verbunden, sodass ihm regelmäßige Aufenthalte in ihrer Nähe selbstverständlich blieben. Hinzu kam ein großes Interesse, das man ihm ab 1870 aus Ungarn entgegenbrachte. Mit Weimar, Rom und Budapest sind die Stichworte genannt. Was nun begann, hat Franz Liszt treffend als seine »vie trifurquée« bezeichnet – sein dreigeteiltes Leben. Ab 1869/70 bis zu seinem Tod hielt er sich nahezu jedes Jahr für einige Zeit in diesen drei Städten auf. Schnell bildete sich so etwas wie ein Rhythmus heraus: Die Frühjahrs- und Sommermonate verbrachte er meistens in Weimar, während es ihn im Herbst und Winter in der Regel nach Rom beziehungsweise Budapest zog. Da die Altenburg nicht mehr zur Verfügung stand, musste in Weimar nach einer neuen Bleibe Ausschau gehalten werden. Gesucht wurde ein Haus, das repräsentativ war und zugleich Liszts bekannter Bescheidenheit Rechnung trug. Carl Alexander stellte seinem Freund schließlich die sogenannte Hofgärtnerei zur Verfügung. Am westlichen Eingang des Parks an der Ilm, dort, wo die Marienstraße in die Belvederer Allee mündet, liegt das 1798/99 errichtete Gebäude, in dem Liszt den ersten Stock bezog. Dort standen ihm ein Schlafzimmer, ein Speiseraum, ein Dienerzimmer sowie ein großer Musiksalon zur Verfügung. Der Salon wurde durch einen zweiteiligen schweren Vorhang in den ungarischen Nationalfarben Rot, Weiß und Grün gegliedert. Hören wir Liszt selbst: »Überall liegen schöne Teppiche; 4 Kachelöfen aus Berlin, Doppelfenster, Gardinen und Portieren aus wertvollem Stoff, entsprechende Möbel, 3 Pendeluhren aus Bronze, mehrere Bronze-Leuchter mit je 3 Kerzen, 6 oder 8 Carcel-Lampen, zwei Spiegel in goldenen Rahmen, Tafelsilber, Gläser und Porzellan für 6 Personen. Man hat mir erzählt, dass die Großherzogin und die Prinzessinnen sich besonders mit der Auswahl der Teppiche, Gardinen etc. beschäftigt haben. Tatsache ist, dass diese Wohnung von ›wagnerischem‹ Luxus ist, an den man in dieser guten Stadt Weimar kaum gewöhnt war.«4 Dem Herrn Abbé stand sogar eine Haushälterin zur Verfügung, Pauline Apel, die als junges Mädchen bereits Carolyne in der Altenburg gedient hatte und jetzt den Alltag in der Hofgärtnerei organisierte. Sie war die gute Seele des Hauses und für die nächsten 17 Jahre aus Liszts Weimarer Leben nicht mehr wegzudenken.

Sonntagsmatinee in der Hofgärtnerei, Gemälde von Hans W. Schmidt, 1882. Hinter Liszt (v.l.) Eugen d’Albert, Alexander Siloti und Alfred Reisenauer, in der ersten Reihe sitzend die Großherzogin Sophie und der Großherzog Carl Alexander, dahinter Adelheid von Schorn (mit weißer Haube) und Olga von Meyendorff, nahe am Fenster (v.l.) Emil Sauer, Bernhard Stavenhagen und Conrad Ansorge.
Carolyne von Sayn-Wittgenstein ließ Liszt gegenüber keine Zweifel daran aufkommen, was sie von dessen regelmäßigen Aufenthalten in Weimar und Budapest hielt – nämlich nichts. Sie hatte für Liszts späte Liebe zu seinem Vaterland nur Spott und Hohn übrig, während Weimar als Stadt ihrer geplatzten Träume für sie ohnehin ein heikler Ort war. Darüber hinaus befürchtete die Fürstin, dass sich der knapp 60-Jährige durch das stetige Pendeln zwischen diesen drei Städten körperlich aufreiben könnte. Die Angst war nicht ganz unberechtigt, bedenkt man, dass die Entfernung zwischen Rom und Budapest auf dem Landweg etwa 1200 Kilometer beträgt und Bahnreisen damals alles andere als komfortable Vergnügungsfahrten darstellten. Carolyne spürte aber auch instinktiv, dass sich ihr Franz während seiner langen Abwesenheiten von Rom ihrem Einfluss und ihrer Überwachung entzog. Wollte sie weiterhin eine gewisse Kontrolle über Liszt ausüben, war sie auf Berichte von Dritten angewiesen.
»Ich vertraue Ihnen Liszt an«,5 schrieb Carolyne Anfang Januar 1869 an Henriette von Schorn. In der 1807 geborenen Schriftstellerin fand sie eine willige Informantin. Die Witwe des Kunstschriftstellers Ludwig von Schorn gehörte zu Weimars gesellschaftlichem Establishment, und Carolyne kannte sie seit den Tagen auf der Altenburg. Im Laufe der Jahre war Henriette ihr eine treue Freundin geworden, auf die sie sich bedingungslos verlassen konnte. Die Schorn fungierte als so etwas wie Carolynes Stellvertreterin in Weimar. Anfänglich waren ihr die Spionagedienste richtiggehend peinlich: »Sagen Sie mir aufrichtig, liebe Frau Fürstin, ob ich Ihnen nicht zu viel über diese Kleinigkeiten schreibe – aber ich beurteile Sie nach mir: daß alles uns interessiert, was im geringsten zum Wohlbefinden derer, die uns teuer sind, beiträgt.«6 Diese Einstellung war ganz nach Carolynes Geschmack, wollte sie doch alles wissen: wie Liszt sich fühlte, wer ihn besuchte, wie lange diese Person blieb, wer sich ohnehin in der Stadt aufhielt und so weiter. Jede Art von Klatsch und Tratsch schien willkommen. Als Henriette von Schorn Mitte Mai 1869 starb, übernahm ihre 28-jährige Tochter Liszts »Betreuung«. Fräulein Adelheid wohnte gegenüber der Hofgärtnerei in der Belvederer Allee 2; von dort hatte sie den perfekten Überblick. Gleichwohl darf man ihr nicht unrecht tun: Adelheid von Schorn war keine »Zwischenträgerin« oder Denunziantin, sondern vielmehr ernsthaft um Liszt besorgt, wovon ihre vielen Briefe, die sie Jahre später veröffentlichte, Zeugnis ablegen. Adelheid wird als »eine überaus eigenartige Persönlichkeit« beschrieben, »aussehend wie die Äbtissin eines russischen Frauenklosters, deren dekoratives, äußerst effektvolles Kostüm sie trug«.7
Zu Franz Liszts neuer Weimarer Entourage gehörte auch Olga von Meyendorff. Die 1837 geborene Baronin entstammte einer alten russischen Adelsfamilie. Sie war die Tochter des Prinzen Michail Gortschakow, ihr Onkel Alexander zählte als Außenminister und Kanzler zur Führungselite Russlands. Mit 20 Jahren heiratete Olga den Diplomaten Felix von Meyendorff. Liszt lernte das Paar bereits im Herbst 1863 in Rom kennen. Da Olga eine schöne junge Frau war und zudem sehr gut Klavier spielte, verbrachte er gerne seine Zeit mit ihr. Als Felix von Meyendorff 1867 die Nachfolge von Apollonius von Maltitz als Geschäftsträger der russischen Botschaft in Weimar antrat, verlor man sich aus den Augen. Drei Jahre später wechselte der Karrierediplomat als russischer Botschafter an den Karlsruher Hof. Dann kam völlig unerwartet das tragische Aus – Anfang Januar 1871 starb von Meyendorff im Alter von nur 37 Jahren und hinterließ seine vier Jahre jüngere Gattin Olga, die nun nicht wusste, wo sie und ihre vier kleinen Söhne bleiben sollten. Olga wandte sich an Liszt: ob es ihm recht wäre, wenn sie sich erneut in Weimar niederlassen würde?
Franz hatte allem Anschein nach nichts dagegen, dass die Baronin seine Nähe suchte. Als sie sich allerdings in ihn verliebte, zierte er sich, was Olga wiederum wenig beeindruckte: »Eines Tages werden Sie sich, wie ich hoffe, nicht weigern, mein Bekenntnis, das ich Ihnen schon am ersten Tage hätte ablegen müssen, voll und ganz zu hören, und es wird Sie sicherlich von dem Druck befreien, der sehr zu Unrecht auf Ihrem viel zu skrupulösem Gewissen lastet.«8
Ob Liszt schwach wurde? Wir wissen es nicht. Gerüchte, dass die beiden zeitweilig ein Liebespaar gewesen seien, waberten bereits damals durch die Salons. Das Verhältnis von Franz und Olga war jedenfalls kompliziert. Liszt schätzte den intellektuellen Austausch mit der schönen Baronin, er bewunderte ihre außergewöhnliche Bildung, und sicherlich war er auch ein Stück weit ihrem exotischen Charme verfallen. Olga polarisierte: »Ihre Gesichtsfarbe ist bleich, ihr Haar dunkel. Sie macht gleichzeitig den Eindruck eisiger Kälte und tropischer Hitze«, erinnerte sich Liszts Schülerin Amy Fay. »Ich werde die stolze Art nie vergessen, in der die Baronin eines Tages, als ich ihr im Park begegnete, ihr Augenglas hervorzog und mich betrachtete. […] Sie wartete, bis ich ganz dicht heran kam, dann nahm sie bedächtig das Glas und besah mich von oben bis unten. Mit einem halb verächtlichen, halb gleichgültigen Blicke ließ sie es wieder fallen, als ob das Examen der Mühe nicht werth wäre.«9
In Weimar war sie hoch umstritten. Man nannte sie nur »die schwarze Katze« – jederzeit konnte sie ihre Krallen ausfahren. Liszts Schülerinnen gerieten fast alle mit Olga von Meyendorff aneinander. »Durchlaucht«, wie sie sich gerne anreden ließ, war fanatisch eifersüchtig und beobachtete die jungen Fräuleins argwöhnisch aus den Augenwinkeln. Da sie ihr Domizil in der Belvederer Allee 1 (direkt neben Adelheid von Schorn in der Nummer 2) aufgeschlagen hatte, konnte auch sie das Leben in der Hofgärtnerei problemlos überwachen. Immer wieder quälte sie Liszt mit Vorwürfen, er würde eine zu große Nähe zu seinen Elevinnen pflegen. Das Mittag- wie das Abendessen musste er in der Regel bei Madame einnehmen. Bat Liszt zu seinen sonntäglichen Matineen in die Hofgärtnerei oder lud er sonst Gäste zu sich ein, war Olga selbstverständlich mit von der Partie.

Die schwarze Katze: Auch die Baronin Olga von Meyendorff soll eine Geliebte von Franz Liszt gewesen sein.
Warum ließ er sich das alles von einer Frau gefallen, die gut seine Tochter hätte sein können? Offensichtlich fühlte sich Liszt von starken, komplizierten und auch neurotischen Frauen geheimnisvoll angezogen. Marie d’Agoult gehörte mit ihrer grenzenlosen Ichbezogenheit ebenso in diese Gruppe wie die exzentrische Fürstin Sayn-Wittgenstein. Nicht wenige Zeitgenossen fühlten sich durch Olga ohnehin an Carolyne erinnert. Nicht äußerlich – dazu waren sie zu verschieden. Aber beider Stärke, Dominanz und auch der psychische Druck, den sie auf Liszt auszuüben vermochten, sind durchaus vergleichbar. Kein Wunder, dass die beiden Damen mit Vorliebe schlecht übereinander sprachen. Während Olga ihre römische Konkurrentin geflissentlich ignorierte, verspottete Carolyne die Baronin als Liszts »russische Muse« und lästerte über das »Meyendorff’sche Leonorenspiel«.10
Majestät hält Hof
Jeden Sonntagvormittag von 11 bis 1 Uhr war Matinée«,11 erinnerte sich Adelheid von Schorn. Die Hofgärtnerei wurde schnell ein gesellschaftlicher und künstlerischer Treffpunkt in Weimar. Liszt lud bekannte und noch unbekannte Künstler ein, mit ihm zu musizieren. Berühmte Musiker wie der Geiger Eduard Reményi, der Pianist Anton Rubinstein oder die Sängerin Pauline Viardot-García, die sich etwa Anfang 1869 nur zufällig in Weimar aufhielten, gehörten ebenso zu Liszts Gästen wie im zunehmenden Maße seine Schülerinnen und Schüler. Großherzog Carl Alexander ließ sich möglichst keine Matinee entgehen, darüber hinaus kamen alte und neue Freunde wie Hofrat Carl Gille, Fräulein von Schorn oder die Baronin von Meyendorff. In Liszts Salon begegneten sich Menschen, die sonst kaum aufeinandergetroffen wären: Künstler und Politiker, Schriftsteller und Forscher, Komponisten und Maler. Hatte Carl Alexander noch Jahre zuvor wegen der »Affaire Wittgenstein« diplomatische Distanz wahren müssen, genoss er nun die Nähe zu seinem geschätzten Freund. Franz Liszts Anwesenheit in Weimar brachte bereits im ersten Jahr neuen mondänen Glanz in das verschlafene Nest. Dazu trug auch seine Lehrtätigkeit bei. Dreimal wöchentlich unterrichtete er bis zu 20 Schülerinnen und Schüler in seinem Salon in der Hofgärtnerei, darunter ab Mai 1873 die knapp 30-jährige Amy Fay aus Chicago. Dank der Briefe, die Amy an ihre Eltern schrieb, können wir uns ein gutes Bild der Weimarer Verhältnisse machen.
»In ganz Weimar ist kein Klavier, weder für Geld noch für gute Worte zu haben«,12 musste Amy kurz nach ihrer Ankunft feststellen. Die Stadt sei voll von jungen Musikern, raunte man ihr zu, die kein anderes Ziel hätten, als Liszt vorzuspielen – und diese Leute hätten alle verfügbaren Klaviere aufgekauft. Selbst in der näheren Umgebung war kein Instrument aufzutreiben, erst im über 100 Kilometer entfernten Leipzig wurde sie fündig. Miss Fay hatte bislang bei Carl Tausig und Theodor Kullak studiert – sie konnte also auf zwei hochbedeutende Lehrer verweisen. Dass der Unterricht bei Liszt in anderen Bahnen verlaufen würde, ahnte sie bereits, als sie ihr Idol zum ersten Mal sah, bei einer Theateraufführung: Der Abbé saß in einer Loge und hielt Hof. Dabei drehte er der Bühne demonstrativ den Rücken zu und plauderte unbekümmert mit einigen Damen.
Die Schülerinnen und Schüler versammelten sich in der Regel gegen drei Uhr nachmittags im Salon der Hofgärtnerei, bei schönem Wetter auch schon einmal vor dem Haus. Hatte Liszt seinen Mittagsschlaf beendet, zeigte er sich am Fenster oder ging direkt in den Salon. Dort stand ein unscheinbarer Tisch, auf den man die Noten des

»Majestät sind alles, nur nicht Jugenderzieher« (Hans von Bülow). Liszt-Schüler warten vor der Hofgärtnerei, bis sich der »Meister« am Fenster zeigt, unter anderen Walter Bache (7. v. l.), Alfred Reisenauer (Bildmitte, Hände in den Taschen), Carl Lachmund (rechtes Bein auf der Stufe), Aufnahme 1883.
Musikstücks ablegte, das man gerne mit Liszt studieren wollte. Nach einer kurzen Begrüßung trat er an das Möbel, blätterte durch die Partituren und wählte spontan ein Werk aus. »Wer spielt das?«, fragte er in die Runde – und die entsprechende Person musste vortreten. Die Auswahl geschah willkürlich, und man konnte nie genau wissen, was dem »Meister« gerade zusagte oder eben nicht. Es gab jedoch einige Werke, die Liszt partout nicht hören wollte. Dazu gehörten Carl Tausigs Bearbeitung von Johann Sebastian Bachs Orgeltoccata in d-Moll sowie seine eigene zweite Ungarische Rhapsodie, die er für epidemisch überspielt hielt.
Liszt erteilte keine Einzelstunden, in deren Verlauf Schüler und Lehrer gewissermaßen unter vier Augen ein Werk erarbeiten, sondern er unterrichtete eine Klasse mit vielen Teilnehmern. Das bedeutete natürlich auch, dass bei Weitem nicht jeder Teilnehmer in jeder Stunde spielen konnte. Aus den Tagebuchaufzeichnungen von Liszts Schüler August Göllerich wissen wir, dass meistens zwischen vier und acht Pianisten drankamen. Die Zahl hing von den jeweiligen Stücken, von der Dauer des Unterrichts und nicht zuletzt von Liszts aktueller Laune ab. Die anderen Schüler waren an jenem Tag dann passive Zuhörer. Liszt verfolgte also ein Konzept, das auch heute noch verbreitet ist, das der »Meisterklasse«. Er war davon überzeugt, dass ein Musiker vom bloßen Zuhören profitieren könne und der öffentliche Unterricht ein Klima schaffe, in dem ein jeder zu einer Inspirationsquelle für andere werden konnte, ein für die damalige Zeit überaus moderner Ansatz.
Dass bei Liszt alles anders war, hatte auch Amy Fay schnell verstanden. »Liszt ist indeß nicht im Geringsten wie ein Lehrer«, berichtete sie nach Hause, »und kann auch nicht als solcher angesehen werden. Er ist ein Herrscher, und wenn er sein königliches Scepter ausstreckt, so mögt Ihr Euch hinsetzen und ihm vorspielen. Ihr dürft ihn niemals auffordern, Euch etwas vorzutragen, so heiß Euer Herz auch darnach verlange. Wenn er in der richtigen Stimmung ist, wird er spielen, wenn nicht, müßt Ihr Euch mit wenigen Bemerkungen begnügen.«13 Diese Anekdote unterstreicht einmal mehr, dass Liszt an Pädagogik im herkömmlichen Sinne nicht interessiert schien. Unterrichten war für ihn nahezu ein charismatischer Vorgang: »Das ist die Art, wie Liszt lehrt. Er vergegenwärtigt Euch eine Idee, diese nimmt Besitz von Eurem Geiste und haftet da fest.«14 Dies funktionierte nur bei Studenten, die über eine große Imaginationsgabe verfügten, deren Technik tadellos war und die auf dem Klavier bereits über eigene Ausdrucksfähigkeit verfügten. Bei weniger talentierten Eleven oder gar bei Anfängern scheiterte Liszt kläglich, verlor die Geduld, wurde unleidlich und ungerecht. Amy Fay: »Er ist der liebenswürdigste Mensch, und dennoch kann er schrecklich sein, wenn er will, und er versteht es, die Leute in der kürzesten Zeit vor die Thür zu setzen.«15
Liszt räumte selbst ein, dass er kein Talent besitze, »um Regeln des Vortrags, der Auffassung und des Ausdrucks pädagogisch zu erörtern. Darüber kann ich nur im persönlichen Verkehr einiges mittheilen.«16 Hans von Bülow kannte die Grenzen seines einstigen Lehrers und Schwiegervaters sehr genau. Wahrscheinlich hielt er Liszt für einen schlechten Pädagogen, spottete er doch über die »Weimarer Miß-Schule« und verpasste Liszt das böse Etikett: »Majestät sind alles, nur nicht Jugenderzieher.«17
Die Kosakin
In Liebessachen muß man sich glücklich preisen, wenn sie ein schönes Ende nehmen«,18 erklärte Liszt einmal augenzwinkernd seinem Schüler August Göllerich. Dieses Bonmot könnte gut ein Motto für die nun folgenden Ereignisse abgeben. Allerdings nahm Liszts neueste Liebelei kein schönes Ende – ganz im Gegenteil. Es ging um eine Kosakengräfin, die keine war, um Drogenexzesse und Revolver in Handtaschen, um verletzte Gefühle und enttäuschte Liebe, um ein Attentat auf Liszt, das vereitelt werden konnte, und nicht zuletzt um vermeintliche Enthüllungsbücher. Aber der Reihe nach.
Mitte 1869 nahm Liszt in Rom eine neue Pianistin in seinen Schülerkreis auf. Die junge Frau nannte sich Olga Janina, gelegentlich auch durch das Adelsprädikat »von« ergänzt. Sie stamme aus dem Kosakenland, behauptete sie, überdies sei sie eine echte Gräfin. Doch war Madame Olga von Janina weder eine Kosakin noch eine Comtesse. Selbst ihr Name war Fiktion – in Wirklichkeit hieß sie Olga Zielińska und war am 17. Mai 1845 im galizischen Lemberg als Tochter wohlhabender Eltern geboren worden. Ihr Vater Ludwik Zieliński besaß im etwa 80 Kilometer entfernten Lubyczy eine Keramikfabrik, zwei Mühlen sowie eine Schnapsbrennerei. Mit 18 Jahren heiratete Olga ihren ersten Mann Karol Janina Piasecki, mit dem sie eine Tochter Hélène hatte. Die Beziehung war allem Anschein nach vom ersten Tage an unglücklich, sodass sich die Eheleute bald trennten. Von ihrem Gatten übernahm sie nun dessen zweiten Namen und nannte sich fortan Olga Janina. Die Legende war geboren.

Die Liszt-Schülerin Olga Janina: »Sie ist eine kleine, geistreiche, närrische Person und liszttoll« (Ferdinand Gregorovius).
Olga verfügte – nach allem, was wir wissen – über großes musikalisches Talent. Ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie von ihrer Mutter, ab 1853 ging sie in Lubyczy bei Wilhelm Blodek, einem Schüler des berühmten Alexander Dreyschock, in die Lehre. 1865 zog sie für eineinhalb Jahre nach Paris, um ihr Klavierspiel bei Henri Herz zu perfektionieren, kehrte aber wieder in ihre Heimat zurück. Es vergingen zwei weitere Jahre, bis Olga im April 1869 in Wien ihr Erweckungserlebnis hatte: Sie hörte Franz Liszt. Dieses Konzert bedeutete für sie so etwas wie eine Offenbarung. Sie schrieb ihrem Idol einen Brief und bat ihn, sie als Schülerin anzunehmen. Hätte Liszt geahnt, in welche Schwierigkeiten dieses Fräulein ihn bringen würde, hätte er sie wohl kaum nach Rom eingeladen.
Olga Janina war schnell das Gesprächsthema in Franz Liszts Entourage. Die junge Frau fiel schon äußerlich auf, kleidete sie sich doch wie ein Mann. Keine schicken französischen Toiletten, keine geschmackvollen Blusen und Röcke, keine dezenten Hüte – Olga bevorzugte Hosen und Jacken. Der Bildhauer Josef von Kopf erinnerte sich: »Klein, lebendig in ihrer Rede, in ihrem Gange rasch, leidenschaftlich, heftig, aufgeregt – war sie eine große Klavierspielerin. Mit ihrem breiten Munde, aufgestülpter Nase, kurzen, nach Männerart geschnittenen Haaren machte sie einen unschönen Eindruck. « Ob er die Geschichte von Olgas blaublütiger Abstammung glaubte? Er winkte ab – »aber die Polinnen sollen im Auslande ja alle Gräfinnen sein!«.19 Olga rauchte – und zwar Zigarren! Zum Unterricht erschien sie gelegentlich mit einem Revolver, was die anderen Schülerinnen und Schüler in Angst und Schrecken versetzte. Als ein weiteres Accessoire trug die selbst ernannte Kosakin einen Dolch, dessen Spitze angeblich vergiftet gewesen sein soll. Keine Frage: Dieser Person kam man besser nicht in die Quere. Olga war exzentrisch und hysterisch überspannt, den Rest erledigten die Drogen, insbesondere das damals in der High Society populäre Opium. In ihrer Tasche führte sie ein Etui mit verschiedenen rauschbringenden Mittelchen und Giften bei sich. Auch Ferdinand Gregorovius lernte Olga in jener Zeit kennen, »welche ihre Kinder verlassen hat aus Fanatismus für Liszt, und dessen Schülerin geworden ist. Sie ist eine kleine, geistreiche, närrische Person und liszttoll.«20
Olga Janina war von Liszt besessen. Sie liebte und verehrte ihn, doch ihr Liebeswahn hatte etwas Zerstörerisches. Josef von Kopf: »Auf den Maëstro war sie fürchterlich eifersüchtig, und alle ihre Konkurrentinnen ohne Ausnahme, und deren gab es Dutzende, haßte sie grimmig.«21 Sie folgte ihrem Geliebten auf Schritt und Tritt – heute würde man wohl von Stalking sprechen.
Wie konnte es so weit kommen? Warum ließ Liszt sich überhaupt mit dieser Person ein? Und warum zog er nicht früher die Reißleine? Hier sind wir auf Vermutungen angewiesen. Zunächst: Olga besaß großes pianistisches Talent, und Liszt erkannte instinktiv das künstlerische Potenzial, das in dieser außerordentlichen Frau steckte. »Sie spielte wie vom Teufel besessen«, erinnerte sich Nadine Helbig. »Ich werde nie vergessen, wie sie in der ersten Stunde den Mephisto-Walzer spielte.«22 Darüber hinaus empfand er – der Abbé – so etwas wie christliches Mitleid. Er kannte Olgas neurotische Persönlichkeit, wusste von ihrer Drogensucht und hatte gehört, dass sie bereits einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Wäre es nicht wahrhaft unchristlich, mag er sich gefragt haben, einer Hilfesuchenden die Tür zu weisen?
Auch wird Olga ihm als Frau gefallen haben. Sie war überaus gebildet, schlagfertig und klug, was ihn immer sehr anzog. Darüber hinaus stammte sie wie Carolyne von Sayn-Wittgenstein aus der heutigen Ukraine. Beide Frauen waren fanatisch in ihrer Liebe, unabhängig in ihrem Denken, unkonventionell in ihrem Auftreten. Die Fürstin und die erschwindelte Gräfin – sie liebten bizarre Verhaltensweisen (man denke nur an die Passion für das Zigarrenrauchen), und beide umgaben sich mit einer Aura der Exotik. Vielleicht erinnerte ihn Olga an Carolyne – an jene Frau, die er einst geliebt hatte. Gut möglich.
Liszt protegierte seine neue Studentin, wo er nur konnte. Ende Mai 1870 begleitete Olga ihren Lehrer nach Weimar, wo er an einem Festival aus Anlass des 100. Geburtstages Ludwig van Beethovens teilnahm. Bei dieser Gelegenheit erklang Liszts Festkantate Zur Säkularfeier Beethovens für Soli, Chor und Orchester. Olga war auch mit von der Partie, als Liszt sich im Sommer zeitweise in Ungarn niederließ. Zum Hintergrund: Am 19. Juli 1870 brach der Deutsch-Französische Krieg aus. Frankreichs Armee war hoffnungslos unterlegen und erlebte am 1. September 1870 bei Sedan in den Ardennen ein militärisches Fiasko. Von nun an ging alles sehr schnell: Kaiser Napoleon III. geriet in Gefangenschaft, die Französische Republik wurde proklamiert, Metz kapitulierte im Oktober, das seit September belagerte Paris gab Ende Januar 1871 auf. Da Liszts Sympathien aufseiten der Franzosen lagen – die Verwandtschaft mit Émile Ollivier, der in der französischen Politik eine bedeutsame Rolle spielte, wird ein wichtiger Faktor gewesen sein –, wollte er während des Krieges nicht in Deutschland sein. In dieser Situation nahm er die Einladung seines Freundes Antal Augusz nach Ungarn an. Der Baron wohnte in Szekszárd, einer Kleinstadt etwa 150 Kilometer südlich von Budapest. Dort blieb Liszt knapp neun Monate; von den Kindertagen abgesehen, war das der längste Aufenthalt in seinem Vaterland.
Liszt erhielt in diesem Herbst 1870 häufig Besuch. Der Geiger Eduard Reményi schaute in Szekszárd ebenso vorbei wie Liszts Schülerin Sophie Menter und die Komponisten François Servais, Ödön von Mihalovich und Mihály Mosonyi. Auch Olga Janina gehörte zu den Gästen. Am 25. September wirkte sie in einem Wohltätigkeitskonzert zugunsten des örtlichen Frauenvereins mit, und Mitte Oktober gab sie in einem Szekszárder Hotel sogar ein Galadiner für ihren »Meister«. Am 22. Oktober feierte Liszt seinen 59. Geburtstag, das gesamte Städtchen war an diesem Samstag auf den Beinen. Antal Augusz’ Villa wurde illuminiert, und Liszt trat wie ein König an das geöffnete Fenster. Als die auf den Straßen wartende Menschenmenge den Abbé erblickte, brandete Jubel auf: »Lang lebe Franz Liszt!« Es folgten ein Festkonzert, in dem Olga eine Lohengrin-Bearbeitung zum Besten gab, sowie ein Bankett für 130 Personen. Ende Dezember finden wir Olga an Liszts Seite in Pest. Doch danach verlieren sich ihre Spuren wieder.
Etwa zur Jahreswende 1870/71 scheint Olgas Leben eine entscheidende Wende genommen zu haben. Durch den Tod ihres Vaters geriet sie in Geldnöte. Da die familiären Zahlungen ausblieben, konnte sie sich den kostspieligen Lebenswandel, das Reisen und wohl auch die Drogen irgendwann nicht mehr leisten. In einem Akt der Verzweiflung versuchte sie im Frühjahr 1871 im Baden-Badener Spielkasino ihr Glück – ohne Erfolg. Anschließend gab sie Konzerte in Warschau und Russland. Etwa aus dieser Zeit stammt der einzige erhalten gebliebene Brief Liszts an Olga. Am 17. Mai 1871, ihrem 26. Geburtstag, schrieb er an »Madame Olga Janina (née Comtesse Zielinska)« in Warschau:
»Haben Sie, an diesem 17. Mai, die verliebte Umarmung meiner Seele gespürt? Sie ist traurig bis in den Tod, und mein Frieden wird nur aus der bittersten Bitterkeit entstehen – (Ecce in pace amaritudo mea amarissima!).
Was schwatzen Sie da von einem ›Almosen der Wut, des Hasses‹? – Ich habe hier bei mir die beiden roten Hefte mit dem goldenen Stern, die Sie mir in die Villa d’Este gebracht haben. Darin steht ganz anderes. Leugnen Sie das nicht, sondern folgen Sie diesem Stern, der Ihnen in meinem Herzen leuchtet.
Sie tun gut daran, ihr außergewöhnliches und bewundernswertes musikalisches Talent zu ›nutzen‹, oder vielmehr, es zu entfalten. Aber um diese Entfaltung nicht zu verderben, müssen Sie Ihre exzentrischen und wechselhaften Launen in den Griff bekommen, die in guter Gesellschaft inakzeptabel sind und meinen Wünschen ebenso widersprechen wie der Würde Ihres Charakters.
Durch Ihre Energie und Ihren Sklaveneifer werden Sie in der Kunst viel erreichen. Ist es möglich, dass Sie darauf verzichten wollen, trotz des Aufschreis Ihres Gewissens, und dass Sie sich von den schändlichen Vergnügungen des Radaus, den ›Erniedrigungen‹, mit ihrem Apothekerkram, Revolvern und anderem widerlichen Unsinn in die Tiefe reißen lassen? Dazu sage ich Nein und nochmals Nein! Lassen Sie mich Ihre Hand drücken und küssen. Ich warte auf Nachricht von Ihnen aus Russland.«23
Ein merkwürdiger Geburtstagsgruß, der zwischen zärtlicher Liebesbekundung und Strafpredigt changierte. Liszt redete ihr energisch ins Gewissen, erwähnte Olgas Launenhaftigkeit ebenso wie ihre Drogensucht, die er freundlich mit »Apothekerkram« umschrieb. Doch das Geburtstagskind brauchte keine warmen Worte, es brauchte offensichtlich Bares. Hatte sie ihn um Geld (»Almosen der Wut, des Hasses«) angebettelt, das er ihr nun versagte?
Im Juli brach Olga in Richtung New York auf. Was dann geschah, lässt sich nicht mehr vollständig ermitteln. Da Liszt alle Briefe von ihr augenscheinlich sorgfältig vernichtet hat und der Verbleib von Madame Janinas Nachlass nicht bekannt ist, sind wir auf Vermutungen und mündliche Überlieferungen angewiesen. Angeblich soll Liszt sie dazu ermuntert haben, in der Neuen Welt Konzerte zu geben und so das schnelle Geld zu machen. Ein Fragezeichen scheint angebracht: Liszt neigte nicht zu übereilten Empfehlungen, die gewissermaßen auf eine Flucht hinausliefen. Darüber hinaus war er selbst nie in den Vereinigten Staaten gewesen, kannte den dortigen Musikbetrieb also gar nicht aus eigener Anschauung. Und nicht zuletzt neigte sich die New Yorker Konzertsaison bei Olgas Ankunft schon wieder dem Ende zu, sodass es für sie kaum etwas zu verdienen gab. Alles in allem hätte man ihr diesen Trip guten Gewissens nicht empfehlen können. Wenn Liszt ihr dennoch zugeraten haben sollte – wollte er sie vielleicht auf einfache Art und Weise loswerden? Hatte er etwa gehofft, dass Olga in den USA auf andere Gedanken kommen und ihn vergessen würde? Diese Vorstellung wäre sehr naiv gewesen.
Olgas Amerikatour entwickelte sich, was unter solchen Umständen nicht weiter verwundert, zu einem Fiasko. Hören wir sie selbst: »Ich hatte an X… [Liszt] geschrieben und nun wartete ich Tag für Tag auf seine Antwort. Die Antwort kam. Es gibt eine Art von Liebe, die der feigen Anhänglichkeit eines Hundes an einen willenlosen Herrn ähnelt. Der Brief war erbarmungslos. Dieses Meisterwerk der Kälte und der berechnenden Grausamkeit legte ich auf mein Herz; ich las es zwanzig Mal, wie einen Trost. Ich gebot meiner Empörung Einhalt, wenn mir, während kurzer Augenblicke, die rechte Beurteilung der Dinge klar wurde. Ich schrieb meinem Herrn einen demütigen, sanften Brief; ich flehte ihn an, einige liebevolle Worte an mich zu richten, die mein Trost und meine Kraft sein sollten. Was hatte ich ihm denn getan, als ihn zu lieben, ihn zu bewundern, ihn zu verteidigen! Was wollte ich tun, so weit entfernt von ihm durch eine übermenschliche Überwindung meiner Leidenschaft, als sein Werk zu verbreiten!«
Ein weiterer Monat verging. »Was ich gelitten habe, während ich auf November und auf die Antwort auf meinen zweiten Brief wartete, lässt sich nicht beschreiben. Dieses Leid trübte jede Klarheit meines Geistes. Es gab Augenblicke, in denen ich, vom Schmerz besiegt, nach Gott schrie. X… antwortete nicht.« Schließlich verlor Olga die Nerven. »Am 1. Oktober schrieb ich abermals. Ich bat ihn inständig, mir das Almosen einiger zärtlicher Worte zu senden, auch wenn diese Worte nur eine Lüge seien. Am 12. November schließlich erreichten mich diese Zeilen: ›Die Heftigkeit Ihrer Gefühle stört meine Ruhe, die eine der Grundlagen meiner Existenz ist. Sie müssen es daher ertragen, dass ich davon absehen werde, Ihre merkwürdigen Hirngespinste zu empfangen, bis Sie begriffen haben, dass Glück ohne die Einhaltung der göttlichen Gesetze nicht möglich ist. Sie müssen auch mit Ihrem Schicksal ins Reine kommen, das übrigens lediglich das Ergebnis Ihrer großen Unbesonnenheit ist.‹«24
Das klingt in Wortwahl und Tonfall nach einem »echten Liszt«; es ist daher gut möglich, dass sie diese Zeilen wörtlich zitiert hat. Olga schäumte vor Wut, gegenüber Dritten sprach sie sogar wüste Drohungen gegen ihn aus. Als Liszts New Yorker Verleger Julius Schuberth davon erfuhr, warnte er seinen Komponisten – er möge sich vor Olga in Acht nehmen, diese Frau sei krankhaft hysterisch, mit ihr sei nicht zu spaßen. Olga war von der Vorstellung besessen, sich für jenes »Meisterwerk der Kälte und der berechnenden Grausamkeit« rächen zu müssen. Sie kabelte nun an Liszt: »Breche diese Woche auf, um Ihnen Ihren Brief heimzuzahlen.«
Liszt war schockiert – doch was konnte er unternehmen? Er hätte die Polizei informieren können, allerdings war ja gar nicht klar, wo Olga ihm auflauern würde – in Rom, Weimar oder Pest. Der Abbé entschied sich, die Nerven zu behalten. Tage und Wochen vergingen – vielleicht hatte Liszt die Angelegenheit schon wieder vergessen. Am Samstag, dem 25. November 1871, überschlugen sich jedoch die Ereignisse: Olga Janina stürmte in Liszts Pester Wohnung. Sie hatte eine Pistole bei sich, mit der sie in höchster Erregung herumfuchtelte, sowie einige Phiolen mit Gift. Liszt: »Es scheint, dass Madame Janina ihren Freunden und Bekannten ganz offen ihren Entschluss mitgeteilt hatte, dass sie nach Pesth kommen wolle, um mich und sich selbst umzubringen. Tatsächlich betrat sie mein Zimmer, ausgestattet mit einem Revolver und mehreren Fläschchen Gift – Accessoires, die sie mir bereits zweimal im vergangenen Winter vorgeführt hatte.« Olga war außer sich und drohte, dass sie Liszt töten und anschließend Selbstmord begehen wolle. Plötzlich erschienen auch Ödön von Mihalovich und Antal Augusz, die Liszt vorsichtshalber informiert hatte. Doch Liszt bat seine Freunde, wieder zu gehen; er werde mit ihr schon alleine fertig.
Nachdem Mihalovich und Augusz das Appartement verlassen hatten, verbrachten Liszt und Olga offensichtlich mehrere Stunden alleine miteinander. Er machte einige Monate später gegenüber der Fürstin vage Andeutungen. »Ich sagte ganz ruhig zu ihr: ›Das, was Sie zu tun gedenken, ist schlecht, Madame. Ich bitte Sie, es zu unterlassen – aber ich kann Sie natürlich nicht daran hindern.‹«25 Die Situation schien endgültig zu eskalieren, als Olga eines ihrer mitgebrachten Giftfläschchen öffnete und den Inhalt herunterschluckte. Sie ließ sich nun zu Boden fallen und verfiel in Krämpfe und Zuckungen. Diese Szene war aber nur gespielt, und Liszt gelang es, seine Schülerin zu beruhigen. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages brachte er sie in ihr Hotel. Ein vorsichtshalber benachrichtigter Arzt stellte fest, dass das vermeintliche Gift harmlos war. Mihalovich und Augusz forderten Olga jetzt ultimativ auf, Pest zu verlassen, andernfalls würden sie rechtliche Schritte gegen sie einleiten; am 27. November reiste Olga in Richtung Paris ab.
Warum hatte Liszt die Polizei nicht zu Hilfe gerufen? Warum hatte er sich auch jetzt noch gegenüber Olga so auffallend nachsichtig verhalten? Der Fürstin erklärte er: »Ich erhob ganz entschieden Einspruch gegen ein Eingreifen der Polizei, was im Übrigen vollkommen zwecklos gewesen wäre, da Madame Janina durchaus in der Lage wäre, einen Revolverschuss abzufeuern, bevor man die Zeit gehabt hätte, sie zu fesseln.«26 Liszts Sorge war sicherlich berechtigt, für seine Zurückhaltung gab es aber noch einen weiteren Grund: Er fürchtete das Bekanntwerden der »Affaire Janina«. Olgas Verhaftung hätte polizeiliche Ermittlungen nach sich gezogen, die kaum unbemerkt geblieben wären. Ihm war diese leidige Sache so peinlich, dass er darüber am liebsten geschwiegen hätte. Bereits wenige Tage nach dem Beinahe-Attentat schrieb er an Carolyne: »Ich bitte Sie dringend, darüber nicht zu sprechen – auch nicht mir gegenüber –, da ich diese Episode, die Dank meines Schutzengels nicht in einer Katastrophe oder in einem öffentlichen Skandal endete, so schnell wie möglich vergessen möchte.«27 Gegenüber der Baronin von Meyendorff erwähnte Liszt nur ausweichend ein »Schreckgespenst«, das plötzlich aufgetaucht sei – »ersparen Sie mir den Schmerz eines detaillierteren Berichts«.28 Das Publikwerden konnte zwar vorerst vermieden werden, die Angelegenheit war damit aber noch lange nicht ausgestanden. Das Schlimmste stand Liszt noch bevor.
Rache ist süß
Olga Janina ließ sich in Paris nieder, konzertierte gelegentlich, hielt im Frühjahr 1873 sogar Vorträge über Liszts Musik – und bereitete im Stillen ihre Rache vor. Das erste Produkt ihres Hasses erschien im folgenden Jahr in Form eines Buches: Souvenirs d’une cosaque. In den folgenden zwei Jahren brachte sie drei weitere Veröffentlichungen heraus: Souvenirs d’un pianiste, die als fiktive Entgegnung Liszts gedacht waren, sowie Les amours d’une cosaque par un ami de l’Abbé ›X‹ und Le roman du pianiste et de la cosaque. Alle vier Werke stammen aus Olgas Feder, auch wenn man ihren Namen vergeblich auf den Buchdeckeln sucht. Als Autor der »Erinnerungen einer Kosakin« trat ein gewisser Robert Franz in Erscheinung, was einen besonders perfiden Seitenhieb darstellte: Der 1815 geborene Komponist Robert Franz gehörte zu Liszts loyalen Freunden und sah sich nun als Verfasser einer Schmähschrift diffamiert. Die »Erinnerungen eines Pianisten« kamen anonym in die Buchläden, schließlich sollte der Eindruck erweckt werden, dass Liszt selbst dieses Buch als Antwort auf Franz geschrieben habe. Für die beiden letzten Schmöker benutzte Olga das Pseudonym Sylvia Zorelli.
Auf insgesamt 1050 Druckseiten erzählt die Kosakin ihre angebliche Lebensgeschichte. Liszt erscheint als »Pianist« oder eben als ominöser »Abbé ›X‹«, was freilich eine bewusst unzureichende Verschleierung darstellte. Mit anderen Worten: Man sollte ihn leicht erkennen können. Der autobiographische Wert dieser Bücher ist schwer zu beurteilen. Vieles wiederholt sich, nicht selten verheddert sie sich in Widersprüche und beschreibt frei erfundene Begebenheiten. Olgas Fantasie ging mit ihr durch, wenn sie etwa behauptet, dass sie auf einem Familienschloss aufgewachsen sei und als junges Mädchen Wölfe mit bloßen Händen gejagt habe. An anderer Stelle liest man, dass sie in Kiew studiert und zu dieser Zeit einen Tiger als Haustier gehalten habe. Sie sei mit der Wildkatze an einer Leine regelmäßig durch das Konservatorium gegangen, und einmal habe die Bestie den Direktor sogar gebissen.29 Das war offenkundiger Nonsens, und Olgas Machwerke wären als Wichtigtuerei einer gestörten Persönlichkeit schnell in Vergessenheit geraten, wenn nicht Franz Liszt darin eine Hauptrolle gespielt hätte, und das machte sie zu Bestsellern. Alleine die Souvenirs d’une cosaque erschienen in 13 Auflagen.

Olga Janina veröffentlichte vier vermeintliche Enthüllungsbücher über ihre Zeit mit Franz Liszt. Bei den Souvenirs d’un pianiste erweckte sie den Eindruck, als stammten diese von Liszt selbst.
Was lernen wir aus Olgas Memoiren über ihre Beziehung zu Franz Liszt? Auch hier ist deren Aussagekraft in der Regel beschränkt, da viele von Olga beschriebene Begebenheiten – wenn sie denn überhaupt stattgefunden haben – nur zwei Zeugen hatten: Franz Liszt und Olga Janina. Das meiste lässt sich nicht mehr aufklären, da sich Liszt dazu nicht im Detail geäußert hat. Die Autorin ging jedenfalls außergewöhnlich geschickt vor, erwischte sie Liszt doch genau dort, wo er am verwundbarsten war: bei seiner Eitelkeit. Sie beschreibt ihn als selbstverliebten Gockel, als hochmütigen und verlogenen Heuchler, der den Menschen nie sein wahres Gesicht zeige. Seine Religiosität sei nur pfäffisches Getue, in Wirklichkeit sei er ein alter Schwerenöter. »Karfreitag und Karsamstag verbrachte er den ganzen Nachmittag in der Kirche«, so Olga. »Vor dem Grab Christi liegend, vergoss er zahllose Tränen und schlug sich gegen die Brust. Die ganze Stadt weinte zur Erbauung mit.« Nach der frommen Übung habe er Olga aber in ihrem Zimmer besucht. Die Tür fiel ins Schloss, und die spirituelle Erbauung war passé: »Er trug den Kopf erhoben und stolz. Seine Augen glühten voller Leidenschaft. Er umarmte und küsste mich; niemals zuvor hat ein Christ die Auferstehung seines Retters inniger gefeiert. ›Siehst du, mein Liebling‹, sagte er mir, ›es gibt nichts Besseres, als mit seinem Gewissen ins Reine zu kommen.‹ Mir wurde klar, dass seine Anfälle von Buße ihn immer wieder überkommen würden. […] In meinen Augen machte ihn das klein, aber ich liebte ihn so sehr, dass sich all die Verachtung, all der Hass, all die Empörung, die früher mein Herz angesichts solch maßloser Scheinheiligkeit erfüllt hatten, sich nun in eine bittere Traurigkeit auflösten. Dieser Mann glaubte vielleicht daran, dass ihm seine erbarmungswürdige Hinterlist im Himmel nützlich sein könne.«30
Olga hat Liszt nachweislich auch in der Villa d’Este in Tivoli besucht, was ein besonders pikantes Detail darstellt, schließlich handelte es sich bei der Villa um die Sommerresidenz des Kardinals Hohenlohe. Doch Liszt habe sich um seinen frommen Gastgeber nicht weiter gekümmert. »Ich kann dir nicht länger widerstehen!«, habe der Abbé einmal gehaucht und Olga an sich gezogen. Anschließend hätten sie – so La Cosaque – miteinander geschlafen.31
Olga Janina wollte Liszts Glaubwürdigkeit und seine moralische Integrität nicht nur erschüttern, sie wollte den Menschen Franz Liszt der Lächerlichkeit preisgeben, sie wollte ihn seiner Ehre berauben. Das alles lief – drastisch formuliert – auf eine öffentliche Hinrichtung hinaus. Dabei war es von untergeordneter Bedeutung, ob sich
etwa die Szenen in der Weimarer Kirche, in Olgas Zimmer oder in Tivoli tatsächlich so zugetragen haben oder ob das Ganze nicht nur ein Produkt ihrer exaltierten Fantasie war. Als viel wirkungsvoller erwies sich, dass Olga Bilder heraufbeschwor, die ohnehin nicht wenige Zeitgenossen von Liszt hatten. Sie appellierte effektvoll an gängige Vorurteile: dass der Abbé nicht von den Damen lassen könne, dass es mit seiner Religiosität nicht so weit her sei, dass man Liszt einen eitlen Schauspieler nennen müsse und so weiter.
Erschwerend kam noch hinzu, dass der Skandal rund um Madame Olga nicht die einzige anrüchige Geschichte war, die man mit dem alten Liszt in Verbindung brachte. Anton Bruckner erzählte seinem und Liszts Schüler August Stradal folgende pikante Begebenheit: »Ich traf Liszt am Michaeler Platz, der mich einlud, ihn zum Bösendorfer zu begleiten. Kaum waren wir ein paar Schritte in der Herrengasse gegangen, da stürzt eine Frau auf Liszt zu und ruft sehr laut: ›Liebster Franz, wann willst du mich endlich heiraten.‹ Liszt war ganz aufgeregt, packte mich am Arm und sagte: ›Bruckner, kommen Sie geschwind, es ist eine arme Wahnsinnige.‹«32 Jene Dame hieß Hortense Voigt und war in Wien keine Unbekannte. Sie schrieb ihrem Idol Briefe, die mit »Mein Heissgeliebter Bräutigam, mein Süsser, herziger Franz!« begannen.33 Die Frau war offensichtlich gestört, und dennoch schien Bruckner ihr irgendwie Glauben zu schenken. »Oh jegerl«, grantelte er gegenüber Stradal, »sein Meister muss aber aner g’wes’n sein, a Don Juanerl!«34 Anekdoten wie diese fanden vielerorts einen guten Nährboden, und das alte lateinische Sprichwort »Semper aliquid haeret« – Es bleibt immer etwas hängen – erwies einmal mehr seine Richtigkeit.
Doch zurück zu La Janina. War das alles schon schlimm genug, verschickte Olga ihre Pamphlete auch noch eigenhändig an enge Freunde ihres einstigen »Meisters« – Rache ist süß. Dass auch Großherzog Carl Alexander ein Exemplar erhielt, dürfte den Abbé besonders geschmerzt haben. Liszt ließ sich nichts anmerken, mehr noch, er weigerte sich zunächst, die Bücher überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Erst als er immer mehr Zuschriften von Bekannten erhielt, was er denn zu beabsichtigen gedenke, reagierte er. Zwei Stellungnahmen sind überliefert: eine entstand, bevor er die Souvenirs d’une cosaque gelesen hatte, die andere datiert aus der Zeit danach.
»Ich habe die fraglichen Souvenirs noch nicht gelesen. Aber nach allem, was mir darüber zu Ohren gekommen ist, gefällt sich die Autorin darin, mich als möglichst lächerlich und verabscheuungswürdig darzustellen. Es steht ihr und ihren Freunden frei, nach eigenem Gut- oder vielleicht besser gesagt ›Schlechtdünken‹ zu handeln; ich kann dem nur mit taktvollem Schweigen begegnen und werde mich nicht da hinein verwickeln lassen, sondern anderen die Aufgabe überlassen, sich in Erniedrigungen zu ergehen. Dass sich die Kosakin selbst darin übertrifft, mich zu verunglimpfen, und die gelehrte Nélida mich mit Beschimpfungen überhäuft, kann ich gelassen betrachten; beide haben früher in begeisterten Briefen davon geschwärmt, wie edel mein Charakter und wie aufrichtig meine Gefühle seien. Darin möchte ich ihnen keinesfalls widersprechen und werde sie auch weiterhin für ihre bemerkenswerten, herausragenden künstlerischen und schriftstellerischen Fähigkeiten sowie ihren Erfindergeist schätzen, obwohl ich es sehr bedauere, dass sie diese Begabungen dazu verwenden, so massiv meine arme Person anzugreifen. Dieser letzte Band wird mir, so hoffe ich, eine endgültige Warnung sein, mich nicht mehr so unbedacht auf unechte Schwärmereien von Pseudokünstlern und die Glut unerwünschter Leidenschaft einzulassen …«
Liszts zweite Stellungnahme ist für seine Verhältnisse außergewöhnlich scharf, was psychologisch verständlich ist: Auch er will sich jetzt rächen, indem er Olga als verlogene, bösartige und geldgierige Schlange, als kranke Kurtisane, letztlich als Prostituierte darstellt:
»Die Kosakin, anrüchig wie die zwielichtige Nélida, ist nächtelang um mein Haus in Rom herumgestrichen. Mein schwerer Fehler bestand darin, dass ich mich schließlich von ihrer exzentrischen Heldenhaftigkeit, die sie mir vorgespielt hat, und ihrem Kauderwelsch, dem es nicht an Witz und einer fast verblüffenden Wortgewandtheit mangelte, habe täuschen lassen; sie verfügt zudem über eine erstaunliche Arbeitsenergie und ist als Pianistin außergewöhnlich begabt. Gewiss hätte ich sie bei ihrer ersten Liebeserklärung hinausweisen müssen und nicht der törichten Versuchung erliegen dürfen, mir einzubilden, dass ich für sie auf irgendeine Weise für irgendetwas gut sein könnte. – Diese kleinen Schlangen lieben es, in Reichtum zu leben und diesen ebenso wie ihre Schande zur Schau zu stellen …«35
Carolyne von Sayn-Wittgenstein gab sich mit Olgas Stigmatisierung nicht zufrieden. Bevor Liszt die Souvenirs d’une cosaque zur Hand nahm, schrieb sie ihm: »Ich bete zu Gott, dass Ihnen die Lektüre so viel Schmerzen bereiten wird wie mir.«36 Das war eindeutig. Überhaupt hatte Madame la Princesse ihre eigenen Vorstellungen von den Ursachen des Skandals. »Sie hat die feste Ansicht (und begründet sie psychologisch)«, erinnerte sich Lina Ramann, »daß ohne Cosima’s Verrat an Bülow weder die Kosackin-Affaire noch das Meyendorff’sche Leonorenspiel sich würde entwickelt haben. Seit seiner [Liszts] damaligen Verzweiflung sei bei ihm eine Wandlung vor sich gegangen – als Komponisten habe sie ihn gelähmt.«37
Carolynes harsche Reaktion gegenüber Franz’ Tochter war ungerecht. Man konnte Cosima nun wirklich nicht die Schuld für das Verhalten ihres Vaters in die Schuhe schieben. In einem langen Brief an Liszts »oncle-cousin« Eduard wurde die Fürstin deutlicher. Halb in Französisch, halb in ihrem holprigen Deutsch versuchte sie, Liszts Verhältnis zum anderen Geschlecht auf den Punkt zu bringen. »Er hat zehn Jahre hintereinander enthaltsam gelebt. Sowohl in Weimar – als auch in Rom. Nur ist er schwach, und wenn eine Frau sich seiner bemächtigen will, kann er ihr nicht widerstehen.« Als Erste habe die Sängerin Emilie (»Mici«) Merian-Genast Liszt den Kopf verdreht und ihn »aus einem fast weisen, intellektuellen Leben gerissen, das ihm zur Gewohnheit geworden war – und zehn Jahre später hat die Janina dasselbe getan! – Als danach die Meyend[orff ] auftauchte, fand sie alle Gewissensschranken gefallen. Man kann sie wieder aufrichten.«
Bei der Wiederherstellung von Liszts Moral sei Carolyne alleine überfordert: »Er muss ein innerliches Prozess der Reue durchmachen. Ich kann ihm nich[t] zu den helfen, wo ich die beleidigte bin.« Vielmehr sei Eduard der Richtige, Liszt auf den Pfad der Tugendhaftigkeit zurückzuführen. Hinweise auf den Katechismus würden bei Liszt aber nicht greifen: »Er beichtet gewissenhaft. Aber für die Sünden, die de facto nicht zahlreich sind, erhält er leicht die Absolution. « Eduard sollte eher an Liszts Würde als Ehrenmann appellieren. »Das ist es, was ihn empfindlich trifft. Sagen Sie ihm, die Welt wisse sehr wohl, dass Janinas Pamphlet voller Unwahrheiten ist; aber man sagt, dass nur Nebensächlichkeiten falsch sind.« Es sei ihr – Carolyne – gegenüber undankbar und niederträchtig, dass Liszt in aller Öffentlichkeit seine Affären zur Schau trage. »Sagen Sie ihm, dass die Welt, die einem verheirateten Mann alle Untreue nachsieht, derartige Vergehen nicht entschuldigt.« Und weiter: »Sagen Sie ihm, dass die Welt alle seine heimliche Untreue vergeben hätte – aber sich auflehnt gegen den in aller Öffentlichkeit gezeigten Mangel an Rücksicht auf eine Frau, die er ganz angenommen hat und deren Ehemann er sein müsste.«
Schließlich folgt der vielleicht wichtigste Abschnitt. Anstatt Liszts Werke zu lieben, habe man um seine Persönlichkeit, »die nie ganz Tadellos war«, in der Presse und in der Öffentlichkeit viel zu viel Aufsehen gemacht. Man habe seine Eskapaden bewundert und seinen mondänen Lebensstil gepriesen: »Ich bin dahintergekommen – dass er glaubt sein Glück bei der Frauen erhällt [sic!] diese Meinung über seine Persönnlichkeit und macht aus ihm einen legendären Mann! Daher hält er sich nur an das, was dem Mann das Recht gibt, eine Frau zu kompromittieren, um daraus das Prestige des Glücks zu erlangen.« Zu guter Letzt bat Carolyne den »cher Mr Edouard« um absolute Verschwiegenheit: »Sie können alles vermuthen sie dürfen nichts wissen von mir! Sonst sieht er in Sie nur meinen Delegat der ihm in meinem Name[n] eine Lewite liest.«38
Dieser Brief, der in der bisherigen Liszt-Forschung zumeist übersehen wurde, ist brisant. Zunächst wird klar, dass die Fürstin Sayn-Wittgenstein keinerlei Zweifel daran hatte, dass Liszts Abenteuer mit Olga Janina, Emilie Merian-Genast oder der Baronin von Meyendorff eben auch sexueller Art waren. Man könnte auch Agnes Street-Klindworth hinzunehmen, doch vielleicht wusste Madame in Rom gar nichts von dieser langjährigen Amoure. Liszts ältere Biographen befanden sich auf dem Holzweg, wenn sie diese Beziehungen zu sittenstrengen und keuschen Freundschaften idealisierten. Carolyne zeichnete vielmehr das Bild eines Mannes, der bis ins hohe Alter für Erotik und sexuelle Ausstrahlung empfänglich blieb. Ihre Analyse war erbarmungslos – im Grunde beschrieb sie einen alternden Casanova, einen in die Jahre gekommenen Don Juan, der sein Selbstwertgefühl von »seinem Glück bei den Frauen« ableitete.
Adelheid von Schorn, Carolynes Stellvertreterin in Weimar, drehte den Spieß um und verklärte Liszt zum Asketen. »Ich habe nie ein junges Mädchen verführt«, soll er ihr einmal gebeichtet haben. »Ich weiß, daß dieser Ausspruch wahr ist«, bestätigte Adelheid, die aber kaum dabei gewesen sein dürfte. Es ist ohnehin fraglich, ob Liszt ein solches Geständnis wirklich abgelegt hat. Was war denn mit den »älteren Mädchen«, mag man spöttisch fragen? Doch auch dafür hatte Adelheid eine Erklärung. »Was Liszt für eine beispiellose Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht hatte, habe ich oft, fast mit Grausen, gesehen. Und das hörte auch mit seinem Altwerden nicht auf. Es war geradezu schmerzlich, daß sich noch immer solche fanden, die den ruhebedürftigen Greis als begehrenswerte Beute betrachteten. Aber wie Liszt – trotz alledem – an jeder Frau nur die beste ihrer Seiten sah, so ließ er sich darin auch nicht irre machen, wenn sie sich ihm aufdrängten.«39 Hier setzte die Legendenbildung der Liszt-Biographen ein: Franz wurde gewissermaßen entsexualisiert und zum bloßen Opfer liebeshungriger Frauenzimmer stilisiert. Die Fürstin wusste es besser.
Franz Liszts bisheriges Leben war reich an Skandalen und Skandälchen gewesen. Viele verebbten als Sturm im Wasserglas, andere – etwa Nélida – bereiteten ihm viel Kummer. Die Affäre rund um La Cosaque zeigte eine andere Qualität. Sie erschütterte ihn nicht nur schwer, sie führte ihm auch schmerzlich die Zerrissenheit seiner Persönlichkeit vor Augen. »Es bleibt noch ein langer Kampf, bis ich meinen alten, erbitterten Feind besiegt haben werde«, schrieb er einmal der Fürstin, »denn es ist nicht der kleine Teufel, der in meinem Hang zum mondänen Leben und zu Extravaganzen steckt, sondern vielmehr der Dämon der extremen Emotionen und Erregungen! Da ich ihn kenne – schließlich bin ich ihm schon mehrmals erlegen – vermeide ich alle Gelegenheiten, bei denen er mich zu leicht überwältigen könnte – und ich hoffe, ihn irgendwann ganz zu besiegen durch Gottes Gnade, die ich jeden Tag erflehe.«40
Die liebe Familie
Mein großer, lieber Freund!«, begann Richard Wagner seinen Brief vom 18. Mai 1872 an Liszt. Mehr als vier Jahre lag die letzte Begegnung zurück, und in jener Zeit war viel passiert, zu viel, mag man ergänzen, was einer Wiederannäherung im Wege zu stehen schien. Nun tat Wagner den ersten Schritt und lud Liszt zur Grundsteinlegung des Festspielhauses nach Bayreuth ein: »Cosima behauptet, Du würdest doch nicht kommen, auch wenn ich Dich einlüde. Das müßten wir denn ertragen, wie wir so manches ertragen mußten! Dich aber einzuladen kann ich nicht unterlassen. Und was rufe ich Dir denn zu, wenn ich Dir sage: komm? Du kamst in mein Leben als der größte Mensch, an den ich je die vertraute Freundesanrede richten durfte; Du trenntest Dich langsam von mir, vielleicht weil ich Dir nicht so vertraut geworden war als Du mir. Für Dich trat Dein wiedergeborenes innigstes Wesen an mich heran und erfüllte meine Sehnsucht, Dich mir ganz vertraut zu wissen. So lebst Du in voller Schönheit vor mir und in mir, und wie über Gräber sind wir vermählt.«41
Es sei einmal dahingestellt, wie ernst es Wagner war. Ging es ihm wirklich um eine Aussöhnung mit seinem Schwiegervater? Oder bemühte er sich vielmehr um einen weiteren prominenten Ehrengast, dessen Anwesenheit der Bayreuther Grundsteinlegung einen gewissen festlichen Glanz verleihen würde? Wie auch immer – Wagners Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Zwar reiste Liszt nicht zum Festakt an, doch schrieb er einen Brief, der echte Rührung erkennen lässt. »Erhabener, lieber Freund!«, lautete die Anrede. »Tieferschüttert durch Deinen Brief, kann ich Dir nicht in Worten danken. Wohl aber hoffe ich sehnlich, daß alle Schatten Rücksichten, die mich ferne fesseln, verschwinden, und wir uns bald wiedersehen. «42
Der Brief wurde von Liszts Freundin Olga von Meyendorff persönlich überbracht, die ihren Botendienst aber offensichtlich mit despektierlichen Bemerkungen verbunden hatte. Cosima und Richard Wagner hatten daher den Eindruck, dass die Baronin für Liszt spreche und in Weimar eine feindliche Stimmung gegenüber den Bayreuthern herrsche. Wagner war enttäuscht und verärgert; sein Groll entlud sich nun ausgerechnet auf Adelheid von Schorn. Zunächst hatte er mit der ihm völlig unbekannten jungen Frau noch gescherzt, als er aber erfuhr, dass Adelheid aus Weimar angereist war, kippte die Stimmung: »Da ließ Wagner meine Hand los, drehte sich auf dem Absatz um und ging fort. Das war kein angenehmer Moment – ich wußte nicht, sollte ich gehen oder bleiben. Aber das dauerte nur einen Augenblick, dann wurde mir der Zusammenhang klar. Das galt nicht meiner harmlosen Person, sondern Liszt. […] Daß Liszt nicht gekommen, hatte ihn tief verletzt, und ich mußte es entgelten. «43 Die Nerven lagen blank. Als Cosima von einer anderen Bekannten aufgefordert wurde, ihren Vater alleine in Weimar zu besuchen, erwiderte sie barsch, »daß ich dies nur mit Wagner tuen werde, entweder das Wiedersehen groß und ganz, [oder] gar nicht«.44 Stolz, wie sie nun einmal war, fürchtete sie sich davor, dass Liszt ihr erneut Vorwürfe machen könnte. Sie wollte ihrem Vater keinesfalls als Bittstellerin gegenübertreten. Je näher der Termin rückte, desto größer wurde das Unbehagen. »Unerfreuliche Besprechung mit R.«, notierte sie Ende August in ihr Tagebuch. »Große Befürchtungen, diese Reise scheint uns eine Torheit – Gott weiß, was wir beschließen; in beiden Fällen werden wir beunruhigt sein.«45 Als Liszt die von der Baronin verursachten »Missverständnisse« ausgeräumt hatte, stand dem Wiedersehen nichts mehr im Wege.
Am Abend des 2. September 1872 trafen die Wagners in Weimar ein: »Der Vater wohl und erfreut, schönes Zusammensein im Russischen Hof.«46 In den folgenden Tagen verbrachten sie viel Zeit miteinander. Bei Tisch versuchte Wagner das Eis zu brechen und erzählte kleine Witze – mit Erfolg: Die Stimmung war gelöst. Liszt machte seiner Tochter sogar eine große Freude und spielte für sie Werke von Bach, Beethoven und Chopin sowie Auszüge aus Richards Opern. Cosima: »Er gedenkt viel der früheren Zeiten, wo wir zusammen auf dem Markt in Berlin Obst kauften – und der alte Zug der Zusammengehörigkeit findet sich ein.«47
Doch bereits am nächsten Tag merkte sie, dass etwas nicht stimmte, »er hatte es büßen müssen, daß er gestern seine große Neigung zu mir zeigte!«48 Jene »Buße« hatte ihm offensichtlich die unvermeidliche Olga von Meyendorff auferlegt. Man kann sich vorstellen, was die Baronin ihm möglicherweise vorgehalten hat: Wagner sei ein Halunke, Tochter Cosima eine Ehebrecherin, der arme Hans von Bülow der Geprellte und dergleichen mehr. Doch die Meyendorff sprach das aus, was auch die Fürstin dachte, und erinnerte Liszt schmerzlich daran, dass es Carolyne war, die einer Aussöhnung mit den Wagners im Wege stand. Cosima hatte von alledem keine Ahnung; sie verstand noch nicht, warum der Vater sich plötzlich so reserviert, gar abweisend verhielt. Betrübt reisten die Besucher am 6. September wieder ab: »Ich gehe mit Trauer von dannen, nicht die Trennung schmerzt mich, sondern die Angst, ganz geschieden zu sein.«49
Als die Fürstin von dem Familientreffen erfuhr, reagierte sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mittel. Sie überschüttete Liszt mit hämischen Briefen, in denen sie insbesondere Richard Wagner und dessen Ring des Nibelungen wüst angriff. Sie hielt Wagner für so etwas wie einen Ketzer, für die Inkarnation des Antichristen, der Liszts Seelenheil gefährde. Liszt und Wagner müssten daher unterschiedlichen Bestimmungen folgen, wie sie Liszt Mitte September 1872 vorhielt: »Ein Schritt genügt, um sich zwischen dem Weg, der nach rechts führt, und jenem, der nach links führt, zu entscheiden. Dieser Schritt wird Ihre Anwesenheit oder Ihre Abwesenheit bei den Nibelungen in Bayreuth sein! Nehmen Sie dies für so gewiss, als würde die Vorsehung selbst es Ihnen sagen. Sie wollen das, weil es Ihnen gefällt, weil es Sie begeistert. Sie wollen es, koste es, was es wolle – und treten dabei mein Herz mit Füßen. In der Tiefe Ihres Bewusstseins haben Sie einen Instinkt, der Ihnen dies gewiss sagt. Sie spüren, dass Sie, wenn Sie erst einmal da sind, sich selbst dafür ohrfeigen könnten. Sie würden eine offenkundige Leichtsinnigkeit begehen, mit der schönsten, der größten Tat Ihres Lebens, indem Sie mit dem Ruhm Ihres Genies aus dem Lager Christi, dessen heiliger Losung Sie sich verschrieben haben, zu den Anhängern Buddhas überlaufen, dessen antichristliches Dogma Wagner verkündet und dessen Flagge er auf seinem Theater gehisst hat! Und Sie wissen, dass nicht Härte aus meinem Mund spricht, dass, wenn Cosima zu mir käme – (und vielleicht wird sich noch das eine oder andere Unglück ereignen, das sie dazu bringt) –, sie meine Tür, meine Arme, mein Herz offen fände. Liebe ist etwas anderes, als sich an einer Sache zu beteiligen, die weder gut noch heilig ist!«50 Das war deutlich.
Carolyne hatte die gescheiterte Hochzeit mit Liszt nie verwunden; seitdem versuchte sie ihn mithilfe eines verschrobenen Katholizismus an sich zu binden. So ernst die Sorgen der strenggläubigen Dame um Liszts Seelenheil auch immer gemeint waren – mit diesen frommen Appellen versuchte sie auch, Macht über ihren einstigen Lebensgefährten auszuüben. Sie verteufelte die »heidnischen« Wagners, musste sie doch befürchten, dass sich Liszt durch deren Einfluss weiter von ihr entfernen könnte. Als Liszt schließlich ankündigte, ausgerechnet anlässlich seines Geburtstages am 22. Oktober Bayreuth besuchen zu wollen, zog sie alle Register: »Sie gefeiert zu sehen von denen, die Jesum Christum in Worten und Taten verleugnen, die Böses tun, und sagen, daß sie Gutes täten – das wird einmal ein schmerzliches Kapitel in Ihrer Biographie sein, da Sie sich ja selbst sagen müssen, daß Sie dieses Fest herausgefordert haben, indem Sie gerade in diesen Tagen Ihren Besuch in Bayreuth machen!«51
Der so Gescholtene ließ sich zunächst nicht beirren. Die Familie Wagner saß am 15. Oktober gerade beim Mittagessen, als das Hausmädchen die Ankunft des Dr. Liszt meldete. Die Freude über das Wiedersehen war auf allen Seiten groß, und Liszt nahm in den folgenden sechs Tagen am Familienleben regen Anteil. Nach dem morgendlichen Kirchgang frühstückte er mit den Seinen, nachmittags besichtigten sie die Baustelle des Festspielhauses oder machten Ausflüge in die Umgebung. Abends kamen oft Gäste, für die der Abbé sogar Klavier spielte. Wagner nahm den Besuch seines Schwiegervaters mit Humor: »Ein edler Geist, ein guter Christ, es lebe Franz Liszt«,52 kalauerte er in einem Trinkspruch.
Vater und Tochter nutzten das Zusammensein aber auch, um sich gründlich auszusprechen. »Langes Gespräch mit dem Vater; Fürstin Wittgenstein quält ihn in Bezug auf uns, er solle Wagner’s Einfluß fliehen, künstlerisch wie moralisch, mich nicht wiedersehen, dies erheische seine Würde, wir hätten einen moralischen Mord an Hans verübt u.s.w. Ich bin sehr betrübt, daß der Vater also gequält wird – er ist so müde, und immer wird an ihm gezerrt! Namentlich die unselige Frau in Rom hat nie anderes gewußt als ihn aufzuhetzen – – mich und uns will er aber nicht aufgeben.«53 Cosima Wagner zeigte sich aber auch erleichtert: Hatte sie zunächst befürchtet, dass Liszt sie verstoßen würde, verstand sie nun, dass es Carolyne war, die gegen die Wagners giftete. Doch auch nach dieser Beichte blieb der Schatten der Fürstin allgegenwärtig, denn Liszt wagte es nicht, bis zu seinem Geburtstag in Bayreuth zu bleiben. Vielleicht war es die Angst vor Carolynes Strafgericht, vielleicht wollte er sich aber auch nur Widrigkeiten ersparen – am Morgen des 21. Oktober reiste er jedenfalls nach Regensburg, wo er seinen 61. Geburtstag ganz alleine verbrachte.
Der Dauerzwist mit Carolyne ließ ihm keine Ruhe; Ende Oktober schrieb er ihr: »Übrigens weiß ich nicht, wer Sie hat glauben lassen können, daß Cosima und Wagner ›Jesus Christus verleugneten‹ und sich offenkundig zum Atheismus bekennen würden. Kein Wort ihrerseits berechtigt zu einer solchen Annahme.« Er wirkt geradezu rührend, wie er die Wagners gegen ihre Kritikerin in Schutz nimmt. »Zweifellos erhebt Wagner keinen Anspruch darauf, zu den orthodoxen und frommen Christen zu zählen, aber muß man ihn deswegen unbedingt in die Schar der Gottlosen zurückwerfen. […] Aber wahrscheinlich halten Sie mich für einen schlechten Gewährsmann in diesen Dingen, die für meinen schwachen Verstand zu erhaben sind.« Am Ende seines langen Briefes scheint Liszt gespürt zu haben, wie sinnlos der Versuch einer Ehrenrettung war. »Ihr Flug hat Sie in erhabenere Regionen befördert, und ich bin in dem steinigen Tal der üblichen, in den Tag hinein lebenden Kunst allein zurückgeblieben. Oft suche ich dort in Gedanken Ihre Hilfe, Ihren Beistand, deren Verlust ich, gerade indem ich mich füge, und Sie aus der Tiefe meines Herzens bewundere, spüre.«54
Liszt schrieb diese Zeilen auf Schloss Horpács bei Ödenburg, wo er einige Tage bei seinem Freund Graf Imre Széchényi verbrachte. Bei dieser Gelegenheit machte er auch einen Abstecher in das nahe Raiding. »An meinem Geburtshaus sind seit meinem letzten Besuch vor 24 Jahren keine merklichen Änderungen vorgekommen«, berichtete er Eduard Liszt. »Die Bauern erkannten mich alsbald, machten mir ihre Aufwartung im Gasthaus und läuteten die Kirchenglocke bei unserer Abfahrt.«55 Mitte November bezog Liszt wieder sein Refugium in Pest, das damals mit Buda zu Budapest vereinigt wurde. In den folgenden gut fünf Monaten gab er zahlreiche Konzerte und spielte bei Wohltätigkeitsveranstaltungen.
Festklänge
Zu den Höhepunkten des Frühjahrs 1873 gehörte die erste vollständige Aufführung des Oratoriums Christus am 29. Mai in der Weimarer Stadtkirche. Dieses Ereignis stand am Ende eines langen Weges. Bereits 1853 hatte Liszt den Wunsch geäußert, das Leben Christi zu vertonen. Doch das Projekt machte lange Zeit keine Fortschritte, da zunächst ein passendes Libretto fehlte. Der Dichter Georg Herwegh, Liszts Sekretär Peter Cornelius und auch die Fürstin Wittgenstein hatten sich vergeblich bemüht, einen Text zu erstellen. Liszt schrieb die Vorlage schließlich selbst anhand von Auszügen aus der Bibel sowie Teilen der katholischen Liturgie; 1868 war das Mammutwerk vollendet. Der Komponist schildert in 14 Nummern das Leben Jesu Christi – Verkündigung und Geburt, die Heiligen Drei Könige, die Seligpreisungen, der Einzug in Jerusalem bis hin zu Passion und Auferstehung. Dabei verzichtet er auf den berichtenden »Evangelisten«, wie ihn beispielsweise Johann Sebastian Bach in seinen Passionen einsetzte. Ist die Musik anfänglich noch von pastoraler Beschaulichkeit, wird sie im weiteren Verlauf immer komplexer und moderner. Am Ende des meisterhaft instrumentierten Drei-Stunden-Opus steht ein »Resurrexit«, das gewaltige Klangapotheosen bietet.
Die Kirche war bis zum letzten Platz gefüllt, als Franz Liszt um 18 Uhr an diesem Donnerstag vor das Riesenensemble trat. Viele Freunde und Bekannte waren eigens angereist, auch Richard und Cosima Wagner sowie Cosimas älteste Tochter Daniela hatten den Weg nach Weimar gefunden. »Ich stand wieder im Chor, nicht weit von Liszt«, erinnerte sich Adelheid von Schorn. »Wir alle fühlten, daß die Aufführung keine tadellose war. Liszt hatte nur die letzten Proben geleitet […] – Chor und Orchester waren nicht daran gewöhnt, daß er manchmal minutenlang den Taktstock hinlegte – es gab bedenkliche Schwankungen. Daß Wagner im Kirchenschiff saß, wirkte vielleicht noch als ein Druck auf die Ausübenden.«56 Liszt machte an jenem Tag einen zerstreuten Eindruck; ihm war bewusst, dass die Proben nicht ausgereicht hatten. Trotz der widrigen Umstände reagierte das Publikum begeistert, das Resümee der Wagners fiel indes zwiespältig aus. Zwar schrieb Cosima ihrem Vater aus Bayreuth einen ebenso langen wie anerkennenden Brief, in ihrem Tagebuch äußerte sie sich aber weitaus zurückhaltender: »Seltsamer eigenartiger Eindruck, der sich in den Worten zusammenfassen läßt, welche R. zu mir abends sagte: ›Er ist das letzte große Opfer dieser lateinisch-romanischen Welt.‹ Gleich bei den ersten Takten sagte mir R.: ›Er dirigiert herrlich, es wird prächtig gehen.‹« Und weiter: »R. macht alle Phasen der Entzückung bis zur äußersten Empörung durch, um zur tiefsten und liebevollsten Gerechtigkeit zu gelangen.«57
Es ist bemerkenswert, dass Wagner seinen Schwiegervater als Opfer bezeichnete, und dass er während der Aufführung mitunter empört war, spricht Bände. Das alles erfuhr aber nur Cosimas Tagebuch, gegenüber Liszt machten die Wagners gute Miene und hofierten den berühmten Verwandten nach allen Regeln der Kunst. Als ihnen das Gerücht zugetragen wurde, der Dirigent Hans Richter habe sich unfreundlich über Liszt geäußert, griff Cosima umgehend zur Feder. Richter möge sich »als Wagner’s Jünger energisch auch für den Vater – nicht in Worten sondern in Thaten – aussprechen«,58 schrieb sie ihm ins Stammbuch. Für dieses Verhalten gab es gute Gründe. Natürlich war die familiäre Annäherung noch eine zarte Pflanze, die gepflegt werden wollte. Richtig ist aber auch, dass man Liszt beim Aufbau der Bayreuther Festspiele brauchte. Insofern war die Fürsorge für den Abbé auch eine kluge Investition in die Zukunft. Geschäft und Moral waren im Hause Wagner seit jeher zwei Seiten einer Medaille. Es verwundert also kaum, dass Cosima ihren Vater geradezu mit Engelszungen beschwor, zum Richtfest des Festspielhauses nach Bayreuth zu kommen. Liszts Anwesenheit – so das Kalkül – wäre die perfekte Werbung für das gerade entstehende Unternehmen. Der so Umgarnte hatte eigentlich andere Reisepläne, doch sagte er seiner Tochter in letzter Minute zu.
Die Stadt war festlich geschmückt, als am 2. August 1873 auf dem sogenannten Grünen Hügel bei bestem Wetter und unter den Klängen des Tannhäuser-Marsches der Rohbau geweiht wurde. Der Stadtdekan sprach einige fromme Verse, und der Bauherr trug ein eilig entworfenes Gedicht vor. Liszt gab sich während seines Aufenthaltes ganz en famille: Tagsüber unternahm er Ausfahrten mit seinen Enkelkindern, abends wurde musiziert.
Im Herbst 1873 folgten weitere Reisen, bis Franz Liszt Anfang Oktober nach einer 64-stündigen Bahnfahrt in Rom eintraf. Knapp zwei Jahre waren seit seinem letzten Aufenthalt im November 1871 vergangen. Trotz dieser langen Unterbrechung schien er sich nun für die Stadt nicht sonderlich zu interessieren. Überhaupt erinnert diese Visite mehr an einen Pflichtbesuch denn an eine Herzensangelegenheit. »Ich habe mich bislang nicht viel in Rom umgeschaut«, ließ er Olga von Meyendorff wissen, »auch fühle ich mich absolut nicht geneigt, die historischen und künstlerischen Wunder zu erkunden. Die meiste Zeit verbringe ich in Gesprächen mit der Prinzessin Wittgenstein.«59 Zur Enttäuschung der Fürstin konnte er nur gut drei Wochen bleiben und brach dann Richtung Budapest auf.
Als er dort Anfang November eintraf, hatte er nur eine ungefähre Vorstellung von dem, was ihn in den folgenden Tagen erwarten würde. Im Mittelpunkt stand sein 50-jähriges Bühnenjubiläum, das mit allen Ehren gefeiert werden sollte. Das Datum war eher von symbolischer Bedeutung, denn der »kleine Liszt« war ja schon im September 1819 in Eisenstadt aufgetreten. Da man aber offensichtlich einen etwas repräsentativeren Bezugspunkt wünschte, nahm man es mit den Zahlen nicht so genau und erhob das berühmte Wiener »Abschiedskonzert« vom April 1823 zum Karrierebeginn. Die Festivitäten wurden von einem »Liszt-Jubiläums-Comite« unter dem Vorsitz von Erzbischof Lajos Haynald organisiert. Der Gottesmann bezeichnete den Jubilar in einem Aufruf als »Kompatriot« und »großen Sohn« der »ungarischen Nation«.60 Damit war die Richtung vorgegeben: Es ging nicht nur um ein an sich schon beachtliches Künstlerjubiläum, sondern auch um eine Manifestation der nationalen Größe Ungarns. Liszt wurde ganz bewusst als Ungar vereinnahmt, obschon er nur den kleinsten Teil seines Lebens dort verbracht hatte. Doch das stand auf einem anderen Blatt.
Bereits der Beginn der Feierlichkeiten war spektakulär: Zwei Regimentskapellen marschierten am frühen Morgen des 8. November vor Liszts Wohnung auf und brachten ihm ein Ständchen. Unzählige Verehrer und Schaulustige strömten herbei und riefen »Éljen! Ferenc Liszt« – »Es lebe Franz Liszt!«. Den künstlerischen Höhepunkt stellte eine Aufführung des Christus dar, und das Festival endete schließlich mit einem Bankett im Hotel Hungaria. Unter den rund 200 Gästen erblickte Liszt viele Freunde aus ganz Europa, örtliche Honoratioren sowie Abgesandte aus Wien und Weimar. In seiner Rede rief Erzbischof Haynald aus: »Früher ist Liszt zu den Nationen gekommen, jetzt sind es die Nationen, die zu ihm kommen.«61
Das Land befand sich in einem Zustand akuter Lisztomanie – und ein Ende schien nicht in Sicht. Liszt war ein gefragter Mann. Er besuchte Gran, er nahm an einer Aufführung der Graner Messe in Pressburg teil, und am 28. November wurde er sogar von Kaiser Franz Joseph I. in Budapest zu einer Privataudienz empfangen.

»Früher ist Liszt zu den Nationen gekommen, jetzt sind es die Nationen, die zu ihm kommen« (Lajos Haynald). Festkomitee zu Liszts 50. Bühnenjubiläum (v.l.n.r.): Erzbischof Lajos Haynald, Imre von Huszár, Franz Liszt, Graf Imre Széchényi, Ödön von Mihalovich, Baron Antal Augusz, Graf Albert Apponyi, Hans Richter, Graf Guido Karácsonyi, Johann Nepomuk Dunkl. Budapest, November 1873.
Anfang Januar 1874 finden wir Liszt in Wien, wo er ein Wohltätigkeitskonzert geben sollte. Knapp 28 Jahre waren seit seinem letzten Auftritt in der Donaumetropole vergangen. Die Nachricht von dem bevorstehenden Comeback verbreitete sich in Windeseile, und die Billets waren in kürzester Zeit ausverkauft. Unter den Zuhörern an jenem 11. Januar befand sich Wiens Starkritiker Eduard Hanslick; selbst er war von der Begeisterung infiziert. Liszt spiele »das Schwerste mit der Leichtigkeit, Kraft und Frische eines Jünglings!«, so der Journalist. Auch mit 62 Jahren konnte der Pianist sein Publikum noch zur Raserei treiben. Hanslick stellte dabei erstaunt fest, dass Liszt selbst im Kleid des Abbé der große Charmeur der Virtuosenjahre geblieben war. Er inszenierte sich, kokettierte und flirtete, bediente sein Publikum mit wunderbarer Musik und einer ebenso eindrucksvollen Show. »Wie Liszt bald aus den Noten, bald auswendig vorträgt, wie er dabei abwechselnd die Lorgnette [Brille] aufsetzt und wieder herabnimmt, wie er das Haupt hier lauschend vorneigt, dort kühn zurückwirft – das alles interessiert seine Zuhörer unsäglich, noch mehr die Zuhörerinnen. Es gehörte jederzeit zu Liszts Eigenthümlichkeiten, in seiner großen Kunst auch noch mit allerlei kleinen Künsten zu effectuiren. […] Das vielhundertköpfige Publicum klatscht, ruft, jubelt, erhebt sich von den Sitzen, wird nicht müde, den Meister hervorzurufen, der seinerseits in der ruhigen, freundlich dankenden Haltung eines Gewohnheitssiegers kundgiebt, daß er auch noch nicht müde ist.« Hanslicks lakonisches Fazit: »Fürwahr, ein Liebling der Götter!«62
Pflicht und Gehorsam
Franz Liszt hatte über sechs Monate in der k.u.k. Monarchie verbracht, als er Budapest Mitte Mai 1874 verließ. Normalerweise bezog er im Frühjahr sein Quartier in Weimar, doch in diesem Jahr war alles anders. Liszt zeigte sich fest entschlossen, zum ersten Mal in seiner »vie trifurquée« einen weiten Bogen um die Stadt Goethes und Schillers zu machen. Bereits im März hatte er an Carolyne geschrieben: »Ich weiß nicht, wie man in Weimar Wind davon bekommen hat, dass ich möglicherweise nicht dorthin zurückkehre. Seit etwa zwei Wochen schreibt man mir von dort mehrere Briefe, die mir die Vorbereitungen einer zweiten Jubiläumsfeier ankündigen! Loën, Frau Helldorf und andere bedrängen mich mit der Bitte, ihnen mitzuteilen, wann ich zurückkomme. Auf diese eindeutige Frage musste ich ebenso eindeutig antworten, ›dass ich überhaupt nicht zurückkehren werde‹. In der Antwort an Loën zitiere ich sogar einen süffisant-trübsinnigen Ausspruch von Bismarck: ›So habe ich die Erfahrung gemacht, dass man gewissermaßen im Sande ermüdet und seine Ohnmacht erkennt.‹« Nicht nur Olga von Meyendorff und die anderen Weimarer Freunde waren verunsichert, auch Großherzog Carl Alexander wunderte sich über das Fernbleiben seines berühmten Bürgers; sichtlich irritiert erkundigte er sich nach den Gründen. Liszt: »Er schrieb mir im Januar den interessanten Brief, den ich an Sie weiterleitete und von dem ich fand, dass es nicht notwendig sei darauf zu antworten (zumal ich ihm nicht zu früh sagen wollte, dass es zu spät sei).« Erst als der Großherzog in pikiertem Ton erneut intervenierte, schickte Liszt einige Zeilen. Er war gereizt. »Einige Umstände und Personen sind gleichzeitig Kletten und Nervensägen«, schloss er seinen Brief an die Fürstin. »In deren klebenden und nervenden Fängen zu hängen ist ein törichtes Martyrium, das eher lächerlich als löblich ist.«63
In einem Brief an die Baronin von Meyendorff machte Liszt seiner Verärgerung Luft: »Sind Sie sich darüber im Klaren, welche Schmerzen Ihre Königlichen Hoheiten mir – vielleicht unbewusst? – während meiner letzten drei Aufenthalte in Weimar verursacht haben? Sie haben nicht einmal die Fürstin [Wittgenstein] mir gegenüber erwähnt.« Liszts Abwesenheit sollte ein Zeichen sein, er wollte unmissverständlich klarstellen, dass er mit Carolynes fortwährender Ausgrenzung am Weimarer Hof nicht einverstanden war. Der Aufenthalt in Rom sei in der gegenwärtigen Situation seine Pflicht, fuhr er fort, »und das geschieht einzig und allein aus meinem eigenen Antrieb, ohne dass es mir jemand ›verschrieben‹ hätte«.64
Liszt reiste nicht leichten Herzens nach Rom, denn er machte sich große Sorgen um Madame la Princesse. »Die Fürstin ist physisch und mehr noch moralisch krank«, gestand er seiner Tochter Cosima. Ihr Leben sei aus den Fugen geraten, sie hause seit 15 Jahren in einem »unerträglichen Provisorium«, das ihr fortwährend Unannehmlichkeiten bereite, während wunderbare Möbel in Weimar eingelagert seien. Nun sei es an der Zeit, organisatorische Entscheidungen zu treffen. »Diese Beschlüsse aber bedrängen sie im höchsten Grade; sie hat sich ihnen bis heute entgegengesetzt: ich hoffe doch, sie dazu zu bewegen, nicht in acht Tagen, aber in acht Monaten.«65
Franz Liszt hatte sich viel vorgenommen. Am 21. Mai traf er in Rom ein, und wie so oft mietete er ein Hotelzimmer ganz in der Nähe der Fürstin. Er besuchte sie täglich, diskutierte mit ihr und spielte ihr auf dem Flügel vor. Nur in einer Angelegenheit kam Liszt nicht weiter: Als er Carolyne vorschlug, mit ihm nach Weimar zu reisen, um dort drängende Vermögensfragen zu klären, erhielt er eine Abfuhr. Ihrer Vertrauten Adelheid von Schorn erklärte sie: »Sie haben keine Idee, wie fünfzehn Jahre ganz einsamen, durch Arbeit absorbierten Lebens mich ängstlich und unpraktisch gemacht haben. Ich werde nie Rom allein verlassen können! – Von hier nach Siena, vier Stunden Reise, wäre mir vielleicht gelungen – . Aber über die Alpen zu gehen!«66 Man kann nicht behaupten, dass die Fürstin nicht gewollt hätte – sie konnte einfach nicht mehr. Aus diesen Zeilen spricht eine große Lebensangst, die sich der 55-Jährigen bemächtigt hatte.
Franz Liszt kannte die bizarren Verhaltensweisen seiner einstigen Partnerin. Er wusste von ihren vielen skurrilen Marotten, die er meistens milde lächelnd hinnahm. Doch nun ging es nicht mehr nur um Theatralik – Carolyne hätte zweifellos die »komische Alte« in einer Komödie von Beaumarchais spielen können –, um Schrullen oder exzentrische Ticks. Die »physische und moralische Krankheit« der Fürstin äußerte sich in einer zunehmenden Vereinsamung. Anfänglich war Carolyne noch ausgegangen, hatte Einkäufe erledigt sowie Konzerte und Museen besucht – doch im Laufe der Jahre verließ sie das Haus nur noch nach Einbruch der Dunkelheit. Dann fuhr sie mit einer Kutsche durch die Gegend, stieg aber so gut wie nie aus. Sie hegte – wie bereits zitiert – eine geradezu krankhafte Angst, Rom zu verlassen. Selbst die heißen Sommer verbrachte sie in ihrer Wohnhöhle, obwohl es nicht an Angeboten mangelte, in kühlere Gefilde zu übersiedeln. Einmal besuchte sie die Villa d’Este, aber bereits am nächsten Tag hielt sie es dort schon nicht mehr aus. Zu den psychischen Zwängen gesellten sich verschiedene körperliche Gebrechen.
Nachdem Liszt gut zwei Wochen bei der Fürstin in Rom verbracht hatte, bezog er sein Arbeitsrefugium – die wunderschöne Villa d’Este in Tivoli und komponierte dort Die heilige Cäcilia – eine »Legende« für Mezzosopran, Chor und Orchester – sowie Die Glocken des Strassburger Münsters, ebenfalls ein Werk für Soli, Chor und Orchester. Hin und wieder machten ihm Freunde die Aufwartung – im Juni kam etwa Hans von Bülow –, sonst lebte Liszt aber zurückgezogen. Die Ruhe wurde jäh gestört, als ihn Mitte September ein Hilferuf aus Rom erreichte: Fürstin Wittgenstein sei schwer erkrankt, Liszt müsse sofort kommen. In Rom fand er Carolyne in einer erbärmlichen Verfassung vor. »Zu ihren anderen Leiden kommt nun auch noch das römische Fieber«,67 ließ er Baronin von Meyendorff wissen. Möglicherweise hatte sich Carolyne Jahre zuvor mit Malaria infiziert, die immer wieder schubweise ausbrach. Liszt kümmerte sich so gut es ging um die Kranke, doch als deren Zustand sich nach einer Woche immer noch nicht gebessert hatte, reiste er zu Carolynes Tochter Marie nach Duino bei Triest. Die beiden kamen schnell überein, dass die Fürstin ständiger Pflege bedurfte. Sie sei einsam und hilflos, die Dienstboten tanzten ihr auf der Nase herum, jemand müsse die Zügel in die Hand nehmen. Die gesuchte Person war mit Adelheid von Schorn schnell gefunden. Die 33-Jährige war ja seit Kindertagen mit Carolyne bekannt, stand mit ihr in regelmäßigem Briefkontakt und wusste also, worauf sie sich einließ.
Am 7. Dezember traf Adelheid in Rom ein; dank ihrer Erinnerungen sind wir gut über das exzentrische Leben in der Via del Babuino informiert. »Die Fürstin schadete ihrer Gesundheit am meisten durch ihre unnatürliche Lebensweise«, lautete die Bestandsaufnahme der neuen Pflegerin. »Sie glaubte keinem Arzt, der ihren Puls regelmäßig fand, und würde auch keinem Fieberthermometer geglaubt haben, wenn man den damals schon gehabt hätte; sie legte sich wochenlang zu Bett und versagte sich monatelang alle Luft, so daß sie immer elender wurde, anstatt sich wieder zu kräftigen.«68
Wenn Liszt zu Besuch kam, wurde meistens gestritten, selbst über die tägliche Zeitungslektüre herrschte keine Einigkeit. »Sie glaubte immer, daß alles anders sei, als es gesagt oder gedruckt wurde. […] Die Fürstin stand noch auf dem Standpunkt, daß sie glaubte, es müsse etwas weiß sein, weil es schwarz genannt wurde. Sie sagte dann: ›So ist es in der großen Welt.‹ Liszt kämpfte oft gegen diesen ihren Glauben an und meinte, manchmal seien die Dinge, die gesagt oder geschrieben würden, doch wahr.«69
Auch Liszts künstlerisches Schaffen sorgte immer wieder für Ärger. Nicht selten mäkelte sie an seiner Arbeit herum, bezeichnete die Transkriptionen etwa als »Kinderreien«, als albernes Zeug, das man ja im Grunde nicht ernst nehmen müsse, und forderte ihn auf, etwas in ihren Augen wirklich Großes zu schaffen. »Hatte sie ihn nicht besitzen können«, vermutete Adelheid von Schorn, »so wollte sie ihn der Kunst erhalten, d.h. immer nur auf dem Wege, den sie für den richtigen hielt.«70
Ihr »Weg« war der der Kirchenmusik. Nach Carolynes Willen sollte Liszts Leben nur der Kirche geweiht sein. In Weimar und Budapest verschwende er nur seine wertvolle Zeit, er solle lieber in Rom und Tivoli leben und zur Ehre des Allmächtigen schaffen. Gelegentlich rechnete sie ihm kühl vor, dass er seit dem Christus kein bedeutendes Werk mehr geschaffen habe. Derartige Vorhaltungen müssen Liszt ungemein geschmerzt haben, zumal er sich bemühte, als Carolynes »Umilissimo Sclavissimo« erfolgreich zu sein. Zu dieser Zeit im Sommer 1874 arbeitete er an einem religiösen Werk großen Formats, das dazu bestimmt war, der Fürstin zu gefallen. Doch die Legende vom heiligen Stanislaus wurde – trotz zahlreicher Anläufe – nie vollendet. »Glauben Sie mir«, hatte er einem Freund bereits 1865 anvertraut, »allen Jubel, alle Begeisterung würde ich hingeben, wenn ich nur einmal ein wirklich schöpferisches Werk hervorbringen könnte.«71 Jetzt – zehn Jahre später – steigerten sich die Selbstzweifel mitunter bis zur Resignation. Er, der nach Carolynes Willen ein neuer Palestrina hätte sein sollen, musste erkennen, »dass wir alle unnütze Diener sind! Sich einzubilden, dass Gott unsere Sätze in der Literatur, in der Musik oder anderswo bräuchte, scheint mir töricht und gotteslästerlich.«72 Was die Fürstin nicht wahrhaben wollte: War Franz Liszt bereits als Abbé ein komischer Heiliger, erschien er in der Rolle des neuen Palestrina als eine klassische Fehlbesetzung. Ein zurückgezogenes Leben nur für die Musica sacra war seine Sache nicht – er ist auch als Geistlicher ein »homme du monde« geblieben. Liszt brauchte die Anregung von außen, er musste ab und zu in die glänzende Welt der Salons eintauchen. Adelheid von Schorn erwies sich in diesem Zusammenhang als gute Beobachterin: »Wenn er in der Stimmung war, ernste Sachen zu schreiben, war er selbst glücklich darüber, aber die Stimmung war eben nicht immer da.«73 So einfach ist das.
Neue Aufgaben
Nachdem sich der Gesundheitszustand der Fürstin gebessert hatte, verließ Liszt Rom Anfang Februar 1875 in Richtung Budapest. Dort angekommen, musste er mit Schrecken feststellen, dass seine Wohnung aufgebrochen und ausgeraubt worden war. Zwar konnten die Diebe schnell gefasst werden, von den gestohlenen Wertgegenständen – darunter ein kostbarer silberner Lorbeerkranz, den Liszt einst in Amsterdam erhalten hatte – fehlte indes jede Spur. Und der Ärger nahm vorerst kein Ende. Aus Bayreuth erreichte ihn die besorgniserregende Nachricht, dass das im Aufbau befindliche Festspielunternehmen vor großen finanziellen Schwierigkeiten stehe. Richard Wagner musste dringend Geld verdienen, sonst war die für das folgende Jahr angekündigte Eröffnung ernsthaft in Gefahr. Wohl oder übel begann Wagner eine kleine Konzerttournee, deren Erlös dem Festspielfonds zufließen sollte – heute würde man von Fundraising sprechen. Im März waren Konzerte in Wien und Budapest geplant, doch blieb lange nicht klar, ob sich damit überhaupt Gewinn machen ließe. In Budapest verlief der Ticketverkauf besonders schleppend, woran eine gewisse antideutsche Propaganda nicht ganz unschuldig war. Als Liszt erfuhr, dass die Veranstalter ein Fiasko befürchteten, intervenierte er und bot seine Mitwirkung an. Ein geschickter Schachzug; Liszt war in Budapest eine Berühmtheit, ein Konzert mit ihm konnte man nicht ignorieren. Die Rechnung ging auf; innerhalb kürzester Zeit waren sämtliche Billets ausverkauft.
Das Programm am 10. März 1875 begann mit der von Liszt geleiteten Uraufführung seiner Kantate Die Glocken des Strassburger Münsters. Im Anschluss daran spielte er Ludwig van Beethovens fünftes Klavierkonzert – Hans Richter dirigierte –, und zum Schluss leitete Wagner einige Auszüge aus seinem Ring des Nibelungen. »Der Vater spielt das Konzert von Beethoven zu unserem völligen Erstarren«, jubelte Cosima Wagner bereits nach der Generalprobe. »Unerhörter Eindruck! Unvergleichlicher Zauber, kein Spielen, ein Ertönen. Richard sagt, dies mache alles tot.«74 Der Morgen dieses Tages hatte damit begonnen, dass Liszt sich in einen Finger der rechten Hand schnitt. Ein besorgter Freund riet ihm daher, auf den Auftritt besser zu verzichten, wovon Liszt aber nichts hören wollte. Dann müsse er eben ohne den verletzten Finger spielen, lautete seine knappe Antwort. Es funktionierte – und die gut 3000 Zuhörer waren völlig aus dem Häuschen. Die Begeisterung galt indes nicht dem Komponisten der Glocken des Strassburger Münsters; auch Richard Wagners Auftritt blieb letztlich nur ein Achtungserfolg. Es war der Pianist Franz Liszt, der die Massen bezauberte.
Die Wagners fühlten sich in Budapest nicht sonderlich wohl. »Im ganzen traurigster Eindruck des ungarischen Landes«, so Cosimas Tagebuch, »es scheint einer vollständigen Auflösung entgegen zu gehen. Der Diebstahl in der Administration an der Tagesordnung, dazu der Größenwahn – es darf kein Wort deutsch gesprochen [werden]. Das Leben ist horrend teuer; kein Bürgerstand, lediglich ein aufgeblähter, unkultivierter Adel. Die musikalischen Zustände ebenso traurig, dem Vater ist alles, jede Tätigkeit abgeschnitten, er ist eigentlich ganz fremd dort.«75 Das entsprach allenfalls der halben Wahrheit, denn just zu dieser Zeit übernahm Liszt in seinem Heimatland neue Aufgaben und Pflichten, die ihm allerdings nicht nur Freude bereiten sollten. Bereits zwei Jahre zuvor – im Februar 1873 – war vom ungarischen Parlament die Gründung einer königlichen Musikakademie mit Sitz in Budapest beschlossen worden. Liszt sollte – so der ehrgeizige Plan – als Präsident des neuen Instituts fungieren, schließlich sei er Ungarns bekanntester Musiker und genieße europaweit hohes Ansehen. Die Verantwortlichen schmeichelten ihm, wofür Liszt stets empfänglich war, man appellierte an sein Nationalgefühl und beschwor seine Hilfsbereitschaft. Mit Erfolg. Wenn Liszt wirklich eine Chance gehabt haben sollte, dieses Amt abzulehnen – er verpasste die Gelegenheit. Man überrumpelte ihn gewissermaßen: »Das also ist der Haken an der Sache«, ließ er die Fürstin wissen, »die unerwartete Gründung der Akademie legt mir einen Strick um den Hals. Die Schlinge wird folgen – und die offiziösen Verantwortlichen werden sicherlich nicht säumen, sie enger zu ziehen! Dennoch – wie ich Ihnen bereits gesagt habe – es gibt für mich kein Zurück, das mir nicht als Feigheit ausgelegt würde. Daher bitte ich meinen Schutzengel mir den rechten Weg zu leuchten und mich zu unterstützen!«76
Ende März 1875 wurde Franz Liszt offiziell zum Präsidenten der Musikakademie ernannt. Die Eröffnung des Hauses erfolgte aber erst am 14. November – bezeichnenderweise in Liszts Abwesenheit; er weilte zu dieser Zeit in Italien. Liszt hatte sich für einen breiten Unterrichtskanon ausgesprochen; da die finanziellen Mittel indes knapp waren, begann der Betrieb zunächst nur mit Klavier- und Theoriestunden. Erst im Laufe der Jahre wurde das Angebot sukzessive erweitert. Der neue Präsident war zugleich ordentlicher Professor für Klavier, erhielt aber für beide Aufgaben – außer einer kostenlosen Dienstwohnung – kein Honorar.
Das erste Studienjahr war schon fast beendet, als Liszt Anfang März 1876 seine Lehrtätigkeit aufnahm. Vier Wochen später verließ er Budapest schon wieder und kam erst Mitte Oktober zurück. Im zweiten Semester unterrichtete er zwar vier Monate, doch in den folgenden Jahren blieb er kaum länger als zwei bis drei Monate in der Stadt. Neben seiner pädagogischen Arbeit wirkte er an Wohltätigkeitskonzerten mit und besuchte die Aufführungen seiner Schülerinnen und Schüler. Da sich Liszts Dienstwohnung im Akademiegebäude befand, hatte er auch in den eigenen vier Wänden in der Regel keine Ruhe. Albert Apponyi, ein Freund aus Budapester Tagen, erinnerte sich: »Dort fand sich sehr häufig abends eine kleine Anzahl von Freunden aus der Budapester Musikwelt, manchmal zum Souper, zusammen, das bei Liszt immer nur aus kalten Gerichten bestand, was er ›kalte Behandlung‹ nannte.«77
Dass er im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens stand, war Liszt natürlich nicht fremd, mehr noch, es war ihm auch nicht unangenehm. Er genoss die vielen kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen man ihn hofierte. Doch in seinem vorgerückten Alter – Liszt war bei der Übernahme des Präsidentenamtes ja schon Mitte 60 – wurde es ihm mitunter zu viel. Seiner Biographin Lina Ramann beschrieb er einen typischen Tagesablauf in Budapest: »Jeden Tag wenigstens 4 Stunden Briefe schreiben: dann Visiten, – geschäftliche und andere – gewärtigen: Korrekturen besorgen. Nachmittags die Woche mehrere Stunden Klavier lektioniren mit ein Dutzend Schülern, wovon einige sich meisterlich gebahren: Abends, manchmal Koncerten beiwohnen, und zur Erholung Whist spielen. Meinen eigentlichen Arbeiten kann ich hier kaum obliegen.«78 Die »eigentlichen Arbeiten« waren seine Kompositionen, und die kamen fast immer zu kurz. »Liszt geht nach Weimar, um sich auszuruhen und zu komponieren, weil er dazu in Budapest nicht kommt«, schrieb eine ungarische Zeitung und traf damit den Nagel auf den Kopf. »Ständig muss er zu Diners, Soupers, Soireen und Konzerten gehen, mit anderen Worten, man erschöpft ihn mit der grossen Verehrung zu Tode.«79
Gegenüber der Fürstin machte er in der Regel gute Miene; zwar erwähnte er mitunter eine Unmenge an Korrespondenz, die er jeden Tag zu erledigen habe – dazu gehörten ja auch die Briefe an Madame –, sonst klagte er aber nicht. Dafür gab es gute Gründe, hielt sie die Aufenthalte in Budapest doch für pure Zeitverschwendung: »Er ist dort Klavierlehrer geworden«, ätzte sie gegenüber »oncle-cousin« Eduard und fügte sarkastisch hinzu: »Schöne und grosse Anstellung!!« Sie sorgte sich um Liszts Ansehen in der Welt, schien es ihr des »neuen Palestrina« doch unwürdig, schnöden Klavierunterricht zu erteilen. Dass der Abbé in Budapest wie auch in Weimar ihrer ständigen Kontrolle entzogen war und möglicherweise sogar junge Fräuleins unterrichtete, war ein weiterer Grund, den sie aber nur andeutete: »Pesth und Weymar sind sehr verderblich für ihm. Wahres Gift! – physisch wegen der zu kalten Clima und moralisch – wegen vieler Gründe.«80
Das fortwährende Pendeln zwischen Rom, Weimar und Budapest verschlang enorm viel Zeit und wohl auch Lebensenergie. Richtig ist ebenfalls, dass Liszt insbesondere durch seine Tätigkeit an der Akademie vom Komponieren abgehalten wurde. Auf große Werke konnte er sich kaum konzentrieren, da seine Tage im Einerlei zerfaserten. Es war aber auch eine Tatsache, dass er all dies freiwillig tat. Er wurde weder zur Übernahme der Präsidentschaft gezwungen, noch hätte man von ihm erwartet, auf eine Honorierung zu verzichten. Diese – freundlich formuliert – ausgeprägte Hilfsbereitschaft war ein Teil seiner Persönlichkeit. Dass er dabei sehr oft ein Opfer seiner Güte wurde, stand auf einem anderen Blatt. Albert Apponyi fasste das Dilemma augenzwinkernd zusammen: »Liszt war überlaufen von Berufenen und Unberufenen, die seinen Rat und seine Hilfe in Anspruch nahmen, und das Talent, Unberufene von sich abzuschütteln, fehlte ihm gänzlich.«81
Bayreuth
Allerdings kann ich weniger ihren Tod beweinen als vielmehr ihr Leben, es sei denn, ich täte es aus Heuchelei«, schrieb Liszt Mitte März 1876 an die Fürstin Wittgenstein. Wenige Tage zuvor – am 5. März – war Marie d’Agoult gestorben. »Madame d’Agoult hatte einen außerordentlichen Sinn, ja sogar eine Leidenschaft für das Falsche – außer in einigen Augenblicken der Verzückung, wobei sie die Erinnerung an diese Momente später nicht mehr ertragen konnte!«82 Die letzten Lebensjahre der Gräfin erzählen die Geschichte ihres stetigen gesundheitlichen Verfalls. Ihr »Spleen« hatte sie nicht mehr in Ruhe gelassen, sodass Claire de Charnacé zur Jahreswende 1860/61 von der Geisteskrankheit ihrer Mutter überzeugt war. Marie litt unter Wahnvorstellungen, immer wieder wurde sie von schweren Depressionen und Suizidgedanken heimgesucht. An einem Tag verhielt sie sich völlig lethargisch und war kaum in der Lage, sich zu bewegen, am anderen Tag durchlebte sie schlimmste Panikattacken. Dann wurde sie aggressiv und schlug um sich, mitunter musste man ihr sogar eine Zwangsjacke anlegen. Mehrfach wurde die Comtesse in Kliniken und Sanatorien behandelt. Um aber keinen falschen Eindruck zu erwecken: Marie d’Agoult wurde nicht dauerhaft weggesperrt. Wenn die Dämonen sie in Ruhe ließen, erlebte sie immer wieder lichte Phasen. In dieser Zeit war sie durchaus in der Lage, ein gesellschaftliches Leben zu führen und ihre literarischen Arbeiten fortzusetzen. 1866 veröffentlichte sie etwa ein Buch über Goethe und Dante, im selben Jahr schloss sie den ersten Teil ihrer Memoiren ab.
Jetzt – im März 1876 – war Marie d’Agoult tot. Liszt zeigte sich unversöhnlich, mehr noch, er hatte für Marie nur Spott und Hohn übrig. »Wie Ihre Mutter es geschafft hat, ihr Vermögen zu verprassen, bleibt mir rätselhaft«, lästerte er in einem Brief an Cosima. »Allerdings nehme ich an, dass der von Ollivier herausgegebene und revidierte Band ihrer Memoiren erfolgreich sein wird. Sie hat mir 1866 in Paris etwa 30 Seiten daraus vorgelesen. Damals stand der Titel noch nicht fest. ›Dichtung und Wahrheit‹ gefiel der Verfasserin am besten, war aber bereits durch Goethe vorbelastet. Im Verlauf des Gesprächs schlug ich ihr schließlich: ›Posen und Lügen‹ vor – zu wahrheitsgetreu, um akzeptiert zu werden.«83 Auch Cosimas Trauer hielt sich in Grenzen. »Mit weniger Begabung hätte sie entschieden harmonischer gelebt«, resümierte die Tochter, »doch da sie mir diess gewiss nie zugegeben haben würde, und bis zuletzt alle persönlichen Leiden mit Hochmuth leugnete, will ich lieber annehmen dass ihr Müssen ihr leicht fiel.«84
Im Frühjahr 1876 hatte Frau Wagner keine Zeit für trübe Gedanken. Anfang Juni waren die Bauarbeiten im Bayreuther Festspielhaus so weit beendet, dass mit den Bühnenproben begonnen werden konnte. Franz Liszt traf am 1. August in der oberfränkischen Kleinstadt ein. Als er im Vorjahr an den ersten Proben teilgenommen hatte, hatte der Grüne Hügel noch einer einzigen Baustelle geglichen. Jetzt konnte man das von Otto Brückwald entworfene Gebäude in seiner ganzen Schönheit und technischen Kühnheit bewundern. Zu den Generalproben Anfang August erschien auch Ludwig II. Der Bayernkönig hätte die Ovationen der Menschen zweifellos verdient, hatte er die Bayreuther Festspiele doch erst möglich gemacht. Doch der Monarch mochte seinem Volk schon lange nicht mehr begegnen und zog es vor, mitten in der Nacht auf freier Strecke einem Sonderzug zu entsteigen. Auch sonst verhielt er sich ausgesprochen merkwürdig und bewegte sich in der Stadt nur hinter zugezogenen Vorhängen. Drei Tage später reiste er ebenso konspirativ wieder ab, kam aber Ende August inkognito wieder zurück. Aus der Reichshauptstadt Berlin kommend, traf Kaiser Wilhelm I. nebst Gattin in Bayreuth ein, auch Kaiser Dom Pedro II. von Brasilien ließ sich die Premiere nicht entgehen. Darüber hinaus sah man den König von Württemberg, den Großherzog von Sachsen-Weimar, den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin sowie Vertreter des österreichisch-ungarischen Adels. Neben Liszt erschienen die Komponisten Camille Saint-Saëns, Anton Bruckner und Peter Tschaikowsky, die Maler Franz von Lenbach, Adolph von Menzel, Anton von Werner und Hans Makart, Schauspieler und Dichter, Wissenschaftler und Journalisten.

Richard Wagner begrüßt Kaiser Wilhelm I., links neben ihm stehen in bezeichnenderweise leicht gebückter Pose Franz Liszt und Hans von Bülow. Die Szenerie ist frei erfunden, denn Bülow war bei der Eröffnung gar nicht anwesend (französisches Sammelbildchen – »Liebigs Fleischextrakt« – anlässlich der Eröffnung des Festspielhauses in Bayreuth, 1876).
Bayreuth war auf diesen Ansturm der internationalen Prominenz nur schlecht vorbereitet. Da nur ganz wenige Hotelzimmer zur Verfügung standen, mussten die meisten Besucher bei einheimischen Familien unterkommen, deren Wohnungen aber in der Regel nicht über den Luxus verfügten, den die vornehmen Besucher sonst kannten. Das Fehlen eines Wasserklosetts brachte so manchen Grafen in arge Nöte. Liszts Freund Albert Apponyi musste immer vier Schlüssel bei sich haben: »Der eine war der Hausschlüssel, der zweite der Schlüssel zu meiner Wohnung, der dritte zur Nebenwohnung, den man haben mußte, um einen gewissen vierten gebrauchen zu können.«85 In den Gasthäusern herrschte das Chaos, erinnerte sich Peter Tschaikowsky, freie Plätze waren heiß umkämpft, und meistens blieben die Teller und Schüsseln ohnehin leer: »Die ganze Premierenwoche über bildete das Essen das Hauptgesprächsthema, das die künstlerischen Fragen bedenklich in den Hintergrund drängte. Man hörte mehr von Beefsteaks, Schnitzeln und Bratkartoffeln reden als von Wagners Leitmotiven.«86
Nicht so in der Villa Wahnfried, wo Franz Liszt nach seiner Ankunft ein Gästezimmer bezog. In dem vornehmen Wohnhaus der Familie Wagner gab es keine Nahrungsengpässe, hier reihte sich vielmehr ein Empfang an den anderen, Bankett folgte auf Bankett. Zu den häufigen Gästen gehörte auch die Sängerin Lilli Lehmann, die eine der Rheintöchter gab. In diesen Sommerwochen 1876 hatte sie viel Zeit, den Abbé zu beobachten. »Es ist merkwürdig, wie verhältnismäßig fremd mir Liszt geblieben ist«, wunderte sich die Lehmann. »Es mag wohl daher kommen, daß er in Wahnfried entweder von der eignen Familie in Anspruch genommen ward, oder auch, 1876 besonders, sich fast ausschließlich mit denjenigen Besuchern Wahnfrieds abgeben mußte, die als Patrone dem Unternehmen Gelder zuführten, ihn bestürmten, ihm keinen freien Augenblick mehr gönnten. Vielleicht lag es auch an den vielen schönen jungen und alten Frauen, die sich an seine Fersen hefteten, ihn in die Kirche brachten und aus der Kirche holten, die sich wie Schönheitspflästerchen neben ihm ausnahmen, und die dem großen Manne so notwendig schienen wie Luft und Sonne!«87
Und weiter: »Um ihn standen alle schönen Frauen, die er umspann, die ihn fesselten, denen er Kußhände, Lächeln, Nachsicht und Liebe in Tönen zuwarf, mit denen er spielte, wie mit Kindern, die ihn doch nicht verstanden.« Liszt war zu diesem Zeitpunkt 64 Jahre alt und strahlte trotz der Soutane offensichtlich immer noch eine erotische Faszination auf das weibliche Geschlecht aus. »Alle kokettierten mit ihm und – soll ich’s sagen? – auch er mit allen.«88 Den Schilderungen der Lehmann konnten wir aber auch entnehmen, dass Liszt in Bayreuth eine Funktion zu erfüllen hatte: Er musste die Sponsoren des Unternehmens – »Patrone« genannt – bei Laune halten.
Am 18. August fand im Restaurant neben dem Festspielhaus ein großes Bankett statt. An langen Tafeln saßen etwa 500 Personen, darunter Liszts Freunde Adelheid von Schorn und Albert Apponyi, sein Schüler Berthold Kellermann sowie sein französischer Kollege Camille Saint-Saëns. Mancher Gast ergriff das Wort, so auch der liberale Reichstagsabgeordnete Franz Duncker, der sich aber so sehr verhaspelte, dass er über die Festspiele sagte, »man könne nicht wissen, was die Zukunft von der Sache halten würde, das Streben aber sei anerkennenswert!«89. Cosima Wagner und die anderen fühlten sich peinlich berührt, ließen sich aber nichts anmerken. Nachdem ein weiterer Gang serviert worden war, erhob sich Richard Wagner, wandte sich zu Franz Liszt und brachte auf seinen Schwiegervater einen bewegenden Toast aus: »Hier ist derjenige, welcher mir zuerst den Glauben entgegengetragen, als noch keiner etwas von mir wußte, und ohne den Sie heute vielleicht keine Note von mir gehört haben würden, mein lieber Freund – Franz Liszt.« Die beiden Männer machten einen Schritt aufeinander zu und nahmen sich in die Arme. Herzlicher Applaus brandete auf, und »Hoch!«-Rufe erfüllten den Saal. Dann erwiderte der Abbé voller Rührung: »Ich danke meinem Freunde für die ehrenvolle Anerkennung und bleibe ihm in tiefster Ehrfurcht ergeben – untertänigst; wie wir uns vor dem Genius Dantes, Michelangelos, Shakespeares, Beethovens beugen, so beuge ich mich vor dem Genius des Meisters.«90
So schön und ernst gemeint die wechselseitigen Elogen auch waren – in jenem Premierensommer begann eine für Liszt sehr unglückliche Entwicklung. In Wagners Fangemeinde betrachtete man ihn zunehmend nur noch als Ermöglicher des großen Richard, er wurde zum Steigbügelhalter des Bayreuther Halbgottes reduziert. Dass der zwei Jahre Ältere nicht nur ein Jahrhundertpianist, sondern auch ein genialer Komponist war, verschwand weitgehend aus der Wahrnehmung der Wagnerianer. Als Lilli Lehmann einmal Liszts Mignons Lied nach Goethe (»Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn«) vortrug, kam Wagner unerwartet zur Tür herein. »Dann schritt er, den Kopf nach hinten geworfen – eine Haltung, die ihm das Ansehen von sehr starkem Selbstbewußtsein gab – ziemlich steif, einen Pack Noten unterm Arm, durch den Salon und wandte sich, ehe er ihn wieder verließ, an Frau Cosima: ›Sieh mal an‹, sagte er, ›ich wußte gar nicht, daß Dein Vater so hübsche Lieder geschrieben hat; ich dachte, er hätte sich nur um den Fingersatz beim Klavierspiel verdient gemacht! Übrigens erinnert mich das Gedicht mit den blühenden Zitronen immer an einen Leichenbitter!‹«91
Liszt selbst war in Bayreuth geradezu ängstlich darum bemüht, sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen, Wagner nicht die Schau zu stehlen oder etwa mit ihm aneinanderzugeraten. Als Lina Ramann ihn bat, ob er ihr Billets für die Generalproben besorgen könne, winkte Liszt ab. Es müsse es »insbesondere vermeiden bei Wagner Probe-Gesuche vorzutragen«, schrieb er ihr. »Deshalb hatte ich bereits Verdruss mit einigen Befreundeten, denen ich keinen besseren Bescheid geben konnte als: sie möchten sich in der ›Generalproben‹-Angelegenheit entweder direct an Wagner, oder an irgend einen Bayreuther Patron oder Mitwirker, wenden: aber ja nicht an meine Wenigkeit, – weil die strengste Discretion mir vornehmlich geboten ist.«92
Die Fürstin hatte das alles kommen sehen. Sie war in ihrem Hass auf Richard und Cosima ohnehin davon überzeugt, dass Liszt von seiner feinen Familie nur ausgenutzt werde. Da sie wusste, dass Liszt ihr über Bayreuth nie ganz offen und ehrlich schreiben würde, bat sie Adelheid von Schorn um diskrete Spionagedienste. Sie möge all das notieren, bat Carolyne ihre Vertraute, »was die Zeitungen nicht erzählen«.93 Geradewegs fügte sie hinzu, dass Adelheid in ihren Berichten auf »allgemeine Konturen« ganz verzichten solle, was so viel heißt wie: bitte auch Klatsch und Tratsch. Was auch immer das Fräulein Schorn berichtet haben mag – Carolyne überschüttete Liszt nun mit Vorwürfen, dass Bayreuth und die Wagners Gift für ihn seien und dergleichen mehr. Doch diesmal parierte Liszt die Angriffe. Er habe einen derartigen Brief nicht verdient, schrieb er ihr am 6. September und fügte selbstbewusst hinzu: »Nach Ihrem heutigen Brief nehme ich davon Abstand, nach Rom zurückzukehren.«94 Jetzt realisierte Carolyne, was sie angerichtet hatte. Umgehend versuchte sie ihn zu beschwichtigen – ohne Erfolg: Liszt blieb hart. Das Fernbleiben von Rom war die schärfste Klinge, die er gegen die Fürstin führen konnte. Er kehrte erst Mitte August 1877 in die Ewige Stadt zurück.
Der Streit vom September 1877 war nur der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die vor längerer Zeit begonnen hatte. Liszt habe sich bereits vor Jahren in »schmerzlichster Weise« dazu durchgerungen, vertraute er Cosima an, sein Verhältnis zur Fürstin Wittgenstein »auf die wichtigsten Punkte unserer Existenz zurückzuführen«. 95 Mit anderen Worten: Er gestand der einstigen Partnerin nur noch eine Nebenrolle in seinem Leben zu. Und als ob er dieser Tatsache weiteres Gewicht verleihen wollte, verbrachte er nun die Karwoche sowie die Ostertage 1877 demonstrativ in Bayreuth.
Liszt fühlte sich in Wahnfried offensichtlich sehr wohl. Nach dem morgendlichen Kirchgang bearbeitete er Korrekturfahnen und erledigte seine Korrespondenz, danach widmete er sich ganz der Familie und genoss das Zusammensein mit Cosima, Richard und seinen fünf Enkeln. Daniela von Bülow, mit knapp 17 Jahren im ärgsten Backfischalter, war bereits eine talentierte junge Pianistin und durfte dem Großvater ab und zu vorspielen. Ihr widmete er auch den Arbre de Noël – den Weihnachtsbaum –, eine im Jahr zuvor vollendete Sammlung von zwölf charmanten Impressionen. Am Ostersonntag gab Cosima für rund 100 Gäste ein Fest: »Es fällt sehr gut aus, da mein Vater die Güte hat, zu spielen (›Franciscus auf dem Wasser‹) und R. guter Laune ist.«96 Auch am nächsten Tag war Wagner noch bester Stimmung. Er schenkte seinem Schwiegervater zum Namenstag ein Exemplar seiner Autobiographie samt gereimter Widmung: »Heiliger Franz!/ Du hast mich ganz./ So nimm’ auch mein Leben,/ es sei Dir gegeben.« Liszt zeigte sich gerührt; zum Dank setzte er sich an den Flügel und spielte seine kolossale Sonate in h-Moll. »Ein schöner teurer Tag«, resümierte Cosima, »wobei ich, dankend dem Himmel, die Genugtuung empfinde, daß keine tief tragische Lebensscheidung, keine Bosheit der Menschen, keine Unterschiede der Naturen uns dreie trennen konnte.«97 Mit der »Bosheit der Menschen« waren die Störmanöver der Fürstin gemeint. Carolynes Einfluss auf Liszt war gebrochen. Doch wie es in ihrem Vater wirklich aussah – davon hatte Cosima Wagner keine Ahnung.

Richard Wagner widmete Liszt ein Exemplar seiner Memoiren mit dem Vers: »Heiliger Franz! / Du hast mich ganz. / So nimm’ auch mein Leben, / es sei Dir gegeben.«
Nuages gris
Nuages gris heißt eine Klavierminiatur, die Franz Liszts Seelenverfassung in seinem letzten Lebensjahrzehnt gut zu beschreiben vermag: trübe Wolken. Zwar führte er ein privilegiertes Leben zwischen Ungarn, Italien und Deutschland, war von Freunden, Schülern und Verehrern umgeben, wurde überall hofiert, man liebte ihn, und mit seiner Familie hatte er sich ausgesöhnt. Franz Liszts Welt war auf den ersten Blick in bester Ordnung. Aber immer häufiger zogen nun Wolken auf, die die Sonnenseite seines Daseins verdunkelten. »Manchmal umhüllt Traurigkeit meine Seele wie ein Grabtuch«,98 gestand er im September 1876 der Baronin von Meyendorff. Liszt meinte damit nicht nur eine leichte Melancholie oder eine emotionale Verstimmung, wie sie viele Menschen dann und wann überfällt, er sprach vielmehr von handfesten Depressionen: »Ich bin niedergeschlagen und komplett unfähig, auch nur einen einzelnen Lichtstrahl Freude zu finden.«99 Er klagte zudem über Schlaflosigkeit, die wiederum alle möglichen körperlichen Unpässlichkeiten zur Folge hatte. Mitunter war er so lethargisch, dass er – unfähig zu arbeiten – tagelang das Bett nicht verließ und kaum in der Lage war, einen kurzen Brief zu schreiben. Alles in allem fühle er sich »ausgesprochen lebensmüde«, und nur sein Glaube an Gott halte ihn davon ab, sich umzubringen.100
Das war in etwa die Stimmung, in der Franz Liszt Ende August 1877 in der Villa d’Este eintraf. Tagelang saß er dort im Park, dessen Wasserspiele und jahrhundertealte Zypressen einen geradezu magischen Reiz auf ihn ausübten. Die archaische Schönheit der Bäume ließ ihn nicht mehr los. »Die gesamten letzten drei Tage habe ich unter den Zypressen verbracht!«, schrieb er der Fürstin. »Ich war wie besessen von dieser Idee, unfähig, an etwas anderes zu denken – nicht einmal an die Kirche – ihre alten Stämme ließen mir keine Ruhe, und ich lauschte dem Gesang und dem Weinen ihrer Zweige mit ihrem immergrünen Nadelkleid!«101 In diesem Spätsommer schuf er fünf Klavierwerke, die – ergänzt durch zwei weitere – später als drittes Heft der Années de pèlerinage erscheinen sollten. Gleich zwei Stücke widmete er Aux cyprès de la Villa d’Este und gab beiden Nummern den Untertitel »Thrénodie«, was so viel wie Trauer- oder Klagelied heißt. Es sind düstere und melancholische Klangbilder von erschütternder Hoffnungslosigkeit. Liszt war von so viel Tristesse selbst überrascht, wie er der Baronin von Meyendorff schrieb: »Diese Sachen eignen sich kaum für den Gebrauch der Salons, sie sind nicht unterhaltsam und noch nicht einmal anmutsvoll verträumt. Wenn ich sie veröffentliche, werde ich den Verleger warnen, dass er Gefahr läuft, nur wenige Exemplare davon abzusetzen.«102
Mit Les jeux d’eaux à la Villa d’Este, der vierten Nummer der Sammlung, gelang Liszt ein atmosphärisches Meisterwerk. Die Musik perlt dahin, und die impressionistischen Klangfarben und arabeskenhaften Figuren fangen das Spiel des Wassers ein. Doch alles in allem stellen die Jeux innerhalb von Liszts Spätwerken eine Ausnahme dar. Viele der in seinem letzten Lebensjahrzehnt entstandenen Kompositionen sind von einer dunklen Schwermut erfüllt. Mit Miniaturen wie Nuages gris, La lugubre gondola oder Unstern schuf er kühne Musik, die weit in das 20. Jahrhundert wies. Die Strukturen atomisieren sich, die Harmonik ist oft bis zur Atonalität erweitert. In der Bagatelle sans tonalité aus dem Jahre 1885 etwa findet sich der experimentelle Charakter schon im Titel. Andere Werke wie die späten Mephistowalzer oder der Csárdás macabre sind dämonisch-zuckende Capricen. Immer wieder bearbeitete er auch frühere Werke und brachte sie in neuen Versionen heraus. »Ich habe letzthin ein paar Clavierstücke geschrieben und auch Umarbeitungen einiger alten Sachen zu Papier gebracht«, schrieb er seinem Freund Alexander Wilhelm Gottschalg. »Sich corrigiren und bessern wäre die richtige Aufgabe der alten Jahre …«103
Bemerkenswert ist auch die geistliche Musik jener Zeit. Bei dem 1878 vollendeten Via Crucis handelt es sich um Meditationen über die 14 Kreuzwegstationen für Soli, Chor und Orgel – es existiert auch eine Fassung für Klavier solo –, deren musikalische Askese damals als erschreckend modern empfunden wurde. Liszt war am Ende des Lebens angelangt, und seine späte Musik ist in ihrer Kargheit auch heute noch ergreifend.
In Liszts Alterswerk finden sich aber auch einige Titel, die an die glänzenden wie charmanten Kompositionen früherer Jahrzehnte erinnern. In dem kurzen Nocturne En rêve glaubt man den Schaten Chopins vorbeihuschen zu hören, während die Quatre valses oubliées den Geist der Pariser Salons zu verströmen scheinen. Doch diese Erinnerungen waren in Liszt längst verblasst – und so klingt die Musik: Der erste und dritte der »vergessenen Walzer« etwa enden mit einstimmigen Melodien, die gewissermaßen in eine ungewisse Zukunft führen. Man könnte auch sagen: Sie weisen den Weg ins 20. Jahrhundert. Dass Liszts Musik das Verbindungsglied zwischen der Romantik und der Moderne darstellte, erkannte auch die Fürstin Wittgenstein: »Man versteht seinen Genius noch nicht – viel weniger als den von Wagner, weil Wagner eine Reaktion der Gegenwart repräsentiert; Liszt aber hat seinen Speer viel weiter in die Zukunft geworfen. – Es werden mehrere Generationen vergehen, bevor er ganz und gar begriffen sein wird.«104

Die Villa d’Este in Tivoli war die Residenz von Liszts Freund Kardinal Gustav Adolf zu Hohenlohe. Hierhin zog sich Liszt immer wieder zum Komponieren zurück. Das 1870 entstandene Aquarell von Salomon Corrodi zeigt Liszt und den Kardinal im Garten der Villa.
Carolyne sollte recht behalten: Liszts Spätwerk öffnete die Tür zur Neuzeit. Komponisten wie Béla Bartók, Arnold Schönberg oder Alban Berg schöpften daraus starke Impulse und Anregungen. »Darin überhaupt«, schrieb Schönberg, »in den vielen Anregungen, die er den Nachfolgern hinterließ, ist seine Wirkung vielleicht größer als die Wagners […].«105 Bei Liszt liege »die Harmonik eines Umstürzlers in der ruhigen Hand eines Herrschers«, konstatierte der große Liszt-Interpret Ferruccio Busoni und fügte hinzu: »Im letzten Grunde stammen wir alle von ihm – Wagner nicht ausgenommen – und verdanken ihm das Geringere, das wir vermögen. César Franck, Richard Strauss, Debussy, die vorletzten Russen insgesamt, sind Zweige seines Baumes.«106
Richard Wagner hatte indes für den asketischen Spätstil seines Schwiegervaters nur Spott und Hohn übrig. Im November 1882 notierte Cosima in ihr Tagebuch: »Am späten Abend, wie wir allein sind, ergeht sich R. über die jüngsten Kompositionen meines Vaters, er muß sie durchaus sinnlos finden und drückt das eingehend und scharf aus.«107 Die Sache ließ Wagner offensichtlich keine Ruhe. Wenige Tage später nahm er Liszts Sammlung Arbre de Noël zur Hand, »und wie ich ihn bitte, ihm selbst seine Bemerkung darüber zu machen, sagt er: Das würde grausam sein.«108 An anderer Stelle sprach er sogar von »keimenden Wahnsinn« und »Missklängen«, denen er nichts abzugewinnen vermöge.109 Der Altersunterschied zwischen Franz Liszt und Richard Wagner betrug nur zwei Jahre, musikalisch trennten sie am Ende ihres Lebens indes Welten.
Im Augiasstall
Nur einmal hatte ich das Glück, Liszt spielen zu hören, und auch dies war eigentlich – man verzeihe meine Ungeniertheit – nur ein mäßiges Glück. […] Trotz lebhafter Phantasie und besten Willens schien mir das Gebotene entschieden zu dürftig, um in die Verzückung der Gläubigen mit einzustimmen.« Und weiter: »Wirklich bewundernswert fand ich bloß das stumme Spiel von Gesicht und Auge, sowie die Pose, welcher eine geradezu klassische Körperhaltung zu Grunde lag. Keine pianistische, wohl aber eine schauspielerische Leistung ersten Ranges!«110 Der Autor dieser Zeilen hieß Emil Sauer und war ab Mai 1884 Liszts Schüler in Weimar. Es sei einmal dahingestellt, ob Liszts Spiel wirklich so ernüchternd war. Mag sein, dass der alte Herr sich nicht in Stimmung fühlte. Vielleicht hatte Sauer aber einfach nur einen schlechten Tag erwischt, denn auch große Künstler musizieren nicht immer auf demselben Niveau. Es spricht einiges für diese Vermutungen, zumal wir aus verschiedenen anderen Quellen wissen, dass Liszt bis ins hohe Alter sein Publikum verzaubern konnte. Was den damals 21-jährigen Sauer so desillusioniert hatte, war vielmehr die Art und Weise, wie man in der Hofgärtnerei selbst auf eine blasse Leistung des »Meisters« reagierte: mit hohler und völlig kritikloser Verehrung.
In seiner Autobiographie Meine Welt schildert Emil Sauer sehr eindrucksvoll die liebedienerische Atmosphäre in Liszts Entourage. Damit erzählt er ein weiteres – allerdings weniger ruhmreiches – Kapitel aus dem Leben des alten Franz Liszt. Aber können wir ihm glauben? Ja. Einerseits begegnen uns im weiteren Verlauf noch andere Zeitzeugen, die sich ähnlich kritisch äußern. Andererseits zählte Sauer, als er 1901 seine Memoiren veröffentlichte, zu den bekanntesten Pianisten Europas – er hatte es schlichtweg nicht nötig, sich an Liszt »berühmt zu schimpfen«.
So modern Liszts Konzept der »Meisterklasse« auch war – das öffentliche Unterrichten erinnerte an Vorlesungen, »die jeder nach Belieben besuchen oder schwänzen konnte«111. An den nachmittäglichen Veranstaltungen nahmen nicht nur Musiker teil, oft kamen auch Liszts Freunde, Vertreter des Weimarer Hofes – allen voran der Großherzog – sowie andere mehr oder weniger illustre Herrschaften. Die Grenze zwischen einer pädagogischen Veranstaltung und einem gesellschaftlichen Ereignis war dann fließend. Über die Zulassung entschied nicht nur die musikalische Qualifikation, auch Schmeicheleien und weltgewandtes Auftreten spielten eine Rolle. Alles das führte dazu, dass sich in der Hofgärtnerei Blender und Speichellecker die Klinke in die Hand gaben. Liszt zeigte sich für Lobpreisungen empfänglich, wie überhaupt die Eitelkeit seit jeher seine Achillesferse gewesen war. Mit dem Alter wurde das Bedürfnis nach Beweihräucherung und Huldigung allem Anschein nach noch größer.
Nun gingen aus Liszts Schule viele bedeutende Künstler hervor: Pianisten wie Hans von Bülow, Carl Tausig, Eugen d’Albert, Sophie Menter, Alfred Reisenauer und August Stradal, um nur einige zu nennen, haben intensiv und teilweise über Jahre hinweg mit Liszt gearbeitet. Diese Damen und Herren kann man getrost als Liszt-Schüler bezeichnen. Darüber hinaus führt die Liste seiner Eleven aber auch Personen, von denen wir wissen, dass sie in Liszts Klasse einfach nichts zu suchen hatten.112 Pianistinnen und Pianisten, die an herkömmlichen Konservatorien gescheitert waren, bedienten mithilfe schönrednerischen Getues Liszts Vorurteile gegenüber der klassischen Musikausbildung und stilisierten sich so zu verkannten Genies. Von Hans von Bülow stammt das bitterböse Bonmot: »So schlecht wie im Juli und August in Weimar, wird in der ganzen Welt nicht gespielt.«113

Liszt und seine Schüler: links mit Carl Lachmund und dessen Frau Karoline in Weimar, Juni 1884, rechts mit dem Komponisten und Dirigenten François Servais und dem Pianistenehepaar Jules de Zarembski und Johanna Wenzel in Brüssel, Mai 1881.
Kein Wunder, dass Emil Sauer seinen Augen und Ohren kaum trauen mochte, als er das »System Liszt« erstmals aus der Nähe studieren konnte. »Der Salon war angefüllt mit Leuten, die augenscheinlich gar nicht hierher gehörten, ja, nicht einmal wußten, warum sie eigentlich gekommen waren.« Sauer fühlte sich an einen Jahrmarkt der Eitelkeiten erinnert. Jeder wollte in Liszts Nähe sein, jeder wollte den »Meister« auf sich aufmerksam machen. Dabei konnte es geschehen, dass »echte« Pianisten wie Reisenauer oder Sauer von Schaumschlägern und Schleimern weggeschubst wurden. »Was mich am meisten schmerzte, war, daß der alte Herr den böses-ten Schmeichlern gegenüber, die mit ihrem ›lieber Meister hier und lieber Meister dort‹ nur so um sich warfen, blind oder zugänglich schien, ja daß er Schwäche genug besaß, an diesen oft beleidigenden Lobhudeleien Gefallen zu finden.«114

Links mit seinen Schülern Ludwig Dingeldey und Eduard Reuß sowie dem Musikschriftsteller Richard Pohl (sitzend), vermutlich 1883 in Leipzig, rechts mit Alexander Siloti in Weimar, Herbst 1884.
Weimar glich damals einem mondänen Kurort. Saison war, wenn Liszt sich in der Stadt aufhielt. Dann konnte man das sonst so verschlafene Nest kaum wiedererkennen. Gäste kamen und gingen, die Hotels waren ausgebucht. Die Stadt war voller junger Pianisten, angehender Komponisten und umtriebiger Verleger, die nur das Ziel verfolgten, mit Liszt in Kontakt zu treten. Sauer sprach in diesem Zusammenhang von »Flaneuren«, an anderer Stelle sogar von »Parasiten«.
Diese Müßiggänger unterteilte er in zwei Gruppen: in hübsche junge Damen, die Liszt den Kopf verdrehen wollten, sowie in blasierte Jünglinge, »welche ihre raffiniertesten Schmeichelkünste erprobten, um sich beim ›Alten‹ lieb Kind zu machen«115. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. So quälte sich ein holländischer Liszt-Schüler (Sauer nennt leider nicht den Namen) regelmäßig in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett und besuchte die Frühmesse, »um durch seine Frömmigkeit Liszts Herz weich zu stimmen«. 116 Die jungen Damen gingen besonders raffiniert ans Werk, und nicht wenige betrachteten den Abbé als »begehrenswerte Beute«117, wie Adelheid von Schorn schrieb. Gut aussehende Fräuleins hatten es dabei besonders leicht. Emil Sauer: »Der mit schwarzem Sammetjackett bekleidete Meister windet sich durch eine Corona schmachtender Jungfrauen, im Schleifschritt vom Flügel zum Schreibtische langsam auf und ab gehend. Manchmal beugt er sich huldreich herab zu einer der Holden, die je nach ihrer äußerlichen Beschaffenheit längerer oder kürzerer Ansprache gewürdigt wird.«118
Liszt wurde von seinen weiblichen Fans wie ein Idol angehimmelt; er war eine Art »Popstar«, dessen Verherrlichung – wie in den wilden 1840er-Jahren – nicht selten groteske Blüten trieb. Berthold Kellermann wusste zu berichten, dass sich einmal sogar Verehrerinnen heimlich in Liszts Schlafzimmer schlichen und abgestandenes Waschwasser aus einer Schüssel stibitzten. In kleine Fläschchen abgefüllt, trugen sie das kostbare Elixier dann auf ihrer Brust.119 Ein anderer Schüler übte in seiner Wohnung Liszts sogenannte Dante-Sonate, und offensichtlich wollte er das Werk besonders »authentisch« vortragen. Kellermann: »Vorher hatte er eine lebende Katze in das Ofenrohr gesteckt und den Ofen angezündet. Das jammervolle Geschrei der armen Katze sollte ihm eine bessere Vorstellung von den Höllenqualen geben!«120
Liszts Tagesablauf in Weimar sah in den 1870er- und 80er-Jahren etwa wie folgt aus. Er stand jeden Morgen um 4 Uhr auf und ging daraufhin – ohne zu frühstücken – in die Kirche. Das tat er immer, auch wenn er erst spät ins Bett gekommen war und nur wenige Stunden Schlaf gehabt hatte. Um 5 Uhr trank Liszt starken Kaffee mit Kognak und aß dazu einige trockene Brötchen. Nun arbeitete er, bis um 13 Uhr zum Mittagessen geläutet wurde. »Das Essen war gut und kräftig, aber einfach. Dazu wurde ein Glas Wein getrunken oder Wasser mit Kognak nach französischer Art, was er sehr gerne hatte. Dann wurde geraucht – geraucht hat er ja immer, wenn er nicht aß oder schlief.«121
An drei Nachmittagen in der Woche fand der Unterricht statt, der bis etwa 18 Uhr dauerte. Wenn Liszt abends nicht eingeladen war, blieben einige Schüler noch länger und leisteten ihm beim Kartenspielen Gesellschaft. Pauline Apel, Liszts Haushälterin, servierte ein frugales Abendessen, wozu Bier getrunken wurde. Zu vorgerückter Stunde konnte es passieren, dass der »Meister« und sein Gefolge doch noch das Haus verließen und in einem der Weimarer Hotels einkehrten. Dort wurde dann weitergetrunken, und nicht selten löste sich die Tafelrunde erst gegen ein Uhr morgens auf.
»Ich muß hier eine Schattenseite in Liszts Leben berühren«, deutete Adelheid von Schorn vorsichtig an, »das war seine Liebe zu starken Getränken.«122 Liszts Schüler Felix Weingartner drückte sich weniger diplomatisch aus und bezeichnete seinen Lehrer als »starken Alkoholiker«123. Liszt hatte sein Leben lang getrunken. Er brauchte den Alkohol zur »Stärkung«, mehr noch, »er fühlte sich ohne diese Anregung matt«.124 In seinen letzten Lebensjahren scheint Liszts Alkoholkonsum aus dem Ruder gelaufen zu sein. Sein amerikanischer Schüler Carl Lachmund notierte im Juli 1882 in sein Tagebuch, dass Liszt täglich eine Flasche Kognak, zwei oder drei Flaschen Wein sowie eine ordentliche Menge Absinth vertilge.125 Er sei auch während des Unterrichts immer wieder in sein Schlafzimmer gegangen und habe dort einen Schluck genommen.126 Bei dieser Alkoholflut und dem suchttypischen Verhalten mag man Weingartners Einschätzung kaum widersprechen. Adelheid von Schorn konnte schließlich mehrfach beobachten, wie Liszt bereits am Vormittag ein Glas hinunterstürzte. Meistens hatte er sich kurz zuvor über irgendetwas geärgert. In seinen eigenen Worten klang das so: »Ich weiß, daß der Kognak mein ärgster Feind ist, aber ich kann ihn doch nicht lange entbehren.«127
Ein Lehrer – zumal eine charismatische Persönlichkeit wie Franz Liszt – sollte den Zöglingen ein gutes Vorbild sein. Man gewinnt aber den Eindruck, dass Liszt es mit der gebotenen Zurückhaltung im Umgang mit seinen Schülern nicht so genau nahm. Dem jungen Berthold Kellermann erklärte er kategorisch: »Ein Musiker muß rauchen. « Als Kellermann sich als Nichtraucher zu erkennen gab, holte Liszt eine große Zigarre und brachte ihm das Rauchen bei. »Fortan gab er mir immer Zigarren, morgens, mittags und abends, Virginias und Havanas.« Einmal hatte der damals 25-jährige Berthold besonders viel geübt: »›Für dein Spiel bekommst du eine Zigarre und ein Glas Wein‹, sagte Liszt, schenkte mir selbst ein und schnitt mir eigenhändig die Zigarre ab.«128 Zwei seiner berühmtesten Schüler – Alfred Reisenauer und Arthur Friedheim – ahmten Liszt auch in seinen Trinkgewohnheiten nach und wurden selbst starke Alkoholiker. Reisenauer trank einmal in knapp drei Stunden dreizehn Seidel Bier, was immerhin gut sechseinhalb Litern Gerstensaft entspricht. Zu dieser Zeit – im Juli 1883 – war er gerade erst 19 Jahre alt.
Emil Sauer beobachtete die Saufgelage mit Schrecken. Er hielt die Vorstellung, dass Alkohol ein besonders feuriges Klavierspiel ermögliche, für einen gefährlichen Irrglauben. »Ich konnte beobachten, wie der Alkohol binnen weniger Jahre das zerstörte, was in Jahrzehnten harter und ernsthafter Arbeit aufgebaut worden war.«129 Natürlich kann man Liszt nicht persönlich für Reisenauers oder Friedheims Alkoholabhängigkeit verantwortlich machen, da zum Entwickeln einer Sucht mehr gehört als nur das schlechte Beispiel des Lehrers, doch wirft diese Distanzlosigkeit im Umgang mit seinen Schülern ein seltsames Licht auf den Pädagogen Franz Liszt. Clara Schumann, die ihrem Kollegen in späteren Jahren kritisch begegnete, notierte nach Liszts Tod in ihr Tagebuch: »Ein eminenter Clavier-Virtuos war er, aber ein gefährliches Vorbild als Solcher für die Jugend. Fast alle auftauchenden Spieler imitierten ihn, aber es fehlte ihnen der Geist, das Genie, die Anmuth und so entstanden nur einige große reine Techniker und viele Zerrbilder.«130
Die »Flaneure« unter Liszts Schülern hatten einen natürlichen Feind – und der hieß Hans von Bülow. Wenn Liszt sich auf Reisen befand oder verhindert war, sprang Bülow gelegentlich für seinen ehemaligen Lehrer ein und übernahm dessen »Meisterklasse«. Diese Vertretungsstunden waren gefürchtet, da Bülow in seinen Lektionen
das vermissen ließ, was Liszt im Übermaß besaß: Geduld und Güte. Mitte Juni 1880 war es wieder einmal so weit. Berthold Kellermann hegte keine Zweifel daran, dass seinen faulen Kommilitonen Fürchterliches bevorstand. Als er Bülow zufällig auf der Straße traf, rief dieser ihm freudig erregt zu: »Wir wollen einmal den Augiasstall ausmisten.«131 Doch zunächst versammelte Bülow alle Schülerinnen und Schüler zu einer Ansprache: »Meine Herrschaften – vergessen Sie nicht, daß der Meister im Jahre elf geboren ist, vergessen Sie nicht, daß der Meister der Inbegriff der Güte und Milde ist, und mißbrauchen Sie ihn nicht in so haarsträubender Weise! Namentlich Sie, meine Damen – glauben Sie mir – die meisten von Ihnen sind mehr für die Myrte bestimmt als für den Lorbeer.«132

Liszt an seinem 73. Geburtstag 1884 in Weimar. Vordere Reihe (v.l.n.r.): Saul Liebling, Alexander Siloti, Arthur Friedheim, Emil Sauer und Alfred Reisenauer sowie Liszts Freund Alexander Wilhelm Gottschalg. Hintere Reihe: Moritz Rosenthal, Viktoria Drewing, Mele Paraninoff, Annette Hempel-Friedheim und Hugo Mansfeld.
In den Augen der Anwesenden spiegelte sich das blanke Entsetzen. Einige verloren die Nerven und verließen den Raum, die anderen wurden von Bülow sozusagen wie das Vieh zur Schlachtbank geführt. Die knapp 20-jährige Dory Petersen hatte Liszts virtuose Etüde Mazeppa ausgewählt – ein Stück, das durch ein Gedicht Victor Hugos angeregt worden war: Ein junger Mann wird im 17. Jahrhundert in Polen zur Strafe auf ein Pferd geschnallt und in die Steppe gejagt. Diesen wilden Ritt – selbstverständlich wird der Held am Ende gerettet – hatte Liszt in Musik gesetzt. Fräulein Petersen galoppierte aber offensichtlich recht holprig durch die Noten, was Bülow zu einem vernichtenden Kommentar verleitete: »Zu diesem Stück haben Sie nur eine Qualität, die Pferdsnatur.«133 Doch bei dieser Beleidigung ließ er es nicht bewenden, er rief der völlig verstörten jungen Frau noch nach: »Ich hoffe, Sie hier nicht wiederzusehen! Sie sollten von hier weggefegt werden, nicht mit dem Besen, sondern mit dem Pumpenschwengel!«134 Und so ging es in einem fort: »Ihr könnt ja gar nichts. Ihr habt kein Recht, den Meister weiter zu belästigen! «135 Nach zwei Stunden waren die, die zwischendurch nicht das Weite gesucht hatten, mit den Nerven völlig am Ende. Gegenüber seiner Tochter Daniela lästerte Bülow: »Sie können sicher sein, dass Fräulein D. P. [Dory Petersen] ohnehin durch irgendeine andere der mitstudierenden Vogelscheuchen vergrault worden wäre, – z. B. durch Fräulein Schmalhansen, ein Schützling der Kaiserin aller Teutonen, – und dass der Musiksalon des Abbé auch weiterhin ein Lotterladen bleibt.«136
Bülow galt als hervorragender, wenn auch strenger Lehrer. Gleichwohl hatte sein Auftritt natürlich nichts mit Klavierunterricht zu tun. Er dachte gar nicht daran, Liszts Klasse zu unterweisen, er wollte vielmehr die »Flaneure« in ihr einschüchtern und verjagen. Adelheid von Schorn erklärte er: »›Ich habe Liszt dieselbe Wohltat erwiesen wie meinem Pudel, wenn ich ihn von den Flöhen befreie.‹ Bülow rannte dabei, sich vor Vergnügen die Hände reibend, in meinem Zimmer herum.«137 Ob sich durch Bülows Säuberungen etwas zum Positiven gewendet hatte? Wohl kaum. Als der Abbé davon erfuhr, sagte er zu Berthold Kellermann: »Ja, eigentlich hat Bülow ganz recht gehabt. Aber es ist doch zu hart! Du triffst doch die Leutchen heute abend im Sächsischen Hof? Sage ihnen, sie sollen warten, bis Bülow wieder fort ist. Dann sollen sie nur wieder kommen.«138
Der Sturz
Der 2. Juli 1881 begann als ganz normaler Tag. Wir können davon ausgehen, dass Liszt wie an jedem Morgen in die Kirche ging, frühstückte und dann mit seiner Arbeit begann. Im Laufe jenes Samstags ereignete sich jedoch ein verhängnisvoller Zwischenfall. Es lässt sich nicht mehr genau feststellen, wie es passierte, vermutlich aber so: Franz Liszt machte auf der Treppe der Hofgärtnerei eine unglückliche Bewegung, verlor das Gleichgewicht und fiel hin. Zunächst sah es so aus, als ob der knapp 70-Jährige noch einmal Glück gehabt hätte. Dr. Richard Brehme, der örtliche Arzt, entdeckte nur eine Wunde am rechten Oberschenkel. Zur Sicherheit bat er aber seinen berühmten Kollegen Dr. Richard Volkmann aus Halle nach Weimar. Der Professor galt als Kapazität, wenn es um komplizierte Knochenbrüche, Verletzungen der Wirbelsäule sowie alle möglichen orthopädischen Leiden ging. Nach einer ersten Untersuchung stellte sich heraus, dass Liszt sich bei seinem Sturz verschiedene Prellungen an Füßen, Zehen und Rippen zugezogen hatte. Doch damit nicht genug – die Doktoren entdeckten plötzlich eine Reihe weiterer Erkrankungen, die der Patient offensichtlich über längere Zeit ignoriert hatte. Der Abbé hasste es, krank zu sein, aber noch mehr verabscheute er, über Krankheiten – insbesondere die eigenen – reden zu müssen. »Man ist nicht krank!«, pflegte er in diesem Zusammenhang zu sagen. Nun kam aber ans Tageslicht, dass Liszt zudem an Wassersucht, Asthma, Schlaflosigkeit, einem grauen Star des linken Auges sowie einer chronischen Herzerkrankung litt.139
Brehme verordnete seinem Patienten strenge Bettruhe und untersagte ihm jede Art von Alkohol. Liszt reagierte so, wie er meistens auf Erkrankungen reagierte: Er hielt das Ganze für eine leichte Unpässlichkeit, die er schnell überwinden werde. Doch diesmal war alles anders, und Liszt musste gut acht Wochen das Bett hüten.
Adelheid von Schorn erkannte in jenem Treppensturz den Anfang vom Ende – »kurz, er wurde körperlich und geistig ein anderer. Seine Figur wurde immer stärker, sein Gesicht war oft aufgeschwemmt, seine Füße immer geschwollen, und seine schönen, feinen Hände bekamen ein krankes Ansehen.« Aber auch Liszts Wesen begann sich zu verändern, er war nun leicht reizbar und hatte sich dann nicht mehr unter Kontrolle, so »daß er gegen ganz unschuldige fremde Menschen heftig wurde […]«. Mit einem Wort: »All diese Anzeichen des Altwerdens begannen in dem Sommer 1881 und steigerten sich von Jahr zu Jahr.«140
In jener Juliwoche waren auch Daniela und Hans von Bülow in Weimar. Vater und Tochter waren sich seit zwölf Jahren nicht mehr begegnet – nun sollte unter dem Dach des Großvaters das Wiedersehen stattfinden. Liszts Unfall trübte natürlich die Stimmung, und die Bülows entschieden sich, einige Tage länger zu bleiben und den Kranken zu pflegen. »Weimar traurig«, schrieb Bülow an seinen Kollegen Karl Klindworth, »Großmeister ersichtlich an Altersschwäche zunehmend! (namentl. geistig) Ungeziefer um ihn herum quantitativ wie negativ-qualitativ ditto zunehmend.«141 Während sich die 20-jährige Daniela um ihren »grand-père« kümmerte, ihm vorlas und Gesellschaft leistete, übernahm Vater Hans dessen Unterrichtsverpflichtungen. Die Kunde, dass Bülow für Liszt einspringen werde, verbreitete sich in Windeseile und versetzte diejenigen, die bereits im Jahr zuvor das Vergnügen gehabt hatten, in Angst und Schrecken. »Allgemeine Bestürzung« habe vorgeherrscht, erinnerte sich die Liszt-Schülerin Emma Großkurth, ja, Bülows Erscheinen wurde wie eine schlimme Naturkatastrophe empfunden. »Einige von uns versuchten, sich zitternd irgendwo zu verstecken, am äußersten Ende des Salons oder hinter dem Vorhang, der den Raum teilte. Aber Hans von Bülow holte sich noch mehrere weitere Opfer, bis endlich diese Schreckenslektion ihr Ende hatte!«142
Auch Emmas Mitschülerin Lina Schmalhausen wollte sich drücken. Als Bülow das bemerkte – er hatte sie ja einmal in einem Brief an Daniela als »Fräulein Schmalhansen« verspottet –, rief er mit der Kaltblütigkeit eines Scharfrichters: »Nein, nein – gerade Sie wünsche ich zuerst zu hören!« Lina kämpfte mit dem rechten Taktmaß und spielte allem Anschein nach sehr schlecht. Bülow hörte sich ihr Geklimper eine Zeit lang an, doch dann platzte ihm der Kragen. Er brüllte: »Ich habe gehört, daß es Leute gibt, die nicht bis drei zählen können – Sie aber können offenbar nicht einmal bis zwei zählen!«143 Die junge Frau fühlte sich verständlicherweise gekränkt, packte ihre Noten zusammen und verließ eilig den Raum. Hatte Bülow gehofft, dass er Lina ein für alle Mal aus der Hofgärtnerei vertrieben hätte, wurde er schnell eines Besseren belehrt. Sie schrieb einen Brief an Liszt, worin sie sich über Bülow beschwerte. Er habe sie vor allen Leuten lächerlich gemacht und gedemütigt, ihr Stolz verbiete es ihr, noch einmal zum Unterricht zu kommen, und dergleichen mehr. Und was tat Liszt? Er entschuldigte sich bei seiner Schülerin für Bülow und bat sie, nach dessen Abreise wieder an den Stunden teilzunehmen. Liszts Reaktion lässt sich nicht nur mit seiner legendären Gutmütigkeit erklären. Dass er einen Kotau vollzog und Bülow im Grunde bloßstellte, musste noch andere Gründe haben. Schauen wir genauer hin.
Wir besitzen nur wenige gesicherte Erkenntnisse über Lina Schmalhausens Lebensweg. Sie kam 1864 in Berlin zur Welt, erhielt früh Klavierunterricht und wurde bereits mit elf Jahren Schülerin des damals berühmten Theodor Kullak. In der Reichshauptstadt hatte sie einmal das Glück, in Gegenwart von Kaiser Wilhelm I. spielen zu dürfen. Offensichtlich hinterließ das junge »Frollein« einen guten Eindruck, denn seitdem wurde Lina von Wilhelms Gattin Augusta protegiert. Man munkelte, die Kaiserin habe Lina sogar ein höchstpersönliches Empfehlungsschreiben ausgehändigt, das die so Geehrte als Entréebillet für die besseren Kreise benutzte. Augustas Brief öffnete allem Anschein nach auch die Pforte der Weimarer Hofgärtnerei, denn Lina Schmalhausen trat mit knapp 15 Jahren in Liszts Klasse ein. Das war im Sommer 1879.
Über Linas musikalische Qualitäten liegen durchweg negative Aussagen vor. Carl Lachmund bezeichnete sie als »eine weniger begabte Schülerin«144, und August Stradal erinnerte sich, dass es unmöglich war, mit ihr zu musizieren, »da sie ohne jeden Rhythmus vortrug, viele Takte übersprang«145. Zu einem Fiasko kam es, als Lina Schmalhausen im Mai 1885 bei einem Festival des Allgemeinen Deutschen Musikvereins Liszts Klavierkonzert in A-Dur aufführte. Die Interpretin war wieder einmal nicht in der Lage, den Takt zu halten; sie spielte so unrhythmisch, dass sie nicht mit dem Orchester zusammenfinden konnte. Der Dirigent Felix Mottl ließ seine Musiker schließlich so laut werden, dass vom Klavier kaum mehr etwas zu hören war.146 Liszt behandelte sie auch nach diesem für alle Seiten peinlichen Desaster auffallend nachsichtig.
Es wurde immer wieder gemunkelt, die beiden seien in Liszts letzten Lebensjahren ein Liebespaar gewesen. Auch Emil Sauer machte sich Gedanken, und er vermutete ebenfalls, dass hier etwas nicht stimmte. In seiner Autobiographie beschreibt Sauer eine bemerkenswerte Unterrichtsstunde. Ein amerikanischer Schüler war gerade von Liszt hinauskomplimentiert worden, als Lina an die Reihe kam: »Sie bringt außer einer passablen Larve ein altes ausgegrabenes Liszt-Arrangement, dessen sich der Komponist selbst kaum mehr erinnert, und erkauft sich mit jenem rührenden Pietätszeichen das Vorrecht, uns eine halbe Stunde anzuelenden, während der Nachsichtsvolle, mit verklärtem Lächeln dann und wann die Hand auf ihre Schultern niedersenkend, über alle falschen Noten und rhythmischen Verzerrungen hinweggleitet und mit öfters dazwischen geworfenen ›Hübsch‹ ruhig sein Stück hinmorden lässt. Die Mamsell hackt unbarmherziger, boshafter als der amerikanische Jüngling; aber sie versteht sich auf schelmische Grübchen, gräbt nach vergessenen Schmökern und ist daher wohlgelitten.«147
Sicher ist, dass Lina ihren »Meister« liebte und verehrte. Sie reiste mit Liszt, half in dessen Budapester Haushaltung, versorgte ihn, kümmerte sich um so alltägliche Dinge wie das Essen und die Kleidung, organisierte seine Korrespondenz und bereitete ihm – ganz allgemein gesprochen – so etwas wie ein behagliches Heim. In den letzten Jahren seiner »vie trifurquée« stellte Lina eine Konstante dar. Liszt war für diese Art von Zuwendung sehr empfänglich, er genoss die Gegenwart der jungen Frau, was mit einer gewissen Intimität einherging – ein zärtlicher Blick, ein verstohlenes Händchenhalten, eine Umarmung, ein Kuss auf die Stirn. Was sonst noch geschehen sein mag – wir wissen es nicht. Liszts Freunde betrachteten Lina misstrauisch aus den Augenwinkeln. Die Affäre mit der angeblichen Steppengräfin Olga Janina steckte allen noch in den Gliedern, und nun Lina – vielleicht war auch sie eine Betrügerin? »Sie ist keine Kosackin, aber ich weiß nicht«, orakelte Lina Ramann im Sommer 1883, »ein Wort, das er mir vor Jahren gelegentlich eines Gesprächs über ›La cosaque‹ sagte, klingt mir beständig im Ohr: ›Den Fehler, den ich gemacht habe, war, daß ich ihr vertraute. – Ich kann nicht für mich einstehen, daß mich nicht noch einmal die Leidenschaft packt.‹«148

Liszt mit seiner Schülerin Lina Schmalhausen, Budapest 1885. »Ich kann nicht für mich einstehen, daß mich nicht noch einmal die Leidenschaft packt.«
Vorsicht schien in der Tat angebracht, zumal ein vertrauensseliger Mensch wie Liszt leicht ausgenutzt werden konnte. Lina litt augenscheinlich immer an Geldmangel, und Liszt steckte ihr oft ein paar Mark zu, damit sie die dringendsten Auslagen bestreiten konnte, doch es reichte vorne und hinten nicht. Not macht bekanntlich erfinderisch, und Lina erwies sich als besonders einfallsreich. Sie ließ sich – salopp formuliert – ihren Einfluss auf den alten Herrn versilbern, wie das folgende Beispiel zeigt. Eine europäische Berühmtheit wie Franz Liszt wurde von allen möglichen Zeitgenossen bedrängt – von Verlegern, Komponisten, Pianisten und natürlich auch von Klavierbauern. Alle bedeutenden Firmen der damaligen Zeit wollten Liszt einen Flügel oder ein Klavier aus eigener Herstellung schenken. Für die Unternehmen rechneten sich derartig teure Präsente, konnten sie doch dann wahrheitsgemäß behaupten, dass der wohl berühmteste Pianist der Gegenwart ein Instrument ihrer Marke spiele. Liszt lehnte die meisten Angebote dankend ab, und zwar aus Platzgründen. Seine Wohnungen in Weimar, Budapest und Rom waren eher klein und ohnehin schon mit Klavieren vollgestopft. Darüber hinaus war er mit dem Chef der Bechstein-Manufaktur verbunden; brauchte Liszt etwa für die Hofgärtnerei einen neuen Flügel, musste er nur seinen Freund Carl Bechstein fragen.
Auch Rudolf Ibach aus Schwelm bei Wuppertal versuchte lange Zeit vergeblich, Liszt ein Instrument zu überlassen. Doch dann lernte er Lina Schmalhausen kennen. Ibach förderte die junge Pianistin in vielfältiger Weise, er lieh ihr gelegentlich Geld, stellte ihr in Weimar und bei den Eltern in Berlin kostenlos Klaviere zur Verfügung und empfahl sie hin und wieder an Konzertagenten. Lina bedankte sich dafür mit Informationen aus dem Hause Liszt. Sie war es schließlich auch, die Liszt dazu bewegte, ein Klavier des Herstellers Höhle, das bislang in der Hofgärtnerei gestanden hatte, gegen ein Instrument aus dem Hause Ibach einzutauschen. Es sei ihr wichtig, schrieb sie an Rudolf Ibach, »daß Sie mich von einer besseren Seite kennen lernen, so habe ich alles aufgeboten, um den Meister zu bewegen, Höhles Pianino abzuschaffen und dafür einen Ibach hineinzubringen«.149 Es funktionierte, und Ibach gewährte ihr zum Dank einen Kredit in Höhe von 300 Mark.
Die anderen Schüler blickten neidisch und eifersüchtig auf Lina, schließlich hatte sie ständig freien Zutritt zum geliebten »Meister«. Man mochte sie nicht besonders. Lina war eine »Zwischenträgerin«, mischte örtlichen Klatsch, studentischen Tratsch und böses Gerede in ihrer Gerüchteküche zu einer giftigen Essenz zusammen, die sie insbesondere Liszt in hohen Dosen verabreichte. Im Englischen bezeichnet man solche Leute als »troublemaker« – als Unruhestifter, die nur Ärger machen. Ihre gefährlichste Feindin war jene bereits erwähnte Dory Petersen, die ihre Eifersucht auf Lina kaum zu bändigen vermochte. Die beiden jungen Damen waren anfänglich sogar einmal befreundet gewesen, doch dann kamen sie sich mit ihren Liebesbeweisen für Liszt in die Quere. Als Lina im Frühjahr 1884 mit dem Gesetz in Konflikt geriet, sah Dory ihre Chance gekommen, die Konkurrentin auszuschalten.
Lina Schmalhausen hatte in einem Weimarer Kurzwarengeschäft etwas Meterware – Spitzen oder Rüschen – in ihre Tasche gesteckt und nicht bezahlt. Das behauptete jedenfalls eine Verkäuferin, die Lina nun des Diebstahls bezichtigte. Die Verdächtige stritt alles ab, und in ihrer Not vertraute sie sich Liszt an. Der Abbé glaubte ihr – und zwar als Einziger. Selbst Linas Mutter hielt ihre Tochter für eine gewöhnliche Gaunerin.150 Mit viel Mühen brachten Liszt und sein Freund Carl Gille die zuständigen Behörden dazu, den Fall nicht weiterzuverfolgen. Doch dann erfuhr Dory von der auch für Liszt überaus peinlichen Angelegenheit, sie ging zu jenem Kurzwarenhändler und ließ sich eine vorbereitete Bescheinigung unterschreiben, in der Lina als die Diebin bezeichnet wurde. Diese Klageschrift machte nun in Liszts Schülerkreis die Runde – Rache ist süß. Als Liszt von Dorys Coup Kenntnis erhielt, bekam er einen Wutanfall und schrieb ihr einen geharnischten Brief: »Nach Ihren letzten Vorgängen mit der Familie Schmalhausen werden Sie begreiflich finden, dass ich weiterhin Ihren Besuch nicht empfange. Die ganze Intrige wurde von Ihnen in Schlechtigkeit angezettelt und leider fortgeführt. «151 Sie müsse sich mit Lina »gehörig aussöhnen«, legte er einige Wochen später nach, andernfalls wolle er sie nie mehr sehen.152
Liszt ließ Lina noch nicht einmal fallen, als sie ihn offenkundig bestahl. Die Haushälterin Pauline Apel will gesehen haben, wie das Fräulein Schmalhausen »in das Ankleidezimmer kam, die Kommode öffnete, etwas herausnahm und dann die Kommode wieder schloß. Als sie diesen Vorfall dem Meister erzählte, wollte er davon nichts wissen.«153
Veritable Alkoholprobleme, die nachlassende Gesundheit, depressive Zustände sowie Schülerinnen, die Liszt bestahlen oder sich in unappetitlichen Heugabelduellen bekriegten – es waren Sorgen und Ereignisse wie diese, die Franz Liszts letzte Lebensjahre ins Zwielicht rückten. Hans von Bülow brachte es wieder einmal auf den Punkt. »Lina Schmalhausen – sehr ergötzlich!«, polterte er in einem Brief an Karl Klindworth. »Arthur Friedheim erzählte mir auf Bahnhofsbegegnung den ganzen Skandal. Wie traurig für unseres Meisters Würde!«154
La lugubre gondola
In den ersten Monaten nach seinem Unfall vom Juli 1881 war Liszt auf ständige Hilfe angewiesen. Hans von Bülow: »Seine Unbehilflichkeit und körperliche (wie leider auch geistige) Schwäche ist in so hohem Grade Tag für Tag zunehmend, daß ihm ein wirkliches Malheur zustoßen könnte, wenn er sich selbst überlassen bliebe.«155 In Weimar gab es genug Freunde und Verehrer, die sich um den Kranken kümmern konnten, doch wer sollte ihn auf die im Herbst bevorstehende Tour nach Rom begleiten? Cosima Wagner, die sich sehr um ihren Vater sorgte, beschloss in dieser Situation, dass Daniela von Bülow mit ihm reisen solle. Liszt mochte seine Enkelin und zeigte sich von der Idee angetan, auch die 21-Jährige willigte nach anfänglichem Zögern ein. Mitte Oktober 1881 wurden die beiden in Rom von Adelheid von Schorn erwartet. »Ich erschrak beim ersten Wiedersehen«, erinnerte sich Adelheid. »Er sah blaß und aufgedunsen aus, seine Hände und Füße waren geschwollen und die Figur sehr stark geworden.« Insgesamt verbrachte Liszt gut dreieinhalb Monate in Rom, wo er im Hotel Alibert zwei Zimmer mit Balkon bezog. Zum Appartement der Fürstin in der Via del Babuino waren es nur wenige Schritte. »Meist saß er am Schreibtisch und arbeitete – oft schlief er auch darüber ein. Abends wurde meist Karten gespielt – manchmal bereitete er uns die Freude, sich an den Flügel zu setzen.«156
In diese Zeit fiel sein 70. Geburtstag am 22. Oktober 1881. Liszt hatte keine Feier gewünscht, der deutsche Botschafter in Rom ließ es sich aber nicht nehmen, zu Liszts Ehren ein Galakonzert im Palazzo Caffarelli zu veranstalten. Der Jubilar freute sich zwar über die freundliche Geste, am liebsten hätte er den Tag jedoch ganz still wie jeden anderen verbracht. An diesem Samstag trafen über 100 Depeschen und Briefe in Liszts Hotel ein, ständig meldete der Portier die Ankunft eines weiteren Glückwunschs. Die vielen Sendungen versetzten ihn in »eine sehr gehobene Stimmung«, ließ er Ludwig Bösendorfer in Wien wissen. »Um dieser Ausdruck zu geben, schrieb ich mehrere Seiten Musik, aber gar keine Briefe. Die Abneigung gegen die Briefschreiberei wird bei mir eine Krankheit. Haben Sie die Güte meine Wiener Befreundeten zu bitten, mich zu entschuldigen. Wahrscheinlich lebe ich noch lange genug, um ihnen bessere Beweise meiner Anhänglichkeit zu liefern, als Worte.«157 Sein Schüler Arthur Friedheim wohnte ebenfalls im Alibert und übernahm die Aufgaben eines Privatsekretärs. Neben der Festtagspost kümmerte er sich so gut es ging auch um Liszts sowieso schon umfangreiche Korrespondenz.
Im Laufe der römischen Wochen besserte sich Liszts Gesundheitszustand merklich, sodass er schließlich seine Abreise nach Budapest für Januar 1882 ankündigte. Als die Fürstin davon hörte, lief sie Sturm. Dass Liszt gerade in seinem jetzigen Zustand das milde italienische Klima zugunsten von Minusgraden und möglicherweise sogar Schnee eintauschen wollte, ging ihr nicht in den Kopf. Da sie mit ihren ständigen Klagen über Budapest und die angeblich so furchtbare Musikakademie bei Liszt auf Granit biss, beschwerte sie sich bei seinem ehemaligen Schüler Kornél Ábrányi. Liszts Gesundheit werde die Reise nach Ungarn nicht guttun, schimpfte die Fürstin, »will man seinen Tod beschleunigen so lässt man ihn im Winter nach Pest reisen«. Unter diesen Umständen, fuhr sie fort, »wäre Liszts Reise und Wohnen in Pest ein wahrer patriotischer Selbstmord«.158
So berechtigt Carolynes Sorgen auch waren – dieser Brief stellte eine unverhältnismäßige Dramatisierung dar. Bei Ábrányi musste nun der Eindruck entstehen, dass Liszt kurz vor dem Ableben stünde. Die Nachricht vom angeblich schlechten Gesundheitszustand des »Meisters« verbreitete sich natürlich – wie sollte es anders sein? – in Windeseile, und alle großen ungarischen Zeitungen brachten entsprechende Meldungen. Adelheid von Schorn ging umgehend zur Fürstin Wittgenstein: Man müsse doch etwas unternehmen, so Adelheid, man müsse die Gerüchte dementieren. Doch davon wollte Madame la Princesse nichts hören; sie selbst habe die Legende in die Welt gesetzt, bekam die verblüffte Adelheid zu hören, um Liszts Abreise zu verhindern. Liszt ärgerte sich über die Einmischungen seiner einstigen Lebensgefährtin, von seinen Plänen ließ er sich indes nicht abbringen; Ende Januar 1882 verließ er Rom.
»Dein Großvater, fürchte ich, wird sich wieder stark übernehmen«, schrieb Hans von Bülow an Daniela, »obwohl die Lokomotion ihm ein Gesundheitsbedürfnis ist und der Schlaf, dem er sich während der Aufführung seiner Werke hinzugeben pflegt, sich stets als ein wirksames Stärkungsmittel bewährt.«159 In den folgenden Monaten verbrachte Liszt jeweils gut acht Wochen in Budapest und Weimar, sonst war er ständig en route. Die Stationen: Wien, Florenz, Venedig, Pressburg, Kalocsa, Brüssel, Antwerpen, Dornburg, Jena, Freiburg im Breisgau, Baden-Baden und Zürich.
Mitte Juli finden wir den 70-Jährigen in Bayreuth. Die Stadt stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Uraufführung von Richard Wagners neuer Oper Parsifal. Liszt wohnte wie immer in der Villa Wahnfried, wo er intensiv am Familienleben teilnahm. Er unterhielt die Gäste des Hauses, besuchte die letzten Proben, und abends wurde Whist gespielt. Am Vorabend der Uraufführung gab Wagner für etwa 400 Ehrengäste ein »Liebesmahl«, wie er das Festbankett nannte. Es wurde spät, da die Pausen zwischen den einzelnen Gängen sehr lang waren, und als Wagner bemerkte, wie Liszt sich zwischen zwei Gerichten etwas streckte, rief er ihm zu: »Was – ? Bist Du am Ende gewillt, uns eine Rede zu halten?« Wagner kannte die Abneigung seines Schwiegervaters gegen Tischreden. Liszt schüttelte verdutzt den Kopf, woraufhin Wagner sich an die anderen Gäste wandte: »Tut mir leid, meine Damen und Herren, aber da ist nichts zu machen!«160 Allgemeine Heiterkeit. Ein Gericht später erhob sich dann Wagner zu einer Tischrede, bedankte sich bei den Künstlern und sprach Liszt ganz persönlich an – leider ist der genaue Wortlaut nicht überliefert. Von Carl Lachmund wissen wir, dass Wagner mit »inniger Dankbarkeit« über Liszt sprach; Cosima bezeichnete den Toast sogar als hinreißend.
Am 26. Juli, nachmittags um vier Uhr, hob sich der Premierenvorhang. Das Wetter meinte es nicht gut mit den Bayreuthern, es regnete in Strömen, und Wagner ärgerte sich schon bei der Hinfahrt über allzu viele Schaulustige. Auch sonst hatte er viel auszusetzen; Cosimas Tagebuch: »Der erste Akt geht noch so ziemlich nach seinem Wunsch, nur das viele ›Komödiantische‹ ist ihm zuwider. Wie nach dem zweiten Akt stark gelärmt und gerufen wird, tritt R. an die Brüstung, sagt, daß die Beifallsbezeugungen seinen Künstlern und ihm zwar sehr willkommen, daß sie aber übereingekommen seien, sich, um den Eindruck nicht zu stören, nicht zu zeigen, also das ›sogenannte Herausrufen‹ fände nicht statt. Nachdem wir gespeist haben, sind R. und ich zusammen in der Loge! Große Rührung überkommt uns. Doch am Schluß ärgert R. das stumme Publikum, welches ihn mißverstanden hat, er redet es noch einmal von der Galerie an, und wie darauf der Beifall sich entladet und immer wieder gerufen wird, tritt R. vor den Vorhang und erklärt, er habe seine Künstler versammeln wollen, aber diese seien schon halb entkleidet. «161 Dennoch: Die insgesamt 16 Vorstellungen, die bis Ende August gegeben wurden, waren große künstlerische und finanzielle Erfolge.
Liszts Kontakt zu den Wagners war in diesem Jahr besonders intensiv; Ende August nahm er auch an der Vermählung seiner Enkelin Blandine mit dem italienischen Grafen Biagio Gravina teil. Bevor er nach Weimar zurückkehrte, um seine Unterrichtstätigkeit fortzusetzen, musste er Richard versprechen, die Familie im Herbst für einige Wochen in Venedig zu besuchen. Gesagt, getan.
Am 19. November 1882 traf Franz Liszt, über Zürich und Mailand kommend, in der Lagunenstadt ein. Cosima und die Kinder holten den Gast am Bahnhof ab, während Richard seinen Schwiegervater daheim erwartete. Die Wagners residierten im Palazzo Vendramin Calergi, einem der schönsten Bauwerke der venezianischen Hochrenaissance. Das am Canal Grande liegende Gebäude war um 1614 durch einen Anbau, Ala bianca, erweitert worden. In diesem Seitentrakt standen Wagner und seinem Gefolge rund 15 Zimmer zur Verfügung. Man lebte auf großem Fuß; zum Hofstaat der Eheleute Wagner gehörten vier Kinder (Blandine war nach der Hochzeit zu ihrem Gatten nach Sizilien übersiedelt), Siegfrieds Lehrer Heinrich von Stein, für die Mädchen eine Gouvernante sowie mehrere Hausangestellte. Darüber hinaus machten zahlreiche Freunde und Bekannte regelmäßig ihre Aufwartung. Für Liszt hatte Wagner im Palazzo ein eigenes Appartement reserviert, in das sich der Abbé vom Familienleben zurückziehen, Ruhe finden und arbeiten konnte. Wie in der Hofgärtnerei oder in der Villa Wahnfried traf man sich jetzt im Palazzo zum Musizieren, Vorlesen und Diskutieren. »Zum Mittagessen (zwei Uhr) und zum Abendessen (acht Uhr) sind wir 9 Personen zu Tisch«, berichtete Liszt der Baronin von Meyendorff. »Vor oder nach dem Abendessen gibt es etwas Musik – aber nicht zu viel. Mir zuliebe endet der Abend normalerweise mit zwei oder drei Partien Whist.«162
Wagner hatte sich auf Liszt zweifellos sehr gefreut, doch bereits am Tag der Ankunft notierte Cosima in ihr Tagebuch: »Mit dem Gespräch aber, trotz aller Herzlichkeit beiderseits, will es nicht gar gut gehen.«163 Liszts Besuch schien Wagners Kräfte zu übersteigen. Der 69-Jährige war schwer krank und klagte oft über Brustkrämpfe, die sich heute eindeutig als Angina Pectoris diagnostizieren lassen. Wagner war unleidlich, und es kam immer wieder zu heftigen Wutausbrüchen, in deren Mittelpunkt ausgerechnet der arme Liszt stand. Mal störte es ihn, dass sein Schwiegervater zu spät zum Essen kam, mal nahm er an Liszts Klavierspiel Anstoß, dann beklagte er sich über dessen angebliche Humorlosigkeit, und nicht selten schimpfte er über seine Kompositionen. Es reichte oft schon aus, dass Cosima und ihr Vater Französisch miteinander sprachen, um Wagners Laune gefährlich zu verdunkeln. So vergingen die Tage. An Heiligabend führte Wagner im eigens gemieteten Teatro La Fenice mit einem örtlichen Schülerorchester seine Sinfonie in C-Dur auf – ein Jugendwerk, das er zuletzt 50 Jahre vorher dirigiert hatte. Im Anschluss stießen die anwesenden Freunde und alle Musiker auf Cosimas 45. Geburtstag an. »Dann sagt R. meinem Vater in’s Ohr: ›Hast du deine Tochter lieb?‹ Dieser erschrickt; ›dann setze dich an das Klavier und spiele‹. Mein Vater tut es sofort zur jubelnden Freude aller.«164

Die Eheleute Richard und Cosima Wagner an der Rückseite des Palazzo Vendramin Calergi in Venedig, Winter 1882/83.
Liszt konnte von seinem Appartement auf den Canal Grande blicken; dort sah er manchmal durch den Nebel der Lagune schwarz verhüllte Trauergondeln gleiten. Dieser verstörend-schöne Anblick veranlasste ihn zur Komposition des Klavierstücks La lugubre gondola . In dem Klagelied, das in verschiedenen Versionen existiert, erweckt Liszt die morbide Atmosphäre jener venezianischen Dezembertage zu ergreifenden Tönen. Das Werk erlangte später traurige Berühmtheit, da es Richard Wagners Tod vorwegzunehmen scheint. Der Komponist war an dieser Deutung nicht ganz unschuldig, denn er gestand einem bekannten Verleger: »Wie aus Vorahnung schrieb ich diese Elegie in Venedig, 6 Wochen vor Wagner’s Tod.«165 Gut möglich, dass Richard Wagner die Entstehung seiner eigenen Trauermusik hörte.
Franz Liszt verließ Venedig am 13. Januar 1883; genau einen Monat später – am 13. Februar – erlag Richard Wagner im Palazzo Vendramin einem Herzinfarkt. Cosima stimmte an diesem Dienstag eine bizarre Totenklage an. Vieles davon ist auch heute noch befremdlich: Immer wieder schlich sie sich zu dem Leichnam, legte sich neben oder auf ihn, küsste und streichelte den Toten. Die erste Nacht verbrachte Cosima sogar mit ihrem verstorbenen Mann im Bett. Im Palazzo herrschte in den Stunden und Tagen nach Wagners Ableben gespenstisches Treiben: Der Arzt Friedrich Keppler und Paul von Joukowsky, ein Freund der Familie, bereiteten die Einbalsamierung der Leiche vor, der Bildhauer Augusto Benvenuti fertigte die Totenmaske an, Wahnfrieds Finanzverwalter Adolf von Groß reiste eigens aus Bayreuth an, um den Rücktransport nach Deutschland vorzubereiten.
Es wäre ein Leichtes gewesen, ein Telegramm nach Budapest zu senden. Doch offensichtlich kam niemand auf die Idee, den Abbé über das traurige Ereignis zu informieren. Am 14. Februar war Liszt jedenfalls noch völlig ahnungslos, er hatte keinen Schimmer davon, was sich 24 Stunden zuvor in Venedig ereignet hatte. Er saß gerade an seinem Schreibtisch, als der Verleger Ferdinand Táborszky in den Raum stürzte und ihm die Nachricht überbrachte. »Unsinn!«, lautete Liszts erste Reaktion. »Da wird er desto länger leben; – ich müßte es doch zuerst wissen!« Er konnte es sich einfach nicht vorstellen, dass Cosima ausgerechnet ihn – den eigenen Vater – im Unklaren gelassen haben sollte. Als er begriff, dass Táborszky recht hatte, sackte er in sich zusammen und stammelte: »Nun, heute er, morgen ich!«166 Liszt kabelte sofort nach Venedig und bot seine Hilfe an, wovon man im Palazzo aber nichts wissen wollte. Cosimas Tochter Daniela, die in dieser Zeit ein Tagebuch führte, notierte am 16. Februar: »Grosspapa wollte kommen uns zu begleiten, auf Mama’s Wunsch baten wir ihn dringend es zu unterlassen.«167

Liszts Handschrift seiner Komposition La lugubre gondola. »Wie aus Vorahnung schrieb ich diese Elegie in Venedig, 6 Wochen vor Wagner’s Tod.«
Richard Wagners Beerdigung fand am 18. Februar 1883 im engsten Freundes- und Familienkreis in Bayreuth statt. Franz Liszt fehlte an diesem Sonntag, gehörte er doch wohl zu den unerwünschten Personen. Im Frühjahr unternahm er verschiedene Versuche, mit seiner Tochter in Kontakt zu treten, doch alle Anläufe wurden von ihr ausgebremst. Cosima lebte völlig zurückgezogen in der Villa Wahnfried, nur die Kinder bekamen ihre Mutter zu Gesicht. Im Festspieljahr 1883 blieb zunächst alles beim Alten, und die zwölf Parsifal-Aufführungen, die Richard Wagner noch persönlich vorbereitet hatte, wurden wie geplant auf die Bühne gebracht. »Nach Bayreuth komme ich diesmal nicht«, schrieb Liszt an sein Patenkind, »wegen der ehrwürdigen Abgeschlossenheit in hehrer Trauer meiner Tochter. «168 Cosimas Verhalten berührte ihn so unangenehm – vermutlich war es ihm sogar richtiggehend peinlich –, dass er sich in abstrakte Entschuldigungen flüchtete. »Zwischen ihr und mir gibt es Bande und Zeitpunkte«, erklärte er der Baronin von Meyendorff, »die ganz außerhalb gewohnter Beziehungen liegen.«169 Wenn Liszt aber die Maske der Selbstbeherrschung ablegte, zeigte sich deutlich, wie sehr Cosimas Zurückweisung ihn verletzte. »Liszt wollte von Pest aus seine Tochter in Bayreuth besuchen und – sie lehnte seinen Besuch ab«, hatte Lina Ramann von Adelheid von Schorn gehört. »Liszt sei beim Empfang ihres Briefes außer sich gewesen, wie sie ihn nie gesehen. Seitdem gebrauche er mehr Cognac als sonst, es sei manchmal kaum mit ihm auszukommen.«170
Im folgenden Jahr 1884 griff Cosima erstmals in die Festspielarbeit ein. Dabei ging sie ausgesprochen geschickt vor, wusste sie doch, dass ihre Legitimation einzig in der Tatsache bestand, dass sie mit Wagner verheiratet gewesen war. Sie machte aus der Not eine Tugend, indem sie ihre Witwenschaft ins Pathetische steigerte. So lenkte sie die Liebe und Verehrung für den toten »Meister« auf ihre Person: Aus der Frau des »Meisters« wurde sukzessive die »Meisterin«. Auf der Seitenbühne ließ sie sich einen Verschlag aus schwarzen Tüchern bauen. Dort hockte sie, eine Partitur in den Händen haltend, und verfolgte durch kleine Schlitze das Geschehen. Sie sprach nicht und durfte auch nicht angesprochen werden; ihre Korrekturen, Wünsche und Anordnungen schrieb sie auf Kommandozettel, die von Helfern weitergegeben wurden.
In diesem Sommer reiste auch Franz Liszt wieder nach Bayreuth. Daniela fiel im Vorfeld die unangenehme Aufgabe zu, dem Großvater höflich klarzumachen, dass er nicht in Wahnfried absteigen könne. Hatte er bislang immer in der Familienvilla gewohnt, war dort für ihn nun kein Platz mehr. Fräulein von Bülow empfahl die nahe gelegene Siegfriedstraße, wo der königliche Regierungs- und Kreisforstrat Ludwig Frölich und Frau Emma ein großes Haus besaßen, in dessen Parterre sie eine möblierte Wohnung vermieteten. Insgesamt blieb Liszt genau vier Wochen in Bayreuth. »Die Hälfte des Tages ist mit Proben belegt«, berichtete er Olga von Meyendorff. »Ich habe bislang alle Orchesterproben besucht. Man hat mir einen Tisch mit einer Lampe für die Partitur in der ersten Sitzreihe aufgebaut. «171
Liszts Enkel Daniel Ollivier, Blandines Sohn, weilte ebenfalls zu den Festspielen in Bayreuth. »Sein Großvater, den er seit 1878 nicht mehr gesehen hatte, erschien ihm müde und fülliger, aber noch immer hochinteressant«, schrieb Marie-Thérèse Ollivier an die Fürstin Wittgenstein. »Seiner Tante [Cosima] ist er nicht begegnet, nur eines Tages hat er zufällig ihr Skelett im Garten flüchtig erblickt. Ebenso traf sie wohl in den Gängen des Theaters auf Liszt. Er hat einige Worte an sie gerichtet, auf die sie lediglich mit gespenstischem Schweigen reagierte. ›Das Theater geht weiter!‹« Man kann sich die groteske Situation gut vorstellen: Liszt trifft zufällig auf seine Tochter, spricht sie an – und Cosima geht schweigend an ihm vorüber. So gut wie alles an dieser hochsommerlichen Szenerie war grotesk, um nicht zu sagen: unwürdig. Cosima hockte hinter ihrem Verschlag und verteilte Kommandozettel, während der eigene Vater wie ein subalterner Regieassistent, den man nicht sonderlich ernst nimmt und allenfalls belächelt, im Zuschauerraum saß. Marie-Thérèse Ollivier: »Zur großen Entrüstung der geheiligten Familie schlief Liszt aus Müdigkeit oder aus Langeweile häufig während der krönenden Abschlussszenen. Das nennt man einen geistigen Rückzug.«172
Liszt traf gelegentlich mit seinen Enkeln zusammen, wobei er besonders bemüht war, Daniela zu unterstützen. Die 24-Jährige musste als ältestes der Kinder die repräsentativen Pflichten der Mutter übernehmen. Bei den vornehmen Empfängen, die auch in dieser Saison in der Villa Wahnfried stattfanden, machte sie die Honneurs, während Mutter Cosima derweil in ihren Gemächern im Obergeschoss der Villa Trübsal blies. Als weltgewandter Mann gab Liszt seiner Enkelin manchen Hinweis, so auch hinsichtlich einer angemessenen Bewirtung: »Einmal pro Woche in ›Wahnfried‹ den Gästen Ihrer Wahl Tee mit dem üblichen Gebäck servieren lassen; später dann, so gegen zehn Uhr, Sandwichs mit Rot- und Weißwein – keinen Champagner – und schließlich Eis ›ad libitum‹. Und da wir glücklicherweise in Bayern sind, könnte zum Nachmittagstee auch Bier gereicht werden.«173
Der Pudel wartet auf
Franz Liszt am 1. Januar 1886: »Sie werden sehen, dies Jahr ist mein Unglücksjahr, denn es fängt mit einem Freitag an.«174 August Göllerich maß diesem Seufzer seines Lehrers nicht sonderlich viel Bedeutung bei. Einerseits wusste er, dass Liszt nicht frei von Aberglauben war, andererseits ging es dem 74-Jährigen erstaunlich gut. Seit Ende Oktober hielt er sich nun schon in Rom auf; das milde italienische Klima hatte ihn sichtlich erfrischt. Er sei »merkwürdig gut aussehend«, schrieb Liszts alte Freundin Malwida von Meysenbug an Daniela: »Es ist ausserordentlich wie er sich erholt hat, wenn ich an jene Zeit denke wo Du mit ihm hier warst.«175 Als Liszt am 21. Januar die Ewige Stadt verließ, dachte keiner daran, dass es ein Abschied für immer sein würde. Über Florenz und Venedig fuhr er nach Budapest, wo er sich bis Mitte März aufhielt – zum letzten Mal. Liszts Reisetätigkeit in diesem Jahr erinnert an eine Abschiedstournee. Er besuchte Wien, Lüttich und Antwerpen, war mehrfach in Paris zu Gast und überquerte zum ersten Mal seit 1841 wieder den Ärmelkanal. Sein ehemaliger Schüler Walter Bache hatte ihn schon seit längerer Zeit immer wieder freundlich gedrängt, London zu besuchen, jetzt sagte er schließlich zu. Liszt wusste zunächst nicht genau, was ihn dort erwartete, deshalb stellte er vorsichtshalber klar: »Es scheint beabsichtigt in London, mich an’s Clavier zu schieben. Öffentlich kann ich mir dies nicht gefallen lassen, weil meine 75jährigen alten Finger nicht mehr dazu passen, und Bülow, Saint-Saëns, Rubinstein und Sie, lieber Bache, meine Compositionen viel besser spielen, als meine verkommene Wenigkeit.«176
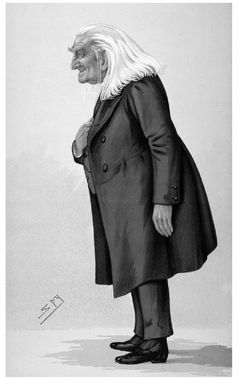
Im Frühjahr 1886 brach Liszt noch einmal nach London auf, wo der charismatische Abbé gefeiert und auch von der Queen in Windsor Castle empfangen wurde (Karikatur von Spy in Vanity Fair, 1886).
Franz Liszt traf am 3. April 1886 in London ein, wo Bache ein richtiges Liszt-Festival arrangiert hatte: Die abendfüllende Legende von der heiligen Elisabeth wurde zweimal aufgeführt, darüber hinaus standen Klavierabende und Orchesterkonzerte auf dem Programm. Am 7. April war Liszt in Windsor Castle bei Queen Victoria zu Gast. Im August 1845 hatte er Ihre Majestät die Königin zuletzt im rheinischen Bonn gesehen, und die Neugierde war nach der langen Zeit auf beiden Seiten sehr groß. Die Queen notierte in ihr Tagebuch: »Nach dem Mittagessen zogen wir uns in den roten Salon zurück, wo wir den berühmten Abbé Liszt trafen, den ich seit 43 Jahren [sic!] nicht mehr gesehen habe und der, damals ein sehr wilder phantastisch aussehender Mann, heute ein ruhiger und gütig aussehender alter Priester ist, mit langen weißen Haaren und kaum Zähnen. Wir baten ihn zu spielen, was er tat, einige seiner Kompositionen. Er spielte wunderschön.«177
Liszt setzte sich noch bei anderen Gelegenheiten ans Klavier, so auch beim Abschiedsdinner am 18. April in Westwood House. Er bedankte sich bei seinen englischen Freunden mit Werken von Beethoven, Weber, Cramer, Bach sowie den eigenen Schubert-Bearbeitungen Soirées de Vienne. Alles in allem war das Londoner Festival ein triumphaler Erfolg.
Ende April finden wir ihn in Paris, wo im Saal des Trocadéro in seiner Gegenwart die Legende von der heiligen Elisabeth aufgeführt wurde. Nachdem der letzte Ton verklungen war, brachen die 7000 Zuhörer in Jubel aus. Die Erfolge an der Themse und an der Seine zeigten, dass Franz Liszt auch als alter Herr die Menschen nach wie vor verzaubern und beglücken konnte. Er galt als der größte Pianist, wurde geliebt und abgöttisch verehrt und war im Wortsinne weltberühmt. Bereits im Vorjahr hatte sich ein amerikanischer Konzertagent bei Liszt vorgestellt und ihm für eine Tournee durch die Vereinigten Staaten die sagenhafte Gage von zwei Millionen Mark angeboten. Der Maestro hätte auch immer nur ein und dasselbe Stück spielen müssen, so die Offerte. Liszt fand das Anerbieten geradezu lächerlich: »Was soll ich, mit 74 Jahren, noch mit zwei Millionen anfangen? Soll ich in Amerika etwa 300 Mal den Erlkönig spielen? Ein alter Pudel wartet nicht mehr auf!«178 Mit dem Klavierspielen hatte er innerlich abgeschlossen. »Möge nun endlich meine leidige Pianisterei zu Ende sein!«, klagte er seiner Biographin Lina Ramann. »Längst ward sie mir zur Thierquälerei. Also, – Amen!«179
Vielleicht hatten die jüngsten Ereignisse sein Selbstwertgefühl angestachelt und seinen Stolz geweckt, vielleicht waren die Wunden, die Cosima ihm durch ihr Verhalten nach Wagners Tod zugefügt hatte, noch nicht verheilt – Liszt wollte jedenfalls in diesem Sommer einen weiten Bogen um Bayreuth machen und verspürte absolut kein Verlangen, seine Familie zu treffen. Seinem Schüler August Göllerich sagte er: »Nein, diesmal gehe ich nicht hin, ich habe es satt, als Pudel aufzuwarten!«180 Es kam anders.
Am 18. Mai 1886 tauchte Cosima unerwartet in Weimar auf. Seit jener spukhaften Begegnung im Sommer 1884 hatte Liszt seine Tochter nicht mehr gesehen – von einem Treffen konnte damals ja ohnehin keine Rede sein. Nun bekniete Cosima ihren Vater: Seine Enkelin Daniela habe sich verlobt, im Sommer werde die Hochzeit stattfinden, es wäre schön, wenn Liszt als Ehrengast an den Feierlichkeiten teilnehmen würde, er solle ruhig bis zur Eröffnung der Festspiele in der Stadt bleiben … und so weiter. Es mag sein, dass Daniela den Besuch ihres Großvaters als Herzensangelegenheit empfand, richtig ist aber auch, dass die Festspielleiterin Cosima Wagner mit der Berühmtheit ihres Vaters kühl kalkulierte. Es war eine einfache Rechnung: Liszt hatte in London und Paris gezeigt, dass er riesige Säle füllen konnte – warum nicht auch das Bayreuther Festspielhaus? Zum Hintergrund: Neben Wagners letztem Werk Parsifal sollte 1886 zum ersten Mal Tristan und Isolde auf dem Grünen Hügel erklingen. Das stellte ein gewagtes Unterfangen dar, und es war zweifelhaft, ob man genug Karten verkaufen würde. Frau Wagner konnte also jede Art von »Publicity« gut gebrauchen. Der »Pudel« willigte ein – und zwar gegen den ausdrücklichen Wunsch der Fürstin Wittgenstein: »Liszt geht es recht gut angesichts dessen, dass er versprochen hat, zu den Aufführungen nach Bay[reuth] zu kommen – was mich vollkommen verzweifeln ließ, denn das heißt den lieben Gott herauszufordern!«181

Fototermin anlässlich der alljährlichen Tonkünstlerversammlung, Sondershausen im Juni 1886. Vor Liszt auf dem Boden (v.l.n.r.) seine Schüler Alexander Siloti, William Dayas, Bernhard Stavenhagen, Arthur Friedheim und August Stradal. Das Wetter sei feucht und kühl und der »Meister« »übel gelaunt« gewesen, berichtete Lina Ramann. Es ist das letzte Foto mit dem Gründungsmitglied Franz Liszt.
Die letzte Reise
In Bayreuth herrschte großer Trubel, als Franz Liszt am 1. Juli 1886 dort eintraf. Die Aufregung galt jedoch weniger ihm als vielmehr seiner 25-jährigen Enkelin Daniela von Bülow und deren drei Jahre älterem Verlobten Henry Thode. Es versteht sich von selbst, dass die Trauung eines Mitglieds des Hauses Wagner in Bayreuth ein gesellschaftliches Großereignis darstellte. Entsprechend umfangreich gestalteten sich die Vorbereitungen. Insbesondere Cosima Wagner hatte alle Hände voll zu tun, denn außer der Familienfeier galt es auch die diesjährigen Festspiele zu planen. »Liszt angekommen«, notierte der Dirigent Felix Mottl an jenem Donnerstag in sein Tagebuch. »Frau Wagner nach der Probe: In Thränen! Kann sich nicht fassen. Umarmt mich! Gieng wirklich gross! Abends Liszt. – Fr. W.: ›Selbst das Liebste kommt einem lächerlich vor, wenn es nicht mit den Festspielen zu thun hat!‹«182 Ob Cosima auch ihren Vater zu jenen Lächerlichkeiten rechnete? Gut möglich. Überhaupt schien sie Liszts Besuch mit gemischten Gefühlen zu betrachten. Zwar legten sie und ihre Kinder großen Wert auf die Anwesenheit des berühmten Verwandten, in den eigenen vier Wänden konnten oder wollten sie den alten Herrn aber nicht unterbringen. Vielleicht war es ihm auch ganz recht, dass er nicht mit anderen Hochzeitsgästen zusammen in Wahnfried logieren musste. Liszt stieg jedenfalls erneut bei den Frölichs in der nahe gelegenen Sieg friedstraße ab. »Madame la Conseillère des Forêts«, wie er Emma Frölich mit formvollendeter Etikette ansprach, hatte ihm die Wohnung im Parterre gerichtet. Dort war er für sich und hatte seine Ruhe.
Die standesamtliche Trauung fand am 3. Juli in Wahnfried statt. »Alles ist gut abgelaufen in Bayreuth«, berichtete er wenige Tage später der Fürstin Sayn-Wittgenstein. »Am Samstag abend, nach der Unterzeichnung des Ehevertrages, gab es in Wahnfried ein großes ricevimento von mehr als 80 Personen. Der Bürgermeister, der mit dem Hause Wagner sehr befreundet ist, hat eine recht passende kurze Ansprache gehalten; die Honoratioren der Stadt und die fremden Künstler, Sänger und Instrumentalisten, die bereits mit den Proben für Parsifal beschäftigt sind, bildeten die Versammlung, die an einem guten und ausreichend mit kalten Speisen versehenen Büffett etwas fand, womit sie sich stärken konnte.«183 Am nächsten Vormittag erfolgte die kirchliche Trauung. Die Festgemeinde sowie unzählige Zaungäste füllten das protestantische Gotteshaus bis auf den letzten Platz. Im Anschluss daran hatte die Brautmutter rund 30 Personen zu einem Mittagessen in das Restaurant neben dem Festspielhaus geladen. Zu den Auserwählten gehörte auch Felix Weingartner: »Frau Wagner war, wie immer, in ein langwallendes Witwengewand gekleidet, das jedoch an diesem Tage nicht von schwarzer, sondern von mattgrauer Farbe war. Eine Art von wehmütiger Freude erhellte vorübergehend die tiefe Trauer. Diese Frau verstand es meisterlich, das zu tun, was Eindruck machte. Alle Anwesenden und ich bewunderten ihren Geschmack in der Wahl dieses hochzeitlichen Witwenkleides und die Art, wie sie sich darin bewegte.«184 Nur Danielas Vater Hans von Bülow fehlte an der Festtafel. »Der Hochzeit kann ich ja – bekanntlich – in Bayreuth nicht assistiren!!!«, spottete er. »Gott gebe der dritten Generation weniger Unheil im häuslichen Leben!«185
Cosima Wagner hätte es gerne gesehen, wenn ihr Vater bis zur Eröffnung der Festspiele in Bayreuth geblieben wäre. Liszts Anwesenheit hätte – so das Kalkül – die Festivalvorbereitungen gewissermaßen geadelt, er wäre in der sich stetig füllenden Stadt so etwas wie eine willkommene touristische Attraktion gewesen. Doch Liszt hatte andere Pläne. Am Tag nach Danielas Hochzeit brach er in Richtung Luxemburg auf. Der ungarische Maler Mihály Munkácsy und seine Frau Cécile hatten ihn eingeladen, einige Tage auf deren Schloss in Colpach zu verbringen. Obschon Liszt seiner Tochter versprochen hatte, zur Eröffnung der Festspiele zurückzukommen, reagierte Cosima verärgert. Felix Mottl schnappte ein kurzes Gespräch auf. »Frau Wagner sagt zu Daniela, welche Bülow sehen wird: ›Die Abreise meines Vaters (Liszt) ärgert mich. Hoffentlich erlebst Du mehr Freude an Deinem Vater.‹ ›Das glaub ich kaum‹ sagt Daniela!«186
Franz Liszt traf am Abend des 5. Juli 1886 am Luxemburger Bahnhof ein, wo er von seinem Schüler Bernhard Stavenhagen in Empfang genommen wurde.187 Nach einer kurzen Pause – der Stationsvorsteher überreichte dem prominenten Gast einen Blumenstrauß und ließ im Wartesaal Erfrischungen servieren – ging die Fahrt weiter nach Colpach. Dieser letzte Teil der Tour war besonders beschwerlich, da Liszt und Stavenhagen zunächst mit dem Zug ins belgische Arlon und von dort mit der Kutsche weiterreisen mussten. Für die vergleichsweise kurze Strecke von insgesamt knapp 40 Kilometern benötigte man damals gut fünf Stunden. Auf dem Schloss der Munkácsys verbrachte Liszt ruhige Tage: In den Morgenstunden erledigte er mit Stavenhagen die unvermeidliche Korrespondenz, später spielte er einige Partien Whist oder ging im Park spazieren. Doch zog er sich in Colpach auch eine schlimme Erkältung zu, worüber er am 17. Juli seiner Freundin Olga von Meyendorff klagte: »Seit 5 Tagen ist zu meinem so bereits annehmbaren körperlichen Zustand ein Husten der heftigsten Art hinzugekommen, der mich Tag und Nacht belästigt. Um mich zu trösten, sagt mir der Arzt, daß diese Art Husten höchst hartnäckig ist. Bis jetzt haben mich weder Mixturen und Kräutertees noch Senfpflaster oder Fußbäder davon befreit.«188
Liszt war also schon krank, als er am Abend des 19. Juli im Luxemburger Bürgerkasino ein Orchesterkonzert zu seinen Ehren besuchte. Cécile Munkácsy hatte ihren Gast gebeten, nach dem offiziellen Programm einige Klavierstücke zu spielen. Er willigte ein, obschon ihm die Erkältung sehr zu schaffen machte. Die zahlreichen Zuhörer staunten jedenfalls nicht schlecht, als nach dem letzten Orchesterstück ein Flügel in den Saal gerollt wurde und Liszt daran Platz nahm. Er spielte seinen ersten Liebestraum, eine Chopin-Bearbeitung sowie die sechste Nummer der Soirées de Vienne. Dieser kurze Auftritt war Franz Liszts Abschied vom Klavier; danach hat er nicht wieder öffentlich gespielt. Eine Zeitzeugin will beobachtet haben, dass es ihm nicht gut ging: »In ehrfurchtsvollem Kreise saß ringsum die vom Zauber des Spiels gebannte Zuhörerschaft. Um die Atembeschwerden des Künstlers zu bekämpfen, hielt Frau Munkaczy ihm von Zeit zu Zeit das mit starkem Parfüm durchtränkte Taschentuch vors Gesicht.«189 Der Interpret wurde begeistert gefeiert. Am nächsten Morgen brachen Liszt und Stavenhagen über Frankfurt in Richtung Bayreuth auf. Die Munkácsys hatten ihn dringend gebeten, nicht zu reisen und lieber die Erkältung zu kurieren. Doch Liszt winkte ab – er habe seiner Tochter Cosima sein Kommen zugesagt, und das müsse er nun halten. Zu allem Übel stand während der Nachtfahrt das Abteilfenster offen – ein Mitreisender hatte darum gebeten –, was Liszts Husten kaum zuträglich gewesen sein dürfte. Als Franz Liszt am 21. Juli 1886 in Bayreuth eintraf, war er bereits ein schwer kranker Mann.
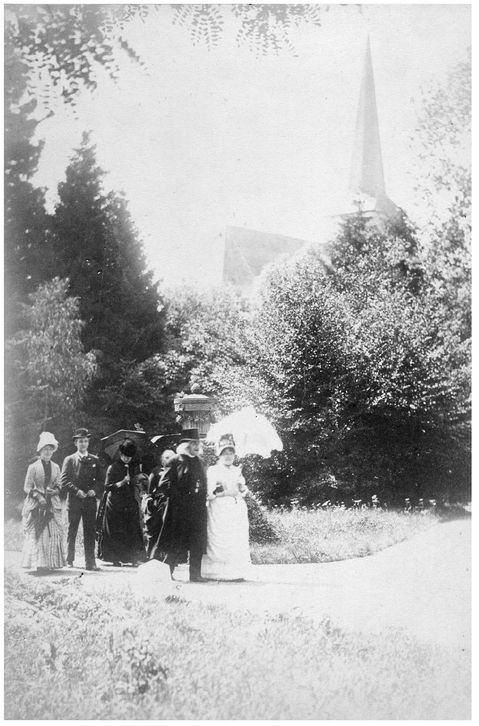
Die letzte Reise: Im Juli 1886 besuchte Liszt das Ehepaar Munkácsy auf deren Schloss in Colpach. Vom Kirchgang kehrt der kränkelnde Liszt am Arm von Cécile Munkácsy zurück.
Danse macabre
Was sich in den nun folgenden 14 Tagen in der Festspielstadt abspielte, konnte unwürdiger nicht sein. Es war ein Trauerspiel, ein bizarrer Totentanz, eine morbide Groteske, die auch heute noch bewegt und erschaudern lässt. Über diese schrecklichen Ereignisse sind wir dank verschiedener Quellen gut informiert. Da sind beispielsweise die Memoiren von Felix Weingartner, die Tagebücher von Felix Mottl, Familienbriefe der Wagners und anderes mehr, mit dessen Hilfe man Franz Liszts letzte Tage rekonstruieren kann. Die zweifellos wichtigste Quelle stellen die in deutscher Sprache unveröffentlichten Aufzeichnungen der Liszt-Schülerin Lina Schmalhausen dar.190 Es ist für den Biographen gewissermaßen ein Jahrhundertfund, wenn ein derartiges Dokument auftaucht. Die Verfasserin hat vom 22. Juli bis zum 3. August 1886 ein Tagebuch geführt, das in immer neuen Variationen ein einziges Thema behandelt: Franz Liszts langes und qualvolles Sterben. Gleichwohl sollte man diese Aufzeichnungen kritisch unter die Lupe nehmen. Lina Schmalhausen erhebt nämlich so ungeheuerliche Vorwürfe gegen die Menschen in Liszts Nähe – allen voran die Familie Wagner –, dass man zunächst die Frage nach der Glaubwürdigkeit stellen muss.
Lina war – wir hörten es bereits – in Liszts Entourage hoch umstritten, und je mehr sie von ihr geschnitten wurde, desto argwöhnischer bewachte sie den »Meister«. In ihren Briefen an Freunde und Bekannte stellte sie Liszt nicht selten als vereinsamten Mann dar, der von seiner herz- wie verständnislosen Umgebung schlecht behandelt werde. Die Beweggründe scheinen eindeutig, sollte ihr Stern als »einzige« und »wahre« Liszt-Vertraute doch umso heller leuchten. Ein Beispiel: Liszt feierte seinen 74. Geburtstag am 22. Oktober 1885 in Innsbruck. Anwesend waren neben Lina Schmalhausen auch die Liszt-Schüler Bernhard Stavenhagen, István Thomán und Conrad Ansorge. Liszt war also keinesfalls alleine, wie überhaupt seine Anwesenheit in der Stadt nicht geheim blieb: Der örtliche Männergesangsverein brachte dem Jubilar sogar ein Ständchen. Die Erinnerungen an diese Geburtstagsfeier unterschieden sich allerdings erheblich voneinander. Conrad Ansorge schrieb in einem Brief an seinen Kollegen August Göllerich: »Interessant dürfte es Dir sein, Fräulein Schmalhausen in einem Brief an die Fräulein Stahr äußern zu hören. Sie schreibt wörtlich: ›Meister verlebte nun seinen Geburtstag ohne Gratulationen (!) ziemlich einsam in Innsbruck, ich war zum Musikvorstand gegangen und ließ ihm des Abends ein Ständchen bringen. Meister fühlte sich äußerst wohl in Innsbruck u. blieb dort 5 Tage. Später kamen Stavenhagen, Ansorge u. Thoman nach, sie waren dem Meister auf die Spur gekommen.‹ (sic!) Dabei hat sie mit mir zu Meisters Geburtstag Geschenke in Innsbruck eingekauft, und Abends beim Ständchen haben Stavenhagen u. ich den Meister aus dem Hotel herausgeführt zu den Sängern. Das schrieb sie 3 – 4 Tage darauf aus Rom; Vergeßlichkeit kann das also nicht gewesen sein, denn dazu war eine zu kurze Zeit (bis zum Schreiben) verflogen.«191
Lina war offenbar eifersüchtig auf Stavenhagen und die anderen, deshalb verschwieg sie deren Anwesenheit. Anna und Helene Stahr, die Adressatinnen, sollten denken, dass sich eben nur die treue Lina um den armen Liszt kümmere. Was ist also nun von Schmalhausens Tagebuch zu halten? Vorsicht ist immer dann geboten, wenn Lina die anderen Liszt-Schüler erwähnt. Deren Charakterisierungen sind ganz offenkundig bewusst negativ gefärbt. Grundsätzlich wirken ihre Schilderungen der Ereignisse rund um Franz Liszts Ende aber glaubwürdig, zumal diese durch andere Quellen bestätigt werden können. Beginnen wir unsere Spurensuche am 22. Juli 1886.
Lina ging am Morgen dieses Donnerstags zum Haus der Frölichs, wo Liszt erneut sein Quartier bezogen hatte. Sie erschrak, als sie ihm gegenüberstand: »Meister sah sehr sehr leidend aus u. hustete in einem fort entsetzlich.«192 Lina, August Göllerich sowie Liszts Butler Mihály Kreiner – genannt Miska – kümmerten sich nun um den Patienten, leisteten ihm bei den geliebten Whistpartien Gesellschaft oder lasen ihm vor. Das Kartenspiel wie die Lektüre mussten aber häufig unterbrochen werden, »da Meister immerzu hustete, sein ganzer Körper zitterte dabei heftig, sein Kopf wurde bluthroth u. er speite in 2 Std. wohl 4 Taschentücher voll Schleim«.193
Einmal am Tag – in der Regel am frühen Morgen – besuchte Cosima Wagner ihren kranken Vater für gut eine Stunde und trank mit ihm Kaffee. Die Mahlzeiten nahm er zunächst bei seiner Familie in der Villa Wahnfried ein, als sich sein Zustand aber weiter verschlechterte, ließ Cosima das Essen zu ihm in das Haus der Frölichs bringen. Da Liszt jedoch über Zahnprobleme klagte, konnte er die servierten Kalbsfilets, Steaks und Koteletts kaum kauen. Meistens stocherte er mit der Gabel in seinem Gericht und aß ein oder zwei Bissen Reis – Appetit hatte er ohnehin nicht. »Wäre ich nur anderswo krank geworden«, soll Liszt in seiner Verzweiflung geschimpft haben, »aber hier gerade aufzusitzen, wo Alles zusammenströmt, ist zu dumm.«194 Am 23. Juli besuchte er eine Aufführung des Parsifal, zwei Tage später ging er in Begleitung seines ehemaligen Schülers Felix Weingartner in die Tristan-Premiere. Während der stundenlangen Darbietungen hielt er sich ein Taschentuch vor den Mund, um das Husten zu unterdrücken.
Trotz seiner schweren Erkrankung erhielt Liszt viel Besuch – zu viel, wie man rückblickend sagen muss. Das ständige Reden – die Gäste wollten sich ja mit dem prominenten Kranken unterhalten – war der Genesung kaum förderlich. Selbst jetzt war ihm die »Étiquette« ungemein wichtig. »Er lag in einem Lehnstuhl und hatte eine dicke Decke über den Knieen«, erinnerte sich Felix Weingartner. »Er fror trotz der Julihitze. Als der Besuch einer Gräfin gemeldet wurde, riss er die Decke von seinen Füssen und erhob sich. ›Aber, Meister, bleiben Sie doch liegen!‹, rief ich besorgt und ergriff seine fieberisch heissen Hände. Er liess sich aber nichts sagen, vertauschte rasch seinen bequemen Hausanzug mit dem Priestergewand und empfing den Besuch mit der ihm angebornen königlichen Galanterie.«195
Am 25. Juli schickte Cosima ihren Hausarzt Dr. Carl Landgraf zu Liszt. Nachdem der Doktor Liszt kurz untersucht hatte, stellt Lina ihn im Flur zur Rede: Wie es um den »Meister« stehe, fuhr sie ihn an, und ob man denn nichts machen könne. Landgraf wiegelte ab – noch bestehe keine Gefahr. »Der Arzt ging und ich empfand über ihn einen widerlichen Eindruck«, notierte sie in ihr Tagebuch, »er schien mir ein gewissenloser verliebter alter Geck, der Meister’s Krankheit nicht richtig versteht.« Als Lina daraufhin zu Liszt in den Salon zurückkehrte, klagte dieser: »›Lina, mit mir geht’s zu Ende, der Arzt versteht mich nicht, ich habe kein Zutrauen zu ihm, er sagt immer es geht schon besser, mein Gott, dann müßte es ja schon ganz gut sein und ich fühle, daß es mit mir jeden Tag schlimmer wird.‹« Lina versuchte ihn zu trösten: Er müsse die Besuche einschränken und sich schonen, andernfalls bekäme er noch eine Lungenentzündung. Darauf Liszt resigniert: »›ich glaub ich hab sie längst.‹«196
Den Wagners war offensichtlich nicht bewusst, wie schlecht es um Liszt stand. Für Cosima kam die Erkrankung des Vaters jedenfalls denkbar ungelegen, schließlich waren die Festspiele gut eine Woche zuvor eröffnet worden, alles drehte sich nun um Richard Wagner. Hatte Cosima den gesunden Liszt geradezu inständig gebeten, zu den Aufführungen nach Bayreuth zu kommen, war ihr der kranke Liszt nur noch lästig. Er störte. Frau Wagner kam nach wie vor nur am Morgen kurz an das Krankenbett, gelegentlich besuchten die Kinder ihren Großvater – das war alles. Als Miska die vom Arzt verordnete Bouillon in Wahnfried abholen wollte, hielt man ihm entgegen, »es würde nur 2 mal wöchentlich Bouillon gekocht«.197
Aus Felix Mottls Tagebuch, 27. Juli 1886: »Großes Spectakel. Liszt krank.«198 In der Nacht zuvor war eine weitere Verschlechterung eingetreten. Es konnte nun kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die Erkältung in eine Lungenentzündung übergegangen war. Damit schien Franz Liszts Schicksal besiegelt, denn diese Erkrankung eines knapp 75-jährigen Mannes war im Grunde nicht heilbar. Penicillin hätte geholfen, das Mittel wurde aber erst 1938 entwickelt. Am Morgen dieses Dienstags erschien Cosima Wagner plötzlich im Haus der Frölichs. Lina verließ still das Krankenzimmer, was Liszt allerdings nicht bemerkte. Er sprach liebevolle Sätze, die weiterhin Lina galten, aber nun ausgerechnet von Cosima gehört wurden. Frau Wagner zeigte sich peinlich berührt, empfand sie die Beziehung ihres alten Vaters zu einer jungen Frau, die seine Enkelin sein konnte, doch als unschicklich. Als Cosima das Zimmer wieder verließ, ging sie stumm an Lina vorüber. Liszts Butler Miska wollte seinen Ohren nicht recht trauen: Der Herr Abbé dürfe keinen Besuch mehr empfangen, befahl sie nun, und er – Miska – müsse dafür Sorge tragen, dass auch Lina Schmalhausen und die anderen Liszt-Schüler draußen blieben. Diese plötzliche Wendung war verhängnisvoll, denn die Festspiele nahmen Frau Wagner so in Anspruch, dass sie im Grunde gar keine Zeit hatte, einen schwer kranken Mann zu pflegen. Dabei mangelte es kaum an Hilfsbereitschaft. Auch Adelheid von Schorn bot an, sich um Liszt zu kümmern, doch Cosima lehnte ab, »sie wolle die Pflege ihres Vaters allein mit ihren Töchtern übernehmen«.199
Am 29. Juli trafen Lina und Miska zufällig Emma Frölich auf der Straße. Liszts Vermieterin war völlig aufgebracht und schimpfte: Die Frau Wagner habe sich in einem Nebenzimmer ein Bett aufstellen lassen, um dort die Nächte zu verbringen. Sie habe sogar ihre Bettwäsche persönlich über die Straße getragen, doch sei das alles ein Getue, das ja nur den Nachbarn gelte. Und überhaupt: Cosima käme erst gegen Mitternacht ins Haus, sie bekomme gar nicht mit, wie es ihrem Vater gehe, da sie ihre Zimmertür immer geschlossen halte. »Ich glaub’s auch, die wären’s zufrieden, sie sind zu herzlos zu dem alten Herrn, ich kann die Nächte nicht schlafen, mein Schlafzimmer ist über dem des alten Herrn u. sein Stöhnen u. Röcheln geht mir durch Mark u. Bein, u. ich bin doch nur eine Fremde. Er hat diese Nacht wieder schrecklich gejammert.«200
Tagsüber sah die Situation nicht besser aus. Ob Eva und Isolde nun heillos überfordert waren oder schlichtweg keine Lust hatten – die beiden jungen Damen beschränkten ihre Pflege darauf, den Patienten möglichst ruhigzustellen. Lina war ins Haus geschlichen und hatte sich im Nebenzimmer versteckt. Dort wurde sie Ohrenzeugin, als Liszt darum bat, aus dem Bett aufstehen zu dürfen. Eva – »dieses Scheusal von Enkel« – erwiderte mit schneidender Stimme: »›Großpapa, ich bitte dich, sei doch nicht so kindisch, in deinem Zustande aufstehen zu wollen; ich begreife dich nicht.‹ Meister: ›Aber wenigstens bis mein Bett gemacht ist, du glaubst nicht wie wund ich bin.‹ Eva in spöttischen Ton: ›warte nur bis Mama kommt, die wird dir schon sagen, was du thuen sollst.‹« 201 Die Bayreuther Festspiele gingen derweil wie gewohnt weiter, was Lina kaum fassen konnte: »Wagner’s sahen sich heute Parsifal an, sie ergriff dort ein Puppentheater, u. der lebende Amfortas rang hier mit dem Tode auf seinem Siechbett.«202
In der folgenden Nacht war die Lage zunächst ruhig. Lina hatte sich im Garten ein Versteck gesucht, von dem sie gut in Liszts Krankenzimmer im Parterre blicken konnte. Gegen 23.30 Uhr kam Dr. Carl Landgraf, gut 30 Minuten später traf auch Frau Wagner, vom Festspielhügel kommend, am Haus der Frölichs ein. Cosima und der Arzt unterhielten sich kurz, dann ging sie – ohne ihren Vater zu besuchen – zu Bett und löschte das Licht. Auch der Doktor verließ den Schauplatz. Liszt röchelte, Miska saß in einem Lehnstuhl neben ihm und schlief. Um 2 Uhr morgens kam es zur Katastrophe. Liszt brüllte plötzlich: »Luft! Luft!« Dieser Erstickungsanfall dauerte eine halbe Stunde, wobei Liszts Schreien und Stöhnen selbst in der Nachbarschaft zu hören war. Dann kollabierte er und fiel in eine Art Koma. Cosima ließ nun nach Dr. Landgraf schicken. Als der Arzt nach eineinhalb Stunden endlich eintraf, hielt er den Patienten anfangs für tot, nachdem er ihm aber »Hoffmanns Tropfen« – eine Mischung aus Alkohol und Äther – verabreichte hatte, kam Liszt wieder zu Bewusstsein. Die Agonie ging weiter.
Als Cosima Wagner nun einsah, dass sie mit der Pflege völlig überfordert war, engagierte sie buchstäblich in letzter Minute am frühen Morgen des 31. Juli mit Bernhard Schnappauf einen sogenannten Bader (heute würde man von Krankenpfleger sprechen). Dessen Aufgabe bestand darin, Liszt die letzten Stunden möglichst erträglich zu gestalten. »Meister ist an einer Lungen-Entzündung erkrankt, deren Verlauf der gewöhnliche ist«,203 schrieb der Diener Miska kühl an Alexander Wilhelm Gottschalg. Soll heißen: Liszt war nicht mehr zu retten, und der Abschied schien nahe. Cosimas Kinder sowie enge Freunde wie Anna und Helene Stahr durften ein letztes Mal an das Krankenbett treten. »Er ist eigentlich sterbend. Ein kranker Löwe! Herrlich mit den weissen Haaren auf seinem rothen Polster«, notierte Felix Mottl in sein Tagebuch. »Nachmittag wieder bei ihm. Ganz matt u. kraftlos. Röchelt stark. ›Armer, geliebter Meister. ›Est-ce q’vous êtes fatigué‹ fragte ihn Fr. Wagner. ›Je ne sais pas!‹ waren die letzten Worte, die ich von ihm hörte.«204
Am frühen Abend kehrte Dr. Landgraf in Begleitung des berühmten Erlanger Medizinprofessors Richard Fleischer an das Krankenbett zurück. Die Ärzte nahmen den Puls, Schnappauf versuchte das Leiden durch Waden- und Brustwickel zu lindern. Mehr konnte man nicht tun. »Daniela, Isolde, Eva u. Siegfried gingen nun wieder fort«, wusste Lina zu berichten, »Siegfried setzte sich in Wahnfried oben auf einen Fenstersims u. las. – (Dieses Kind hatte das Herz in Stunden wo sein Großvater mit dem Tode rang, friedlich auf einem Fensterbrett seinem Roman nachzugehen.) Um 8 ½ Uhr war in Wahnfried noch ein gemütliches Souper, Stavenhagen wurde auch dazu gebeten.«205
Lina Schmalhausen war immer noch auf ihrem Guckposten, als Liszt kurz nach 23 Uhr zwei Injektionen in die Herzgegend erhielt. Möglicherweise handelte es sich dabei um Kampferöl, das Schnappauf eigens in der Apotheke besorgt hatte. Lina will durch das angelehnte Fenster einen charakteristischen Geruch wahrgenommen haben, was für Kampfer sprechen würde. Die Folgen waren dramatisch : Liszts Körper bäumte sich auf und wurde von heftigen Krämpfen durchzuckt. Um 23.15 Uhr wurde es plötzlich ganz still. Die Ärzte beugten sich über ihn und stellten den Exitus fest – Franz Liszt war tot.
»Cosima kniete vor dem Bett (ich konnte in dieser Stellung genau ihr Gesicht beobachten), sie war ganz ruhig, nicht der mindeste Zug von Bewegung war in diesem Marmorgesicht«, heißt es in Lina Schmalhausens Bericht. »Sie kniete noch 10 Minuten vor dem Bett, faltete die Hände u. betete, Isolde kam hinein, kniete sich vor dem Bett nieder, umarmte die Mutter u. ging gleich wieder hinaus.«206 Lina wusste zunächst nicht, was sie davon halten sollte, zumal nicht gesprochen wurde. Weder die Wagner-Damen noch die Ärzte wechselten ein Wort miteinander – es herrschte eine geradezu gespenstische Stille. Nachdem Isolde und die Doktoren das Zimmer verlassen hatten, breitete Cosima ihren Oberkörper schräg über Liszts Beine. Nach einiger Zeit setzte sie sich auf einen Stuhl am Fußende des Bettes und faltete abermals die Hände. Dann schlief sie ein – ihr Kopf fiel abwechselnd nach rechts, nach links und nach vorne. Zwischenzeitlich wachte sie auf, nickte dann aber erneut ein. Als der Morgen dämmerte und Lina befürchten musste, entdeckt zu werden, verließ sie den Garten der Frölichs und ging nach Hause. Sie war erleichtert, glaubte sie doch, dass Liszt eine Beruhigungsspritze erhalten habe und nun schlafe. Alles andere schien ihr unwahrscheinlich, und da sie den Gedanken, Liszt sei gestorben und Cosima neben ihrem toten Vater einfach eingeschlafen, für absurd hielt, musste sie annehmen, ihr »Meister« sei noch am Leben.

