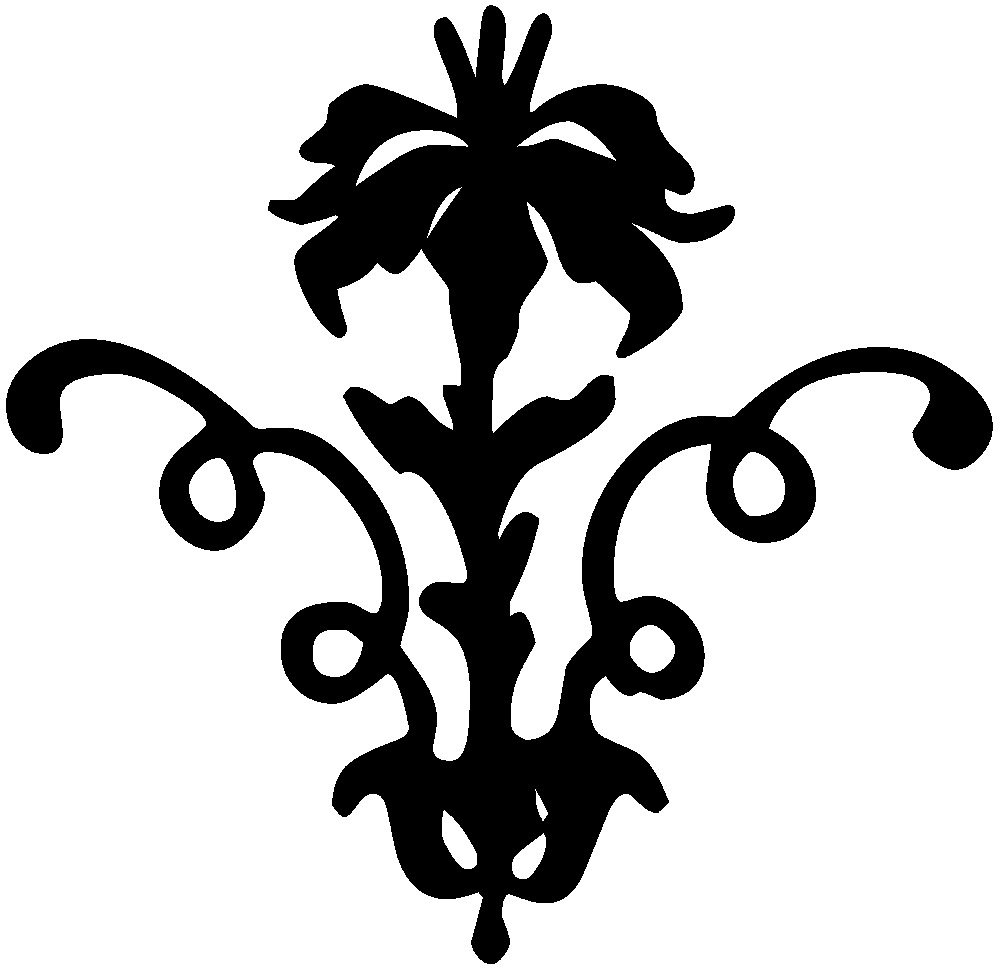
13
H azel verfiel in eine angenehme neue Routine. Sie stand morgens auf, zog sich an und machte sich auf den Weg nach Warwick House, wo die Dienstboten sie mit einer Tasse Tee und einem gemütlichen Sitzplatz empfingen, während Hazel darauf wartete, ob die Prinzessin sie an diesem Tag sehen wollte oder nicht. Da ihre Doktortasche noch immer nicht eingetroffen war, hatte Hazel alle Instrumente, die sie sich aus der Krankenstation von Kew ausgeliehen hatte, in ein Stück Leinentuch gewickelt und trug das ganze Bündel stets mit sich herum. Bisher hatte sie noch nichts davon benutzt.
An den meisten Tagen, wenn die Prinzessin einen kurzen Nachmittagsschlaf hielt, spielten Hazel und Eliza Whist, wobei sich die Hofdame bei dem Kartenspiel als eine harte Gegnerin herausstellte.
»Ich bin als Jüngste von vier Mädchen aufgewachsen«, erklärte Eliza. »Ich habe gelernt, mich nicht in Zurückhaltung zu üben, wenn es ums Kartenspielen geht.«
»Ich habe Brüder«, sagte Hazel.
»Ah«, meinte Eliza. »Sehen Sie, wenn Sie Schwestern hätten, wüssten Sie, dass Frauen verschlagen sein können. Wie jetzt, als ich Sie mit einem Gespräch abgelenkt habe, damit ich hiermit davonkomme.« Mit einer ausschweifenden Handbewegung schnippte sie ihre Trumpfkarte auf den Tisch. »Ich habe wieder gewonnen.«
»Ich denke, Sie haben einen Vorteil. Sie sind bei diesem Spiel weitaus geübter als ich.«
»Na, dann tue ich Ihnen ja einen Gefallen, wenn ich jetzt gegen Sie spiele und keine Wetten abschließe, während Sie lernen und besser werden.«
Hazel erfuhr, dass Eliza nicht nur eine skrupellose Kartenspielerin, sondern auch seit fast zwei Jahren die Hofdame der Prinzessin war. Ihr Vater war der dritte Sohn eines Barons und seine Aussichten auf ein Erbe waren äußerst gering. »Ich muss also einen geeigneten Ehemann für mich finden, bevor ich dazu verdammt bin, den Rest meines Lebens als unverheiratete Tante zu verbringen. Zwei meiner Schwestern sind bereits vermählt und haben Kinder. Ich habe drei Neffen !«
»Und, hatte der Heiratsmarkt bisher etwas Interessantes zu bieten?«, fragte Hazel. »Haben Sie Ihrem Soldaten vom Kontinent schon eine Antwort gegeben?«
Eliza schenkte ihr ein kleines, schiefes Lächeln. »Es gibt Gespräche. Briefe und mögliche Liebeserklärungen.«
Hazel hob eine Augenbraue. »Von ihm oder von Ihnen?«
»Oh, von ihm natürlich. Er ist völlig in mich vernarrt. Sie werden es mit eigenen Augen sehen können. Er kommt zum Regentenball in Buckingham House übernächste Woche.«
»Ein Ball?«
»Ja, Sie kommen doch auch? Der Regent gibt ständig Bälle in der Hoffnung, dass es der Prinzessin irgendwann gut genug gehen wird, um zu tanzen, jemanden kennenzulernen, sich zu verlieben und endlich einen Ehemann auszuwählen. Natürlich hofft er insgeheim, dass sie ihre Meinung ändern wird, was den Prinzen von Oranien betrifft.«
»Und das wird sie nicht?«
Eliza lachte auf. »Haben Sie den Erbprinzen von Oranien schon einmal gesehen? Kümmerlicher Hänfling. Blickt immer drein, als wäre ihm etwas über die Leber gelaufen. Schrecklicher Tänzer. Außerdem sieht er wie ein Zwölfjähriger aus.«
»Nicht wie Ihr Erster Leutnant.«
»Nein«, erwiderte Eliza, die ein Lächeln nicht unterdrücken konnte. »Kein bisschen wie er.«
Hazel grinste. »Und zum ersten Mal heute habe ich Sie bei einer Partie Whist geschlagen!« Sie zeigte ihr Blatt.
»Das ist unfair! Ich war abgelenkt … Ich musste Sie über wichtigen gesellschaftlichen Tratsch auf den neuesten Stand bringen!«
»Falls Sie sich dann besser fühlen«, sagte Hazel, »Sie haben mich davor etwa fünfundvierzig Mal hintereinander geschlagen. Nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit musste ich irgendwann einmal gewinnen.«
Eliza lächelte und legte die Karten ordentlich zusammen. Sie neigte den Kopf in Richtung der geschlossenen Tür der Prinzessin. »Ich werde einmal nach ihr sehen.«
Ein paar Minuten später steckte Eliza den Kopf aus dem Zimmer und Hazel stand auf. »Es tut mir leid«, sagte Eliza. »Sie möchte Sie heute nicht empfangen, aber sie hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass ihre momentanen Symptome Magenschmerzen, Kopfweh und Schüttelfrost sind. Außerdem ist ihr Urin dunkler als sonst. Hilft Ihnen das weiter?«
»Das weiß ich noch nicht, aber es kann gut sein. Auf jeden Fall danke«, erwiderte Hazel.
»Für einen Whist-Champion, immer.«
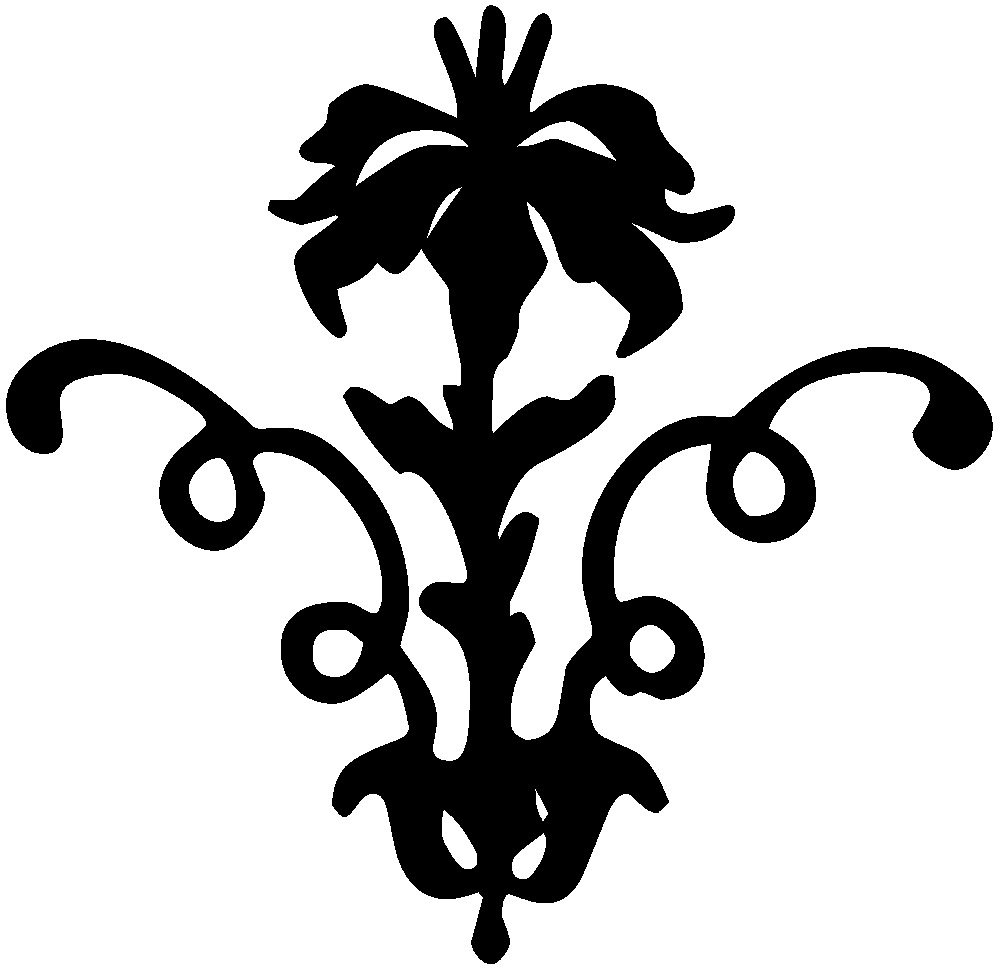
Bei der Arbeit an ihrer Abhandlung fiel es Hazel außerordentlich schwer, sich in ihrem Zimmer auf das Schreiben zu konzentrieren. Es war zu hell, zu licht , zu heiter. Die Luft war abgestanden und heiß. Etwas an der Art, wie die Sonne durch die hauchdünnen weißen Vorhänge schien, sorgte dafür, dass die Worte nicht aus ihrer Feder fließen wollten. Alles in allem war es ihrem Labor in Edinburgh zu unähnlich, das dunkel war und nach Stein und Erde roch.
An einem Tag, als die Prinzessin und Eliza sie weggeschickt hatten, kaum dass sie durch die Tür gekommen war, brachte Hazel an dem kleinen Schreibtisch neben ihrem Bett nicht mehr als einen halben Satz zustande. Und so beschloss sie, mit Pergamentbögen und Tinte gewappnet zur Krankenstation in Kew Palace zu fahren, wo es, soweit sie sich erinnerte, einen unlackierten hölzernen Arbeitstisch mit einer Bank und kein einziges helles Fenster gab.
Wie schon bei ihrem ersten Besuch fand sie die Station leer und ebenso gut organisiert und angenehm ordentlich vor. Hazel setzte sich auf die Holzbank und breitete ihre Blätter vor sich aus. Wie sich herausstellte, fiel es ihr gar nicht so schwer, an der Stelle weiterzumachen, wo sie in Edinburgh aufgehört hatte. Hazel hatte das Gefühl, erst seit kurzer Zeit zu schreiben, als sie den Blick hob und durch das schmale Fenster sah, dass sich das Tageslicht bereits in das goldene Orange des Nachmittags verwandelt hatte. Sie arbeitete gerade hochkonzentriert daran, ein Schaubild eines Herzens zu beschriften, das sie angefertigt hatte.
»Die linke Herzkammer pumpt Blut in den Körperkreislauf, nicht aus dem Körperkreislauf«, sagte eine leise Stimme über ihre Schulter. Hazel sprang auf die Füße und verschüttete beinahe ihr Tintenfass. »Oh, verzeihen Sie«, sagte Dr. von Ferris, der die Hände hob, wie um sein Gesicht zu schützen. »Ich war neugierig und wollte sehen, woran Sie gerade arbeiten.«
Hazel versuchte, ihr rasendes Herz zu beruhigen, das von dieser plötzlichen Störung wie wild pochte. »Was machen Sie denn hier?«
»Das ist … meine Krankenstation«, erwiderte er.
»Es ist die Krankenstation des Palastes. Sie arbeiten im Auftrag der Krone, genau wie ich.«
»Ach, wirklich?«, sagte der Doktor und legte den Kopf schief. »Dann wissen Sie also, was ich tue.« Es war eine Feststellung und keine Frage und Hazel war sich mit einem Mal bewusst, dass sie sich allein und ohne Anstandsdame mit einem Mann in einem Zimmer befand, in das jeden Augenblick jemand hereinspazieren könnte. Vor sehr langer Zeit hätte sie diesen Umstand besorgniserregend gefunden. Bevor sie sich als Mann verkleidet hatte, um in der Anatomists’ Society zu studieren. Bevor sie Jack kennengelernt hatte. Doch sie konnte jetzt einfach nicht an Jack denken. Hazel ordnete ihre Papiere und stellte sich davor, um Dr. von Ferris die Sicht auf ihre Arbeit zu versperren.
»Ja, in der Tat«, erwiderte sie. »Sie behandeln George III., möge Gott ihm beistehen und erretten.«
Dr. von Ferris hob einen Mundwinkel zu einem Grinsen an. »Geben Sie es zu«, sagte er, »Sie sind ein klein wenig beeindruckt.«
»Von Ihnen ? Warum sollte ich?«
Er legte den Kopf schief. »Mit sechzehn Klassenbester an der Universität von Uppsala. Jüngster leitender Chirurg am Sankt-Göran-Krankenhaus in Stockholm. Bereits im Journal of the Royal Society of Medicine und im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Zweimal in letzterem. Mitglied der Königlichen Akademie für Chirurgie von England. Ich spreche fließend Schwedisch, Französisch, Englisch, Latein und Deutsch. Oh, und Dänisch. Und ich bin im Alter von vierundzwanzig Jahren Leibarzt des Königs von Großbritannien und Irland. Soll ich fortfahren?« Hazel verdrehte die Augen. Dr. von Ferris sprach weiter: »Darf ich sehen, woran Sie da arbeiten? Vielleicht kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Wie, zum Beispiel, Sie daran erinnern, welche Aufgabe die linke Herzkammer hat?«
»Ich weiß , welche Aufgabe die linke Herzkammer hat.«
»Das bezweifle ich nicht«, erwiderte Dr. von Ferris. »Aber in Ihrem Schaubild ist es falsch eingezeichnet. Es ist die linke Herzkammer aus der Sicht des Patienten, nicht aus der des Arztes. Die linke Seite des Patienten.«
Hazel sah auf ihre Zeichnung hinunter. Ärgerlicherweise hatte er recht. »Ich weiß, welche Herzkammer die linke ist«, grummelte sie und bereute es sofort, weil sie wie ein bockiges Kind klang.
Dr. von Ferris verzog das Gesicht. »Sind Sie sicher?«
Hazel nahm ihre Feder und strich schnell durch, was sie geschrieben hatte. »Ein Fehler bei meiner Kennzeichnung. Nicht bei meinem Gedankengang. Das ist ein Unterschied. Manchmal hat man den richtigen Gedanken , schreibt ihn aber falsch auf. Das ist alles.«
Der Doktor beachtete sie nicht weiter, ging zum Arzneischrank und holte ein paar Kräuter heraus. Dann nahm er ein großes Porzellangefäß von einem hohen Regal und hob langsam den Deckel ab. Hazel reckte den Hals, um zu sehen, was sich darin befand.
»Blutegel!«, sagte sie.
»Ja, natürlich.« Dr. von Ferris zuckte mit den Schultern. »Eine gute Behandlungsmethode, um die Körpersäfte in Einklang zu bringen.«
»Jaja, ich weiß, ich finde nur …« Hazel erschauderte unwillkürlich, was Dr. von Ferris bemerkte.
»Wie kurios«, meinte er. »Eine Ärztin, die links und rechts nicht unterscheiden kann und zimperlich ist. Äußerst kurios.«
»Ich bin nicht zimperlich. Ich habe zwei Beine amputiert und zweimal so viele Arme gebrochen sowie eine Kugel aus einem Oberschenkel und ein Schwert von einem Ohr entfernt und in beiden Fällen hat der Patient überlebt.«
Der Schnurrbart des Doktors kräuselte sich, dann nahm er einen dicken braunen Blutegel hoch und ging langsam auf Hazel zu. Sie zuckte unfreiwillig zusammen. Der Doktor legte ihn zurück zu den anderen. »Wenn Sie meinen«, sagte er leichthin. Er nahm das ganze Gefäß mit den Blutegeln und ging die Treppe hoch und aus dem Zimmer.
In Hazels Kopf brummte es und ihre Ohren wurden heiß. Sie korrigierte ihr Herzschaubild, stellte dann aber fest, dass sie für den Rest des Tages nicht mehr weiterschreiben konnte.
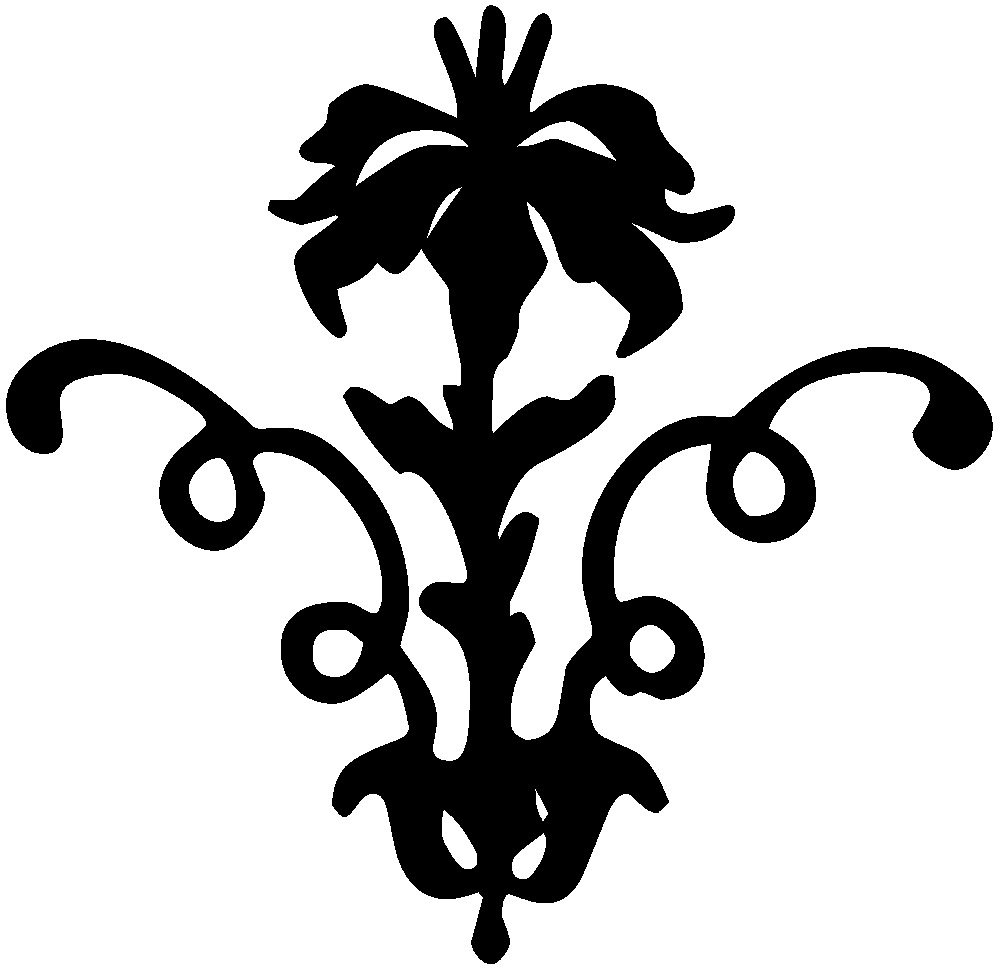
Eine Woche später war Hazel gerade dabei, eine Luftröhre zu zeichnen, als Dr. von Ferris erneut hinter ihr auftauchte.
»Dr. von Ferris. Stören Sie junge Frauen etwa immer beim Schreiben?«
»Nur, wenn sie in meiner Krankenstation sitzen. Ich habe Ihnen eine Tasse Tee gebracht.« Er setzte sie auf dem Tisch ab, wobei er genau darauf achtete, sie nicht auf eines von Hazels Blättern zu stellen.
»Danke, Dr. von Ferris«, sagte sie so kühl wie möglich.
»Sie können mich Simon nennen.«
»Das würde ich lieber nicht.«
»Mir wäre es viel lieber, wenn Sie es täten. Sonst klingt es viel zu vertraut, wenn ich Sie Hazel nenne.«
»Also, erstens: Sie werden mich nicht Hazel nennen. Auch wenn Sie es offenbar für angebracht halten, mich zu stören, während ich hier allein arbeite, brauchen Sie sich nicht einzubilden, wir wären auf irgendeine Weise miteinander vertraut.«
Von Ferris verbeugte sich spöttisch. »Wie Sie wünschen, Miss Sinnett.«
»Und zweitens: Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass wir einander vorgestellt wurden. Woher kennen Sie überhaupt meinen Namen? Haben Sie sich etwa nach mir erkundigt?« Die letzte Frage rutschte ihr heraus, bevor sie sich auf die Zunge beißen konnte.
»Nun ja, Miss Sinnett , vielleicht interessiert es Sie ja zu erfahren, dass es in Großbritannien nicht viele Ärztinnen gibt und noch weniger, die gebeten wurden, die Prinzessin zu behandeln. Ihr Ruf, wie es so schön heißt, eilt Ihnen voraus.«
»Und, welchen Ruf habe ich?«
Er ließ demonstrativ den Blick über ihre Figur wandern. »Intelligent. Stur. Mit guten Verbindungen, aber eine Schande für ihre Familie. Wenn ich mich nicht irre, habe ich etwas von einem Gefängnisaufenthalt in Edinburgh gehört. Gut mit Nadel und Faden, wenn etwas genäht werden muss. Schreckliche Handschrift. Dünne Beine.«
»Das haben Sie nicht gehört!«
»Ach nein?«
»Nun ja, ich habe auch von Ihnen gehört, Dr. von Ferris. Es heißt, Sie seien viel zu verwöhnt und arrogant und gehörten zu einer langen Liste von frühreifen medizinischen Berühmtheiten, die von ihrem eigenen Ruhm so eingenommen sind, dass sie sich nicht die Mühe geben, gute Arbeit zu leisten.«
»Eine Berühmtheit ! Ich danke Ihnen, Miss Sinnett.«
»Es war nicht als Kompliment gemeint, Dr. von Ferris.«
»Simon.«
»Nein.«
Simon von Ferris seufzte und steckte die Hände in die Taschen seines großen Mantels. »Wie schade. Ich habe Ihnen eine Tasse Tee gebracht, in der Hoffnung, einen guten Eindruck zu machen. Irgendwie sind wir vom Kurs abgekommen.«
»Ich glaube, Sie haben mich einige Male beleidigt«, gab Hazel zurück.
»Ich glaube, was ihr Engländer irrtümlich für Beleidigungen haltet, ist lediglich Ehrlichkeit. In Schweden sind wir viel ehrlicher. Ihr hüllt eure Beleidigungen in Höflichkeit. Das ist viel grausamer.«
»Jetzt irren Sie sich aber bei einer Sache«, erwiderte Hazel. Sie nahm einen Schluck von dem Tee, den Simon ihr gebracht hatte. Er war stark und schmeckte nach Vanille. Sie lächelte. »Sie haben recht, was die Engländer im Allgemeinen betrifft. Aber ich bin keine Engländerin. Ich bin Schottin.«
»Dann sind wir hier also beide Ausländer«, bemerkte er. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?« Er zeigte auf einen Holzstuhl neben Hazels Bank. »Zumindest bis Sie Ihre Tasse Tee ausgetrunken haben. Und dann lasse ich Sie wieder in Ruhe arbeiten, versprochen.«
Hazel nickte und Simon setzte sich zufrieden. Aus einer der vielen Taschen seines Mantels nahm er einen Apfel und biss herzhaft hinein.
Hazel lachte. »Hatten Sie den schon die ganze Zeit in Ihrer Tasche?«
»Aber gewiss!«, antwortete Simon, nachdem er den Bissen hinuntergeschluckt hatte. »Man weiß nie, wann man einen Imbiss brauchen könnte.« Er klopfte auf seine Taschen. »Voller Geheimnisse und Vorräte.«
»So wird man also der Leibarzt des Königs von Großbritannien: indem man stets auf alles vorbereitet ist.«
»Das und mit dem nötigen Wissen, wie man mit Hoheiten spricht. Die sind nämlich eine Spezies für sich.« Er nahm einen weiteren Bissen von seinem Apfel.
Hazel wandte sich ihm ganz zu. »Vielleicht können Sie mir ja helfen.«
»Mit mehr als Tee?«
»Mit der Prinzessin. Sie will sich partout nicht von mir untersuchen lassen.«
»Ah«, sagte Simon. »Ja, ich weiß wohl über die Verhaltensmuster der Prinzessin Bescheid. Sie hat mich nicht einmal durch die Tür in Warwick House gelassen, als man mich zu ihr schickte, um herauszufinden, was ihr fehlt.«
»Rein aus Neugierde«, sagte Hazel, »was fehlt der Prinzessin Ihrer Meinung nach?«
Er biss noch einmal in den Apfel. »Gott, wenn ich das nur wüsste. Könnte sonst was sein. Bin ich Ihnen schon behilflich?«
»Nein, aber ich glaube, Sie könnten es sein. Wie spricht man denn nun mit Hoheiten? Zwar habe ich nicht den Eindruck, dass sie mich verachtet, aber sie lässt nicht zu, dass ich sie mir richtig ansehe. Nur, wie soll ich herausfinden, was ihr fehlt, wenn ich sie nicht untersuchen kann?«
Simon überlegte kurz, während er sich einen Finger an die Lippen hielt. »Waren Sie schon einmal auf der Entenjagd in Venedig?«
»Venedig?« Hazel wollte ihm nicht verraten, dass sie Großbritannien noch nie verlassen hatte, und so antwortete sie schlicht: »Nein. Noch nicht, meine ich.«
Und dann redete er zu Hazels Freude und Überraschung einfach weiter, ohne irgendwelche herablassenden Floskeln von sich zu geben wie Oh, es ist fabelhaft, Sie müssen unbedingt einmal teilnehmen . Vielleicht hatte er recht, was englische Höflichkeit betraf. »Man muss vor dem Morgengrauen aufstehen«, erklärte er. »Sogar noch früher, wenn die Enten noch schlafen. Und in den Lagunen dort gibt es Hunderte. Tausende vielleicht. Aber man kann erst anfangen zu schießen, wenn man Teil der Umgebung geworden ist. Und dann wartet man an Ort und Stelle. Mucksmäuschenstill, ohne sich zu bewegen, etwa eine Stunde lang, bis die Enten allmählich aufwachen. Und dann stellt man fest, dass sie sich bereits an einen gewöhnt haben, weil man bei ihrem Erwachen schon dort war. Und dann kann man schießen.«
»Vergleichen Sie die Behandlung der Prinzessin mit … Entenschießen?«
»Nur beiläufig, aber ich erkenne an, dass diese Analogie möglicherweise nicht ganz stimmig ist.«
»Ich gehe schon jeden Tag hin. Verbringe Stunden damit, in ihrer Eingangshalle zu lesen. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass sie sich bei mir unwohl fühlt.«
»Nun, dann müssen Sie vielleicht ein Spiel daraus machen?«, sagte er. »Oder Sie müssen sie einfach direkt fragen. Hat Ihnen niemand erklärt, was für ein bemitleidenswertes Leben Menschen von königlichem Blut führen? Sie verbringen den ganzen Tag in ihren vergoldeten Käfigen und warten darauf, dass sie jemand wie einen echten Menschen behandelt und nicht wie ein Stück Porzellan. Es ist ein schreckliches Dasein.«
»Es fällt mir schwer, Mitleid mit Menschen zu haben, die so viel Geld und Besitz haben, dass sie nicht mehr wissen, was sie damit anfangen sollen«, gab Hazel zurück.
»Dann sind Sie also eine Revolutionärin?«, fragte Simon.
»Nicht unbedingt«, sagte Hazel. »Aber ich habe in Schottland zu viel Zeitung gelesen, um mich als eine überzeugte Monarchistin zu wähnen.«
»Sehr weise«, meinte Simon. »Wie ich sehe, sind Sie mit Ihrer Tasse Tee fertig. Ich nehme sie mit und lasse Sie in Ruhe weiterarbeiten.«
»Ich wollte Sie noch fragen«, sagte Hazel, als er Tasse und Untertasse vom Tisch nahm. »Zeigen die Blutegel Wirkung? Beim König?«
Simon schüttelte den Kopf. »Nicht mehr oder weniger als irgendeine andere Behandlung. Während meiner Zeit mit König George habe ich gelernt, dass selbst jemand, der nicht viel für die Monarchie übrighat, Mitleid mit dem Mann haben würde. Guten Tag, Miss Sinnett.«
Der Doktor machte große Schritte auf die Tür zu. Hazel hatte allein sein wollen, um zu arbeiten, doch nun wollte sie, dass er blieb. »Warten Sie!«, rief sie. »Ich habe ganz vergessen, Sie etwas zu fragen. Sie sind schon länger in London als ich. Haben Sie schon einmal von dem Club der Todesgefährten gehört?«
Simon legte den Kopf schief und fuhr sich mit einem Finger über den Schnurrbart. »Ja. Marie-Anne Lavoisier und ihr Zirkel. Sie mögen die Jungen, Schönen und Brillanten. Ich gehe davon aus, dass sie sich jeden Augenblick bei Ihnen melden werden.«
Der Name Marie-Anne Lavoisier kam Hazel bekannt vor, doch sie konnte ihn nicht einordnen. Sie fragte sich, welche der Gestalten sie gewesen war, die mit den Kaninchenmasken Pall Mall entlanggerannt waren. »Dann hat man Sie also eingeladen?«, fragte Hazel Simon, bevor sie es sich anders überlegen konnte.
Simon lächelte. »Ich ziehe Abende zu Hause und einen ruhigen Schlaf vor. Einen Tee trinken, ein Buch lesen und um neun ab ins Bett.« Er verließ die Krankenstation, und obgleich er die Tasse mit Hazels Teeblättern mitgenommen hatte, hätte sie schwören können, dass der Duft des herben Schwarztees und der Vanille noch lange, nachdem er gegangen war, in der Luft lag.
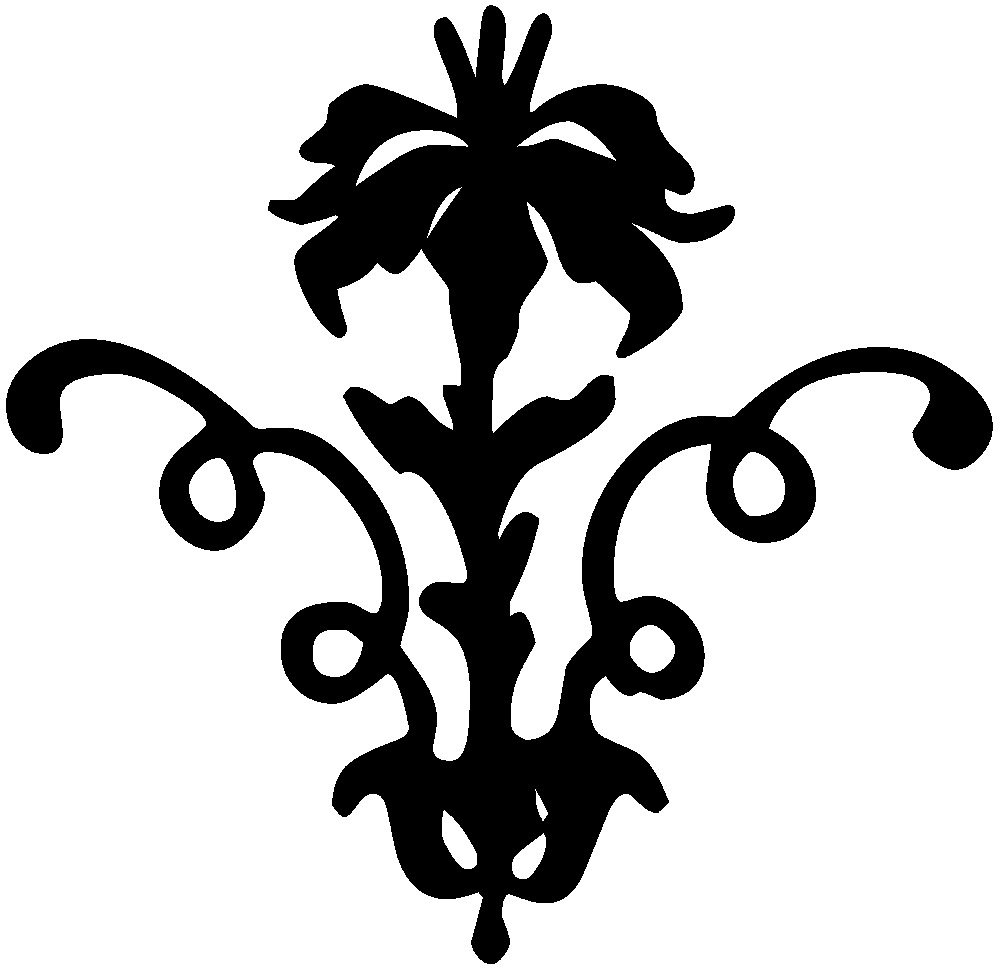
Am nächsten Morgen ging Hazel mit drei Büchern, einer frischen Schreibfeder und mehreren sauberen Bögen Papier zu Fuß nach Warwick House. Wenn sie schon Stunden damit verbringen musste, darauf zu warten, dass die Prinzessin sich bereit erklärte, sie zu sehen, würde sie ihre Zeit zumindest produktiv nutzen.
Hazel hatte auch die aus Kew geliehenen und in ein Leinentuch gewickelten medizinischen Instrumente mitgenommen.
Als Hazels Truhe ohne ihre Doktortasche angekommen war, hatte sie sofort nach Hawthornden geschrieben und Iona gebeten, sie hinterherzuschicken. Ein paar Tage später war ihre geliebte Tasche dann tatsächlich eingetroffen, doch Hazel hätte weinen können, als sie sie öffnete: Das Leder war triefend nass und das Innere der Tasche mit grüngrauem Schimmel überzogen. Irgendwo auf der Strecke zwischen Edinburgh und London war die Tasche in eine Pfütze gefallen und darin liegen geblieben. Der Geruch war so schrecklich, dass sie davon würgen musste.
Der Verschluss war verrostet und kaputt. Die Notizbücher, die sie darin aufbewahrt hatte, waren zu nutzlosem Brei aufgeweicht.
Selbst nachdem sie die komplette Tasche weggeworfen hatte, hing der Schimmelgeruch noch tagelang in der Luft.
Hazel hatte eine neue Doktortasche kaufen wollen, hatte jedoch noch nichts Passendes gefunden. Bevor sie unbrauchbar wurde, war ihre alte aus Edinburgh einfach perfekt gewesen: ausreichend abgenutzt, damit das Leder zwar weich war, aber noch nicht auseinanderfiel, und groß genug, damit sie alles, was sie benötigte, darin verstauen konnte, ohne unhandlich zu sein. Hazel war erfolglos einen ganzen Nachmittag in den Geschäften umhergestreift. Zwar hatte sie ein Dutzend Doktortaschen gefunden, doch die waren alle aus unterschiedlichen Gründen nicht die richtige, dreimal so teuer und nicht annähernd so gut wie ihre vorherige gewesen.
Und so musste sie fürs Erste weiter mit dem Leinentuchbündel vorliebnehmen.
Hazel trug ihre Bücher unter dem Arm und überlegte gerade, mit welchem sie anfangen sollte, als sie auf etwas vor ihr aufmerksam wurde: ein kleines graues Fellknäuel, das in der Sonne direkt auf der Straße lag.
»Na, hallo«, sagte Hazel, während sie sich ihm näherte.
Der Hund ohne Halsband und Leine rollte auf den Rücken und wand sich im Staub, wobei er sich entweder nicht bewusst war oder es ihn nicht weiter störte, dass jeden Augenblick eine Kutsche vorbeifahren konnte. Hazel trat näher heran und sah, dass es sich bei dem kleinen grauen Hund, mehr Flausch als Tier, um denjenigen handelte, den sie in Prinzessin Charlottes Bett hatte herumlungern sehen: Edith oder Edwarda. Edwina. »Ich glaube nicht, dass du ganz allein hier draußen sein solltest, meine Kleine«, murmelte Hazel.
Wie aufs Stichwort erschien die Prinzessin mit offenem Haar und nur in einen Morgenmantel gekleidet in der Tür von Warwick House. »Edwina!«, rief sie verzweifelt. »Komm zu Mami!«
Die kleine Hundedame spitzte die Ohren, als sie ihren Namen hörte, sprang auf alle viere und wedelte mit dem Schwanz, als wollte sie erneut weglaufen und das Spiel so weiter in die Länge ziehen. Bevor Edwina die Chance hatte, abermals zu entwischen, hob Hazel sie hoch und erreichte kurz darauf die Eingangstreppe von Warwick House.
»Dem Himmel sei Dank!«, rief Charlotte und riss Hazel Edwina aus den Armen. Die kleine Hündin leckte glücklich das Gesicht ihres Frauchens ab. »Als sie heute Morgen nicht im Bett war, habe ich überall nach ihr gesucht. Und dann dachte ich, sie könnte mit dem Diener hinausgerannt sein, und ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn sie weg wäre.«
Sie murmelte dem Hund in ihren Armen sanft und leise zu und wechselte auf dem Weg zurück in ihr Schlafgemach zwischen Schelte und Koseworten hin und her. Zwar dankte sie Hazel nicht, schloss aber auch nicht die Tür hinter sich.
Und so folgte Hazel ihr und statt auf ihren üblichen Platz auf dem Gang setzte sie sich an den Frühstückstisch im Zimmer der Prinzessin. Kurz darauf platzte Eliza herein, mit zerzaustem Haar und Schweißperlen auf der Stirn.
»Oh, Ihr habt sie gefunden. Ich habe die Küchen durchkämmt.«
»Sie war draußen«, säuselte Prinzessin Charlotte, ohne ihre Aufmerksamkeit auch nur für einen Moment von dem Hund in ihren Armen abzuwenden. »Und Miss Sinnett hat sie gefunden.«
»Oh, na, was sagt man dazu?«, erwiderte Eliza. Sie ließ sich Hazel gegenüber auf den Stuhl plumpsen. Die Prinzessin hatte sich wieder unter ihre Decken verkrochen und war mit ihrem Hündchen, das sich auf ihrer Brust zusammenrollte und ihr Gesicht ableckte, in ihre eigene Welt vertieft. Eliza seufzte und wandte sich an Hazel: »Karten?«
Der Morgen wurde zum Nachmittag. Hazel hatte gegen Eliza gerade ihre dritte Partie Whist in Folge verloren, als die Prinzessin aus ihrem Schlaf erwachte und nach der Zofe klingelte, damit diese Tee brachte.
Es war ein träger Nachmittag. Die Prinzessin war vollkommen entspannt – dankbar, dass Hazel ihren Hund zurückgebracht hatte (wenngleich sie das nicht laut ausgesprochen hatte). Zumindest fühlte sie sich in ihrer Gegenwart so wohl, dass sie ihr erlaubte, in ihrem Privatgemach zu sitzen. Hazel setzte in dem Moment ganz auf ihre Intuition und beschloss, dass es an der Zeit war zu versuchen, die Prinzessin dazu zu bringen, sich ihr zu öffnen. Sie würde es mit einer neuen Taktik versuchen.
Hazel stand vom Tisch auf und räusperte sich. Prinzessin Charlotte hob eine Augenbraue und Hazel machte einen kleinen Knicks. »Eure Königliche Hoheit, dürfte ich für einen kurzen Moment ganz ehrlich mit Euch sein?«
Mit stoischer Miene beobachtete Eliza das Ganze aus ihrer Ecke des Zimmers, doch allmählich trat Sorge in ihren Blick. Charlotte zuckte nur mit den Schultern.
»Euer Vater hat mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ich eine Diagnose stellen muss, ganz gleich, was Euch fehlt. Sollte mir das nicht gelingen, so fürchte ich, dass er meiner Mutter und meinem Bruder das Leben schwer machen wird. Noch schwerer. Sie mussten bereits über den Skandal hinwegkommen, dass ich mich einer Verlobung verweigert und mich als Mann verkleidet habe, um Anatomie studieren zu können. Und wenn der Regent glaubt, ich hätte die Krone verraten, werden wir vermutlich, nun ja, aus dem Königreich fliehen und auf St. Helena leben müssen.«
»Sie haben eine Verlobung aufgelöst?«, fragte Charlotte.
»Letztes Jahr. Mit meinem Cousin. Ich hatte Gefühle für jemand anderen.« Und wie aus dem Nichts brach der Gedanke an Jack wie eine unaufhaltsame Welle über Hazel herein. Sie war wieder mit ihm auf dem Friedhof, in dem Grab, das sie gerade ausgehoben hatten, ihre Körper eng aneinandergeschmiegt, umgeben vom Geruch nach Erde, während sie dem Atem des anderen lauschten und ihre schlagenden Herzen spürten. Zurück im Gemach der Prinzessin zog sich eine Gänsehaut über Hazels Arm. »Fünf Minuten, Ma’am. Mehr verlange ich nicht. Nur fünf Minuten, dann kann ich Gaspar einen Bericht für den Prinzregenten schreiben.«
Hazel hielt den Atem an.
»Na gut«, sagte Charlotte. »Fünf Minuten.«
Eliza blickte äußerst überrascht. »Ich gehe und bestelle frischen Tee.«
»Nein, bleiben Sie«, sagte die Prinzessin. »Miss Sinnett kann den Tee bestellen und mich untersuchen, wenn sie wieder zurück ist.«
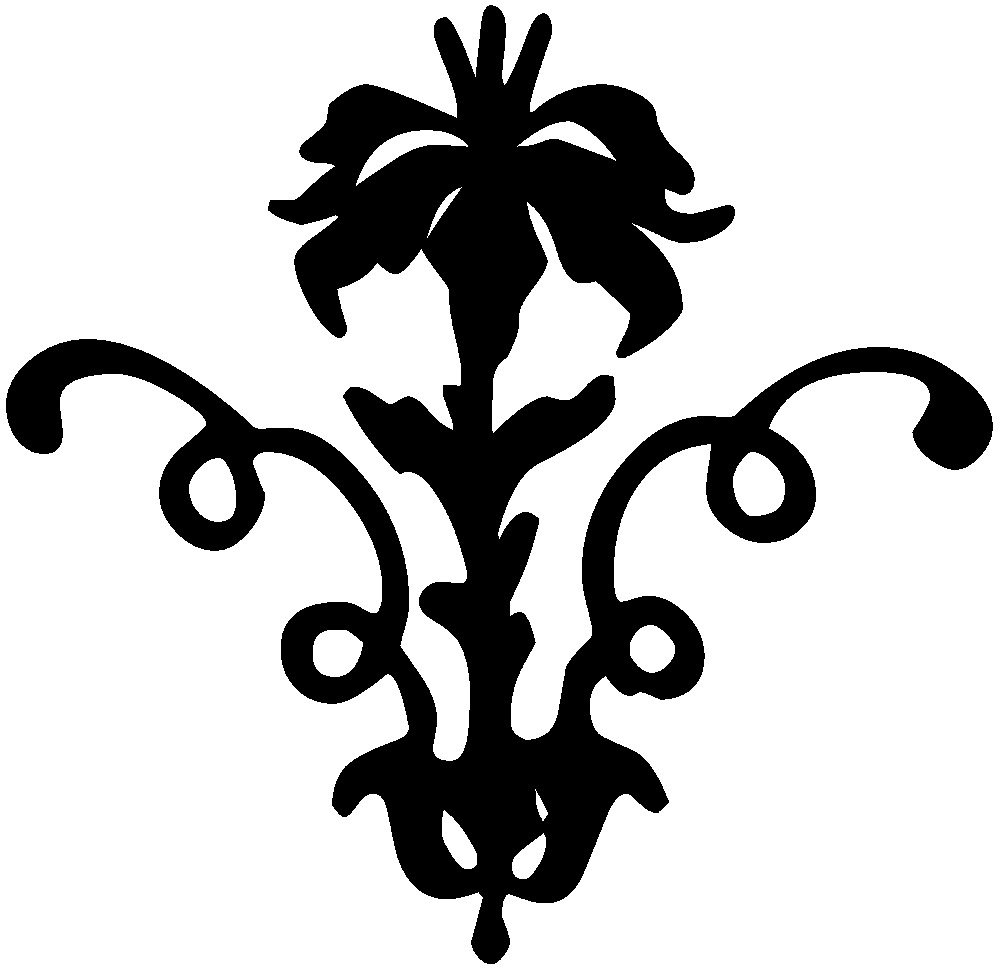
Wenngleich Hazel nicht erwartet hatte, dass die Symptome der Prinzessin ihr irgendwelche untrüglichen Hinweise darauf geben würden, woran sie litt, so hatte sie nunmehr zumindest erste Anhaltspunkte. Charlottes Stirn war warm gewesen, ihre Temperatur eindeutig erhöht. Ein Fieber, so viel war klar, wie auch die Tatsache, dass die Prinzessin über Müdigkeit und eine verschwommene Sicht klagte. Doch bei der restlichen Untersuchung der Prinzessin erwies sich alles andere als normal. Ihr Herzschlag war regelmäßig. Sie fand weder Schwellungen noch Ausschläge. Auf ihrem Rücken waren Narben, Spuren des Römischen Fiebers, das sie überlebt hatte, doch zum Glück war keines der Male frisch. Die Prinzessin beklagte sich über Magenschmerzen, aber Hazel konnte an ihrem Unterleib weder Versteifungen noch Geschwülste feststellen.
Alles in allem lieferte die Untersuchung keine Erklärung dafür, warum eine zweiundzwanzigjährige Frau wochenlang mit Fieber im Bett lag. Dennoch schrieb Hazel alles pflichtbewusst auf und fügte die Untersuchung ihrem Beobachtungsbuch hinzu. Sie machte Fortschritte. Und als sie an dem Abend in ihre Kutsche stieg, um zurück zu ihrer Wohnung zu fahren, ging ihr ein seltsamer Gedanke durch den Kopf: Sie würde Simon von Ferris gerne von ihrer heutigen Untersuchung erzählen, obwohl sie das Rätsel noch nicht gelöst hatte.