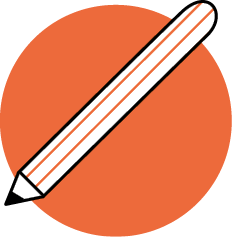Prepare yourself! –
die richtige Vorbereitung
Es gibt nichts Wichtigeres als unsere gute Gesundheit –
das ist unsere Hauptkapitalanlage.
Wir können uns Arlen Specter nur vollumfänglich anschließen, auch wenn Sie sich vielleicht fragen, was ein US-Senator mit Medizin zu tun hat. Ganz einfach: Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Und genau wie bei einer finanziellen Kapitalanlage muss auch in die Gesundheit investiert werden. Wenn Sie darauf achten, dass aus den richtigen Töpfen immer wieder ein Mindestmaß (oder sogar mehr) in unsere Kinder investiert wird, können sie später auf ein optimales Gesundheitsguthaben zurückgreifen. Der erste Topf, unsere erste Säule einer gesunden Kindheit, ist die Prävention, dort legen wir das Hauptaugenmerk auf die Vermeidung von schweren Krankheiten.
Leichter gesagt als getan? Nicht wirklich. Denn in den letzten Jahrzehnten hat sich in der Medizin eine Menge bewegt, wir können viele Krankheiten oder ihre Vorstufen frühzeitig erkennen (danke, Vorsorgeuntersuchungen!). Zusätzlich haben Eltern immer mehr Möglichkeiten, in Erste-Hilfe-Maßnahmen geschult zu werden und somit im Notfall besonnen und bedacht zu reagieren. Auch eine kindersichere Umgebung im eigenen Haushalt zu schaffen sowie die Hausapotheke zu bestücken, ist eigentlich nicht weiter kompliziert. Alles steht und fällt mit der richtigen Vorbereitung.
Ein erster elementarer Bestandteil der Prävention ist eine gesunde Schwangerschaft mit ausgewogener Ernährung. Deswegen starten wir gleich mit diesem Thema: dem Anfang aller Anfänge.
Schwangerschaftsvorsorge
Eine Schwangerschaft bringt große Gefühle, Vorfreude und Erwartungen mit sich. Aber auch Ängste und Sorgen begleiten die werdenden Eltern in den ersten neun Monaten. Ist unser Kind gesund? Ist es zu groß oder zu klein? Zu dick oder zu dünn? Ist alles dran, was dran sein soll?
Die Schwangerschaftsvorsorge beschäftigt sich genau damit, sie möchte möglichst viele dieser offenen Fragen beantworten, und leider müssen Sie deswegen ständig in die gynäkologische Praxis. Blut wird abgenommen, Ultraschalluntersuchungen sollen gemacht oder CTGs geschrieben werden – und das, obwohl die meisten werdenden Mütter keine Probleme haben, die über typische Schwangerschaftsbeschwerden hinausgehen. Die einen sehen es positiv und fühlen sich so deutlich sicherer als ohne ärztliche Begleitung, anderen ist es zu viel – big brother is watching you – und sie hätten gern etwas weniger Termine. Viele der Termine können aber auch von der Hebamme des Vertrauens vorgenommen werden. Wie auch immer die Schwangere aber diesen Vorsorgeuntersuchungen gegenübersteht: Darauf verzichten sollte sie keinesfalls.
Denn die Schwangerschaftsvorsorge ist ein Paradebeispiel dafür, wie sinnvoll es ist, die Gesundheit im Auge zu behalten und etwaige Risiken oder Komplikationen für die Schwangere und das Kind so früh wie möglich zu erkennen. Je eher das geschieht, desto zielführender können Behandlungen oder weitere Untersuchungen angesetzt werden.
In Deutschland wird die ärztliche Betreuung einer Schwangeren durch die sogenannten Mutterschaftsrichtlinien geregelt. Sie werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss, dem obersten Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzt*innen, Zahnärzt*innen, Psychotherapeut*innen, Krankenhäuser und Krankenkassen, festgelegt und umfassen eine unserer Meinung nach erfreulich umfangreiche Anzahl an Untersuchungen und Terminen von Beginn an.
Doch der Reihe nach. Am Anfang der allermeisten Schwangerschaften steht – ein positiver Schwangerschaftstest. Mit dem Ergebnis im Gepäck suchen die Schwangeren dann in der 4. bis 5. Schwangerschaftswoche (SSW) ihre gynäkologische Praxis auf. Dort erfolgt zunächst die Erstuntersuchung, mit Blutuntersuchungen, eventueller Krebsvorsorge und der Anlage des Mutterpasses.
Der Mutterpass ist ein persönliches Dokument, das die wichtigsten Befunde enthält und die regelmäßige Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen dokumentiert. Gemeinsam mit dem sogenannten Gelben Heft des Kindes, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden, ist es nicht nur der einfachste Weg für den*die Mediziner*in, einen genauen Überblick über die Fakten, Probleme und geplanten Abläufe einer Schwangerschaft zu behalten oder zu bekommen. Es ist beinahe wie ein Sticker-Album, das einem das Leuchten in die Augen zaubert, wenn alle Sticker – oder in unserem Fall eben alle Untersuchungen – komplett sind. Die im Mutterpass verewigten Befunde sind meist auch für medizinische Laien lesbar und mit einer gewissen Dosis gesundem Menschenverstand interpretierbar.
Die einfachste Übung und erste Amtshandlung in der Frauenarztpraxis ist die Bestimmung des Gewichts der Schwangeren. Allein schon die Dokumentation, wie schnell und wie viel eine Schwangere zunimmt, kann eine wichtige Auskunft darüber geben, ob eine Schwangerschaft planmäßig verläuft oder nicht. Zusammen mit dem Allgemeinbefinden, aber auch anderen Hinweisen wie dem Durstverhalten, kann das Gewicht ein erster entscheidender Hinweis sein, ob ein Schwangerschaftsdiabetes vorliegt. Ganz grundsätzlich gibt das Körpergewicht aber auch Auskunft darüber, ob eine Schwangere gut, schlecht oder vielleicht auch übermäßig mit Nährstoffen und Energie versorgt ist.
Neben den regelmäßigen klinischen Untersuchungen in der gynäkologischen Praxis gibt es eine Reihe an Terminen, die eine Blutuntersuchung der werdenden Mutter oder eine Ultraschalluntersuchung des Ungeborenen und der Fruchthöhle vorsehen.
Zunächst werden die Blutgruppe und der Rhesusfaktor der Schwangeren bestimmt, um herauszufinden, ob sie rhesus-negativ ist. Rhesus-negativ zu sein bedeutet im Grunde genommen nichts Schlimmes und ist nicht krankhaft – zum Glück, denn das betrifft immerhin 15 Prozent aller Menschen. Niemand hat deshalb ein erhöhtes Risiko für eine Krankheit oder kann deswegen schlechter Kinder bekommen. Und Sie merken auch gar nicht, ob Sie rhesus-negativ sind. Nicht an der Haarfarbe, nicht an Ihrem Intelligenzquotienten oder an sonst irgendetwas. Es bedeutet lediglich, dass Sie kein Blutgruppenmerkmal D besitzen. Rhesus-positiv heißt hingegen, dass man das Blutgruppenmerkmal D hat – logisch.
Doch warum ist es dann überhaupt so wichtig, diesen Faktor zu bestimmen? Nun, da es bei der Geburt zum Übertritt von kleinen Mengen kindlichen Blutes in den Kreislauf der Mutter kommen kann, ist es problematisch, wenn der Rhesusfaktor der beiden nicht übereinstimmt. Denn plötzlich merkt das mütterliche Blut, dass hier ein unbekanntes Blutgruppenmerkmal, nämlich das D, herumschwimmt. Es wird als fremd erkannt, und augenblicklich beginnt der mütterliche Organismus, es zu bekämpfen. Dazu bildet er Antikörper, die alle Blutzellen mit dem Merkmal D zerstören sollen. Puh, ganz schön gefährlich! Das Kind ist aber zu dem Zeitpunkt ja schon geboren und bekommt von diesem Aufmarsch der Antikörper gar nichts mit. Glück gehabt!
Sollte die Mutter nun aber noch einmal schwanger werden und wieder ein rhesus-positives Kind in sich tragen, so hat sie bereits Antikörper gegen D in ihrem Repertoire. Diese können dann während der Schwangerschaft auf das Kind übergehen und dessen rote Blutkörperchen zerstören, was bei ihm zu einer schweren Blutarmut führen kann. Diese vor allem für das Kind gefährliche Situation kann aber durch eine kleine List verhindert werden: Wenn der Schwangeren vor und nach der Geburt eine kleine Menge Antikörper gegen D von außen, in Form einer Spritze, zugeführt wird, so hält ihr Körper es nicht mehr für notwendig, selbst welche zu produzieren. Die verabreichten Antikörper sind jedoch nicht in der Lage, das Blut des Kindes zu zerstören, und so können beide im Einklang die Schwangerschaft fortsetzen.
Was eigentlich eine schonende und clevere Entschärfung einer potenziell riskanten Situation ist, stößt trotzdem auch immer wieder auf Kritik. Und zwar dann, wenn die Schwangere gar kein rhesus-positives Kind bekommt und die Anti-D-Prophylaxe somit umsonst (aber nicht gratis) war. Antikörper sind nichts anderes als spezielle Eiweiße, die aus menschlichem Blutplasma isoliert wurden. Und immer wenn einem Menschen etwas von einem anderen Menschen verabreicht wird, z. B. eine Bluttransfusion, eine Knochenmarkstransplantation oder eben, wie in diesem Fall, Antikörper, droht als Hauptnebenwirkung eine Unverträglichkeit im Sinne einer allergischen Reaktion. Diese kann sich als Rötung an der Einstichstelle bis hin zu Herzrasen, Luftnot oder sogar als anaphylaktischer Schock zeigen. Es ist also durchaus nachvollziehbar, dass eine solche Maßnahme kritisiert wird, wenn sie nicht notwendig ist. Bis vor Kurzem gab es allerdings gar keine Alternative, da erst nach der Geburt festgestellt werden konnte, welcher Rhesusgruppe das Kind angehört.
Mittlerweile gibt es aber die Möglichkeit, deutlich früher Informationen über die Blutgruppenmerkmale zu bekommen. So kann nun mittels DNA-Analyse des mütterlichen Blutes eruiert werden, auf welche Rhesusgruppe das darin enthaltene Erbgut des Kindes hinweist. Mit diesem mittlerweile häufig angewandten, nicht invasiven Pränataltest (NIPT), der auch bei der Suche nach Chromosomenanomalien und einer Reihe krankheitsverursachender Gene eingesetzt wird, sollte jedoch zumindest bis zur 12. Schwangerschaftswoche gewartet werden.
Es gibt außerdem den sogenannten Suchtest, bei dem nach Antikörpern gegen D geforscht werden kann. Sollten diese bereits in der mütterlichen Blutbahn zu finden sein, kann man sich die Rhesusprophylaxe sparen, weil sie zu spät käme. In dem Fall erfolgt eine besondere und intensivere Überwachung der Schwangerschaft durch die gynäkologische Praxis.
Die weiteren im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge vorgesehenen Blutuntersuchungen betreffen hauptsächlich Infektionskrankheiten. Es wird nach Antikörpern oder Erregern von Röteln, Syphilis, Hepatitis B und HIV gesucht. Wenn einer dieser Erreger oder ein fehlender Schutz dagegen nachgewiesen wird, wird entweder die Krankheit behandelt (Syphilis zum Beispiel mit Antibiotika) oder die Impfung nachgeholt (bei Röteln bei der Mutter, bei Hepatitis B wird das Kind nach der Geburt geimpft) oder besondere Vorsichtsmaßnahmen müssen vor beziehungsweise während der Geburt ergriffen werden (bei HIV).
Eine weitere wichtige Infektionskrankheit ist die Besiedelung des Vaginal- oder Analbereichs mit B-Streptokokken. Diese Bakterien können vor oder während der Geburt auf das Neugeborene übergehen und eine lebensbedrohliche Early-Onset-Sepsis, also eine frühe Blutvergiftung des Kindes, zur Folge haben. Wird die Infektion bei der Schwangeren aber rechtzeitig erkannt, lassen sich die B-Streptokokken gut mit einem Antibiotikum behandeln.
Ultraschall
Die Mutterschaftsrichtlinien sehen aktuell insgesamt drei Ultraschalluntersuchungen im Laufe der Schwangerschaft vor. Grundsätzlich ist bereits ab der 5. Schwangerschaftswoche eine kleine Fruchtblase in der Gebärmutter im Ultraschall zu erkennen, und nur zwei bis drei Wochen später kann man dann sogar schon den Herzschlag des Kindes sehen. Die erste ausführliche und detaillierte Ultraschalluntersuchung sollte zwischen der 9. und 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Neben der nicht ganz unerheblichen Frage, ob es sich vielleicht um eine Mehrlingsschwangerschaft handeln könnte, steht vor allem die Entwicklung des Kindes bis zu diesem Zeitpunkt im Fokus.
Ein deutlich konkreteres Bild zeigt sich bei der nächsten Ultraschalluntersuchung, zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche. Zu diesem Zeitpunkt können bereits einige Organe erkannt und beurteilt werden, wie das Herz, das Gehirn, die Blase und der Magen. Auch ein Großteil der körperlichen Entwicklungsstörungen kann dadurch ausgeschlossen werden. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Diagnostik von angeborenen Herzfehlern durch die sogenannte fetale Echokardiographie gelegt, also einen Ultraschall des kindlichen Herzens.
Und noch aus einem anderen Grund ist dieser Termin für viele werdende Eltern ein besonderes Highlight: In diesen Wochen steigt die Trefferquote, wenn man das Geschlecht des Kindes bestimmen möchte. Aber erwarten Sie sich nicht zu viel. Es kommt kaum vor, dass eine eindeutige und klare Vorhersage gemacht wird. Vielmehr sprechen die Kolleg*innen von »Wahrscheinlichkeiten« und davon, dass es »zu circa 70 Prozent ein Mädchen« ist. Das hat zwei Gründe: Zum einen sehen sich das männliche und das weibliche Geschlechtsteil bei Ungeborenen ziemlich ähnlich, gerade zu Beginn. Sie entstehen ja auch aus der gleichen Zellansammlung, und erst nach und nach entwickelt sich ein Penis oder eine Vagina.
Der zweite Grund ist weitaus profaner: Niemand wird so schonungslos verklagt wie Gynäkolog*innen. Und nur ungern werden die Kosten für das Überstreichen eines rosaroten Kinderzimmers mit himmelblauer Wandfarbe von den Frauenärzt*innen übernommen, die den werdenden Eltern in Woche 17 noch ein Mädchen in Aussicht gestellt haben, obwohl es letztendlich dann doch ein Junge geworden ist.
Beim dritten Ultraschall, in Woche 29 bis 32, werden erneut das Wachstum und die Lage des Kindes, aber auch die Fruchtwassermenge und die Position sowie Größe der Plazenta untersucht. Letzteres kann Aufschluss über eine drohende Unterversorgung des Kindes (Plazentainsuffizienz) geben und unter Umständen Anlass für eine frühzeitige Beendigung der Schwangerschaft durch einen Kaiserschnitt sein.
Die Kombination aus Ultraschall und Blutuntersuchung dient darüber hinaus der Früherkennung von chromosomalen Fehlbildungen, vor allem der Trisomie 21, dem Downsyndrom. Unter Trisomie versteht man, dass ein Chromosom oder ein Teil davon dreifach vorliegt. Die Ursache liegt in einer außergewöhnlichen Teilung von Spermium oder Eizelle. Ein Mensch mit Trisomie 21 besitzt in all seinen Körperzellen somit dreimal das 21. Chromosom. Insgesamt sind somit 47 und nicht wie bei den meisten Menschen 46 Chromosomen vorhanden. Zunächst werden durch die sonografische Beurteilung der Nackenhaut, auch Nackenfalte genannt, erste Hinweise für das Vorliegen überzähliger Chromosomen und damit verbundener Organfehlbildungen gesucht. Die Ergebnisse werden mit der Bestimmung zweier Blutwerte im mütterlichen Blut, namens PAPP-A und freies ß-HCG, in Relation gesetzt. Allein dadurch werden etwa 90 Prozent aller Schwangerschaften mit Chromosomenanomalien identifiziert.
Noch mehr Klarheit über das Vorliegen einer derartigen chromosomalen Fehlbildung liefern direkte DNA-Untersuchungen aus dem mütterlichen Blut. Auch bei diesem Test handelt es sich um den bereits bei der Rhesus-Fragestellung erwähnten NIPT. Vereinfacht gesagt wird mit dieser Variante des Tests untersucht, ob im Blut mehr genetische Bruchstücke des Chromosoms 21 gefunden werden. Dies wäre dann das Indiz dafür, dass es öfter vorhanden ist als andere Chromosomen, nämlich dreifach.
Derzeit wird diese relativ teure Untersuchung nur von der Krankenkasse übernommen, wenn im Rahmen der ärztlichen Schwangerenbetreuung die Frage entsteht, ob eine fetale Trisomie vorliegen könnte, und »die Ungewissheit für die Schwangere eine unzumutbare Belastung darstellt«. So der Wortlaut des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Dieser Fall tritt dann ein, wenn Ultraschall- und Blutuntersuchungen Auffälligkeiten ergeben, wenn die Mutter älter als 35 Jahre ist, bei vorausgegangenen Schwangerschaften mit Chromosomenstörungen oder wenn es solche im familiären Umfeld gab. Auch wenn die Schwangeren große Ängste haben, kann die Indikation für diese Untersuchung gestellt werden. Doch auch diese aufwendigen Tests können keine 100-prozentige Sicherheit geben. Das Ergebnis ist kein klares Ja oder Nein. Ein unauffälliges Testergebnis bedeutet aber, dass eine Chromosomenabweichung so gut wie ausgeschlossen ist. Ein auffälliges Testergebnis ist dagegen ein starker Hinweis dafür, dass beim Kind eine Trisomie vorliegt.
Gewissheit kann letztendlich nur durch eine Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) oder eine Plazenta-Punktion (Chorionzotten-Biopsie) erreicht werden. Durch diese Eingriffe werden die Schwangere und das Kind jedoch einem sehr hohen Stresslevel ausgesetzt. Eine mögliche Folge sind vorzeitige Wehen, und in 0,5 bis 2 Prozent der Fälle kann es sogar zu einer Fehlgeburt kommen. Umgerechnet bedeutet das, dass von zweihundert Frauen, bei denen diese Untersuchung durchgeführt wird, bis zu vier ihr Kind verlieren oder es aber deutlich zu früh zur Welt bringen. Lassen Sie diese Untersuchungen also bitte keinesfalls leichtfertig und ohne starken Verdacht durchführen.
Werden bei einer dieser Vorsorgeuntersuchungen Auffälligkeiten festgestellt, denen genauer nachgegangen werden muss, tritt die Pränataldiagnostik auf den Plan. Dabei kommen spezialisierte Ärzt*innen in spezialisierten Einrichtungen zum Einsatz, die die Schwangeren dann mit spezialisierten Geräten untersuchen. Sehr spezialisiert eben.
Es ist aber auch nicht selten, dass auffällige Befunde, die vielleicht banal klingen mögen, in den letzten Wochen einer Schwangerschaft wieder und wieder kontrolliert werden. Auch das liegt an der Verklagefreudigkeit der Bevölkerung gegenüber der Gynäkologie. Der Grund ist wohl, dass Frauen und Paare (zu Recht oder zu Unrecht, das sei dahingestellt) bei gesundheitlichen Problemen, die erst bei oder nach der Geburt entdeckt werden, meinen, dass diese schon früher hätten bemerkt werden sollen, und dass sie außerdem auf Schadensersatz hoffen.
Die Zahlen sind erschreckend (vor allem für Frauenärzt*innen): Laut einer Studie haben 74 Prozent der Gynäkolog*innen in ihrer Laufbahn bis sie 45 werden schon mit derartigen Versicherungsfällen zu tun gehabt. Ein mögliches Szenario, das immer bedacht werden muss.
Alles in allem sollte eine Schwangere bis zur 32. Schwangerschaftswoche alle vier Wochen einen Termin in der gynäkologischen Praxis wahrnehmen; danach – bei einem unkomplizierten Verlauf – im zweiwöchentlichen Rhythmus.
Dass sich so eine Schwangerschaft innerhalb kürzester Zeit »verkomplizieren« kann, mussten auch Florian und seine Frau mehr als einmal erleben.
Im gesamten Verlauf einer Schwangerschaft, vor allem aber in den letzten Wochen vor der Geburt, kommt es immer wieder vor, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht. Hier übt sie sich im wahrsten Sinn des Wortes in der Höchstleistung, die während der Geburt vollbracht werden muss, nämlich darin, das Kind aus der Gebärmutter herauszupressen. Deshalb werden diese Vorgänge auch Übungswehen genannt. Sie sind normal und kein Grund zur Sorge. Treten die Kontraktionen aber über einen längeren Zeitraum und in kürzeren Abständen (mehrmals pro Stunde) auf und sind sie außerdem mit einem unangenehmen Ziehen im Unterleib verbunden, handelt es sich um vorzeitige Wehen, die den Gebärmutterhals verkürzen und sogar den Muttermund, durch den das Kind während der Geburt hindurchmuss, öffnen können.
Genau das passierte in der zweiten Schwangerschaft von Florians Frau. Immer wieder verspürte sie ein leichtes Ziehen, der Bauch wurde hart. Beim nächsten Ultraschall, in der 27. Schwangerschaftswoche, wurde dann eine Verkürzung des Gebärmutterhalses diagnostiziert. Somit drohte plötzlich eine Frühgeburt, das Mädchen wog zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich erst weniger als ein Kilo. Solange aber die Fruchtblase nicht geplatzt ist, versucht man, in einer derartigen Situation eine Frühgeburt zu verhindern.
Eine Möglichkeit, die Geburt hinauszuzögern, ist das Legen einer Cerclage, um den Muttermund bis zur Geburt zu verschließen. Dabei wird unter örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose ein Kunststoffbändchen um den Gebärmutterhals geschlungen und zusammengezogen. Sinnvoll ist dieser Eingriff zwischen der 15. und 28. Schwangerschaftswoche. Bei Erfolg (oder wenn die Wehen nicht mehr aufzuhalten sind) wird das Bändchen wieder durchtrennt. Der Nutzen einer derartigen Cerclage wird heutzutage allerdings immer mehr infrage gestellt. Denn auch nach diesem aufwendigen Eingriff ist eine Frühgeburt grundsätzlich möglich. Bei der schonenderen Variante, dem Zervixpessar (hierbei wird eine Silikonkappe zur Stabilisierung des Muttermundes eingesetzt), sind die Daten noch eindeutiger: Dieser beugt einer Frühgeburt laut einer Studie nicht besser vor als eine abwartende Behandlung ohne Pessar.
Bei Florians Frau kam eine andere Methode zum Einsatz, die schonender, weniger invasiv, aber auch sehr mühsam und deutlich langwieriger ist: die Bettruhe. Wochen- und monatelang nur für das Notwendigste die liegende Position zu verlassen, und das mit einem oder mehreren Kindern zu Hause, ist eine logistische und vor allem psychische Herausforderung, wenn nicht sogar ein Ding der Unmöglichkeit. Doch es herrscht grundsätzlich die Meinung, dass sich ein Gebärmutterhals, der sich einmal verkürzt hat, nicht mehr zurückentwickeln, also wieder verlängern wird. Im Idealfall wird deswegen zunächst der verkürzte Status quo gehalten und die Geburt nimmt erst zu einem späteren Zeitpunkt ihren natürlichen Verlauf. Das hat jedoch zur Folge, dass jeder weitere gynäkologische Kontrolltermin ein Bangen um Millimeter wird. So auch bei Florians Frau. Denn je kürzer der Gebärmutterhals, desto kürzer auch die Schwangerschaft.
Heutzutage ist die Bettruhe allerdings nur in Ausnahmefällen wirklich nötig. Denn es gibt auch Risiken in Form von Gefäßverschlüssen (Thrombosen), Knochen- und Muskelschwund und Depressionen. Diese werden in der aktuellsten Leitlinie zur Vorbeugung und Therapie der Frühgeburt explizit angeführt. Stattdessen wird mittlerweile zu körperlicher Schonung geraten, was in der Umsetzung auch deutlich realistischer als die Bettruhe ist. Das bedeutet konkret: keine Anstrengung, keinen Sport, kein Schleppen schwerer Einkäufe – oder ebenso schwerer Kinder. Aber erklären Sie mal einem Zweijährigen, dass Mama ihn jetzt nicht mehr die Treppen hochtragen darf – ein Kraftakt der besonderen Art! Wenn die drohende Alternative jedoch eine Frühgeburt des Geschwisterchens in der 27. SSW ist, werden auch junge, sehr gutmütige Eltern auf einmal zu kompromisslosen Nicht-auf-den-Arm-Nehmern. Als Vater kann man, wie Florian schnell bemerkte, dabei trotz aller Bereitschaft abgemeldet sein, denn je mehr Papa sich anbietet, desto dringender will der kleine Trotzkopf manchmal zur Mama.
Und so ziehen – wenn die Familie das Glück der Tüchtigen ereilt – die Wochen und Monate ins Land, und was anfangs unvorstellbar schien (zweieinhalb Monate Bettruhe!!!), geht auch vorbei. Bei Florians Frau wurde das Bewegungsverbot in der 34. SSW aufgehoben, da bis dahin das Gröbste überstanden und das geschätzte Gewicht akzeptabel schien. Und offensichtlich war die körperliche Schonung tatsächlich dringend notwendig gewesen, denn nur wenige Tage nachdem Florians Frau wieder angefangen hatte, sich normal zu bewegen, setzten nicht mehr zu kontrollierende Wehen ein, und schließlich kam ihre Tochter als Frühchen nach 35 Schwangerschaftswochen zur Welt. Trotz dieser frühzeitigen Niederkunft entwickelte sich das Mädchen aber erfreulicherweise prächtig und sie hat die fehlenden Wochen in Mamas Bauch vorbildlich aufgeholt.
Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes
Für Notärzt*innen und Rettungssanitäter*innen kommt es immer wieder darauf an, möglichst schnell und dennoch besonnen zu handeln, im richtigen Moment das Richtige zu tun und so Menschenleben zu retten. Es gibt jedoch eine Situation, in der die aktuellen Grenzen der modernen Medizin besonders drastisch aufgezeigt werden, und das häufig vollkommen unabhängig davon, wie schnell der Notarztwagen mit Blaulicht und Sirene herangebraust kommt: wenn Eltern ihren Säugling leblos im Bettchen vorfinden. Und das ohne jegliche Verletzungen oder Anzeichen, dass etwas nicht stimmt. Es trifft die Beteiligten vollkommen unvorbereitet, weil sich das Kind zuvor meist in einem Zustand von bester Gesundheit befand. Von einem Tag auf den anderen ändert sich das Leben der betroffenen Familie dann radikal. Der Tod eines Kindes ist für viele Menschen das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Findet das Ereignis darüber hinaus im 1. Lebensjahr statt und kann selbst die Medizin den verzweifelten und traumatisierten Eltern keine Erklärung liefern, ist es umso schwerer zu akzeptieren und zu verarbeiten.
Wenn alle möglichen Ursachen ausgeschlossen worden sind, dann sprechen wir vom Plötzlichen Säuglingstod, dem Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).
WAS WISSEN WIR ÜBER DIESES EREIGNIS?
Definiert wird der Plötzliche Säuglingstod als plötzlicher Tod eines bisher gesund erscheinenden Säuglings, ohne dass in nachfolgenden Untersuchungen ein medizinischer Grund gefunden werden kann. Der Plötzliche Säuglingstod tritt also meist auf, wenn sich das Kind in einem Zustand völliger Gesundheit befindet. Die zugrunde liegende biologische Todesursache ist meistens ein akuter Sauerstoffmangel (Hypoxie genannt). Um schlussendlich einen Plötzlichen Säuglingstod zu diagnostizieren, dürfen auch post mortem, also nach dem Tod, keine weiteren Anzeichen oder Todesursachen gefunden werden.
Die kritischste Phase für einen Säugling mit dem höchsten Risiko für den Plötzlichen Säuglingstod liegt zwischen dem 2. und 6. Lebensmonat. Grundsätzlich kann er jedoch auch jenseits des ersten Geburtstages noch auftreten.
Unter near-SIDS, also dem Beinahe-Auftreten eines Plötzlichen Säuglingstodes, auch ALTE (apparent life-threatening event; akutes lebensbedrohliches Ereignis) genannt, versteht man einen lebensbedrohlichen Zustand bei Säuglingen, der unerwartet und ohne erkennbare Ursache eintritt. Dieses Syndrom ist durch eine beängstigende Konstellation von Symptomen gekennzeichnet, bei denen das Kind eine Kombination aus Atemstillstand, Farbveränderung, Veränderung des Muskeltonus, Husten oder Würgen zeigt.
RISIKOFAKTOREN
Weil die medizinische Forschung bis heute keine genaue Ursache für das Auftreten des Plötzlichen Säuglingstodes kennt, ist es umso wichtiger, sämtliche Risikofaktoren, die das Auftreten dieses einschneidenden Ereignisses potenziell begünstigen können, so gut wie nur möglich aus dem Familienleben zu eliminieren.
MERKE!
Bekannte und etablierte Risikofaktoren für das Auftreten eines Plötzlichen Säuglingstodes:
- 90 % der Fälle ereignen sich im Schlaf!
- Schlafen in Bauchlage
- weiche Schlafunterlage
- Nikotinexposition (Rauchen im Haushalt/Wohnraum)
- Überwärmung
- Verlegung der Atemwege durch Decken, Kuscheltiere, Schlafen im Elternbett ohne Sicherheitsmaßnahmen
- SIDS bei Geschwistern
- Frühgeburtlichkeit
- Schlafen außerhalb des Elternzimmers im eigenen Bett
DAS TRIPLE-RISK-MODELL
Relativ verbreitet ist mittlerweile das sogenannte Triple-Risk-Modell, das für ein Auftreten des Plötzlichen Kindstodes die wahrscheinlich beste Erklärung gibt. In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass ein Kind dann ein SIDS erleidet, wenn drei Risikofaktoren aufeinandertreffen: erstens ein externer Stimulus, zweitens eine kritische Phase in der Entwicklung des Kindes und drittens ein besonders vulnerables, also verwundbares, Kind. Ein konkretes Beispiel wäre ein Kind, das im Haushalt Zigarettenrauch ausgesetzt wurde (dadurch vulnerabel ist) und im 3. bis 5. Lebensmonat (kritische Phase) in Bauchlage schläft (externer Risikofaktor). Treffen diese Einzelheiten, die für sich genommen natürlich noch nicht zwangsläufig zum Tod eines Kindes führen, unglücklich aufeinander, ist ein derart tragischer Vorfall möglich.
Auch die ersten Lebenstage sind als besonders kritisch zu betrachten. Alle Beteiligten, sowohl das Kind als auch Mutter und Vater, sind noch sehr erschöpft. Zusätzlich liegen Kinder in dieser Zeit häufig stunden- oder sogar tagelang ausschließlich auf dem Bauch und werden sehr warm eingepackt. Auch diese Kombination kann ohne jegliche Anzeichen zum Plötzlichen Kindstod führen.
PRÄVENTION
Hand in Hand mit dem Wissen um die oben beschriebenen Risikofaktoren geht die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen. Um ein Ersticken zu vermeiden, sollten Kinder nicht auf dem Bauch, sondern in Rückenlage schlafen, solange sie das Köpfchen nicht eigenständig heben können. Natürlich kommt im Laufe des 1. Lebensjahres irgendwann der Zeitpunkt, an dem sich das Kind von allein auf den Bauch drehen wird. Es ist dann nicht notwendig, das Kind bei jeder Gelegenheit und sofort nach Gewahrwerden der Lageänderung wieder zurück auf den Rücken zu drehen. Vermeiden Sie Kuscheltiere oder Kissen im Kinderbettchen und verzichten Sie auf sogenannte Nestchen, die das Gitter rund um das Bett auskleiden. Benutzen Sie keine Decke, sondern einen für Größe und Jahreszeit angemessenen Schlafsack. Auch wenn es gut gemeint ist, können diese Gegenstände die Atemwege des Kindes blockieren. Um Überwärmung zu verhindern, achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur im Zimmer, in dem das Kind schläft, nicht mehr als 20 Grad beträgt. Im elterlichen Schlafzimmer sollten die Kinder im eigenen Kinderbett oder Beistellbett schlafen. Darüber hinaus trägt Stillen zur Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes bei. Wie eine groß angelegte Studie zeigen konnte, haben Kinder, die zumindest zwei Monate gestillt wurden, ein um die Hälfte geringeres Risiko, am Plötzlichen Säuglingstod zu versterben, als kürzer oder gar nicht gestillte Kinder.
EINE UNTERSUCHUNG, DIE GEWISSHEIT BRINGT?
Eine aktuelle Studie, erst wenige Wochen vor Erscheinen dieses Buches veröffentlicht, sorgte in diesem Zusammenhang für Aufsehen. Die Autoren aus Australien fanden heraus, dass die Aktivität eines speziellen Enzyms, der Butyrylcholinesterase, bei Säuglingen, die später an SIDS starben, im Vergleich zu lebenden Kontrollpersonen und anderen Säuglingen, die nicht an SIDS starben, signifikant verringert war. Gemessen wurde die Enzymaktivität in getrockneten Blutflecken, die zwei bis drei Tage nach der Geburt entnommen wurden, also für das Neugeborenen-Screening gedacht waren.
Diese Studie ist die erste, die einen biochemischen Marker bei SIDS-Kindern vor ihrem Tod identifizieren konnte, der sie von Kontrollfällen und anderen Todesursachen unterscheidet.
Ein dramatisches Detail dieser Entdeckung: Die Erstautorin dieser Studie, Dr. Carmel Harrington, verlor im Jahr 1991 ihren eigenen Sohn durch Plötzlichen Säuglingstod. Dieses einschneidende Erlebnis bewegte sie dazu, immer weiter nach einer möglichen Ursache dieses tragischen Ereignisses zu forschen.
Bei einem genauen Studium der Daten fällt jedoch auf, dass sich die Gruppe der gesunden Kinder und derer, die an einem SIDS verstorben sind, bezüglich der Enzymaktivität überschneiden. Es gibt also einerseits gesunde Menschen, die niemals ein derartiges Ereignis erleben, obwohl sie eine verminderte Enzymaktivität aufweisen, und auf der anderen Seite gibt es an SIDS verstorbene Kinder mit normaler Enzymaktivität.
Und wie es in der Allgemeinbevölkerung aussieht, ist noch ungewisser. Dies wirft die Frage auf, ob man die Eltern mit der Diagnose der verminderten Enzymaktivität nicht unnötig verunsichert. Beantwortet werden kann diese Frage wieder mit dem Triple-Risk-Modell, das eben nicht nur einen einzigen Risikofaktor als Übeltäter sieht – auch nicht die Butyrylcholinesterase. Das Enzym macht im Triple-Risk-Modell den Säugling zu einem vulnerablen Kind. Fällt das mit zwei weiteren Risikofaktoren zusammen, kann es zum Plötzlichen Säuglingstod kommen.
Auf den ersten Blick mag der Gedanke naheliegen, dass das Neugeborenen-Screening so schnell wie möglich um dieses Enzym erweitert werden sollte, da es scheinbar einen objektivierbaren Marker für SIDS gibt. Doch so einfach ist es nicht.
1968 legte die WHO die Leitprinzipien für jedes Neugeborenen-Screening-Programm fest. Zusammenfassend wurde entschieden, dass es sich bei den gescreenten Erkrankungen um ein signifikantes Problem mit bekanntem natürlichem Verlauf handeln sollte. Außerdem muss es eine vereinbarte Strategie geben, wer als Patient*in zu behandeln ist, und Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sollten zur Verfügung stehen. Des Weiteren sollte ein geeigneter, akzeptabler Test existieren und die Kosten der Untersuchung sollten im Verhältnis zu den medizinischen Kosten insgesamt ausgewogen sein.
Gleich mehrere Punkte wären bei einem auf das Enzym abzielenden Screening nicht erfüllt – etwa, dass die gesunde von der erkrankten Bevölkerung klar zu unterscheiden ist. Die Zugehörigkeit zu Ersterer wäre in Bezug auf Menschen, bei denen eine verminderte Enzymaktivität festgestellt werden würde, die aber dennoch kein SIDS erleiden, nämlich der Fall. Außerdem gibt es bisher keinen therapeutischen Ansatz. Auch das ist ein wichtiges Kennzeichen der beim Neugeborenen-Screening untersuchten Erkrankungen. Denn was ist die Konsequenz eines Tests, der ein erhöhtes SIDS-Risiko ergibt? Wird das Kind vor dem Schlafengehen verkabelt und an einen Monitor angeschlossen? Und wenn ja, wie lange? Und was passiert mit der Psyche von Eltern und Kind durch die zahlreichen nachgewiesenermaßen falschen Alarme, die diese Geräte von sich geben und die die Familie möglicherweise in den Wahnsinn treiben?
Den Eltern kann diese Bürde, den kindlichen Schlaf auf diese Weise zu überwachen, nicht auferlegt werden. Auch wenn jede Mama und jeder Papa bei drohendem SIDS, ohne zu zögern, mit Argusaugen über den Schlaf ihres Babys wachen und selbst kein Auge zutun würde, so ist das über einen längeren Zeitraum nicht möglich, ohne dabei die eigene Gesundheit einzubüßen. Wie bereits erwiesen, sind aber auch die technischen Hilfsmittel wie Matratze oder Monitor fehleranfällig.
Und was macht es außerdem mit der Entwicklung der Psyche des Kindes und der Beziehung zwischen Kind und Eltern oder auch Geschwistern, wenn alle Beteiligten monate- oder jahrelang in größter Sorge vor dem plötzlichen Tod leben und sich dementsprechend verhalten? Auch diese Frage müssen wir uns stellen, jetzt, da wir der Ursache für das Auftreten des Plötzlichen Säuglingstodes langsam näherkommen. Wir sind der Meinung, dass wir noch nicht so weit sind, durch die Bestimmung eines Blutwertes angemessen auf das Risiko für den Plötzlichen Säuglingstod zu reagieren. Aber wir sind sicher, dass die moderne Medizin sehr bald eine hilfreiche und umsetzbare diagnostische Strategie entwickeln wird, mit der dieses Ereignis noch seltener auftreten wird als ohnehin schon. Bis dahin gilt es, möglichst alle Risikofaktoren für das Kind zu vermeiden, um dem Triple-Risk-Modell Rechnung zu tragen.
Kinder-Erste-Hilfe –
für den Ernstfall vorbereitet sein
Als das dreijährige Kind aufrecht auf der Liege sitzend von mehreren Rettungskräften in die Notfallambulanz geschoben wurde, ahnte noch niemand, welche dramatischen Ereignisse sich nur wenige Minuten zuvor abgespielt hatten. Der Notarzt las die Eckdaten seines Einsatzprotokolls und begann zu erzählen. Der Junge war mit seiner Mutter im Schwimmbad und die beiden kurz davor gewesen, nach Hause zu gehen. In dem Moment, in dem die Mutter die Tasche packte, entdeckte das Kind offenbar einen kleinen Ball, der nahe dem Beckenrand im Wasser trieb. Unbemerkt lief es darauf zu, beugte sich vornüber und fiel in das 90 cm tiefe Wasser. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis die Mutter bemerkte, dass ihr Sohn nicht mehr bei ihr war und sein Körper regungslos unter der Wasseroberfläche trieb. Während sie so laut sie konnte um Hilfe rief, stürzte sie sich in das hüfthohe Wasser und zog ihr Kind an den Beckenrand. Als es nicht auf ihre vehemente Ansprache reagierte, begann die Mutter sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. »Zweimal beatmen und dann mit der Herzmassage beginnen. Das habe ich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt«, antwortete sie auf die Frage des Rettungssanitäters, noch sichtlich geschockt, aber mit der festen Stimme einer Mutter, die gerade ihrem Kind das Leben gerettet hat.
Das eigene Kind reanimieren zu müssen, gehört sicherlich zu den Ausnahmesituationen des Elternseins. Dennoch: Es reicht ein Sturz mit dem Fahrrad, ein Sprung vom Beckenrand, ein Schluck aus einer Flasche Reinigungsmittel. Oder Sie finden Ihr Kind bewusstlos vor, ohne zu wissen, was genau passiert ist. Ganz unvermittelt könnten Sie sich in einer Situation wiederfinden, die schnelles Handeln und die richtigen Handgriffe erfordert.
Nicht jede (Beinahe-)Katastrophe ist vorhersehbar und nicht auf jede Eventualität können Sie sich vorbereiten. Dennoch gibt es Wissen, das Sie sich im Vorhinein aneignen, und Maßnahmen, die Sie erlernen und üben können. Wer sollte mein erster Ansprechpartner bei Unfällen sein? Wo finde ich rasche Hilfe bei Vergiftungen? Wann muss ein Kind beatmet werden, wann benötigt ein Kind eine Herzdruckmassage? Und in welcher Reihenfolge soll das geschehen?
Das und vieles mehr wird Ihnen in einem Erste-Hilfe-Kurs näher- und beigebracht. Damit Sie im Notfall die Ruhe bewahren, wissen, wie Sie Ihrem Kind rasch helfen können und wie Sie die Zeit bis zum Eintreffen der Profis überbrücken. Dieses Kapitel ist ein Plädoyer für die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs für Eltern. Denn ALLES ist besser, als nichts zu tun.
Der (Nachhol-)Bedarf ist unter Deutschlands Erwachsenen enorm. Aktuelle Umfragen bescheinigen eine große Unsicherheit in der Bevölkerung. Laut ADAC-Bericht aus dem Jahr 2021 trauen sich nur die Hälfte der Befragten überhaupt zu, Erste Hilfe zu leisten. Das Verhältnis von Herzdruckmassage und Atemspende war nur 10 Prozent der Befragten bekannt!
Dabei müssen in Deutschland jährlich ungefähr 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche aufgrund eines Unfalls ärztlich behandelt werden.
Zum Großteil passieren diese Unfälle zu Hause oder im näheren Umfeld (etwa 60 Prozent). Am häufigsten sind Ertrinkungsunfälle und Stürze, gefolgt von Erstickung, Vergiftung und Verbrennungen bzw. Verbrühungen. Und fast bei jedem dieser Ereignisse wäre die erste Person an der Unfallstelle theoretisch in der Lage, mit den richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen wichtige Akzente zu setzen oder eben sogar Leben zu retten.
Auch die Zahlen, die das Deutsche Ärzteblatt dazu veröffentlichte, sind erschreckend. Zwar gab in der Umfrage einer deutschen Krankenkasse die überwiegende Mehrheit an, schon einmal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht zu haben, bei einem Viertel der Befragten lag dieser jedoch schon mehr als 20 Jahre zurück. Wahrscheinlich liegt das daran, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, vor der Führerscheinprüfung einen derartigen Kurs zu besuchen. Danach kümmert sich aber kaum noch jemand darum.
Wir sind aber unbedingt der Meinung, dass ein Erste-Hilfe-Kurs vor der Geburt eines Kindes genauso dazugehören sollte wie ein Geburtsvorbereitungskurs. Wir sehen es sogar noch strenger. Ein Erste-Hilfe-Kurs sollte, ebenso wie beim Autoführerschein, obligatorisch sein. Also wie eine Art Kinderführerschein. Das Angebot an Erste-Hilfe-Kursen ist mittlerweile reichlich. Viele Krankenhäuser und Geburtskliniken sowie das Deutsche Rote Kreuz bieten Elternkurse an. Damit können Sie kaum etwas falsch machen. Anders sieht es bei Online-Angeboten aus. Man muss teilweise gar nicht wenig Geld für eine Videodatei bezahlen, die sich als Erste-Hilfe-Kurs on demand bezeichnet. Hier können wir nur zur Vorsicht raten. Die Qualität dieser teilweise nicht von Notfall- oder Kindermediziner*innen angebotenen Kurse mag mangelhaft und das Geld nicht wert sein. Darüber hinaus sind solche Video-Tutorials gerade bei Erste-Hilfe-Maßnahmen, bei denen man »anpacken« muss, einem Kurs in persona immer unterlegen.
Der Erste-Hilfe-Kurs, den die Mutter des Kindes mit dem eingangs geschilderten Beinahe-Ertrinkungsunfall besucht hatte, war sein Geld mehr als wert. Das Kind konnte nach einer kurzen Beobachtungsphase das Krankenhaus unbeeinträchtigt und ohne jegliche Folgeerscheinungen wieder verlassen.
VERSCHLUCKEN
Babys, aber auch ältere Kinder, lieben es, Gegenstände in den Mund zu nehmen und daran zu nuckeln und zu kauen. Der Grund dafür ist einfach: Bei Kindern ist das Fühlen, also der Tastsinn, über Lippen und Zunge weitaus besser entwickelt als über die Finger, und auch das Sehen ist noch nicht die große Stärke kleiner Kinder. So sind sie darauf angewiesen, ihre Umgebung auch mit dem Mund zu erkunden, um sich durch das Ertasten eines Gegenstandes mit Lippen, Zunge und Gaumen ein Bild zu machen. In dieser Phase, die etwa bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres dauert, ist die Gefahr besonders groß, dass die Kinder Murmeln, Münzen oder kleine Spielzeugteile, die auf dem Boden liegen, verschlucken oder sogar aspirieren, also in die Luftröhre bekommen. Kann der Fremdkörper nicht mehr weiter hinuntergeschluckt oder wieder herausgehustet werden, kommt es zum Auftreten charakteristischer Anzeichen und Symptome: anhaltender Hustenreiz, Atemnot, ein Pfeifgeräusch beim Atmen und Rot- oder Blaufärbung des Gesichts, weil die Atmung aussetzt.
Ältere Kinder sollten Sie dann, genau wie Erwachsene, zunächst dazu auffordern, den Fremdkörper wieder herauszuhusten. Unterstützend können Sie mehrere Male (bis zu fünfmal) mit der flachen Hand auf den Rücken der vorgebeugten Person schlagen.
Ergibt sich aus diesen Maßnahmen keine Besserung, wählen Sie umgehend den Notruf, beruhigen Sie die betroffene Person, vor allem, wenn es sich um ein Kind handelt, und versuchen Sie in weiterer Folge, mit dem Heimlich-Griff den Fremdkörper zu lösen. Dazu platzieren Sie, hinter der Person stehend, Ihre Faust unterhalb des Rippenbogens. Mit der anderen Hand umfassen Sie Ihre Faust und ziehen diese bis zu fünfmal kräftig nach hinten oben in Richtung Ihrer eigenen Brust.
Aufgrund der Größenverhältnisse ist das Heimlich-Manöver bei Babys und kleinen Kindern so allerdings nicht möglich. Wenn Ihr Kind trotz Aufforderung nicht mehr effektiv hustet, gehen Sie folgendermaßen vor: Säuglinge sollten Sie bäuchlings auf Ihren ausgetreckten Arm legen (Kinder jenseits des 1. Lebensjahres auf den Oberschenkel), den Kopf etwas tiefer positioniert als den restlichen Körper. Dann klopfen Sie bis zu fünfmal zwischen die Schulterblätter des Kindes. Bleiben diese Maßnahmen ohne Erfolg und tritt keine Besserung ein, drehen Sie das Kind auf den Rücken und drücken mit zwei Fingern oder dem Handballen auf die Mitte des Brustbeins. Nur bei Kindern, die älter sind als ein Jahr, können Sie das Heimlich-Manöver durchführen. Tritt hierdurch keine Besserung ein, wechseln Sie die Handgriffe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ab.
Verliert das betroffene Kind das Bewusstsein, müssen Sie umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen.
Dieses Kapitel kann und soll natürlich den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses nicht ersetzen. Deshalb verzichten wir bewusst auf die Schilderung der notwendigen Maßnahmen für das Wiederbeleben.
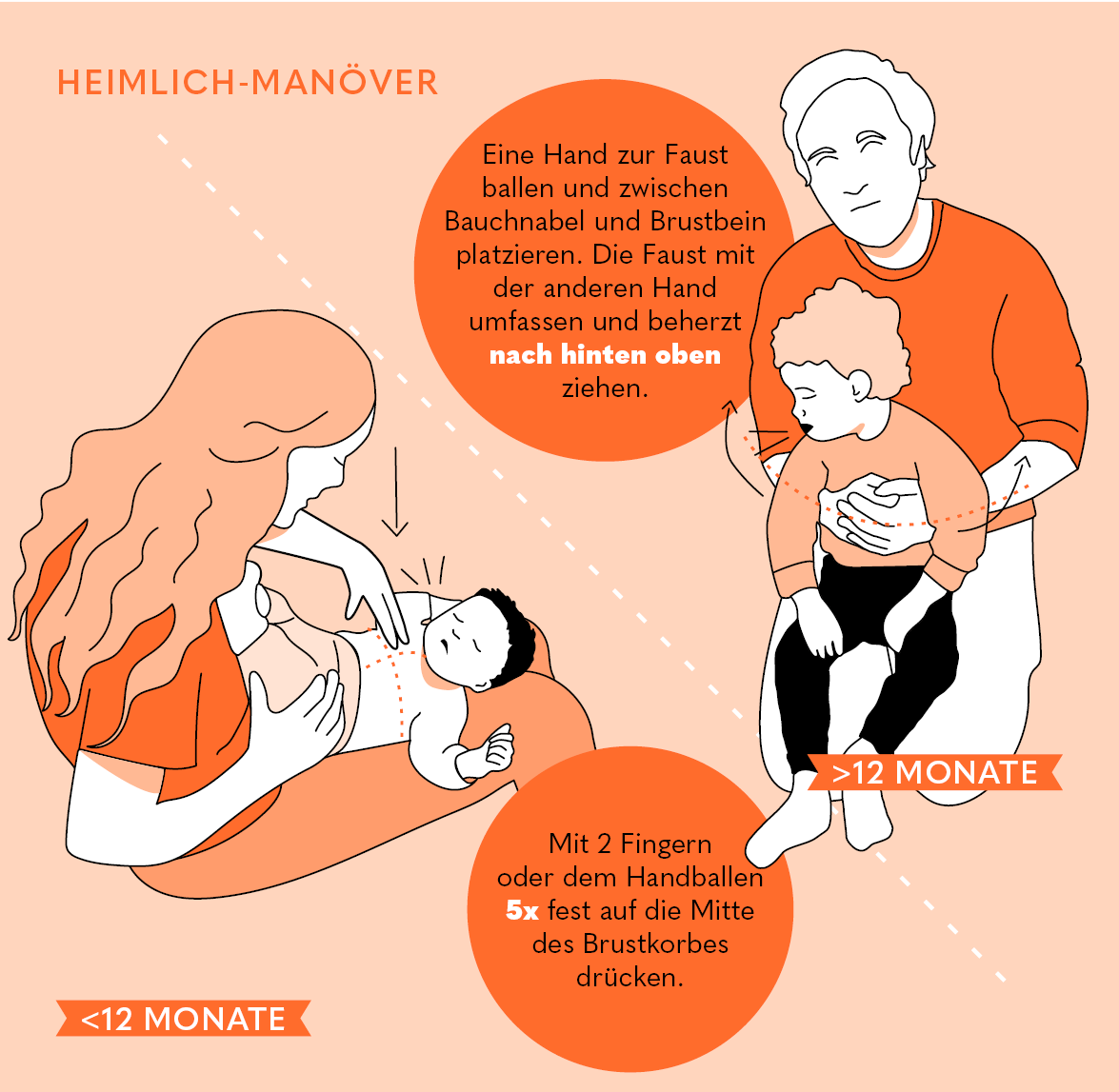
SCHÄDELPRELLUNG UND SCHÄDEL-HIRN-TRAUMA
Als Florian mit seiner Frau und seinen ersten beiden Kindern mit dem Wohnwagen durch den Südwesten der USA fuhr, passierte es ausgerechnet am höchsten Aussichtspunkt des Grand Canyon: Ihre Tochter, die damals ein Jahr alt war, kippte rücklings aus dem Bett. Mit einem lauten Knall schlug ihr Hinterkopf auf dem Fußboden des Wohnmobils auf. Sie schrie sofort auf und begann zu weinen. Bekanntermaßen gibt es unendlich viele außergewöhnliche Aussichtspunkte am Grand Canyon, aber kaum medizinische Versorgung. Schon gar keine Kinderklinik, die ein Kind mit Schädel-Hirn-Trauma überwachen könnte. Und erst recht keine Neurochirurgie, die bei einer akut aufgetretenen Hirnblutung tätig werden müsste. So mussten Florian und seine Frau als Kinderarzt und Kinderkrankenschwester die Überwachung des Kindes selbst in die Hände nehmen, mit der Camping-Taschenlampe regelmäßig die Pupillenreaktion überprüfen und für die nächsten 24 Stunden eine Glasgow Coma Scale auf Walmart-Rechnungen dokumentieren. Anhand dieser Skala überwacht medizinisches Personal das Ausmaß einer Bewusstseinseinschränkung. Durch Objektivierung von verbaler und motorischer Reaktion sowie dem Augenöffnen kann eine Bewusstseinslage erkannt werden, die es beispielsweise notwendig macht, den Patienten oder die Patientin in ein künstliches Koma zu versetzen.
Doch lassen Sie uns mit dem Grundsätzlichen anfangen. Was verstehen wir eigentlich unter dem in der Überschrift angeführten Begriff Schädelprellung und was ist ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT)? Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden?
AUF EINEN BLICK
Die Glasgow Coma Scale
Zur Abschätzung einer Bewusstseinsstörung von 3 (tiefes Koma) bis höchstens 15 Punkten (vollständig wach).
|
Punkte |
Augen öffnen |
Beste verbale Kommunikation |
Beste motorische Reaktion |
|---|---|---|---|
|
6 |
– |
– |
spontane Bewegungen |
|
5 |
– |
Plappern, Brabbeln, Sprechen |
auf Schmerzreiz, gezielt |
|
4 |
spontan |
Schreien, aber tröstbar |
auf Schmerzreiz, ungezielt |
|
3 |
auf Anschreien |
Schreien, untröstbar |
auf Schmerzreiz, Beugereaktion |
|
2 |
auf Schmerzreiz |
Stöhnen oder unverständliche Laute |
auf Schmerzreiz, Streckreaktion |
|
1 |
keine Reaktion |
keine verbale Reaktion |
keine Reaktion auf Schmerzreiz |
Schädelprellung wird definiert als eine Verletzung des Kopfes ohne Funktionsstörung oder strukturelle Schädigung des Gehirns. Was heißt das im Klartext? Eine Funktionsstörung des Gehirns sind beispielsweise ein Bewusstseinsverlust, Erbrechen, Seh-, Hör-, Sprach- oder Bewegungsstörungen, Lähmungen, Wesensänderungen oder Gedächtnisstörungen. Eine Hirnblutung wäre ein Beispiel für eine strukturelle Schädigung des Gehirns. Tritt eines der geschilderten Symptome nach einer Kopfverletzung auf, sprechen wir von einem Schädel-Hirn-Trauma.
Werden anhand der Glasgow Coma Scale 13 bis 15 Punkte erreicht, ist das Kind beinahe unbeeinträchtigt und man bezeichnet das Schädel-Hirn-Trauma als leicht. Ein mittelschweres SHT zeichnet sich ab, wenn das Kind 9 bis 12 Punkte erreicht und alles ab 8 Punkten abwärts nennen wir schweres SHT.
Häufig sind Eltern überrascht, wenn sie mit ihrem Kind in die Notfallambulanz gehen, weil es zum Beispiel von der Couch oder der Wickelkommode gefallen ist und der Arzt oder die Ärztin eine 24- bis 48-stündige stationäre Überwachung empfiehlt. Gerade wenn der erste Schock überwunden ist und sich alle Beteiligten von dem Sturz erholt haben, scheint für Eltern die Gefahr, dass etwas Schlimmeres passiert ist, gebannt zu sein. Doch im Gegensatz zu den Situationen, in denen ein Kind stationär aufgenommen wird, weil es ihm nicht gut geht, dient die stationäre Aufnahme bei einem Schädel-Hirn-Trauma zunächst lediglich der Überwachung. Der Grund liegt in der drohenden Dynamik der Ereignisse. Sollte das Kind beim Sturz eine Hirnblutung erlitten haben, so gilt: Je früher sich daraus Symptome entwickeln, desto schneller muss reagiert werden. Je schneller sich also eine Blutung ausbreitet, desto weniger Zeit bleibt, dem Gehirn noch ausreichend Platz zu schaffen. Wenn eine Blutung erst nach mehreren Tagen symptomatisch wird, weil es sich um eine kleine sogenannte Sickerblutung handelt, so bleibt etwas mehr Zeit, gegenzusteuern.
Wie schwer ein Schädel-Hirn-Trauma ist oder ob es zu einer Blutung gekommen ist, lässt sich von außen zunächst nicht abschätzen. Auch der Hergang oder die Sturzhöhe lassen keine automatischen Rückschlüsse zu. So gibt es Kinder, die nach einem Sturz aus dem ersten Stock ohne Schädel-Hirn-Trauma davongekommen sind, während ein anderes Kind eine schwere Hirnblutung davongetragen haben kann, nachdem es auf dem Pausenhof mit dem Kopf eines Mitschülers zusammengestoßen ist.
Daher ist es für Sie als Eltern wichtig, die Alarmsignale zu kennen, die auf eine schwere Gehirnerschütterung oder Schlimmeres hinweisen.
Auch hier gilt wie so oft: Je jünger das Kind, desto unspezifischer sind die Symptome und desto schwerer ist das Problem zu erkennen. Bei Säuglingen ist z. B. eine gespannte Fontanelle ein absolutes Warnsignal und das Kind sollte umgehend in eine kinderärztliche Klinik gebracht werden. Aufgrund der schwierigen Gemengelage müssen Säuglinge meistens sogar bei jedem Sturz auf den Kopf, auch ohne Anzeichen für ein SHT, zur Beobachtung in der Klinik bleiben.
AUF EINEN BLICK
Alarmzeichen für eine Bewusstseinsstörung bei Schädel-Hirn-Trauma
- verwaschene, undeutliche Sprache
- Benommenheit
- Verwirrtheit
- Doppelbilder
- Erbrechen
- Teilnahmslosigkeit
- Gedächtsnisverlust
VERGIFTUNGEN
Heutzutage wird von den Herstellern bei fast allen Produkten, nicht nur bei Lebensmitteln, auf das Aussehen geachtet. Haben Sie schon einmal wahrgenommen, welch schillernde und appetitliche Farben Reinigungs-, Geschirrspül- oder Waschmaschinentabs haben? Versetzen Sie sich nun in ein Kleinkind hinein, das eine Packung voll Reinigungsmittel findet. Die Frage, ob das Gefundene genauso gut schmeckt wie Bonbons, ist naheliegend – immerhin sieht es genauso schön und bunt aus.
Florians zweijähriger Sohn darf regelmäßig dabei helfen, den Tab in die Geschirrspülmaschine einzulegen. So soll dem Kind ganz klar und unspektakulär die korrekte Bestimmung der Tabs beigebracht werden. Sollte der Kleine also doch mal zufällig einen Reinigungstab finden, wird er nicht auf die Idee kommen, ihn in den Mund zu stecken oder zu essen, sondern sich eher einen Geschirrspüler suchen, um den Tab dort einzulegen.
Leider gibt es in jedem Haushalt zahllose Stoffe und Substanzen, die in großen oder auch kleinen Mengen zu schweren Vergiftungssymptomen führen können. Wie bereits erwähnt sämtliche Reinigungsmittel, Waschutensilien wie Shampoo oder Duschgel, aber auch Zahnpasta, Deodorant, Nagellack, Parfüm, Medikamente und vieles mehr. Und auch im Garten und im Park können Blätter oder Blüten von gewissen Pflanzen schwere gesundheitliche Schäden nach sich ziehen, wie zum Beispiel Goldregen, Tollkirsche und Eisenhut.
Besteht der Verdacht, dass ein Kind eine giftige Substanz zu sich genommen hat, greift auch das Personal in Notfallpraxen und Kinderkliniken schnell zum Telefon. Die Nummer der zuständigen Giftnotrufzentrale ist in jedem Notaufnahmetelefon fest eingespeichert. Die Mitarbeiter*innen der Giftnotrufzentralen haben Zugriff auf die wichtigsten Daten sämtlicher Inhaltsstoffe, die man sich vorstellen kann, und sprechen auch Empfehlungen über die weitere Handhabung und Vorgehensweise aus. Und auch auf den heimischen Kühlschränken sollte die Nummer einer der nachfolgenden Giftnotrufzentralen stehen, damit Sie im Unglücksfall schnell handeln können:
- Berlin: Tel.: 030/19240
- Bonn: Tel.: 0228/19240
- München: Tel.: 089/19240
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat im Internet außerdem eine aktuelle Liste der Giftnotrufzentralen und Giftinformationszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht. Dabei ist es nicht notwendig, dass Sie die geographisch nächste Zentrale anrufen. Wenn Sie in Berlin wohnen, können Sie trotzdem den Giftnotruf in München um Rat fragen – und umgekehrt.
AUF EINEN BLICK
Dos and Don’ts bei Vergiftungen
- Bewahren Sie die Verpackung der eingenommenen Substanz oder die Substanz selbst für spätere Rückfragen auf.
- Lösen Sie bei Ihrem Kind kein Erbrechen aus. Denn das Hochgewürgte kann je nach Substanz die Speiseröhre schädigen oder in Luftröhre und Lunge geraten. Sollte es von allein erbrechen, helfen Sie ihm, die dafür richtige Körperposition und Lage einzunehmen. Drehen Sie dem liegenden Kind den Kopf zur Seite und fangen Sie mit einem Gefäß oder einer Schale Erbrochenes auf. Wenn das Kind sitzt, beugen Sie seinen Kopf nach vorne und halten Sie die Stirn mit einer Hand fest.
- Kontrollieren Sie, ob im Mund gegebenenfalls noch Rückstände der giftigen Substanz vorhanden sind, und entfernen Sie diese.
- Geben Sie Ihrem Kind Wasser zu trinken, jedoch keine kohlensäurehaltigen Getränke und keine Milch.
- Aktivkohle oder entschäumende Mittel sollten nur nach Rücksprache mit Ärzt*innen oder dem Giftnotruf eingesetzt werden.
- Wurde das Gift über die Atemwege aufgenommen, beispielsweise in Form von Gas, dann sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an die frische Luft kommt, oder öffnen Sie Fenster und Türen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, da das giftige Gas nicht nur das Kind, das Sie vorgefunden haben, bewusstlos machen kann, sondern gegebenenfalls auch Sie (Selbstvergiftung).
STROMUNFÄLLE
Abgesehen von der Vorstellung in einer kinderärztlichen Praxis im Nachgang eines Stromunfalls gibt es eventuell auch akute Maßnahmen, die erforderlich sind. Sollte das Kind noch immer mit der Stromquelle in Kontakt stehen, achten Sie darauf, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen, und vermeiden Sie den Kontakt mit dem Strom. Ziehen Sie so schnell wie möglich den Stromstecker oder schalten Sie die Sicherung ab. Sollte das nicht möglich sein, versuchen Sie, das Kind mit einem nicht leitenden Gegenstand von der Stromquelle wegzuziehen.
Kinder, die unversehrt scheinen und vielleicht nur einen Stromschlag abbekommen haben, sollten trotzdem immer zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Hier wird das Kind umfassend durchgecheckt und vor allem auch auf Herzrhythmusstörungen, die Folge eines Stromunfalls sein können, untersucht. An den Ein- und Austrittsstellen des elektrischen Stromes kann es zu kleinen Verbrennungen an der Haut kommen. Diese Strommarken können helfen, den Stromweg durch den Körper nachzuvollziehen. Darüber hinaus liefern sie nicht selten das fehlende Puzzleteil bei einem vor der Steckdose sitzenden weinenden Kind, das außer »Aua-Finger!« keine weiteren sachdienlichen Hinweise zum Unfallhergang abgeben kann.
Gefahren im Haushalt minimieren –
den Wohnraum kindersicher machen
Ein Bekannter rief mich eines Tages völlig außer sich an. »Ich weiß nicht, was ich tun soll … Wir haben doch dieses Babyspielzeug, das immer so viel Krach macht … Ich hab’s eben unter dem Bett gefunden … Der Deckel vom Batteriefach ist weg – und eine Knopfbatterie fehlt. Du sagst doch immer, dass diese Dinger so gefährlich sind! Ich weiß nicht, ob Helena die Batterie verschluckt hat … Ich habe schon überall gesucht!«
Wir wechselten noch ein paar Sätze über das Telefon, die aber auch kein Licht ins Dunkel brachten und vor allem keine brauchbaren Informationen über den Verbleib der Knopfbatterie lieferten. Eine halbe Stunde später trafen wir uns in der Klinik und nach wenigen Minuten machte ich bereits eine Röntgenaufnahme von Helenas Oberkörper. Erfreulicherweise war darauf kein Röntgenschatten einer kreisrunden Knopfbatterie auszumachen und die beiden konnten beruhigt nach Hause fahren. Zwei Tage später stand Helena ganz stolz vor ihrer Mama und zeigte ihr, was sie in ihrem Schuh gefunden hatte: eine Knopfbatterie. Zum Glück dachte sie nicht einmal daran, sie in den Mund zu nehmen, und übergab sie vorbildlich ihren Eltern. Die beiden wussten, dass diese Geschichte auch anders hätte ausgehen können – mit einer Darmblutung und mehrfachen Operationen bis hin zur Gefahr des Verblutens –, weshalb sie sich nach diesem Erlebnis erneut auf die Suche nach Gefahrenquellen in ihrer Wohnung begaben. Dieses Mal mit ganz speziellem Fokus auf batteriebetriebenem Kinderspielzeug.
Geschichten wie diese sind heutzutage, wo es viel elektronisches Spielzeug und auch sonst unzählige Gefahrenquellen im Haushalt gibt, leider an der Tagesordnung. Und viel zu oft kommen die Beteiligten, allen voran die Kinder, nicht mit dem Schrecken davon, sondern erleiden Vergiftungen, Verbrennungen, Verätzungen oder Ähnliches. Aus diesem Grund besteht für junge Eltern die unbedingte Notwendigkeit, ihre Wohnung, die bis vor Kurzem noch für zwei Erwachsene ausgelegt war, kindersicher zu machen. Doch das ist schwieriger, als man denkt: Wo fange ich an? Worauf muss ich achten? Was sind Gefahrenquellen im Haushalt?
Eine gute Strategie, um solche Gefahrenquellen für ein Kind zu identifizieren, ist, den Blickwinkel des Kindes einzunehmen und die Umwelt durch seine Augen zu betrachten. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Begeben Sie sich im Wohnzimmer, in der Küche, im Badezimmer und im Kinderzimmer buchstäblich in die Position des Kindes. Krabbeln Sie auf allen vieren oder – noch besser – robben Sie auf dem Bauch durch die Wohnung. Es mag ein eigentümlicher Anblick sein (es muss Sie ja niemand dabei beobachten), aber das kann dabei helfen, viele Gefahrenquellen zu identifizieren.
Hierzu zählen zum Beispiel die untersten Fächer des Bücherregals, in denen Glasvasen und Briefbeschwerer (wie bitte? Sie haben keinen Briefbeschwerer?) stehen, der Unterschrank in der Küche mit den Geschirrspültabs, die Klobürste neben der Toilette, die Schublade im Bad mit der Nagelschere und den Kosmetikartikeln – und natürlich die unzähligen Steckdosen. All das gehört zum Alltag der Erwachsenen, aber nicht in die Reichweite von Kindern.
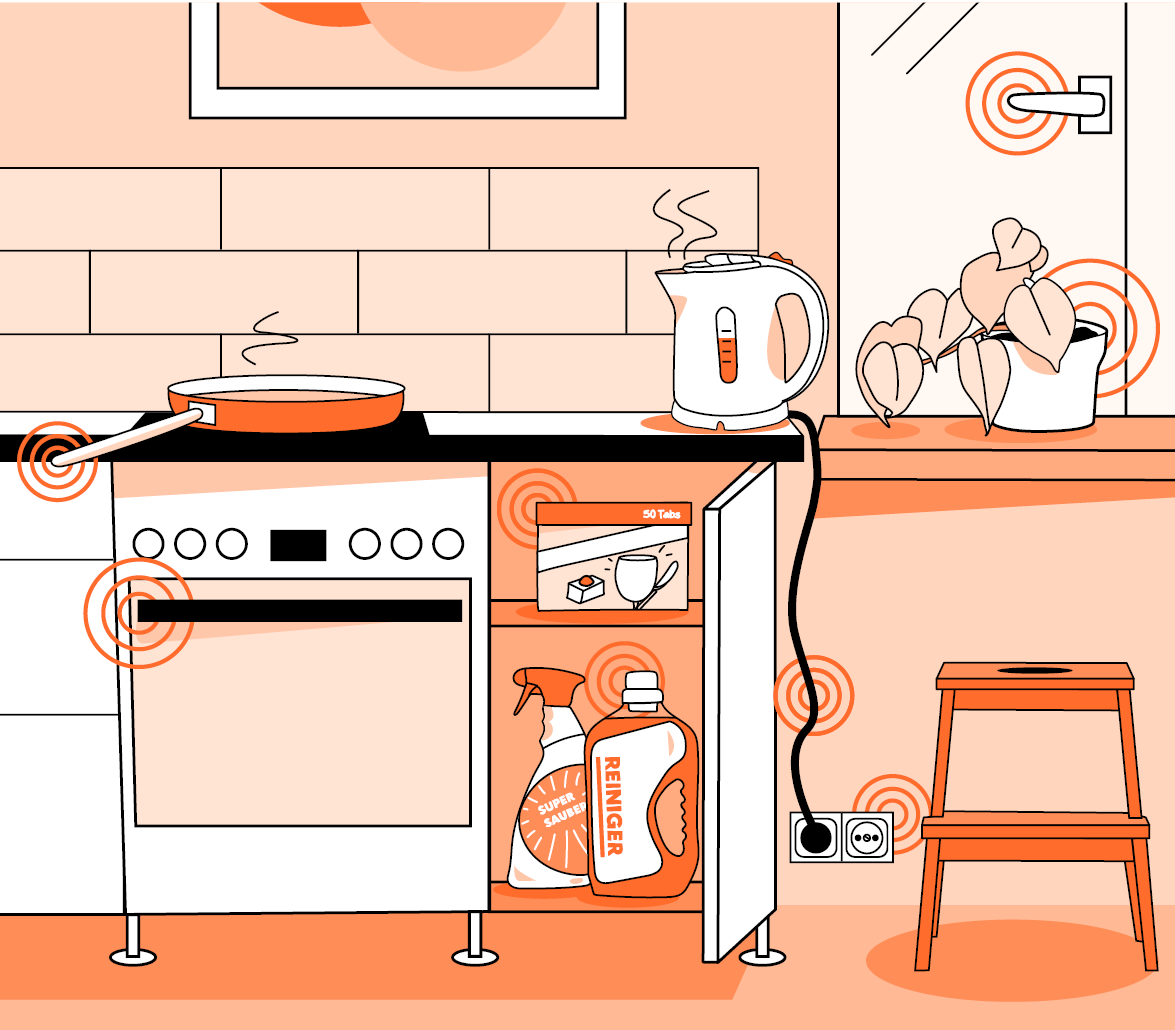
STROM
Fangen wir mit den unzähligen Stromquellen in einem Haushalt an.
Diese üben eine fast magische Anziehungskraft auf Kinder aus. Davon weiß Florian ein Lied zu singen. Aber ausnahmsweise nicht durch seine Kinder, sondern aus eigener Erfahrung. Im Alter von neun Jahren zog er mit seiner Familie in eine andere Stadt. Am Umzugswochenende waren alle Beteiligten mit dem Transport der Einrichtung beschäftigt, als Florian einen kleinen Schraubenzieher fand. Wie ferngesteuert nahm er das Werkzeug und steckte es in eine Steckdose. Einfach so. Warum er das tat, kann er sich heute auch nicht mehr erklären, aber irgendwie weckt so ein Loch in der Wand offenbar den Entdeckergeist. Bevor Florian einen Stromschlag bekommen konnte, der wahrscheinlich lebensgefährlich gewesen wäre, wurde sein Treiben von einem Erwachsenen entdeckt. Der Schraubenzieher wurde ihm weggenommen, und er wurde aufgefordert, sich stattdessen nützlich zu machen. So wie derartige Beinaheunfälle eben enden.
Wenn Strom durch den menschlichen Körper fließt, kann das dramatische Folgen haben. Zum einen können dadurch die Muskeln verkrampfen. Besonders ungünstig ist das, wenn man eine Stromquelle mit der bloßen Hand anfasst und daraufhin die Muskeln der Hand so stark kontrahieren, dass die Stromquelle nicht wieder losgelassen werden kann. In diesem Fall sollte die zu Hilfe eilende Person versuchen, das Unfallopfer mit einem Gegenstand aus nicht leitendem Material (Gummi oder Holz) von der Stromquelle zu wischen. Bei den wenigsten Stromunfällen kommt es glücklicherweise zu einer Schädigung des Herzens. Im Extremfall sind jedoch ein Herzstillstand und Bewusstseinsverlust die Folgen. Denn ein weiterer Muskel, der sich durch den Stromschlag plötzlich zusammenzieht und somit aus seinem Rhythmus geworfen wird, ist der Herzmuskel. Im Extremfall kann durch den Stromschlag Kammerflimmern ausgelöst werden, ein Zustand, in dem das Herz sich zwar kraftlos, aber dafür viel zu oft zusammenzieht. Die dramatische Folge ist ein Kreislaufzusammenbruch und möglicherweise der Tod. Ebenso lebensgefährlich ist eine Beeinträchtigung der Atemmuskulatur. Wenn diese sich aufgrund des Stromflusses zusammenzieht und nicht mehr entspannt, droht qualvolles Ersticken.
Um solche dramatischen Situationen zu verhindern, bringen Sie an jeder Steckdose, die vom Boden aus erreichbar ist, eine Schutzblende an. Am praktischsten sind solche, die durch einen einfachen Dreh des Steckers um 90 Grad geöffnet werden können. Im Vergleich dazu eher unhandlich sind Blenden, die jedes Mal entfernt und wieder eingesetzt werden müssen. Zur Benutzung sind hier zusätzliche Handgriffe notwendig und die Gefahr ist hoch, dass das Wiedereinsetzen vergessen wird und die Steckdose infolgedessen erneut freiliegt.
ELEKTROGERÄTE
Elektrogeräte, die am Strom hängen, sind gleich mehrfache Gefahrenquellen. Der Föhn, das Radio, der Wasserkocher, das Bügeleisen oder auch der Toaster befinden sich zwar in der Regel in unerreichbarer Höhe, doch häufig hängt das dazugehörige Stromkabel bis auf den Boden. Nun kann es passieren, dass ein Kind damit spielt oder sich daran hochziehen möchte – und ihm das ganze Gerät auf den Kopf fällt. Bei großen Geräten wie einem Föhn, Radio oder Mixer kann das Verletzungen wie Platzwunden zur Folge haben. Sollte das Gerät das Kind glücklicherweise verfehlen, so besteht dennoch die Gefahr, dass es durch einen einfachen, vielleicht auch nur zufälligen Knopfdruck in Betrieb genommen wird. Das kann zu Verbrennungen durch einen Föhn oder zu schweren Verletzungen durch einen Stabmixer führen.
Auch Ladekabel von Handys, Tablets oder Laptops sollten nicht am Stromnetz angeschlossen herumliegen. Kinder erforschen ihre Umgebung nicht nur in der oralen Phase am liebsten, indem sie möglichst alles in den Mund nehmen und darauf herumlutschen oder -kauen. Bei dadurch feucht gewordenen Endstücken von Ladekabeln kann es zu einem unangenehmen bis schmerzhaften Stromfluss kommen.
BATTERIEN
Eine Gefahr, die in der Allgemeinbevölkerung meistens gar nicht als solche wahrgenommen wird, ist das schon angesprochene Verschlucken von Batterien: die Batterieingestion. Die Annahme, dass so eine Batterie nach einer gewissen Zeit auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden wird und demnach nicht der Rede wert ist, ist schlichtweg FALSCH!
Gefährlich sind verschluckte Batterien vor allem dann, wenn sie mit einer feuchten Oberfläche in Kontakt geraten und so ein Stromfluss entsteht. Zudem kann die Oberfläche der Batterie erodieren, sich also auflösen, wodurch eine zusätzliche, ätzende chemische Reaktion entsteht. Ab diesem Moment bleibt dann nicht mehr viel Zeit. Innerhalb weniger Minuten kann die durch die Reaktion entstandene Säure ein Loch in die Speiseröhre fressen. Es kann sogar dazu kommen, dass in der Nähe liegende große Blutgefäße angefressen werden und so eine lebensbedrohliche Blutung ausgelöst wird. Zusätzlich können die chemischen Substanzen zusammen mit vermehrtem Speichel und Sekret die Speiseröhre herablaufen und langstreckige Verätzungen verursachen. Diese langen Verätzungen können zu schwerer Narbenbildung und einer Verengung der Speiseröhre führen, sodass im Verlauf das Schlucken nicht mehr ausreichend möglich ist.
Besonders gefährlich – teilweise lebensgefährlich – sind Knopfbatterien, da sie besonders leicht verschluckt werden können und der breite Durchmesser dazu führen kann, dass sie in der Speiseröhre hängen bleiben. Zudem liegen bei diesen Batterien Plus- und Minuspol sehr nahe beieinander, was das größte Gefahrenpotenzial birgt. Die feuchte Schleimhaut der Speiseröhre legt sich nun auf beide Seiten der Batterie, und so kommt es zu einem Stromfluss zwischen Plus- und Minuspol der Knopfbatterie. Dieser dauerhafte Stromfluss führt bereits nach wenigen Minuten zu einer Veränderung der Schleimhaut und schließlich zu Verätzungen und schweren Schäden an angrenzenden Blutgefäßen oder Organen. Zwar ist der Schaden umso größer, je voller geladen die verschluckte Batterie ist, aber auch vermeintlich entladene Batterien, die im Spielgerät nicht mehr genug Energie liefern, können schwere Schäden verursachen. Größere, zylindrisch geformte Batterien sind weniger problematisch, da Plus- und Minuspol weiter voneinander entfernt sind und sie durch ihren schmalen Durchmesser seltener in der Speiseröhre hängen bleiben können. Diese werden tatsächlich meist ohne Probleme einfach wieder ausgeschieden.
Typische Symptome nach dem Verschlucken einer Batterie sind Husten, Würgen, vermehrter Speichelfluss und blutiges Erbrechen.
Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat, verlieren Sie keine Zeit und bringen Sie es umgehend in die nächstgelegene Kinderklinik. Wenn dort mittels Röntgen des Brustkorbs die Batterie entdeckt wird, muss sie sofort entfernt werden.
Unser eindringlicher Appell lautet: Bewahren Sie Ihre Batterievorräte an einem sicheren Ort auf und achten Sie bei Spielzeug darauf, dass das Batteriefach mit einer Schraube oder Ähnlichem gesichert ist.
BIS EINER WEINT: GESCHWISTERKINDER
Eine weitere, oftmals unterschätzte Gefahrenquelle sind die Geschwisterkinder, und das in unterschiedlichsten Lebenslagen. Gerade im Kindergarten- und Schulkindalter lieben Geschwister es, gemeinsam zu baden. Während Kinder, die noch nicht schwimmen können, natürlich keine Sekunde aus den Augen gelassen werden dürfen, kommt es schon mal vor, dass ältere Kinder gefühlt stundenlang in der Badewanne spielen und ein Elternteil mit einem Ohr wachsam ist. Der Fantasie ist oft kaum eine Grenze gesetzt und alles Mögliche wird als Wasserspielzeug benutzt: Becher, Besteck, Spielzeugautos, ja teilweise ganze Puppenhäuser. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass auf keinen Fall ein Föhn an die Steckdose angeschlossen ist. Sollte nämlich ein Geschwisterkind, das sich nicht in der Badewanne befindet, auf die Idee kommen, auch dieses Utensil zum (Wasser-)Spielzeug umzufunktionieren, könnte das in einer Katastrophe enden.
Eine weitere Gefahrenquelle ist das Spielzeug der älteren Geschwister. Kleine Lego-Steinchen vom großen Bruder können verschluckt, an einem ungesichert auf dem Boden liegenden Holzschnitzmesser kann sich geschnitten werden. Aus elektrischem Spielzeug, das sich in greifbarer Nähe befindet, kann eine Knopfbatterie entfernt werden, und auch Murmeln können im Mund landen. Sie sehen, der Gefahren-Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt.
Aber natürlich müssen eine gewisse Realität und Lebbarkeit eingehalten werden. Auch ältere Geschwisterkinder brauchen altersgerechtes Spielzeug, und Sie können den Nachwuchs natürlich auch nicht aus den Kinderzimmern der älteren Brüder und Schwestern fernhalten.
FENSTER, TÜREN UND BALKONE
Gerade in der sonnigen Jahreszeit ist es toll, einen Balkon zu haben. Wenn er groß genug ist, kann die Familie im Freien gemeinsam essen, oder ein kleines Planschbecken sorgt an heißen Tagen für eine willkommene Abkühlung. Die Kehrseite der Medaille ist die Gefahr, die von ungesicherten Balkongittern und -geländern ausgeht.
Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass die Abstände der Balkongitterstäbe so gering sind, dass kein Kinderkopf hindurchpasst. Der Kopf ist bei kleinen Kindern breiter als der restliche Körper. Das bedeutet, dass überall dort, wo der Kopf hindurchpasst, auch das restliche Kind genug Platz hat. Sollte das der Fall sein, dürfen Sie Ihrem Kind keinesfalls auch nur eine Sekunde den Rücken zudrehen, wenn es sich mit Ihnen auf dem Balkon befindet. Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, sich als Heimwerker*in zu betätigen, um das Balkongeländer kindersicher zu machen, lassen Sie Ihre Idee bitte zumindest vom Partner*innen-TÜV des anderen Elternteils abnehmen. Sie sollen den Wohnbereich ja schließlich nicht unsicherer machen, als er vorher war.
Wenn die Kinder dann ein Alter erreichen, in dem Kopf und Körper keineswegs mehr durch ein Balkongeländer passen, ergibt sich sogleich das nächste Problem: Die Kinder werden mobiler und können nun auf und über Hindernisse klettern, wie zum Beispiel Möbel oder Geländer. Außerdem werden sie natürlich auch schlauer: Um besonders hohe Hindernisse zu überwinden, werden Kisten, Stühle, Bobbycars oder sogar Staubsauger zu Tritthilfen umfunktioniert.
Selbst wenn Ihre eigenen vier Wände kindersicher sind, so lauern dann im Urlaub die gleichen Gefahren. Achten Sie deshalb bei der Wahl Ihres Feriendomizils unbedingt auf die Kindertauglichkeit. Florian kann aus eigener Erfahrung berichten, dass sich Urlaubsunterkünfte, die explizit als familien- und kindergeeignet angepriesen werden, bei genauerem Hinsehen oftmals als das genaue Gegenteil entpuppen.
Achten Sie bei der Außenansicht darauf, wie weit der Abstand der Streben des Balkon- oder Treppengeländers ist und wie viel Abstand sie zum Boden aufweisen. Ein Pool direkt vor der Ferienunterkunft kann der pure Luxus sein. Ist dieser jedoch ungesichert und Ihre Kinder können noch nicht schwimmen, werden Sie im wohlverdienten Urlaub keine ruhige Minute haben. Es lohnt sich also, bei der Wahl des Feriendomizils sämtliche vorhandenen Fotos genauestens auf diese Aspekte hin zu prüfen.
Womit wir beim nächsten Thema wären: Nicht nur im Urlaub, sondern auch im täglichen Leben sind Fenster und Türen die Verbindung zur Außenwelt. Trotzdem oder genau deshalb stellen sie eine weitere Gefahrenquelle dar – ganz besonders für kleine Kinder. Unvergessen bleibt eine Meldung aus Kanada aus dem Jahr 2015: Elijah, ein dreijähriger Junge, öffnete unbemerkt die Haustür und verließ das Haus. Unglücklicherweise herrschten draußen minus 30 Grad und es war spätnachts. Die Tür, die das Kind von innen ohne Probleme öffnen konnte, verriegelte sich hinter ihm automatisch und konnte so von außen nicht mehr geöffnet werden. Der kleine Junge verlor offensichtlich die Orientierung und erfror schließlich einige hundert Meter vom Haus entfernt. Was für ein unvorstellbares Schicksal.
Eine Methode, gerade die Kleinsten daran zu hindern, unbemerkt Türen zu öffnen, ist, die Türklinke um 90 Grad nach oben gedreht anzubringen. Bei einer normalen Türklinke reicht es aus, wenn das Kind diese gerade so erreicht und etwas nach unten zieht, damit die Tür aufspringt. Bei der 90-Grad-Variante sind einige zusätzliche Zentimeter Körperlänge und eine ganz andere Krafteinwirkung notwendig.
Ihre Fenster und Balkontüren sollten Sie hingegen gänzlich gegen kindliches Öffnen sichern. Hierfür gibt es entweder eigens konzipierte Griffe mit inkludierter Kindersicherung oder Sie können eine Kindersicherung nachrüsten. Auch wenn das Fensteröffnen für Erwachsene dadurch etwas mühsamer ist, weil ein Handgriff mehr benötigt wird, kann eine solche Vorrichtung Leben retten. Denn alles Mögliche kann ein kleines Kind dazu bringen, sich aus dem Fenster zu lehnen: ein Blatt im Wind, ein Käfer oder eine Ameise, die auf der Fensterbank krabbeln, oder einfach nur ein neugieriger Blick auf die Straße. Die dramatischen Folgen kennen viele Intensivmediziner*innen und Kinderärzt*innen aus dem Schockraum – und leider passiert häufig weitaus Schlimmeres als einfach nur ein Knochenbruch.
Darüber hinaus können Sie mit einfachen Hilfsmitteln gegen weitere kleine oder auch größere Unfälle vorbeugen. Gerade in einem Alter, in dem Kinder kaum daran zu hindern sind, sämtliche Wege rennend zurückzulegen, sollten Sie versuchen, neuralgische Punkte, wie zum Beispiel eine sehr schön anzuschauende, aber möglicherweise doch sehr rutschige Holztreppe in puncto Grip zu verbessern. Selbstklebende Antirutschstreifen auf der Vorderkante der Stufen können den einen oder anderen Ausrutscher und schmerzhaften Sturz auf der Treppe verhindern.
Sollte Ihr Heim außerdem mit einem Fliesenboden ausgestattet sein, so sollten rutschfeste Socken und Hausschuhe gerade im Kindergartenalter nicht fehlen.
Verstehen Sie diese Tipps nicht falsch. Wir wollen nicht, dass Ihr Kind jahrelang in Watte beziehungsweise in rutschfeste Socken gepackt wird. Natürlich gehört es zum Lernprozess und zur Beherrschung des eigenen Körpers dazu, dass man im Laufe der Zeit auch auf rutschigem Untergrund die Kontrolle behält. Wir sprechen vielmehr von einem Alter, in dem das Laufen selbst ohnehin noch genug Probleme macht. Da sollte nicht auch noch der Untergrund zu zusätzlichen Frustrationen und vielleicht sogar Platzwunden führen.
VERBRENNUNGEN UND VERBRÜHUNGEN
Verbrennungen und Verbrühungen durch heiße Flüssigkeiten zählen zu den häufigsten Verletzungen von Kindern im Haushalt – und auch zu den unangenehmsten.
Die heißen Quellen sind mannigfaltig und fast unzählig: Kochtöpfe auf dem Herd, eine Kaffeetasse, ein Suppenteller, ein Wasserkocher oder einfach nur das heiße Wasser aus der Leitung.
Hier lohnt es sich wieder, die Welt beziehungsweise in diesem Fall die Bedienung von Wasserleitungen aus der Sicht des Kindes zu sehen. Für uns Erwachsene ist es sonnenklar, dass wir den Hebel für kaltes Wasser zur blauen und für heißes zur roten Farbe drehen. Viele Kinder kennen diese Eigenheit der Warm- und Kaltwasserversorgung eines Haushalts natürlich noch nicht. Wenn ein Kind den Wasserhahn aufdreht, um sich ein Glas mit Wasser zu füllen, so achtet es möglicherweise nicht darauf, auf welcher Temperatur dieser steht. Daher gilt: Auch wenn Ihre Bedürfnisse vielleicht andersgeartet sind, so sollten Sie Ihr Untertischgerät oder Ihren Durchlauferhitzer aus dem oben genannten Grund nie auf mehr als 40 Grad einstellen.
Beim Herd ist es besonders wichtig, bereits früh klare Regeln aufzustellen. Sowohl der Herd als auch der Backofen sollten für ein Kind von Anfang an und in jedem Zustand ein Tabu bleiben. Auch im ausgeschalteten Zustand sollten Sie Ihrem Kind nie erlauben, an den Knöpfen und Drehschaltern herumzuspielen. Wenn Ihr Kind Ihnen in der Küche beim Kochen oder Backen hilft (was eine tolle Sache für alle Beteiligten ist – außer für die Person, die am Ende alles sauber machen muss), benötigt es unter Umständen ein kleines Treppchen, um die Arbeitsfläche zu erreichen. In dem Fall sollten Sie darauf achten, dass dies in ausreichendem Abstand zum Herd und zum Backrohr steht.
Sollte es doch zu einer Verbrennung, Verbrühung oder Brandverletzung kommen, so ist rasches Handeln erforderlich. Zunächst müssen Sie dafür sorgen, dass die Hitzeeinwirkung so schnell wie möglich gestoppt wird. Beispielsweise muss Kleidung, die mit heißer Flüssigkeit durchtränkt ist, rasch ausgezogen werden, sofern sie nicht mit der Haut verklebt ist.
Die Größe der verbrühten Fläche und das Ausmaß geben die weiteren Schritte vor. Kleinflächige Verbrennungen können mit mäßig kühlem bis kaltem – aber nicht eiskaltem – Wasser vorsichtig gekühlt werden. Kaltes Wasser aus der Leitung hat hierfür die optimale Temperatur. Eiskaltes Wasser hingegen eignet sich nicht zum Kühlen! Studien haben gezeigt, dass 16 Grad handwarmes Wasser, das man für 20 Minuten über die Verbrennung laufen lässt, den Heilungsprozess positiv beeinflussen kann. Führen Sie diese Maßnahme aber nur bei kleinflächigen Verbrennungen durch – und nicht bei Säuglingen! Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein Kind zusätzlich zur Verbrühung noch unterkühlt und der Kreislauf dadurch ungünstig beeinträchtigt wird.
Vermeiden Sie es außerdem, irgendwelche Substanzen oder Verbände direkt auf die verletzte Stelle aufzutragen. Weder Puder noch Mehl oder Brandsalben haben auf frischen Verbrennungen etwas zu suchen. All diese Stoffe verschlechtern die Wundheilung und reduzieren die Sauerstoffdurchlässigkeit der Haut, die zur Heilung notwendig ist. Verbände und Wickel können mit der Wundfläche verkleben.
Legen Sie keine Kühlpads oder Eiswürfel auf die verbrannten Stellen, da hierdurch die Durchblutung und dadurch der Heilungsprozess verschlechtert wird und es zu Verunreinigungen der Wunde kommen kann. Die Einwirkung von Eis und eiskalten Gegenständen oder Wasser kann außerdem schlicht und einfach schmerzhaft sein.
Um die Zeit bis zum Eintreffen in der Kinderklinik bei schweren und großflächigen Verbrennungen zu überbrücken, können Sie handelsübliche Frischhaltefolie auf oder um die verletzte Hautstelle wickeln. Das schützt gegen Schmutz und Bakterien, die bei größeren Verbrennungen eine problematische Folge sein können, und verhindert außerdem ein Verkleben mit Kleidungsstücken.
Sollten sich bereits erste Brandblasen auf der Haut gebildet haben, dürfen Sie diese keinesfalls mit einer Nadel, Pinzette oder Ähnlichem öffnen. Wenn Sie eine Klinik aufgesucht haben, werden das die Mediziner*innen übernehmen – allerdings unter bestmöglichen hygienischen Bedingungen, wie Sie sie zu Hause nicht vorfinden können. Eine saubere, aber auch gründliche Erstversorgung von Verbrennungen und Verbrühungen ist Grundvoraussetzung für eine möglichst komplikationslose Wundheilung.
Vorsorgeuntersuchungen – wann, wie oft, warum?
Eine der wichtigsten, vermeintlich unscheinbarsten, aber auch schwierigsten Entscheidungen ist die für den richtigen Kinderarzt oder die richtige Kinderärztin. Nur mit jemand Erfahrenem an Ihrer Seite können Sie Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen frühestmöglich erkennen. Und wenn Sie Glück (oder eben das richtige Händchen bei der Arztwahl) haben, kann eine Bindung für die gesamte Kindheit und Jugend Ihres Nachwuchses entstehen.
Vielleicht sind Sie gerade jetzt auf der Suche nach einer (neuen) Kinderarztpraxis und fragen sich, wie Sie die richtige finden sollen. Als Erstes würden wir raten, im Freundeskreis herumzufragen. Wenn Freunde oder Bekannte von Ihnen mit ihrer Praxis zufrieden sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch Sie sich mit dem Arzt oder der Ärztin gut verstehen werden. Noch deutlicher wird es im Umkehrschluss: Wenn Ihre beste Freundin mit einer Kinderarztpraxis unzufrieden ist, scheidet diese für Sie wahrscheinlich automatisch aus, richtig? Bewertungen von Suchmaschinen oder Ärztebewertungsportalen sind unserer Meinung nach kritisch zu sehen. Nur zu gut kennen wir wirklich kompetente, nette und großartige niedergelassene Kinderärzt*innen, um die man laut Google-Bewertung aber besser einen weiten Bogen macht. Und umgekehrt genauso. Wie das zustande kommt, entzieht sich unserer Kenntnis, aber ausschlaggebend für die Wahl Ihrer kinderärztlichen Praxis sollte es nicht sein.
Wie Sie schon bald nach der Geburt feststellen werden, sind Kinderärzt*innen nicht nur da, um Ihrem Kind zu helfen, wenn es ihm schlecht geht. Gar nicht so selten werden Sie die Kinderarztpraxis auch aufsuchen, wenn alles in Ordnung ist. Kein Rotz, kein Ausschlag, kein Fieber. »Und dann willst du dich auch noch ins volle Wartezimmer setzen? Neben all die schniefenden und hustenden Kinder? Und deinem Kind auch noch eine Spritze geben lassen?« Ja, genau so wird das ablaufen. »Wird das wenigstens vertuscht und niemand erfährt davon?« Ganz im Gegenteil! Danach wird alles fein säuberlich in einem Heft dokumentiert und festgehalten. Und das Ganze nennt sich Vorsorgeuntersuchung.
Jedes Kind ist anders und entwickelt sich unterschiedlich schnell. Während sich der eine Junge erst mit 16 Monaten dazu bequemt, auf den eigenen zwei Beinen zu laufen, löst ein anderes Mädchen Staunen und Glückseligkeit in der Verwandtschaft aus, wenn es bereits mit 8 Monaten die ersten Schritte macht. Und das Kind, das erst mit 13 Monaten den ersten Zahn bekommen hat, spricht dafür mit 2 Jahren schon wie ein vierjähriges. Aber was davon ist noch normal? Woher sollen Eltern wissen, ob die Entwicklung ihres Kindes im Rahmen ist oder ob es vielleicht doch etwas Hilfe und Unterstützung (Förderung) benötigt?
Genau zur Beantwortung dieser Fragen wurden die Vorsorgeuntersuchungen entwickelt. Dadurch sollen regelmäßig und in sämtlichen Altersstufen Abweichungen von einer normalen Entwicklung aufgedeckt werden, damit notwendige Therapien oder Förderungen schnellstmöglich in die Wege geleitet werden können.
AUF EINEN BLICK
Der Apgar-Score
Der Apgar-Wert ist ein objektives Maß für den Zustand des Babys nach der Geburt. Er gibt Hebammen, Ärzt*innen und Pflegekräften Hinweise darauf, ob ein Baby sofort behandelt oder überwacht werden muss. Der Apgar-Score wird eine, fünf und zehn Minuten nach der Geburt erhoben und bewertet Hautfarbe, Herzfrequenz, Reflexe und Reaktionsfähigkeit, Muskelspannung und Atemfrequenz des Neugeborenen. Jede Eigenschaft wird mit 0–2 Punkten bewertet (0 für nicht vorhanden, 2 für vollständig vorhanden). Werte über 7 sind als ausreichend und gut zu erachten, während Kinder mit einem Wert unter 5 eine möglicherweise schwere Anpassungsstörung zeigen und intensivere pädiatrische Betreuung benötigen. Als Anpassungsstörung wird ein Zustand bezeichnet, in dem das Kind offenkundig noch Probleme hat, mit der neuen Lebenssituation außerhalb des Mutterbauchs zurechtzukommen. Es hat sich buchstäblich noch nicht an die neuen Bedingungen angepasst. Das kann sich durch stöhnende Atmung, schlechte Hautdurchblutung oder zu hohe bzw. zu niedrige Körpertemperatur äußern.
Auch wenn sich Millionen von Medizinstudierenden die 5 bewerteten Charakteristika als Akronym A-P-G-A-R aus den Worten Aussehen, Puls, Grimassieren, Atmung und Reflexe hergeleitet und gemerkt haben, so ist Apgar eigentlich ein Eigenname und der Score ist nach seiner Erfinderin, Dr. Virginia Apgar, 1909–1974, benannt. Solange die Studierenden wissen, woher der Name stammt, ist natürlich auch das Akronym als Eselsbrücke erlaubt. Die Autoren sprechen hier aus eigener Erfahrung.
Von der Neugeborenenperiode (U1) bis zum 17. Lebensjahr (J2) können so anhand standardisierter Untersuchungen wichtige Abweichungen festgestellt und eingeordnet werden. Was, wann und wie untersucht werden soll, ist in der Richtlinie über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie) festgelegt. Die Untersuchungen sind kostenlos und eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Die jeweiligen Ergebnisse werden im gelben Kinderuntersuchungsheft dokumentiert. Dieses Heft sollte auch zu allen außerplanmäßigen Arztvorstellungen mitgebracht werden. Erfahrene Mediziner*innen finden dort auf einen Blick alle Informationen über Probleme und chronische Erkrankungen.
AUF EINEN BLICK
Die elf Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche
U1 Im Gegensatz zu allen anderen Us wird die U1 in der Regel nicht von Kinderärzt*innen durchgeführt, sondern von einer Hebamme oder Gynäkolog*innen, da sie direkt nach der Geburt noch im Kreißsaal stattfindet. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf Fehlbildungen und lebensbedrohliche Erkrankungen gelegt, die möglicherweise im Rahmen der Schwangerschaftsuntersuchungen nicht entdeckt wurden. Darüber hinaus wird der Apgar-Score erhoben und eine lückenlose Familien-, Schwangerschafts- und Geburtsanamnese durchgeführt. Das erweiterte Neugeborenen-Screening und das Hörscreening sollten bis zum dritten Lebenstag vorgenommen werden.
U2 (3.–10. Lebenstag) Im Idealfall wird die U2 kurz vor der Entlassung aus der Geburtsklinik von Kinderärzt*innen durchgeführt. Erstmals kann das Kind in Ruhe vollständig körperlich untersucht werden. Erneut wird geprüft, dass keine Fehlbildungen vorliegen. Ein Hauptaugenmerk liegt auf dem Vorhandensein der Neugeborenenreflexe, außerdem können Augen und Ohren genauer inspiziert werden als unmittelbar nach der Geburt. Wie bei jeder U spielt die Beratung der noch frischgebackenen Eltern eine wichtige Rolle. Zu diesem Zeitpunkt sind die richtige Ernährung, der Plötzliche Säuglingstod sowie die Vitamin-D- und Fluoridprophylaxe die Hauptthemen. Wichtig: Dem Baby wird, wie unmittelbar nach der Geburt, noch einmal Vitamin K zur Optimierung der Blutgerinnung verabreicht.
U3 (4.–5. Lebenswoche) Nachdem bei der U1 Hebamme oder Gynäkolog*in und bei der U2 meist Klinik-Kinderarzt oder -ärztin die Untersucher*innen waren, kommt es im Rahmen der U3 häufig zum ersten Kennenlernen mit den niedergelassenen Kinderärzt*innen. Sie verschaffen sich einen Überblick über sämtliche Körperfunktionen einschließlich des Sehens und Hörens und untersuchen das Hüftgelenk mittels Ultraschalls. So werden ein frühzeitiges Einschreiten und Entgegenwirken bei Entwicklungsstörungen und Fehlbildungen, wie der Hüftgelenksdysplasie oder -luxation, ermöglicht. Auch dem Gewicht kommt eine besondere Bedeutung zu. Während ein Neugeborenes in der 1. Lebenswoche noch bis zu 10 Prozent seines Geburtsgewichtes wieder verlieren darf, sollte es danach zu einem stetigen Anstieg um ca. 150 Gramm pro Woche kommen. Ab diesem Zeitpunkt werden zusätzlich wichtige Themen wie Impfungen und der Umgang mit Schreibabys besprochen. Spätestens jetzt sollten Eltern über die unbedingte Notwendigkeit eines ausreichenden UV-Schutzes aufgeklärt werden. Außerdem erfolgt die dritte und letzte Vitamin-K-Gabe.
U4 (3.–4. Lebensmonat) Die Abschnitte zwischen den Us werden nun größer. Umso wichtiger ist es, den vorgegebenen Zeitraum einzuhalten. Neben der üblichen Ganzkörperuntersuchung und -funktionstestung widmen sich die Kinderärzt*innen bei der U4 speziell der Beweglichkeit und der Motorik des Säuglings sowie dem perzentilengerechten Wachstum. Perzentilen sind Messwerte, die zeigen, wo ein Kind im Vergleich zu anderen Kindern steht. In Wachstums-, Gewichts-, Längen- und vielen weiteren Diagrammen werden sie als gebogene Linien dargestellt. Liegt das Gewicht eines Kindes beispielsweise auf der 50. Perzentile, bedeutet dies, dass von 100 Kindern im gleichen Alter 50 größer und 50 kleiner sind. Liegt es auf der 75. Perzentile, bedeutet dies, dass es größer ist als 75 und kleiner als 25 von 100 Kindern in seinem Alter.
U5 (6.–7. Lebensmonat) Weitere Entwicklungsmeilensteine werden geprüft: Besitzt der Säugling eine ausreichende Kopfkontrolle sowohl im Sitzen als auch in Bauchlage, kann er sich an zwei umklammerten Fingern aus der liegenden Position hochziehen und gelingt das gezielte Greifen? Schielen, das in den ersten Monaten meist noch keinen Krankheitswert hat, muss bei weiterem Bestehen nun genauer untersucht und kritisch bewertet werden.
U6 (10.–12. Lebensmonat) Zum Abschluss des 1. Lebensjahres erlangt das Kind immer mehr Fähigkeiten. Hier müssen die Kinderärzt*innen über eine gewisse Objektivität und Gelassenheit verfügen, um die Eltern nicht unnötig zu beunruhigen. Denn während manche Kinder bereits frei stehen oder sogar laufen können (statistisch gesehen eher die Mädchen), denken andere (Sie haben es erraten: statistisch gesehen eher die Jungs) noch nicht einmal daran, sich an irgendetwas hochzuziehen, und krabbeln oder robben weiter munter durchs Leben. Gibt es aber keine zugrunde liegenden körperlichen Probleme, sollte dieses gesamte Spektrum noch als normal angesehen werden.
U7 (21.–24. Lebensmonat) Die sprachliche Entwicklung des Kindes spielt nun eine immer größere Rolle. Anhand dieser können die Kinderärzt*innen auch einen wichtigen Teil der neurologischen Entwicklung überprüfen. Bei Defiziten muss vor allem an ein vermindertes Hörvermögen gedacht werden, das von Hals-Nasen-Ohren-Ärzt*innen objektiviert werden sollte. Auch der Gesundheitszustand der Milchzähne sollte von den Kinderärzt*innen im Auge behalten werden, wenngleich zahnärztliche Kontrollen bereits in diesem Alter regelmäßig durchgeführt werden sollten. Zudem gehören jetzt auch die empfohlenen Impfungen besprochen und bisher versäumte Teilimpfungen vor dem Eintritt in die Kindertageseinrichtung nachgeholt.
U7a (34.–36. Lebensmonat) Bei der U7a handelt es sich um die letzte Untersuchung vor dem Start in den Kindergarten. Zunehmend sollte jetzt mit den Eltern das Thema Medienkonsum besprochen werden. Informationen zum dosierten Medienkonsum und Strategien, wie er eingehalten werden kann, werden gerne angenommen und bieten eine wichtige Hilfestellung auf diesem meist unbekannten Terrain.
U8 (46.–48. Lebensmonat) Neben Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit sowie Reflexen, Muskelkraft und Zahnstatus werden hier besonders Sprache und Aussprache untersucht.
U9 (60.–64. Lebensmonat) Mehr und mehr rückt auch das soziale Verhalten der Kinder in den Fokus. Dabei sind die Kinderärzt*innen natürlich auf die Schilderungen der Eltern angewiesen.
U10/U11 (7.–8./9.–10. Lebensjahr) Diese neuen Gesundheitsuntersuchungen sollen die große Lücke zwischen U9 und J1 schließen. Entwicklungsverzögerungen und -störungen wie die Lese-Rechtschreib- und/oder Rechenschwäche sowie motorische Defizite, die sich häufig erst in der Schule manifestieren, sollen so frühzeitiger erkannt werden. Die U10 und U11 sind jedoch nicht gesetzlich vorgeschrieben und werden auch nicht von allen Krankenkassen erstattet.
J1 (13.–14. Lebensjahr) Möglicherweise wurde das Kind nun schon mehrere Jahre nicht mehr routinemäßig in der kinderärztlichen Praxis vorgestellt. Umso wichtiger ist es, sich den Themen Psyche, Pubertät, Schulleistungen sowie Rauchen, Alkohol und Drogen zu widmen.
J2 (16.–17. Lebensjahr) Auch die J2 wird nicht von allen Krankenkassen erstattet. Hauptthemen dieser dennoch wichtigen Vorsorgeuntersuchung sind Pubertät und Sexualität. Die Jugendlichen sollten informiert werden, dass sie hierbei auch ohne Eltern mit den Ärzt*innen ein vertrauensvolles Gespräch führen können.
ZAHNÄRZTLICHE VORSORGE
Können Sie sich noch an Ihren ersten Besuch beim Zahnarzt oder bei der Zahnärztin erinnern? Wenn ja, dann geht es Ihnen wie ganz vielen Menschen, die in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren geboren wurden: Ihre Eltern haben Sie nach heutigem Wissen zu spät das erste Mal in die Zahnarztpraxis geschleppt. Während es in früheren Generationen üblich war, erst dann mit Kindern hinzugehen, wenn sie Zahnschmerzen hatten, wissen wir heutzutage, wie wichtig eine frühe und regelmäßige Vorsorge der Zähne ist. Aber was bedeutet früh und was regelmäßig?
Im Durchschnitt bricht bei Säuglingen im Alter von sechs Monaten der erste Zahn durch. Aber Vorsicht! Wie so häufig in der Medizin handelt es sich auch hier nur um einen Richtwert. Kein Grund zur Panik also, wenn das Kind seinen ersten Geburtstagskuchen noch ohne mampfen muss. Auf der anderen Seite kommen manche Kinder sogar schon mit einem durchgebrochenen Zahn zur Welt. Aber egal wann er kommt, der erste Zahn sollte Anlass für den ersten Besuch in der zahnärztlichen Praxis sein.
Wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, ist so ein Besuch nicht unbedingt etwas Schönes. Selbst als Erwachsener lässt man sich nicht gerne am Backenzahn herumbohren oder eine Nadel ins Zahnfleisch stechen, um im Anschluss stundenlang weder Flüssiges noch Festes im Mund behalten zu können, weil der Mundwinkel nicht mehr das macht, was er soll. Auch kein Vergnügen ist das Bestimmen der Tiefe der Zahnfleischtaschen oder gar das Ziehen eines Zahnes. All das ist für ein Kind sogar noch dramatischer, schmerzhafter und auch unverständlicher. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ein Kind seine Zahnärztin oder seinen Zahnarzt nicht in einer dieser Situationen kennenlernt, weil es die Person und die dazugehörige Praxis dann in der Folge mit diesen Schmerzen und dem Gefühl des Ausgeliefertseins in Verbindung bringt. Vielmehr sollte bei den ersten Zahnarztbesuchen am besten gar nichts passieren – außer sich kurz in den Mund gucken zu lassen und dafür eine Belohnung abzuholen. Und wenn das Kind nicht einmal das zulässt, dann ist das auch nicht schlimm. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Aber so wird der Zahnarztbesuch nicht dämonisiert, sondern kann sogar etwas Freudiges sein. Fragen Sie bitte nicht, warum (denn wir wissen es nicht), aber Florians Tochter fragt in regelmäßigen Abständen, wann sie denn endlich wieder zum Zahnarzt gehen kann, und ist ganz traurig, wenn der nächste Besuch erst in einigen Wochen oder Monaten vorgesehen ist.
Damit der Zahnarzt oder die Zahnärztin im Laufe einer Kindheit (und auch im späteren Erwachsenenalter) möglichst wenig zu tun hat, müssen die Zähne natürlich regelmäßig und mit dem richtigen Werkzeug geputzt werden. Und es sollte auch naheliegend und eigentlich selbstverständlich sein, dass schon der erste Zahn ab seinem Erscheinen geputzt werden will.
Doch selbst beim Thema Zähneputzen und Zahnpasta gibt es heutzutage Empfehlungen, die man sich dreimal durchlesen muss, um die richtige Menge Fluorid ins Kind und auf den Zahn zu bekommen. Ausführlich kauen wir das Durcheinander aus Reiskörnern, Erbsen und parts per million in der dritten Säule durch, der Ernährung.
Der Akt des Zähneputzens selbst ist in den ersten Lebensjahren ein ständiges Auf und Ab. Mal ist es kaum zu glauben, wie brav das Kind mitmacht und sich einen Zahn nach dem anderen schrubben lässt. Und dann gibt es wiederum Phasen, in denen das Zähneputzen einem Ringkampf gleicht und man sich nur mit größter Anstrengung und einem gekonnten Griff wenige Sekunden erkämpfen kann, um mühselig zumindest einen Anflug von Zähneputzen zu erreichen.
Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen. Manche Kinder machen von Anfang an ausgesprochen gut beim Zähneputzen mit. Ja, angeblich gibt es diese Exemplare. Das andere Extrem sind Kinder, die jahrelang kein einziges Mal freiwillig Zähne putzen oder auch nur im Entferntesten so etwas wie Kooperation zeigen. Dieses Phänomen können wir immer wieder beobachten: ein Teufelskreis, bei dem die Fronten so verhärtet sind, dass irgendwann gar nichts mehr geht. Je mehr sich das Kind wehrt, desto vehementer wird es dazu gezwungen, sich die Zähne putzen zu lassen. Und je mehr das Kind sich wehren kann, weil es älter und kräftiger wird, desto fester ist der Griff, der ihm die Gegenwehr nehmen soll. Und irgendwann denken alle Beteiligten nur noch mit Sorge an die zwei Mal Zähneputzen am Tag.
Trotzdem ist gerade die Zahnhygiene nichts, wo man nach einigen Versuchen sagen kann: »Okay, das klappt wohl nicht. Wenn es so schwierig ist, dann lassen wir es halt bleiben.« Das hätte ausgesprochen dramatische Folgen für die Milchzähne und auch für die später nachfolgenden bleibenden Zähne.
Doch wie lässt sich dieses Zusammenspiel, bei dem es um die Zahngesundheit Ihres Kindes geht, verbessern oder von Anfang an optimieren?
Es gibt leider kein allgemeingültiges und bei jedem Kind anwendbares Patentrezept. Aber aus eigener Erfahrung wissen wir, dass folgende Aspekte hilfreich sind:
Sprechen Sie während des Zähneputzens mit Ihrem Kind. Oder singen Sie. Lenken Sie das Kind ab, so gut es geht.
Machen Sie Ihrem Kind die Laute vor, die Ihnen wiederum das Zähneputzen erleichtern. Bei »Hiiiiiiiiiiiii« werden die vorderen Zähnchen geputzt und bei »Ahhhhhhhhhh« die hinteren.
Setzen Sie sich realistische Ziele. Einem zweijährigen Kind drei Minuten lang die Zähne zu putzen, wird nicht möglich sein. Das ist aber auch nicht notwendig. Wenn Sie es geschafft haben, jeden der ein bis 20 Milchzähne nach KAI (Kaufläche-Außen-Innen) zu schrubben, haben Sie beide schon Außerordentliches geleistet.
Respektieren Sie außerdem die Tagesverfassung Ihres Kindes. Wenn es eigentlich im Großen und Ganzen ein ganz braves Zahnputzkind ist, sich aber heute partout nicht weiter die Zähne putzen lassen will, dann lassen Sie es gut sein. Einmal etwas weniger gründlich (oder vielleicht gar nicht!) geputzt zu haben, wird für die Zähne weniger Folgen haben, als wenn ein Kampf auf Biegen und Brechen Ihrer beider Zahnputzverhältnis belasten wird.
Lassen Sie es Ihr Kind wissen, wenn Sie in den letzten Zügen des Zähneputzens sind. Ihr Kind wird sich vielleicht etwas weniger wehren, wenn es so wie Sie weiß, dass nach den nächsten beiden Zähnen Schluss ist. Wenn das Ende nicht absehbar ist, reißt der Geduldsfaden wahrscheinlich etwas früher.
Elektrische Zahnbürsten können übrigens bereits in jungen Jahren eine erfrischende Abwechslung sein. Florians Kinder besitzen alle seit dem 2. Lebensjahr eine elektrische Zahnbürste. Darüber hinaus ist es für Kinder auch angenehmer, von einer elektrischen Zahnbürste fremdgeputzt zu werden, da der Bürstenkopf einfach nur sanft auf die Zähne gedrückt wird, als wenn eine Handzahnbürste im Mund hin und her und hin und her geführt wird und damit auch Stellen erreicht werden, die nicht angenehm sind (Gaumen, Wangentaschen).
Im Hause Babor stehen im Badezimmer vier verschiedenfarbige elektrische Zahnbürsten für die Kinder und daneben vier verschiedene Sorten Kinderzahnpasta. Das ist der Preis, damit sich alle ausnahmslos gutmütig und bereitwillig die Zähne putzen oder putzen lassen. Aber wehe, wenn Papa aus Versehen die Zahnbürsten mit der falschen Zahnpasta bestückt! Dann sind das Geschrei und der Protest groß, zumal die anderen drei Sorten Zahnpasta ja so unglaublich eklig schmecken. »Papa! Wie konntest du nur??« Ja, wie konnte er nur?? Aber leider hat Papa nur Medizin und nicht Zahnpastalogie und Bürstentechnik studiert.
AUGENÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN – DIE BRILLE ALS VERMEINTLICHE LAST UND BELASTUNG
Für viele Eltern ist der Gedanke, dass ihr Kind eine Brille tragen muss, schwer zu akzeptieren. Hinzu kommt noch die Angst, dass das Kind mit der Brille womöglich nicht einverstanden ist, sie nicht tragen möchte und so in der Familie ein neuer ständiger Kampf um das Tragen der Sehhilfe entsteht. Diese Sorge ist unserer Meinung nach aber in den meisten Fällen unberechtigt. Es kommt äußerst selten vor, dass ein Kind die eigene Sehstörung bemerkt und sich darüber bei den Eltern beschwert, da es den (verschwommenen) Blick auf seine Umwelt ja nicht anders kennt. Wenn das Kind dann jedoch einmal in den Genuss des scharfen Sehens kommt, merkt es sehr wohl, dass es von einer Brille profitiert, weil es – Überraschung – einfach besser sieht. Wenn Ihr Kind in der darauffolgenden Zeit die Brille freiwillig trägt, kann das fast schon als Verlaufskontrolle des Sehtests angesehen werden. Es geht sogar so weit, dass sich manche Kinder die Brille auch abends gar nicht mehr abnehmen lassen. Umgekehrt sollten Sie der Spur nachgehen, wenn Ihr Kind die Brille plötzlich nicht mehr tragen möchte. Vielleicht hat sich das Sehvermögen verändert, die Brille sitzt nicht mehr gut oder ist nicht mehr zentriert. Eine erneute Untersuchung der Augen sollte Abhilfe schaffen.
Alles in allem sollten Sie die Notwendigkeit einer Brille bei Ihrem Kind also als Chance sehen (!), sein Leben zu verbessern, und nicht als Bürde.
Und eine weitere Sache sei gleich vorweggenommen: Ja, es ist durchaus möglich, dass die Sehhilfe nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr notwendig ist und die Augenärzt*innen sie für überflüssig erklären. Sollten Sie diese Zeilen jetzt voller Hoffnung lesen und darauf warten, zu erfahren, was Sie tun müssen, damit sich das Sehvermögen wieder bessert, müssen wir Sie leider enttäuschen. Hier sind die Augen Ihres Nachwuchses zur Gänze auf Mutter Natur angewiesen. Es hilft also nicht, wenn Sie Ihr Kind zum Tragen einer Brille zwingen, weil Sie hoffen, dass dadurch »die Augen wieder besser werden«.
Aber der Reihe nach. Die erste Person, die Ihrem Kind sprichwörtlich tief in die Augen schaut, ist der Kinderarzt oder die Kinderärztin, der oder die die U2 am dritten Tag nach der Geburt durchführt. So früh wird schon geschaut, ob die Augen Ihres Kindes in Ordnung sind. Natürlich kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob das Kind kurz- oder weitsichtig ist. Auch das Schielen steht noch keineswegs im Zentrum des Interesses. Im Gegenteil, ein Kind, das zu diesem Zeitpunkt nicht schielt, wäre eher die Ausnahme. Äußere Auffälligkeiten wie sichtbares Herabhängen von Augenlidern, Augenzittern, Augapfel- oder Pupillenanomalien können jedoch auch bei neugeborenen Babys schon untersucht werden. Im Zuge dessen sollten bekannte Augenerkrankungen in der Familie von den Ärzt*innen erfragt beziehungsweise von den frischgebackenen Eltern angesprochen werden.
Wie war das? Kurzsichtig? Oder weitsichtig? Zeigen sich die Schwierigkeiten beim Lesen oder wenn ich in die Ferne schaue? Und hat nicht jemand einmal etwas von einem zu langen Augapfel erzählt? Wie kann das denn überhaupt sein?
Ganz genau! Die Länge des Augapfels bestimmt mein Sehvermögen. Das Ganze spielt sich natürlich nur im Zehntelmillimeterbereich ab, aber das genügt schon, um alles nur noch unscharf zu sehen. Ist der Augapfel genau richtig groß, dann sehe ich auch gut. Sowohl in unmittelbarer Nähe als auch in der Ferne. Wenn der Augapfel jedoch eine Spur zu lang ist, liegt der Brennpunkt des einfallenden Lichts vor der Netzhaut und liefert unscharfe Bilder aus der Ferne. Wir sprechen dann von Kurzsichtigkeit. Puh, was für ein Durcheinander. Aber wir merken uns: Kurzsichtig – Augapfel zu lang – Probleme mit der Ferne. Kurzsichtige können also Dinge aus kurzer Distanz gut sehen.
Dem gegenüber steht die Weitsichtigkeit. Sie haben richtig kombiniert. Dabei ist der Augapfel zu kurz und das Sehen naher Objekte ist beeinträchtigt. Weitsichtig – Augapfel zu kurz – Probleme in der Nähe. Das heißt, Weitsichtige können weit entfernte Objekte scharf sehen. Rätsel gelöst!
In jeder der darauffolgenden Vorsorgeuntersuchungen widmen sich die Mediziner*innen wieder den Augen des Kindes, und so wie das kindliche Sehen im Laufe der Lebensjahre immer besser wird, so werden auch die Untersuchungsmethoden immer aufwendiger und zeitgleich auch aussagekräftiger.
Der Gipfel der kinderärztlichen Sehuntersuchung wird bei der U5 erreicht, wenn ein sogenanntes Refraktometer zum Einsatz kommt, mit dem die Brechkraft des Auges geprüft werden kann. Was äußerst technisch und spektakulär klingt, ist für das zu untersuchende Kind erfreulicherweise gar nicht weiter aufregend. Es muss lediglich auf das Kinn gestützt in eine Art Schaukasten hineinschauen, in dem ein Luftballon, ein Auto oder andere für Kinder interessante Objekte gezeigt werden. Durch das Scharfstellen des Bildes lässt sich erkennen, wie viel Korrektur die Augen benötigen, um gut zu sehen.
Ein derartiges Refraktometer wird meist ab einem Alter von zwei Jahren eingesetzt. Da es heutzutage in den meisten Kinderarztpraxen vorzufinden ist, wird es teilweise sogar schon bei jüngeren Kindern angewendet. Das muss aber nicht unbedingt sein – auch wenn durch diese frühen Untersuchungen ganz selten Krankheitsbilder, die sich in jungen Jahren manifestieren, herausgefischt werden. Denn viele Fehlsichtigkeiten, die in den ersten beiden Lebensjahren auftreten, wachsen sich aus und benötigen keine Behandlung. Daher reicht eine Untersuchung ab dem 2. Geburtstag aus. Zudem ist der*die Untersuchende auch auf die Mitarbeit des Kindes angewiesen. Zwar entfällt der typische Augenarztdialog (»Ist es jetzt besser oder schlechter?«, »Besser«, »Und ist es jetzt besser oder schlechter?«, »Schlechter« usw.), dennoch muss das Kind zumindest so kooperativ sein, in das Gerät hineinzuschauen. Außerdem kann das Refraktometer nicht der Augenbewegung folgen. Das macht eine Untersuchung bei einem wehrigen oder unruhigen Kind fast unmöglich.
Als Florians Tochter mit dreieinhalb Jahren an der Schwelle zum Brillenträgertum stand und die erste Refraktometer-Untersuchung wegen mangelhafter Mitarbeit verschoben werden musste, hatte seine Frau wieder einmal die zündende Idee. Sie bastelte mit den älteren Geschwistern aus Pappkarton und Spielzeugautoreifen eine Heimversion des Refraktometers und stellte die Untersuchungsbedingungen zu Hause nach. Nachdem das Mädchen merkte, dass ihre größeren Geschwister unbedingt in diesen Kasten hineinschauen wollten und dabei den größten Spaß hatten, traute sie sich dann doch auch. Und weil die Kinder vom Spielzeugrefraktometer schließlich gar nicht mehr genug kriegen konnten, war die eigentliche Untersuchung in der Praxis dann auch kein Problem mehr.
Ein weiterer Unterschied zwischen kinder- und augenärztlicher Untersuchung ist das sogenannte Weittropfen. Dabei wird dem Kind vor der Untersuchung eine Flüssigkeit (Mydriaticum) ins Auge getropft, die die Pupille erweitert. So wird der Blick durch die Linse in das Auge erleichtert. Diese Flüssigkeit hat aber noch eine weitere Wirkung, die gerade bei der Untersuchung von Kindern unerlässlich ist: Der Lesemuskel wird lahmgelegt, wodurch das Kind nicht mehr akkommodieren, also scharfstellen, kann. Das kindliche Auge kann durch diesen Muskel nämlich einiges an Fehlsichtigkeit kompensieren. Für die Eltern ist dann vor allem zu beachten, dass die Wirkung dieses Medikaments noch einige Stunden anhält, die Kinder in dieser Zeit schlechter sehen (weil sie eben nicht scharfstellen können) und das Auge auch lichtempfindlicher ist.
Das Sehvermögen der Kinder wird heutzutage also durch uns Kinderärzt*innen sehr früh und regelmäßig überprüft. Dadurch werden Kinder bereits in jungen Jahren in die Augenarztpraxis überwiesen, was dann dem Sehvermögen zugutekommt. Aber was passiert genau bei auffälligen Befunden?
Die meisten Kinder sind im Vorschulalter etwas weitsichtig. Wenn das Kind nicht schielt und die Weitsichtigkeit 2,5 Dioptrien nicht überschreitet, kann das zunächst ohne die Verschreibung einer Sehhilfe beobachtet werden, da die Fehlsichtigkeit sich bis zur Einschulung wieder zurückentwickeln kann.
AUF EINEN BLICK
Fehlsichtigkeiten bei Kindern
Folgende Fehlsichtigkeiten können bereits in den ersten Lebensjahren bei Kindern erkannt werden:
- Weitsichtigkeit
- Kurzsichtigkeit
- Hornhautverkrümmung
- Ungleichsichtigkeit
- Fehlstellung
- Trübung
- Unterschied im Pupillendurchmesser
Im Falle einer Hornhautverkrümmung oder eines Seitenunterschiedes ist es jedoch wichtig, diese Ungleichheiten früh zu entdecken und vor allem zu korrigieren, damit die Sehbahn bestmöglich geschult wird. Unsere Augen bilden zwar die Umwelt ab, aber die Wahrnehmung davon findet in der Sehrinde des Gehirns statt. Ähnlich wie andere Nervenprozesse (das Sprechen, das Gehen, das Greifen) wird das Sehen in Kindheit und Jugend geschult und verbessert. Dies geschieht vor allem durch eine immer perfektere Verschaltung der Nerven. Wenn das Bild der Augen unscharf ist, dann kann auch die Sehrinde nicht perfekt funktionieren und wird nicht optimal verschaltet. Eine Brille korrigiert dieses unscharfe Bild, das an das Gehirn geschickt wird.
WANN UND WIE OFT ZUR AUGENUNTERSUCHUNG?
Wenn es eine familiäre Belastung gibt, die Eltern eine Brille tragen oder eine Schielbehandlung als Kind hatten, dann sollten Eltern ihr Kind schon mit sechs Monaten das erste Mal in der augenärztlichen Praxis vorstellen – spätestens aber zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr. Durch diese fachliche Eskalation von Kinderärzt*innen zu Augenspezialist*innen ist es möglich, sehr diskrete Störungen zu entdecken, die für das spätere Sehvermögen ausschlaggebend sein können. Je nach Ergebnis folgen dann Kontrollintervalle.
Brillentragende Kinder sollten zunächst alle drei Monate zur Kontrolle, um die Sehhilfe an die angesprochenen alters- und wachstumsbedingten Weiterentwicklungen anpassen zu lassen.
Nicht nur aus kosmetischen, sondern auch aus praktischen Gründen fragen viele Eltern und auch Kinder nach der Möglichkeit, Kontaktlinsen anstelle einer Brille zu tragen. Dies hängt von der Fähigkeit und Verlässlichkeit des Kindes ab. Allgemein gesprochen sind Kontaktlinsen ab dem 13. Lebensjahr geeignet.
INSIDERWISSEN
Kurzsichtigkeit und Tageslicht
Der Risikofaktor Nummer 1 für Kurzsichtigkeit: mangelndes Tageslicht! Die meisten Kinder sind in jungen Jahren weitsichtig.
Das ist in vielen Fällen als physiologisch – also normal – anzusehen und wächst sich häufig auch wieder aus.
In den letzten Jahren ist aber ein beunruhigender Trend zu beobachten: Immer mehr Menschen und vor allem auch Kinder werden kurzsichtig. Schätzungen besagen, dass im Jahr 2050 wahrscheinlich etwa die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig sein wird. Aber überraschenderweise liegt das nicht an Handy, Laptop, Tablet und Co. – zumindest nicht direkt.
Hauptursache und Risikofaktor Nummer eins ist ein Mangel an Tageslicht.
Der Blick auf das Handy oder den PC macht also nicht per se kurzsichtig, indirekt ist der Gebrauch moderner Medien und Spielekonsolen aber sicherlich mitverantwortlich, weil Kinder sich damit stundenlang in ihrem Zimmer verbarrikadieren.
Die eindeutige Empfehlung zur Vorbeugung von Kurzsichtigkeit lautet daher: raus ins Freie, zwei Stunden pro Tag! Denn in der unteren Hälfte der Netzhaut liegen Rezeptoren für Tageslicht. Wenn diese stimuliert werden, wird das Längenwachstum des Auges gestoppt. Und das wirkt sich dramatisch auf die Fähigkeit unserer Augen aus. Wenn das Auge nur um einen Millimeter zu lang ist, hat dies eine Kurzsichtigkeit von drei Dioptrien zur Folge!
Lesen wiederum (außer stundenlang unter der Bettdecke) ist gut für das Auge. Denn das Auge tut nun einmal eines am liebsten: sehen! Davon kann und soll es nicht genug bekommen.

Florian und seiner Frau fiel eines Tages auf, dass ihr ältester Sohn im Alter von sechs Jahren im Urlaub plötzlich schielte, obwohl er das nicht mehr getan hatte, seit er ein Baby gewesen war. Nicht nur die Eltern, sondern auch der kleine Junge waren sichtlich betroffen und beunruhigt. Ein Schielen aus heiterem Himmel in diesem Alter ist definitiv ein Warnsignal. Nach einer kurzen Schrecksekunde wurde aber des Rätsels Lösung gefunden: Um die heißen Mittagsstunden zu überbrücken, durfte der Junge auf dem Handy ein Spiel spielen. Wie so häufig bei Kindern hielt er das Gerät, gebannt vor Aufregung, immer wieder zu nah vor seine Augen. Diese mussten ihre Stellung zueinander daraufhin verändern, um das Vorgehen auf dem Handy nicht doppelt zu sehen. Und weil das Normalisieren der Stellung der Augen zueinander auch nach Spielende noch eine ganze Weile brauchte, schielte Florians Sohn auch ohne Handy vor der Nase noch fast eine Stunde weiter, bis sich sein Blick schließlich wieder normalisierte.
Gerade im 1. Lebensjahr werden Ärzt*innen und Hebammen immer wieder von besorgten Eltern konfrontiert: Sehen Sie sich an, wie mein Kind schielt! Ist das noch normal? Die Sorge ist zwar nachvollziehbar, kann in den meisten Fällen aber zunächst genommen werden.
Denn die gute Nachricht lautet: Bis zum Alter von 6 Monaten ist Schielen noch normal und gehört fast zum süßen Anblick von Säuglingen dazu. Die Augen kennen einander in dieser ersten Zeit noch nicht und müssen sich im wahrsten Sinn des Wortes erst aufeinander einstellen.
Sollte sich aber über das erste Lebenshalbjahr hinaus ein Schielen manifestieren, ist zunächst eine gründliche augenärztliche Untersuchung notwendig, in der die Fehlsichtigkeit bestimmt wird. In vielen Fällen kann nämlich eine Brille das Schielen schon korrigieren. Sollte es dafür jedoch zu ausgeprägt sein, muss gehandelt werden, denn sonst droht eine Amblyopie. Darunter versteht man die Schwachsichtigkeit eines Auges, die folgendermaßen zustande kommen kann: Wenn ein Auge schielt, ist es für das Sehen weniger nützlich, weil es aufgrund der Fehlstellung nicht das richtige, gewollte Bild abliefert. Das vom schielenden Auge projizierte Bild wieder herauszurechnen, ist für das menschliche Gehirn allerdings Arbeit, die es sich lieber ersparen würde. Deshalb wird dieses Auge grob vernachlässigt und darf sich nicht mehr am Sehen beteiligen. Das andere Auge muss hingegen alles kompensieren und wird zum Einzelkämpfer. Das Problem ist, dass eine derartige Benachteiligung des einen Auges nicht wiedergutzumachen ist, weil die Nerven nicht gut verschaltet werden und die Sehbahn verkümmert. Ab dem Schulalter ist dieser Prozess dann nicht mehr aufzuhalten. Versäumnisse haben dann Auswirkungen auf das ganze restliche Leben, beginnend mit der Schulzeit. Denn um eine »normale« Schule besuchen zu können, sind beispielsweise 40 Prozent Sehkraft auf beiden Augen notwendig. Eine adäquate Schielbehandlung und Förderung stellen also bereits früh die Weichen für das restliche Leben.
Hausapotheke bestücken – weniger ist mehr
Erst kürzlich war Florian wieder zu Besuch bei seiner Schwester in Österreich. Wie so oft verspürte er aufgrund der im Haushalt lebenden Katzen das unmittelbare und unwiderstehliche Bedürfnis, seine Reaktion auf sie mit einem antiallergischen Medikament zu bekämpfen. Mit Staunen stieß er auf die wohl umfangreichste Hausapotheke, die er je gesehen hatte. In einer großen Schublade standen rund 250 (!) Medikamente unterschiedlichster Herkunft und für verschiedenste Indikationen. Auch wenn Florians Schwester und ihr Mann Tierärzt*innen sind, so war das Ausmaß dieser Apotheke dennoch mehr als verblüffend. Als er auf Nasentropfen für Babys stieß, wurde er aber misstrauisch. Seine Nichte und sein Neffe waren schließlich schon erwachsen. Er nahm die Umverpackung aus der Schublade und bekam beim Blick auf das Ablaufdatum eine Antwort auf die Frage, wie man es schafft, dermaßen viele Medikamente zu horten: Das Mindesthaltbarkeitsdatum der Tropfen war der 18. Juli 2002 gewesen.
Um Ihre Apotheke zu Hause zeitgemäß (!), sinnvoll und zweckerfüllend auszustatten, sind nicht viele Medikamente und Utensilien notwendig. Die unserer Meinung nach wichtigsten haben wir im Folgenden zusammengefasst.
An erster Stelle steht auf jeden Fall das Fieberthermometer, ohne das sicherlich keine Hausapotheke und kein Haushalt auskommen können. Dennoch machen vor allem Väter geradezu einen Sport daraus, die Körpertemperatur des Nachwuchses per Kuss auf die Stirn oder durch Handauflegen auf die zweite Nachkommastelle genau zu schätzen. Natürlich bekommt man im Laufe der Jahre ein gewisses Gespür für die Hauttemperatur der eigenen Kinder, jedoch gibt es verschiedene Faktoren, die das subjektive Empfinden der Temperatur einer anderen Person beeinflussen: Warme Außentemperaturen im Sommer, eine warme Bettdecke oder auch Herumtoben haben Auswirkungen auf die oberflächliche Temperatur der Haut, nicht aber auf die Kerntemperatur, die letztendlich der aussagekräftige Wert ist.
Deshalb sollten Sie immer ein geeignetes Fieberthermometer zu Rate ziehen. Von den unterschiedlichen Produkten, die im Handel und in der Apotheke erhältlich sind, möchten wir Ihnen zwei ganz besonders ans Herz legen. Bei dem ersten handelt es sich um ein elektronisches Standardthermometer, das vor allem im 1. Lebensjahr bestens geeignet ist. In welchem Alter Sie welches Modell am besten einsetzen, erklären wir in Säule 2. Je nach Alter und vor allem Wehrhaftigkeit Ihres Kindes können diverse Modelle im wahrsten Sinne des Wortes fehl am Platz sein.
Jenseits des 1. Lebensjahres ist der äußere Gehörgang der ideale Ort, um die Körpertemperatur zu messen. Deshalb geht unsere zweite Empfehlung für den alltäglichen Gebrauch ganz klar in Richtung eines Ohrthermometers.
Wovon wir nur abraten können, sind althergebrachte Modelle mit Quecksilber. Hier kann es zu Funktionsstörungen oder zum Bruch des schützenden Gehäuses kommen, wobei das giftige Schwermetall austritt. Zwar nicht giftig, aber unserer Erfahrung nach sehr ungenau sind moderne Haut- bzw. Stirnthermometer. Die Ergebnisse sind alles andere als verlässlich und unterscheiden sich von anderen Methoden um mehrere Grad Celsius – nicht gerade das, was man beim Fiebermessen gebrauchen kann, denn um die Situation richtig einschätzen zu können, brauchen Sie zuverlässige Werte.
Neben dem Fieberthermometer sind, in logischer Konsequenz, fiebersenkende Medikamente ein zweites Must-have für jede Hausapotheke. Auch hier sollten Sie die dem Alters Ihres Kindes entsprechende Darreichungsform und Konzentration auf Lager haben. Wir meinen sogar, dass dies die einzigen Medikamente sind, die in keiner Hausapotheke fehlen sollten. Genau wie der Po bei Säuglingen der ideale Ort zum Fiebermessen ist, so ist er auch die beste Anlaufstelle, um ein Medikament gegen das Fieber zu verabreichen. Säuglinge und Kleinkinder sind schließlich noch nicht in der Lage, Tabletten zu schlucken, und auch Fiebersaft werden Sie in den ersten beiden Lebensjahren nur schwer in das Kind bekommen. Zwar können Sie den Saft mit einer Plastikspritze hinten in die Wangentasche applizieren. Aber je nach Tagesverfassung und Kooperationsbereitschaft des Kindes kann das auch leicht dazu führen, dass Sie das Kind und sich umziehen müssen, weil der Saft überall gelandet ist, nur nicht im Magen. Um das Thema Zäpfchen ist in der letzten Zeit ein regelrechter Glaubenskrieg entstanden. Nicht etwa, weil die Wirksamkeit oder die Daseinsberechtigung infrage gestellt wird, das keineswegs. Vielmehr geht es um die profane Frage, mit welcher Seite voran das »Torpedozäpfchen« in den Po geschoben werden soll. Auch diesem Thema widmen wir uns in Säule 2, im Kapitel über Fieber. Die Quintessenz ist überraschend!
Irgendwann ist jedoch bei jedem Kind ein Alter erreicht, in dem das Zäpfchen einen mit normalen Mitteln und Überredungskunst nicht mehr zu gewinnenden Kampf auslöst. Dann wiederum ist der süßliche Geschmack des Fiebersaftes so verlockend, dass dieser zur Darreichungsform Nummer eins wird.
Aber auch darüber hinaus gibt es einiges zu beachten. Analog dazu, wie Ihr Kind wächst, gedeiht und schwerer wird, verändert sich auch die notwendige Dosierung des fiebersenkenden Medikaments. Zugegebenermaßen können unterschiedliche Angaben zu Millilitern und Milligramm verwirrend sein. Aber keine Sorge, Sie müssen dafür nicht Medizin studiert haben. Abhilfe leisten natürlich zum einen die Kinderärzt*innen, die Ihnen eine Dosierung aufs Milligramm genau empfehlen und auch verschreiben werden. Oder Sie werfen einfach einen Blick auf die Verpackung. Auch hier finden Sie Angaben zur notwendigen Dosis. Um sie patientenfreundlich und übersichtlich zu gestalten, werden von den Pharmafirmen aber ganze Gewichtsklassen zusammengefasst und mit Dosierungen versehen. Das bedeutet auch, dass Ihr Kind im Zweifelsfall etwas mehr von dem Medikament vertragen könnte. Nicht selten werden wir in der Notfallpraxis damit konfrontiert, dass ein Kind trotz Fiebersaft oder -zäpfchen nicht entfiebert. Bei genauer Nachfrage stellt sich dann heraus, dass dem Kind nur zweimal am Tag 50 Prozent der möglichen Dosis gegeben wurde. Bei korrekter Anwendung (nämlich 100 Prozent drei- bis viermal täglich) hätte dem Fieber Einhalt geboten werden können.
Gerade bei Säuglingen und Kleinkindern sind Bauchschmerzen (oder das, was dafür gehalten wird) ein wichtiges Thema. Es lässt sich praktisch nicht zählen, wie oft ein Kind im Laufe seiner ersten Lebensjahre das Gefühl von Bauchschmerzen äußert. Meist stecken aber harmlose Ursachen dahinter, die für sich genommen keinerlei Krankheitswert haben. Dazu gehören Verstopfung, Hunger, schlechte Laune oder einfach nur ein quersitzender Pups. Je banaler und vermeintlich ungefährlicher ein Zustand ist, desto besser lässt er sich mit einer Riesenportion Zuneigung und Einfühlsamkeit, aber auch mit einer Bauchmassage mit Babyöl oder einer Wärmflasche bekämpfen. Sie sollten dies in Erwägung ziehen und ausprobieren, bevor die Medikamentenkeule geschwungen wird und vielleicht sogar Schmerzmittel verabreicht werden. Außerdem können Sie mit einer lauwarmen Tasse einer wohlerprobten Teesorte wie Kamille, Fenchel oder Anis das Bauch-Aua oftmals in den Griff bekommen.

Für kleinere Verletzungen und für die Erstversorgung größerer Wunden sollten außerdem folgende Materialien vorhanden sein:
- Desinfektionsmittel (mit und vor allem auch ohne Alkohol, da Ersteres bei offenen Wunden brennt wie Hölle!)
- sterile Kompressen
- Pflaster (verschiedene Größen)
- Mullbinden
- Wund- und Heilsalbe (z. B. Bepanthen)
- Schere
- Pinzette (für Splitter, Scherben etc.)
- Einmalhandschuhe
Mittlerweile gehört es in ganz Deutschland und Mitteleuropa im Sommer zur Normalität, dass man mindestens einmal von einer Zecke gestochen wird (ja, Sie haben richtig gelesen, es handelt sich um einen Zeckenstich und nicht um einen Zeckenbiss). Deshalb sollte ein geeignetes Werkzeug zur Entfernung von Zecken in keiner Hausapotheke fehlen. Ob Sie hierbei lieber mit einer Zange, einer Karte oder sogar einem dafür konzipierten Lasso (ja, das gibt es!) vorgehen, ist reine Geschmackssache. Sämtliche Variationen sollten bei fachgerechter Handhabung dafür sorgen, dass die Zecke restlos aus der Haut entfernt werden kann. Übrigens: Sollte noch ein kleiner Rest in der Haut verbleiben und dieser etwa bei einem sehr wehrigen Kind auch nicht so ohne Weiteres entfernbar sein, ist das kein Problem und kein Drama. Unabhängig von der vollständigen Entfernung der Zecke besteht jedoch die Möglichkeit, dass sie Borreliose überträgt. Deshalb sollte die Einstichstelle in den folgenden Wochen weiter beobachtet werden.Während man früher noch dachte, dass der verbliebene Kopf der Zecke mitsamt seinem Beißwerkzeug unerwünschte Wirkungen hat und noch weiter sein Unwesen treibt, wissen wir heute, dass der kleine Rest mit der Zeit von der Haut abgestoßen wird und unbedenklich ist.
Auch der Sonnenschutz ist bei Kindern jeden Alters ein Thema, das immer relevanter wird. Mittlerweile wissen wir um die potenziell schädliche Wirkung von UV-Strahlen, und die Haut der Kleinsten ist besonders empfindlich gegenüber Sonneneinstrahlung. Während im Kleiderschrank UV-Shirts und -Hosen für die sonnigen Tage am Wasserspielplatz oder am Strand nicht fehlen dürfen, ist auch eine altersgerechte Sonnencreme mit ausreichend hohem Lichtschutzfaktor unbedingt notwendig. Auch wenn Sie nicht gerade in der Südsee Ihre Elternzeit verbringen, sondern nur den Sommer auf Balkonien.
Ein weiterer treuer Begleiter in der Husten- und vor allem Schnupfensaison ist der Nasensauger. Säuglinge sind sogenannte Nasenatmer. Das heißt, sie sind – im Gegensatz zu größeren Kindern und Erwachsenen – in der Lage, während des Trinkens weiter durch die Nase ein- und auszuatmen. Das ermöglicht es ihnen, über den Zeitraum, in dem sie gestillt werden, angedockt zu bleiben und ungestört an der Brust oder Flasche zu saugen. Genau aus diesem Grund sind sogar kleinere Schnupfeninfekte für die Kleinen nicht nur unangenehm, sondern können sogar gefährlich werden, wenn die notwendige Trinkmenge über einen längeren Zeitraum nicht im Kind landet, weil es Probleme mit der Nasenatmung hat. Die einzige natürliche Art, sich des Rotzes zu entledigen, ist, ihn einfach hinauslaufen zu lassen. Das gelingt aber nur bei sehr flüssiger Beschaffenheit des Nasensekretes. Gerade bei zähem Rotz ist auch die Schwerkraft nicht in der Lage, die Nase zu befreien.
Dann ist ein Nasensauger Gold wert. In Form eines kleinen Miniaturblasebalges oder eines Schlauches mit Mundstück lassen sich ungeahnte Mengen von Rotz aus der Nase eines Säuglings herausholen. Wir raten zur Anschaffung eines Modells, dessen Unterdruck durch Saugen am Endstück des Utensils erzeugt wird. Hierdurch können Sie den Druck genau dosieren. Und keine Sorge, das zwischengeschaltete Reservoir verhindert, dass der Rotz direkt aus der Nase im Mund der Eltern landet.
Bei dem Modell mit Blasebalg ist der Druck deutlich schwieriger zu kontrollieren und es besteht die Gefahr, bei zu hohem Unterdruck kleinste Gefäße in der Nasenschleimhaut zu verletzen.
Zu den Geheimtipps, die in Florians Familie schon so manche schwierige Nacht doch noch beruhigen konnten, zählen Brustwickel und Heilwolle.
Brustwickel können aus Thymian, Zitrone oder Zwiebel selbst hergestellt oder im Drogerie- oder Supermarkt ready to go gekauft werden. Sie haben eine wundersam beruhigende und hustenlindernde Wirkung auf die in Mitleidenschaft gezogenen Atemwege von Babys und Kleinkindern und ermöglichen so wichtige Stunden Schlaf für das betroffene Kind, seine Eltern und die Geschwister.
Heilwolle hingegen hat einen ganz anderen Bestimmungsort. Aufgrund der fettigen Konsistenz und der Inhaltsstoffe hilft sie bei heftigen Irritationen und wunden Stellen im Windelbereich und lässt diese zügig abklingen. Der wichtigste Bestandteil, das sogenannte Lanolin, besitzt eine entzündungshemmende und zugleich pflegende Wirkung. Darüber hinaus wird die Wolle aufgrund der absorbierenden, wärmenden und juckreizlindernden Eigenschaften schon seit vielen Jahrhunderten als Hausmittel genutzt. Zu beachten ist, dass sie ohne weitere Cremes oder Zusätze angewandt und nicht direkt auf offene Wunden aufgetragen wird, da die Wolle sonst mit der Wunde verkleben kann.
In unseren Augen ist es nicht notwendig, darüber hinaus noch weitere Medikamente in der Hausapotheke vorrätig zu haben. Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Pharmaka wie Kortison, Antibiotika oder Ähnliches zum Einsatz kommen müssen. Zum anderen besitzen all diese Medikamente ein Ablaufdatum. Deshalb ist es zwar gut gemeint, aber nicht sehr hilfreich, wenn Sie sich bei der Geburt Ihres Kindes z. B. mit Kortisonzäpfchen eindecken (im Übrigen ein absolutes Notfallmedikament!), da Sie diese Jahre später gar nicht mehr verabreichen können, wenn Ihr Kind sie bei einem Pseudokruppanfall wirklich brauchen würde.
Von dieser Position ausgenommen sind natürlich Bedarfs- und vom Arzt verschriebene Medikamente, die zur Behandlung einer Erkrankung regelmäßig oder punktuell zum Einsatz kommen. Hierzu zählen antiallergische Medikamente, Nasensprays, Elektrolytlösungen und so weiter, die Ihrem Kind im Laufe der Jahre verschrieben werden.
Unabhängig vom Umfang der Hausapotheke sollten Sie aber unbedingt darauf achten, dass die Medikamente und Utensilien adäquat und professionell gelagert werden, das bedeutet, dass Sie für die Sammlung einen Ort finden, der dunkel, trocken und kühl ist. Vor allem aber sollte er unerreichbar für Kinder sein und so eine Selbstbedienung unmöglich machen. Das erreichen Sie am besten, wenn Sie ein abschließbares Schränkchen dafür verwenden. Das Badezimmer ist im Übrigen aufgrund der ständigen Feuchtigkeit ein denkbar ungünstiger Ort für eine Hausapotheke.