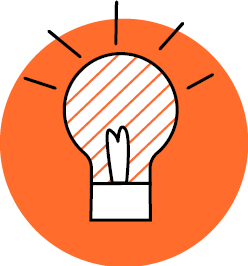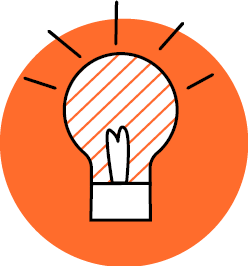Die Geburt – Bindung von Anfang an
Florians erste Tochter verbrachte die gesamte Schwangerschaft in Beckenendlage. Das Kind liegt dabei »verkehrt herum«, das Köpfchen zeigt also nach oben, die Beinchen nach unten. Eine Geburt, bei der das Kind »richtig herum«, also in Schädellage liegt, ist kalkulierbarer und sicherer als eine Entbindung aus der Beckenendlage. In Schädellage kommt das Köpfchen zuerst, und da das der Körperteil mit dem größten Umfang ist, folgt der Rest in der Regel gut nach. Wenn aus Beckenendlage die schmalere untere Körperhälfte durch die engste Stelle des Geburtskanals getreten ist, sagt das noch wenig darüber aus, ob auch das Köpfchen da hindurchpasst. Es besteht dementsprechend ein erhöhtes Risiko, dass das Kind in gefährlicher Weise »stecken bleibt«. Deshalb traut sich kaum eine Geburtsklinik heutzutage noch zu, ein Kind aus dieser Beckenendlage zu entbinden, da es viel Erfahrung und – im wahrsten Sinne des Wortes – Fingerspitzengefühl benötigt, die nötige Ruhe zu bewahren und eine derartige Geburt zu ermöglichen. Als Florians Frau dann eines Tages ein verdächtiges Ziehen im Unterleib bemerkte, taten die beiden dies zunächst als sogenannte Übungswehen ab. Im weiteren Verlauf wurde das Ziehen jedoch regelmäßiger und auch schmerzhafter. Und es dauerte fast eine Stunde, bis Florian und seine Frau realisierten, dass die Kombination aus Beckenendlage und regelmäßigen Wehen aus oben genannten geburtsklinischen Gründen bedeutete, dass ihre Tochter noch am selben Tag per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden würde. Ein eigenartiges Gefühl. Kein Abwarten, ob sich die Wehen vielleicht wieder beruhigen würden, keine Hausmittelchen, um die bevorstehende Geburt Tage oder gar Wochen hinauszuzögern. Sie wussten: Wenn sie jetzt die Klinik betreten würden, wäre der OP vorbereitet und sie würden noch heute Eltern eines kleinen Mädchens. Eines sehr kleinen Mädchens, da für Florians Frau gerade erst die 36. Schwangerschaftswoche begonnen hatte und das Kind somit als Frühchen fünf Wochen zu früh zur Welt kommen würde. Und so geschah es dann auch.
Das Mädchen kam zu Beginn der 36. Schwangerschaftswoche zur Welt und wog nur 2550 Gramm. Die Grenze dafür, dass ein Kind in der Kinderklinik überwacht werden muss, lag in der Geburtsklinik, die Florian und seine Frau ausgewählt hatten, bei 35 Schwangerschaftswochen und 2500 Gramm. Denkbar knapp also. Dennoch bedurfte es einiger Überredungskünste und vor allem der Tatsache, dass Florian erfahrener Kinderarzt war, dass das Kind doch mit den frischgebackenen Eltern zurück in den Kreißsaal und die ersten Stunden und Tage auf Mama ruhend ankommen durfte.
Die ersten Stunden waren durch häufige Blutzuckermessungen und die fortwährende Diskussion der erhobenen Werte aber dennoch nervenzehrend. Immer wieder wurde ein Piks und das damit verbundene Legen eines Zugangs angedroht. Darüber hinaus sollte bei weiterer Verschlechterung des Allgemeinzustandes eine zuckerhaltige Infusion verabreicht und so der niedrige Blutzucker ausgeglichen werden. Letztlich gelang es Florians Frau und seiner Tochter jedoch, durch frühzeitiges Anlegen und Aktivieren des Saugreflexes sowie kurzfristiges, vom Kind unbemerktes Zufüttern von Säuglingsnahrung (über einen kleinen Schlauch während des Saugens an der Brust) den so wichtigen Blutzuckerwert über das notwendige Maß zu heben. So konnte letztendlich doch noch eine weitestgehend ungestörte Anfangszeit ohne räumliche Trennung ermöglicht werden.
Vierzig Wochen lang haben werdende Eltern Zeit, sich auf die bevorstehende Geburt vorzubereiten. Aber wie an Florians Geschichte zu erkennen ist, kommt es dann doch oft anders, als man denkt. Oder hofft. Vierzig Wochen, die gerade am Anfang wie eine Ewigkeit erscheinen. Retrospektiv haben aber viele junge Eltern den Eindruck, dass sogar noch mehr Zeit gut gewesen wäre, um sich noch besser auf das große Unbekannte vorbereiten zu können. So vieles will geplant und durchorganisiert, das Nestchen zu Hause (um-)gebaut und der eigene Mikrokosmos auf das weitere Familienmitglied bestmöglich vorbereitet werden. Und dann ist es plötzlich schon so weit. Das Kind erblickt das Licht der Welt, manchmal vollkommen überraschend, weil der errechnete Geburtstermin eigentlich noch ein paar Wochen entfernt wäre oder weil es für den unvorhergesehenen Blasensprung keine Anzeichen dafür gab. Es kann alles so schnell gehen, dass der Papa in spe noch den Parkplatz sucht, während bereits die ersten Presswehen kommen. Manchmal schlendern Mama und Papa aber auch noch stunden- oder tagelang um die Geburtsklinik herum und zählen die Minuten, bis es so weit ist.
Für das Neugeborene passiert das alles nicht minder überfallartig. Und was sich dann abspielt, ist wohl der erste große Kulturschock unseres Lebens. Zwar wird es in den letzten Tagen immer enger in Mamas Höhle, aber trotzdem gibt es wohl keinen schöneren Platz auf dieser Welt. Vom wohlig warmen, lärmgeschützten, stoßsicheren Bauch, begleitet von den regelmäßigen Herzschlägen und Atemzügen der Mutter, wird das Kind mit einem Mal in die grelle, vergleichsweise kühle, laute und ungewohnte Welt hineingeboren. Nach 40 Wochen Dunkelheit blendet nun die Leuchtstoffröhre des Kreißsaals, nach gemütlichen 37 Grad Körperwärme kommt es zum Temperatursturz um 15 Grad und mehr. Sämtliche Geräusche und Schallwellen wurden zuvor vom umgebenden Fruchtwasser abgedämpft, und jetzt piept und knallt und scheppert es plötzlich in jeder Ecke.
Nun sind die Regulationsmechanismen des Kindes gefragt, um in der neuen Umgebung anzukommen und sich daran anzupassen. Dabei benötigt das Neugeborene gerade zu Beginn die Unterstützung seiner Umwelt, vor allem der Eltern oder engsten Bezugspersonen.
Je besser wir es schaffen, dem Neugeborenen etwas von dem Gefühl und der Geborgenheit der Zeit im Mutterleib zurückzugeben, desto besser wird es in der Welt ankommen. Hier wirkt der direkte Hautkontakt mit den Eltern unmittelbar nach der Geburt Wunder. Bevor irgendetwas gemacht wird – etwa die Herzfrequenz gemessen, das Kind gewogen oder ein Stempelabdruck vom Babyfüßchen angefertigt –, sollte das Neugeborene der Mutter nackt auf die Brust gelegt werden, damit beide einander spüren und das sogenannte Bonding genießen können.
Wir können an dieser Stelle gar nicht genug betonen, wie wichtig das Bonding in der ersten Lebensphase des Kindes ist. Viele wissenschaftliche Studien haben sich mit diesem Thema beschäftigt und kommen zu dem Schluss, dass der enge Hautkontakt zwischen Mutter und Kind zur Verbesserung der physiologischen Parameter beim Kind (wie Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung, Atem- und Herzfrequenz) beiträgt, die Bindung und das emotionale Erleben der Eltern verstärkt und zur Förderung des Stillens führt. Außerdem kommt es zu einer messbar geringeren Stressbelastung und zu höherer Zufriedenheit bei den Müttern. Das gilt nicht nur unmittelbar nach der Geburt, sondern trifft auch für jede weitere Stunde zu, die so innig verbracht wird. Besonders hervorzuheben ist auch das sogenannte Känguruhen, das bei frühgeborenen Kindern einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt. Dabei darf das Baby ohne Kleidung, nur mit einer Windel, auf der nackten Brust von Mama oder Papa liegen und Liebe und Wärme tanken.

Auch das Bonding mit dem Vater, wie es bei der Geburt von Florians Sohn praktiziert wurde, hat bewiesenermaßen ähnlich positive Effekte wie bei Müttern. Auch Männer sind weniger ängstlich, finden sich schneller in ihrer Rolle als Vater zurecht und neigen weniger zu Depressionen. Und bei den mit dem Vater in Hautkontakt tretenden Neugeborenen zeigten sich in Studien ebenfalls stabilere Herzfrequenzen und Körpertemperaturen, außerdem kürzere Weinphasen und das Stillen begann deutlich früher als in der Kontrollgruppe.
Während Mutter und Kind unmittelbar nach der Geburt ein ganz besonderes Wiedersehen und -spüren feiern, geschieht etwas Bemerkenswertes: Diese kleinen, vermeintlich hilflosen Wesen schaffen es nun, über reflexartige Reaktionen von selbst die Brust der Mutter zu finden, und unternehmen ihre ersten Saugversuche, ohne dass es ihnen jemals gezeigt wurde. Diese Versuche sind wiederum der Auslöser für eine ganze Reihe an Stoffwechsel- und Hormonvorgängen, die dazu beitragen, dass die Mutter das Bindungshormon Oxytocin ausschüttet. Oxytocin hat schon während der Geburt dafür gesorgt, dass sich die Gebärmutter immer wieder kontrahierte, somit also Wehen ausgelöst, und nun stimuliert es den Milcheinschuss. Darüber hinaus bewirkt das Hormon auch weiterhin ein Zusammenziehen der Gebärmutter, das zur Plazentaabstoßung führt.
Wie wichtig die vollständige Abstoßung der Plazenta ist, musste Florians Frau leider am eigenen Leib erfahren. Gleichzeitig zeigt die folgende Geschichte, dass die heile Welt nach einer Vorzeigegeburt doch recht abrupt gestört werden kann. Umso wichtiger ist es, dem Neugeborenen trotzdem die nötige Nähe zu einem Elternteil zukommen zu lassen und auch Papas nackte Brust eignet sich zum Bonding unmittelbar nach der Geburt.
Zunächst lief alles nach Plan. Vom Auftreten der ersten Wehen über die ruhige Fahrt ins Krankenhaus und ein beruhigendes Bad im Kreißsaal für die erfahrene Mutter bis hin zur natürlichen Entbindung ihres Sohnes in der 40. Schwangerschaftswoche lief alles reibungslos. Der Kleine wurde der nun Vierfach-Mama auf die Brust gelegt, daneben stand ein glückseliger Papa, und die stolzen Eltern konnten ihr Glück ein weiteres Mal kaum fassen.
Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Etwa eine Stunde nach der Geburt berichtete die immer blasser werdende Mutter von Übelkeit und Schwindel. Die Hebamme, die unterdessen schon zur nächsten Geburt geeilt war, wurde schnell zurückgerufen. Sie erkannte umgehend, was los war. Innerhalb von Minuten wurde klar, dass Florians Frau notfallmäßig in den OP musste, damit die Blutung, die ein unbemerkt verbliebener Plazentarest verursachte, durch eine Ausschabung gestillt werden konnte. Es ging alles sehr schnell, und Florian fand sich wenige Minuten später mit seinem neugeborenen Sohn auf dem Arm allein im Kreißsaal wieder, während seine Frau im OP auf den Eingriff vorbereitet wurde.
Im Falle sogenannter Plazentareste verbleibt ein mitunter verschwindend kleines Stückchen der Plazenta in der Gebärmutter und wird dort weiterhin über kleinste Gefäße mit Blut versorgt. Eine solche Situation führt zu immer wiederkehrenden Blutungen. Zur Vermeidung eines chronischen Blutverlustes müssen die Reste daher schnellstmöglich operativ entfernt werden.
Doch damit fing der Albtraum erst richtig an. Nach einer gefühlten Ewigkeit betrat die Hebamme mit dem Anästhesisten, der die Narkose überwachte, den Raum, in dem Florian mit seinem Sohn ausharrte. Mit besorgtem Blick erzählte der Narkosearzt, dass die frischgebackene Mutter offensichtlich eine seltene Unverträglichkeit gegenüber einem Narkosemedikament habe, denn sie könne nicht aus dem künstlichen Koma geweckt werden. Die Unverträglichkeit beruhte auf einem seltenen genetisch bedingten Mangel des Enzyms Butyrylcholinesterase, an dem Florians Frau bis dahin unbemerkt gelitten hatte. Durch diesen Enzymmangel konnte sie das Narkosemedikament nicht abbauen und deshalb keinen ihrer Muskeln, auch nicht die, die sie zum Atmen brauchte, selbstständig bewegen. Dauer? Unbekannt. Vielleicht Stunden, vielleicht Tage. Äußerlich gefasst und innerlich in absoluter Panik nahm Florian diese Worte zur Kenntnis. Die Katastrophenfantasien, die während der nächsten Stunden unentwegt durch seinen Kopf schossen, hatten nichts mit dem zu tun, worauf er und seine Frau sich die letzten neun Monate vorbereitet hatten.
Florians Frau berichtete später, dass sie teilweise wach und bei Bewusstsein gewesen war und hören konnte, was um sie herum geschah. Unter anderem die vehementen Aufforderungen, Luft zu holen, damit ihre Beatmung beendet werden konnte. Sie konnte aber weder Luft holen noch etwas sagen, weshalb sie erneut in ein künstliches Koma versetzt wurde. Erst Stunden später, als das Medikament langsam, aber sicher ihren Körper verlassen hatte, konnte sie wieder eigenständig atmen und ihre Muskeln bewegen. Erst dann wurde sie zurück auf die Geburtsstation verlegt und das Leben als sechsköpfige Familie konnte endlich richtig beginnen. Bei allem Schrecken, den dieser Tag mit sich brachte, konnten der Neugeborene und sein Papa eine ganz außergewöhnliche, wenn auch nicht unbeschwerte Exklusivzeit miteinander verbringen.
Übrigens: Die Butyrylcholinesterase ist Ihnen, liebe Leser*innen, keine Unbekannte mehr. Sie erinnern sich? Es handelt sich dabei um das Enzym, dessen Aktivität auch bei Kindern mit Plötzlichem Säuglingstod signifikant verringert war, es spielt aber auch in der Narkosemedizin eine wichtige Rolle. Der Enzymmangel wird weitervererbt, sodass es möglich ist, dass auch eines von Florians Kindern den Mangel aufweist. Glücklicherweise sind alle vier über das SIDS-typische Alter hinaus. Dennoch macht es Sinn, die Kinder bei Gelegenheit auf das Enzym zu testen, um später bei eigenen Kindern diesen Risikofaktor miteinschätzen zu können.
Zurück zur Ablösung der Plazenta. Nicht nur ein drohender Blutverlust macht Plazentareste zu einer gefährlichen Angelegenheit, sie sind auch eine Infektionsquelle. Letzteres kann sich zum sogenannten Kindbettfieber entwickeln, einer gefürchteten Infektion, die noch bis ins 19. Jahrhundert hinein als Hauptursache einer übermäßigen Sterblichkeit bei Wöchnerinnen war. Durch die Verbesserung der hygienischen Standards auf Geburtsstationen, die Entwicklung von Antibiotika und das stetig wachsende medizinische Wissen von Ärzt*innen und Geburtshelfer*innen wurde diese schwere Komplikation erfreulicherweise zur Seltenheit.
Eingangs haben wir bereits das Hormon Oxytocin erwähnt, das dafür sorgt, dass der Milchfluss angeregt wird. Eine weitere Wirkung von Oxytocin sind Stressabbau und Entspannung. Das gelingt, weil das Hormon den Blutdruck reguliert und den Cortisolspiegel im Blut positiv beeinflusst. Nicht umsonst wird es auch das Kuschelhormon genannt – es bewirkt ein Gefühl der Bindung zwischen Menschen, auch Erwachsenen, besonders aber zwischen Mutter, Vater und Kind. Insgesamt erzeugt Oxytocin ein Wohlbefinden, das gerade in der ersten Zeit nach der Geburt dringend nötig ist und sich beim Kind sogar auf das spätere Bindungsverhalten auswirkt.
Aber es passieren noch mehr wundersame und wichtige Dinge nach der Geburt. Durch die Ausschüttung des Oxytocins kommt es, wie schon erwähnt, überhaupt erst dazu, dass der erste Tropfen Muttermilch unmittelbar nach der Geburt fließt. Diese auch »Kolostrum« genannte Frühmilch ist ein weiteres Wunderwerk der Natur. Und der Kreis schließt sich, wenn durch das Saugen des Kindes an der mütterlichen Brust noch mehr Oxytocin freigesetzt wird.
Kolostrum ist die erste Milch, die das Baby nach der Geburt (vom 1. bis zum 5. Tag) aufnimmt. Sie unterscheidet sich maßgeblich von reifer Muttermilch, die nach dem Kolostrum gebildet wird. Sie wird in den Brustdrüsen gebildet und spielt eine wichtige Rolle beim Aufbau des Immunsystems. Zwar beinhaltet das Kolostrum weniger Fett, Zucker (konkret den Milchzucker Laktose) und Energie, jedoch deutlich mehr Proteine, HMOs (Humane Milch-Oligosaccharide) und Vitamine. Wenn möglich, sollte diese Milch in jedem Fall aufgefangen werden. Selbst wenn die frischgebackene Mutter nicht stillen möchte oder das Stillen in diesen ersten Tagen nicht klappt, kann Kolostrum von Hand abgepumpt und über einen Sauger verfüttert werden. Die Proteine, Vitamine, Mineralien und Immunglobuline (Antikörper), die zu einem ersten Aufbau des Immunsystems des Babys beitragen, haben immensen Wert für das Neugeborene. Wegen seiner satten goldenen bis bräunlichen Farbe (die unter anderem durch den hohen Gehalt an Betacarotin hervorgerufen wird) und seiner wertvollen Vorteile wird es oft als »flüssiges Gold« bezeichnet.
Diese ersten Stunden und Tage prägen also die Beziehung zwischen Kind und Eltern auf besondere Art und Weise. Wie wir am Beispiel von Florians viertem Kind gesehen haben, kommt es aber immer wieder zu Situationen, die diese Zwei- oder Dreisamkeit nicht zulassen. Wenn Kinder deutlich vor dem errechneten Termin zur Welt kommen und deshalb noch mit einer Anpassungsstörung zu kämpfen haben, Atemunterstützung brauchen oder Medikamente wie Antibiotika gegen bedrohliche Infektionen, ist möglicherweise eine pädiatrische, oft sogar intensivmedizinische Behandlung unumgänglich. Sie darf natürlich nicht zugunsten des Bondings aufs Spiel gesetzt werden. Die Folgen könnten lebensbedrohlich sein.
Als Kinderärzte empfehlen wir grundsätzlich, eine Klinik für die Entbindung auszuwählen, in der es eine Kinderstation gibt. Wir finden einfach, dass es kein übertriebenes Maß an Sicherheit ist, auf Kinderärzt*innen zurückgreifen zu können, wenn das Kind unmittelbar nach der Geburt unvorhergesehenerweise doch medizinische Unterstützung braucht. Wir haben es schon oft genug erlebt, dass eine Komplikation aus heiterem Himmel eintrat. Darüber hinaus sollten Sie sich bereits in der Schwangerschaft bei der Besichtigung der potenziellen Geburtsklinik oder der Kreißsaalführung erkundigen, wie nahe die dazugehörige Kinderklinik ist. Ist sie mehrere Gebäude entfernt, kann das für die Mutter nach einem Kaiserschnitt möglicherweise zu einer unüberwindbaren Hürde werden. Liegen Frauen- und Kinderstation aber Tür an Tür, sollte der Weg problemlos zu bewältigen sein.

Umgekehrt sollten aber auch keine unnötigen Maßnahmen diesen prägenden Beginn der emotionalen Beziehung zwischen einem Säugling und seinen Eltern stören. Um notwendige Interventionen von aufschiebbaren sensibel unterscheiden zu können, bedarf es der Betreuung durch eine erfahrene Hebamme oder ein erfahrenes Geburtshilfe-Team. Aber auch Eltern haben bis zu einem gewissen Punkt ein Mitspracherecht und können zumindest einfordern, dass ein Kind nur im äußersten Notfall räumlich von ihnen getrennt wird.
Das »Sauberrubbeln« des Kindes beispielsweise ist kein Notfall und kann ohne Probleme im Beisein der Eltern erfolgen oder aufgeschoben werden. Das Neugeborene kann unmittelbar nach der Geburt zwar durchaus einen wüsten Anblick bieten, das ist aber kein Grund zur Sorge. Abhängig von der Geburtswoche, in der das Kind zur Welt kommt, ist es mal mehr, mal weniger mit der sogenannten Käseschmiere bedeckt. Je vorzeitiger eine Geburt eintritt, desto dicker ist die Schicht. Dazu kommen, je nach Geburtsmodus, Blut und natürlich reichlich Fruchtwasser. Doch das kann erst einmal genau so gelassen werden, wie es ist. Was das Baby jetzt viel dringender braucht, sind der mütterliche Duft, ihr vertrauter Herzschlag und ihre Wärme.
INSIDERWISSEN
Vernix caseosa oder Käseschmiere
Bei der Geburt ist ein Baby von einer wächsernen, weißlichen Schicht umhüllt, der Vernix caseosa. Diese natürliche »Hautcreme« besteht aus wasserhaltigen Hautzellen, die in eine Lipid(Fett)-Matrix eingebettet sind, und hat vor, während und nach der Geburt wichtige Aufgaben. Sie vermag die Haut des Neugeborenen zu schützen und erleichtert deren Anpassung an das Leben außerhalb der Gebärmutter in der ersten Woche nach der Entbindung. Darüber hinaus ist sie eine wichtige Barriere gegen Wasserverlust sowie Teil der Temperaturregelung und der angeborenen Immunität. Deshalb sollte dieser natürliche weiße, cremige Biofilm aus dem letzten Trimester der Schwangerschaft nach der Geburt keinesfalls vorschnell abgewaschen oder abgerubbelt werden.

Daneben gibt es da noch weitere Vorgänge, Diagnosen und Therapien, die sich in einer Grauzone bewegen. Einerseits ist bei ihnen die Behandlung durch Kinderärzt*innen notwendig, andererseits erfordern sie aber nicht unbedingt die Trennung der frischgebackenen Familie. Ein Beispiel ist die Neugeborenengelbsucht (Ikterus neonatorum). Überschreitet der gelbe Blutfarbstoff (Bilirubin) einen gewissen Wert, so versuchen wir diesen durch künstliche UV-Bestrahlung in seine Bestandteile zu zerlegen, damit er ausgeschieden werden kann. Ansonsten drohen bei weiterer Ansammlung von Bilirubin vor allem im Gehirn Schäden (Kernikterus). Die UV-Therapie wird über mehrere Stunden bis Tage verabreicht, ist aber für sich genommen kein Grund, das Kind nicht weiterhin in der Nähe der Mutter zu belassen, um Stillen und Bonding zu ermöglichen. Denn wenn das Kind für diese UV-Therapie in ein anderes Gebäude, z. B. die Kinderklinik, verlegt wird, werden wichtige verbindende und prägende Momente verhindert. Das Gleiche gilt für Flüssigkeitsinfusionen gegen Unterzuckerung, die gefürchtete neonatale Hypoglykämie. Erfreulicherweise verfügen viele Kliniken heutzutage über ein räumliches Konzept, das der Mutter-Kind-Beziehung Rechnung trägt und derartige Behandlungen interdisziplinär von Kinder- und Frauenärzt*innen gemeinsam und somit ohne räumliche Trennung ermöglicht.
DIE NEONATALE HYPOGLYKÄMIE ERKLÄRT
In der Gebärmutter wird das ungeborene Kind kontinuierlich über das mütterliche Blut mit Zucker versorgt. Mit der Geburt und der Abnabelung bricht diese Versorgung plötzlich und abrupt ab, das Neugeborene muss sich in der Folge anpassen und seine eigene Glukoseversorgung mithilfe von Nahrung sicherstellen. Neugeborene benötigen in den ersten Lebenstagen fast ihre gesamten Glukosevorräte für das Gehirn.
Aber selbst bei optimaler Anpassung nach der Geburt kann der Blutzuckerspiegel bei gesunden Neugeborenen innerhalb der ersten Lebensstunden niedrig sein.
Er steigt danach üblicherweise langsam, aber stetig an und bleibt bis etwa 48 Lebensstunden nach der Geburt stabil, bevor er weiter ansteigt und am vierten Lebenstag ein neues Plateau erreicht.
Ungefähr 15 Prozent der Neugeborenen bekommen zumindest vorübergehend eine Unterzuckerung, Hypoglykämie genannt, die meisten davon in den ersten 24 Stunden nach der Geburt. Bleibt die Unterzuckerung unbehandelt und weiter bestehen, kann dies jedoch schwere akute und langfristige gesundheitliche Folgen für die Entwicklung des Gehirns haben. Oft verursacht die Hypoglykämie keine sichtbaren Symptome, kann aber auch durch subtile Beschwerden wie Zittrigkeit oder ein Gefühl der Schwäche bis hin zu schweren Symptomen wie Atemaussetzern und Krampfanfällen gekennzeichnet sein.
Aus diesem Grund sind routinemäßige Blutzuckerbestimmungen bei Risikokindern notwendig. Dazu zählen Kinder, die für ihr Alter zu schwer oder auch zu leicht sind, Frühgeborene, Kinder von zuckerkranken Müttern und Kinder, die mit einer anderen Grunderkrankung oder Beeinträchtigung zur Welt gekommen sind. Hauptziel ist es, eine Unterzuckerung beim Neugeborenen zu erkennen und schnellstmöglich durch eine Anpassung der Nahrungsmenge oder durch eine Infusion zu behandeln!
Der erste Kontakt mit uns Kinderärzt*innen nach der Geburt findet in den meisten Fällen im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen statt. Allerdings normalerweise erst bei der U2, da die erste Vorsorgeuntersuchung direkt nach der Geburt in der Regel von Hebammen bzw. Geburtshelfer*innen oder Frauenärzt*innen vorgenommen wird. Aber auch dieser Kontakt kann unterschiedlich ausfallen: Im Idealfall kommen nette und einfühlsame Kinderärzt*innen für die U2 ins Zimmer gestiefelt, um die Untersuchung auf der dort vorhandenen Wickelvorrichtung vor den Augen von Mama und Papa durchzuführen. Deutlich ungünstiger und sogar eine erhebliche Belastung für die junge Familie ist es, wenn das Kind dafür in den Kindersaal oder sogar in die Kinderklinik transportiert werden muss. Denn dafür muss das Kind erst einmal angezogen werden, dann über den kalten Krankenhausflur (oder sogar nach draußen in ein anderes Gebäude!) geschoben oder getragen werden, um, am Ziel angelangt, seiner oder ihrer medizinischen Hoheit auf dem Präsentierteller vorgelegt zu werden. Nach erfolgter Audienz (also der U2) darf sich das junge Glück wieder auf den gleichen beschwerlichen Rückweg machen.
Die Schilderung mag etwas übertrieben sein. Aber wirklich notwendig ist eine derartige Odyssee in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr. Gerade Geburtskliniken sollten alles dafür tun, dass das Neugeborene und seine Eltern so schonend wie möglich behandelt werden und sämtliche überflüssigen Belastungen vermieden werden.
Für viele Patient*innen kann der Krankenhausaufenthalt meist gar nicht kurz genug sein. Sobald es auch nur den Funken einer Entwarnung bei diagnostischer Abklärung oder die Entwöhnung von Infusion und Schmerzmitteln nach einer Operation gibt, drängt es viele sofort nach Hause. Das ist grundsätzlich auch nachvollziehbar. Die vertraute Umgebung, ruhigere Stunden nachts und fast immer besseres Essen sind natürlich verlockend. All das trägt meist auch sicherlich zur weiteren Genesung bei, wenn medizinisch vertretbar. Nach den Strapazen einer Geburt kann das aber auch anders sein.
INSIDERWISSEN
Die Kliniktasche für die Geburt
Dokumente
- Mutterpass
- Personalausweis
- Versicherungskarte
Kleidung
- altes, weites T-Shirt, das schmutzig werden kann
- dicke Socken
- Bademantel
- bequeme Kleidung, weit und locker (v. a. nach Kaiserschnitt benötigt)
- mehrere Nachthemden
- Still-BH
Sonstiges
- ausreichend Snacks und Getränke
- Kaugummis, Bonbons
- Ladekabel
- (Klein-)Geld

Denn so eine Geburt lässt im Familienleben erst einmal keinen Stein auf dem anderen. Vor allem für Mutter und Kind ist es ein übermenschlicher Kraftakt. Und auch der Vater, wenn auch von der Natur am wenigsten gefordert, macht so einiges mit. Unter Umständen sind daher das Kennenlernen, das Baby-Kino, bei dem weder Mama noch Papa den Blick von ihrem Nachwuchs abwenden können, das Nachholen von Schlaf und noch vieles mehr doch besser in der Frauenklinik zu realisieren als zu Hause. Denn in den eigenen vier Wänden muss gekocht werden, die Schwiegereltern bleiben länger zu Besuch, als einem lieb ist, und die Post klingelt einen aus dem Schlaf. All das nimmt Zeit und Nerven in Anspruch, die für den Beziehungsaufbau aufgewendet werden könnten, und verhindert das Kräftesammeln für die ebenfalls nicht weniger anstrengenden nächsten Tage und Wochen. Daher kann es ratsam sein, nicht schon auf eine Entlassung zu drängen, bevor die Hebamme überhaupt 10 Minuten nach der Geburt den sogenannten Apgar-Score bestimmen konnte.
Aber natürlich gibt es auch schlagkräftige Argumente für eine frühzeitige Rückkehr nach Hause. Denn »zu Hause fängt das (Familien-)Leben an«. Vielleicht kommen die jungen Eltern erst dann dazu, die Geschehnisse der letzten Stunden und Tage zu verarbeiten und zu begreifen. Und um ehrlich zu sein: Eine Chefarztvisite kann genauso störend sein wie der Paketmann.
Auch hier gibt es also kein Universalrezept, das für alle gilt. Hören Sie auf Ihr Inneres und Ihr Bauchgefühl, besprechen Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, was Ihnen für Sie als Familie jetzt am besten erscheint, und dann begeben Sie sich mitten hinein ins neue Leben mit Kind.