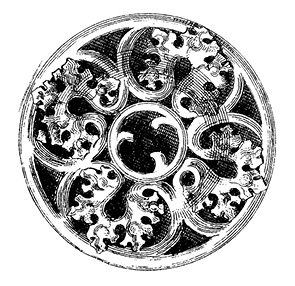
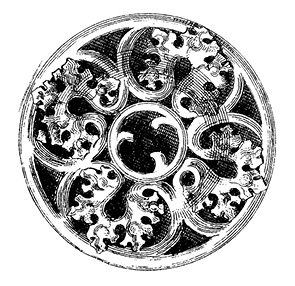
MINERVA RIEB SICH NERVÖS DIE HÄNDE an ihrem Unterrock, um sie zu trocknen, dann betastete sie zum dutzendsten Mal ihr Haar, obwohl sie wusste, dass es so fest hochgesteckt war, wie es irgend möglich war; die Haut ihres Gesichts fühlte sich gedehnt an, ihre Augenbrauen absurd hochgezogen. Sie warf einen raschen Blick in den Spiegel – zum dutzendsten Mal –, um sich zu vergewissern, dass dem nicht so war.
Würde Mrs Simpson kommen? Sie hatte während des ganzen Wegs nach London und während der zwei Wochen seit ihrer Ankunft über ihre Mutter nachgegrübelt – und sie hasste Grübeln mehr als alles andere. Sie fasste Entschlüsse und dann los!
Also hatte sie ihren Entschluss gefasst, doch diesmal hatte er die Zweifel nicht ausgeräumt. Vielleicht hätte sie zum Haus ihrer Mutter gehen und ohne Vorwarnung vor ihrer Tür auftauchen sollen. Das war ihr erster Impuls gewesen, und er war auch jetzt noch stark. Schließlich hatte sie sich stattdessen entschlossen, einen Brief zu schicken – mit äußerster Schlichtheit und nur den knappsten Fakten formuliert – und um das Vergnügen gebeten, Mrs Simpson am Montag, dem achten Juni, in ihren Räumen an der Great Ryder Street begrüßen zu dürfen.
Sie hatte daran gedacht, eine Note zu schicken, in der sie um die Erlaubnis bat, Mrs Simpson zu besuchen; das hätte vielleicht einen höflicheren Eindruck gemacht. Doch sie hatte Angst vor einer ablehnenden Antwort – oder schlimmer noch, Schweigen –, und so hatte sie stattdessen eine Einladung verfasst. Falls ihre Mutter heute Nachmittag nicht kam, stand es ihr immer noch offen, vor ihrer Tür zu erscheinen. Und bei Gott, das würde sie tun …
Die Note knisterte in ihrer Tasche, und sie zog sie heraus – einmal mehr –, und faltete sie auseinander, um den Inhalt zu lesen, verfasst mit sicherer, rundlicher Handschrift – vermutlich Mrs Simpsons –, ohne Gruß oder Unterschrift, Versprechen oder Zurückweisung.
Haltet Ihr das für klug?, stand da.
»Nun, offensichtlich nicht«, sagte sie laut und gereizt und schob den Zettel in ihre Tasche zurück. »Was spielt das für eine Rolle?«
Ihr blieb fast das Herz stehen, als es an der Tür klopfte. Sie war hier! Sie war früh – es war erst Viertel vor zwei –, doch vielleicht hatte Mrs Simpson ja genauso sehr wie sie auf die Begegnung gebrannt, trotz der reservierten Kühle der Note.
Das Zimmermädchen – Eliza, eine verlässliche Frau in den mittleren Jahren, die sich in reichlich Stärke kleidete und zum lebenden Inventar der Zimmer gehörte – sah sie an, und auf ihr Nicken hin ging sie durch den Flur, um die Tür zu öffnen. Minnie schaute noch einmal in den Spiegel (Gott, wie wild ich aussehe), strich sich den bestickten Überrock glatt und setzte eine reservierte, aber freundliche Miene auf.
»Oberst Quarry, Ma’am«, sagte die Bedienstete, die jetzt zurück ins Zimmer kam und beiseitetrat, um den Besucher einzulassen.
»Wer?«, sagte Minnie verständnislos. Der hochgewachsene Herr, der an ihrer offenen Tür erschienen war, war stehen geblieben, um sie neugierig zu betrachten; sie hob ihr Kinn und erwiderte seinen Blick.
Er trug seine rote Uniform – Infanterie – und war auf eine kantige Weise gut aussehend. Ein schneidiger Kerl – der sich dessen absolut bewusst war, dachte sie und lächelte verstohlen. Sie wusste, wie man mit dieser Sorte umging, und ließ das Lächeln erstrahlen.
»Euer Diener, Ma’am«, sagte er und ließ seinerseits die Zähne aufblitzen. Er verbeugte sich sehr elegant vor ihr, richtete sich auf und sagte: »Wie alt seid Ihr?«
»Neunzehn«, sagte sie und fügte ohne Zögern zwei Jahre hinzu. »Und Ihr, Sir?«
Er kniff die Augen zusammen. »Einundzwanzig. Warum?«
»Ich interessiere mich für Numerologie«, sagte sie, ohne eine Miene zu verziehen. »Ist Euch diese Wissenschaft vertraut?«
»Äh … nein.« Er betrachtete sie immer noch interessiert, doch es war jetzt eine andere Art Interesse.
»Wie lautet Euer Geburtsdatum, Sir?«, fragte sie und schlüpfte hinter den kleinen, vergoldeten Schreibtisch, wo sie nach einer Schreibfeder griff. »Wenn Ihr so freundlich wärt?«, fügte sie höflich hinzu.
»Der dreiundzwanzigste April«, sagte er, und seine Lippen zuckten sacht.
»Ah«, sagte sie und kritzelte emsig drauflos, »das ist zwei plus drei, also fünf, plus vier – da April ja der vierte Monat ist«, teilte sie ihm freundlich mit. »Was neun ergibt, und dann fügen wir die Ziffern Eures Geburtsjahrs hinzu, also … eins plus sieben plus zwei plus drei? Ja, genau … insgesamt zweiundzwanzig. Dann addieren wir die beiden Zweien und bekommen Vier heraus.«
»So sieht es aus«, pflichtete er ihr bei und trat zu ihr, um über ihre Schulter auf das Papier zu blicken, auf das sie eine große Vier geschrieben hatte, die sie jetzt einkreiste. So dicht neben ihr strahlte er spürbar Hitze aus. »Und was bedeutet das?«
Sie entspannte sich ein wenig in ihrem engen Korsett. Jetzt hatte sie ihn. Wenn sie erst einmal neugierig waren, konnte man sie dazu bringen, einem alles zu erzählen.
»Oh, die Vier ist die männlichste aller Zahlen«, versicherte sie ihm – völlig wahrheitsgetreu. »Sie steht für ein Individuum von großer Kraft und Stabilität. Verlässlich und absolut vertrauenswürdig.«
Er richtete sich ein wenig auf.
»Ihr seid sehr pünktlich«, sagte sie und warf ihm mit gesenkten Wimpern einen Seitenblick zu. »Gesund … kräftig … Ihr nehmt viele Details wahr und behaltet den Überblick in komplexen Situationen. Und Ihr seid loyal – sehr loyal gegenüber denen, die Euch am Herzen liegen.« Ein kleines, aber bewunderndes Lächeln begleitete ihre Worte.
Vieren waren kompetent und hartnäckig, aber keine schnellen Denker, und wieder einmal war sie überrascht, wie oft sich die Zahlen als richtig erwiesen.
»Tatsächlich«, sagte er und räusperte sich mit verlegener, aber unleugbar angenehm berührter Miene.
An diesem Punkt hörte sie das gedämpfte Ticken der Standuhr hinter sich, und Nervosität durchfuhr sie wie ein Stoß. Sie musste ihn loswerden, und zwar schnell.
»Aber ich bezweifle, dass der Wunsch, die Wissenschaft der Numerologie zu erlernen, der Grund für das Vergnügen Eures Besuchs ist, Sir.«
»Nun.« Er betrachtete sie von Kopf bis Fuß, um sich ein Bild von ihr zu machen, doch sie hätte ihm sagen können, dass es viel zu spät dazu war. »Nun … um ganz offen zu sein, Madam, ich würde Euch gern engagieren. In einer Angelegenheit, die … der Diskretion bedarf.«
Das versetzte ihr einen weiteren kleinen Stoß. Er wusste also, wer – oder besser, was – sie war. Dennoch, auch das war eigentlich nicht ungewöhnlich. Es war schließlich eine Profession, in der sämtliche Kontakte von Mund zu Mund zustande kamen. Und sie war inzwischen mit mindestens drei Herren in London bekannt, die vermutlich in Kreisen verkehrten, zu denen Oberst Quarry Zugang hatte.
Zwecklos also, um den heißen Brei herumzureden oder die Schüchterne zu spielen; sie interessierte sich für ihn, noch mehr jedoch lag ihr daran, dass er ging. Sie nickte ihm kaum merklich zu und sah ihn fragend an. Er erwiderte das Nicken und holte tief Luft. Diskretion, soso …
»Die Situation ist wie folgt, Madam: Ich habe einen guten Freund, dessen Frau kürzlich im Kindbett gestorben ist.«
»Es tut mir leid, das zu hören«, sagte Minnie aufrichtig. »Wie furchtbar tragisch.«
»Ja, das war es.« Es stand Quarry ins Gesicht geschrieben, was er dachte, und die Verstörung in seinen Augen war unübersehbar. »Umso mehr vielleicht, als die Frau meines Freundes … nun ja … seit einigen Monaten eine Affäre mit einem seiner Freunde hatte.«
»Oje«, murmelte Minnie. »Und – verzeiht mir – war das Kind …?«
»Mein Freund weiß es nicht.« Quarry verzog das Gesicht, entspannte sich aber ein wenig, was bedeutete, dass der schwierigste Teil seines Anliegens nun heraus war. »Schlimm genug, könnte man sagen …«
»Oh ja.«
»Doch die weitere Schwierigkeit … nun, ohne auf die Gründe einzugehen, warum … würden wir … ich … Euch gern engagieren, um Beweise für diese Affäre zu finden.«
Das verwirrte sie.
»Euer Freund – er ist sich nicht sicher, dass sie eine Affäre hatte?«
»Doch, absolut sicher«, sagte Quarry. »Es gab Briefe. Aber … nun, ich kann Euch nicht erklären, warum dies notwendig ist, aber er benötigt den Beweis aus … aus einem juristischen Grund, und es kommt für ihn nicht infrage, dass jemand die Briefe seiner Frau liest, obwohl das Urteil der Öffentlichkeit sie nicht mehr zu treffen vermag und es katastrophale Folgen haben könnte, wenn die Affäre nicht bewiesen wird.«
»Ich verstehe.« Sie betrachtete ihn neugierig. Gab es wirklich einen Freund, oder war es seine eigene, notdürftig getarnte Situation? Sie glaubte es nicht; er empfand eindeutig Trauer und Bestürzung, doch er war nicht rot oder irgendwie beschämt oder wütend. Und er sah nicht aus wie ein verheirateter Mann. Absolut nicht.
Als hätte ihn ihr unsichtbarer Gedanke an der Wange getroffen wie eine Fliegenklatsche, sah er ihr scharf und direkt in die Augen. Nein, kein verheirateter Mann. Und nicht so voll Trauer und Bestürzung, dass nicht ein deutlicher Funke in seinen dunkelbraunen Augen aufblitzte. Einen Moment lang senkte sie sittsam den Blick, dann hob sie ihn und gab sich wieder ganz nüchtern und sachlich.
»Nun denn. Habt Ihr eine bestimmte Vorstellung, wie ich diese Nachforschungen anstellen könnte?«
Er zuckte ein wenig verlegen mit den Schultern.
»Nun … ich dachte … vielleicht könntet Ihr Bekanntschaft mit einigen von Esmés Freundinnen schließen – das war ihr Name, Esmé Grey, Gräfin Melton. Und … äh … vielleicht mit einigen … seiner … guten Freunde. Des, äh, Mannes, der …«
»Und der Name des Mannes?« Sie ergriff ihre Schreibfeder, notierte Gräfin Melton, dann blickte sie erwartungsvoll auf.
»Nathaniel Twelvetrees.«
»Ah. Ist er ebenfalls Soldat?«
»Nein.« Überraschenderweise wurde Quarry jetzt doch rot. »Poet.«
»Ich verstehe«, murmelte Minnie und schrieb den Namen auf. »Also schön.« Sie legte den Federkiel beiseite, trat hinter dem Schreibtisch hervor und kam so dicht an ihm vorbei, dass er nicht anders konnte, als sich ihr zuzuwenden – und der Tür. Er roch nach Lorbeer und Vetivergras, obwohl er keine Perücke und keinen Puder in seinem Haar trug.
»Ich bin bereit, diese Nachforschungen für Euch zu übernehmen, Sir – obwohl ich natürlich nicht garantieren kann, dass sie zu etwas führen werden.«
»Nein, nein. Natürlich.«
»Nun, ich habe um zwei Uhr eine Verabredung.« Er blickte auf die Uhr, genau wie sie: vier Minuten bis zur vollen Stunde. »Wenn Ihr aber vielleicht eine Liste der Freunde anfertigen würdet, die Ihr eventuell für hilfreich haltet, und mir diese übersendet? Sobald ich mir einen Überblick über die Möglichkeiten verschafft habe, kann ich Euch meine Konditionen mitteilen.« Sie zögerte. »Dürfte ich an Mr Twelvetrees herantreten? Sehr diskret natürlich«, versicherte sie ihm.
Er schnitt eine Grimasse, halb Schock und halb Belustigung.
»Leider nicht, Ms Rennie. Mein Freund hat ihn erschossen. Ich schicke Euch die Liste«, versprach er, und nach einer tiefen Verbeugung ließ er sie allein.
Die Tür hatte sich kaum hinter ihm geschlossen, als es erneut klopfte. Das Zimmermädchen tauchte aus dem Boudoir auf, wo sie sich unauffällig aufgehalten hatte, und glitt lautlos über den dicken roten Orientteppich.
Minnie spürte, wie es ihr den Magen verknotete und die Kehle zuschnürte, als hätte man sie in großer Höhe aus einem Fenster geworfen und in letzter Sekunde am Hals aufgefangen.
Stimmen. Männerstimmen. Verdutzt eilte sie in den Flur, wo das Zimmermädchen hartnäckig zwei Exemplaren die Stirn bot, die eher nicht zu den feinen Herren zählten.
»Madam ist …«, sagte Eliza gerade entschlossen, doch einer der Männer erspähte Minnie und schob sich an dem Zimmermädchen vorbei.
»Ms Rennie?«, erkundigte er sich höflich, und auf ihr ruckartiges Kopfnicken hin verbeugte er sich überraschend stilvoll für jemanden, der so einfach gekleidet war.
»Wir sind hier, um Euch zu Mrs Simpson zu begleiten«, sagte er. Und an das Zimmermädchen gewandt: »Seid doch so freundlich und holt die Sachen der Dame, bitte.«
Das Zimmermädchen drehte sich mit großen Augen um, und Minnie nickte ihr zu. Ihre Arme waren mit Gänsehaut überzogen, und ihr Gesicht fühlte sich taub an.
»Ja«, sagte sie. »Bitte.« Und ihre Finger schlossen sich um das Papier in ihrer Tasche, das vom Anfassen feucht war.
Haltet Ihr das für klug?
IM FREIEN WARTETE eine Kutsche. Keiner der Männer sagte etwas, doch einer öffnete ihr die Tür; der andere nahm sie beim Ellbogen und half ihr höflich in das Gefährt. Ihr Herz hämmerte, und ihr Kopf war voll mit den Warnungen ihres Vaters vor dem Umgang mit Fremden, für die niemand bürgte – Warnungen, die mit detaillierten Berichten über die Dinge einhergingen, die unvorsichtigen Personen aus seiner eigenen Bekanntschaft infolge ihres Mangels an Argwohn zugestoßen waren.
Was, wenn diese Männer gar nichts mit ihrer Mutter zu tun hatten, aber wussten, wer ihr Vater war? Es gab Menschen, die …
Während ihr Phrasen wie »Und alles, was man von ihr fand, war ihr Kopf …« durch das Hirn hallten, dauerte es einige Sekunden, ehe sie Notiz von den beiden Herren nehmen konnte, die hinter ihr in die Kutsche gestiegen waren und gegenüber Platz genommen hatten, um sie nun zu beobachten wie zwei Eulen. Hungrige Eulen.
Sie holte tief Luft und presste die Hand an ihre Taille, wie um ihr Korsett bequemer zurechtzurücken. Ja, der kleine Dolch steckte nach wie vor beruhigend hinter ihrem Mieder; so wie sie schwitzte, würde er völlig verrostet sein, wenn sie ihn benutzen musste. Falls, verbesserte sie sich. Falls sie ihn benutzen musste …
»Geht es Euch nicht gut, Madam?«, fragte einer der Männer und beugte sich vor. Seine Stimme überschlug sich bei dem Wort »Madam«, und erst jetzt nahm sie ihn richtig in Augenschein. Tatsächlich, er war ein bartloser Junge. Größer als sein Begleiter und recht gut gewachsen, aber dennoch ein Junge – und sein argloses Gesicht drückte nichts als Besorgnis aus.
»Doch«, sagte sie. Sie schluckte, zog einen kleinen Fächer aus ihrem Ärmel und ließ ihn aufklappen. »Nur … ein wenig warm.«
Der ältere Mann – Mitte vierzig, schlank und dunkelhaarig mit einem Dreispitz auf dem Knie – griff auf der Stelle in seine Tasche und holte eine Trinkflasche hervor; ein hübsches Stück aus ziseliertem Silber, das mit einem großen Chrysoberyll geschmückt war, wie sie überrascht erkannte.
»Versucht das«, sagte er mit freundlicher Stimme. »Es ist Orangenblütenwasser mit Zucker, Kräutern, Blutorangensaft und einem Schuss Gin zur Belebung.«
»Danke.« Sie verdrängte das murmelnde »betäubt und vergewaltigt« in ihrem Hirn und nahm die Flasche entgegen. Sie hielt sie sich verstohlen unter die Nase, nahm aber keinen verräterischen Laudanumgeruch wahr. Im Gegenteil, es duftete göttlich und schmeckte noch besser.
Die beiden Männer sahen ihre Miene und lächelten. Kein Lächeln der Genugtuung, weil sie ihnen in die Falle gegangen war, sondern echte Freude, weil sie ihr Angebot angenommen hatte. Sie holte tief Luft, trank noch einen Schluck und begann, sich zu entspannen. Sie erwiderte das Lächeln. Andererseits … lag die Adresse ihrer Mutter in Parson’s Green, und ihr war gerade aufgefallen, dass sie geradewegs in die entgegengesetzte Richtung unterwegs waren. Zumindest dachte sie das.
»Wohin fahren wir?«, fragte sie höflich. Die beiden sahen überrascht aus und blickten erst einander mit hochgezogenen Augenbrauen an, dann sie.
»Nun … zu Mrs Simpson«, sagte der Ältere. Der Junge nickte ihr unbeholfen zu.
»Mrs Simpson«, murmelte er und errötete.
Und das war alles, was auf dem Rest des Weges gesagt wurde. Sie beschäftigte sich damit, die erfrischende Orangenmixtur zu trinken und ihre … doch wohl nicht Wächter? Eskorten? – unauffällig zu beobachten.
Der Mann, der ihr die Flasche gegeben hatte, sprach exzellentes Englisch, jedoch mit dem Hauch eines fremden Akzents: Italienisch vielleicht oder Spanisch?
Der jüngere Mann – trotz seiner glatten Wangen und des Stimmbruchs wirkte er eigentlich nicht wie ein Junge – hatte ein ausdrucksvolles Gesicht, und obwohl er rot geworden war, strahlte er Selbstbewusstsein aus. Er war blond mit goldenen Augen, doch dieser kurze Blick, den die beiden ihr fragend zugeworfen hatten, hatte ihr eine verschwindend kleine Ähnlichkeit gezeigt. Vater und Sohn? Vielleicht.
Sie blätterte rasch in der Akte in ihrem Kopf, auf der Suche nach einem solchen Paar unter den Klienten – oder Feinden – ihres Vaters, fand aber niemanden, auf den die Beschreibung ihrer Begleiter zutraf. Sie holte tief Luft, trank noch einen Schluck und beschloss, an nichts zu denken, bis sie ihr Ziel erreichten.
Eine halbe Stunde später war die Flasche beinahe leer, und die Kutsche kam wankend in einer Gegend zum Stehen, die sie für Southwark hielt.
Ihr Ziel war ein kleines Gasthaus an einer Straße voller Geschäfte, die von Kettrick’s Eel-Pye House dominiert wurde – offenbar ein beliebtes Speiselokal, den vielen Menschen und dem kräftigen Aalgeruch nach. Ihr Magen knurrte, als sie aus der Kutsche stieg, doch das Geräusch verlor sich im Lärm der Straße. Der Junge verbeugte sich und bot ihr den Arm an; sie ergriff ihn, setzte ihr freundlichstes Allerweltsgesicht auf und ging mit ihm hinein.
INNEN WAR ES SCHATTIG; denn das Licht fiel durch zwei schmale Fenster, deren Vorhänge geschlossen waren. Ihr fiel auf, wie es roch – nach Hyazinthen, wie seltsam –, sonst aber nichts. Alles war verschwommen; alles, was sie spürte, war der Schlag ihres Herzens und der feste Arm des Jungen.
Dann ein Flur, dann eine Tür und dann …
Eine Frau. Blaues Kleid. Sanftbraunes Haar hinter den Ohren hochgesteckt. Augen. Blassgrüne Augen. Nicht blau wie die ihren.
Minnie erstarrte und atmete nicht. Im ersten Moment empfand sie eine seltsame Enttäuschung; die Frau hatte keine Ähnlichkeit mit dem Bild, das sie ihr ganzes Leben mit sich herumgetragen hatte. Diese Frau war hochgewachsen und dünn, beinahe hager, und ihr Gesicht war zwar faszinierend, aber es war nicht das Gesicht, das Minnie in ihrem Spiegel sah.
»Minerva?«, sagte die Frau, und ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Sie hustete, räusperte sich heftig, kam dann auf Minnie zu und sagte um einiges lauter: »Minerva? Bist du es wirklich?«
»Nun, ja«, sagte Minnie, die nicht genau wusste, was sie tun sollte. Sie muss es sein; sie kennt meinen richtigen Namen. »Das ist mein Name. Und Ihr seid … Mrs … Simpson?« Jetzt überschlug sich ihre Stimme; die letzte Silbe klang wie das Kreischen einer Fledermaus.
»Ja.« Die Frau wandte den Kopf und nickte den beiden, die sie hergebracht hatten, knapp zu. Der Junge verschwand sofort, aber der ältere Mann berührte die Frau sanft an der Schulter und lächelte Minnie zu, ehe er ihm folgte. Hinter ihm sahen Minnie und Mrs Simpson einander unverblümt an.
Mrs Simpson war gut, aber unauffällig gekleidet. Sie spitzte die Lippen, betrachtete Minnie, als erwägte sie die Möglichkeit, dass sie bewaffnet sein könnte, dann seufzte sie und ließ ihre kantigen Schultern hängen.
»Ich bin nicht deine Mutter, Kind«, sagte sie leise.
Die Worte mochten leise sein, doch sie trafen Minnie wie Fäuste, sechs feste Hiebe in die Magengrube.
»Nun, wer zum Teufel seid Ihr dann?«, wollte sie wissen und trat einen Schritt zurück. Jedes warnende Wort, das sie ignoriert hatte, rauschte jetzt mit der Stimme ihres Vaters auf sie ein.
»… entführt … an ein Bordell verkauft … in die Kolonien verschifft … für ein bisschen Kleingeld ermordet …«
»Ich bin deine Tante, meine Liebe«, sagte Mrs Simpson. Nun, da das Schlimmste heraus war, hatte sie etwas von ihrer Fassung zurückerlangt. »Miriam Simpson. Deine Mutter ist meine Schwester Hélène.«
»Hélène«, wiederholte Minnie. Der Name entzündete einen Funken in ihrer Seele. Wenigstens das hatte sie. Hélène. Eine Französin? Sie schluckte.
»Ist sie tot?«, fragte sie, so gefasst sie konnte. Mrs Simpson spitzte erneut unglücklich die Lippen, schüttelte aber den Kopf.
»Nein«, sagte sie widerstrebend. »Sie lebt noch. Aber …«
Minnie wünschte, sie hätte eine Taschenpistole mitgebracht statt eines Messers, dann würde sie genau jetzt einen Schuss in die Zimmerdecke abfeuern. Stattdessen trat sie einen Schritt vor, sodass ihre Augen nur noch wenige Zentimeter von den grünen Augen entfernt waren, die keine Ähnlichkeit mit den ihren hatten.
»Bringt mich zu ihr. Sofort«, sagte sie. »Ihr könnt mir die Geschichte unterwegs erzählen.«