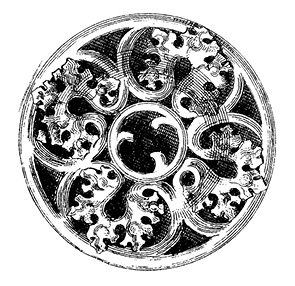
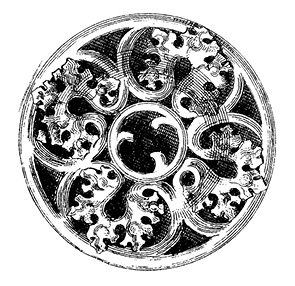
ES WAR ZWAR NICHT notwendig, dass sie Lord Meltons Briefe las, doch nichts in der Welt hätte sie davon abgehalten, und sie ergriff den ersten, als wäre er eine Granate mit brennender Lunte, die in ihrer Hand explodieren könnte.
Genauso war es auch. Sie las die fünf Briefe durch, ohne innezuhalten. Keiner trug ein Datum, und es war unmöglich zu sagen, in welcher Reihenfolge sie geschrieben worden waren; Zeit hatte für den Verfasser offensichtlich keine Rolle gespielt – und doch hatte sie ihm alles bedeutet. Dies war die Stimme eines Mannes, der über eine Klippe in den Abgrund der Ewigkeit gestürzt wurde und seinen Fall dokumentierte.
Ich werde dich ewig lieben, ich kann gar nicht anders, doch bei Gott, Esmé, ich werde dich ewig hassen, mit aller Macht meiner Seele, und hätte ich dich vor mir und deinen langen weißen Hals in meinen Händen, ich würde dich erwürgen wie einen verdammten Schwan und es mit dir treiben, während du stirbst, du …
Er hätte genauso gut das Tintenfass ergreifen und damit nach dem Blatt werfen können. Die Wörter waren dahingekritzelt und voller Flecken, groß und schwarz, und hier und da befanden sich ausgefranste Löcher im Papier, die er mit dem Federkiel hindurchgestochen hatte.
Sie schnappte heftig nach Luft, als sie das Ende erreichte, und fühlte sich, als hätte sie kein einziges Mal geatmet, während sie las. Sie weinte nicht, doch ihre Hände zitterten, und der letzte Brief rutschte ihr aus den Fingern und segelte zu Boden. Hinuntergezogen von einem quälenden Verlust, der nicht schneidend war, sondern seine Beute gnadenlos mit den Klauen in blutige Fetzen riss.
SIE LAS DIE BRIEFE nicht noch einmal. Es hätte sich wie eine Entweihung angefühlt. Es war auch gar nicht nötig, sie erneut zu lesen; sie hatte das Gefühl, dass sie niemals ein einziges Wort davon vergessen würde.
Sie musste das Haus verlassen und eine Zeit lang spazieren gehen, um zumindest ansatzweise die Fassung wiederzufinden. Hin und wieder spürte sie, wie ihr Tränen über die Wangen rannen, und tupfte sie hastig fort, ehe ein Passant sie sehen und fragen konnte, was ihr Kummer bereitete. Sie fühlte sich, als hätte sie tagelang geweint, oder als hätte jemand auf sie eingeprügelt. Und doch hatte es nichts mit ihr zu tun.
Sie spürte, dass ihr einer der Brüder O’Higgins irgendwo folgte, doch er hielt sich taktvoll zurück. Sie ging von einem Ende des St.-James-Parks zum anderen und umrundete den ganzen Weiher, doch schließlich setzte sie sich in der Nähe einer Flottille von Schwänen auf eine Bank, körperlich und gedanklich gleichermaßen erschöpft. Jemand setzte sich ans andere Ende der Bank – Mick, wie sie aus dem Augenwinkel sah.
Es war Teezeit; das geschäftige Treiben auf den Straßen ließ nach, während die Leute nach Hause hasteten oder in ein Wirtshaus einkehrten, um sich nach der Arbeit eines langen Tages zu stärken. Mick hüstelte vielsagend.
»Ich habe keinen Hunger«, sagte sie. »Geht nur, wenn Ihr möchtet.«
»Aber, Bedelia. Ihr wisst genau, dass ich ohne Euch nirgendwo hingehe.« Er war über die Bank gerutscht und saß jetzt kameradschaftlich direkt neben ihr. »Soll ich Euch ein Pastetchen holen? Was auch immer Euch bedrückt, mit vollem Bauch sieht es besser aus.«
Sie hatte zwar keinen Hunger, doch sie war leer, und nach einem Moment der Unentschlossenheit gab sie nach und schickte ihn zu einem Straßenverkäufer, um ihr ein Pastetchen zu kaufen. Es duftete so kräftig und so gut, dass sie sich schon besser fühlte, als sie es nur in der Hand hielt. Sie knabberte an der Kruste, spürte den aromatischen Saft in ihren Mund laufen, schloss die Augen und gab sich der Pastete hin.
»Na also.« Mick, der mit seiner eigenen Pastete längst fertig war, sah sie wohlwollend an. »Besser, nicht wahr?«
»Ja«, gab sie zu. Immerhin konnte sie jetzt über die Angelegenheit nachdenken, statt darin zu ertrinken. Und auch wenn ihr nicht bewusst war, dass sie unterwegs tatsächlich nachgedacht hatte, hatte ein Hinterzimmerchen ihres Verstandes die Dinge anscheinend von oben nach unten gekehrt.
Esmé und Nathaniel waren tot. Harold, der theoretische Herzog von Pardloe, war es nicht. Das war es, worauf es hinauslief. Für ihn konnte sie etwas tun. Und sie stellte fest, dass sie dazu fest entschlossen war.
»Aber was?«, fragte sie, nachdem sie Mick die groben Tatsachen beschrieben hatte. »Ich kann diese Briefe nicht an den Kriegsminister schicken – es ist unmöglich, dass Seine Durchlaucht es nicht herausfände, und ich glaube, es würde ihn umbringen zu wissen, dass andere sie gelesen haben, ganz zu schweigen von anderen, die … die Macht über ihn haben.«
Mick verzog das Gesicht, räumte aber ein, dass das möglich war.
»Was hättet Ihr denn gern, Lady Bedelia?«, fragte er. »Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg?«
Sie holte so tief Luft, dass es ihr bis zu den Schuhen ging, und atmete langsam wieder aus.
»Ich möchte vermutlich dasselbe wie Hauptmann Quarry: dem Eindruck ein Ende bereiten, dass Seine Durchlaucht nicht bei Verstand ist, und dafür sorgen, dass sein Regiment wieder in den Dienst gestellt wird. Ich glaube, ich muss beides hinbekommen. Aber wie?«
»Und Ihr könnt – oder wollt – die Briefe nicht dazu benutzen …« Er warf ihr einen Seitenblick zu, um zu sehen, ob sie vielleicht doch vom Gegenteil zu überzeugen war, doch sie schüttelte den Kopf.
»Einen falschen Zeugen besorgen?«, schlug er vor. »Jemanden dafür bezahlen, dass er aussagt, dass es eine Affäre zwischen der Gräfin und dem Dichter gab?«
Minnie schüttelte skeptisch den Kopf.
»Ich möchte nicht sagen, dass ich niemanden finden könnte, der sich dafür bezahlen lässt«, sagte sie. »Aber niemanden, dem man glauben würde. Die meisten jungen Frauen sind keine guten Lügnerinnen.«
»Nein«, pflichtete er ihr bei. »Ihr seid eine Ausnahme, das stimmt.« Er sagte es bewundernd, und sie quittierte das Kompliment mit einem Kopfnicken, setzte aber ihren Gedankengang fort.
»Die andere Sache ist die, dass es zwar leicht ist, ein Gerücht in die Welt zu setzen, aber wenn es einmal da ist, ist es gut möglich, dass es ein Eigenleben annimmt. Ich meine, man kann es nicht kontrollieren. Wenn ich jemanden – Mann oder Frau – dazu brächte zu sagen, dass er oder sie von der Affäre wusste, wäre das ja nicht das Ende. Und weil es von Anfang an nicht die Wahrheit wäre, ist es unmöglich zu sagen, wo es enden würde. Und man zündet keine Lunte an, von der man nicht weiß, wohin sie führt«, fügte sie hinzu und sah ihn mit hochgezogener Augenbraue an. »Das hat mein Vater immer zu mir gesagt.«
»Ein kluger Mann, Euer Vater.« Mick fasste sich respektvoll an die Hutkrempe. »Wenn es also kein bezahlter Zeuge sein soll … was würde Seine Gnaden, Euer Vater, wohl sonst empfehlen?«
»Nun … Urkundenfälschung vermutlich«, sagte sie und zuckte mit den Schultern. »Aber ich glaube, dass es im Großen und Ganzen nicht viel besser wäre, eine gefälschte Version dieser Briefe vorzulegen als die Originale.« Sie rieb sich mit dem Daumen über die Finger, die von der Pastetenkruste noch etwas glatt waren. »Holt mir noch eine Pastete, Mick, ja? Denken macht hungrig.«
Sie aß die zweite Pastete. Gestärkt begann sie dann, im Geiste Esmés Briefe noch einmal durchzugehen. Es war schließlich die Gräfin Melton, die fons et origo des ganzen Elends war.
Würdet Ihr sagen, dass es das wert war, frage ich mich?, dachte sie, an die abwesende Esmé gewandt. Vermutlich hatte die Frau nur ihren Ehemann eifersüchtig machen wollen; sie hatte wohl kaum auch nur die geringste Absicht gehabt, ihren Mann dazu zu treiben, dass er einen seiner Freunde erschoss; ganz gewiss hatte sie nicht vorgehabt zu sterben, noch dazu mit ihrem Kind. Dieser Umstand traf Minnie besonders lebhaft und erinnerte sie aus irgendeinem Grund an ihre Mutter.
Du hast bestimmt auch nichts von dem, was geschehen ist, beabsichtigt, dachte sie voll Mitgefühl. Erst recht hast du mich nicht beabsichtigt. Dennoch fand sie, dass die Situation ihrer Mutter zwar bedauerlich war, aber nicht an Esmés dramatische Tragödie heranreichte. Wir leben schließlich beide noch.
Und ich kann zwar nur für mich sprechen, fügte sie hinzu, aber ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin mir hinreichend sicher, dass sich Vater auch darüber freut.
Ein leises Geräusch riss sie aus ihren Gedanken, und sie bemerkte, dass Mick seine Haltung geändert hatte und wortlos andeutete, dass es allmählich spät wurde und sie sich am besten auf den Rückweg zur Great Ryder Street begeben sollten.
Er hatte recht; die Schatten der hohen Bäume bewegten sich jetzt über den Pfad wie verschütteter Tee, der sich als Fleck ausbreitete. Auch die Geräusche hatten sich verändert: Das heisere Gelächter der feinen Damen mit ihren Sonnenschirmen war zum Großteil verstummt und den Stimmen der Soldaten, Geschäftsleute und Sekretäre gewichen, die zielsicher auf ihren Tee zusteuerten wie Esel auf ihre Futterkrippen.
Sie stand auf und schüttelte sich die Röcke zurecht, dann nahm sie ihren Hut und steckte ihn in ihrem Haar fest. Sie nickte Mick zu und signalisierte ihm mit einer kleinen Handbewegung, dass er mit ihr gehen sollte, statt ihr zu folgen. Sie trug ein anständiges, aber sehr bescheidenes blaues Baumwollkleid und einen einfachen Strohhut; man konnte sie leicht für ein besseres Hausmädchen halten, das einen Spaziergang mit einem Verehrer unternahm, solange sie niemandem begegnete, der Minnie kannte – und das war um diese Uhrzeit unwahrscheinlich.
»Dieser Knabe, den Seine Lordschaft erschossen hat«, sagte Mick einen halben Block später. »Es heißt, er war ein Dichter, stimmt das?«
»So sagt man mir.«
»Habt Ihr vielleicht schon eins von seinen Gedichten gelesen?«
Sie warf ihm einen überraschten Blick zu.
»Nein. Warum?«
»Nun, es ist nur, weil Ihr doch gesagt habt, dass Euer Pa in bestimmten Situationen so viel von Fälschungen hält. Ich habe mich gefragt, was Ihr fälschen könntet, was vielleicht helfen könnte, und mir ist der Gedanke gekommen – was, wenn dieser Twelvetrees ein enthüllendes Gedicht über die Gräfin geschrieben hätte. Oder vielmehr«, fügte er für den Fall hinzu, dass sie nicht verstand, worauf er hinauswollte, was sie jedoch sehr wohl tat, »was, wenn Ihr eins für ihn schreiben würdet?«
»Das ist eine Idee«, sagte sie langsam. »Vielleicht sogar eine sehr gute Idee – aber wir wollen ein wenig darüber nachdenken, ja?«
»Aye«, sagte Mick, der jetzt Feuer und Flamme war. »Aber erst einmal: Was für eine Fälscherin würdet Ihr wohl sein?«
»Keine begnadete«, räumte sie ein. »Ich meine, ich würde niemals eine gute Banknote hinbekommen. Und eigentlich habe ich das auch noch nicht oft getan – die Handschrift eines echten Menschen nachgeahmt, meine ich. Meistens schreibt man einen gefälschten Brief an eine Person, die den Absender nicht kennt. Und nur hin und wieder, nicht oft.«
Mick stieß ein leises Summen aus.
»Aber Ihr habt ja ein paar seiner Briefe als Vorlage«, meinte er. »Könntet Ihr vielleicht hier und da ein paar Wörter abpausen und dazwischen etwas einfügen?«
»Vielleicht«, sagte sie skeptisch. »Doch zu einer guten Fälschung gehört mehr als nur die Handschrift. Wenn sie für eine Person bestimmt ist, die den Absender kennt, dann muss auch der Stil ein gutes Faksimile sein – das heißt, er muss dem der echten Person ähnlich sein«, fügte sie schnell hinzu, als sie sah, wie seine Lippen »Faksimile« zu formen begannen.
»Und sein Stil bei einem Gedicht könnte anders sein als beim Schreiben eines Briefes?« Mick dachte einen Moment darüber nach.
»Ja. Was, wenn er dafür bekannt war, nur Sonette zu schreiben, und ich würde eine Sestine schreiben? Jemand könnte Verdacht schöpfen.«
»Ihr habt bestimmt recht. Obwohl ich nicht vermute, dass der Mann die Angewohnheit hatte, dem Kriegsminister Liebesgedichte zu schreiben, wie?«
»Nein«, sagte sie knapp. »Aber wenn ich etwas schriebe, was schockierend genug wäre, um als Rechtfertigung dafür zu dienen, dass Seine Lordschaft den Verfasser erschossen hat, wie wahrscheinlich ist es dann, dass der Minister es jemand anderem zeigen würde? Der es jemand anderem erzählen könnte und … und so weiter.« Sie winkte ab. »Wenn es jemandem zu Augen kommen würde, der erkennen könnte, dass Nathaniel Twelvetrees es nicht geschrieben hat, was dann?«
Mick nickte nüchtern. »Dann würden sie vielleicht glauben, Seine Lordschaft hat es selbst geschrieben, meint Ihr das?«
»Das ist eine Möglichkeit.« Die andere Möglichkeit dagegen war unleugbar faszinierend.
Sie hatten die Great Ryder Street und die blank geputzte Treppe vor ihrer Tür erreicht. Der Duft frisch gebrühten Tees schwebte aus dem Dienstbotenraum neben der Treppe herauf, und ihr Magen verknotete sich in wohliger Vorfreude.
»Es ist eine gute Idee, Mick«, sagte sie und berührte flüchtig seine Hand. »Danke. Ich werde Lady Buford fragen, ob Nathaniel seine Gedichte veröffentlicht hat. Wenn ich etwas davon lesen könnte, nur um zu sehen …«
»Ihr schafft das schon, Lady Bedelia …«, sagte Mick. Er lächelte sie an, hob ihre Hand und küsste sie.
»NATHANIEL TWELVETREES?« Lady Buford war überrascht und betrachtete Minnie durch ihr Monokel. »Ich glaube nicht. Er hatte eine große Vorliebe dafür, seine Gedichte bei Salons vorzutragen, und ich glaube, einmal ist er so weit gegangen, auf einer Bühne zu lesen, aber dem wenigen nach, was ich von seiner Lyrik gehört habe – nun ja, dem wenigen nach, was ich die Leute über seine Lyrik habe sagen hören –, hätten es die meisten Drucker vermutlich finanziell nicht für vielversprechend erachtet.«
Sie richtete den Blick wieder auf die Bühne, auf der gegenwärtig eine mittelmäßige Darbietung stattfand, die »Reizende Lieder vom Lande, ein Duett zweier Damen« betitelt war, doch hin und wieder tippte sie sich mit dem geschlossenen Fächer an die Lippen, ein Anzeichen, dass sie weiter nachdachte.
»Ich glaube«, sagte sie, sobald die nächste Pause im Programm gekommen war, »Nathaniel hat einige seiner Gedichte privat drucken lassen. Zur Erbauung seiner Freunde«, fügte sie hinzu und zog eine ihrer kräftigen grauen Augenbrauen vielsagend in die Höhe. »Warum fragt Ihr?«
Glücklicherweise hatte die Unterbrechung Minnie genügend Zeit gegeben, diese Frage kommen zu sehen, und sie antwortete bereitwillig.
»Sir Robert Abdy hat neulich bei Lady Scroggs Abendgesellschaft über Mr Twelvetrees gesprochen – recht verächtlich«, fügte sie ihrerseits vielsagend hinzu. »Aber da Sir Robert seinerseits Ambitionen in dieser Richtung hegt …«
Lady Buford lachte, ein tiefes, gewinnendes Lachen, sodass sich die Leute in der Nachbarloge fragend umdrehten, und ließ dann ihrerseits einige verächtliche – und höchst amüsante – Dinge über Sir Robert folgen.
Doch Minnie dachte weiter nach, während zwei italienische Feuerschlucker auftraten, ein tanzendes Schwein (das sich auf der Bühne blamierte, zum Entzücken des Publikums), zwei angebliche Chinesen, die ein angeblich komisches Lied sangen, und mehrere ähnliche Akte.
Privat gedruckt. Zur Erbauung seiner Freunde. Es gab mindestens zwei Gedichte, die ausdrücklich zur Erbauung der Gräfin Esmé Melton geschrieben worden waren. Wo waren sie?
»Ich frage mich«, sagte sie ganz beiläufig, während sie sich durch die Menge der Theaterbesucher den Weg ins Freie bahnten, »ob die Gräfin Melton Gedichte mochte.«
Lady Buford hörte ihr nur mit halbem Ohr zu, weil sie damit beschäftigt war, den Blick eines Bekannten auf der anderen Seite des Theaters auf sich zu lenken, und sie erwiderte zerstreut: »Oh, ich glaube nicht. Die Frau hat im Leben kein Buch gelesen außer der Bibel.«
»Die Bibel?«, fragte Minnie ungläubig. »Ich hätte sie nicht für einen … einen religiösen Menschen gehalten.« Es war Lady Buford gelungen, den Freund auf sich aufmerksam zu machen, der sich jetzt in ihre Richtung durch die Leute zwängte, und sie bedachte Minnie mit einem zynischen Lächeln.
»Das war sie auch nicht. Aber sie hat die Bibel gern gelesen, um sich zum Entsetzen der Leute darüber lustig zu machen. Das geht leider viel zu einfach.«
»SIE HÄTTE DIE GEDICHTE nicht weggeworfen«, hielt Minnie Rafe entgegen, der eher skeptisch schien. »Sie waren an sie gerichtet, über sie. Keine Frau würde ein Gedicht wegwerfen, das ein Mann, der ihr am Herzen liegt, über sie geschrieben hat – schon gar nicht eine Frau wie Esmé.«
»Hat Euch je ein Mann ein Liebesgedicht geschrieben, Lady Bedelia?«, fragte er provozierend.
»Nein«, sagte sie spröde, spürte aber, wie sie errötete. Es hatten schon mehrere Männer genau das getan – und sie hatte die Gedichte behalten, obwohl ihr nicht besonders viel an den Männern lag, die sie geschrieben hatten. Dennoch …
»Mmm«, räumte Rafe ein und wackelte mit dem Kopf. »Aber vielleicht hat dieser Melton sie verbrannt. Ich würde das tun, wenn so ein Schmierfink meiner Frau so etwas geschickt hätte.«
»Wenn er die Briefe nicht verbrannt hat«, sagte Minnie, »wird er auch die Gedichte nicht verbrannt haben. Ihr Inhalt kann unmöglich noch schlimmer sein.«
Warum hat er die Briefe nicht verbrannt?, fragte sie sich mindestens zum hundertsten Mal. Und warum er die Briefe alle behalten hatte – Esmés, Nathaniels … und seine eigenen.
Vielleicht waren es Schuldgefühle, das Bedürfnis, für das, was er getan hatte, zu leiden, indem er sie wie ein Besessener immer wieder las. Vielleicht war es Verwirrung – der Wunsch oder die Hoffnung, sich einen Reim auf das zu machen, was geschehen war, was sie alle getan hatten, um diese Tragödie herbeizuführen. Er war schließlich der Einzige, der es noch konnte.
Oder … vielleicht war es auch einfach so, dass er seine Frau und seinen Freund noch liebte, um sie beide trauerte und es nicht über sich brachte, sich von diesen letzten persönlichen Andenken zu trennen. Seine eigenen Briefe waren weiß Gott von herzzerreißendem Schmerz erfüllt, der zwischen den Flecken aus Wut gut zu erkennen war.
»Ich glaube, dass sie die Briefe mit Absicht an einen Ort gelegt hat, an dem ihr Mann sie finden würde«, sagte Minnie langsam und beobachtete eine Reihe halbwüchsiger Schwäne, die ihrer Mutter folgten. »Aber die Gedichte … vielleicht enthielten sie keine eindeutigen Bemerkungen über Lord Melton. Wenn nur sie der Gegenstand war, ist es doch möglich, dass sie sie an einem privaten Ort aufbewahrt hat, sie an einem sicheren Ort versteckt hat, meine ich.«
»Und?« Argwohn stahl sich in Rafes Miene. »Man wird uns dort nicht mehr ins Haus lassen. Sämtliche Dienstboten haben uns letztes Mal gesehen.«
»Jaja.« Sie streckte ein Bein aus, um ihre neuen, kalbsledernen, guten Schuhe zu betrachten. »Aber ich habe mich gefragt … ob Ihr vielleicht … eine Schwester oder eine Cousine habt, die nichts dagegen hätte, sich … sagen wir … fünf Pfund zu verdienen?« Fünf Pfund war für einen Hausbediensteten ein halber Jahreslohn.
Rafe erstarrte und sah sie an.
»Was habt Ihr denn vor, dass wir dort einbrechen oder das Haus anzünden?«
»Nichts derart Gefährliches«, beruhigte sie ihn und klimperte ausnahmsweise mit den Augen. »Ich möchte nur, dass Ihr – oder vielmehr Eure Komplizin – die Bibel der Gräfin stehlt.«
SCHLIEẞLICH WAR ES GAR nicht notwendig gewesen, die Bibel zu stehlen. Cousine Aoife hatte in der Verkleidung eines frisch angestellten Zimmermädchens die Bibel einfach durchgeblättert, die nach wie vor sittsam auf dem Nachttisch neben dem verwaisten Bett der Gräfin lag, eine Handvoll zusammengefalteter Blätter herausgenommen, diese eingesteckt und war dann die Treppe hinunter und zum Abort hinter dem Haus gegangen, wo sie unauffällig durch ein Loch in der Hecke verschwunden war, um nie mehr zurückzukehren.
»Etwas dabei, was Ihr brauchen könnt, Lady Bedelia?« Am Tag, nachdem sie ihre Beute abgeliefert und Aoifes Lohn entgegengenommen hatten, waren Mick und Rafe beide zu ihr gekommen.
»Ja.« Sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, und alles in ihrer Umgebung hatte etwas Traumwandlerisches an sich, auch die beiden Iren. Sie gähnte, nachdem sie in letzter Sekunde ihren Fächer gespreizt hatte, und blinzelte die beiden an, dann griff sie in ihre Tasche und zog ein versiegeltes Pergament hervor, das an Sir William Tonge, Kriegsminister adressiert war.
»Könnt Ihr sicherstellen – und ich meine wirklich sicher –, dass Sir William das bekommt? Ich weiß«, sagte sie trocken, als sie sah, wie Rafe sie mit Rehaugen anschaute, »ich verletze Euch. Trotzdem. Sorgt dafür.«
Sie lachten und gingen, während sie in der Stille des Zimmers zurückblieb, wo ihr Papier Gesellschaft leistete. Kleine Barrikaden aus Büchern schützten den Tisch, auf dem sie ihre Magie vollzogen hatte, indem sie mit einem halben Glas Madeira den Schatten ihres Vaters heraufbeschwor, sich bekreuzigte und ihre Mutter um ein segnendes Gebet bat, ehe sie ihren Federkiel ergriff.
Nathaniel Twelvetrees, die gute, erotisch veranlagte Seele, hatte sich ausgiebig über die Vorzüge seiner Mätresse ausgelassen. Zudem hatte er in einem der Gedichte diverse Merkmale des Ortes beschrieben, an dem sich die Liebenden miteinander vergnügt hatten. Er hatte es zwar nicht unterzeichnet – doch unter das andere hatte er Dein für immer, mein Schatz – Nathaniel geschrieben.
Nach einigem Zaudern hatte sie dann beschlossen, das Risiko einzugehen, um jeden Zweifel auszuräumen. Nachdem sie zwei Pergamentbogen mit Übungen gefüllt hatte, hatte sie sich einen frischen Federkiel zurechtgeschnitten und – in etwas, was sie für eine brauchbare Version von Nathaniels Handschrift und Stil hielt – einen Titel für sein unsigniertes Gedicht geschrieben: Die immerwährende Blüte der Liebe: zur Feier des siebten April. Und unter das Gedicht – nach weiterem, ausgiebigem Üben: Mit Leib und Seele Dein, liebste Esmé – Nathaniel.
Wenn sie Glück hatte, würde niemand auch nur auf die Idee kommen nachzuforschen, wo die Gräfin Esmé Melton am siebten April gewesen war, doch in einem ihrer Briefe hatte besagte Gräfin eine Verabredung für dieses Datum getroffen, und die Ortsbeschreibung in Nathaniels Gedicht passte zu dem, was Minnie über den Ort wusste, den sie für diese Verabredung gewählt hatte.
In jedem Fall verdeutlichte das Gedicht, dass der Herzog von Pardloe mehr als gerechtfertigte Gründe dafür gehabt haben würde, Nathaniel Twelvetrees zum Duell herauszufordern. Und es deutete zweifellos an, dass die Gräfin Twelvetrees ermuntert hatte, sich ihr zuzuwenden, wenn nicht mehr – doch es enthüllte weder den wahren Kern der Angelegenheit noch Esmés Charakter oder die quälend intimen Gedankengänge ihres Mannes.
So. Nun war es vorbei.
Die Briefe lagen immer noch – vollzählig – in ihrer Tarot-Anordnung vor ihr auf dem Tisch, stumme Zeugen.
»Und was mache ich jetzt mit euch?«, sagte Minnie zu ihnen. Sie füllte ihr Weinglas und trank es langsam, während sie nachdachte.
Das Einfachste – und bei Weitem Sicherste – war es, sie zu verbrennen. Doch zwei Überlegungen hinderten sie daran.
Erstens. Wenn das Gedicht seinen Zweck nicht erfüllte, waren die Briefe der einzige Beweis für die Affäre. Als letzten Ausweg konnte sie sie Harry Quarry geben und es ihm überlassen, wie er sie am besten benutzte.
Zweitens. Dieser letzte Gedanke ließ ihrem Herzen keine Ruhe. Warum hatte er sie aufbewahrt? Ob aus Schuld oder Schmerz, als Buße oder Trost oder zur Erinnerung – Seine Durchlaucht hatte sie aufbewahrt. Für ihn besaßen sie Wert.
Mittsommer war gerade vorbei; die Sonne stand noch am Himmel, obwohl es schon nach acht Uhr war. Sie hörte die Glocken von St. James die volle Stunde schlagen, und nachdem sie ihr Glas geleert hatte, stand ihr Entschluss fest.
Sie würde die Briefe zurücklegen müssen.
OB ES AN DEN Gebeten ihrer Mutter lag oder am wohlwollenden Eingreifen der Mutter María Anna Águeda de San Ignacio, nach dieser Hals über Kopf getroffenen Entscheidung dauerte es nur drei Tage, bis Minerva die Gelegenheit in den Schoß fiel, sie in die Tat umzusetzen.
»Was für Neuigkeiten, meine Liebe!« Lady Buford war ganz rot geworden, ob vor Hitze oder Aufregung, und sie fächelte sich hektisch Luft zu. »Graf Melton gibt einen Ball zu Ehren des Geburtstags seiner Mutter.«
»Was? Ich wusste gar nicht, dass er eine Mutter hat. Äh … ich meine …«
Lady Buford lachte und errötete noch mehr.
»Selbst dieser Schurke Diderot hat eine Mutter, meine Liebe. Aber es stimmt, dass man von der verwitweten Gräfin Melton nicht viel sieht. Nach dem Selbstmord ihres Gatten war sie so klug, ihre Zelte in Frankreich aufzuschlagen, wo sie seitdem in aller Stille lebt.«
»Aber … jetzt kommt sie zurück?«
»Oh, das bezweifle ich sehr«, sagte Lady Buford und zog ein sehr abgenutztes Spitzentaschentuch hervor, mit dem sie sich die Stirn betupfte. »Gibt es Tee, meine Liebe? Ich brauche unbedingt eine Tasse; man trocknet ja aus in dieser Sommerluft.«
Eliza hatte nicht gewartet, bis man sie rief. Da sie mit Lady Bufords Teegewohnheiten vertraut war, hatte sie angefangen, eine Kanne zuzubereiten, als Lady B’s Klopfen an der Tür ertönte. Und jetzt kam sie mit einem klappernden Tablett durch den Flur.
Minnie wartete mit aller Geduld, die sie aufbringen konnte, bis der Tee mit der nötigen Zeremonie ausgeschenkt war: unter Hinzufügung von drei Stücken Zucker – Lady Buford hatte nur noch wenige Zähne, was kein Wunder war – und eines großen Schusses Sahne, dazu exakt zwei Ingwerplätzchen. Schließlich wieder bei Kräften, hielt sich Lady Buford die Finger vor die Lippen, unterdrückte einen kleinen Rülpser und richtete sich auf, bereit, zum Geschäftlichen zu kommen.
»Natürlich redet alle Welt darüber«, sagte sie. »Die junge Gräfin ist ja noch keine vier Monate tot. Und ich bin mir zwar sicher, dass seine Mutter nicht vorhat, bei diesem Anlass aufzutauchen, doch die Entscheidung, ihren Geburtstag zu feiern, ist … gewagt, aber gewagt, ohne einen offenen Skandal auszulösen.«
»Ich würde doch meinen, davon hätte Seine … äh … Lordschaft auch genug«, murmelte Minnie. »Ähm, aber was meint Ihr mit ›gewagt‹?«
Lady Buford sah sie selbstzufrieden an; sie genoss es, ihre Künste zu demonstrieren.
»Nun. Wenn jemand – vor allem ein Mann – etwas Ungewöhnliches tut, muss man stets fragen, welche Absicht er damit verfolgt. Ob er dieses Ziel erreicht oder nicht, die Absicht erklärt üblicherweise vieles. Und in diesem Fall«, sagte sie und nahm sich geziert ein neues Plätzchen vom Teller, um es in ihren Tee zu tunken, »denke ich, Seine Lordschaft beabsichtigt, sich zu zeigen, um der Gesellschaft zu beweisen, dass er nicht verrückt ist – was auch immer er sonst sein mag«, fügte sie nachdenklich hinzu.
Minnie war sich zwar nicht so sicher, was Lord Meltons Geisteszustand betraf, doch sie nickte pflichtschuldigst.
»Seht Ihr …« Lady Buford hielt inne, um am Rand ihres aufgeweichten Plätzchens zu knabbern, zog eine beifällige Miene und schluckte. »Seht Ihr, würde er einfach nur eine normale Gesellschaft geben, würde man ihn bestenfalls für oberflächlich und frivol halten, schlimmstenfalls für kalt und gefühllos. Außerdem würde er sich einem beträchtlichen Risiko aussetzen, dass niemand die Einladung annimmt.«
»Aber so?«, drängte Minnie.
»Nun, es gibt den Faktor der Neugier, den man nicht unterschätzen darf.« Lady Bufords ziemlich spitze Zunge schoss hervor, um einen verirrten Krümel einzufangen und ihn außer Sichtweite zu befördern. »Doch indem er das Fest zu Ehren seiner Mutter gibt, fordert er mehr oder weniger die Loyalität ihrer Freunde ein – welche sehr zahlreich sind – sowie derjenigen, die Freunde seines verstorbenen Vaters waren, ihn aber nicht offen unterstützen konnten. Und«, fügte sie hinzu und lehnte sich bedeutungsschwanger vor, »dann sind da noch die Armstrongs.«
»Wer?«, fragte Minnie verständnislos. Sie verfügte inzwischen über einen umfangreichen Katalog der Londoner Gesellschaft, erkannte darin jedoch keine prominente Person namens Armstrong.
»Die Mutter des Herzogs ist eine geborene Armstrong«, erklärte Lady Buford, »obwohl ihre Mutter Engländerin war. Aber die Armstrongs sind eine sehr einflussreiche schottische Familie aus der Border-Region. Und es heißt, Lord Fairbairn – das ist der mütterliche Großvater des Herzogs, nur ein Baron, aber sehr reich – ist in London und wird dem … äh … Ereignis beiwohnen.«
Allmählich fand Minnie, dass Tee der Lage nicht angemessen war, und erhob sich, um die Karaffe mit dem Madeira von der Anrichte zu holen. Lady Buford äußerte keine Einwände.
»Natürlich müsst Ihr hingehen«, sagte Lady Buford, nachdem sie mit einem Schluck ein halbes Glas getrunken hatte.
»Tatsächlich?« Minnie empfand diese plötzliche, durchdringende Leere, die mit Aufregung, Vorfreude und Panik einhergeht.
»Ja«, sagte Lady Buford entschlossen. Sie schüttete den Rest in sich hinein und stellte das Glas mit einem Pochen hin. »Fast alle Eurer besten Heiratskandidaten werden dort sein, und es gibt nichts Besseres als Konkurrenz, um einen Herrn dazu zu bewegen, seine Absichten zu erklären.«
Jetzt war das Gefühl die nackte Panik. Minnie war so mit anderen Dingen beschäftigt gewesen, dass sie ganz vergessen hatte, dass sie auf der Jagd nach einem Ehemann sein sollte. Erst letzte Woche hatte man ihr zwei Anträge gemacht, obwohl die Bewerber glücklicherweise nicht besonders distinguiert waren und Lady Buford nichts dagegen hatte, dass sie sie abwies.
Sie leerte ihren Madeira und schenkte ihnen beiden nach.
»Also schön«, sagte sie mit einem leichten Schwindelgefühl. »Was meint Ihr, was ich anziehen soll?«
»Das Beste, was Ihr habt, meine Liebe.« Lady Buford hob ihr frisch gefülltes Glas zu einer Art Toast. »Lord Fairbairn ist nämlich Witwer.«