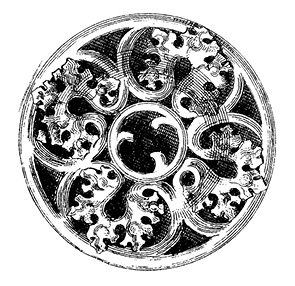
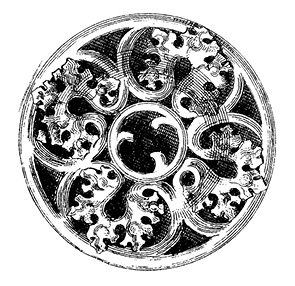
ES WAR NICHT SO SCHWIERIG zu verschwinden. Die Brüder O’Higgins waren Meister in dieser Kunst, wie sie ihr versicherten.
»Überlasst das uns, Kleine«, sagte Rafe und nahm die Handtasche, die sie ihm reichte. »Für einen Londoner fängt die Fremde am Ende seiner Straße an. Ihr müsst Euch nur von den Orten fernhalten, an denen die Leute es gewohnt sind, Euch zu sehen.«
Ihr war kaum etwas anderes übrig geblieben. Sie hatte nicht vor, sich in die Nähe des Herzogs von Pardloe oder seines Freundes Quarry oder der Brüder Twelvetrees zu begeben. Doch sie hatte noch einiges zu erledigen, ehe sie nach Paris zurückkehren konnte – Bücher zu verkaufen und zu kaufen, Lieferungen abzusenden und in Empfang zu nehmen … und dazu noch ein paar Privatangelegenheiten.
Also hatte Minnie eine Note geschrieben, in der sie Lady Buford den Rest ihres Lohns zukommen ließ und ihre Rückkehr nach Frankreich verkündete, und dann hatte sie einen Monat in Parson’s Green bei Tante Simpson und ihrer Familie gewohnt. Die weniger komplexen Dinge ließ sie durch die Brüder O’Higgins erledigen, und die heikleren Ankäufe hatte sie – mit einigem Widerstreben – Mrs Simpson und ihrem Vetter Joshua anvertraut. Es hatte zwei oder drei Klienten gegeben, die sich geweigert hatten, sich mit jemand anderem als mit ihr zu treffen, und obwohl die Versuchung beträchtlich war, war das Risiko zu groß, und sie hatte ihnen einfach nicht geantwortet.
Einmal war sie mit Tante Simpson noch zu dem Hof gefahren, um sich von ihrer Mutter zu verabschieden. Doch sie hatte sich nicht dazu überwinden können, Sœur Emmanuelles Gemach zu betreten, und hatte nur Kopf und Hände an das kühle Holz der Tür gelegt und lautlos geweint.
Doch jetzt war alles getan. Und sie stand allein im Regen an Deck der Thunderbolt, die wie ein Korken auf den Wellen des Kanals gen Frankreich torkelte. Zu ihrem Vater.
DAS LETZTE, WAS SIE je tun würde, das schwor sie sich, war, ihrem Vater zu sagen, wer es gewesen war.
Er wusste, wer Pardloe war, kannte die Geschichte seiner Familie und wusste, wie verletzbar das Ansehen dieser Familie gegenwärtig war. Und wie leicht Pardloe daher zu erpressen war.
Vielleicht keine direkte Erpressung … zumindest widerstrebte es ihr zu glauben, dass sich ihr Vater dieses Mittels bedienen würde. Er hatte ihr immer davon abgeraten. Nicht aus moralischen Gründen – er hatte Prinzipien, ihr Vater, aber keine Moral –, sondern aus dem rein pragmatischen Grund, dass es gefährlich war.
»Die meisten Erpresser sind Amateure«, hatte er zu ihr gesagt und ihr einen kleinen Stapel Briefe zu lesen gegeben – einen aufschlussreichen Austausch zwischen einem Erpresser und seinem Opfer, verfasst im späten fünfzehnten Jahrhundert. »Sie wissen nicht, was man verlangen kann, und sie wissen nicht, wann sie aufhören sollten, selbst wenn sie es wollten. Die Opfer brauchen nicht lange, um das zu begreifen, und dann … ist die Folge oft der Tod. Für den einen oder den anderen. In diesem Fall«, hatte er gesagt und kopfnickend auf die brüchigen, braun gefleckten Papiere in ihrer Hand gewiesen, »waren es beide. Die Erpresste hat den Erpresser zu sich zum Essen eingeladen und ihn vergiftet. Doch sie hat das falsche Gift benutzt; es hat ihn nicht auf der Stelle umgebracht, aber es hat doch so schnell gewirkt, dass er merkte, was sie getan hatte, und er hat sie beim Dessert erwürgt.«
Nein, vermutlich hatte er nie die Absicht gehabt, Pardloe selbst zu erpressen.
Gleichzeitig war sie jedoch intelligent genug zu begreifen, dass die Briefe und Dokumente, mit denen ihr Vater handelte, oft von Menschen bestellt oder gekauft wurden, die ihrerseits vorhatten, sie zur Erpressung zu benutzen. Sie dachte an Edward Twelvetrees und seinen Bruder und fühlte sich kälter als der eisige Wind des Ärmelkanals.
Sollte ihr Vater merken, dass es Pardloe war, der seine Tochter entehrt hatte … Was in aller Welt würde er tun?, fragte sie sich.
Er würde keine Skrupel haben, Pardloe umzubringen, wenn er es insgeheim tun könnte, da war sie sich hinreichend sicher. Allerdings war er ausgesprochen pragmatisch: Es war gut möglich, dass er nur finanzielle Genugtuung als Kompensation für den Verlust der Jungfräulichkeit seiner Tochter verlangen würde. Diese war schließlich ein verkäufliches Gut.
Oder – die schlimmste aller Möglichkeiten – er könnte versuchen, den Herzog von Pardloe zu zwingen, sie zu heiraten.
Das war es schließlich, was er gewollt hatte: einen reichen englischen Ehemann für sie zu finden, vorzugsweise einen mit einer guten Position in der Gesellschaft.
»Nur über meine Leiche!«, sagte sie laut, sodass ihr ein Matrose, der gerade vorbeikam, einen seltsamen Blick zuwarf.
SIE HATTE ES auf der Rückreise durchgespielt. Wie sie es ihrem Vater sagen würde – was sie ihm nicht sagen würde – was er wohl sagen, denken, tun würde … Sie hatte sich einen Monolog zurechtgelegt – entschlossen, ruhig, endgültig. Sie war darauf vorbereitet, dass er sie anschrie, ihr Vorwürfe machte, sie enterbte, ihr die Tür wies. Sie war in keiner Weise darauf vorbereitet, dass er sie so ansehen würde, als sie in der Ladentür stand, und dass er dann nach Luft schnappen und in Tränen ausbrechen würde.
Völlig verblüfft sagte sie nichts, und im nächsten Moment wurde sie in seinen Armen fast erdrückt.
»Geht es dir gut?« Er hielt sie ein Stück von sich fort, sodass er ihr ins Gesicht sehen konnte, und wischte sich mit dem Ärmel über das feuchte, bangende Gesicht mit den grauen Bartstoppeln. »Hat das Schwein dir wehgetan?«
Sie konnte sich nicht entscheiden, ob sie »Welches Schwein?« oder »Wovon redest du?« sagen sollte, stattdessen begnügte sie sich mit einem skeptisch klingenden »Nein …«.
Da ließ er sie los, trat einen Schritt zurück und fischte in seiner Tasche nach einem Taschentuch, das er ihr reichte. Erst jetzt merkte sie, dass sie schluchzte und ihr die Tränen in die Augen stiegen.
»Es tut mir leid«, sagte sie, und alle Worte, die sie sich zurechtgelegt hatte, waren vergessen. »Ich wollte nicht, dass …« Doch, das wolltest du, rief ihr Herz ihr ins Gedächtnis. Du hast es gewollt. Sie schluckte diesen Gedanken mit ihren Tränen herunter und sagte stattdessen: »Ich wollte dich nicht verletzen, Papa.«
So hatte sie ihn seit Jahren nicht mehr genannt, und er stieß ein Geräusch aus, als hätte ihn jemand in den Bauch geboxt.
»Ich bin der, dem es leidtut, Kleine«, sagte er mit bebender Stimme. »Ich habe dich allein gehen lassen. Ich hätte niemals … ich wusste es … Himmel, ich bringe ihn um!« Das Blut strömte ihm in die bleichen Wangen, und er ließ die Faust auf die Ladentheke knallen.
»Tu das nicht«, sagte sie alarmiert. »Es war meine Schuld. Ich …« Ich was?
Er packte sie bei den Schultern und schüttelte sie, wenn auch nicht fest.
»Sag das ja niemals. Es … was auch immer … wie es auch immer geschehen ist, es war nicht deine Schuld.« Er ließ die Hände von ihren Schultern sinken und holte Luft, keuchend, als wäre er gerannt. »Ich … ich …« Er verstummte, fuhr sich mit zitternder Hand über das Gesicht und schloss die Augen.
Zweimal holte er noch tief Luft, dann öffnete er die Augen und sagte fast wieder mit seiner normalen Ruhe: »Komm und setz dich, ma chère. Ich mache uns Tee.«
Sie nickte und folgte ihm. Ihre Tasche ließ sie liegen, wo sie hingefallen war. Das Hinterzimmer kam ihr gleichzeitig vollkommen vertraut und absolut fremd vor, als wäre sie vor Jahren das letzte Mal hier gewesen, nicht vor Monaten. Es roch falsch, und sie fühlte sich beklommen.
Dennoch setzte sie sich und legte die Hände auf die abgenutzte Tischplatte aus Holz. Ihr war schwindelig vor Augen, und als sie tief Luft holte, um das Gefühl zu unterbinden, kehrte die Seekrankheit zurück, und der Geruch nach Staub und alter Seide, nach Tee und dem nervösen Schweiß so vieler Besucher gerann in ihrem Magen zu einer fettigen Kugel.
»Wie … hast du es herausgefunden?«, fragte sie ihren Vater, um sich von der beklemmenden Anspannung zu befreien.
Er stand mit dem Rücken zu ihr, während er ein Stück von dem bereits sehr mitgenommenen Teeziegel losmeißelte und es in die Porzellankanne mit dem Sprung und den blauen Pfingstrosen fallen ließ. Er drehte sich nicht um.
»Was glaubst du denn?«, sagte er gemessen, und sie dachte plötzlich an die Spinnen mit den Tausenden von Augen, die reglos an ihren Fäden hingen und alles beobachtet …
»Pardonnez-moi«, sagte sie atemlos. Sie stand stolpernd auf, stürmte in den Flur und zur Tür, die auf die Straße führte. Dort übergab sie sich auf das Pflaster.
Sie verharrte vielleicht eine Viertelstunde im Freien und ließ sich das Gesicht von der kalten Luft im Schatten kühlen, ließ die Geräusche der Stadt in ihr Bewusstsein zurückkehren, der Straßenlärm ein schwaches Echo der Normalität. Dann schlug die Glocke von Sainte-Chapelle die volle Stunde, all die anderen folgten, und das ferne Bong der Notre-Dame de Paris teilte der Stadt mit seiner tiefen Bronzestimme mit, dass es drei geschlagen hatte.
»Es ist beinahe Zeit für die Non«, hatte ihre Tante gesagt. »Wenn sie die Glocken hört, wird sie nichts mehr tun, bis das Gebet zu Ende ist, und danach verfällt sie oft in Schweigen.«
»Non?«
»Die Stunden des Tages«, hatte Mrs Simpson gesagt und die Tür aufgedrückt. »Schnell, wenn du möchtest, dass sie mit dir spricht.«
Sie wischte sich den Mund an ihrem Rocksaum ab und ging ins Haus. Ihr Vater hatte den Tee fertig zubereitet; an ihrem Platz stand eine frische Tasse. Sie griff danach, nahm einen Schluck der dampfenden Flüssigkeit, spülte ihren Mund damit aus und spuckte ihn in die Topfpalme.
»Ich bin bei meiner Mutter gewesen«, platzte sie heraus.
Er starrte sie an, so erschrocken, dass er nicht zu atmen schien. Nach einem langen Moment öffnete er vorsichtig die geballten Fäuste und legte die Hände auf den Tisch, eine auf die andere.
»Wo?«, sagte er ganz leise. Sein Blick war immer noch gebannt auf ihr Gesicht geheftet.
»In London«, sagte sie. »Hast du gewusst, wo sie war – ist?«
Er hatte angefangen zu überlegen; sie sah die Gedanken hinter seinen Augen umherhuschen. Was wusste sie? Würde sie ihm eine Lüge abnehmen? Dann kniff er die Augen zusammen, holte tief Luft und atmete durch die Nase aus, ein Seufzer … der Entscheidung, dachte sie.
»Ja«, sagte er. »Ich … stehe mit ihrer Schwester in Verbindung. Wenn du Emmanuelle begegnet bist, hast du vermutlich auch Miriam kennengelernt?« Eine seiner buschigen Augenbrauen hob sich, und sie nickte.
»Sie hat gesagt … gesagt, dass du für ihren Unterhalt bezahlst. Aber hast du sie einmal gesehen? Gesehen, wo sie sie verwahren, gesehen, wie … es ihr geht?« Die Gefühle durchtosten sie wie ein nahendes Gewitter, und sie konnte die Stimme nur mit Mühe ruhig halten.
»Nein«, sagte er, und sie sah, dass er bleich um die Lippen geworden war; ob vor Wut oder durch ein anderes Gefühl bewegt, konnte sie nicht sagen. »Ich habe sie nie wiedergesehen, nachdem sie mir gesagt hat, dass sie ein Kind erwartet.« Er schluckte, und seine Augen wanderten zu seinen gefalteten Händen.
»Ich habe es versucht«, sagte er und hob den Blick, als hätte sie seine Worte infrage gestellt, obwohl sie nichts gesagt hatte. »Ich bin zum Kloster gegangen, habe mit der Mutter Oberin gesprochen. Sie hat mich verhaften lassen.« Er lachte auf, aber ohne Humor. »Hast du gewusst, dass die Entweihung einer Nonne ein Verbrechen ist, für das man an den Pranger kommt?«
»Ich vermute, du hast dich freigekauft«, sagte sie, so schneidend sie konnte.
»Das würde jeder tun, der die Mittel dazu hat, ma chère«, sagte er beherrscht. »Aber ich musste Paris verlassen. Damals kannte ich Miriam noch nicht, aber ich wusste von ihr. Ich habe ihr eine Nachricht geschickt und Geld und sie angefleht herauszufinden, was sie mit Emmanuelle gemacht hatten … sie zu retten.«
»Das hat sie auch getan.«
»Ich weiß.« Er hatte sich jetzt wieder im Griff und sah sie scharf an. »Und wenn du Emmanuelle gesehen hast, weißt du auch, wie ihr Zustand ist. Sie ist verrückt geworden, als das Kind …«
»Als ich geboren wurde!« Sie schlug mit der Hand auf den Tisch, und die Tassen klirrten auf ihren Untertassen. »Ja, ich weiß. Und gibst du mir die Schuld für ihre … für das, was mit ihr geschehen ist?«
»Nein«, sagte er mit sichtlicher Überwindung. »Das tue ich nicht.«
»Gut.« Sie holte Luft und platzte heraus. »Ich bin schwanger.«
Er wurde leichenblass, und sie dachte, er würde in Ohnmacht fallen. Sie dachte, auch sie würde vielleicht in Ohnmacht fallen.
»Nein«, flüsterte er. Sein Blick sank auf ihre Taille, wo ihr ein tiefes Rumoren das Gefühl gab, sie könnte sich noch einmal übergeben.
»Nein. Ich werde … ich werde nicht zulassen, dass dir so etwas zustößt!«
»Du –« Sie hätte ihn am liebsten geohrfeigt, hätte es vielleicht sogar getan, wenn er nicht auf der anderen Seite des Tisches gestanden hätte.
»Wage es nicht, mir zu sagen, wie ich es loswerden kann!« Sie fegte Tasse und Untertasse vom Tisch und schleuderte sie in einer Flut von Bohea-Tee an die Wand. »Das würde ich niemals tun – niemals, niemals, niemals!«
Ihr Vater holte tief Luft und nahm bewusst eine entspanntere Haltung an. Er war nach wie vor bleich, seine Augen von Falten der Bestürzung umringt, doch er hatte sich unter Kontrolle.
»Das«, sagte er leise, »ist das Letzte, was ich je tun würde. Ma chère. Ma fìlle.«
Sie sah, dass seine Augen voller Tränen waren, und spürte seinen Schmerz wie einen Hieb. Er hatte sie gerettet, als sie geboren war. Hatte sein Kind gerettet, es umsorgt und bei sich behalten.
Seine Augen waren auf ihre Fäuste gerichtet, als sie sie löste, und er kam einen Schritt auf sie zu, zögernd, als liefe er auf Eis. Doch sie wich nicht zurück, sie schrie ihn nicht an, und noch ein Schritt, und sie lagen sich in den Armen und weinten beide. Sein Geruch hatte ihr so gefehlt, Tabak und schwarzer Tee, Tinte und süßer Wein.
»Papa …«, sagte sie und weinte noch mehr, weil sie nie »Mama« hatte sagen können und es auch nie können würde, und weil dieses winzige, hilflose Wesen, das sie trug, nie einen Vater haben würde. Sie hatte sich noch nie so traurig gefühlt – und getröstet zugleich.
Er hatte sich um sie gesorgt. Er hatte sie zu sich geholt, als sie geboren war. Er hatte sie geliebt. Er würde sie immer lieben – das war es, was er jetzt sagte, ihr in das Haar murmelte, während er mit den Tränen kämpfte. Er würde nie zulassen, dass man sie verfolgte und quälte wie ihre Mutter, würde nie zulassen, dass ihr oder dem Kind etwas zustieß.
»Ich weiß«, sagte sie. Erschöpft legte sie ihren Kopf an seine Brust und hielt ihn fest, wie er sie festhielt. »Ich weiß.«