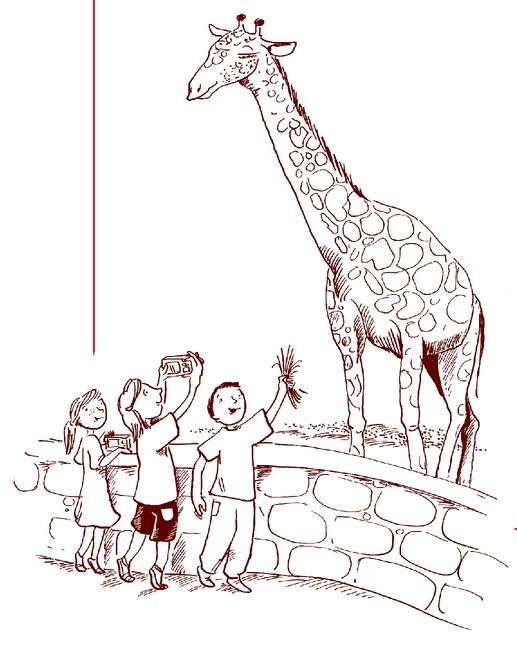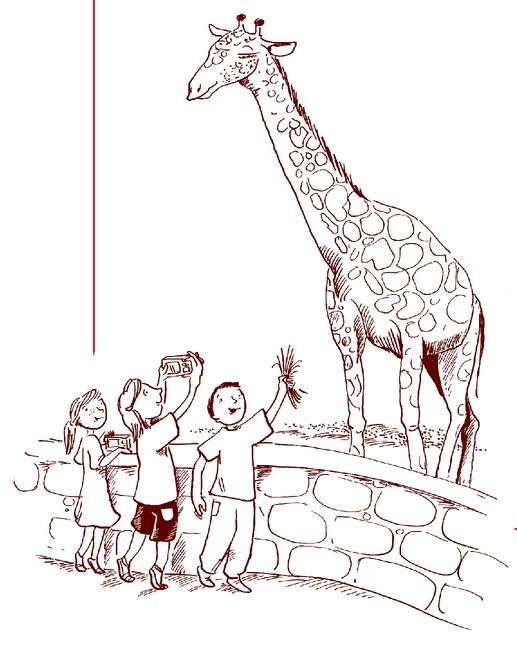Computerspiele Fernsehen & Co.
Am Thema Medien kommen Eltern und Erziehende heute nicht mehr vorbei. Es stellt Familien mit Vorschul- ebenso wie mit Schulkindern vor große Herausforderungen. Da Kinder mit den neuen Medien und Geräten wie Computer, Playstation, Internet und Handy ganz »normal« aufwachsen, entwickeln sie einen Zugang zu ihnen, der anders ist als der unsere. Im Gegensatz zu manchen Eltern bewegen sie sich in den elektronischen, digitalen und virtuellen Welten mit beneidenswerter Leichtigkeit. Manchmal werden Kinder und Jugendliche heute als »digital natives« bezeichnet, als »digitale Muttersprachler«, während die ältere Generation sich innerhalb der digitalen Medien eher wie in einer mehr oder minder vertrauten Fremdsprache bewegt.
Das heißt für Erwachsene: Wenn sie Kinder in virtuellen Welten begleiten möchten, um ihnen Medienkompetenz zu vermitteln, müssen sie sich damit auseinandersetzen und über die technischen Gegebenheiten und Umstände der modernen Medien mehr wissen und können, um diese selber zu begreifen, zu bedienen und im passenden Moment einzusetzen.
Medienerziehung: Was zu beachten ist
Zu früher und zu viel elektronischer und digitaler Medienkonsum und stundenlanges Medien-Spielen kann kleine Kinder behindern, all ihre Sinne in einem natürlichen Tempo auszubilden wie: hören, sehen, riechen, schmecken, tasten, sich bewegen von Kopf bis Fuß, den Gleichgewichtssinn aufbauen oder eine reiche Sprache entwickeln! In passivem Medienkonsum liegt immer auch ein Suchtpotenzial. Professor Manfred Spitzer geht in seinem Buch Vorsicht Bildschirm sogar so weit zu sagen: »Fernsehen macht Kinder dick, dumm und aggressiv.«
Förderspiele am Bildschirm?
Viele Hersteller locken mit vollmundigen Versprechungen, wie viel Kinder an Lern- oder Förderspielen am Computer oder Gameboy lernen könnten. Doch vor dem »BeGreifen« braucht es das »Greifen«! Rein kognitives oder abstrahierendes Verstehen kann sich nicht ausbilden ohne tatsächliche, handfeste Erfahrungen. Kinder, die schlecht rückwärts gehen können, tun sich beispielsweise auch schwerer beim Subtrahieren - die abstrakte mathematische Aktion nachzuvollziehen ist viel schwerer für den, der die Bewegung nicht im eigenen Körper verankert hat. »Mit jeder Stunde, die Kinder vor dem Computer verbringen, fehlt ihnen eine Stunde, um ihr Gehirn für die Anforderungen im wirklichen Leben weiterzuentwickeln«, mahnt der Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther. Turnen, musizieren, Fingerspiele, die Natur entdecken - all das ist weitaus geeigneter, um Kinder zu fördern. »Kinder und Jugendliche brauchen Aufgaben, an denen sie wachsen und neue Erfahrungen machen können. Sie brauchen auch Anregungen und Gelegenheiten, um ihre sportlichen oder künstlerischen Talente zu entwickeln und Eltern, die ihnen Liebe, Geborgenheit und Orientierung geben«, meint Hüther.
Eltern sollten möglichst viele alternative Spielformen anbieten, die eine anregende Umgebung schaffen. »Normales« Kinderspiel ist mit seiner sinn- und gefühlsanregenden Vielfalt der beste Schutz gegen Fernsehschäden und elektronische Mediensucht.
Kinder sehen anders
Kinder nehmen Fernsehbilder und Medieninhalte anders wahr als Erwachsene, sie fürchten sich vor anderen Dingen und haben an anderen Sachen Spaß. Sie begreifen oft den Zusammenhang der Geschichte nicht, weil die Bildfolgen zu schnell sind oder inhaltliche Sprünge passieren, die Kinder noch nicht begreifen. Beispielsweise lässt sich in Untersuchungen zeigen: Wenn ein Hase in einem Tunnel verschwindet und auf der anderen Seite wieder herauskommt, glauben kleine Kinder, dass es sich um eine andere Figur handelt. Auch schrille, laute und unheimliche Töne und Musik können Angst auslösen.
Beobachten Sie Ihr Kind, wenn es sich mit Medien beschäftigt. Nehmen Sie an seinen Empfindungen und Wahrnehmungen Anteil. Lassen Sie sich erzählen, was es gesehen hat, was ihm besonders gut gefällt und was es »blöd« findet oder ihm Angst einflößt. Bieten Sie Ihrem Kind immer wieder Gelegenheiten, die Mediengeschichten im Rollenspiel darzustellen oder beim Malen und im Freispiel zu verarbeiten. Beobachten Sie die Gefühle und Reaktionen des Kindes auf die gesehene Sendung. Begleiten Sie Ihr Kind durch Zuhören und klärende Gespräche.
Kreativer Umgang mit Medien
• Sinnvoll sind besonders Aktivitäten, die dem isolierten Vor-dem-Bildschirm-Hocken entgegenwirken und die eigenes Gestalten fördern wie z. B.: Wir machen die Kinder mit der Digitalkamera vertraut und stellen ihnen kleine Fotoaufgaben wie: Wo wohne ich? Was ist mein Lieblingsbaum? Wer fotografiert ein Tier? usw. Anschließend laden wir die Fotos auf den PC und drucken sie aus. Die Kinder kleben ein Fotoalbum oder ein Gemeinschaftsbild.
• Wir gestalten mit den Kindern gemeinsam ein kleines Hörspiel mit Dialogen und Geräuschen oder nehmen wie ein Reporter Gespräche auf.
• Wir brennen zusammen eine CD mit der Lieblingsmusik jedes Kindes und stellen auch ein schönes Cover her.
• Wir schauen uns gemeinsam DVDs an. Hier ein sinnvolles Beispiel: Jiriki geht seit Kurzem in die erste Klasse. Er ist sehr neugierig und wissensdurstig. Er wünscht sich DVDs, die zeigen, »wie es innen aussieht«. Er hat schon zwei bekommen: Die eine zeigt, wie ein Flugzeug aufgebaut ist und funktioniert, und die andere erzählt das Gleiche von einem Schiff. Er ist hell begeistert und jeder, der ins Haus kommt, muss mit ihm diese DVDs anschauen und darüber sprechen.
• Schulreife Kinder dürfen gelegentlich auf dem PC Kinderspiele machen oder Bilder ausmalen.
• Selbstverständlich gehören Kinder- und Bilderbücher zum täglichen Leben!
Kein mediendominanter Tagesablauf
Wählen Sie gemeinsam mit den Kindern aus, welche Sendungen sie sehen dürfen. Auch wenn es Kinderkanäle gibt, die den ganzen Tag Kinderprogramme ausstrahlen, heißt das noch lange nicht, dass die Kinder stundenlang und täglich vor der »Flimmerkiste« sitzen müssen oder dürfen!
Treffen Sie klare, unverrückbare Regelungen, wer wie lange und wie oft am Computer sitzen und Fernsehen oder Video ansehen darf. Geben Sie für kleine Kinder nie die Fernbedienung aus der Hand. Sie behalten damit sozusagen die »Schlüsselgewalt« über das Fernsehgerät und ersparen sich damit viele unnütze Diskussionen.
Nehmen Sie beliebte und wertvolle Sendungen oder kurze Kinderfilme auf, denn Kinder lieben Wiederholungen. Die Kinder können dann ihre Lieblingssendung öfter ansehen, wann und wie es ihnen passt. Es ist besser, sich eine Sendung immer wieder anzusehen als in der gleichen Zeit viele unterschiedliche Sendungen, denn die Wiederholung trägt zum besseren Verständnis bei.
Bei allen Untersuchungen zu kindlichen Freizeitwünschen standen Aktivitäten mit Eltern oder mit Freunden an erster Stelle. Kinder brauchen viel Bewegung, sinnliche Wahrnehmungen und direkten sprachlichen Austausch, um sich gesund zu entwickeln. Darum ist es an uns, darauf zu achten, dass sie nicht »Couchpotatoes« werden! Digitale Medien dürfen nie den gesamten Tagesablauf der Kinder bestimmen. Darum sind Erwachsene gefordert, klare Regelungen und Absprachen zu treffen.
Wie viel Medienkonsum darf es sein?
• Für Zwei- bis Vierjährige empfiehlt sich eine kurze Sendung von zehn Minuten bis zu einer halben Stunde, aber nicht täglich! Das Zuschauen oder Zuhören wird einfacher für die Kleinen, wenn sie sich dazwischen frei bewegen können und Fragen stellen dürfen.
• Für Vier- bis Fünfjährige sind auch kleine Hörspiele auf CD interessant. Am Anfang gönnen wir uns ein gemeinsames Zuhören, tauschen Gedanken dazu aus und regen die Kinder an, das Gehörte nachzuspielen.
• Gute Kinderradiosendungen (beispielsweise »Lilipuz« oder »Bärenbude«, beide WDR 5) liefern ausgewählte kindgerechte Hörspiele und Informationen.
• Für Fünf- bis Siebenjährige empfiehlt sich eine bis höchstens zwei Sendungen, maximal 45 Minuten, nicht täglich. Wenn möglich sehen wir uns die Sendungen gemeinsam an. Spaßiges und Seltsames lässt sich besser verarbeiten, wenn ein Elternteil daneben sitzt.
• Hin und wieder schauen wir uns einen kleinen Spielfilm gemeinsam an. Es können auch Familienaufnahmen sein.
• Nutzen Sie bei einem Video oder einer DVD auch die Möglichkeit, eine Pause einzulegen! Das gibt Raum, sich über das Gesehene zu unterhalten, sich etwas zu bewegen oder ein Glas Wasser zu trinken.
Machen Fernsehen und Computerspiele gewalttätig?
Momentan gibt es auf der Erde so viel Gewalt, Verbrechen und Kriege, sodass wir die Kinder so wenig wie möglich mit zusätzlicher Gewalt aus den Medien »füttern« sollten. Kinder fragen nach dem Sinn des Lebens und nach Gott. Sie fragen: Warum muss der sterben? Warum tun die Bösen das? Wäre das auch bei uns möglich? Dadurch sind Eltern und Erziehende herausgefordert und suchen nach Antworten. Wir möchten die Kinder ja nicht in Angst und Schrecken erziehen, sondern zu Hoffnung und Vertrauen. Das hat mit falsch verstandener »heiler Welt« nichts zu tun. Kinder brauchen eine altersgemäße Hilfestellung, um gesund und stark in die Welt hineinzuwachsen, sie brauchen gerade im Vorschulalter sicher nicht täglich TV-Nachrichten mit brutalen, grässlichen Bildern und vor dem Einschlafen keine Krimis mit Mord und Totschlag.
Der Zen-Meister Thich Nhat Hanh schreibt in seinem Buch Zeiten der Achtsamkeit zur Problematik des Fernsehens für Erwachsene und Kinder:
»Wir schalten den Fernsehapparat ein, lassen ihn laufen und erlauben, dass andere Menschen uns führen, formen und zerstören. Wenn wir uns derart verlieren, legen wir unser Geschick in die Hände anderer, die womöglich verantwortungslos handeln. Wir müssen aufpassen, welche Sendungen unserem Nervensystem und Geist, unserem Herzen schaden - und welche uns gut tun.«
Über den tatsächlichen Einfluss gewalttätiger Bilder auf Kinder streiten sich die Experten. Sicher ist jedoch ein Kind, das in einem stabilen, liebevollen Umfeld aufwächst, das sich selbst und seinen Körper in vielfältiger Weise ausprobieren und erfahren darf, das reale Herausforderungen und Abenteuer bestehen kann und Erfolgserlebnisse hat, weit weniger gefährdet, computersüchtig zu werden oder an gewalttätigen Bildern und Computerspielen Schaden zu nehmen. Machen wir uns klar, was unsere Kinder an den virtuellen Welten eigentlich so fasziniert - und übernehmen wir dann die Verantwortung dafür, Kindern und Jugendlichen ein Umfeld zu bieten, das ihren Bedürfnissen wirklich gerecht wird. Im Spiel, das die Sprache des Herzens kennt, kann das wunderbar gelingen.