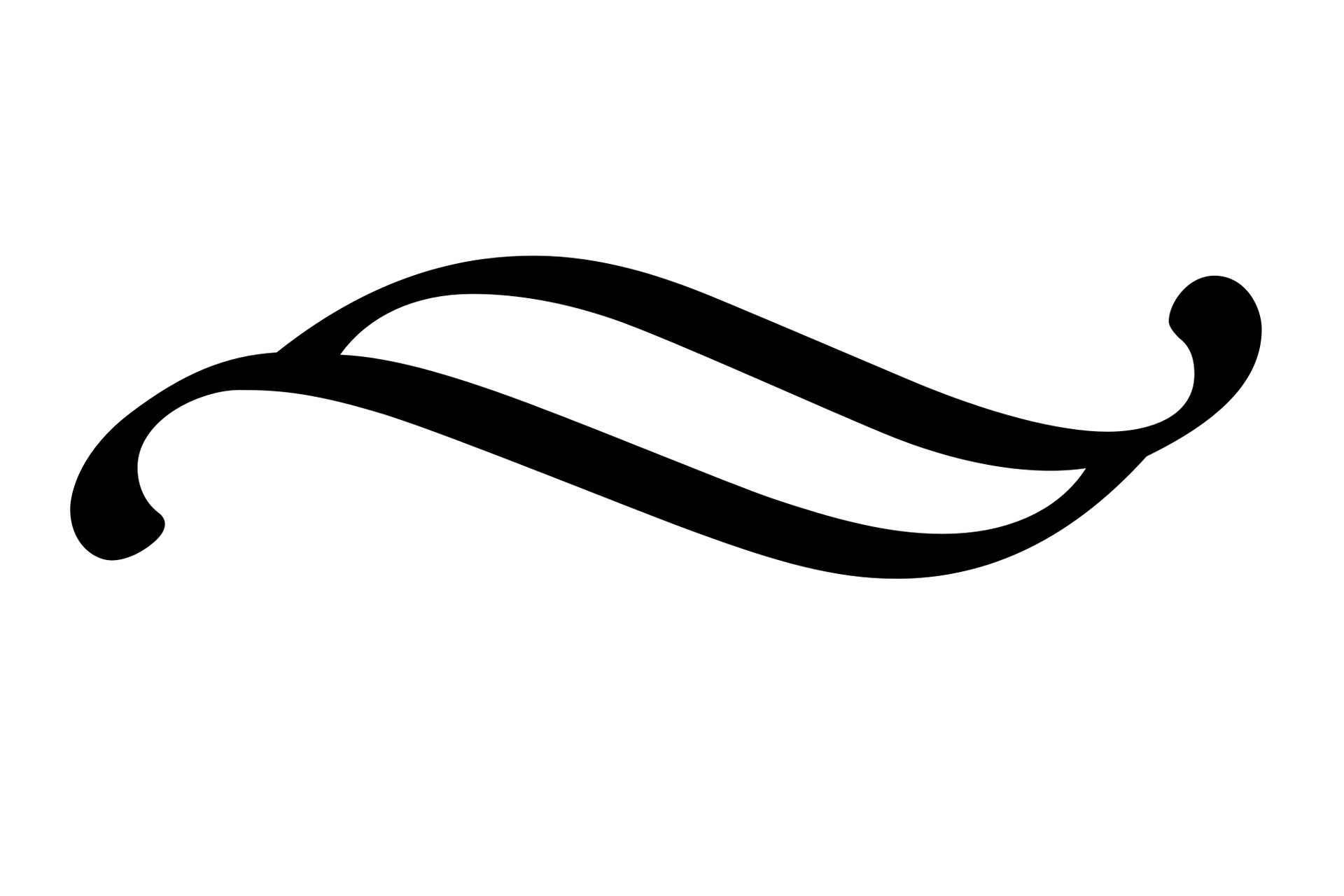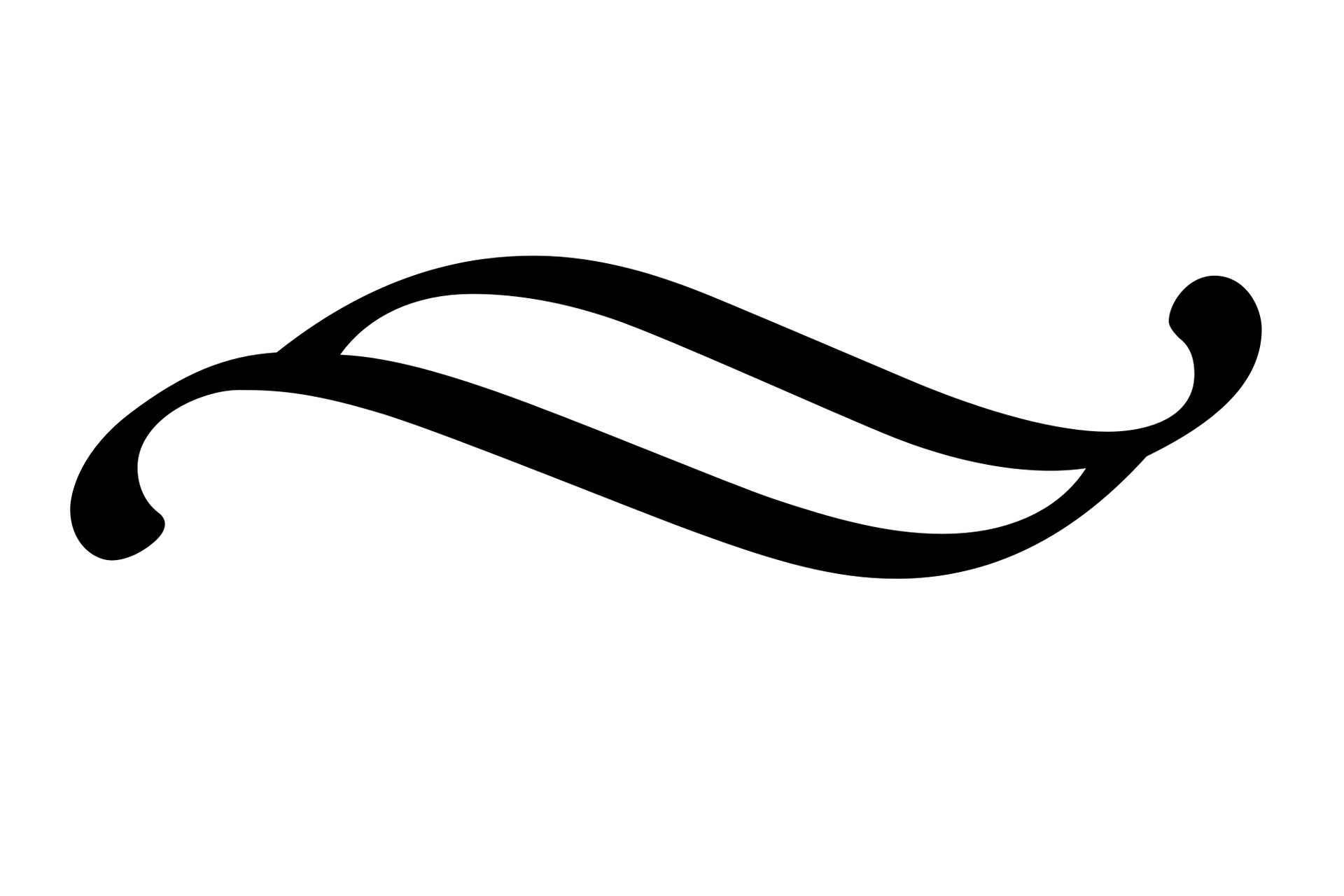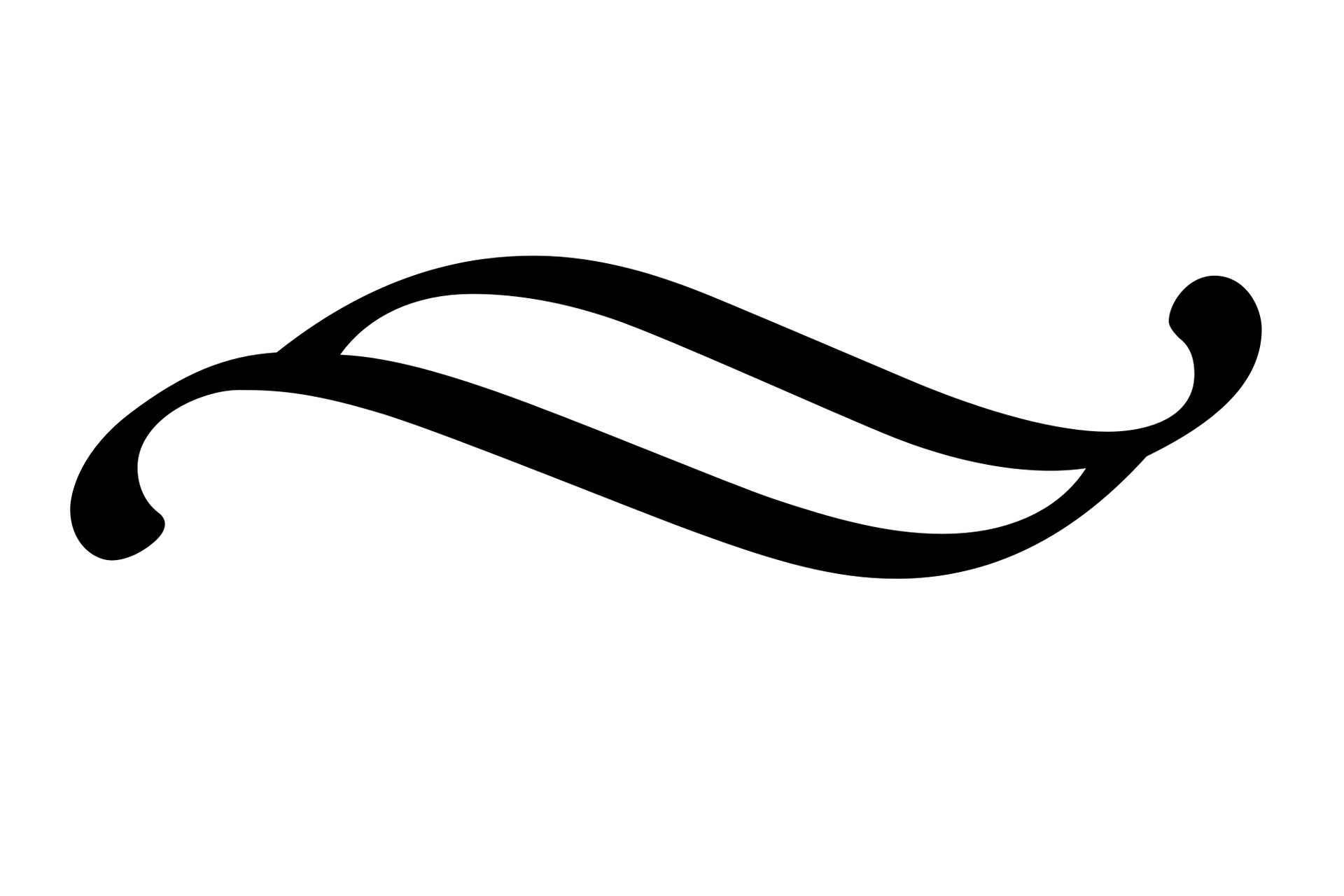E
iner für alle – alle für einen.
Niemals hat die Geschichte wahrere Worte geschrieben, die gleichzeitig so unfassbarer Bullshit sind.
Seufzend lasse ich meinen Blick über die monströse Anzahl an Bierkästen und Schnapsflaschen schweifen, die die gesamte Arbeitsfläche unserer Küche in Beschlag nehmen. Ein paar Kästen stapeln sich auf dem Boden davor, und auch einen guten Teil des Kühlschranks füllen die Flaschen aus. Unmengen an Alkohol, die nur darauf warten, von uns und unseren Gästen verputzt zu werden. Gäste, die zwar gebeten werden, auch etwas mitzubringen – aber wir stehen schließlich nicht an der Tür und kontrollieren. Bisher ging es immer gut, jeder hatte seinen Spaß. Und wer wollte, hatte genug Alkohol, um sich ordentlich einen hinter die Binde zu kippen.
Spaß. Belanglosigkeit. Gute Musik.
Nicht zum ersten Mal fühle ich bei diesem Ausblick Widerwillen.
Die Jungs rücken ein paar Möbel im Wohnzimmer umher, dumpfe Bässe dringen an mein Ohr, und der glasklare Klang von Helenas Gelächter schneidet einmal quer durch meine Seele. Maik ruft etwas, das eindeutig an sie gerichtet ist, und ein zweiter, noch tieferer Schnitt hinterlässt eine weitere Wunde.
Ein lautloses Stöhnen entkommt meinen Lippen, und meine Hand fährt unbewusst zu meiner Brust. Ich muss hier raus. Ich kann das nicht. Nicht heute. Sorry, Leute – ohne mich.
Meine Wangen brennen, und ich spüre diese Wut unter meiner Oberfläche brodeln. Mittlerweile kenne ich sie gut genug, um sie als alte Freundin zu bezeichnen, aber es gab eine Zeit, in der es solch heftige Gefühle selten in mir gegeben hat. Der immer ausgeglichene, ruhige Timo? Vergangenheit, verdammt nochmal. Und ich kann genau sagen, wann es zu diesem Umbruch bekommen ist.
Ich definiere mich neuerdings gerne in »vor Helena«. Und traurigerweise eben auch in »danach«.
Schlimmer als die Wut ist jedoch die drückende Enge, die sich um meinen Brustkorb legt. Ich habe eine Weile gebraucht, um dieses Gefühl einzuordnen. Viel schwerer zu identifizieren als Wut, Freude, Irritation und all diese typischen Regungen, die man mehrmals täglich spürt. Denn das – das ist wirklich neu.
Hektisch lasse ich ein letztes Mal meinen Blick schweifen. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, mir eine Flasche Wodka zu schnappen und alleine loszuziehen. Mir einen ruhigen Ort abseits zu suchen, den Schnaps zu köpfen und gegen dieses Gefühl anzukämpfen. Doch das geht zu weit. Alleine auf einer Parkbank abstürzen? Ich bin ziemlich tief gesunken, aber einen Rest Würde habe ich mir bewahrt. Also nehme ich mir nur einen der vier verbliebenen Isodrinks aus dem Kühlschrank und wende mich ab, ehe ich doch noch eine richtig beschissene Entscheidung fälle.
An der Haustür zögere ich, hin und her gerissen zwischen dem Bedürfnis, von hier fortzukommen, und dem Wissen, dass meine Freunde sich womöglich sorgen werden, wenn ich einfach so verschwinde. Gerade, als ich glaube zu wissen, was ich tue und einmal mit meinem Schlüsselbund klimpere, betritt niemand anderes als Jo den Flur. Von all den anderen ist er wohl die beste Alternative. Unsere Blicke treffen sich – und verflucht. Die Enge in meiner Brust wird beinahe unerträglich, als ich das Mitgefühl in seinen Augen wahrnehme.
Ich korrigiere mich. Ganz beschissene Alternative.
»Alles okay, Kumpel?«
Für einen Moment presse ich meine Zähne aufeinander – so fest, dass ich glaube, mein Kiefer bräche auseinander. Dann mache ich eine Bewegung, die Nicken und Kopfschütteln zugleich ist. »Wird schon. Ich muss nochmal weg. Ich werde -«
»Schon gut. Ich verstehe.« Jo unterbricht mich, ehe ich ein Versprechen gebe, das ich womöglich nicht einhalten werde. Und ich weiß, dass er es ernst meint. Er versteht mich wirklich. Jo ist so etwas wie der Ruhepol in dieser WG, und viel früher als so manch anderer hat er meine inneren Konflikte durchschaut.
Weil die Enge mittlerweile meinen Hals erreicht hat, nicke ich erneut, ehe ich endlich den erlösenden Schritt wage und das erste Mal, seitdem wir zu unseren legendären Hauspartys laden, verschwinde, ehe es überhaupt losgeht.
Das Schlimmste daran: Zu wissen, dass mich wahrscheinlich sowieso niemand vermissen wird.
Willkommen in meinem Leben.
Einer für alle – alle für einen.
Jepp. Das war mal unser Motto. Ist es noch immer, irgendwie. Während ich planlos durch die frühabendlichen Straßen laufe, muss ich darüber nachdenken, wie es war, als wir uns gefunden und die WG gegründet haben. Uns einte die Leidenschaft für Sport, die Faszination für Parkour. Wir machten Nägel mit Köpfen, gingen viral, wurden zu JumpSquad. Die coole Truppe. Die Jungs von der Uni, die die Welt zu ihrem Spielplatz machen, ohne mit der Wimper zu zucken.
Nur, dass so vielen gar nicht klar ist, dass auch ich ein Teil davon bin, weil man mich auf den offiziellen Videos nahezu niemals sieht – ich bin der Kameramann. Der Mann im Hintergrund, der die Stunts filmt und schneidet und für das Endprodukt sorgt, das später im Netz zu sehen ist. Der Typ, der extra einen Sommerjob angenommen und Überstunden gekloppt hat, um sich seine Kamera zu kaufen; eine Sony Alpha 6500. Mein ganzer Stolz – aber darüber muss ich mit niemandem reden. Versteht sowieso keiner.
Außer Helena.
Bei den öffentlichen Trainings bin ich mit am Start und zeige, dass auch ich mich gerne frei bewege. Grenzenlos. Obwohl mir das nicht immer reicht, stand es noch nie außer Frage, dass ich diesen Part übernehme. Im Rahmen meines Studiums der Medienwissenschaften habe ich ein gesteigertes Interesse für jede Arbeit rund ums Filmen und will später beruflich in diese Kerbe schlagen – ein perfektes Übungsfeld für mich.
Außerdem hat es mich nie gestört, im Hintergrund zu sein. Eigentlich tut es das noch immer nicht. Ganz sicher empfinde ich es nicht als Strafe.
Wenn es denn nicht neuerdings den beschissenen Druck auf meiner Brust verstärken würde. Den Druck, den ich endlich, endlich verstanden habe. Nach nächtelangen Grübeleien, inneren Bestandsaufnahmen und einem sehr Gin-lastigen Abend – nicht mit meinen Freunden, sondern alleine –, war es mir auf einmal klar.
Es ist Einsamkeit. Und dann auch noch eine ganz spezielle Form. Keine reine Sehnsucht, kein Bedürfnis nach Nähe im Allgemeinen. In einer WG mit drei Jungs herrscht eigentlich nie Ruhe. Nein. Es ist Einsamkeit, durchzogen mit Neid.
Neid auf das Glück meiner Freunde – bei einem von ihnen sogar ganz speziell.
Einer für alle, alle für einen. Das zählte mal, als wir noch zu viert waren. Als es nur uns gab, Parkour, das zugehörige Workout, Seminare und Playstation-Duelle an entspannten Abenden. Damals war es unkompliziert. Das erste Mal in meinem Leben lebte ich in einem reinen Männerhaushalt, genoss die Einfachheit, aber auch das bedingungslose Vertrauen in meine Freunde – denn ganz ehrlich, ohne könnten wir nicht gemeinsam eine solche Art von Sport betreiben.
Aber dann kamen die Mädchen.
Der Druck in meiner Brust wird heftiger. Frustriert reibe ich mit der Faust über die schmerzende Stelle, doch dadurch wird es nicht besser, im Gegenteil. Verdammt nochmal. Ich habe nichts gegen Frauen. Hatte ich noch nie. Ich schätze sie, ja, aber ich habe im Laufe der Jahre ein ums andere Mal einige sehr schmerzhafte Erfahrungen machen müssen, die mir einen sehr deutlichen Stempel aufgedrückt haben. Lange Zeit habe ich mich dagegen gewehrt. Habe versucht, dagegen anzukämpfen, wollte es nicht glauben. Mittlerweile jedoch ist mir klar, dass ich mich meinem Schicksal ergeben habe.
Ich bin der Inbegriff der Friendzone.
Wütend reibe ich weiter über meine schmerzende Vorderseite. Ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß. All die Jahre habe ich zusehen müssen, wie jeder um mich herum ein Mädchen fand. Oder wahlweise auch mehrere. Immer wieder waren welche dabei, die auch mich interessiert haben, doch der Ablauf war immer der gleiche: Sie hingen mit mir ab, aber vögelten mit meinen Freunden.
Nicht, dass es mir nur um den Sex geht. Das war noch nie mein alleiniges Ziel.
Aber einmal – ein einziges Mal möchte ich erleben, dass ich genüge. Dass ich mehr bin als ein sexuelles Neutrum. Ich will mehr sein als der Wohlfühl-Kumpel. Und verdammt nochmal, ich will nie wieder ein gebrochenes Herz haben. Meine aktuellste Erfahrung darin, als Partner nicht auszureichen, gar nicht erst in Erwägung
gezogen zu werden, hat bereits so desaströsen Schaden angerichtet, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich es wieder vollständig zusammensetzen soll.
Ein weiterer Schlag aus dieser Richtung, und ich werde aufgeben müssen.
Ich bin ja jetzt schon kurz davor.
Der würzige Geruch von Käse, Knoblauch und Brot dringt in meine Nase. Ich hebe überrascht den Kopf und stelle fest, dass ich wohl doch nicht ganz so planlos durch die Gegend gelaufen bin wie gedacht. Ohne es zu bemerken, habe ich in der vergangenen halben Stunde meine Schritte ins Zentrum gerichtet, bis ich vor einem sehr bekannten Italiener halt gemacht habe.
Ich schüttle den Kopf, unsicher, ob ich belustigt oder irritiert sein soll. Immerhin lüftet sich so etwas von dem Druck auf meiner Brust. Zumindest für den Moment.
Seufzend werfe ich einen Blick durch die gläserne Front und sehe, dass ein guter Teil der Tische besetzt ist – aber eben nicht alle. Eigentlich habe ich keinen sonderlichen Appetit. Ich bin derart in meinem Selbstmitleid versunken, dass ich Galle schmecke und ganz bestimmt keinen Bock auf Pizza oder Pasta habe.
Und doch – nach einem kurzen Zögern betrete ich die Trattoria
. Nicht, weil ich es geplant habe. Nicht, weil ich denke, dass es die beste Idee ist, in ein Restaurant zu gehen, das von Freunden und Pärchen bevölkert sein wird, wo ich selbst doch gerade mit der einschnürenden Einsamkeit zu kämpfen habe, die mir mehr und mehr zu schaffen macht.
Sondern lediglich, weil es mir wie die einzige Option erscheint, um nicht vollends durchzudrehen. Vielleicht habe ich ja Glück und Tasha arbeitet an diesem Abend. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie mich mit ihren lockeren Sprüchen auf andere Gedanken bringt.
Erst einmal im Inneren, stelle ich fest, dass sogar noch mehr los ist, als ich angenommen habe. Ich muss einige Minuten warten, ehe ein Kellner in meine Richtung kommt, um mir einen Tisch zuzuweisen. Es ist mein vierter Besuch in den letzten zwei Wochen, und ich bilde mir ein, dass der Typ mich erkennt. Vielleicht sieht er sogar ein bisschen mitleidig aus – aber ich versuche, nicht näher darüber nachzudenken, sonst verlasse ich das Restaurant doch wieder, und dann kann ich nie mehr zurückkommen. Zumindest einen Rest meines Stolzes muss ich mir bewahren.
Gott sei Dank hat er einen Tisch für mich. Keinen von der Sorte, wie Pärchen sie zu einem romantischen Date haben wollen, am Fenster oder in einer der privaten Nischen, aber nahe an der Küche, und wenn man bedenkt, dass ich auf Tashas Gesellschaft hoffe, ist das gar nicht so verkehrt.
Auch wenn sie vermutlich gar keine Zeit haben wird, mit mir zu quatschen, selbst wenn sie da ist. Ich brauche nur einmal meinen Blick schweifen lassen, um zu bemerken, dass die Kellner alle Hände voll zu tun haben.
Was zur Hölle tue ich hier eigentlich?
Ich versuche, niemandem auf den Teller oder in die Augen zu sehen, während ich den Platz ansteuere, der mir zugewiesen wurde. Gedankenverloren reibe ich meine Brust, die sich erneut mit Schwere füllt, und ziehe in Erwägung, Jo eine Nachricht zu schicken. Oder Daniel. Kurz wandern meine Gedanken sogar zu Helena, doch das löst nichts als einen weiteren scharfen Schmerz in meiner Magengrube aus, also beschließe ich, mich bei niemandem zu melden. Jo weiß, dass ich abgehauen bin.
Mehr müssen die Jungs vorerst nicht wissen.
Ein schräges Gefühl, alleine in einem Restaurant zu sitzen – ohne auf jemanden zu warten, der sich dazugesellen wird. Meine vergangenen Besuche hier hatten genau dieses Ziel: Verabredungen mit Frauen, die ich über eine Dating-App kennengelernt habe. Verzweifelte Versuche, jemanden zu finden, der mehr in mir sieht als einen Kumpel – und der mich davon ablenkt, dass ich einen weiteren Korb eingeholt habe. Einen, der beinahe meine Freundschaft zu Maik zerstört hat und der mir jeden Tag aufs Neue unter die Nase gerieben wird.
Ich schätze, ich muss nicht betonen, dass kein einziger Versuch von Erfolg gekrönt war.
Als ich mir nun die Karte schnappe, ist das nichts weiter als ein Akt der Verlegenheit. Ich bin alleine in einem Restaurant, an einem Samstagabend, während jeder andere um mich herum ein normales Sozial- und Liebesleben führt. Ich habe einer Party in unserem Haus den Rücken gekehrt, um hier zu sitzen – also muss ich ein Mindestmaß an Normalität wahren und der Etikette folgen.
Und die besagt, dass ich ein Gericht auswählen muss, selbst wenn ich eigentlich schon genau weiß, was ich bestellen werde, wenn denn -
»Timo!«
Jackpot. Nun lüftet sich ein beträchtlicher Teil des Drucks auf meiner Brust. Ich lasse die Karte sinken, um in die erfreute, aber auch überraschte Miene der Kellnerin zu schauen, deren Gesellschaft ich mir nach meiner unbewussten Flucht hierher am meisten gewünscht habe.
»Tasha.« Ich schenke ihr ein, so hoffe ich, glaubhaftes Lächeln. Da sie als Reaktion ihre Stirn in Falten legt, ahne ich jedoch, dass meine Mission nicht geglückt ist.
»Heute ohne Rose?«
Hm, ja. Mein Erkennungszeichen der vergangenen Dates war nicht gerade sehr einfallsreich. Eine langstielige Rose, die auf mich aufmerksam machen sollte. Zwar ist mein Bild relativ aussagekräftig, aber man weiß ja nie. Tasha hat es sich zur Gewohnheit gemacht, mich damit aufzuziehen. Kein Wunder also, dass ihr das Fehlen ebendieser sofort aufgefallen ist. »Tja, was das angeht ...«
»Du siehst anders aus als sonst. Was ist los?« Ohne eine Antwort abzuwarten, gleitet sie auf den Stuhl mir gegenüber. Ihr Blick zuckt einmal Richtung Küche, und ich vermute, dass sie sich diese Zeit gar nicht nehmen kann. Dennoch tut sie es.
Und das freut mich mehr, als es sollte.
Ich zucke mit den Schultern. »Heute keine Verabredung. Ich bin ... nur durch Zufall hier gelandet.«
Tasha hebt ihre linke Augenbraue beinahe im Zeitlupentempo und verleiht ihrer Miene einen untrüglich skeptischen Ausdruck. Sie muss die Worte gar nicht erst aussprechen, ich weiß auch so, was sie denkt.
Kein Mitleid, schießt es mir durch den Kopf. Wenn auch sie mich nun mitleidig ansieht, muss ich auf diesen Laden verzichten. Dann springe ich auf der Stelle vom Stuhl, haue ab und komme nie wieder.
Aber sie erstaunt mich. Nicht Mitleid blitzt in ihrer Miene auf, sondern vielmehr eine Ernsthaftigkeit, die mich noch viel mehr trifft, wenn auch auf andere Art und Weise.
»Okay, Mister Timo-Zufall. Du bleibst heute also alleine?«
Danke, dass du es so betonst. »Ja.«
Sie nickt mir zu, und als ihre Mundwinkel nun in die Höhe wandern, hat ihr Lächeln etwas Sanftes, das mich direkt entspannt. »Ich nehme an, wie immer?«
Ich überlege eine ganze Weile, versinke dabei in ihren Augen, die je nach Lichteinfall eine andere Farbe zu besitzen scheinen. Heute ein helles Blau, das in einem interessanten Kontrast zu den rosafarbenen Strähnen in ihrem ansonsten blonden Haar steht. Ich wette, dieser Laden bekommt eine Menge mehr Gäste und Trinkgeld, seitdem sie hier arbeitet. »Fast«, antworte ich schließlich. »Ich nehme die Pizza wie immer, und vorweg Bruschetta. Aber dazu hätte ich gerne einen Gin Tonic.« Ich überlege kurz. »Und ein Wasser.«
Falls meine Getränkewahl sie irritiert – bisher bin ich ausschließlich nüchtern geblieben – lässt sie es sich nicht anmerken. Sie nickt mir zu, immer noch lächelnd, tippt meine Bestellung in ihr Smartpad, und räumt dann das zweite Gedeck ab.
Als wenn es den Umstand, alleine Essen zu gehen, weniger deprimierend macht, wenn der Tisch nur für mich eingedeckt ist.
Immerhin ist mein Appetit zurückgekehrt.
Ich muss kleinschrittig denken.
Mann, ist dieses Mädchen flink. Während ich mir meine Vorspeise schmecken lasse – so langsam wie möglich, ohne zu wirken, als würde ich Zeit schinden –, beobachte ich sie. Sie und jeden anderen Mitarbeiter, der an mir vorbei hetzt. Selten mit freien Händen, mit diesem angestrengten Lächeln, das höflich wirken soll und den Stress überdeckt, den sie haben. Tasha ist die Einzige, der ich es abnehme.
Und sie ist auch die Einzige, die ab und an für einen kurzen Moment bei mir stehen bleibt, mit mir plaudert, nachfragt, ob es schmeckt, und mich anlächelt. Daher ist sie es auch, bei der ich einen zweiten Gin Tonic bestelle. Und einen dritten zur Pizza. Und noch zwei weitere zum Nachtisch.
Der Alkohol bewirkt zweierlei. Zum einen glättet er die scharfen, schmerzenden Kanten in meiner Brust. Zum anderen erzeugt er eine Gleichgültigkeit dem Umstand gegenüber, dass ich wie ein einsamer Loser an meinem Tisch sitze, während um mich herum geflirtet und gelacht wird.
Sei’s drum. Ich habe meinen Gin. Und ich habe Tasha, die mir in Windeseile Nachschub bringt, wenn ich ihn verlange.
Es könnte mir bedeutend schlechter gehen.