Die Stellvertretende Kraft steht oft im Zusammenhang mit der Schützenden Gewalt. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Gefahr für das Kind nach dem Einsatz der Schützenden Gewalt noch nicht vorüber ist und dein Kind weiterhin deine Unterstützung braucht, um außerhalb dieser Gefahrensituation zu bleiben. Rennt dein Kind beispielsweise auf die Straße, hältst du es im Sinne der Schützenden Gewalt fest, damit es auf dem Bordstein und damit in Sicherheit bleibt. Du wendest diese erste Gefahrensituation durch dieses Festhalten ab. Spürst du nun, dass dein Kind beim Loslassen erneut Richtung Straße rennen würde, geht die Schützende Gewalt fließend über in die Stellvertretende Kraft, indem du dein Kind aus dieser Situation nimmst – es also zur Seite trägst und so lange festhältst, wie es für seine Sicherheit nötig ist. Damit verschmilzt der führend liebevolle und gleichzeitig gewaltsame Eingriff zu seinem Schutz mit dem Einsatz deiner Kraft zum Wohle deines Kindes, das die Konsequenzen seines Handelns nicht selbst absehen kann.
Folgende Situationen zeigen beispielhaft, wann es in der Regel eine Kombination aus Schützender Gewalt und Stellvertretender Kraft braucht:
-
Dein Kind fährt mit dem Laufrad zur Straße: Du greifst dein Kind am Arm (Schützende Gewalt). Sofern du den Eindruck hast, dass es beim Loslassen erneut zur Straße fahren würde, nimmst du ihm das Laufrad aus der Hand (Stellvertretende Kraft).
-
Dein Kind zieht an den Haaren eines anderen Kindes: Du hältst seine Hand fest (Schützende Gewalt); falls dein Kind keine Bereitschaft zeigt, loszulassen, setzt du die Stellvertretende Kraft wie oben beschrieben ein und nimmst dein Kind aus der Situation.
-
Dein Kind schlägt, schubst, schreit laut und beißt: Hier gehst du im Sinne der Schützenden Gewalt erst einmal dazwischen und verhinderst den körperlichen Übergriff, indem du beispielsweise die Hand deines Kindes nimmst oder seinen Kopf wegdrehst, wenn es beißen will etc. Damit alle heile bleiben, trägst du dein Kind danach aus der Situation (Stellvertretende Kraft).
-
Dein Kind macht Dinge kaputt und wirft Gegenstände oder Essen durch den Raum: Du nimmst deinem Kind den Gegenstand, den es werfen will, aus der Hand (Schützende Gewalt). Spürst du, dass es nach weiteren Dingen sucht, die es werfen kann, trägst du es aus der Situation an einen Ort, wo es nur Dinge gibt, die es werfen darf – beispielsweise Kuscheltiere –, oder du hältst es so lange fest, wie es das für die Sicherheit aller braucht.
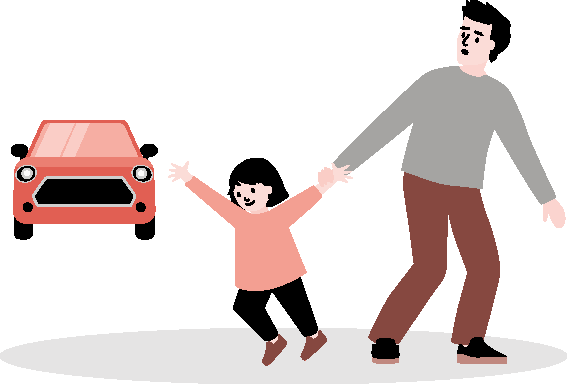
Wie im Kontext der Schützenden Gewalt und der Stellvertretenden Kraft jeweils schon ausgeführt, fühlt sich der Einsatz beider Strategien in der Situation selbst nie gut an, weil es sich um eine Form von Gewalt handelt. Dieses Gefühl verstärkt sich bei der Kombination beider Strategien, weil diese Situation meist länger anhält. Das auszuhalten, kann Eltern viel Kraft und Energie abverlangen, ganz besonders dann, wenn sie als Kinder selbst Situationen des Machtmissbrauchs und der damit einhergehenden Ohnmacht erlebt haben. Umso wichtiger ist hier, in der Haltung zu bleiben, dass du immer zum Schutz und zur Sicherheit deines Kindes handelst. Unterstützend kannst du euch beiden nonverbale Empathie schenken (vgl. Seite 112), indem du dein Kind und dich selbst mit all euren Gedanken und Gefühlen siehst, statt euch beide zu verurteilen. Ihr tut euer Bestmögliches und kümmert euch um euch – auch wenn sich das in der ganz konkreten Situation nicht gut anfühlt.
![]() Aus der Beratung
Aus der Beratung
»Meine Tochter (7) überschreitet bei meinem Sohn (3) körperliche Grenzen. Das passiert oft im Spiel, weil sie ihre Kraft nicht einschätzen kann (Tritte) oder weil sie einfach zu doll mit ihm kuscheln möchte (Schwitzkasten). Sie überhört sein ›Nein‹, und auch wenn er weint, lässt sie nicht von ihm ab. Da sie ihm körperlich überlegen ist und auch meine Worte nicht an sie herankommen, greife ich ein. Sie hat eine Wahnsinnskraft, und ich muss tatsächlich meinen ganzen Körper einsetzen, um ihn aus ihrem Klammergriff zu befreien – mit meinen Worten bleibe ich aber ruhig. Dennoch: Ich schütze meinen Sohn, indem ich bei meiner Tochter Gewalt anwende, das fühlt sich für mich nicht gut an. Meist tröste ich auch erst mal ihn. Wie werde ich in dieser Situation beiden Kindern gerecht?« Eva
Beginnen wir wieder bei der Mama und überlegen, wie sie in die Selbsteinfühlung kommen kann, indem wir genau schauen, welche Gefühle bei ihr beim Einsatz der Stellvertretenden Kraft in Kombination mit der Schützenden Gewalt ausgelöst werden und welche ihrer Bedürfnisse unerfüllt sind. Dabei findet auch ihr inneres Kind Beachtung, da eventuell alte Gefühle und unerfüllte Bedürfnisse von früher ausgelöst werden und die Situation eventuell bedrohlicher wahrgenommen wird, als sie ist.
Eva weiß, dass die körperliche Gesundheit ihres Sohnes in Gefahr ist und dass sie dafür zuständig ist, ihn zu schützen. Der Einsatz der beiden Strategien der Elterlichen Führung wiederum fühlt sich für sie nicht gut an, da sie faktisch Gewalt bei ihrer Tochter anwendet. Sie ist überfordert, weil sie nicht genau weiß, ob ihr Handeln so »richtig« ist, ihre Wirksamkeit ist also unerfüllt, weil sie unsicher ist, was genau sie tun kann. Außerdem fühlt sie sich unwohl mit dem Einsatz ihrer Elterlichen Führung, weil ihr die Verbindung zu ihrer Tochter wichtig ist. Und vielleicht ist sie gleichzeitig traurig, weil sie nicht versteht, warum ihre Tochter das macht; ihr Bedürfnis, zu verstehen, ist also ebenso unerfüllt. Sie möchte beiden Kindern gerecht werden und ist enttäuscht, dass ihr das ihrer Auffassung nach nicht gelingt. Das wiederum entspricht ihrem Bedürfnis nach Fürsorge.
Um zu verstehen, was sie tun und wie sie handeln kann, braucht Eva zunächst das Verständnis darüber, was ihre Tochter ihr sagen möchte. Mit diesem Wissen können beide dann Lösungen finden, wie solche Situationen langfristig vermeidbar werden.
Zunächst darf Eva sich davon verabschieden, dass es eine Möglichkeit gibt, beiden Kindern gleichzeitig gerecht zu werden. Das ist in so einem Streitfall nie möglich. In diesem Fall heißt das, zu schauen, wer im Sinne der Unversehrtheit und der körperlichen wie seelischen Gesundheit gerade mehr Hilfe braucht. Das ist in dem Fall der jüngere Sohn. Er hat sich erschrocken, also nimmt sie ihn zuerst auf den Arm und kümmert sich um ihn. Danach wendet sie sich ihrer Tochter zu. Warum dies im Sinne der liebevoll führenden Erziehung und damit gerecht ist, erklären wir im folgenden Kapitel zur Hierarchie in der Familie ausführlich. Außerdem kann Eva sich in solchen Situationen immer wieder vor Augen führen, dass sie zum Schutz ihres Sohnes handelt und gleichzeitig ihre Tochter dabei unterstützt, sich um sich zu kümmern. Denn der körperliche Übergriff ist nur dann ein Missbrauch ihrer elterlichen Macht, wenn sie ihrer Tochter mit der Haltung begegnet »sowas macht man nicht«, »du bist böse« oder »du machst das extra«. Mit der Haltung, dass ihre Tochter Hilfe braucht und etwas über sich erzählen möchte, braucht es dennoch den Eingriff – nur findet dieser im Kontext der Liebevollen Führung statt. Nach ihrem Eingriff, der nur wenige Worte braucht, nimmt Eva ihren jüngeren Sohn auf den Arm, wiegt ihn und schenkt ihm Empathie (»Du hast dich ganz doll erschrocken, oder?«). Im Sinne der Stellvertretenden Kraft versucht sie im Anschluss, über Berührung und Augenhöhe an ihre Tochter heranzukommen. Sie ist sieben, also können sie im Gespräch herausfinden, was die Tochter ihr mit diesem Verhalten sagen wollte – welche ihrer Bedürfnisse sie sich zu erfüllen versucht hat. Vielleicht war ihr das gemeinsame Spielen mit ihrem kleinen Bruder zu viel und sie wollte allein sein und brauchte Ruhe. Oder ihr Bruder hat etwas genommen, was ihr gehört, und sie wollte gefragt werden. Oder sie wollte zeigen, dass sie mit Eva alleine sein möchte und Mama-Nähe braucht. Vielleicht versucht sie auch, ihre Position in der Familie einzufordern, weil sie sich dieser unsicher ist? Wichtig ist, dass Eva hier in ihrer Verantwortung bleibt und ihrer Tochter hilft, Lösungen dafür zu finden, wie sie sich in solchen Situationen um sich kümmern kann. Braucht ihre Tochter beispielsweise Ruhe, können beide überlegen, wie sie das beim nächsten Mal anders formulieren kann. Evas Verantwortung bleibt es in diesem Fall, das zu verstehen und dafür zu sorgen, die Spielzeit beider Kinder auseinanderzuhalten. Will ihre Tochter gefragt werden, wenn es um ihre Dinge geht, können sie hier gemeinsam Ideen finden, wie sie das anders kommunizieren kann. Evas Aufgabe bleibt es, die Grenzen ihrer Tochter zu wahren. Mit dem Wissen, dass ihre Kinder dazu neigen, in Konfliktsituationen körperlich zu werden, braucht es in gemeinsamen Spielsituationen Evas volle Aufmerksamkeit und ihre feinen Antennen, damit sie frühzeitig eingreifen kann, ohne dass die Schützende Gewalt oder die Stellvertretende Kraft überhaupt nötig werden.
Kommen wir an dieser Stelle noch einmal auf das Beispiel von Petra aus Kapitel 4 zurück (vgl. Seite 119). Petra setzte zunächst die Schützende Gewalt ein, um ihren Sohn davon abzuhalten, auf die Straße zu fahren – sie löst damit die Situation im Sinne der FüLi-Erziehung. Um weitere Gefahrensituationen zukünftig zu vermeiden, wird Petra entweder entscheiden, das Fahrrad je nach Gefährlichkeitsgrad des Weges vorerst zu Hause zu lassen, oder auf den Wegen sehr nah an ihrem Sohn sein und dafür sorgen, dass er an ihrer Seite fährt. Der Einsatz der Stellvertretenden Kraft könnte in der Situation an der Straße folgen, wenn Petras Sohn den Eindruck erweckt, dass er nach dem Einsatz der Schützenden Gewalt erneut zur Straße fahren würde. Dann kann Petra entscheiden, das Fahrrad an sich zu nehmen. Hier entscheidet vor allem ihre Haltung, ob sie es ihm wegreißt, weil er sich nicht so verhält, wie sie es in dieser Situation erwartet, oder ob sie es zum Schutz ihres Sohnes ruhig und bestimmt an sich nimmt.
Der Einsatz der Schützenden Gewalt und der Stellvertretenden Kraft in Kombination kann sehr fordernd für Eltern sein. Und doch gibt es Situationen, wo es beide FüLi-Strategien für die Sicherheit und die körperliche Unversehrtheit des Kindes braucht. Mit der entsprechenden Haltung, Berührung und dem empathischen Auffangen auf Augenhöhe im Nachhinein kann viel Verbindung entstehen. Außerdem schenkt deine Klarheit und deine Liebevolle Führung deinem Kind Sicherheit und Geborgenheit durch die Erfüllung seiner Bedürfnisse nach Orientierung, Verlässlichkeit, Stabilität und Schutz. Auch wenn es wirklich nicht einfach ist, die Schützende Gewalt und Stellvertretende Kraft anzuwenden, ist es doch dringend nötig für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Insbesondere dann, wenn dein Kind bereits eine sichere Bindung zu dir aufgebaut hat und darüber Vertrauen in dich als verlässliche Bezugsperson entwickeln konnte, wird es deine empathische und klare innere Haltung spüren, weshalb dein Handeln nicht schädlich für die Seele deines Kindes oder eure Beziehungsqualität sein wird.
Wie steht es um dein Wissen zur Kombination aus Schützender Gewalt und Stellvertretender Kraft? Das kannst du in unserem Test in Kapitel 9 herausfinden (vgl. Seite 256).