

Als ihr Flugzeug in New York landete, war von Frisch in schlechter Verfassung. Die Reise hatte ihn erschöpft und außerdem plagten ihn Verdauungsstörungen. Nachdem er an der Cornell University seine erste Vorlesung gehalten hatte, kollabierte er und blieb für ein paar Tage im Bett, um wieder zu Kräften zu kommen. Donald Griffin, sein Gastgeber, war besorgt, dass die Rundreise zu anstrengend sein könnte und schlug vorsichtig vor, die Anzahl der Vorlesungen gegenüber der ursprünglichen Planung ein wenig einzuschränken. Von Frisch jedoch versicherte, er würde bald wieder so weit genesen sein, um die Vortragsreise wiederaufzunehmen. Doch Griffin sorgte sich, und zwar so sehr, dass er einen vervielfältigten Brief an all jene sandte, die den Besucher auf seiner Reiseroute beherbergen würde. Darin warnte er die künftigen Gastgeber vor der fragilen Konstitution des Wissenschaftlers: »Wenngleich sich von Frischs Gesundheitszustand bessert«, mahnte er, »sollten allgemeine Mittagessen, Nachmittagstees etc. abgesagt werden.«358
Darüber hinaus empfahl Griffin, mit der Tradition zu brechen, dass nach der formalen Vorlesung Fragen gestellt werden dürfen. Er befand, dass es an der Cornell University gut geklappt hatte, Karteikarten zu verteilen, auf die die Hörer ihre Fragen schrieben, diese dann einzusammeln und dem Redner vorzulegen, damit er sie beantworten konnte. Das verkürzte die direkte Kommunikation und milderte ein weiteres Problem, das sich früh auf von Frischs Reise gezeigte hatte – seine zunehmende Schwerhörigkeit. Es war, schrieb Griffin seinen Kollegen, enorm schwer, sich mit dem europäischen Besucher zu unterhalten, vor allem für jene, die nicht Deutsch sprachen. Er hoffte auf eine baldige Verbesserung dieser Situation, zumal er einen Termin für von Frisch mit Mitarbeitern des psychoakustischen Labors in Harvard vereinbart hatte, damit sie ihm eine Gehörhilfe anpassten. Zum Abschluss seines Briefs gab er den Gastgebern den Rat, ihre Pläne sehr flexibel zu halten und »auf Frau von Frischs Rat zu hören, was sie an Verabredungen ihres Mannes für klug hält.«359
Doch entgegen aller Erwartungen erholte sich von Frisch schnell und konnte seine Vorlesungen wiederaufnehmen. Und sie nahmen, trotz Griffins Besorgnis, ihr Publikum gefangen: knapp und klar führte der Meister seine Mitreisenden gewandt durch das rätselhafte Terrain der Sinnesphysiologie und der Kommunikation der Bienen.
Es waren jeweils drei Vorlesungen, die er an den Universitäten hielt, die auf seinem Reiseplan standen. Und mit jeder erkundete er einen anderen Aspekt seiner Arbeit mit Bienen.360 In der ersten und in der zweiten Vorlesung ging es um eine generelle Einführung in die optischen und chemischen Sinne der Tiere, in der dritten um seine aktuellsten Entdeckungen zur »Tanzsprache«. Er begann mit einer Erklärung des Farbensehens und erzählte von seinen damals bereits klassischen Konditionierungsexperimenten, bei denen er Bienen darauf dressiert hatte, auf farbigem Papier zu fressen, um ihre Fähigkeit zur Farbunterscheidung zu testen. Dieses Experiment, erklärte er seinem Publikum, zeige die Bandbreite des Farbensehens der Bienen im Vergleich zu jener des Menschen: Zwar nähmen Bienen Rot nicht wahr, sähen jedoch Gelb, Blaugrün, Blau und ultraviolettes Licht. Daraufhin setzte er den Farbensinn der Tiere in Beziehung zu jener Imkerpraxis, bei der die Fluglöcher der Bienenstöcke, in denen zahlreiche Kolonien lebten, mit verschiedenen Farben gestrichen wurden. Das diene dazu, die Bienen nach ihren Sammelflügen in den richtigen Stock zu lotsen und damit zu verhindern, dass sie von den Wächtern der anderen Stöcke getötet würden. Wollte ein Imker, dass sich seine Mühen lohnten, riet von Frisch dazu, beim Bemalen der Fluglöcher den Farbensinn der Bienen zu bedenken und die »menschlichen« Farben zu vermeiden. Er schloss seine Vorlesung damit, dass er einen Zusammenhang zwischen der Signifikanz des Farbensehens der Insekten und speziellen Blumenmarkierungen herstellte: Dieses sogenannte Saftmal leitete die Biene zum Nektar und hatte sich genetisch parallel zum Farbensehen der Insekten und ihrer Bestäubungstätigkeit entwickelt.
Die zweite Vorlesung von Frischs trug den Titel »Chemical Senses« und behandelte Geruchs- und Geschmackssinn. Nun machte von Frisch seine Zuhörer mit seinen keramischen Duftboxen bekannt. Auf einer kleinen Leiste im Inneren des Gehäuses wurde etwas Duftöl verteilt, damit der Experimentator danach die Anzahl der anfliegenden Bienen zählen konnte. Er erzählte, wie es ihm möglich gewesen war, Umfang und Schärfe des Geruchssinns der Tiere festzustellen, indem er eine ganze Reihe von Keramikhäuschen aufgestellt hatte, von denen die meisten keinen Geruch verströmten, während einem oder zweien jener Duft anhing, auf den die Bienen zuvor dressiert worden waren. Und er erinnerte seine Zuhörer daran, dass der Geruchssinn der Bienen jenem der Menschen vergleichbar sei, auch wenn die Fähigkeit der Bienen etwas besser ausgebildet sei, da sie bestimmte Gerüche aus einer Duftmischung herausriechen könnten.
Darüber hinaus berichtete er von Versuchen, bei denen er die Fühler der Bienen abgeschnitten hatte, um herauszufinden, ob ihr Geruchs- oder Geschmackssinn darunter leidet. Anhand faszinierender Illustrationen erklärte er, wie Geruchs- und Tastsinn auf den Fühlern zusammengestellt sind und dass die Tiere eine Art dreidimensionale Duftlandschaft bewohnen: »Ein rundes Duftobjekt könnte Bienen einen ganz anderen Eindruck vermitteln als ein rechteckiges.« Er zitierte den Schweizer Entomologen August Forel, der »bereits vor vielen Jahren konstatierte, dass Bienen die Form eines Gegenstandes möglicherweise ›riechen‹ können, da zwischen den Tast- und den Riechorganen auf den Fühlern eine enge Beziehung besteht.« In diesen Vorlesungen ging er weit in die Vergangenheit seiner frühesten Arbeiten zurück, um zu erklären, wie sich die Sinnesphysiologie der Tiere gemeinsam mit den Blumen entwickelt hatte. Jetzt berichtete er auch von Versuchen, in welchen er herausgefunden hatte, dass die Saftmale die Bienen nicht nur optisch zum Nektar locken, sondern dass sie als zusätzliches Lockmittel auch einen bestimmten Geruch entwickelt hatten. Dazu hatten Blumen sich insofern an ihre Hauptbestäuber angepasst, als sie ihren Nektar veränderten. Bienen ziehen süßere Lösungen den dünneren vor, da sie nur Flüssigkeiten mit einer hohen Zuckerkonzentration in Honig umwandeln können. Und von Frisch erklärte nun, dass Blumen als Reaktion darauf mit der Zeit hochkonzentrierten Nektar entwickelt haben.
Diese Vorlesung schloss er mit der Betonung darauf, dass dieses Wissen um die Sinne der Bienen genützt werden könne, um die Tiere zu Futterpflanzen zu leiten. Es waren Kommentare, die auf seiner Arbeit für das Reichsernährungsministerium während des Kriegs basierten. Sowohl in diesen Vorlesungen als auch bei späteren Gelegenheiten verlieh von Frisch seiner Hoffnung Ausdruck, Imker könnten seine Methode der Duftlenkung übernehmen, um die Ernten zu verbessern.
In der jeweils letzten Vorlesung schließlich präsentierte Karl von Frisch den Höhepunkt seiner Arbeit: die Tänze der Bienen. Er erklärte, wie der Hinweis auf Entfernung vom Tempo abhängt, in welchem der Schwänzeltanz vorgeführt wird. Um diesen Punkt ganz besonders hervorzuheben, präsentierte er seiner Zuhörerschaft eine elegante Kurvenlinie, mit der die Anzahl der Drehungen mit der Entfernung zum Futterplatz in eine Relation gesetzt wurde, die eine nahezu perfekte Korrelation zeigte. Die Kurvenlinie übrigens beruhte auf beeindruckenden 3885 Beobachtungen. Doch auch wenn die Korrelationen überzeugend schienen, waren sie doch unvollkommen, weshalb er die Faktoren auseinandersetzte, die zu den Abweichungen geführt hatten. Erstens wiesen die Bienen beachtliche individuelle Unterschiede auf. Zweitens gäbe es in verschiedenen Kolonien kleine Schwankungen im Zusammenhang zwischen Tanztempo und Entfernung vom Futterplatz. Dieser Aspekt wurde später durch noch faszinierendere Resultate bestätigt, und zwar durch die Schwankungen zwischen verschiedenen Bienenstämmen, was Bienenforscher annehmen ließ, dass es so etwas wie Bienendialekte gab.361 Ganz zum Schluss berichtete von Frisch noch darüber, dass der Wind zu Abweichungen in der Relation zwischen Tanz und Entfernung führen könne: Starker Gegen- oder Rückenwind beeinflusste, wie Bienen die Distanz wahrnahmen, die sie geflogen waren.
In Anbetracht der majestätischen Berge, die den Wolfgangsee umgeben, überraschte es das Publikum wohl kaum, dass sich von Frisch fragte, wie Bienen es zustande bringen, die Lage eines Futterplatzes zu vermitteln, der hinter mächtigen Hindernissen lag. Schließlich war es Bienen in einem solchen Fall nicht möglich, in einer geraden Linie zum Futter zu fliegen. Doch wie, fragte er, würden sie diese Information an ihre Stockgenossinnen weitergeben? Indem sie die Umwege, die sie geflogen waren, tanzten? Oder indem sie ohne Rücksicht auf das Hindernis nur die direkte Strecke zum Futterplatz tanzten?
Abb. 7. 1. Wanderer auf dem Weg zu einem Experiment, das auf dem Schafberg beim Wolfgangsee stattfand. (Nachlass Karl von Frisch, Bayerische Staatsbibliothek, München, ANA 540.)
Diesen Teil der Vorlesung begleitete ein Schwarz-Weiß-Foto von Studenten, die mit Rucksäcken auf einen Berg wanderten, um dieses Experiment durchzuführen. Sie waren mit den Bienen auf den Schafberg gestiegen, um sie darauf zu dressieren, auf diesem Bergkamm zu fressen. Jetzt sahen die Zuhörer, wie tief die Wissenschaftler und deren Arbeit in ihrer Umgebung und der Natur verwurzelt waren. Mit Sicherheit wurde damit eine Saite im Publikum zum Klingen gebracht: Das idyllische Bild stammte aus einer Zeit, in der das Land in einen tödlichen Konflikt verwickelt war. Und trotzdem gab es keine Spur von Militär, Krieg oder Gewalt. Diese Präsentation der Arbeit mit Bienen strahlte das Gegenteil aus – eine Ruhe, die zutiefst mit der Natur der Umgebung harmonierte. Hier und auch an den anderen Orten waren von Frischs Ausführungen von einer Art Hyperrealismus erfüllt, der mit den detailliert geschilderten Versuchsanordnungen Zeit und Ort anschaulich zum Leben erweckte. Es war, als würden die Zuhörer über seine Schulter lugen, um bei den Versuchen zuzusehen, während sie stattfanden.
Von Frisch erzählte von zwei Experimenten, bei denen er untersuchte, wie Bienen Hindernisse umfliegen. Im ersten Versuch umflogen die Bienen den Berg in engen Schleifen. Damit stellte sich die Frage, ob die Bienen ihren Stockgenossinnen die direkte Route anzeigen würden oder jene in Haarnadelkurven, die sie geflogen waren. Zu von Frischs Überraschung signalisierten die Bienen die Luftlinie, also die gerade Linie vom Abflugort zum Ziel. In einem weiteren Versuch wurden die Bienen darauf dressiert, um einen steilen Bergkamm zu fliegen. Doch hierbei zeigten sich die Bienen weit weniger kooperativ als im vorangegangenen Versuch: Anstatt um den Bergrücken herumzufliegen, flogen sie in gerader Linie darüber. Bei diesem Weg hatten die Tiere zwar keinerlei Probleme mit der Richtung – sie waren schließlich buchstäblich die Luftlinie geflogen –, doch er fragte sich, wie die Hinweise auf die Entfernung wohl aussehen würden, da der Weg den Berg hinauf und auf der anderen Seite den Berg hinunter die insgesamt geflogene Strecke doch signifikant verlängerte. Es stellte sich heraus, dass die Bienen ihre Tänze der tatsächlich geflogenen Strecke anpassten und nicht die kürzere Distanz anzeigten, die sie über flaches Gelände geflogen waren. Die Bilanz: »In einer solchen Situation ist es zweifellos eine Herausforderung, dass die neuen Bienen nicht nur die absolute Richtung anzeigten, sondern die tatsächliche Flugdistanz entlang der am besten geeigneten Strecke.« Um auf die Tiefe seiner Verblüffung und seiner Demut angesichts eines so bewundernswerten Verhaltens hinzudeuten, fügte er noch folgenden Zusatz hinzu: »Obwohl ich gesehen habe, wie es geschah, bin ich nicht in der Lage, diese Fähigkeit der Bienen zu begreifen.«
Zum größten Teil wurden seine Vorlesungen gut aufgenommen, doch manchmal traf er auch auf Widerstand. Seine nächste Station war die Yale University, wo er seine Arbeit an der Fakultät für Psychologie präsentierte. Während eines lebhaften Gesprächs, das dem Vortrag folgte, verstrickte er sich in eine Diskussion mit Frank Beach, einem Mitglied dieser Fakultät. Später notierte er in seinem Tagebuch seine Bestürzung darüber, dass der vergleichende Psychologe keinen Unterschied zwischen Instinkt und Verstand zu machen schien. Für von Frisch war diese Unterscheidung so offensichtlich wie essenziell. Instinktive Verhaltensweisen sind angeboren und automatisch. Sie verlangen vom Tier nicht, dass es sein Ziel versteht, und werden wie erbliche physische Merkmale von Generation zu Generation weitergegeben. Intelligentes Verhalten hingegen beruht darauf, dass das Tier eine bestimmte Situation erkennt. Das ermöglicht eine Veränderung des Verhaltens und ein Abweichen vom angeborenen Entwurf. Entsprechend dem europäischen Denkansatz umfasst jedes Verhalten sowohl instinktives als auch intelligentes Handeln, und sie ergänzen einander. Im Gegensatz dazu hatten die Amerikaner seit dem frühen 20. Jahrhundert die Instinkte aus nahezu all ihren wissenschaftlichen Arbeiten verbannt und konzentrierten sich stattdessen auf angelerntes Verhalten. Die Behavioristen, wie die Anhänger dieser amerikanischen Schule des Verhaltens genannt werden, legten ihr Hauptaugenmerk ausschließlich auf sichtbares Verhalten. Das Fundament dieses Denkansatzes war die Annahme, dass die meisten Verhaltensweisen auf einer Reiz-Reaktions-Konditionierung beruhten. Berühmt wurde in diesem Zusammenhang die Behauptung des Behavioristen John Broadus Watson, dass er, würde man Kinder seinen fähigen Händen überlassen, in der Lage wäre, diese zu allem zu trainieren, was er nur wollte.362
Dass Beach jedoch den Unterschied zwischen intelligentem und instinktivem Verhalten offensichtlich nicht begriff, hatte weniger mit Ignoranz zu tun als vielmehr mit einem kulturell bedingten Missverständnis zwischen den beiden Wissenschaftlern.363 Der Gedankenaustausch berührte einen sensiblen Nerv der amerikanischen Behavioristen. Beach hatte tatsächlich das Gefühl vermittelt bekommen, die vergleichenden Psychologen Amerikas hätten bloß ein diffuses Verständnis für die Unterscheidung zwischen Erkenntnis und Instinkt. Was er jedoch meinte, war nicht, dass kein Unterschied bestünde, sondern dass es vielmehr notwendig sei, verschiedene Verhaltensweisen besser zu verstehen und zu unterscheiden.
Nur wenige Monate später hielt Beach eine Rede vor der American Psychological Association’s Division of Experimental Psychology, in der er diesen Mangel an Verständnis beklagte. Laut Beach hatten sich die amerikanischen vergleichenden Psychologen auf Albinoratten konzentriert, und zwar auf Kosten aller anderen Organismen und Verhaltensweisen. Während die Anzahl der Beiträge im Journal of Animal Behavior und in dessen Nachfolger, dem Journal of Comparative and Physiological Psychology, in den letzten Jahrzehnten angestiegen war, hatte sich die Vielfalt der behandelten Spezies in den Artikeln dramatisch verringert: »Von 1930 bis zur Gegenwart widmete sich mehr als die Hälfte aller Artikel in jeder Ausgabe der Zeitschrift dieser einen Art.« In unheilschwangerem Tonfall warnte Beach, dass die vergleichende Psychologie ihre Fokussierung zum Schaden ihrer eigenen Relevanz geschmälert hätte. Um auf den Punkt zu kommen, zitierte er die Geschichte des Rattenfängers von Hameln, der mithilfe seiner Zauberflöte »die Stadt Hameln von einer Rattenplage befreite, indem er die Schädlinge in den Fluss lockte. Jetzt«, warnte er, »hat sich der Spieß umgedreht. Die Ratten spielen die Flöte und eine große Menschenmenge folgt ihnen … Wenn sie dem Bann des Rattus norvegicus nicht entkommen, dann drohen die Forscher auszusterben. […] Vielleicht«, scherzte er, »wäre es angebrachter, den Titel der Zeitschrift in The Journal of Rat Learning zu ändern.«364 Während also erlerntes Verhalten nur unzureichend verstanden wurde, wurde alles andere, das aus dem engsten Bereich fiel, hoffnungslos negiert. Karl von Frisch hatte die amerikanische Psychologie mit seiner Vorlesung mitten ins Herz getroffen, da diese sich damit herumschlug, ein schwindendes behavioristisches Paradigma in den Griff zu bekommen. Von Frisch jedoch hinterließ dieser Gedankenaustausch eher ratlos denn informiert.
Nach ein paar Tagen in Yale reiste das Ehepaar von Frisch weiter nach Massachusetts, wo Vorlesungen an der Harvard University vorgesehen waren. Die Labors der Biologen in Harvard gehörten für von Frisch »zu den schönsten«, die er gesehen hatte. Überwältigt von der schieren Größe der Fakultät, schrieb er voller Bewunderung über die Forschungsarbeit ihrer Mitglieder.365
Besonders angetan hatten es ihm die Versuche von Carroll Williams über die Rolle der Hormone in der Entwicklung der Insekten. Für eines seiner Experimente hatte Williams kleine Teile von der Außenhaut verpuppter Schmetterlinge chirurgisch entfernt und durch Glasstückchen ersetzt. Durch diese Miniaturfenster konnte von Frisch nun einen Blick auf die kleinen schlagenden Herzen der Tiere werfen. Er bewunderte, dass ein geduldiger Beobachter auf diese Weise Zeuge der gesamten Transformation aller inneren Organe des Tiers werden konnte, während es seine Metamorphose zum Schmetterling vollzog.
In einem anderen Versuch hatte Williams die Puppen wie eine Gänseblümchenkette miteinander verbunden. Er hatte aus dem oberen Bereich ihrer Köpfe jene Teile des Gehirns entfernt, wo das für die Metamorphose verantwortliche Hormon produziert wird. Dadurch, dass diese wesentlichen Zellen fehlten, konnten die Tiere ewig in ihrem verpuppten Stadium gehalten werden. Setzte der Forscher jedoch den entfernten Teil wieder in irgendein Gehirn der Puppenkette ein, löste das eine Kaskade an Metamorphosen aus, die schließlich jedes Element der Kette in einen Schmetterling verwandelte.366 Von Frisch gab zu, dass diese Experimente möglicherweise ein wenig »wie eine Spielerei« aussehen, fügte jedoch schnell hinzu: »Der Kundige freut sich über die originellen Methoden, die zu wesentlichen Erkenntnissen geführt haben.«367 Auch wenn er nicht genauer ausführte, welcher Natur diese »wichtigen Entdeckungen« waren: seine Begeisterung über diese Versuche war spürbar.
Während er in Cambridge zu Gast war, besuchte von Frisch auch die nahe gelegene Polaroid Company, wo er deren legendären Gründer Edwin Land traf. Land war Student in Harvard gewesen, brach sein Studium jedoch ab, um sich seinen Erfindungen von polarisierten Filmen und Linsen zu widmen.368 Das war auch der Grund für von Frischs Besuch, der hier verschiedene Folien erhielt, mit denen er die Fähigkeit der Bienen, polarisiertes Sonnenlicht zu erkennen, testen wollte.
Abgesehen davon, dass ihm Land eine ganze Auswahl an Folien überließ, machte er hier eine weitere Erfahrung, die er nicht so schnell vergaß. Land brachte ihn in ein Hinterzimmer, wo er eine kleine, viereckige Schachtel auf ihn richtete. Bloß einen Moment, nachdem Land auf einen Knopf gedrückt hatte, schob sich ein Stück schwarzes Papier aus einem schmalen Schlitz am Boden des Geräts. Land nahm es an seinem Rand und zog es aus der Kamera. Und hier, direkt unter ihren Augen, entstand aus der Schwärze des Papiers von Frischs Abbild. »Fantastisch«, schrieb von Frisch begeistert in sein Tagebuch, »ohne einen weiteren Handgriff, außer das Papier herauszuziehen.«369 Dabei war von Frisch nicht der Einzige, dem diese Sofortbildkamera Vergnügen bereitete. Das Gerät war den Kunden im Bostoner Jordan-Marsh-Kaufhaus vergangene Weihnachten erstmals als Novität vorgestellt worden. Zu jedermanns Überraschung war der gesamte Lagerbestand innerhalb des ersten Tages ausverkauft gewesen.370
Kurze Zeit später ging es von Boston wieder nach New York, wo ein dichter Terminplan auf das Ehepaar von Frisch wartete. Am ersten Tag wurde von Frisch von einem Journalisten der New York Times im American Museum of Natural History interviewt. Tags darauf erfuhren die Leser der Times, dass »der erste Mensch, der so enge soziale Beziehungen mit der Welt der Insekten aufgebaut hat«, in der Stadt sei, um seine Serie aus drei Vorlesungen im Museum zu halten.371 Die Times berichtete über jeden einzelnen der Vorträge und schrieb nach der abschließenden Präsentation der Bienentänze: »Der Wissenschaftler, der in die Geheimnisse der Bienensprache eingedrungen ist, hat hier gestern am Abend erzählt, wie er das getan hat.«372
In New York besuchten Margarete und Karl von Frisch auch den später Bronx Zoo genannten Zoologischen Garten. Von Frisch und Fairfield Osborn, der Zoodirektor, hatten sich bei einem Bankett in Yale kennengelernt. Dort hatte Osborn das Ehepaar zum Mittagessen und zu einer Spezialführung durch den Zoo eingeladen. Und nun waren die beiden unterwegs in diesem Tiergarten, dessen schiere Größe so überwältigend war, dass Osborn einen Wagen zur Verfügung gestellt hatte. Dennoch war von Frischs Beurteilung des Zoos gemischt. Er beklagte, dass die Kolibris, die man in einen Käfig gepfercht hatte, bloß ein trauriger Abklatsch ihrer wunderschönen Artgenossen in der Freiheit waren. An anderen Aspekten fand er dennoch Vergnügen und war begeistert von einem echten Schnabeltier, das »unterirdisch in strenger Abgeschiedenheit gehalten [wurde], denn man hoffte auf Nachkommenschaft.«373
Zu den anderen Höhepunkten dieses Aufenthalts in New York zählte das American Museum of Natural History. »Welcher Reichtum«, rief er aus und zeigte sich besonders von der Lebensechtheit der Exponate beeindruckt: »Da sind nicht nur die Affen echt. Jeder Stein, jede Pflanze des Vordergrundes stammt aus der Gegend, in der die dargestellte Gorillafamilie gehaust hat und diese Szenerie verschmilzt unmerklich mit dem naturgetreu und künstlerisch gemalten Hintergrund.« Derart authentisch waren die Schaukästen, dass junge Besucher fragten, wie man »hineinkommt, um die Pflanzen zu gießen.« Von Frisch hat sich um die eingeschlossenen Pflanzen wahrscheinlich nicht gesorgt, war aber dennoch von der verblüffenden Ausstellung überwältigt: »Nirgends sonst habe ich die toten Geschöpfe so lebenswahr dargestellt gesehen.«374
Während seines New-York-Aufenthalts traf von Frisch auch mit Warren Weaver, dem Direktor der Rockefeller Foundation, zusammen. In scharfem Kontrast zur kurz angebundenen Antwort, die Hasler 1945 auf seinen Brief, in dem es um eine Förderung für von Frisch gegangen war, erhalten hatte, wurde der Wissenschaftler nun zum Lunch und einem Gespräch über seine aktuelle Arbeit eingeladen.
Von Frisch war nicht nur von der Lage der Radio City Music Hall mitten in Manhattan beeindruckt, sondern auch von der Geschwindigkeit des Aufzugs, der das 55. Stockwerk in nur wenigen Sekunden erreichte.375 Bald hatten alle ihre Plätze rund um den Tisch eingenommen. Warren Weaver hatte den Vorsitz, die Abteilungsleiter flankierten von Frisch und das Gespräch während des Mittagessens mäanderte vom Vogelzug zur Orientierung. Weaver hatte von Frisch vor dem Lunch darauf vorbereitet, dass alle in der Stiftung vor allem an Völkerkommunikation interessiert seien, und er hatte ihn ermutigt, näher auf seine Entdeckungen über die Kommunikation von Bienen einzugehen. Von Frisch tat ihm den Gefallen und hielt aus dem Stegreif einen Vortrag über die Bienentänze und seine neuesten Erkenntnisse darüber.
Als von Frisch und Weaver nach dem Lunch in dessen Büro saßen, fragte von Frisch besorgt, ob es ihm die Rockefeller Foundation übelnähme, dass er München wegen Graz verlassen hatte. Von Frisch fürchtete, die Stiftung könnte es möglicherweise gegen ihn verwenden, dass er jenes Institut verlassen hatte, das in den frühen i93oer-Jahren mit Rockefeller-Geld errichtet worden war. Absolut nicht, versicherte ihm Weaver. Die Stiftung hat »volles Verständnis« für diese Entscheidung. Die zweite Frage, die er Weaver stellte, war, ob die Stiftung neuerlich in der Lage sei, ihm zu helfen. Weaver fragte, was er denn brauchen würde. Geld, lautete die – charakteristischerweise ohne Umschweife vorgebrachte – Antwort. Er schätzte, dass er um die 5.000 Dollar jährlich brauchte. Weaver zeigte sich zwar zurückhaltend und warnte, dass er nicht in der Position sei, irgendwelche Versprechungen zu machen. Doch gleichzeitig meinte er, es sei für von Frisch einfacher, in Österreich Geld zu bekommen, als wenn er in Deutschland geblieben wäre. In Deutschland, klagte Weaver, würden so viele Geld brauchen. Er ermutigte von Frisch, einen Vorschlag zu machen, und falls er die finanziellen Mittel bekäme, könne er frei darüber verfügen, wofür er das Geld verwende. Wenn, dann würde er das Geld zuerst einmal für drei Jahre bekommen, doch wenn der Antrag genehmigt sei, gäbe es keinen Grund, so Weaver, die Unterstützung nicht zu verlängern. Am darauffolgenden Tag stellte von Frisch den gewünschten Antrag für eine Finanzierung durch die Stiftung zusammen.
Von New York aus ging es weiter nach New Jersey an die Universität von Princeton. Während er seine Vorlesung vor einem brechend vollen Saal hielt, traf es ihn wie ein Blitz, als er Albert Einstein im Publikum erkannte. Aufmerksam lauschte der Mann mit der weißen Mähne und den lachenden Augen dem Vortrag über Bienen. Einstein war ein berühmtes Symbol für die Brillanz der deutschen Wissenschaft und die Diskriminierung durch die Nazis geworden. Im Jahr 1933 hatte er lautstark gegen die Machtergreifung der Nazis protestiert, indem er seinen Reisepass aufgegeben und es abgelehnt hatte, von einer Auslandsreise nach Deutschland zurückzukehren. Daraufhin hatte das Regime seine Arbeit als typisch für jüdisches Denken geschmäht und einen Allerweltsphysiker auf seinen Platz befördert.376
Nach dem Vortrag lud Einstein von Frisch in sein Büro ein, das sich im nahen Institut für Höhere Studien befand. Mit Zuneigung erinnerte sich von Frisch an Einsteins Sinn für Humor und stellte später ganz unbefangen fest, dass der Mann einen »guten Kopf« besaß.377 Dass sie sich lange über ihre Geschichten mit den Nazis oder über Deutschland unterhalten haben, ist kaum anzunehmen. Viel eher drehte sich das Gespräch um von Frischs Arbeit und das von den beiden geteilte Vergnügen am Intellekt. Sowohl Einstein als auch von Frisch waren ausgezeichnete Beispiele für Wissenschaftler, denen sich das amerikanische Publikum nach dem Krieg getrost zuwenden konnte, da beide unpolitisch schienen, noch besser: Von beiden war bekannt, dass sie mit dem Deutschen Reich gehadert hatten.
Während er noch in Princeton war, unternahm von Frisch eine kleine Exkursion in die Nachbarstadt Plainsboro, wo er ein weiteres Wunder des modernen Zeitalters besichtigte: eine unter dem Namen Rotolactor bekannte futuristische Milchfabrik. Errichtet auf rund zehn Quadratkilometern hügeligen Agrarlands – zu einer Zeit, in der der Gartenstaat noch getupft war von Pfirsichhainen –, verfügte die Molkerei über rund 1550 Kühe, die unter hochmodernen Bedingungen gehalten wurden.378 Während normale Kühe abgrasten, was es am Boden eben gab, wurde diesen Tieren eine wissenschaftlich zusammengestellte Diät verfüttert. Täglich bekamen sie 27,7 Kilogramm zu fressen, die aus vierzehn Ingredienzien bestanden, darunter Rübenbrei, Salz, Milchpulver, konzentriertes Riboflavin sowie Saat-Luzerne, die man aus Colorado, Arizona und Nevada hierher transportiert hatte.
Die spektakulärste Innovation, abgesehen von der anspruchsvollen Nahrung, wurde jedoch beim täglichen Melken demonstriert. Von Frisch und einige weitere Besucher konnten die Vorgänge von einer Plattform aus, die sich hinter einem Fenster befand, beobachten. Die Tiere marschierten »der Reihe nach und offenbar gern in ihre Boxen auf der Riesendrehscheibe, die sich in 10 V Minuten einmal herumdreht.« Von Frisch beschrieb, dass ihnen von einer »weißgekleideten Jungfrau mit einem Gartenschlauch Popo und Euter abgespritzt wird. Dann kommt, mech. ausgelöst, ein Strom Warmluft gegen Popo u. Euter. Dann wird mit der Hand der vierteilige Melkschlauch angesetzt u. man sieht wie die elektr. gemolkene Milch sich im Glasgefäß sammelt, von wo sie dann mechanisch ausgeleert u. automatisch gewogen … wird.« Er erfuhr, dass 1550 Kühe auf diese Weise in bloß sechs Stunden gemolken wurden.379
Nicht nur hier, sondern auch an anderen Orten, die er während seiner Reise sah, bemerkte von Frisch die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Landwirtschaft, die klinische Atmosphäre (mit »blitzsauberen« Kühen) und den hohen Grad an Technisierung, der die Tiere in den USA eng an Maschinen band. Während seiner ganzen Reise beschrieb er ähnliche Eindrücke. Dabei ging es um Honigproduktion im großen Stil ebenso wie um Windhunde, die nur für Rennen und Wetten gehalten wurden – zwei für die USA typische Tierarten, die für menschliche Bedürfnisse und Wünsche eingespannt wurden.
Während der Osterferien trafen Karl und Margarete von Frisch auf weitere Beispiele für Tiere, die von ihren Betreuern offensiv manipuliert worden waren. Diesmal jedoch explizit im Namen der Wissenschaft und nicht in jenem der Landwirtschaft oder der Unterhaltung. Nach einem engen Terminplan während des ersten Teils ihrer Reise fuhren sie nun nach Florida, wo sie eine Woche Urlaub in der Yerkes Primate Station in Orange Park verbringen sollten.380 In dieser Primatenstation wurde eine Vielzahl an Versuchen durchgeführt, darunter Elektroschocktherapie, Gehirnoperationen sowie Deprivationsexperimente, bei denen Schimpansen in vollkommener Dunkelheit gehalten wurden oder man ihre Hände jahrelang ruhigstellte, um zu erforschen, ob ihre manuelle Geschicklichkeit angeboren oder erlernt ist.
Die Affenstation befand sich in einer idyllischen Gegend mit »grandiosen Virginia-Eichen und silbrigem Spanischem Moos«. Die Straße zur Station »führte durch eine kleine südliche Stadt« und entlang einer »Ansammlung schöner alter Landsitze und bescheidener Hütten, vorbei an ländlichen Krämerläden und einer Autobushaltestelle«, wie sich ein anderer Besucher aus etwa derselben Zeit erinnerte. »Außerhalb des Dorfs fiel die Straße kurz ab und führte durch ein Stück baumbestandenes Marschland. Wenn man weiter und wieder nach oben fuhr, gelangte man zum Laboratorium: stattliche weiße Bauten inmitten von semitropischer Vegetation und umgeben von einem stabilen elektrischen Zaun. Außer Sichtweite, aber unüberhörbar lag das Ziel unserer Reise – Käfig an Käfig mit kletternden, stampfenden, lauten Schimpansen.«381
An jenem Abend, als Karl und Margarete von Frisch ankamen, lag Aufregung in der Luft. Laute Schreie und aufgeregtes Kreischen hielt die beiden wach, als sie versuchten, in der fremden Umgebung ein wenig Ruhe zu finden. Am Morgen danach erfuhren sie, dass eine Schimpansenmutter nachts ein Junges auf die Welt gebracht hatte.382 Als sie gingen, um sich den Neuankömmling anzusehen, war er frisch gewickelt und schrie genauso »wie ein Menschenbaby.« Das Junge war seiner Mutter unmittelbar nach der Geburt weggenommen worden und wurde nun von seinen Pflegern mit dem Milchfläschchen aufgezogen. Von Frisch notierte, dass die Mutter »keine Zeichen von Traurigkeit [zeigt] – wie wir uns selbst überzeugen können – wenn man ihr das Baby gleich wegnimmt.«383
Ein anderer Schimpanse war seiner Mutter etwa neunzehn Monate zuvor weggenommen und in die Obhut eines jungen Paares, Catherine und Keith Hayes, gegeben worden. Viki, das Schimpansenmädchen, hatte eben gelernt, leise »Mama« zu sagen, und erinnerte auch sonst in vielerlei Hinsicht an ein menschliches Kind. Um feststellen zu können, bis zu welchem Maß die Schimpansin menschliches Verhalten annehmen würde, gedachte das Paar, ihren Schützling unter denselben Bedingungen aufzuziehen, als wäre er ihr eigenes Kind. Catherine hatte das Affenkind zu sich genommen, als es erst drei Tage alt war. Ihr besonderes Interesse gehörte dem Spracherwerb und ob man der Schimpansin sprechen beibringen konnte, wenn sie von Geburt an menschlicher Kultur und Sprache ausgesetzt war.384 Als das Ehepaar Viki zu Karl Lashleys Einweihungsparty, an der auch Karl und Margarete von Frisch teilnahmen, mitbrachte, spielte sie hinter dem Rock ihrer »Ziehmutter« Verstecken und Kuckuck!, wenn sich Fremde näherten. Obwohl der Primat in vielem an ein menschliches Kind erinnerte, fiel von Frischs persönliche Beurteilung der Forschungseinrichtung, der Aufzucht und der Yerkes Primate Station insgesamt nicht besonders günstig aus. Seinem Tagebuch vertraute er an, die Arbeiten würden »nicht den Eindruck von sehr hohem Niveau« machen.385
Nach ihrem Osterurlaub in Florida bestiegen die beiden neuerlich ein Flugzeug. Diesmal ging es nach Ohio, wo von Frisch eine Vorlesung an der Ohio State University halten sollte, bevor es weiter nach Ann Arbor in Michigan ging. Und von Michigan reisten sie nach Chicago, wo von Frisch besonders vom achtspurigen Lake Shore Drive beeindruckt war, der sich – die moderne Stadt immer im Rücken – den scheinbar unendlichen See entlangwindet. Hier lernten sie auch die flexiblen Mäuerchen kennen, mit denen damals der Verkehr geregelt wurde: Sie konnten automatisch gehoben oder versenkt werden, um den Verkehr in und aus der Stadt während der Stoßzeiten zu regulieren.
Nach der Vorlesung an der Universität von Chicago trafen Karl und Margarete von Frisch ihren Nachkriegsfreund Arthur Hasler aus Wisconsin wieder, der aus Madison gekommen war, um sie abzuholen. Mit Muße legten sie den Weg dorthin zurück und genossen die Landschaft des Mittleren Westens, die an den Autofenstern vorüberzog. »Es bliebe«, erklärte von Frisch später, »ein Versuch mit unzulänglichen Mitteln, wenn ich von den schönen Landschaftsbildern dieser Autoreise erzählen wollte.« Nicht weniger eingenommen war er von ihrem Ziel, das er als »eine der schönsten Universitätsstädte« bezeichnete. Hasler führte sie durch Madison und brachte sie schließlich zur Forschungsstation am Lake Mendota, wo »den arbeitsfreudigen Zoologen die Versuchsfische fast ins Laboratorium« schwimmen. Von Frisch war gebührend von Haslers Arbeitsbedingungen beeindruckt und schrieb bewundernd über die »eifrigen Forscher«, die für ihn arbeiteten.386
Nach ein paar Tagen in Wisconsin packte Hasler das Ehepaar von Frisch wieder in sein Auto und brachte sie nach Minneapolis, wo von Frisch seine Vorträge an der Universität von Minnesota halten sollte. Der Rest der Reise verflog schnell. Nach einem kurzen Aufenthalt in Iowa gingen sie wieder an Bord eines Flugzeugs und flogen an die Westküste. Hier fuhren sie von San Francisco bis Los Angeles, wobei unterwegs einige Vorlesungstermine eingehalten werden mussten.
Am 30. Mai flogen Karl und Margarete von Frisch zum letzten Mal nach New York, legten jedoch in Chicago einen kurzen Zwischenstopp ein. Die Köpfe nebeneinander blickten sie hingerissen durch die kleinen Fenster: »Obwohl wir uns oft über einem Wolkenmeer befanden, gab es doch wundervolle Durchblicke auf Sandwüsten mit felsigen Bergen, auf den Grand Canyon, auf die vielen schneebedeckten Kämme der Rocky Mountains …«. Und zum Anblick eines ganzen Ozeans aus gelben Blüten gesellte sich ein wunderschöner Sonnenuntergang über dem Eriesee. Spätabends schließlich erreichten sie New York.387
Die letzten Tage ihrer Reise verbrachten sie wieder in Ithaca an der Cornell University mit ihrem Gastgeber Donald Griffin. Griffin hatte ersucht, von Frisch möge seine aktuellsten Arbeiten mit Bienen demonstrieren. Dafür hatte er einen Bienenstock von der Abteilung für Entomologie des New York State College of Agriculture organisiert. Von Frisch führte Griffin in seine Arbeitsmethode mit den Insekten ein, sodass Griffin während der folgenden Wochen versuchte, diese Experimente zu wiederholen. Später, in der Einleitung zu von Frischs publizierten Vorlesungen, gestand Griffin »ohne Verlegenheit, dass ich ebenfalls einen Rest von Skepsis hatte, bevor ich diese einfachen Versuche selbst durchführte.« Seine Reserviertheit war offensichtlich von kurzer Dauer. Nach ein paar Wochen war er überzeugt und räumte ein, »dass viel zusätzliche Arbeit notwendig sein wird, bis die Tänze und die ›Sprache‹ der Bienen vollständig verstanden werden können.« Aber, versicherte er den Lesern, »die wichtigen grundlegenden Fakten … scheinen ohne jeden Zweifel festzustehen.«388

Vom Wohlstand des Landes ebenso beeindruckt wie von der fortschrittlichen und optimistischen Atmosphäre, die die Menschen ausstrahlten und die sich überall zeigte, verließ das Ehepaar von Frisch die USA. Angesichts des dunklen Hintergrunds, den Europa in diesem schmerzvollen Kampf um den Aufbau bot, muss ihnen das Leuchten des amerikanischen Sterns noch heller erschienen sein. In Amerikas Lebensmittelläden gab es eine erstaunliche Menge an Nahrungsmitteln, die »sauber in durchsichtige Hüllen verpackt« waren. Vor dem Eingang ins Geschäft konnten sich die Kunden ein »Drahtkorb-Kinderwagerl« nehmen und, staunte von Frisch, »unbeaufsichtigt« hineintun, »was das Herz begehrt.« Im Haus seines früheren Kollegen Richard Goldschmidt sah das Ehepaar von Frisch zum ersten Mal eine Geschirrspülmaschine. Und auch von der »raffiniertesten Sache«, die man in den USA bekommen konnte, erzählten ihnen die Goldschmidts: Eine Maschine, die abends mit gemahlenem Kaffee und Wasser gefüllt wird und dann so eingestellt, dass sie früh am Morgen mit der Zubereitung des Kaffees beginnt. Steht der Kaffee in der Kanne bereit, wird das Gerät zum Wecker, der seine glücklichen Besitzer mit dem Geruch nach frischem Kaffee aus den Betten holt. Und sie besuchten betriebsame Laboratorien, die mit teuren Geräten ausgestattet waren und in denen so viele Professoren und Assistenten arbeiteten, dass von Frisch gestand, es mache »einen deutschen Biologen etwas schwindelig.«389
Von der Vielzahl der Eindrücke und Erinnerungen abgesehen, war der Besuch auch insofern nützlich, als er von Frisch die Gelegenheit gab, transatlantische Verbindungen zu schmieden und zu vertiefen. Viele Amerikaner waren ihren einstigen Feinden gegenüber nach wie vor argwöhnisch, und von Frisch war für viele der erste Deutsche, den sie nach dem Krieg persönlich trafen. Was die Kontakte stark vereinfachte, war das Wissen, dass er unter den Nazis gelitten hatte. Und was das intellektuelle Format und die politische Unschuld betraf, wurde seine Wissenschaft als »gut« betrachtet. Von seinen Bienen zu hören, von deren Sinnen ebenso wie von ihrer segensreichen Verwendung für die Landwirtschaft, ließ die Menschen hoffen, dass es eine Wissenschaft gab, die sowohl unpolitisch als auch positiv für die Menschheit war. Von Frisch und seine Bienen konnten als Sonderbotschafter in einer Nation dienen, die sich inmitten einer globalen Neuordnung gegen den aufkommenden Kalten Krieg befand.
Die zweimonatige Reise ermöglichte es von Frisch, seine aktuellste Arbeit vielen der einflussreichsten Wissenschaftler seiner Zeit zu präsentieren. Und es waren Vorlesungen, die das Publikum in ihren Bann zogen. Donald Griffin, von Frischs Gastgeber in Ithaca, sprach von einer »erfreulichen Direktheit und Einfachheit«, als von Frisch seine neuesten Entdeckungen präsentierte, und berichtete darüber hinaus, dass seine »rezente Arbeit einen höchst vorteilhaften, vielleicht sollte ich sogar sagen: einen höchst dramatischen Eindruck auf Biologen machte, wo immer er sich aufhielt.«390 Der Gastwissenschaftler, hielt Griffin fest, »unterbreitete seinen Hörern keine vagen oder geheimnisvollen Spekulationen, sondern eher Phänomene, die – so erstaunlich sie auch sein mögen –, konkret sind und beobachtet wurden.«391 Und der komparative Psychologe Robert Yerkes erklärte, er habe »niemals eine perfektere Vorlesung gehört« als von Frischs Vortrag über die Tänze der Bienen.392
Karl von Frisch gewann nicht nur eine wichtige Hörerschaft für sein wissenschaftliches Werk, es war ihm darüber hinaus möglich, eine Reihe informeller Gespräche über die Bedingungen in seinen beiden Heimatländern, Deutschland und Österreich, zu führen. Erhalten geblieben ist von diesen nichtwissenschaftlichen Konversationen, die sich am Rande seiner beruflichen Treffen ergaben, sehr wenig. Wenn es in den Unterhaltungen um seine Kriegserfahrungen ging, dann wird er – wie man sich leicht vorstellen kann – von seinen Mühen unter den Nazis erzählt haben, dass er ihr Vorgehen immer missbilligt hatte und über ihren Sturz froh sei. Die Begegnungen stärkten zweifellos seine zuvor schwachen transatlantischen Bindungen, da er offensichtlich von Kollegen wie Hasler und Griffin ebenso geschätzt wurde wie von dem Genetiker Richard Goldschmidt, einem jüdischen Emigranten. Es waren diese Verbindungen, die sich für den Zuspruch und die Fortsetzung seiner Arbeit in den kommenden Jahren als wesentlich herausstellen sollten.
Doch die bedeutendste Begegnung für von Frischs Zukunft fand möglicherweise in der Rockefeller Foundation in New York statt. Das Ansuchen, das er so eilig nach seinem Besuch aufsetzte, brachte ihm eine Subvention ein, die einmal mehr einen großen Teil seiner zukünftigen Forschungsarbeit zuerst in Graz und dann in München finanzierte. Angesichts des Flächenbrandes, den der Zweite Weltkrieg ausgelöst hatte, war man in der Rockefeller Foundation besonders an Projekten interessiert, die sich mit Kommunikation befassten. In der Stiftung war man begierig, eine Forschung zu fördern, die Brücken über jene Abgründe zu schlagen vermochte, die Nationen, Kulturen oder, in diesem Fall, Arten trennten. Am Abend nach seinem Termin schrieb von Frisch in sein Tagebuch: »Weaver hat mir vorher gesagt, alle sind an wechselseitiger Verständigung zwischen den Völkern interessiert.«393 Mehr als vier Jahre und unzählige Gespräche später erfüllte sich auf diese Weise Haslers Charakterisierung von Frischs, er sei die »richtige Art von Deutschem«.

Begierig darauf, wieder an seine Arbeit zu kommen, kehrte von Frisch nach Österreich zurück. Es war Anfang Juni, die Saison begann also gerade erst. Im vorangegangenen Sommer hatte er mit Versuchen begonnen, bei denen er eine Polarisationsfolie einsetzte und die darauf hinzudeuten schienen, dass Bienen ihre horizontalen Tänze aufgrund ihrer Wahrnehmung der Polarisationsmuster des Himmels auf die Sonne ausrichten. Die Versuche hatte er mit einer einzigen Polarisationsfolie durchgeführt, die ihm ein Kollege von einer früheren Amerikareise mitgebracht hatte. Für die weiteren Schritte jedoch benötigte er mehr Folien, und jene Folien, die er von Land bei seinem Besuch der Polaroid Company erhalten hatte, erwiesen sich nun als nützlich.
Wenn Bienen in der Lage sind, die Polarisationsmuster des Himmels zu analysieren, überlegte von Frisch, dann musste irgendetwas in ihren Augen dazu dienen. Dieses Forschungsfeld war ihm aufgrund seiner früheren Studien über Facettenaugen vertraut. Sein Onkel Sigmund Exner hatte eine Abhandlung über das Facettenauge geschrieben, die später auf Englisch wiederaufgelegt wurde und zu der von Frisch ein Vorwort schrieb. Er lobte die Arbeit für ihre »internationale Bedeutung« und die Tatsache, dass sie »heute wiederaufgelegt wird, ohne dass sich auch nur ein grundlegender Punkt in den vergangenen Jahren als falsch herausgestellt hat.«394 »Heute«, das waren genau einundneunzig Jahre nach der Erstauflage. Das heißt, dass sich von Frisch in diesem und in den vergangenen Sommern, als er sich auf das Verhalten der Bienen und die funktionellen Aspekte ihrer physiologischen Fähigkeiten konzentrierte, deutlich der komplizierten physischen Strukturen ihres Sehapparats bewusst war. Dieser ganzheitliche Blickwinkel auf das Tier – von seiner evolutionären Geschichte bis zu seinen Zellen – hatte sich nicht zuletzt durch jene Arbeit perfektioniert, die er jahrelang als Herausgeber der Zeitschrift für vergleichende Physiologie geleistet hatte. Nirgendwo in seinem Werk zeigt sich sein enormes Wissen verbunden mit seinem Einfallsreichtum für Experimente brillanter als hier.
Abb. 7. 2. Eine Doppelseite aus dem Notizbuch von Karl von Frisch, wo er die Schattierung der verschiedenen dreieckigen Teile der künstlichen Augen aufzeichnete. Hier hielt er zudem Tageszeit, relative Bewölkung und die Richtung, in die er das »Auge« gehalten hatte, fest. (Nachlass Karl von Frisch, Bayerische Staatsbibliothek, München, ANA 540.)
Damit die Bienen polarisiertes Licht wahrnehmen können, schlussfolgerte von Frisch, muss es in ihren Augen einen physischen Analysator geben. Seine Überlegungen gingen dahin, dass es möglicherweise etwas im Auge gab, das wie ein Prisma funktionierte. Dem Vorschlag eines Kollegen folgend, der sich auf die Physiologie des Sehsinns spezialisiert hatte, richtete er seine Aufmerksamkeit auf die sternförmig angeordneten Sinneszellen, die in den Augenkeilen oder Ommatidien zu finden sind.395 Was von Frisch an diesen Zellen als potenzielle Kandidaten für jenes Organ, mit dem polarisiertes Licht wahrgenommen wird, so faszinierte, war die Tatsache, dass jeder Augenkeil acht dieser Zellen sternförmig um einen zentralen Nerv angeordnet hat. Um herauszufinden, ob sich ein solcher Aufbau strukturell zur Analyse der Lichtmuster am Himmel eignete, konstruierte von Frisch mit den Folien von Polaroid ein Modellauge.
Dafür schnitt er acht Dreiecke aus der Polarisationsfolie und ordnete sie sternförmig an – wie eine Pizza aus acht Teilen. Die Enden der Teile waren allerdings nicht rund, sondern fügten sich zu einem regelmäßigen Achteck zusammen. Die Polarisationsachse jedes Dreiecks verlief parallel zu seiner Basis, woraus sich eine sternförmige Struktur ergab. Das Ganze diente als modellhafte Darstellung, wie die acht Rhabdome – Sehstäbe – im Einzelauge einer Biene rund um den zentralen Nerv angeordnet sind. Sah man Licht vom Himmel durch das, was von Frisch »Sternfolie« nannte, erschien jedes der Dreiecke in einem anderen Grad von Hell oder Dunkel, abhängig davon, wie viel polarisiertes Licht durchgedrungen war. Hielt man die Sternfolie in andere Richtungen am Himmel, veränderte sich das Muster in den acht Dreiecken.
Polarisiertes Licht ist eine stehende Welle. Man stelle sich nun vor, eine Polarisationsfolie hat parallel verlaufende Schlitze, die nur Lichtschwingungen durchlassen, die besonders flach einfallen. Je nachdem, wie sich das Licht in irgendeinem Bereich des Himmels zusammensetzt, wird die Folie nur das Licht hindurchlassen, das in dieselbe Richtung schwingt, wie die Schlitze verlaufen. Ist die Folie auf eine Stelle ausgerichtet, wo viel Licht mit der Polarisationsachse der Folie übereinstimmt, wird viel Licht ungehindert durchdringen und diesen Bereich der Folie sehr hell erscheinen lassen. Ist die Schwingungsrichtung jedoch ganz anders als die Ausrichtung der Schlitze in der Folie, wird der Lichteinfall blockiert. In der Folge sieht die Folie dunkler aus. Jeder Bereich des Himmels verfügt abhängig von seiner örtlichen Relation zum Sonnenstand über seine eigene einzigartige Zusammenstellung polarisierten Lichts. Das Augenmodell bot für jede Position eine ebenso einzigartige Konfiguration aus Dreiecken in relativer Helligkeit und Dunkelheit. Karl von Frisch setzte das Phänomen damit in Beziehung, wie eine Biene es sehen würde: »Bei der Betrachtung des blauen Himmels durch dieses künstliche Auge ließ sich ein charakteristisches Muster auf jedem Himmelsausschnitt erkennen, das von der Sonne abhängt und sich deswegen mit der Tageszeit ändert. Ist die Biene fähig, die Unterschiede der Muster wahrzunehmen, so kann sie sich … nach einem Stück Himmel orientieren.«396
Doch benutzten die Bienen einen analogen Polarisationsprozess in ihren Augen, um ihre Tänze auszurichten, oder war dies bloß eine weitere interessante Art, wie man Licht analysieren konnte? Um diese schwierige und wichtige Frage zu klären, untersuchte von Frisch im nächsten Schritt das künstliche Auge an der Seite seiner tanzenden Bienen.
Nun führte er parallele Experimente durch, in denen er die Sternfolie neben den Bienen verwendete, um zu untersuchen, ob deren Verhalten aufgrund des Gebrauchs der Folie genau vorhergesagt werden kann. Für diese Versuche montierte er eine Polarisationsfolie über das künstliche, achtseitige Auge und eine zweite über das Glasfenster eines horizontal gelegten Bienenstocks. Indem er die Polarisationsachse auf den beiden Folien einzeichnete und ihre Neigung an einer kreisförmigen Scheibe mit eingezeichneten Graden adjustierte, konnte er die Orientierung beider Folien exakt ausrichten. War die Folie über dem künstlichen Auge so positioniert, dass die Dreiecke sich nicht veränderten, ging er davon aus, dass das Polarisationsmuster dieses Himmelsausschnitts ungehindert durch die Folie drang. Nun konnte er die Folie über dem Bienenstock in genau demselben Winkel ausrichten: Die Tänze der Bienen veränderten sich nicht, was bestätigte, dass die Lichtstrahlen unverändert durch die Folie drangen. Variierte er danach den Winkel der beiden Folien ganz identisch so, dass sich eine Veränderung beim Muster des künstlichen Auges zeigte, veränderten auch die Bienen ihre Tänze. Nach diesem Versuch bewegte von Frisch das künstliche Auge (nun ohne die darübergelegte Folie) über den Himmel, bis er jene Position fand, in der sich dasselbe Muster zeigte wie vorhin, als das Auge während des Versuchs mit der Folie abgedeckt war. Er erkannte, dass die Bienen ihre Tänze in eine »falsche« Richtung ausgeführt haben, und zwar in exakt jenem Winkel, in dem sie angenommen hatten, dass die Sonne steht. Und damit befand sich das letzte Teilchen des Puzzles vom vergangenen Sommer an der richtigen Stelle: Von Frisch folgerte aus dem Versuch, dass das künstliche Auge ein akzeptables Modell dafür war, wie Bienen das polarisierte Licht des Himmels wahrnehmen, wenn sie auf horizontalen Oberflächen tanzen.

Als Arthur Hasler von seiner Strategic-Bombing-Survey-Mission aus Deutschland in die USA zurückkam, bereiste er mit seiner Familie Utah, den Bundesstaat, aus dem er stammte. Hasler und seine Familie liebten die Natur, und an einem der folgenden Tage unternahmen sie eine Wanderung auf den Mount Timpanogos. Wie, hatte sich Hasler vor einiger Zeit in seinem Labor gefragt, finden Lachse an ihre ursprünglichen Laichplätze zurück? Als sie zu einer Felszunge des Bergs kamen, wurde Hasler unversehens von einer Welle des Wiedererkennens getroffen – ein unverwechselbarer Geruch nach Erde, Blumen und Luft fegte über ihn hinweg. Und dann ging es ihm auf: Es war der Geruch nach Zuhause. Hier ist nachzulesen, wie er nahezu vier Jahrzehnte später davon erzählte:
»Während ich einen Bergpfad der Wasatch Range in den Rocky Mountains, wo ich aufgewachsen bin, entlangwanderte, wurden meine Überlegungen über das Wanderverhalten der Lachse bald von wundervollen Geruchsnoten unterbrochen, wie ich sie seit ich ein Bub war nicht mehr gerochen habe. Als ich in die alpine Zone am Osthang des Mount Timpanogos hinaufkletterte, erreichte ich einen Wasserfall, der dem Blick durch einen Felsvorsprung vollständig entzogen war; doch als eine kühle Brise den Duft nach Moos und Akelei um das felsige Hindernis trug, sprangen die Details dieses Wasserfalls und seine Lage an der Bergwand plötzlich vor mein inneres Auge. Tatsache ist, dass der Geruch so eindrucksvoll war, dass er eine ganze Erinnerungsflut an meine Kindheit wachrief, die längst aus dem bewussten Erinnerungsvermögen verschwunden war.«397
Die Lösung für die Frage, warum die Lachse fähig waren heimzukehren, ging ihm auf, muss irgendwie mit ihrer Wahrnehmung von und ihrer Erinnerung an heimatliche Gerüche zu tun haben. Im Laufe der folgenden Monate und Jahre arbeitete er daran, diese Hypothese durch Versuche zu untermauern, was sich als ein Meilenstein seiner akademischen Karriere erweisen sollte.
Doch wie es oft mit den Lösungen widerspenstiger wissenschaftlicher Probleme ist, sind es kleine Einsichten, die sich sammeln und aufbauen, bis sie die kritische Masse erreichen. Hasler, der vieles in seiner späteren Erinnerung erkannte, schrieb diese Einsicht den Werken von zwei europäischen Tierverhaltensforschern zu, die er vor dieser Entdeckung gelesen und studiert hatte: Konrad Lorenz’ Arbeit über die Prägung und Karl von Frischs Forschung über Panikreaktionen bei Fischen und die Angstsubstanz, die sie verströmen, wenn sie verletzt sind.398 Anzunehmen ist außerdem, dass von Frisch und Hasler in Brunnwinkl über die Duftlenkung von Bienen zu Futterpflanzen gesprochen haben. Tatsächlich hat ja Hasler zwei Jahre später von Frischs Buch über seine Arbeit für Science besprochen.399 In diesem Werk wurde nicht allein die Kraft von Gerüchen für die Navigation von Bienen besprochen, sondern auch deren Fähigkeit, spezifische Gerüche zu unterscheiden und zu erinnern.
Damit wurde Haslers Arbeit zu jener Verkörperung eines transatlantischen Ideenaustausches, den er unmittelbar nach dem Krieg erhofft hatte. Für viele war damals eine gute Wissenschaft per definitionem objektiv und somit frei von jeder Ideologie. Sie dachten, dass – ausgenommen die offensichtlichen Nazi-Rassenkundler und jene Ärzte, die öffentlich in Nürnberg angeklagt worden waren – gute Wissenschaftler keine Entnazifizierung nötig hätten. Anhänger dieser Sichtweise, und Hasler gehörte dazu, waren offener als andere dafür, die internationalen Kontakte mit ihren deutschen Kollegen wiederaufzunehmen. Sie setzten sich nachdrücklich für die Wissenschaft ein, die sie als eine Möglichkeit betrachteten, Frieden und Demokratie neuerlich aufzubauen. Von Frisch selbst erklärte in der Einleitung zur englischsprachigen Sammlung seiner Vorlesungen, die er in den USA gehalten hatte, dass »wissenschaftliche Arbeit international sein muss und nicht vorankommen kann, wenn man sie in einen Käfig sperrt.«400 Hasler und auch andere boten Wissenschaft als eine Zuflucht vor der Politik an. Doch verknüpft mit der Nachkriegshoffnung, Wissenschaft könnte den internationalen Frieden fördern, ist eine damit verbundene und gleichzeitig entstandene Geschichte: die trügerische Vorstellung, Wissenschaftler seien vom Nazi-Regime geopfert worden, weil es eine streng antiwissenschaftliche Ideologie unterstützt hatte.
Jene wie Hasler und Griffin, die von Frisch den Rücken stärkten, waren entscheidend für die Legitimierung und Verbreitung der Geschichten vom nazi-feindlichen Betragen des Wissenschaftlers. Das heißt nicht, dass das, was sie über von Frischs Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs erzählten, faktisch unrichtig oder absichtlich irreführend war. Doch sie trugen erheblich zu einer bestimmten Meinung bei. Von Frisch erwies sich als perfektes Vehikel dafür, einem Deutschen nach dem Krieg wieder Wohlwollen entgegenbringen zu können. Es war glaubhaft, dass er ein Opfer der Nazis war und es dennoch zuwege gebracht hatte, seine hervorragende wissenschaftliche Arbeit während des ganzen Kriegs fortzusetzen. Er kam dann in die einzigartige Position, seine Arbeit frei und von den Nazis finanziert in Brunnwinkl weiterführen zu können, ohne auch nur irgendeinen Makel davonzutragen. Er war politisch tragbar, wo so viele andere sich kompromittiert hatten. Für das Konstrukt dieser Charakterisierung war eine subtile Verlagerung dessen nötig, wie seine Arbeit während des Kriegs dargestellt wurde. Von Frisch und seine Unterstützer vollführten aktive Manöver, um sicherzustellen, dass er seine Forschung fortsetzen konnte. Doch diese Bemühungen waren über weite Strecken damit verbunden, wie die Geschichte in der Nachkriegszeit erzählt wurde. War die deutsche Wissenschaft auch ruiniert – hier gab es jemanden, mit dem sich die Amerikaner wohlfühlen konnten.
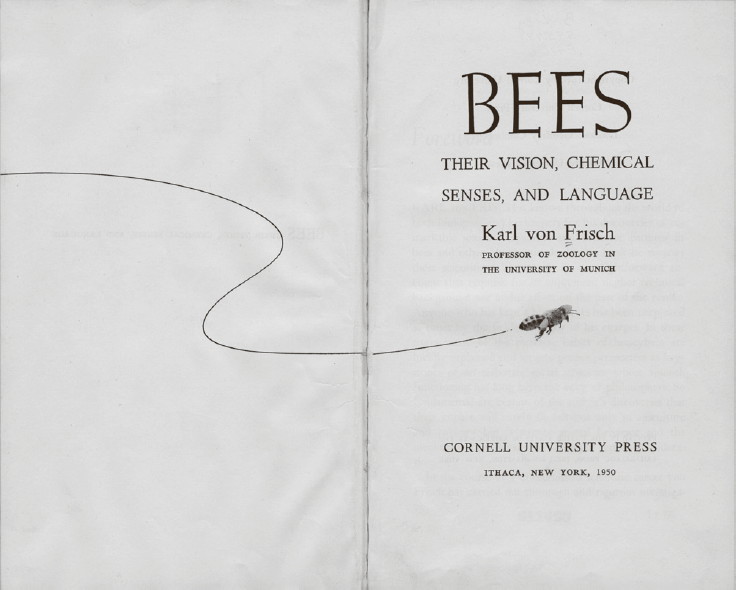
Abb. 7. 3. Titelseite des Buchs, in dem die Vorlesungen veröffentlicht wurden, die von Frisch bei seiner USA-Reise 1949 gehalten hatte. Donald Griffin schrieb die Einleitung und machte die Publikation durch die Cornell University Press, des Verlags seiner Universität, wahrscheinlich auch möglich. (Karl von Frisch: Bees: Their Vision, Chemical Senses, and Language. Cornell University Press, Ithaca, NY, 1950.)
Diese Transformation vom unberührbaren Deutschen (was den Blickwinkel der Rockefeller Foundation betraf) zum »guten Deutschen« hatte von Frischs USA-Reise im Jahr 1949 ermöglicht. Umgekehrt ermöglichte ihm dieser Besuch, sich neuerlich der Förderung durch die Stiftung zu versichern. Im Juni 1949 traf die Rockefeller Foundation die Entscheidung, von Frischs Grazer Institut 25.000 Dollar zukommen zu lassen. 10.000 Dollar waren für die Reparatur des immer noch stark beschädigten Gebäudes gedacht, je 5.000 Dollar während der kommenden drei Jahre sollten seine Forschungen unterstützen. Tatsächlich förderte die Rockefeller Foundation von Frisch und seine Studenten großzügig bis in den Sommer 1964.401 Der Bienenforscher war also einer der am besten finanzierten Forscher vor dem Krieg und konnte während der folgenden Dekaden wiederum unter enorm günstigen Bedingungen arbeiten.
Abgesehen davon, dass es ihm möglich war, großzügige Förderungen für seine Arbeit zu bekommen, bot ihm diese Reise in die USA auch die Gelegenheit, zu einer Zeit vor einem amerikanischen Publikum über seine Arbeit zu sprechen, als der europäische Ansatz in der Tierforschung begann, großes Interesse hervorzurufen. Da der Behaviorismus allmählich einbrach, waren die Amerikaner auf der Suche nach anderen Methoden, die ihnen halfen, Tiere zu verstehen, und zwar nicht bloß als Doubles für Menschen in einer künstlichen Laborszenerie. Der europäische Zugang brachte etwas Neues: Tiere in ihren natürlichen Habitaten wurden ihretwegen erforscht und nicht als bloßer Ersatz für Menschen. Und die Kontakte und Unterstützungen, derer sich von Frisch auf dieser Reise versicherte, kamen ihm zugute, als er sich einer der größten Herausforderungen seiner Karriere gegenübersah.