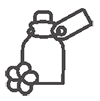Wie eine kleine Fee steht sie da, im bemoosten, nebeligen Wald, und lädt zum Träumen ein. Auch im lichten Unterholz, an Quellen und in der Nähe fließender Gewässer findet man sie, die anmutige, ausdauernde, krautige, menschengroße Staude, der man den Namen Baldrian gegeben hat. Sie besitzt feine, fiedrige Blätter und harmonisch abgerundete, in rispigen Scheindolden zusammengesetzte, weiße bis rosarote Blüten, die von Juni bis August blühen. Dann erscheinen die Samen, kleine, vom Lufthauch getragene Schirmflieger, die auch vom Wasser fortgeschwemmt werden können. Und wenn Schweben und Schwimmen nichts bringt, kann sich die Pflanze auch mittels kriechender Wurzelausläufer vermehren. Der Echte Baldrian wächst von Westeuropa über Sibirien bis in den Fernen Osten.
Zur Familie der Baldriangewächse (Valerianaceae)30 gehören weltweit acht Gattungen mit rund 350 Arten; die Gattung Valeriana umfasst 120 Arten. Zu den recht illustren Pflanzenpersönlichkeiten der Baldrianfamilie zählen zum Beispiel:
Echter Speik (V. celtica), dessen Wurzel ebenfalls den durchdringenden Baldriangeruch hat. Wie der Gallier Marcellus Empiricus berichtet, galt diese Pflanze bei den Kelten als hervorragendes Magen- und Lebermittel; sie benutzten die getrockneten Wurzeln auch als Räucherwerk. Ein Name dieser Pflanze ist Magdalenenkraut, denn man glaubte, Maria Magdalena habe mit dem Öl aus Speik die Füße Jesu gesalbt. Es handelt sich dabei aber um einen Ersatz, denn das echte Nardenöl wurde aus den Wurzeln des Nardenbalsams (V. jatamansi), eine teure Spezerei aus Indien, gewonnen.
Die Rote Spornblume (Centranthus ruber), auch Roter Baldrian genannt, ist ebenfalls eine nahe Verwandte aus dem Mittelmeerraum, die man gelegentlich auch in unseren Gärten findet und deren Wurzel auch eine beruhigende Wirkung hat. Die jungen Blätter lassen sich wie der Nüssler als Salat zubereiten.
Der Feldsalat (Valerianella locusta), auch Nüssler oder Rapünzli genannt, war einst ein »Unkraut« in wärmeren Gebieten, wo Weinanbau möglich ist. Die zarten, äußerst schmackhaften, vitaminreichen Blätter sind inzwischen aus den Salatschüsseln gesundheitsbewusster Zeitgenossen nicht mehr wegzudenken.

Eng verwandt mit dem Echten Baldrian ist die Rote Spornblume, die bei uns als genügsame Steingartenpflanze beliebt ist.
NAMEN UND BRAUCHTUM
Der wissenschaftliche Name der Gattung Valeriana wie auch der deutsche Name Baldrian lassen sich höchstwahrscheinlich auf das mittellateinische/französische Wort valere (»stark sein, starke Kräfte besitzen«) zurückführen. Aber da streiten sich die Gelehrten. Die alten Griechen und Römer kannten die Pflanze unter diesem Namen jedenfalls nicht, sondern als Phu, was sich wahrscheinlich auf ihren starken Geruch bezieht. Aber ob das Phu, von dem Dioskurides und andere Autoren der Antike berichten, wirklich unser Echter Baldrian war oder doch eine andere Pflanze, ist auch nicht sicher. Die Benennung Valeriana ist nicht klassisch, sie erscheint erstmals im 10. Jahrhundert.
Sicherlich geht der Name nicht – wie manchmal behauptet wird – auf die Region Valeria in der römischen Provinz Pannonien an der Donau zurück. Das Wiktionary gibt zwar an, es sei ein Wort, welches das Steppenvolk der Awaren, eines der Turkvölker, mitbrachte, als es Pannonien eroberte. Es käme vom mongolischen balčirgana, was »Engelwurz« bedeute und sei mit dem türkischen Wort baldiran (»Schierling«) verwandt. Das scheint mir aber ziemlich weit hergeholt und stimmt wahrscheinlich ebenso wenig wie die Zurückführung auf den römischen Kaiser Valerianus, der von 253 bis 260 n. u. Z. herrschte.
Katholische Mönche erzählten dazu folgende fromme, pädagogische Mär: Zur Zeit dieses Kaisers war das Gefängnis, in welchem christliche Märtyrer schmachteten, allnächtlich von einem überirdischen Licht erfüllt. Der Kaiser, dem das berichtet wurde, befahl, ins Bettenlager der Gefangenen Baldriankraut zu streuen, denn er wusste, dass die Pflanze jeglichen Zauber vertreiben konnte. Aber der Kerker erglänzte in der folgenden Nacht schöner und heller als je zuvor. Unter dem Haupte der Bekenner trieb das Kraut rosa angehauchte Blüten, die nun wie eine Siegeskrone erstrahlten (Zimmerer 1896: 278).
Die Romantiker des 18. und 19. Jahrhunderts, begeistert von geheimnisvollen Märchen und Mythen, leiteten den Namen der Pflanze von Baldur, dem reinsten und lichthaftesten Gott der skandinavischen Götterwelt ab, dem Sohn von Odin und Frigg. Der schwedische Botaniker Linnaeus war ebenfalls überzeugt, dass der Name des Baldrians auf den nordischen Sonnengott zurückgehe31. Aber eigentlich ist der Baldrian gar keine Sonnenpflanze, wie etwa die Sonnenblume oder das Gänseblümchen. Der Baldrian ist, wie Siegfried Bäumler schreibt, an magisch-mystischen Orten, neben Bachläufen, versteckten Quellen und in nebligen, feuchten Auen zu finden, umtanzt in mondhellen Nächten von Wesen des Wassers und des Mondes – den Undinen, Nixen, Elfen und Feen (Bäumler 2007: 69).
Die Geschichte von Baldurs Verbindung mit dem Baldrian stimmt ebenso wenig wie die ebenfalls schwärmerische, romantische Legende der Göttin Herta, der Mutter der friedlichen Wanen, die auf einem edlen Hirsch reitend durch den Wald zieht und eine Atmosphäre der heiligen Harmonie verbreitet. In ihrer Hand hält sie, wie einen Königszepter, eine Gerte aus Baldrian; die Zügel bestehen aus Hopfenranken. Das mit den Hopfenzügeln kann aber auch nicht stimmen, denn den alten Germanen war die Pflanze vermutlich nicht bekannt. Alles spricht dafür, dass die Kletterpflanze ursprünglich in den Wäldern West- und Mitteleuropas nicht vorkam und hier noch nicht allzu lange heimisch ist. Sie stammt aus dem pontisch-kaspischen Raum. 5000 Jahre lang hat man Bier ohne Hopfen gebraut. Erst im 8. Jahrhundert begann man, zuerst in Frankreich und dann in Bayern, dem Bier die bittere Würze zuzusetzen (Reichholf 2008: 246).
Genauer gesagt, kennt man den Ursprung des Wortes Baldrian nicht wirklich.
Baldrian – englisch valerian; französisch valériane; italienisch valeriana, russisch valeriána – kommt im ganzen deutschen Sprachraum in den verschiedensten Verballhornungen vor: Baldrion, Ballerjon, Bollerjan, Bolderjan, Fallerjan, Balderkraut und so weiter. Aus Bollerjan und Donnerjahn versuchten einige auf germanisches Altertum fixierte Gelehrte eine Verbindung zum polternden (bullernden) Gewittergott Donar herzustellen, aber das ist wieder einmal eine intellektuelle Spinnerei, die keine Basis hat.
Wo man ihn auch antrifft, überall gilt der Baldrian als hexenwidriges Zauberkraut:
...
Baldrian, Dost und Dill,
die Hex‘ kann nicht, wie sie will.
...
Wenn Baldrian über der Tür hängt, kommt die Hexe nicht in Haus und Stall, liegt er in der Tränke, kann sie das Vieh nicht verzaubern. Oft befestigte man ein mit einer Schnur zusammengebundenes Büschel getrockneten Baldrians an der Decke der Stube. Wenn ein altes Weib eintrat und man wusste nicht, ob es sich verstellte und falsch-freundlich tat, dann bewegte sich das Büschel sanft und zeigte damit an, dass es sich um eine Unholdin handelte. Besonders eine Wöchnerin nach der Geburt ist durch üble Mächte gefährdet, ebenso wie die Kuh nach dem Kalben. Baldrian kann beide schützen.
Eine niederdeutsche Sage erzählt, wie ein böser Elf eine junge Mutter mit ihrem neugeborenen Kind überfiel und entführte. Als sie zu einer Wiese kamen, auf der Baldrian wuchs, rief der Geist der Frau zu: »Heb deinen Rock, dass der Balderjanke nicht in den Saum fällt!« Die Frau war klug genug, das nicht zu tun, sie pflückte im Gegenteil noch einige blühende Baldrianstängel, sodass das unholde Wesen von ihr ablassen und fliehen musste.
In Skandinavien weihte man das Waldkraut dem sagenhaften Meister der Täuschung, dem Schmied und Magier Wieland (altnordisch Völundr; englisch Wayland). Es ist »die Wurzel Wielands«, die Velandsurt in Dänemark und Island, die Velandsrot in Schweden. Mit der Wurzel lässt es sich zaubern. Damit wird geräuchert, wenn jemand an der Elfenkrankheit leidet. Die Elfen, wie man sie traditionell wahrnahm, waren nicht die lieblichen, wohlwollenden, eher kitschigen Naturgeister mit schillernden Libellenflügeln, wie man sie sich so gerne in der britischen Lektüre des 19. Jahrhunderts oder in der heutigen Esoterikszene vorstellt. Früher wusste man, dass die Elfen gefährlich sein können. Gerne holen sich diese bezaubernden Wesen der Parallelwelt besonders hübsche Kinder, schöne Frauen in ihrer jugendlichen Blüte, begabte Sänger und Musiker oder kräftige junge Männer hinüber in ihr Zauberreich. Die Opfer werden nicht nur entrückt oder verrückt, sondern oft bedeutet das, dass sie sterben (Storl 2012: 269ff).
Der Neid der Elfen war gefürchtet. Brautleute etwa, die sich verheiraten wollen, erregen leicht diesen Neid. Damit der Bräutigam potent bleibt, sollte er am Hochzeitstag einige Baldrianwurzeln in seiner Rocktasche tragen – so der Brauch in Schweden.
Ein Kraut der Liebesgöttin und der Katzen
Katzenkraut ist eine häufig vorkommende Benennung der Pflanze. Es ist das Chatzechrut im alemannischen Sprachraum, das Kattenkrut auf dem plattdeutschen Land, Kattenbullerjan in Mecklenburg; herbe aux chats oder gar merde au chat im Französischen und erba gatta im Italienischen. Der Name passt, denn der Geruch berauscht die Katzen vollkommen. Chatzerüschi (Katzenrausch) nennt man es in Sargans.
Schon im ersten in deutscher Sprache geschriebenen Kräuterbuch, Gart der Gesundheit (Mainz 1485), heißt es, dass die Katzen sich an diesem Kraut reiben und Kater darauf ihren Samen ablassen; darum soll man das Kraut, wenn es zur Arzneiherstellung verwendet wird, vor den Miezen schützen.
Es ist weniger der Duft der Isovaleriansäure als der des Monoterpens Actinidin, der die Katzen fast verrückt werden lässt. Er kommt auch in der Katzenminze (Nepeta) vor und ähnelt dem Sexuallockstoff der Katzen. Der Geruch lässt sie flehmen, das heißt, sie ziehen die Oberlippe hoch und öffnen das Maul, um die Duftstoffe besser aufzunehmen; sie tollen und rollen liebestrunken auf dem Kraut, vor allem auf den Wurzeln. Im schwäbischen Sprichwort heißt es dementsprechend: »Du streichst wie eine Katze um den Baldrian!«
Das Verhalten haben sich Widerständler während der sowjetischen Okkupation Lettlands in Riga zunutze gemacht. Sie gossen Baldriansaft rund um die bombastische Statue Lenins, die sämtliche Schulkinder, Stadtbesucher und Delegationen besuchen mussten. Der Baldrian zog alle Kater an. Diese spritzten und schissen den Platz voll, sodass es höllisch stank. Keiner der obligatorischen Besucher des Ortes hielt den fürchterlichen Gestank lange aus.
Die Katze ist ja in fast allen Kulturen der Liebesgöttin geweiht. Katzen sind Symbole der Erotik. Katzennamen wie Pussy, Mimi oder Muschi sind oft synonym mit der weiblichen Scham. Das Schmusetier gehörte der Freya ebenso wie der Aphrodite, der Isis oder der Mondgöttin Diana. Im pharaonischen Ägypten, wo unsere Hauskatzen ursprünglich herkommen, war sie das Tier der sanftmütigen Göttin Bastet, Herrin der Sexualität, der Fruchtbarkeit, der Lebensfreude und Beschützerin der Schwangeren. Als Symbol sinnlicher Begierde und lustvoller Ekstase war sie den mittelalterlichen Christen suspekt, ein Hexentier also. Deswegen, aber auch wegen seiner pharmakologischen Wirkung auf Katzen, galt das Katzenkraut als Aphrodisiakum, als Liebesmittel.
In einer alten Handschrift aus Schloss Wolfsthurn bei Sterzing (15. Jahrhundert) lesen wir: »Wiltu (willst du) gute freuntschaft machen under manne und under weibe, so naym valerianam und stoß die czu pulver und gib ins czu trincken in wein.« Otto Brunfels, einer der »Väter der Botanik«, sekundiert, indem er schreibt, »macht holdselig, eins und friedsam, wo zwei das (aus dem Baldrian destillierte) Wasser trinken«.
»Wenn du Baldrian(-wurzel) in den Mund nimmst und jemanden küsst, gewinnt die Person dich gleich lieb«, heißt es im Volksaberglauben; oder – so der Rat an die Männer – »damit Frauen nichts abschlagen können, soll er Baldrian und Eberwurz bei sich tragen.« Unsere aufgeklärten Zeitgenossen, die diese Pflanze wahrscheinlich kaum bestimmen können, mögen über diese Aussagen schmunzeln und den Kopf schütteln. Aber wie der erfahrene Münchner Heilpraktiker und Mitgründer der Heilschule Natura Naturans, Max Amann, einmal sagte: »Versucht es doch einfach mal; die alten Kräuterfrauen und Wurzelsepps waren ja nicht dumm.«

Etwa von Juni bis Juli öffnen sich dicken Knospen des Echten Baldrians zu zartrosa bis weißen Blütendolden.
Der pheromonartige Duft der Wurzel ähnelt dem Geruch des Achselschweißes. Isovaleriansäure entsteht auch auf unserer Haut bei der Zersetzung des Schweißes. Diese unterschwellig wirkenden Düfte lösen sexuelle Erregung aus und spielen eine wichtige Rolle in der Partnerwahl.
Der Baldriangeruch zieht nicht nur Katzen an, sondern auch andere Tiere wie etwa Ratten. Es gibt Märchenforscher, die die Hypothese aufstellten, dass es nicht die Flöte war, mit der der Rattenfänger von Hameln die Nagetiere herbeilockte, sondern dass er in seiner Tasche Baldrianwurzeln trug. Angler wissen, dass sie mehr Fische fangen, wenn sie die armen Angelwürmer, ehe sie sie auf den Haken aufspießen, in Baldriansaft tauchen.
Wie schon erwähnt, versuchte die Kirche im frühen Mittelalter die gebräuchlichen, heidnischen Namen der Heilpflanzen mit den Namen von Heiligen und Märtyrern zu ersetzen. Man wollte nicht, dass die Pflanzen an sich als Träger der Heilkraft galten, sondern die damit verbundenen Heiligen, die den Segen Gottes vermittelten. Der Baldrian wurde so zu Sancti Georgi herba, also einer Pflanze des drachentötenden Ritters Georg, dem Schutzherrn der Ritter und zahlreicher ehemals heidnischern Frühjahrsbräuche, die unter seinem Namen einen christlichen Zusammenhang fanden und weitergeführt wurden. Bei Fieber, fiebrigen Entzündungen, Schlangenbiss, bei Fallsucht und gegen die Pest flehte man den frommen Ritter um dessen Fürbitte an. Der Georgstag, der 23. April, galt aber auch als ein Tag des Liebeszaubers – und da sind wir wieder beim Baldrian. Es heißt übrigens auch, Sankt Georg mache unfruchtbare Frauen fruchtbar. Noch heute wird übrigens in Spanien, besonders in Katalonien, der Georgstag als Tag der Verliebten groß gefeiert.

Die Wurzeln des Echten Baldrians galten durch die Jahrhunderte fast als Allheilmittel. Sie werden etwa Ende September ausgegraben und getrocknet.
Weitere Namen der Waldpflanze Baldrian sind, unter anderem, Stinkkraut, Heilkraut (englisch heal-all), Augenwurzel, Schlangenbisskraut, Kraftwurzel, Waldfräuleinkraut, Mondwurz, Elfenkraut, Krampfwurzel, Theriakwurzel und Katzentheriak.
In den alemannisch sprechenden Regionen heißt der Baldrian Dennenmark, Donnermark, Tammark und dergleichen. Hildegard von Bingen kennt das Heilkraut als denemarcha. Einige fixschlaue Gelehrte meinten, der Name beziehe sich auf Dänemark; dänische Kräuterhändler hätten die Wurzeln aus Dänemark mitgebracht. Das ist sicherlich weit gefehlt, denn der Echte Baldrian wächst überall in deutschen Landen. Man weiß einfach nicht, woher diese althochdeutsche Bezeichnung stammt.
Es war in Europa Brauch, wichtige Heilpflanzen, wenn sie gepflückt oder ausgegraben wurden, mit Sprüchen anzureden oder zu besingen und sie um ihre Hilfe zu bitten. Ein solcher Ausgrabespruch für den Baldrian ist uns aus Göttingen überliefert:
...
Balderjan! Most upestan (aufstehen),
most hengan (hingehen),
most helpen allen Minschenkinderen
und allen Nawersrinderen (Nachbars Rindern).
...
Der Spätherbst oder der ganz frühe Frühling sind die besten Zeiten, den Baldrian auszugraben.
HEILPFLANZE
Hildegard von Bingen schreibt zur denemarcha, diese sei mehr warm als kalt und sei feucht. Wer an Brustfellentzündung oder vich – zusammenziehenden, kolikartigen Darmschmerzen – leide, der solle sich aus pulverisierter Baldrianwurzel, Mehl, Wasser und Schmalz, mit Beimischung von etwas Katzenminze, Küchlein in der Pfanne machen und diese essen. Das würde die Kälte, die vom vich ausgehe, vernichten. Mehr sagt die heilkundige Äbtissin dazu nicht.
Allheilmittel
Ansonsten hatte die Baldrianwurzel in früheren Zeiten einen hohen Stellenwert als Allheilmittel – sonst wäre sie nicht als Zutat zur Theriak-Herstellung infrage gekommen. Theriak war ein kostspieliges Universalheilmittel, bestehend aus Gewürzen, Balsamen und Kräutern. Diese wurden von Apothekern unter strenger Aufsicht der Behörden und Magistraten auf den städtischen Marktplätzen stundenlang zu einer aromatischen Latwerge (lateinisch electuarium) gekocht. Die Aufsicht war nötig, um zu verhindern, dass die Apotheker bei den teuren Zutaten schummelten. Theriak sollte überschüssige oder verdorbene Körpersäfte (Humore) reinigen. Baldrian gehörte immer mit in dieses Wundermittel.
Der Medizinprofessor und Alchemist Johann Joachim Becher (1635–1682) schreibt in Reimen, was die Pflanze alles kann (Parnassus Medicinalis, 1663):
»Der Baldrian erwärmt, eröffnet und macht dünn, treibt Gift, Schweiß, Harn und dienet den Augen mit Gewinn, im Seitenstechen, Pest, in engem Atem auch, zur Gelbsucht, Brüchen, Milz, hat er oft sein Gebrauch. Er treibt der Weiber Zeit, Kopfweh und Augenflecken, wie auch scharfe Flüß’; man darf nicht viel erschrecken, wenn man getroffen ist, die Kugel stecken bleibt, der Baldrian zieht‘s raus, ja wie man von ihm schreibt, den alten Wunden er macht ein gewünschtes End, die Beulen der Pest vertreibt er behänd, ein Wasser und Extrakt aus ihm machen tut. Die zwei sind wie gemeldet zu vielen Sachen gut.«
Johann Bechers Zeitgenosse, Nicholas Culpeper, hat für den Baldrian – oder setwal, wie er in der englischen Umgangssprache heißt – ganz ähnliche Indikationen. Hinzu kommen unter anderem Ausflüsse (rheums) aus dem Kopf, schmerzhaftes, erschwertes Harnlassen (Strangurie) und geschwollene Hoden. Er stellt den Baldrian unter die Herrschaft des Planeten Merkur, des Patrons der Heiler (Culpeper 1653: 224).
Schutz gegen Pest
Es ist also kein Wunder, dass man einer derart vielseitigen Heilpflanze auch zutraute, der Pest Einhalt zu gebieten. Der Schwarze Tod und andere Seuchenzüge, die man als Pest bezeichnete, entvölkerten zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhundert ganze Landstriche. Es war die »kleine Eiszeit«, eine Periode, in der es überdurchschnittlich kalt war, die Ernten geringer wurden, Hunger sich ausbreitete und die Menschen dadurch immunologisch anfälliger waren als im hohen Mittelalter. Im kältesten, dem 17. Jahrhundert, wütete zusätzlich der Dreißigjährige Krieg. Er verschlimmerte die Zustände, begünstigte die Ausbreitung von Krankheiten und vernichtete in vielen Menschen die Hoffnung auf Besserung. In solchen Zeiten der Angst und Not wird der Schleier, der die Geisterwelt verhüllt, dünner. Den verängstigten Menschen erscheinen dann die Bewohner der Anderswelt, die Geister, Ahnen oder Engel. So erschien, als der Schwarze Tod in der Oberpfalz wütete, ein Holzfräulein, ein Waldgeist, und sagte:
...
Esst Bibernell und Baldrian,
so geht euch die Pest nicht an.
...
Im westsächsischen Bernsdorf erschien ein gnomenhaftes »graues Männel«, ging von Haus zu Haus und klopfte an die Tür. So viele Male es klopfte, so viele starben in dem Haus. Einem Dorfbewohner und seiner Frau sagte es: »Eure Nachbarn werden sterben, ihr müsst sie begraben. Trinkt Baldrian, so kommt ihr davon.« In Schlesien raunte ein Geist den verängstigten Leuten zu:
...
Koch, koch Baldrian,
es wird schon wieder besser wa’n!
...
Es sind mehrere derartige Aufzeichnungen überliefert (Storl 2020e: 118).
Die Volksmedizin empfiehlt, dem Kind etwas Baldrianwurzel mit ins erste Badewasser zu tun, um Krankheit und Pest fernzuhalten.
Augenpflanze
Eines der Zunftgeheimnisse der Goldschmiede war die Anwendung des Baldrians als Augenwasser, wenn sie ganz feine, filigrane Arbeiten zu verrichten hatten. Aus Würzburg ist überliefert, dass ein Goldschmied durch tägliches Einreiben seiner Augen mit Baldrianwasser so scharf sehen konnte, dass er auf einer zerbrochenen Nadel einen erkennbaren Löwen eingravierte. Leonhart Fuchs, einer der »Väter der Botanik«, schreibt in seinem New Kreüterbuch (1543), »die Baldrion wurtzel in Wein oder Wasser gesotten und in die Augen getropft, macht ein klar Gesicht«, das heißt, sie verbessert die Sehkraft. In der Volksheilkunde der Siebenbürger kaut der Heiler zu diesem Zwecke die Wurzel und haucht den Atem über die trüben oder kranken Augen. Und in St. Gallen ist der Baldrian Teil des Augebündeli, das man zur Heilung entzündeter Augen an einem Schnürchen am Hals trägt. Baldrian ist die Augenwurzel (dänisch ojenrod; schwedisch ögneört). Fleckwurz heißt er ebenfalls, denn wie der gelehrte Kräutermann Jacobus Tabernaemontanus schreibt, vertreibt Baldrian »Flecken und Fell der Augen«. Wahrscheinlich ist das nicht nur Wunschdenken oder ein Placeboeffekt, sondern hat mit der nervenberuhigenden Wirkung der Pflanze zu tun, die aber erst in der Neuzeit entdeckt wurde und heute die Hauptheilanzeige ausmacht.
Neuzeitliche Heilanwendung
Angeblich kauten Henker Baldrianwurzeln, um bei ihrer gruseligen Arbeit die Nerven nicht zu verlieren. Kleinkindern hat man bei »Gichtern« (Krampfanfällen) Baldrian unters Kissen gelegt, um sie zu beruhigen. Aber abgesehen von solchen Ausnahmen wurde die beruhigende, nervenentspannende Wirkung der Baldrianwurzel erst im angehenden Maschinenzeitalter von dem exzentrischen englischen Arzt und Botaniker John Hill (1714–1775) entdeckt. Er veröffentlichte seine Einsicht in dem Buch The Virtues of Wild Valerian in Nervous Disorders (1772). Als er lebte, kam der Behemoth, das schnaufende Ungetüm der Industriellen Revolution, gerade ins Rollen. Kleinbauern und Landarbeiter wurden gezwungen, ihre ländliche Heimat zu verlassen, sich bei langen Arbeitszeiten und Hungerlöhnen in Fabriken und Bergwerken zu verdingen und ihr Leben an den gnadenlosen Rhythmus der Maschinen anzupassen. Auch bei den Unternehmern lösten der endlose Konkurrenzkampf und die Unsicherheiten, die mit den Wirtschaftszyklen einhergehen, ständigen Stress aus. Die Nerven gingen durch, Anspannung, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen und innere Unruhe nahmen zu. Traditionell war das Arbeitsleben immer hart und erschöpfend gewesen, aber es war kein Stress im heutigen Sinn. Stress bedeutet Verspannung ohne Möglichkeit der Entspannung.
Für solche Zustände hatten die Ärzte Laudanum (Schlafmohnsaft) und andere Opioide in ihren schwarzen Köfferchen parat. Das Narkotikum ließ sich aber noch schlechter als Alkohol mit den Anforderungen einer Industriekultur vereinbaren. Der Mitbegründer der Naturheilkunde, der Arzt Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836), zu dessen Patienten in Weimar Goethe, Schiller, Herder und Wieland gehörten, war einer der ersten Mediziner, der die neue Anwendung des Baldrians aufgriff. Er pries die Pflanze als »eines der besten Nervenmittel«, wenn sie als Tee morgens und abends getrunken werde; er habe dabei »langwierige Nervenschäden, Hysterie und Krämpfe aller Art verschwinden sehen«. Seit dieser Zeit wird die Wurzel als Pille, Tinktur, in Wein, als Badezusatz, als Tee und heute vorzugsweise als Kaltwasserauszug (2 Teelöffel pro Tasse, 8 Stunden ziehen lassen) bei allen Spannungs- und Erregungszuständen, bei Schlafstörungen, Depressionen, vegetativer Dystonie, Herzneurosen, Angstzuständen, Magen-Darm-Krämpfen und geistiger Überarbeitung verschrieben (Storl 2020e: 115).


Echter Baldrian (links) und Gewöhnlicher Erdrauch (rechts) wirken beide amphoter, das heißt, sie können in zwei entgegengesetzte Richtungen wirken (Holzschnitte aus dem Gart der Gesundheit von 1485).
Die Wirkung wird in der Fachsprache der Phytotherapeuten als amphoter beschrieben: Die griechische Amphora ist ein Gefäß mit zwei gegenüberliegendes Henkeln. Was man damit sagen will, ist, dass zwei entgegengesetzte Wirkungen möglich sind, so kann etwa der Erdrauch (Fumaria officinalis) den Gallenfluss anregen oder unter Umständen auch reduzieren. Was den Baldrian betrifft, lässt er einen verspannten Menschen schlafen, aber er kann auch anregend wirken. Er beeinträchtigt nicht die Konzentration, etwa beim Autofahren oder beim Lesen eines Buches. Baldrian beruhigt Unruhige und regt Erschöpfte an; er wirkt vegetativ ausgleichend.
Wenn man Baldrian einnimmt und dann meditativ die Sinne nach innen richtet, dann hat man das Gefühl, man liege an einem Sommertag im schattigen Wald, auf einem weichen Mooskissen; man hört den Wind durch die Baumwipfel streichen und das sanfte Plätschern eines Baches. Was man da erlebt, ist eigentlich die Signatur der Pflanze. Wenn man diese in der Seele aufsteigenden Bilder und Gefühle hinterfragt, merkt man: Das Windgeräusch ist eigentlich das Geräusch der Atemzüge der Lunge und das Plätschern des Baches das Rauschen des eigenen Blutes. Diese Art der Meditation ist übrigens eine gute Methode, das Wesen von Heilpflanzen zu erkunden. Die chemische Analyse der Pflanze im Labor stellt nur eine von mehreren Möglichkeiten dar, dem Wesen der Pflanzen näherzukommen.

Der blühende Baldrian kommt in der biodynamischen Gärtnerei zum Einsatz: Der Saft wird über den Kompost gesprüht, weil er die saturnische Wärme vermittle.
Chemisch-molekulare Analyse
Laborwissenschaftler haben sich viel Mühe gegeben, die »Wirkstoffe« der Baldrianwurzel ausfindig zu machen. Dabei haben sie auch eine Menge gefunden: verschiedene ätherische Öle, Sesquiterpene, Iridoide-Ester (Valepotriate – ein Kunstwort aus Valeriana-Epoxy-Triester), geringe Mengen Alkaloide (Chatinin und Valerin), die Valerensäure und vieles mehr. Aber den einen Wirkstoff, auf den die therapeutische Effektivität zurückzuführen wäre, fand man nicht. Damit wurde die Pflanze für die Pharmazie weniger interessant. Die Inhaltsstoffe ließen sich weder synthetisieren noch auf sinnvolle Weise extrahieren.
Es war für mich ein kleiner Kulturschock, als ich nach zweieinhalb Jahrzehnten in Amerika und Indien im Herbst 1986 wieder nach Deutschland zurückkehrte. Das Land meiner Geburt hatte sich im Vergleich zu meiner Kindheit stark verändert. Um die Ecken und Kanten besser ertragen zu können, ging ich in die Apotheke, um mir ein Fläschchen beruhigenden Baldriansaft zu beschaffen. »Das können Sie vergessen«, belehrte mich die Apothekerin, »es ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass Baldrian nicht wirkt; es ist nur ein Placebo!«
Nun, ich wusste, dass das nicht sein konnte, und ging zu einer anderen Apotheke. Dort wurde mir erzählt, Baldrian habe zwar eine Wirkung, aber nur, wenn die getrocknete Wurzel über ein Jahr aufbewahrt werden würde. Sie hätten aber leider keine auf Lager. Ich musste also mit Hopfen und Malz vorliebnehmen. Jahre später lernte ich im Allgäu eine nette Künstlerfamilie kennen, die abseits im Wald, weit entfernt von der Stadt, wohnten. Als ihr Sohn in die Schule kam, war das für den Kleinen traumatisch. Er war außer sich und konnte nicht schlafen. Die armen Eltern wussten nicht, was sie machen sollten. Als ich einmal an ihrem Häuschen vorbeilief, fragten sie, ob ich ein Kraut kenne, welches helfen würde. Meistens fällt mir da spontan nichts ein. Aber am Bach in der Nähe war es, als winkten mir die dort wachsenden, blühenden Baldrianstauden zu. Ich sagte, sie sollten dem Jungen jeden Tag einen Tee von den Wurzeln machen. Der Tee wirkte. Nach einer Woche schon konnte das Kind wieder schlafen und kam in der Schule zurecht. Dieses Erlebnis überzeugte mich, dass man die Wurzel nicht ein Jahr lang trocknen müsse.
Inzwischen hat sich durchaus erwiesen, dass Baldrian, obwohl die isolierten Wirkstoffe einzeln unwirksam sind, ein wertvolles Phytotherapeutikum ist. Der renommierte Universitätsprofessor Dr. med. Rudolf Fritz Weiß (1895–1991) sagte dazu: »So hat sich der Baldrian geradezu als Musterbeispiel dafür erwiesen, dass kein einzelner Wirkstoff zu finden ist, sondern dass erst das Zusammenwirken verschiedener Stoffe den therapeutischen Effekt gibt.« (Weiß 1991: 351)
Weiter bekundet Professor Weiß, dass beim Baldrian nicht die Gefahr einer Gewöhnung oder gar Sucht besteht – anders als etwa bei Benzodiazepinen wie Valium. Um eine Wirkung zu erzielen, rät der alte, weise Professor, genügten nicht nur ein paar Tröpfchen Baldriantinktur, sondern es müssten schon ein bis zwei Teelöffel sein.
Wenn man einen Tee aus den Wurzeln machen will, sollte der Aufguss lange ziehen, um die Wirkstoffe herauszulösen, und eine Zugabe von einigen Tropfen Tinktur im Tee kann die Wirkung vorteilhaft verstärken.
Weitere Anwendungen
Die biodynamischen Gärtner und die Demeter-Bauern haben eine besondere Beziehung zum Baldrian. Als eines ihrer Kompostpräparate sammeln sie blühenden Baldrian, pressen den Saft aus, rühren einige Tropfen pro Eimer Regenwasser unter und sprühen die Mischung über den Kompost. In diesem Präparat wirkt der Saturn, sagen sie. Im Makrokosmos ist der Saturn der äußerste sichtbare Planet; dahinter funkeln die Fixsterne, in denen sich die Urbilder befinden. Das Präparat vermittelt saturnische Wärme in die ungestalte Kompostmasse hinein. Der Baldrian, der an feucht-schattigen Standorten gedeiht, besitzt nach Rudolf Steiner eine wärmeerzeugende, »phosphorige« Wirkung. Das Präparat kann im Herbst, wenn es kühler wird, auch auf Tomaten und Paprika vernebelt werden, um sie länger vor der Einwirkung von Frost zu bewahren. In dem Fall dämpft der Saturn seinen lunaren Gegenspieler (den Mond), der das Wachstum von Mehltau und anderen Pilzen begünstigt. Über die Beete oder auf den Kompost gesprüht, regen Baldriantee oder das biodynamische Baldrianpräparat die Regenwürmer zum Humusaufbau an.
Baldrian tut nicht nur den Regenwürmern gut, sondern ist auch ein Freund der Imker. Wenn man den Bienenstock mit dem Kraut ausreibt, bleiben die Bienen gerne da und – so liest man gelegentlich – hält das Raubbienen fern.
Motten scheinen den Duft nicht zu mögen, deswegen kann man Baldrianwurzeln in den Kleiderschrank legen.
Übrigens wirkt der Baldrian, wie bei den Menschen, auch bei Hunden beruhigend – im Gegensatz zu Katzen.
Die kleine, 10 bis 30 Zentimeter hoch wachsende Braunelle ist ein hübscher Lippenblütler mit blauvioletten, zygomorphen Blüten und bräunlichen Tragblättern. Das Pflänzchen wächst auf Waldlichtungen, an Waldwegen und auf Weiden, aber auch auf den gemähten Vorstadtrasen gedeiht es, neben den wackeren Gänseblümchen, recht gut. Von Juni bis Oktober blüht das Kräutlein fleißig und bereitet den Hummeln und Bienen viel Freude. Die Braunelle ist in den gemäßigten Regionen Eurasiens und in Nordamerika weit verbreitet und wächst im Flachland wie im Gebirge bis auf etwa 2000 Meter Meereshöhe.
Persönlich lernte ich die Braunelle kennen, kurz nachdem meine Frau und ich nach längerem Aufenthalt in Indien in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt waren und ich dummerweise vom Fahrrad auf die asphaltierte Fahrbahn stürzte – es muss der Kulturschock gewesen sein! –, wobei mir das linke Schlüsselbein wie eine Glasröhre zersplitterte. Ich heilte den Bruch mit einem Breiumschlag aus frisch geraspelten Beinwellwurzeln.
Zwischen der täglichen Erneuerung der Beinwellpackung nahm ich heiße Bäder mit Kräutern, die neben dem Haus im Rasen oder an dessen Rand wuchsen: Schafgarbenblüten zur Beschleunigung der Wundheilung, Baldrianwurzel zur Entspannung der Muskeln und Braunelle, die im Rasen das wöchentliche Mähritual überstanden hatte und von der ich gehört hatte, dass sich die subkutanen gelben und blauen Flecken, die durch Prellungen bei Prügeleien oder Wirtshausschlägereien entstehen, dadurch schnell auflösen würden. Tatsächlich überzeugte mich die Heilkraft dieser kleinen Pflanze32.
Dass die Braunelle, was ihre Heilkraft betrifft, sehr viel mehr kann als das, erfuhr ich erst später.

Der heilige Antonius ist der Patron gegen das Antoniusfeuer, eine Krankheit, ausgelöst durch einen Getreidepilz, die man mit der Braunelle zu heilen suchte.
NAMEN UND BRAUCHTUM
Der lateinische Name des kleinen Kräutleins, Prunella, beruht möglicherweise auf seinen »pflaumenfarbigen« Blüten – prunum bedeutet lateinisch »Pflaume«. Er könnte aber auch auf das germanische brun (= braun, dunkel gefärbt) zurückgehen, das dann von frühen Botanikern latinisiert wurde. Wie dem auch sei, Braunwurz, Braunelle, Brünichrut (Berner Oberland), niederländisch, englisch und schwedisch brunel, Pennsylvania-Deutsch Prunelgraut und ähnliche Benennungen beziehen sich auf das Braune in den Blüten und deren Anwendung bei »braunen Krankheiten«, etwa braunen Flecken durch Quetschungen, Prellungen oder »Halsbräune« (Diphterie).
Der hohe Stellenwert der Pflanze als Heilkraut zeigt sich in Benennungen wie Gottheil, Selbstheil, Gutheil oder Immergesund (englisch heal-all, selfheal, touch-and-heal). Der Arzt und Kräutermann Leonhart Fuchs schreibt: »Braunell hat seinen Namen daher / das diß Kraut sehr bewähret wider der Breüne im Mund.« Diese Bräune bezieht sich auf die Rachenbräune (Diphterie). Halskraut, Mundfäulekraut oder Braunheil sind weitere Namen.
Bekannt war die Braunelle auch als Sankt-Antonius-Kraut (englisch St. Anthony’s Wort), eine Benennung, die sie mit dem Weidenröschen (Epilobium, Feuerkraut, fireweed) teilt, da man sie gegen das schreckliche Heilige Feuer (ignis sacer) oder Antoniusfeuer anzuwenden versuchte. Mit diesem Namen bezeichnete man die Mutterkornvergiftung (Ergotismus), die die Menschen im späten Mittelalter heimsuchte. Besonders in jener Zeit, als das hochmittelalterliche Klimaoptimum zu Ende ging, verbreitete sich diese gefürchtete Erkrankung. Als damals das Klima kälter wurde und das Wetter unbeständiger, da wurde das Getreide, vor allem der Roggen, immer häufiger von dem Mutterkornpilz (Claviceps purpurea) befallen. Das tägliche Brot enthielt dann oft die giftigen Mutterkornalkaloide, die zur Gefäßverengung in den Extremitäten und zu Durchblutungsstörungen führen33. Finger und Zehen färbten sich braun, faulten und schmerzten höllisch, als würden sie im Feuer brennen. Zugleich kam es zu schlimmen Krampfanfällen und Wahnvorstellungen. Letzteres, weil der Getreidepilz – wie der Schweizer Biochemiker Albert Hofmann entdeckte – auch Lysergsäurediethylamid (LSD) enthält. Die Patienten fühlten sich, als wären sämtliche Teufel aus der Hölle ausgebrochen. Und da der ägyptische Einsiedler, der heilige Antonius, einen ähnlichen Höllensturm hatte erleiden müssen, diesem aber widerstehen konnte, flehte man ihn um Hilfe an34.

Die Kleine Braunelle wächst auf Waldlichtungen und neben Wegen, fühlt sich aber auch auf Wiesen und sogar im Rasen wohl.
Folglich kümmerte sich der Mönchsorden der Antoniter um die am Antoniusfeuer Erkrankten in seinen Hospizen. Da der ägyptische Heilige sich mit einem Schwein anfreundete, wurde er auch zum Patron dieser Borstentiere – im süddeutschen Raum kannte man den Heiligen auch als den Facken (Ferkel)-Toni oder Säuli-Töni, in westdeutschen Mundarten wurde er zum Swinetünnes. So durften die Antoniter-Mönche auch Schweinezucht betreiben und benutzten die Braunelle auch gegen den Milzbrand (Anthrax) der Schweine.

Früher galt die Braunelle auch bei uns vielen als Allheilmittel, in der chinesischen Medizin ist das heute noch der Fall.
HEILPFLANZE
In der heutigen Zeit ist die Kleine Braunelle praktisch eine vergessene Heilpflanze. In den meisten Kräuterbüchern fehlt sie. Für den amerikanischen Unkrautexperten Prof. Edwin R. Spencer, dessen Werk wir an der Uni lesen mussten, ist die Braunelle (heal-all) lediglich ein lästiges Unkraut im englischen Rasen, das mit Herbiziden in Schach gehalten werden muss (Spencer 1968: 213). Einst galt der hübsche Lippenblütler aber geradezu als Allheilmittel. Bei Mandel- und Kehlkopfentzündung, als Wundwasser, bei Magen-Darm-Erkrankungen, bei hohem Blutdruck, Augenentzündung, Seitenstechen, Verdauungsschwäche und fiebrigen Erkrankungen fand er als Tee, im Bad oder als Umschlag Anwendung.
Für den berühmten astrologischen Kräuterarzt der Renaissance, Nicholas Culpeper, gehörte die Braunelle zu den Pflanzen der Venus. Er setzte sie – zusammen mit Sanikel (Sanicula europaea) – bei inneren und äußeren Wunden ein.
Vor allem aber bei »Rachenbräune« oder »Halsbräune« kam die Braunelle zum Einsatz. Mit dieser Bezeichnung meinte man die durch das Stäbchenbakterium (Corynebacterium diphtheriae) verursachte Diphterie (griechisch diphthera = Leder), die durch bräunliche, ledrige Beläge auf den Schleimhäuten der Tonsillen und dem Kehlkopf charakterisiert ist. Bei der Infektion kann es zu Komplikationen an Herz und Nervensystem kommen; die ledrige Pseudomembran im Hals kann zur Erstickung führen. Mit dem Tee oder Sud der Pflanze wurde dagegen gegurgelt. Inzwischen hat die Diphterie ihren Schrecken verloren und mit dem Aufkommen der chemischen Medizin und ihrer Antibiotika geriet die Braunelle als Heilpflanze ins Abseits.
Ganz anders verhält es sich in der chinesischen Medizin, dort wird die blühende Pflanze – Xia-ku-Cao genannt – vielfältig eingesetzt. Schon das älteste Kräuterbuch Shennong Bencao, angeblich geschrieben von dem Urkaiser Shennong, erwähnt das kleine Kräutlein. Es wirkt vor allem auf den Lebermeridian; es gilt als kalt, etwas bitter und scharf und als Leber-Yang absenkend. Indikationen sind folgende: Es wirkt »kühlend« bei Kopfschmerzen, Schwindel, geschwollenen Augen, es löst Knotenbildungen und Drüsenschwellungen, es zerstreut Stauungen und bewegt Leber-Qi. Bestimmte Zubereitungen – Tees und Abkochungen – werden gegen entzündliche Erkrankungen, Geschwüre im Rachen- und Mundbereich, bei Magen-Darm-Katarrh, Durchfall und Frauenleiden eingesetzt (Hempen 2007: 146). Auch bei Tuberkulose, Krebs, Leberentzündung, Bluthochdruck und Brustentzündung findet es Anwendung.
Neuere medizinische Forschungen in Korea und China entdeckten eine Reihe neuer Anwendungsgebiete. Die Inhaltsstoffe können – so südkoreanische Forscher – einen schützenden Effekt auf die Bauchspeicheldrüse ausüben und den Anstieg des Blutzuckers verringern35. Sehr interessant ist die Entdeckung, dass die Kleine Braunelle bei Herpes und anderen Viruserkrankungen hilft. Herpes ist ja durchaus lästig; wiederkehrende schmerzhafte, nässende Bläschen an Lippen, Nase und Genitalien können das Leben recht ungemütlich machen. Da hilft aber das Auftragen des frischen Saftes oder einer Salbe aus der Braunelle. Das wirkt sogar bei Viren, die gegen das polymerasehemmende Virostatikum Aciclovir resistent sind. Auch gegen andere Viren, etwa gegen HIV, zeigt die Braunelle eine positive Wirkung.
Die nordamerikanischen Indianer benutzten den Tee der Pflanze bei fiebrigen Erkältungen, Husten und Magenschmerzen und äußerlich zum Waschen von Wunden und Verbrennungen.
_______
BRAUNELLENSALBE BEI HERPES
_______
50 g Kokosöl im Wasserbad bei maximal 30 °C erwärmen. 1 EL frisches, sehr fein geschnittenes Braunellenkraut zugeben und gut verrühren. Im warmen Wasserbad 30 Minuten ziehen lassen, durch ein Gazetuch filtern und in ein Gläschen mit Schraubdeckel abfüllen.
IN DER KÜCHE
Ein richtig ergiebiges Wildgemüse ist die Braunelle nicht. Giftig ist sie aber auf keinen Fall und die jungen Blätter kamen bei unserer Landbevölkerung, wie auch bei den amerikanischen Ureinwohnern, mit in den Suppentopf.