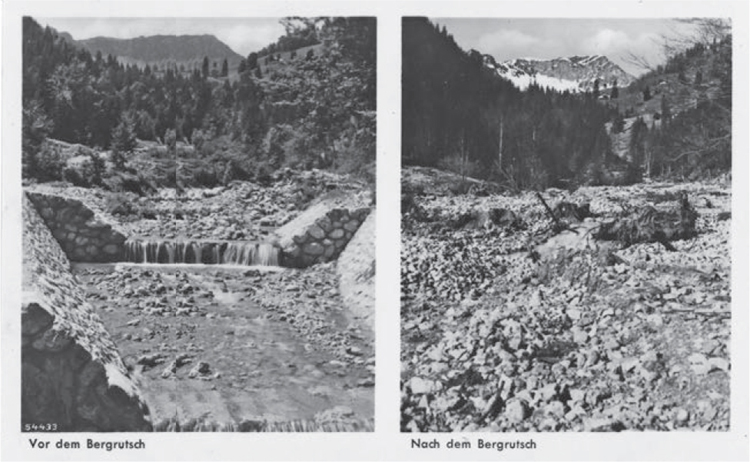
Der britische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Robert Malthus (1766–1834) veröffentlichte 1798 seine nationalökonomische Bevölkerungstheorie. Er ging davon aus, dass mit steigender Ressourcenverfügbarkeit die Bevölkerungsdichte exponentiell zunehmen würde. Da Ressourcen dagegen selbst bei intensiver Bewirtschaftung nur linear und nicht exponentiell anwachsen, würden sie bei mehr Essern wieder knapp; die Bevölkerung würde verarmen und durch Krieg, Hunger und Seuchen reguliert, wenn dies nicht durch vorbeugende Einschränkung des Bevölkerungswachstums durch Verhütung (damals im Wesentlichen Enthaltsamkeit) verhindert würde. Entweder käme es zur Erhöhung der Sterberate oder man müsse dieser Entwicklung durch Senkung der Geburtenrate vorbeugen, so Malthus. Er zog daraus den fatalen Schluss, dass die Unterstützung von Armen unterbleiben sollte, um ihre Vermehrung zu vermindern. Malthusianisches Denken ist bis heute verbreitet.
Die dänische Agrarökonomin Ester Boserup widersprach allerdings in den 1960er-Jahren der malthusianischen Theorie. Bevölkerungswachstum führt nach ihren Untersuchungen in Entwicklungsländern zur Intensivierung des Anbaus. Ungenutztes Land wird kultiviert, Brache durch permanenten Ackerbau ersetzt, verstärkte Düngung und Bewässerung bewirken höhere Flächenerträge. Damit wird eine wachsende Bevölkerung ernährbar.
Malthus sah Katastrophen als Folge von Überbevölkerung an. So lassen sich die Hungersnöte, die 1783 bis 1785 in Europa wüteten, nachdem der isländische Laki-Vulkan ausgebrochen und seine Asche- und Gasemissionen zu einem extrem kalten Winter und zu einem feuchten und kühlen Sommer 1784 geführt hatten, aber nicht erklären. Auch das verheerende Hochwasser von 1342, bei dem innerhalb einer Woche das Relief und die Böden Mitteleuropas dauerhaft verändert wurden, hat seine Ursachen nicht allein in den Handlungen von Menschen, sondern auch in der Dynamik der Natur.
Mit dieser Dynamik zu leben und sie aktiv zu nutzen, war notwendige Voraussetzung für das Überleben. Menschen sind Teil der Natur und von Ökosystemen1, die sie durch Eingriffe oft in einer (nicht erwarteten) Weise verändern, die ihnen mehr Schaden als Nutzen bringt. Natürliche Systeme verändern sich ständig. Ein längerfristiger, langsamer Wandel wie der nacheiszeitliche Meeresspiegelanstieg mit den resultierenden Küstenveränderungen ist schwer wahrzunehmen; Reaktionen setzen daher oft erst verzögert ein. Die kleinen Lebewesen, mit denen wir in den Ökosystemen leben, sind hingegen oft schneller als Menschen – jedes Jahr entstehen neue Infektionskrankheiten, gegen die neue Impfstoffe entwickelt werden müssen. Der Spanischen Grippe erlagen von 1918 bis 1920 mindestens 25 Millionen der vom Krieg geschwächten und teils mangelhaft ernährten Menschen. Wie viele Opfer Infektionskrankheiten insgesamt forderten, ist kaum festzustellen. Die Pestpandemie in der Mitte des 14. Jh., die als »Schwarzer Tod« bezeichnet wird, wütete insbesondere unter der städtischen Bevölkerung. Und doch: Am Verlauf von Grippe- und Pestepidemien waren die Menschen beteiligt: Durch Handel und Transport verbreiteten sie die Erreger. Auch die Wirkungen von Hochwassern und Dürren hängen davon ab, wie Gesellschaften organisiert sind und wie sehr die herrschenden Eliten die Dynamik der Natur in ihre Pläne einbeziehen.
»ELB-KLONDYKE«. Tiefster Wasserstand der Elbe seit 1800, 227 cm unter Null. Goldsucher am Kronenpfeiler im Flussbett der Elbe, Juli 1904 Dresden (Sachsen). (Postkarte)
HOCHWASSER am 9. Februar 1909 in Nürnberg, Bayern. (Postkarte, gelaufen am 22.4.1910)
Stich der ÜBERSCHWEMMUNG am 12. März 1879 in Szeged, Ungarn. (Postkarte)
Der STURM vor der Küste von GREAT YARMOUTH (Vereinigtes Königreich) trieb 1902 Wassermassen gegen den Ort – so wie auch im Jahr 2013. (Postkarte, gelaufen 1903)
Schäden des großen KANTŌ-ERDBEBENS vom 1.9.1923 in YOKOSUKA, Japan. (Postkarte)
Sturmfluten und Küstenschutz an der Nordsee
Das Leben an der Küste hat gewichtige Vorteile: Zugang zu den Ressourcen des Meeres, die Möglichkeiten des Handels sowie fruchtbares Marschland für Ackerbau und Viehhaltung. Daher wurden an der niederländischen und der deutschen Nordseeküste auch sturmflutgefährdete Gebiete erschlossen und besiedelt. Dazu war ein hoher technischer Aufwand nötig. Die ersten Deiche dienten zunächst dem Schutz vor dem mittleren Tidenhochwasser. Hohen Wintersturmtiden vermochten sie aufgrund ihrer steilen Außenböschungen und unzureichenden Höhe noch nicht standzuhalten. Sturmfluten richteten daher immer wieder Schäden an. Am 29. September 1014 waren zahlreiche Todesopfer an der flandrisch-holländischen Küste zu beklagen und am 2. Oktober 1134 verschlang das Meer ganze Dörfer an den Küsten der Grafschaften Brabant und Walcheren. Die Menschen wichen der Gefahr nicht. Sie begannen, sich durch bessere Bauten zu schützen.
»In jenen Tagen, als Konrad eben zur höchsten Stufe des Priestertums befördert war und sich noch beim Erzbischof in der Harburg aufhielt, die am Ufer der Elbe liegt, brach im Monat Februar, und zwar am 17. [Februar 1164], ein großes Unwetter mit heftigen Stürmen, grellen Blitzen und krachendem Donner los, das weit und breit viele Häuser in Brand setzte oder zerstörte; überdies entstand eine Meeresflut so groß, wie sie seit alters unerhört war. Sie überschwemmte das ganze Küstengebiet in Friesland und Hadeln sowie das ganze Marschland an Elbe, Weser und allen Flüssen, die in den Ozean münden; viele Tausend Menschen und eine unzählige Menge Vieh ertranken. Wie viele Reiche, wie viele Mächtige saßen abends noch, schwelgten im Vergnügen und fürchteten kein Unheil, da aber kam plötzlich das Verderben und stürzte sie mitten ins Meer« (HELMOLD VON BOSAU, Slawenchronik, 20087: 339, Zeilen 24–35).
Ab der Mitte des 12. Jh. ließen adelige Grundherren in den Marschen des Rhein-Maas- und des Schelde-Deltas jeweils etwa einen Quadratkilometer umfassende Flächen um die Siedlungen eindeichen. 100 Jahre später waren bereits größere Gebiete der Deltas durch miteinander verbundene Ringdeiche geschützt. In den Poldern wurde Getreide für die Stadtbewohner Flanderns angebaut. Deichverbände organisierten die Instandhaltung der Küstenschutzbauten; aktiver Sturmflutschutz wurde auf kommunaler Ebene betrieben. Danach begann die Anlage küstenparalleler Deiche in Holland und Flandern. Doch auch sie vermochten nicht, die Verwüstungen durch Sturmfluten entscheidend zu mindern: Das Ausmaß der Schäden der Julianenflut übertraf nach Auffassung der Chronisten am 17. Februar 1164 alles Dagewesene. Eine Marcellusflut zerstörte am 16. Januar 1219 Deiche in Friesland und am 1. Januar 1287 brach die Luciaflut weit in das Land am Unterlauf der Ems ein. Die Clemensflut zerstörte am 23. November 1334 Deiche an der englischen Kanalküste, an der Themse, in Flandern, Holland und Friesland. Die einzelnen Sturmfluten trafen jeweils unterschiedliche Küstenabschnitte. Dutzende Sturmfluten bewirkten so große Zerstörungen, dass sie in historischen Berichten Erwähnung finden. Doch zumeist hielten die Deiche und bestätigten, dass dem Meer Siedlungsraum abgewonnen werden konnte. Langfristig erwies sich dies in vielen Gegenden aber dennoch als Irrglaube.
STURMFLUTABLAGERUNGEN am alten Hafen der Hallig Langeneß in Nordfriesland.
Die auch als Grote Mandränke bezeichnete Flut am Marcellustag, dem 16. Januar 1362, zerriss an der deutschen Nordseeküste viele Deiche und drang tief in das Sietland ein. Besonders groß waren die Landverluste in den nordfriesischen Uthlanden. Überreste von Warften, Wegen und Deichen, Brunnen, Ackerstreifen und Torfstichen, die die Flut zerstört oder überdeckt hatte, bezeugen noch heute im Watt, dass fruchtbare Landschaften mitsamt wohlhabender bäuerlicher Familien untergegangen waren. Sagenumwoben ist das Schicksal des Ortes Rungholt in der nordfriesischen Edomsharde.
Warum hat diese Flut derart verheerende Schäden angerichtet? War die natürliche Fluthöhe außergewöhnlich? Oder hatten Menschen die dramatischen Schäden mit zu verantworten? Waren die Deiche zu niedrig und zu instabil gewesen? Durch Entwässerung was das Land abgesunken. Denn wenn Marschland trocken gelegt wird, kommt es zur Torfzehrung. Auch zuvor wasserreiche Sedimente hatten sich dadurch gesetzt. So vermochten die Grote Mandränke 1362 und nachfolgende Sturmfluten in den durch anthropogene Eingriffe tiefer liegenden Tälern Priele einzureißen und die Uthlande zu teilen. Weiter südlich wurde Eiderstedt vorübergehend vom Festland abgeschnitten und die Insel Strand bildete sich. Positiv waren die Veränderungen für einige nunmehr nah an der vorgerückten Küste liegenden Orte – Husum konnte sich als Hafenort etablieren.
Nach dieser Marcellusflut verheerten schadensreiche Sturmfluten vorerst andere Küstenräume. Die Menschen blieben auf dem eingeschlagenen Weg, immer höhere Schutzbauten zu errichten; sie glaubten an die technische Machbarkeit.
»Heute bin ich über Rungholt gefahren
Die Stadt ging unter vor fünfhundert Jahren
Noch schlagen die Wellen da wild und empört
Wie damals, als sie die Marschen zerstört
Die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte
Aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte:
Trutz, Blanke Hans.«
Auszug aus dem Gedicht »Trutz, Blanke Hans« des Pellwormer Hardesvogtes Detlef Lilienchron aus dem Jahr 1882 (MEIER, 2005: 110)
Am 11. Oktober 1634 suchte mit der Burchardiflut die zweite große Katastrophe die Reste der Uthlande und der südlich angrenzenden Gebiete heim. Die etwa 220 km2 große Marschinsel Strand zerriss in zwei kleine Teile. Pastor Lobedantz bilanzierte die Schäden der einen Nacht für die Insel Strand: 6123 Tote (etwa drei Viertel der Bevölkerung), 1336 zerstörte Häuser, sechs beschädigte Kirchen, 28 umgefallene Mühlen und etwa 50.000 tote Pferde, Rinder, Schafe und Schweine (MEIER, 2005: 128ff.).
Die großen Mandränken bewirkten 1362 und 1634 zwar die größten Verluste an Menschen und an fruchtbarem Marschland, doch auch die Weihnachtsflut 1717 und die Februarflut 1825 verliefen in einzelnen Küstenabschnitten dramatisch.
Im 19. und im 20. Jh. waren die Deiche an der niederländischen Küste weiter ausgebaut worden. Allerdings waren sie durch deutsche Bombardierungen während des Zweiten Weltkriegs und Beschädigungen durch die Niederländer zur Beeinträchtigung der deutschen Besatzung in einem schlechten Zustand. Sie wurden in den ersten Jahren nach dem Krieg instand gesetzt.
Am 31. Januar 1953 warnte das königliche niederländische meteorologische Institut um 11 Uhr per Fernschreiben nur jene Gemeindeverwaltungen, die den Wetterbericht abonniert hatten, vor einem Sturm mit gefährlichem Hochwasser. In den 18-Uhr-Nachrichten des Rundfunks wurde ein schwerer Sturm angekündigt – allerdings ohne Warnungen. Nachts sendete der Rundfunk nicht; Notfallprogramme mit Informations- und Evakuierungsplänen gab es nicht. In den frühen Morgenstunden wurden Wasserstände von mehr als 4 m über dem niederländischen Nullpegel NAP gemessen. Vor allem an der Südwestküste der Niederlande brachen an mehr als 80 Abschnitten die Deiche und binnen weniger Stunden wurden mehr als 130.000 Hektar Kulturland geflutet. Viele Menschen wurden im Schlaf überrascht, 1835 starben. Tausende Häuser wurden zerstört, Zehntausende beschädigt. In den Folgejahren wurde der Küstenschutz in den Niederlanden erfolgreich reorganisiert und hocheffektiv ausgebaut.
In Deutschland waren nach der Hollandflut zuerst die Deiche an Weser und Ems verbessert worden. Die noch vergleichsweise schlecht geschützte Stadt Hamburg wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 von einer katastrophalen Sturmflut heimgesucht. Fast ein Sechstel der Stadtfläche wurde geflutet; mehr als 300 Menschen starben. Die Bemessungsgrenzen wurden danach auf 100-jährliche Sturmtiden ausgelegt. So richtete die am 3. Januar 1976 in Hamburg noch höher auflaufende Sturmflut des Orkans Capella kaum Schäden an.
Seit mehr als zwei Jahrtausenden kämpfen Küstenbewohner mit immer ausgefeilteren technischen Verfahren gegen die Wirkungen des »Blanken Hans«. Heute stehen nicht nur Naturschutzinteressen neuen Eindeichungen an der deutschen Nordseeküste entgegen. Die Eindeichungen reduzierten die Speicherräume und bewirkten vor allem in den Flussmündungen höher auflaufende Fluten. (MEIER, 2005; BEHRE, 2008)
Folgen der STURMFLUT vom 6. November 1911 an der nordfriesischen Nordseeküste. (Postkarte)
Mitteleuropa vom 19. bis 25. Juli 1342
Gelegentlich ziehen Tiefdruckgebiete vom zentralen Mittelmeer über die Adria und den Balkan vorbei an den Alpen nach Österreich, Tschechien und Deutschland. Meteorologen bezeichnen diese Tiefdruckstraße nach der Systematik des deutschen Meteorologen Wilhelm Jacob van Bebber (1841–1909) als Vb-Zugbahn und die Wetterlage als Vb-Großwetterlage. In heißen Sommern transportieren solche Mittelmeertiefs manchmal große Wassermassen über die Vb-Zugbahn nach Mitteleuropa; anhaltend starke Niederschläge in einem ungewöhnlich großen Raum sind die Folge. Binnen Stunden werden dann die oberflächennahen Bodenspeicher aufgefüllt, und ein Teil des Regenwassers beginnt über die Oberfläche vegetationsarmer Äcker hang- und talabwärts zu fließen. Auch von versiegelten Flächen strömt dann Wasser in die Oberflächengewässer. Starke, lang anhaltende Hochwasser resultieren daraus. So lösten starke Vb-Niederschläge 1997, 2002 und 2013 unter anderem an Oder, Elbe und Donau sehr starke Überschwemmungen aus. Viele weitere extreme Hochwasser wurden in den vergangenen Jahrhunderten von Tiefdruckgebieten hervorgerufen, die vom Mittelmeer über Österreich und Tschechien nach Deutschland und Polen zogen.
Außergewöhnlich hohe Wasserstände traten an der oberen Donau, an Mittel- und Niederrhein, Weser, Elbe und zahlreichen Nebenflüssen während der Magdalenenflut im Juli 1342 auf. Zeitgenössische Quellen erlauben eine zeitliche Rekonstruktion des Ereignisses: Am 19. Juli erreichten die heftigen Niederschläge Franken und Thüringen. Die Front zog in den folgenden Tagen langsam weiter nach Nordwesten und am 22. Juli über die deutsche Nordseeküste. Von der oberen Donau bis nach Nordfriesland, vom Rhein bis zur Oder »fiel Regen auf die Erde wie im 600. Jahre von Noahs Leben« (Michaelis de Leone Canonici Herbip olensis annotata historica, BORK, 1988).
Der extrem starke Abfluss vermochte im Juli 1342 selbst in kleinen Tälern verheerende Schäden anzurichten. So riss der Reiherbach im Dorf Winnefeld im südniedersächsischen Solling mehrere am Talrand errichtete Gebäude fort. In der Aue finden sich talabwärts im Schotterkörper des Juli 1342 Tausende Keramikbruchstücke und Ziegelfragmente. (BORK & BEYER, 2010) An Main und Lahn, an Werra, Fulda und Weser, an der Elbe und ihren Nebenflüssen sowie an der oberen Donau riss das Magdalenenhochwasser Brücken und Gebäude ein; viele Menschen ertranken. Die Abflussmengen des Juli 1342 übertrafen diejenigen der Oderflut 1997 und der Elbfluten 2002 und 2013 um das Dreißig- bis Hundertfache (BORK, 1988; BORK et al., 1998, 2006).
Diese Ereignisse im Jahr 1342 gelten als »Naturkatastrophe«, doch diese Einschätzung hält einer genauen Unter suchung nicht stand, menschliche Landnutzung hatte entscheidenden Anteil. In mehreren langen hochmittelalterlichen Phasen der Klimagunst und des Bevölkerungswachstums war ein massiver Landesausbau erfolgt: Die Wälder Mitteleuropas waren weitgehend gerodet und in Acker- und Dauergrünland umgewandelt worden. Durch die Art des Pflügens waren viele Wölbäcker entstanden. Während zu Beginn des Frühmittelalters noch fast 90% der Oberfläche Deutschlands von Wäldern bedeckt waren, schrumpfte die Waldfläche bis 1300 auf unter 15%: Nur noch Teile der Alpen, der höheren Lagen der Mittelgebirge, Feuchtstandorte in Auen und nährstoffarme Standorte in Norddeutschland waren waldreich. So trafen die Extremniederschläge im Juli 1342 auf kaum durch Vegetation geschützte Landschaften mit oftmals ausgelaugten Böden.
In den wasserdurchlässigen Böden der norddeutschen Restwälder versickerte der Niederschlag vollständig. Unter Wald waren selbst in den Mittelgebirgen Abflussbildung und Bodenerosion gering. Auf bereits abgeernteten hängigen Äckern und im Sommergetreide vermochte der sich rasch bildende Oberflächenabfluss jedoch große Massen von Bodenpartikeln fortzureißen. Die wertvolle Krume wurde oft flächenhaft abgetragen. Der Abfluss strömte in Dellen zusammen und floss konzentriert in Bahnen hang- und talabwärts. Hier entstanden zunächst kleine Rillen, die sich binnen weniger Stunden verbreiterten und vor allem vertieften. Bis zu mehreren Kilometern lange und bis zu vielen Metern tiefe, verzweigte Schluchtensysteme waren das Resultat. Besonders dramatisch war die Zerschluchtung in hügeligen Lösslandschaften mit Wölbackerbau in Gefällerichtung. Dort strömte der Oberflächenabfluss in die Furchen zwischen die Wölbäcker und von dort talwärts. Der Abfluss in den Furchen fiel am unteren Ende einer Wölbackerflur in die dort soeben im Tal einreißende große Schlucht. Der über die Schluchtwand hinunterstürzende Abfluss riss dann in der Furche zwischen zwei Wölbäckern eine schmale Schlucht furchenaufwärts ein. Die Wölbäcker waren danach nicht mehr bearbeitbar und fielen wüst. Die Schluchten stürzten in den auf den Starkniederschlag folgenden Tagen und Wochen zusammen, die Rutschmassen blieben oft bis heute erhalten. In den folgenden Jahrzehnten brachte der Abfluss schwächerer Starkniederschläge Sediment in die verstürzten Wölbackerschluchten, das sich in den Hohlräumen der Rutschmassen und später auf ihnen ablagerte. Schließlich waren die schmalen Wölbackerschluchten soweit verfüllt, dass wieder gerodet und Ackerbau aufgenommen werden konnte.
Eisen-, Keramik- und Ziegelbruchfunde aus dem SCHOTTERKÖRPER DER FLUT wohl vom 22./23. Juli 1342 in Winnefeld (Niedersachsen).
Von einem Hochwasser am 8. Juli 1927 im Kurort Berggießhübel (Sachsen) angeschwemmte VIEHKADAVER. (Wohlfahrtspostkarte)
Manche Gemarkung verlor durch flächen- und linienhafte Bodenerosion während dieses kurzen Ereignisses einen erheblichen Teil ihres Ackerlandes. In den sandreichen Lockersedimenten Norddeutschlands dauerte es nur wenige Jahrhunderte, bis sich unter Wald neue humose Böden gebildet hatten, die dann ackerbaulich genutzt werden konnten. In den tieferen Lagen der Mittelgebirge wurden jedoch die dort häufig flachgründigen Böden im Juli 1342 manchmal bis zur Obergrenze des Festgesteins abgetragen. Hier wird erst die nächste Kaltzeit mit Permafrost die Standorte mit neuem Lockergestein überziehen, in denen sich dann in der darauffolgenden Warmzeit wieder ackerbaulich nutzbare Böden bilden können – das könnte in etwa 120.000 Jahren der Fall sein.
Ohne Eingriffe der Menschen wären die Landschaften Mitteleuropas mit Ausnahme der höheren Alpen und besonders nasser Standorte fast vollständig bewaldet. Auch stärkste Niederschläge würden dann – abgesehen von Mittel- und Hochgebirgsstandorten mit geringmächtigen Böden – zwischengespeichert und langsam über die Bodenund Grundwasserpfade in die Oberflächengewässer sowie über die Verdunstung in die Atmosphäre geführt werden. Starke Hochwasser sind also außerhalb der alpin beeinflussten Gewässer durch Menschen ermöglicht.
Das Desaster von 1342 erzwang durch den Bodenverlust eine Extensivierung der Landnutzung. Das kann als Selbstregulation des Systems verstanden werden, doch war diese mit großem Leid für viele verbunden. Heute – besonders nach den Oder-, Elb- und Donaufluten von 1997, 2002 und 2013 – versuchen staatliche Institutionen zumindest die Zwischenspeicherung von Abflusswasser durch die Schaffung von neuen Retentionsräumen in den Auen zu ermöglichen und damit die Situation der Unterlieger zu verbessern. In größerem Umfang ist dies nur in kaum besiedelten Auenabschnitten möglich, nur sehr eingeschränkt an Rhein und Donau. Also gilt es, zukünftig die Abflussbildung zu mindern. Von Äckern sollte auch bei stärksten Niederschlägen kein Wasser abfließen – eine vor allem durch Flureinteilung und Fruchtfolgewahl sowie durch weniger die Böden verdichtende Techniken realisierbare Forderung. Niederschlagswasser, das auf versiegelte Flächen trifft, müsste vor Ort vollständig versickern, statt dass es so rasch wie möglich in die Oberflächengewässer geleitet wird. Die Umsetzung dieser Forderung bedingt einen erheblichen finanziellen und technischen Einsatz. Am schwersten umzusetzen ist die einfachste Lösung: die Vermeidung weiterer Versiegelung und der Rückbau versiegelter Flächen. Hier ist ein Umdenken dringend erforderlich, Vb-Großwetterlagen sind ein übliches Wetterphänomen. Es liegt an den Menschen, wie sie sich auswirken.
(BORK et al., 1998, 2006; BORK & BEYER, 2010; BORK, 2013)
Eine FLUTWELLE riss wahrscheinlich am 22./23. JULI 1342 im Dorf Winnefeld im Solling (Niedersachsen) eine Dorfstraße fort. Schnitt durch die östliche Flanke der fortgerissenen Straße mit dem Schotterkörper vom Juli 1342 und darüber jüngeren Ablagerungen.
Die Pestpandemie in Mitteleuropa 1347 bis 1351 und ihre Folgen
Nach 1351 verdreifachte sich der Waldanteil Mitteleuropas innerhalb von weniger als zwei Jahrhunderten. Um 1300 hatte der Bewaldungsgrad unter 15% gelegen; umfängliche Rodungen hatten zur geringsten Waldbedeckung der letzten 10.000 Jahre geführt. Was führte zur Umkehrung dieser Entwicklung? War die Landwirtschaft so effektiv geworden, dass ausgedehnte Flächen nicht mehr für den Ackerbau benötigt wurden? Hatten sich die Ernährungsgewohnheiten geändert? Nein, die Bevölkerungsdichte war wesentlich zurückgegangen. Am Ende des Jahres 1351 lebten in Mitteleuropa nur noch gut halb so viele Menschen wie 50 Jahre zuvor. Kalte Winter und Frühjahre, Bodenerosion und Überschwemmungen hatten wiederholt zu gravierenden Ernteausfällen und Hungersnöten geführt. Allein im Jahr 1315 soll jeder zehnte Bewohner Mitteleuropas verhungert sein – Zahlen aus dieser Zeit sind immer nur Schätzungen, doch sie zeigen die Dynamik.
Die Ursachen von UNTERERNÄHRUNG und STERBLICHKEIT. Verändert nach WHO, UNICEF 1992.
Mitte des düsteren 14. Jh. kam es bei der durch Hunger geschwächten Bevölkerung zu einem Massensterben. Unmittelbare Ursache war die Pest, der »Schwarze Tod«. Beginnend in den 1330er-Jahren im Osten Chinas erreichte sie über die Seidenstraße und südasiatische Handelsrouten 1347 Damaskus, Athen, Neapel, Sardinien, Korsika, Genua, Marseille und Dubrovnik. Im Jahr darauf hatte sie sich nach dem östlichen Spanien, nach Frankreich, Südengland, Italien und Südosteuropa ausgebreitet. 1349 kam sie in Portugal, Mittelengland und Irland, Westdeutschland, Österreich und Ungarn an, 1350 in Schottland, Ost- und Nordostdeutschland, in Dänemark, West- und Südskandinavien und den Baltischen Staaten sowie 1351 in Nordschweden, Finnland und Russland. Nur küstenferne Teile Polens, Teile von Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Brandenburg sowie Mailand und ein Abschnitt der nördlichen Pyrenäen blieben weitgehend verschont.
Etwa 60 bis 80% der Menschen in den von der Pest betroffenen Regionen infizierten sich, 75 bis 90% der Erkrankten starben. Die Pest suchte hauptsächlich die Bevölkerung der Städte heim. Ihre Ausbreitung begann oft in Häfen. In Europa starb wohl ungefähr ein Drittel der gesamten Bevölkerung, Schätzungen gehen von etwa 25 Millionen Menschen aus. In vielen Gebieten dauerte es mehr als anderthalb Jahrhunderte, bis die Bevölkerungszahlen der Zeit vor 1347 wieder erreicht worden waren. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pestpandemie der Mitte des 14. Jh. waren dramatisch. Schuldige wurden gesucht; Menschen jüdischen Glaubens wurden verdächtigt, die Epidemie gezielt, insbesondere durch die Vergiftung von Brunnenwasser, ausgelöst zu haben. Judenpogrome resultierten.
Doch wodurch wurde die Pest wirklich ausgelöst? Welche Krankheitsbilder und welche Ausbreitungsmechanismen besitzt sie? Das überaus anpassungsfähige Bakterium Yersinia pestis löst die hochansteckende Infektionskrankheit aus, die allgemein als »Pest« (lateinisch: pestis, übersetzt: Seuche) bezeichnet wird. Das Bakterium kommt bei den Wüstenrennmäusen in Asien endemisch vor; sie erkranken üblicherweise nur leicht. Beißen Insekten (vorwiegend Flöhe) diese Nager, können diese das Bakterium danach auf zahlreiche weitere Säugetierarten übertragen – auch auf den Menschen. Die wichtigsten Überträger von Pestepidemien beim Menschen sollen in der Vergangenheit infizierte schwarze Hausratten, braune Wanderratten und untergeordnet auch Hausmäuse gewesen sein. Epidemiologische Studien legen einen Zusammenhang zwischen der Massenvermehrung von Ratten und der Pestepidemie beim Menschen nahe. Wurde das Pestbakterium durch Flohbisse erst einmal auf den Menschen übertragen, so konnte sich die Krankheit durch Tröpfcheninfektion sehr rasch weiter ausbreiten.
Bereits vor der Pest in der Mitte des 14. Jh. hatte es zahlreiche verheerende Seuchenzüge gegeben, die ebenfalls mit der Pest in Verbindung gebracht werden. So trat eine bedeutende Pestepidemie um 541/42 n. Chr. nahezu im gesamten Mediterranraum auf (die Justinianische Pest). Es folgten Pestwellen unter anderem in den Jahren 544/545 in Irland, 590, 593, 680, 749/750 in Italien, 664 bis 666 und 684 bis 687 in England. Auch nach 1351 erreichte die Pest in Europa Dutzende Male epidemische Ausmaße. Frankfurt a. M. war 1356 erneut betroffen sowie norddeutsche, dänische, niederländische und englische Städte durch verschiedene Epidemien von 1358 bis 1362. Im frühen und im späten 15. Jh. führten zwei Pestpandemien zum Tod von etwa der Hälfte der Bevölkerung Islands. Die Große Pest von London forderte 1665/1666 allein in der englischen Hauptstadt etwa 70.000 Todesopfer. Von 1709 bis 1711 starben in Polen, Litauen und Ostpreußen mehr als 200.000 Menschen an der Pest – um nur einige Beispiele zu nennen. Aufgrund katastrophaler hygienischer Zustände gingen von Konstantinopel auch noch in der frühen Neuzeit wiederholt Pestepidemien aus. Nach 1771 gab es keine Pestepidemien mehr in Europa. In einigen Regionen der Erde tritt die Pest bis heute auf, ist aber bei geeigneter Antibiotikagabe beherrschbar.
Die Ursachen der Pest
Seit der Entdeckung des sehr ansteckenden Pestbakteriums Yersinia pestis im Jahre 1898 ging man davon aus, dass es auch für die Pestpandemie Mitte des 14. Jh. verantwortlich war. In jüngster Zeit gab es jedoch Zweifel an der Letalität der von Yersinia pestis hervorgerufenen Erkrankung, am Infektionsweg und an der Bedeutung des Zwischenwirtes Ratte. Für die Mitte des 14. Jh. liegen kaum Berichte über Rattenplagen vor und eine hohe Nagetierdichte scheint eine wichtige Voraussetzung für die Übertragung zu sein. Auch für andere der Pest zugeschriebene Epidemien in der Antike und im Frühmittelalter war kein Kausalzusammenhang zur Massenausbreitung von Ratten eindeutig nachweisbar. Dennoch wurde bereits im Altertum das massenhafte Auftreten von Nagetieren als Vorbote der Pest angesehen. In der biblischen Überlieferung zu den Philistern wird die Opferung von Mäusen zur Abwehr der Pest beschrieben (I Sam. 5,6 ff). Ein Team um die Archäologin und Forensikerin Verena Schünemann und die Anthropologin Kirsten Bos konnte durch Analysen alter DNA kürzlich eine bislang unbekannte und heute nicht mehr existente Variante des Pestbakteriums Yersinia pestis an gut erhaltenen Skelettresten von Pestopfern nachweisen, die 1348 bis 1350 in einem Massengrab auf dem East-Smithfield-Friedhof in London bestattet worden waren (SCHÜNEMANN et al., 2011). Damit ist das Pestbakterium Yersinia pestis erstmals an einem Ort eindeutig als Verursacher der Pest in der Mitte des 14. Jh. nachgewiesen worden.
Können besondere Umweltbedingungen zur Ausbreitung der Pest beigetragen haben? Ein Kausalbezug ist (noch) nicht nachgewiesen. Die spätantiken und frühmittelalterlichen Pestwellen wie die Pestpandemie der Jahre 1347 bis 1351 traten vorwiegend in Zeiträumen mit ungünstiger Witterung, insbesondere in Jahren mit niedrigen Temperaturen und hohen Niederschlägen, mit Überschwemmungen und Missernten auf. Unterernährte Menschen, die in feuchten Häusern lebten, waren immunologisch geschwächt und damit wohl besonders anfällig.
Der umgekehrte Kausalzusammenhang – die Umweltwirkung von Pestpandemien – ist hingegen nachweisbar. So resultierten die eingangs geschilderten drastischen Landschaftsveränderungen zweifellos vor allem aus dem Massensterben durch die Pest der Jahre 1347 bis 1351 in Mitteleuropa. Eine besonders starke Dynamik erfasste aufgrund der Wiederbewaldung ausgedehnter Gebiete die regionalen Energie-, Wasser- und Stoffhaushalte. Die Grundwasserstände fielen und viele Feuchtgebiete trockneten aus. So änderte sich auch das regionale Klima. Der mittlere Abfluss der großen Flüsse reduzierte sich nach Modellrechnungen um bis zu ein Viertel. Die Hochwasser vieler Fließgewässer wurden seltener und weniger stark. Die Waldvegetation schützte die Böden; dort trat fast keine Bodenerosion mehr auf. Mit dem rasch nachlassenden Nutzungsdruck auf die Landschaften Mitteleuropas konnten sich auch die Ernährungsgewohnheiten der überlebenden Menschen ändern. Vor 1347 konnte der größte Teil der Bevölkerung fast nur über Getreideprodukte und Gemüse ernährt werden, mit der Folge zeitweilig starker Mangel- und Unterernährung. Das energetisch aufwendiger zu produzierende, teure Fleisch stand fast nur der Oberschicht zur Verfügung. Mit der Wiederbewaldung wuchsen die Wildtierbestände und gewann die Haltung von Schweinen und Rindern in Wäldern an Bedeutung. Der Fleischkonsum der Menschen nahm zu. Die Pest hatte also nicht nur das Sozialsystem und die Umwelt verändert, sondern sogar die Ernährungsgewohnheiten der Menschen in Mitteluropa. (GRASSL, 1982; BORK et al., 1998; COHN, 2002; WINIWARTER & KNOLL, 2007; HOFFMANN, 2010)
Im Jahr 1679 floh Kaiser Leopold I vor der Pest aus Wien. Zum Dank für die Rettung der Stadt ließ er eine PESTSÄULE erbauen. Das 1693 geweihte Monument steht im Herzen der Innenstadt Wiens.
Vulkanausbrüche auf Island 1783/1784
Die Skaftáfeuer erleuchteten tags wie nachts den Himmel. Dazu kamen ohrenbetäubendes Donnern und grelle Blitze, Ascheniederschlag und übelriechende Gaswolken, die seit Wochen die Menschen im Süden Islands verängstigten. Zeitweise schossen Dutzende Lavafontänen entlang einer mehr als 20 km langen Spalte wohl bis mehrere Hundert Meter in die Höhe. Lava wälzte sich die Täler hinab, fruchtbare Weiden für Jahrtausende verschlingend. Auf Einzelgehöften in den betroffenen Tälern wohnende, verängstigte Menschen flohen zu Nachbarn und Verwandten. Am fünften Sonntag nach Trinitatis, dem 20. Juli 1783, bewegte sich ein Lavastrom unaufhaltsam auf eine kleine Kirche im südisländischen Kreis Kirkjubæjar zu. Es gab offenbar keinen sicheren Platz mehr für die hier lebenden Menschen, weshalb sich Pastor Jón Steingrímsson mit seiner Gemeinde in der Kirche Kirkjubæjarklaustur versammelte, um nach etlichen Jahren des Wohlstands gottergeben den sicheren Tod zu erwarten. Der Gottesdienst endete und die Laven hatten die Kirche immer noch nicht zerstört. Einige Männer prüften draußen, wie lange es noch dauern werde. Doch der Lavastrom war während des Gottesdienstes keinen Meter näher gekommen, die Lava hatte sich oberhalb Schicht für Schicht aufgetürmt und so die nachfließenden Laven umgelenkt. Die nunmehr fröhliche Gemeinde verließ die Kirche in größter Dankbarkeit (STEINGRÍMSSON, 1788 [1998]: 48ff.).
Blick auf KRATER, der vom 8. Juni 1783 bis zum 7. Februar 1784 durch die AUSBRÜCHE AN DER ISLÄNDISCHEN LAKI-SPALTE entstanden.
Dieses außergewöhnliche Ereignis gab Jón Steingrímsson Anlass, nicht nur die Geschehnisse vom 20. Juli 1783 niederzuschreiben, sondern die am 8. Juni 1783 beginnenden und am 7. Februar 1784 endenden Ausbrüche des isländischen Vulkans Laki mit ihren verheerenden Folgen detailliert zu erläutern (STEINGRÍMSSON, 1788 [1998]: 27f.): Das streng riechende Regenwasser war manchmal gelblich, manchmal bläulich. Die Menschen litten unter Atembeschwerden und verloren gelegentlich fast das Bewusstsein. Die Zugvögel waren geflohen und die zurückgelassenen Eier aufgrund ihres Gestankes und des schwefligen Geschmacks kaum mehr essbar. Desorientierte Pieper, Zaunkönige und Bachstelzen wurden beobachtet und schließlich ganze Scharen tot aufgefunden. Eisen wurde rostrot und der schwefelreiche Niederschlag färbte Holz grau. Das grüne und saftige Gras bleichte aus und verwelkte. Männer versuchten die Asche von den Weiden zu rechen, damit die Rinder das Gras erreichen und fressen konnten. Einige Bauern mähten und wuschen das Gras, um es dann an die Rinder zu verfüttern. Aber alles war vergebens, wenn nicht altes Heu eingemischt wurde. Der Milchertrag sank. Die Säuren des Niederschlags ätzten Brandflecken in das Fell der Schafe. Niemand hatte vorhergesehen, dass es am besten gewesen wäre, die Schafe zu schlachten, als sie noch viel Fleisch auf den Knochen hatten.
Über eineinhalb Jahre hatte diese zu den größten Vulkanausbrüchen der jüngeren Erdgeschichte gehörende Eruption auf Island angedauert. Die Lava bedeckte im Februar 1784 schließlich eine Fläche von 565 km2. 14,7 km3 Laven und Tephra waren eruptiert. Mehr als 100 Millionen Tonnen Schwefeldioxid, 15 Millionen Tonnen Fluorwasserstoff und 7 Millionen Tonnen Chlorwasserstoff wurden freigesetzt. Etwa 10.000 Menschen, ein Viertel der Bevölkerung Islands, kamen zu Tode. 187.000 Schafe (79% des Bestandes) und 27.000 Pferde (76% des Bestandes) verendeten.
Die Auswirkungen waren auch in Europa spürbar; im Juni 1783 häuften sich Erwähnungen der in zeitgenössischen Quellen als »Herrauch«, »Höhenrauch« oder »Höhennebel« bezeichneten Aerosolwolke der Laki-Eruptionen. Im Schönberger Kirchenbuch ist zu lesen: »Anno 1783 war in den Monaten Juni, Juli und August in dem ganzen Deutschland, ja fast in ganz Europa, ein sonderbarer trockener Nebel, von den Gelehrten ein Herrauch genannt. Bei dem heitersten Wetter konnte man die Sonne von morgens 7 bis abends 7 Uhr nicht sehen; wenn sie durch den Nebel hervorbrach, war sie blutrot. Die Blätter aus vielen Bäumen versengten, und wenn die Bäume wieder Laub getrieben hatten, geschah das bei nicht wenigen zum andern, ja wohl zum 3. Male, so daß sie abstarben. Einige wollten das der Kälte in einigen Nächten zuschreiben« (CLASEN, 1898: 122).
Menschen in ganz Europa klagten im Sommer 1783 über Kopfschmerzen und Atembeschwerden. Die schwefelreichen Gase und die indirekt ebenfalls auf die Vulkanausbrüche in Island zurückzuführende extreme Witterung erhöhten die Mortalität in einigen Regionen Europas offenbar deutlich. So waren im August und im September 1783 sowie im Januar und Februar 1784 in England insgesamt etwa 20.000 zusätzliche Todesopfer zu beklagen.
VULKANITE der Ausbrüche an der Laki-Spalte 1783/84 (Süd-Island).
Die vulkanischen Aktivitäten an der Laki-Spalte beeinflussten über mehrere Jahre das nordhemisphärische Klima stark. So folgte in Mitteleuropa auf den heißen und trockenen Sommer 1783 ein außergewöhnlich strenger und schneereicher Winter mit kurzen Warmlufteinbrüchen. In Wien fielen die Temperaturen auf – 27 °C und in Heidelberg auf – 30 °C. In Köln wurden Schneehöhen von 150 cm und in Würzburg von 180 cm verzeichnet. Einer der niederschlagsreichen Warmlufteinbrüche führte Ende Februar 1784 zu einer plötzlichen Schneeschmelze, zu starker Abflussbildung und damit zu einer der verheerendsten Überschwemmungskatastrophen der Neuzeit. Die Eisdecke riss vom 26. bis 28. Februar 1784 auf den mitteleuropäischen Flüssen nahezu gleichzeitig auf. Die Flüsse schwollen rasch an. Eisschollen stauten sich an Brücken. Mitgerissene Baumstämme wirkten als Stoßkeile. Am 27. Februar 1784 wurden Brücken über die Werra in Hannoversch-Münden, jene über die Lahn in Weilburg und über die Regnitz in Bamberg durch Eisgang und Hochwasser zerstört. Einen Tag später waren Brücken über den Main in Würzburg, über die Donau in Regensburg und in Linz sowie die Karlsbrücke in Prag betroffen. Am 1. März wurden die Elbbrücken in Dresden und in Meißen beschädigt. An der Elbe gingen am Rittergut Tauschwitz 600 Faschinen verloren, 16 Dämme wurden zerstört. Zahlreiche flussnahe Häuser wurden eingerissen. Der 13-jährige Ludwig van Beethoven flüchtete erfolgreich mit seinen Eltern in den ersten Stock des Hauses seiner Gastfamilie in Bonn. Viele andere starben. (GLASER, 2008: 233–238; NEBEL, 2011)
Gärten, Äcker und Wiesen wurden mit Sediment bedeckt. Diese Bodenmassen stammten von ackerbaulich genutzten Hängen, auf denen das Schmelz- und Regenwasser die Krume oftmals flächig fortgespült und gelegentlich auch tiefe Schluchten eingerissen hatte. Im Osten Brandenburgs bewirkte flächenhafte Erosion auf einigen Hängen der Märkischen Schweiz eine derart starke Abnahme der Bodenfruchtbarkeit, dass sie aufgeforstet werden mussten. Die Vernichtung von Ackerland förderte, wie Berichte aus Südwestdeutschland belegen, sogar die Auswanderung. (BORK et al., 1998)
Heute kann schon ein schwacher Vulkanausbruch auf Island (wie etwa derjenige des Eyjafjallajökull von März bis April 2010) erhebliche ökonomische Auswirkungen nicht nur in Nord- und Mitteleuropa haben. Ein Vulkanausbruch, der im Hinblick auf die Masse und Zusammensetzung der ausgestoßenen Partikel sowie die Hauptwindrichtung mit dem an der Laki-Spalte in den Jahren 1783 und 1784 vergleichbar wäre, würde heute enorme Schäden verursachen. Zwar wären die Schäden auf vielen ackerbaulich genutzten Standorten zum Beispiel durch den Anbau von Zwischenfrüchten geringer. Jedoch führten die Verdichtung der Ackerböden durch das Befahren mit schweren Fahrzeugen und insbesondere die dramatische Versiegelung unserer Landschaften durch befestigte Wege und Straßen, Gebäude und Parkflächen zu sehr viel mehr Abfluss als noch im späten 18. Jh. Die Hochwasser wären schneller und damit auch höher. Schließlich haben wir mittlerweile viele Gebäude in Auen errichtet, die wir nur zum Teil schützen können. Vulkanausbrüche wie diejenigen an der Laki-Spalte 1783/84 sind Teil der geologischen Dynamik der Erde. Der nächste kommt bestimmt …
(THORARINSSON, 1969; STOTHERS, 1996; BORK et al., 1998; THORDARSON & SELF, 2003; WITHAM & OPPENHEIMER, 2007; GLASER, 2008; BRÁZDIL et al., 2009)
AUSBRUCH DES VESUV im April 1906. (Postkarte)
Gesellschaftlicher Umgang mit Klima und Wetter
Niemand kann das Klima und seine Entwicklung mit den Sinnen wahrnehmen, doch sind die natürlichen Ökosysteme an das jeweilige Klima angepasst und die Produktionssysteme des Menschen auf das jeweilige Klima zugeschnitten. So reicht etwa das Verbreitungsgebiet der Tsetse-Fliege (Glossina sp.), die die Schlafkrankheit überträgt, von den westafrikanischen Tropen aus nur so weit nach Norden, bis der mittlere Jahresniederschlag unter etwa 1000 mm sinkt.
Wie gehen Menschen mit der kurzfristigen Dynamik des Wetters und der mittelfristigen der Witterung, insbesondere mit extremer Trockenheit, Feuchte, Hitze oder Kälte um? Welchen Einfluss haben Dürren und Hungersnöte auf politische Systeme? Zerbrechen Staaten an Dürren oder wird Zentralmacht gar gestärkt? Ein Herrscher oder eine politische Elite, die durch das Anlegen von Vorräten oder auch durch Raubzüge bei Nachbarn Extreme abfedern konnten, wurde früher durch Dürren und andere klimatische Extreme eher gestärkt. Die folgende Frage ist schwerer zu beantworten. Sind Wirkungen von Witterungs- und Klimadynamiken auf menschliche Gesellschaften wirklich nachweisbar? Diese Frage kann ohne Berücksichtigung der sozialen Differenzierung nicht beantwortet werden. Das zitierte Gedicht ist das Klagelied einer Tuareg-Frau. Witterungsbedingte Ernteausfälle und andere Kalamitäten trafen immer zunächst die Ohnmächtigen: Angehörige der Unterschicht, Frauen, Kinder. Die Wirkungen von Klimaänderungen hängen also nicht nur von deren Ausmaß, sondern auch vom sozialen Status der Menschen ab. Hinsichtlich der Wirkung von Klimaextremen auf Konflikte erweist sich, dass vorwiegend klimabedingte Konflikte über knapper werdende Ressourcen von solchen Konflikten, die durch Druck auf das Nahrungssystem etwa durch Bevölkerungswachstum oder Migration verursacht wurden, kaum unterschieden werden können. Konflikte gibt es eindeutig, ohne dass Klima oder Wetter eine Rolle spielen. Zuletzt ist zu berücksichtigen, dass kriegerische Auseinandersetzungen Nahrungssysteme ruinieren oder zumindest schwer beeinträchtigen. Marodierende Soldaten plündern Felder und Ställe, Panzer fahren durch Felder, Landminen machen Bewirtschaftung unmöglich. Dieser Zusammenhang fand sogar sprachlichen Niederschlag: Nicht umsonst nennt man besonders üble Situationen »verheerend«.
Klima und Konflikte können also durchaus kausal zusammenhängen, aber Ursache und Wirkung sind schwer zu differenzieren. Bis in das frühe 20. Jh. waren Ackerbaugesellschaften durch Mangelernährung, saisonale Knappheit und Hungerzeiten, aber höchstens kurzzeitig durch Überfluss geprägt. Schwankungen waren normal. Dies lässt sich an einem afrikanischen Beispiel veranschaulichen. Hunger und Dürre wurden in der öffentlichen Meinung Europas und Nordamerikas in den 1970er-Jahren mit Bildern aus der Sahelzone, der im Süden an die Sahara angrenzenden niederschlagsarmen Region, verknüpft – als ob es sich um eine besondere Katastrophe handelte. Erklärungen folgten einem Modernisierungsnarrativ oder der romantischen Vorstellung von den durch brachiale Kolonialpolitik in ihrem Einklang mit der Natur gestörten »edlen Wilden«.
Lag es am veränderten Klima, dass die Menschen im Sahel verhungerten? Der Blick in die Geschichte sollte helfen, die Katastrophe besser zu verstehen. Klimaforscherinnen und -forscher konnten zwar langfristige Trends für den Sahel zeigen; aus Mangel an Quellen war eine Verknüpfung mit bestimmten historischen Ereignissen aber kaum möglich. Allerdings, soweit geht der Konsens, ist Hunger im Sahel keine direkte Folge von Dürre. Mangelernährung und Hunger bereiten den Weg für Krankheiten, Menschen verhungern selten; viel öfter fallen sie geschwächt Epidemien zum Opfer. Malaria, Pocken, Gelbfieber, Schlafkrankheit und Cholera sind in der Region endemisch; durch Handel und Pilgerfahrten verbreiteten sie sich. In Krisenzeiten gingen Menschen vermehrt auf Wanderschaft, um bessere Lebensbedingungen zu suchen. Mit ihnen breiteten sich die Krankheiten aus. Ob jemand hungert, ist zudem keine Frage potenziell vorhandener Nahrung, sondern hängt davon ab, ob die Person Zugang zu Nahrung hat, sie bezahlen und erreichen kann.
Seit der Mond des Monats Djir-mouhden am Himmel erschienen ist, seid ihr Krieger auf einer Razzia, wir dagegen sind im Tahaft-Tal, ohne uns zu rühren.
Wenn ihr lebt, so sind wir tot.
Der sarat-Monat ist wieder da,
er, den wir für immer abwesend glaubten.
Alles, was ihr von den Frauen kennt, ist mager wie bei einem Tier.
Sie sind nackt, wie wenn sie durch die Feinde ausgeraubt worden wären.
Mein Abendessen besteht aus trockenem Holz, ich sterbe vor Hunger.
Der Hunger hat das Fleisch von unseren Knochen genommen, ohne etwas übrig zu lassen;
Er hat unser Mark ausgekratzt, unsere Knochen sind nackt und leer; Gott hat ihm nur unser Leben verweigert.
(CASAJUS, 1997: 220; Übersetzung Gerd Spittler, SPITTLER, 2000)
Die Landwirtschaft des Sahel unterliegt seit jeher langfristigen raum-zeitlichen Veränderungen. So lagen die drei Zonen der Kamelhaltung, der Rinderhaltung und des Regenfeldbaus um 1600 etwa 200 bis 300 km weiter nördlich als um 1850. Die Rinderhaltungszone des Sahel hatte sich damit nach Süden in früher agrarisch genutzte Gebiete verschoben. Die Zone, in der die Tsetse-Fliege Viehhaltung unmöglich macht, bewegte sich in entgegengesetzter Richtung: Sie hat sich in den letzten zwei Jahrtausenden um rund 200 km nach Norden verschoben und damit nicht nur die Zone der Rinderhaltung beeinflusst, sondern auch das militärische Kräfteverhältnis verschoben; berittene Soldaten konnten in einem größeren Raum operieren, ohne dass sie befürchten mussten, ihre Pferde mit der Schlafkrankheit zu infizieren.
Die islamischen Reiche, die sich im 16. Jh. herausbildeten und die zum Teil bis ins 20. Jh. bestanden, waren offenbar erstaunlich resilient gegen Klimaveränderungen. Zentrifugale und zentralistische Kräfte hielten einander die Waage; doch gelang es den Herrschern, das Ausmaß ihrer auf einem starken Militär beruhenden Kontrolle durch Tribute, Steuern und Zwangsarbeit zu steigern. Die ökologische Diversität wurde aktiv in Austauschbeziehungen genutzt. Sklaverei war verbreitet. Der innerafrikanische Sklavenhandel war ebenso wie der atlantische in dieser Zeit besonders umfangreich. Alle diese Entwicklungen fanden vor dem Hintergrund sich verstärkender Trockenheit statt.
Das Klima des Sahel ist durch eine hohe interannuelle Variabilität der Niederschläge gekennzeichnet, in unregelmäßigen Rhythmen folgen Serien von Trockenjahren auf Jahre mit niederschlagsreicheren Sommern. Diese klimatische Situation macht die Abgrenzung von Dürren schwer. Trotz der hohen Witterungsvariabilität kann mithilfe des Wasserspiegels des Tschadsees mit einiger Sicherheit rekonstruiert werden, wann es besonders trocken war. Die trockensten Perioden waren demnach die Mitte des 15. Jh., die Jahre 1565 bis 1590, die Zeit um 1680, das Ende des 18. Jh., die Jahre von 1830 bis 1840 und von 1900 bis 1915.
Die in den 1970er-Jahren im kollektiven Gedächtnis noch präsente Hungersnot von 1913/1914 fällt in eine Trockenperiode; doch ebenso bedeutsam für ihre Effekte war die innenpolitische Situation, die nach dem plötzlichen Tod eines starken Herrschers durch interne Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen gekennzeichnet war. Auch die Hungerkatastrophen des 19. Jh. sind in einem Kontext von Gewalt und Krieg verortet, das erklärt auch ihre begrenzte lokale Ausdehnung.
Der vorkoloniale Sahel war durch Diversität in den Produktionsweisen, Verteilungsmechanismen und Nahrungsgewohnheiten und hohe Wandlungsfähigkeit gekennzeichnet. Mischkulturanbau ebenso wie regelmäßige Wanderungen waren und sind adaptive Strategien, die Änderungen der natürlichen ebenso wie der politischen Rahmenbedingungen abfedern können. Diese Mechanismen brachen zusammen, wenn Krieg und Gewalt das Land überzogen.
Klima und Gesellschaft sind in einem komplexen Zusammenhang von natürlicher und gesellschaftlicher Dynamik miteinander verknüpft. Um sich an wechselnde Bedingungen anzupassen, muss niemand das Klima als solches wahrnehmen. Seine Effekte auf Landwirtschaft, Viehzucht und Insektenpopulationen nahmen die Menschen im Sahel aber sehr wohl wahr und reagierten mit Vorsorge und Nutzung von Chancen, so wie überall auf der Erde. Wanderungen waren eine von mehreren Strategien. Fixierte Grenzen ebenso wie mit Entwicklungshilfe gebaute Brunnen machen diese Strategie weitgehend unmöglich. Auch dies senkt die Resilienz. Die Dürrekatastrophe der 1970er-Jahre kann im Licht historischer Kenntnisse als durch politische Bedingungen und klimatische Extreme gleichermaßen verursacht gelten.
(MEIER, 2007)
Die Austrocknung des TSCHAD-SEES von 1968–2000. Die Wasserfläche schrumpfte durch Wasserentnahme für Bewässerung und wahrscheinlich auch aufgrund des Klimawandels um ca. 95%. Aufnahmen der NASA.
Zwei BÄUERINNEN pflanzen im Land der Konso mit dem GRABSTOCK Sorghum (Süd-Äthiopien).
NASSREISANBAU in Vietnam. (Postkarte um 1950)
An nur einem halben Tag fingen Sportfischer zu Beginn des 20. Jahrhunderts 5 TONNEN THUNFISCH, Santa Catalina Island vor Südkalifornien, USA. (Postkarte versandt am 3.6.1905)
WASSERRÄDER im Orontes im syrischen Hama. (Postkarte, frühes 20. Jh.)
HEIDELANDSCHAFT bei Müden an der Örtze, Niedersachsen.
»Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich« (Leo Tolstoi, Anna Karenina, 1878 [2009]: 1).
Alle Agrargesellschaften ähneln einander; sie optimieren die Nutzung von Nährstoffen und den Einsatz ihrer Arbeitskräfte und entwickeln risikominimierende Portfolios. Die Herausforderungen, die sie in ihren individuellen Naturräumen zu bewältigen haben, machen sie andererseits sehr divers. Diese Diversität zeigen zehn Besuche bei Agrargesellschaften von den Tropen bis zur Subarktis, die in den folgenden Geschichten beschrieben werden.
Böden sind überall eine zentrale Ressource. Der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit wird großes Augenmerk geschenkt und viel Arbeitszeit gewidmet. Agrargesellschaften beruhen auf der Nutzung von Sonnenenergie, die hauptsächlich in Form von Biomasse verfügbar ist. Dazu kommt der Wind, der Segelschiffe und Mühlen antreibt sowie Wasser, dessen Energie vielfältig genutzt wird. Energie und Anbaufläche sind direkt voneinander abhängig. Daher haben Angehörige von Eliten meist ausgedehnten, fruchtbaren Landbesitz.
Viele Gesellschaften verbinden Ackerbau und Viehhaltung. Vieh dient der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, der Bereitstellung von Nahrung und von Rohstoffen für das Handwerk und leistet landwirtschaftliche Arbeit. Für die Viehhaltung und die Haltbarmachung von Fleisch wird Salz benötigt. In Salzgärten wurde es direkt mit Sonnenwärme gewonnen; bei bergmännisch gewonnenem Salz war Holz nötig: Das führte lokal zu Entwaldung und Nachnutzungen, wie sie heute noch in der Lüneburger Heide konserviert sind. Hielt man kein Vieh, wurde das Sammeln menschlicher Fäkalien zur Rückführung von Nährstoffen in die Böden nötig. Um Nachttopfinhalte konnte durchaus Streit ausbrechen, wie wir aus Japan wissen.
Böden sind in menschlichem Zeitmaß nichterneuerbare Ressourcen, ihre Bildung dauert Tausende Jahre. Umfängliche Boden schützende Eingriffe wie der Bau von Terrassen sind weltweit bezeugt. Der Kampf gegen Erosion verlief gerade dort, wo fruchtbare Ablagerungen durch Wind (Löss) die Landwirtschaft begünstigten, nicht immer erfolgreich. An Terrassen im chinesischen Lössplateau lassen sich lange Phasen, in denen Menschen Erosion erfolgreich kontrollierten, von solchen mit dramatischem Bodenverlust unterscheiden. Der Besuch auf der Osterinsel macht mit der Steinmulchung, einer ungewöhnlichen Form der Erosionsbekämpfung, bekannt. Die steinreiche Oberfläche wurde lange nicht als mühsames Menschenwerk erkannt, die Landschaften fälschlicherweise für unfruchtbar gehalten. Eine weitere Möglichkeit, Erosion zu verhindern, ist die Nutzung von Wäldern zur Weide, die gerade bei Wasserknappheit vielfach positiv wirkt. Im Mittelmeerraum war diese Nutzungsform langfristig erfolgreich.
In tropischen Böden ist der Mangel an Nährstoffen ein Problem. Die indigene Bevölkerung im Amazonastiefland lernte, nährstoffarme Böden durch Zugabe von Tonscherben und Holzkohle in die fruchtbare »Terra Preta do Índio« zu verwandeln.
Die Nahrung von Jägern und Sammlerinnen war durch Fleisch und Fisch eiweißreich. Agrargesellschaften dagegen versorgten sich hauptsächlich mit Kohlehydraten, dem Hauptbestandteil von Getreide. Tierisches Protein war wegen der geringeren Flächeneffizienz der Tierhaltung selten und kostbar. Fischteiche bereicherten den Speisezettel um eiweißreiche Nahrung, die zudem ermöglichte, religiöse Fastengebote einzuhalten. Vielerorts wurde zur Erhöhung der Erträge be- oder entwässert. In Grönland war es nur möglich, in der durch Trockenheit und lange Winter gekennzeichneten Subarktis zu überleben, wenn genug Heu für die Herden zur Verfügung stand. Kanalsysteme zur Wiesenbewässerung waren eine Voraussetzung für die 400-jährige Erfolgsgeschichte der in Grönland siedelnden Wikinger. Ihr Fortgang sollte nicht als »Kollaps« gewertet werden.
Eingriffe in Ökosysteme haben nicht nur beabsichtigte, sondern oft auch unerwünschte Wirkungen. In den Niederlanden führte der Kampf gegen das Wasser zu langfristigen Nebenwirkungen. Für den Anbau von Brotgetreide in den moorigen, flachen Landschaften wurde entwässert. Die Moore schrumpften. Die dadurch tiefergelegte Oberfläche musste eingedeicht und das Grundwasser beständig abgepumpt werden. Der Abbau von Torf verstärkte das Problem. Diese Wirkungskaskade beschäftigt die Niederländer bis heute. Die venezianischen Eichenwälder Oberitaliens belegen, dass durch Schutzmaßnahmen Schaden entstehen kann. Je mehr die für den Schiffsbau nötigen Eichen geschützt wurden, desto weniger Eichen wuchsen.
Einsicht in ökologische Zusammenhänge war und ist für Agrargesellschaften entscheidend, aber nicht leicht zu erhalten. Heute finden wir in den Quellen vergangener Gesellschaften Informationen, aus denen wir vieles für eine nachhaltige Zukunft lernen können.
PFLÜGEN im trockengelegten Wieringermeer, Niederlande. (Postkarte, nach 1930)
Transport auf dem Wasser: BLOECHERTRIFT im Bayerischen Wald. (Postkarte versandt am 25.8.1902)
WALKNOCHEN aus der Zeit der Grönlandfahrten im 18. Jh. auf Borkum, Niedersachsen. (Postkarte versandt am 4.6.1916)
REISIGTRÄGERIN in der Auvergne, Frankreich. (Postkarte, 1905)
Werbepostkarte mit DÜNGUNGSEMPFEHLUNGEN (Ausschnitt).
Werbepostkarte für ELSÄSSISCHES KALI (Anfang 20. Jh.).
Werbepostkarte »TOD DEM UNKRAUT DURCH DÜNGUNG MIT KALKSTICKSTOFF« (vor 1939).
SCHAFMILCHSCHWEINEKUHPFERD als Zuchtziel der Deutschen Landwirtschaft, Werbepostkarte für die landwirtschaftliche Ausstellung in Düsseldorf (1907).
Überlebenswichtig für Ackerbaugesellschaften
Speisesalz ist für den Menschen lebensnotwendig. Vor dem Neolithikum mussten die Menschen, die von der Jagd lebten und sich wesentlich von Fleisch und Milch ernährten, ihre Nahrung nicht salzen. Die Nahrung enthielt meist mehr als die benötigte Mindesttagesdosis von zwei bis fünf Gramm Natriumchlorid (NaCl, Speisesalz). Mit dem Aufkommen der Tierhaltung und des Ackerbaus änderte sich die Versorgungssituation grundlegend. Tierhalter benötigten Salzlecksteine für das Vieh, von dem sie sich ernährten. Mit dem allmählich zunehmenden Verzehr von pflanzlichen Produkten nahm zudem die Versorgung der Menschen mit Speisesalz ab. Salzmangel aber kann Störungen von Kreislauf und Nervensystem, Übelkeit und Ermüdung, Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe sowie eine gefährliche Austrocknung auslösen. Vor der Möglichkeit, Lebensmittel durch Kühlung haltbar zu machen, war außerdem die Behandlung mit Salz eine der wichtigsten Techniken, um Nahrung zu konservieren.
Die Bereitstellung von Natriumchlorid wurde also mit dem Aufkommen von Tierhaltung und Ackerbau für Menschen und Haustiere lebensnotwendig. Die Suche nach Salz begann. Die gezielte Verdunstung von Meerwasser ist dabei ein bedeutendes, seit Jahrtausenden vor allem in Gebieten mit Trockenzeiten praktiziertes Verfahren. Meerwasser, das auch NaCl enthält, wird verdunstet. Da die verschiedenen Salze im Meerwasser verschieden gut löslich sind, können sie in Kaskaden von Verdunstungsbecken voneinander getrennt werden. Sorgfältige Arbeit führt zu nur geringen Verunreinigungen mit anderen Salzen und kleinsten Mineralen (Tonmineralen) im Umfang von wenigen Prozent. Dieser Betrieb von Salzgärten in Trockengebieten hatte – abgesehen von den kleinräumigen Relief- und Bodenveränderungen an den Anlagen – wohl keine relevanten negativen Umweltwirkungen.
Auch an einigen niederschlagsreichen Flachküsten kann Salz oberflächennah gewonnen werden. So enthalten zeitweilig von Meerwasser überflutete Torfe an der Nordseeküste Salz. Salzsieder wuschen es aus dem Torf, fingen das salzreiche Wasser auf und erhitzten es in Siedepfannen, um es anzureichern. In Mittelalter und Frühneuzeit war dies ein gängiges Verfahren der Salzgewinnung an den Küsten der Niederlande, Deutschlands und Dänemarks. Die Bezeichnung »Halligen« für die Siedlungshügel in der nordfriesischen Marsch resultiert aus der Salztorfnutzung durch die Bewohner (Hal = mittelhochdeutsch für Salz). Heute wird nur noch auf der dänischen Insel Læsø als besondere Attraktion für Besucher Salz aus Torf gewonnen (MIETH & BORK, 2009). Die Salztorfgewinnung hinterließ in den Marschen zahllose kleine, mit Grund- oder Meerwasser teilweise gefüllte Hohlformen und damit stark veränderte Böden. Archäologische Untersuchungen weisen nach, dass die Technik der Salzsiederei von Südosteuropa kommend in Mitteleuropa Einzug hielt. Menschen der frühneolithischen Lengyel-Kultur im heutigen Polen und im Mittelneolithikum lebende Menschen der Bernburger Kultur im heutigen Sachsen-Anhalt, der Wartberg-Gruppe in Hessen und der Schönfelder Kultur in Niedersachsen siedeten Speisesalz (FRIES-KNOBLACH, 2002: 5).
Bestimmte Gesteinsschichten enthalten Steinsalzlagen. In Mitteleuropa entstanden in der Zeit des Zechsteins vor etwa 255 Millionen Jahren mächtige Salzlager. Die hohe Auflast der seitdem ablagerten Gesteine verflüssigte die Zechsteinsalze und ließ sie in riesigen Salzdomen manchmal bis zur Oberfläche aufsteigen. Grundwasser löste dort Natriumchlorid, das in Bäche und Flüsse gelangte. Menschen schmeckten das salzige Wasser und begannen nach den Steinsalzlagern zu suchen, um sie dann unter Tage abzubauen. Nach dem Zechstein bildeten sich weitere Salzlager. Auch sie wurden später aufgepresst, unter anderem am nördlichen Rand der Alpen.
BAHNHOF DER 710 METER SOHLE des Kali- und Steinsalzbergwerkes der Bergwerksgesellschaft Mariaglück in Höfer bei Celle (HELMCKE, 1930, S. 589). unten Nachbau eines SALZSIEDEOFENS der Latènezeit (ca. 500 bis 50 v. Chr.) im Keltenpavillon in Bad Nauheim.
SALINE in Bad Münster am Stein bei Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz. (Postkarte, 1930er-Jahre)
In einigen mitteleuropäischen Landschaften mit oberflächennah anstehendem Steinsalz setzte der untertägige Abbau von trockenem Steinsalz früh ein. Im Jahr 1838 hatte Johann Georg Ramsauer, Leiter des Hallstätter Salzbergwerks im oberösterreichischen Salzkammergut, bei Grabungen in einem Gräberfeld im Hallstätter Hochtal ein Hirschgeweihfragment gefunden. Es war offenbar als Pickel am Hallstätter Salzberg verwendet worden. Moderne Untersuchungen mittels Radiokohlenstoffdatierung ergaben ein Alter der Hirschgeweihhaue von etwa 7000 Jahren, somit ist auch die Salzgewinnung mindestens so alt.
Während der Bronzezeit und der Vorrömischen Eisenzeit drangen Menschen tief in den Hallstätter Salzberg ein, um Salzsteine abzubauen. Murenabgänge, deren Auftreten wahrscheinlich durch die intensive bergbaubedingte Waldnutzung entscheidend begünstigt wurde, verschütteten um etwa 2300 v. Chr.1 die Eingänge des Salzbergwerks; wiederholt eindringendes Wasser brachte Stollen zum Einsturz und beendete vorübergehend den Salzbergbau. Im ersten vorchristlichen Jahrhundert wurde der Abbau wieder aufgenommen. Prächtige römische Villen am Fuß des Salzberges bezeugen, dass die Salzgewinnung und der überregionale Salzhandel in den folgenden Jahrhunderten eine neue Blüte erreichten. Die negativen Auswirkungen des Salzabbaus und der Salzverarbeitung auf den Zustand der benachbarten Wälder und die Qualität der Fließgewässer im Tal werden beträchtlich gewesen sein.
Im frühen Mittelalter war der Bergbau zurückgegangen. Im Hoch- und Spätmittelalter sowie in der frühen Neuzeit brachten ausgereiftere Abbau- und Verarbeitungstechniken schwere und gefährliche Arbeit für viele Menschen und Wohlstand für einzelne in die Salzorte der Ostalpen wie Hallstatt, Bad Ischl, Hallein und Hall in Tirol. Landesfürstliche und klösterliche Betriebe lösten zunehmend die kleinen Familienbetriebe, die »Mitsieder«, ab. Die nasse Salzgewinnung ersetzte den über sechs Jahrtausende praktizierten trockenen Bergbau. Menschen gruben Höhlen in die Salzlagerstätten, fluteten sie und führten die entstandene salzreiche Lösung durch Holzrohrleitungen in die Täler, wo die Sole in großen Sudpfannen bis zur vollständigen Verdampfung des Wassers und der Kristallisierung des Salzes erhitzt wurde. Holzknechte schlugen das als Brennstoff benötigte Holz. Ausgefeilte Forstordnungen regelten Zugang und Nutzung zu Holz. Raubbau sollte verhindert werden. Schon in der frühen Neuzeit begannen damit die Bemühungen um eine Minimierung der negativen Wirkungen von Bergbau und Salzsiederei auch auf den Wasserhaushalt und auf die Intensität von Murenbildung und Erosion (SONNLECHNER & WINIWARTER, 2002). Der Bedarf nach Salz hatte organisatorische wie technische Innovationen zur Folge, aber auch Auswirkungen auf die Fiskalpolitik. Regierungen der frühen Neuzeit führten Salzmonopole ein, die zum Teil bis heute bestehen. Frankreich schuf bereits 1286 die Gabelle, eine verhasste Salzsteuer. Sie wurde erst mit der Französischen Revolution 1790 abgeschafft.
Salz wurde über Salzstraßen und Flüsse transportiert und zu den Verbrauchern gebracht. Schon im 9. Jh. wurde Hallstätter Salz über die Traun verschifft. Auf der Donau war Salz zeitweise die bedeutendste Fracht. (BAMBERGER & MAIER-BRUCK, 1967: 986) Die frühe Entwicklung von Venedig und Chioggia ist mit der Salzgewinnung verbunden, das in der Lagune hergestellte Salz begründete ihren Reichtum. Das mittelalterliche Königreich der Mali war auf dem Austausch von Salz und Gold aufgebaut. Salz fand sich in ausgetrockneten Seen in der Wüste und wurde mit Karawanen weit transportiert, es wurde in Gold aufgewogen, wie Montesquieu in seinem Werk über den Geist der Gesetze beschrieb: »So haben die Mauritanischen Karavanen, welche zu Tombouktou, am äußersten Ende Arabiens, Gold gegen Salz eintauschen, bei ihrem Handel kein Geld nötig. Der Mauritanier schüttet sein Salz auf einen Haufen, der Neger seinen Goldstaub auf einen anderen, und von beiden Seiten wird so lange zugelegt und abgenommen, bis man des Tausches einig ist« (MONTESQUIEU, [1748] 1804, 2: 291). Die Fußnote zu dieser Ausführung belegt eindrucksvoll, wie wichtig Salz war: »Wegen der häufigen Salznoth, die in Tombouktou entstehet, hat das Salz dort meistens einen hohen Preis und machet den vorzüglichsten Gegenstand des Handelverkehrs aus«(ebd.).
Heute macht sich eine gewisse Besorgnis breit, dass künftig Kriege wegen des Zugangs zu Ressourcen wie Wasser geführt werden könnten. Doch Macht ist nicht erst seit Beginn des 3. Jahrtausends mit dem Zugang zu strategisch wichtigen Ressourcen wie Salz verknüpft. Ressourcen bestimmten schon seit der Antike das Schicksal von Völkern.
Der Norden Chinas
Terrassen sind gebaute Kulturgeschichte. Nicht selten sind in ihnen ganz besondere Geheimnisse verborgen. Terrassen werden an Hängen vieler Landschaften der Erde oftmals seit Jahrhunderten, in seltenen Fällen nachweisbar seit Jahrtausenden garten- oder ackerbaulich genutzt. Manche Terrassen wurden von Menschen angelegt. Andere entstanden allmählich durch die Ablagerung von Bodenpartikeln, die Starkregen oberhalb abgespült hatten.
GARTEN IM NORDCHINESISCHEN LÖSSPLATEAU. Der verlagerte Löß wird durch Regentropfen verschlämmt, die feste, wenig wasserdurchlässige Kruste, die beim Trocknen entsteht, muss von Frauen in Handarbeit immer wieder aufgehackt werden.
Im nordchinesischen Lössplateau liegt etwa 300 km nördlich der alten Kaiserstadt Xi’an bei Yan’an eine Terrasse, die die Landnutzungsgeschichte der Region während der vergangenen fünf Jahrtausende exemplarisch widerspiegelt. Die Abtragung hat hier in das ehemalige Lössplateau bis zu 300 m tiefe Täler eingeschnitten. Zwischen ihnen liegen langgezogene Rücken mit steilen Hängen, in denen der Löss gelegentlich sichtbar ist. Inmitten der aus dem Pleistozän stammenden größten und mächtigsten Lössablagerungen der Erde entwickelte sich am Oberhang des Zhongzuimao, eines langgezogenen Rückens, eine schließlich 8 m hohe Terrasse.
Geoarchäologische Untersuchungen belegen, dass Mitglieder der frühneolithischen Yanshao-Kultur die natürliche Vegetation rodeten und größere Gärten anlegten. Damals lag an der Geländeoberfläche ein etwa anderthalb Meter mächtiger intensiv roter, lehmiger Boden. Er wurde in der früh- und mittelneolithischen Phase des Gartenbaus über mehrere Jahrtausende hinweg durch viele Starkregen vollständig abgetragen. Der unter dem Boden liegende hellgraue, kalkhaltige Löss gelangte dadurch an die Oberfläche. Er ist zwar nährstoffreicher, sein Wasserhaltevermögen ist jedoch geringer. Damit waren die in den Gärten gedeihenden Kulturpflanzen nach dem Abtragen des roten Bodens stärker der Trockenheit ausgesetzt. Die trockenheitsbedingte Grenze des Regenfeldbaus verschob sich durch die Bodenerosion nach Südosten in die etwas niederschlagsreicheren Gebiete.
Gesellschaftlicher Wandel in China
Wahrscheinlich schon vor mehr als 3500 Jahren entwickelte sich das chinesische Feudalsystem. Die Grundbesitzer, die ihr Land selbst nutzten oder verpachteten, blieben über lange Zeit in ihren Dörfern weitgehend autonom. Spuren früher harmoniegeleiteter Philosophie und Religion, insbesondere eines Ahnenkults, sind nachweisbar. Aus diesen bildeten sich spätestens ab dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert die Volksreligion des Daoismus und der mit einem strengen Sittenkodex verbundene Konfuzianismus. Ab dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert fasste der Buddhismus in China Fuß. Im 7. Jh. wurde er neben dem Daoismus zur wichtigsten Religion.
Ein absolutistischer, von einem Kaiser regierter Zentralstaat mit einem auf gelehrter Bildung beruhenden Beamtenapparat löste das Feudalsystem ab. In der Kaiserzeit von 221 v. Chr. bis 1911 n. Chr. war der Konfuzianismus Staatsdoktrin. Grundherren und Bauern verloren ihre Freiheiten und wurden vom Zentralstaat abhängig. Missernten führten, wie in allen Agrargesellschaften, immer wieder zu Hungersnöten. Erst im 19. Jh. erschütterten europäische Kolonialmächte mit ihren ökonomischen Interessen das chinesische Kaiserreich. Im Jahr 1911 brach es schließlich zusammen. Eine krisenreiche republikanische Zeit folgte, die in Verbindung mit dem Überfall Japans und dem Zweiten Weltkrieg der Kommunistischen Partei Chinas den Weg ebnete. Am 1. Oktober 1949 rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus. Ein vollkommen andersartiges Agrarsystem resultierte aus den Reformen der 1950er-Jahre.
Etwa um 3000 v. Chr. änderte sich die Landnutzungsstruktur. Die Gärten wurden wesentlich verkleinert. Ein Garten war nur noch etwa 600 m2 groß. Die Grenzen zwischen den neuen, kleineren Gärten lagen entlang der Höhenlinien als schmale, von Gräsern und Kräutern bedeckte, ganz leicht erhöhte Säume. Oberhalb abgespülte Bodenpartikel lagerten sich an der Gartengrenze ab, da das Gefälle hier geringer war. So wuchs dort allmählich eine Terrasse auf. Vor etwa 4700 Jahren riss der konzentrierte Abfluss eines sehr heftigen Regens eine anderthalb Meter breite, kastenförmige Schlucht in diese Terrasse. Die Menschen konnten zunehmend auch mit den Abflüssen extremer Starkregen umgehen. Sie warfen per Hand Löss in die Schlucht, stampften diesen und häuften einen flachen Wall auf. Damit verhinderten sie, dass sich eine neue Schlucht in der Füllung der alten bilden konnte.
Über 3500 Jahre und alle gesellschaftlichen Wandlungen hinweg bis zum Beginn der kommunistischen Zeit wurde an der Terrasse auf dem Zhongzuimao nahezu unverändert Gartenbau betrieben. Der Boden wurde mit der Hand bearbeitet, bis in die 1950er-Jahre wurde kein Pflug eingesetzt. Die Terrasse wuchs langsam und beständig. Mitte des 20. Jh. erreichte sie eine Höhe von 7 m und eine Breite von 80 m. Die Terrassenentwicklung belegt, dass die beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen keinen bedeutenden Einfluss auf den Landbau hatten. Kein einziger der zahlreichen extremen Starkregen tiefte über 3500 Jahre auch nur eine Rille ein. Die anthropogen geprägte Landschaft hielt stand, wahrlich eine erfolgreiche nachhaltige Bodenbewirtschaftung.
Diese nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens im Lössplateau endete 1958 mit der Massenkampagne »Großer Sprung nach vorne« der Kommunistischen Partei Chinas. 99% der Bauernfamilien wurden in Volkskommunen reorganisiert, riesigen Agrarstaatsbetrieben mit Tausenden bis Zehntausenden Mitgliedern (vgl. S. 152).). Das neue Agrarsystem führte zu einer Vergrößerung der Schläge und zu verminderter Aufmerksamkeit für Maßnahmen des Bodenschutzes. Die Bodenerosion explodierte erstmals im Sommer 1959. Von 1959 bis 2002 lagen in der Umgebung des Zhongzuimao die Bodenerosionsraten – ohne eine signifikante Erhöhung der Starkregenhäufigkeiten und -intensitäten – um das 50- bis 200-fache über denjenigen der Jahrhunderte vor 1959. (BORK & DAHLKE, 2006)
Um den Weitertransport des erodierten fruchtbaren Lösses und Schäden durch Ablagerung am Unterlauf des Gelben Flusses und an der Küste des Gelben Meeres zu mindern, wurden in den Auen der kleinen Flüsse unterhalb des Zhongzuimao (und in vielen weiteren Auen im Lössplateau) Erddämme ohne Durchlass oder gesicherten Überlauf angelegt. Ein großer Teil des abgetragenen Materials setzte sich in den Stauräumen oberhalb der Erddämme ab. Manche Reservoire füllten sich innerhalb von nur zwei bis drei Jahren. Dann wurden die Dämme überflutet und durch Erosion zerrissen. Neue, höhere Dämme wurden errichtet. Die Vorgänge von Verfüllung, Überflutung und Zerstörung wiederholten sich. Ein Erddamm unterhalb des Zhongzuimao war schließlich 17 m hoch. Immer wieder wurde versucht, die aufwachsenden ebenen Reservoirböden ackerbaulich zu nutzen. Doch fast jedes Jahr vernichteten die Abflüsse einen Teil der Kulturpflanzen in den Reservoiren.
Vor anderthalb Jahrzehnten begannen schließlich nationale Bemühungen um einen effektiven Bodenschutz. In der Umgebung des Zhongzuimao wurden ortsferne, schlecht zugängliche Oberhänge aufgeforstet und deren Beweidung untersagt – nicht immer erfolgreich. Wege wurden zu anderen, besser erreichbaren Oberhängen geschoben, um mit Maschinen hohe Terrassen für den Gartenbau anlegen zu können. Hier treten seitdem an den instabilen unbewachsenen Terrassenwänden neben Bodenerosion auch Rutschungen auf. An Mittelhängen etablierte Obstbaumkulturen bieten keinen Bodenschutz, da die Oberfläche vegetationsfrei gehalten wird. In der Bilanz haben diese Maßnahmen die Bodenzerstörung weiter gefördert. Wie könnte sie gemindert werden? Eine an die lokalen Bedingungen angepasste Ausbildung in Bodenschutz für Bäuerinnen und Bauern, die dann die Verantwortung für ihren Boden übernehmen, könnte längerfristig die dramatische Bodenzerstörung mindern und eine neue Phase nachhaltiger Nutzung einleiten.
Durch NACHHALTIGEN GARTENBAU über mehr als 4.000 Jahre aufgewachsene TERRASSE bei Yanjuangou im nordchinesischen Lößplateau.
INTENSIVE BEWEIDUNG IN STEILLAGEN fördert starke Bodenerosion im nordchinesischen Lößplateau.
Spanien seit dem Neolithikum
Die Iberische Halbinsel wurde ab dem Neolithikum vielfältig genutzt. Zuerst dominierte Tierhaltung mit Ackerbau, danach wurden Ackerbau und Tierhaltung betrieben sowie Bäume genutzt. Diese Integration von Bäumen in die Landnutzung bereicherte entscheidend. In Abhängigkeit von der Lage und den lokalen Standortbedingungen wurden Eichen gefördert, Weinstöcke, Oliven-, Walnuss- oder Kastanienbäume gepflanzt. Die dreigliedrige Subsistenzstrategie erforderte eine komplexe Organisation und erhöhte zugleich die Ernährungssicherheit – Witterungsextreme wie Starkregen, Dürren und ungewöhnliche Nässe schädigten meist nur ein oder zwei Komponenten. (BUTZER, 2005: 1775)
In guten Jahren konnten die Oliven- und Weinerträge den Subsistenzbedarf übertreffen. Nach der Einführung der Ölpresse und von Techniken zur Herstellung von Wein konnten die Produkte, die nunmehr länger als Getreide haltbar waren, auch vermarktet werden. Das dreigliedrige System brachte damit neben einer Risikominderung ökonomische Vorteile. Die Voraussetzungen für die Entwicklung komplexer, strukturierter Gesellschaften mit Spezialisierung sowie (über-)regionalem Handel und Urbanisierung waren gegeben. Wein und Öl aus Palästina wurden bereits um 3200 v. Chr. in versiegelten Gefäßen vom ägyptischen Hof importiert – in einer Zeit starken Bevölkerungs- und ökonomischen Wachstums. Im 14. vorchristlichen Jahrhundert entstand ein vergleichbares Produktions- und Handelssystem in Griechenland. (BUTZER, 2005: 1775f.)
Überschüsse an Getreide, Wein oder Olivenöl in Verbindung mit Bergbau und Metallverarbeitung sowie die Verfügbarkeit von Holz für den Schiffsbau in einzelnen Regionen wurden die Grundlage eines Seehandels, der sich über das Mediterrangebiet und bis Indien erstreckte. Die dreigliedrige mediterrane Landnutzungskultur mit regional unterschiedlichen Produkten war Teil eines überregionalen ökonomischen Informations-, Produktions- und Handelssystems geworden, das auf der ungleichen räumlichen Verteilung von natürlichen und humanen Ressourcen beruhte. Soziale Ungleichheit war eine weitere Voraussetzung. Sklaverei und andere Formen von Zwangsarbeit waren Teil des Systems.
Längere Blütezeiten um 3000 v. Chr., 1300 v. Chr. und 100 n. Chr. wurden von Phasen des Niedergangs unterbrochen. Städte und Siedlungen wurden verlassen, die Agrartechnologie wurde wieder einfacher, die Kulturflächen kleiner. Entsprechend war auch das politisch-ökonomische System schlichter organisiert. Diese Entwicklung ist an vielen Orten nachweisbar. Die Zyklen waren menschgemacht, durch Kriege, Zerstörungen und Unruhen verursacht. (BUTZER, 2005: 1775ff.)
In günstig gelegenen Landschaften des Mittelmeerraumes mit fruchtbaren Böden begann bereits im Neolithikum oder in der Bronzezeit mit Waldrodungen und anschließender agrarischer Landnutzung ein gravierender Rückgang der Artenvielfalt und starke, bald ertragsmindernde Bodenerosion. Die weniger bekannte Entwicklung in Spanien zeigt, dass sich langfristig nachhaltige Tierhaltungssysteme auch sekundär bilden können, und ist daher besonders interessant. In den neolithischen agro-pastoralen Kulturen dominierte die Weidewirtschaft, Ackerbau hatte nur ergänzende Funktion. Pollen- und Holzkohleanalysen belegen, dass im späten Neolithikum und in der Bronzezeit mit der Beweidung eichenreicher Wälder, die auf Standorten mit geringer Bodenfruchtbarkeit wuchsen, und der Entnahme anderer Gehölzarten begonnen und die ursprüngliche Waldvegetation dadurch wesentlich verändert wurde. Bis zur Römerzeit besaßen die intensiv beweideten lichten, immergrünen Eichenwälder große Bedeutung. In der Spätantike ging die Bevölkerungsdichte in der Extremadura und im westlichen Andalusien zurück. Sukzession führte zu neuen geschlossenen Wäldern. (STEVENSON & HARRISON, 1992; CLÉMENT, 2008).
Ab 711 n. Chr. kamen große Teile der Iberischen Halbinsel unter arabische Herrschaft – aus Al Andalus kennen wir komplexe Bewässerungssysteme und eine hoch entwickelte gartenbauliche Bewirtschaftung; Flachs und Getreide sind neben Oliven vielfach nachgewiesen. Nach der Rückeroberung des südwestlichen Spaniens von den Mauren in der ersten Hälfte des 13. Jh. durch die Christen wurde die waldreiche Extremadura wieder besiedelt. Die spanische Krone überließ den Ritterorden von Alcántara, Calatrava und Santiago, die sich bei der Rückeroberung Verdienste erworben hatten, fast 20.000 km2 Land. Diese nutzten es vorwiegend als Waldweide. König Alfonso X. vergab weitreichende Privilegien an den 1273 gebildeten »Ehrenwerten Rat der Mesta«, eine Vereinigung von Schafzüchtern. Sie durften ihre Schafherden in sämtlichen Wäldern des Königs weiden lassen, ein Wanderweidesystem (Transhumanz) etablierte sich. Gegen Ende des 15. Jh. stellten sich die Territorien des »Ehrenwerten Rates der Mesta« als umhegte, parkartig beweidete Wälder mit etwa 2,7 Millionen Schafen dar. Im Sommer weideten sie im Norden, im Winter im Süden. Wolle war das wichtigste Produkt. In den eichenreichen Wäldern war ein silvo-pastorales Wirtschaftssystem entstanden. Es wird in Spanien als Dehesa und in Portugal als Montado bezeichnet. (CLÉMENT, 2008: 72ff.).
In weiten Abständen wachsende Korkeichen (Quercus suber) oder Steineichen (Quercus ilex) mit breiten Kronen dominierten; zwischen ihnen gediehen Gräser und Kräuter. Isoliert stehende Eichen produzieren bis zu zehnmal mehr Eicheln als in geschlossenen Wäldern wachsende. Von großer Bedeutung waren die Jagd und die Beweidung mit Ziegen, Schafen, Rindern und Schweinen. Trüffel und Honig wurden gesammelt, Feuerholz und Blattgrünfutter durch die regelmäßige Beschneidung der Eichen und die Entfernung aufkommender Gehölze gewonnen. Ein Teil des Holzes wurde verkohlt. Bis in das späte 20. Jh. war die Nutzung der Korkrinde ertragreich. In größeren Zeitabständen wurden, auch zur Beseitigung aufkommender Gehölze, in manchen Bereichen der parkartigen Eichenwälder Weizen, Gerste, Hafer oder Roggen angebaut. (PLIENINGER et al., 2003; PLIENINGER et al., 2004; SCHAICH et al., 2004)
Der in den 1950er-Jahren beginnende sozioökonomische Wandel erfasste auch diese Hutewälder. Verbraucher ernährten sich anders; Importwaren verdrängten einheimische Produkte. Mit dem Verfall des Wollpreises verlor die Schafhaltung an Bedeutung. 1957 wurde die Afrikanische Schweinepest nach Portugal und Spanien eingeschleppt, mit gravierenden Folgen für die traditionelle Schweinehaltung. Die Einführung modernen Hochleistungsrassen, die in intensiver Weise gehalten werden, verhindert heute die Regeneration der Eichen weitgehend. Die zunehmende Versorgung mit Elektrizität und Gas beendete die Brennholz- und Holzkohlenutzung. Besser bezahlte Arbeitsplätze in den Industriegebieten Spaniens und der Europäischen Gemeinschaft begünstigten die Abwanderung und damit die Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzung an Marginalstandorten, die sich wieder bewaldeten. Die Rodung von Eichenwäldern wurde in Spanien zeitweise staatlich gefördert. Der Anbau von Getreide und Gemüse für den internationalen Markt wurde durch Mechanisierung und neue Bewässerungssysteme ausgeweitet. Diese Anbauform ist aufgrund des hohen Wasserverbrauchs problematisch.
(SCHAICH et al., 2004: 117; CLÉMENT, 2008)
EICHENHUTEWÄLDER im Süden Spaniens.
Eine präkolumbianische Erfolgsgeschichte
Im Amazonastiefland gibt es hochwasserfreies festes Land »Terra firme« und regelmäßig überflutete Flussauen »Várzea«. In der Terra firme sind intensiv verwitterte und extrem nährstoffarme Böden weit verbreitet. Bis in die Mitte des 19. Jh. glaubte man, dass in der Terra firme die äußerst geringe Bodenfruchtbarkeit und in der Várzea Überschwemmungen das Aufkommen nachhaltig produktiver Ackerbaukulturen verhindert hätten. Berichte spanischer und portugiesischer Expeditionen, die seit dem späten 16. Jh. den Amazonas und seine Nebenflüsse befahren hatten, bestätigten diese Auffassung. Sie fanden in den Tieflandregenwäldern nur wenige Menschen.
Frühere Aufzeichnungen des spanischen Dominikanermissionars Caspar de Carvajal (ca. 1500–1584) wurden dagegen als wenig glaubwürdig eingestuft. Carvajal hatte die Expedition des Konquistadors Francisco de Orellana 1542 als Kaplan begleitet. Orellana und seine Besatzung durchfuhren auf der Suche nach Zimtbäumen und nach El Dorado, dem sagenhaften Goldland, als erste Europäer das Amazonastiefland von Westen nach Osten. Carvajal beschrieb Kriegstaktiken, Rituale und Gegenstände der vorgefundenen Kulturen. Er erwähnte kilometerlange Siedlungen mit jeweils Tausenden Bewohnern auf hochwassersicheren Flussterrassen – das klang wie ein Märchen. Auch die Schilderungen der Mitglieder einer zweiten spanischen Expedition, die der mordend durch Amazonien ziehende Lope de Aguirre im Jahr 1561 anführte, geben Kenntnis von intensiv genutzten Kulturlandschaften. (DENEVAN & WOODS, 2007; CLEARY, 2001: 80f.)
Der US-amerikanische Naturforscher James Orton (1830–1877) erwähnte 1870 in Amazonien existierende schwarze und sehr fruchtbare Böden. Der kanadische Naturkundler Charles Frederic Hartt (1840–1878) skizzierte 1874 schwarze, von Menschen gemachte Böden im Raum Santarém. Hartts Assistent Herbert Smith beschrieb fünf Jahre später eine 30 Meilen lange, fast durchgängige Zone fruchtbarer schwarzer Böden mit viel Keramikbruch an der Oberfläche, die durch Abfälle Tausender Küchen über lange Zeit entstanden sei. Der böhmisch-österreichische Geologe und Mineraloge Friedrich Katzer (1861–1925) schließlich erklärte 1903 die schwarze Farbe mit dem hohen Humusgehalt und Holzkohlebeimischungen. Auch er nahm eine anthropogene Entstehung an. Seit den 1960er-Jahren wird zwischen schwarzer Terra Preta aus Siedlungsabfall und dunkelgraubrauner Terra Mulata, deren Bildung auf langanhaltende agrarische Nutzung zurückführen ist, unterschieden. Manche Terra-Preta-Areale sind mehrere Quadratkilometer groß, andere kaum einen Hektar. Terra Preta nimmt wohl etwa 0,1 bis 1% der Fläche des Amazonastieflandes ein und liegt damit zwischen der Größe von Luxemburg und Belgien. (SOMBROEK, 1966; SMITH, 1980; SOMBROEK et al., 2002; GLASER & WOODS, 2004; WOODS, 2005; DENEVAN & WOODS, 2007)
In den 1990er-Jahren begann die intensive Erforschung der Terra Preta und der untergegangenen Kulturen Amazoniens. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden wesentliche Geheimnisse der Terra Preta gelüftet. So wissen wir heute, dass die dunkelsten, bis über 2 m mächtigen, mit Holzkohle und Tonscherben durchsetzten Terra-Preta-Vorkommen Reste großer Abfallhaufen in Siedlungen sind, die über längere Zeiträume entstanden. Ausgedehnte Flächen mit bis zu etwa 60 cm mächtiger Terra Mulata umgeben oftmals diese Terra Preta. Auch die Relikte der Terra Mulata sind durch die Düngung mit Holzkohle in präkolumbischer Zeit bis heute fruchtbar. In den Terra-Mulata-Gärten wurde wahrscheinlich hauptsächlich Maniok angebaut. Das Geheimnis der Fruchtbarkeit liegt im Gehalt an organischem Kohlenstoff. Während Terra Preta davon 9% enthalten kann, sind im umgebenden Boden Gehalte von etwa 0,5% üblich. (FRASER & CLEMENT, 2008; WOODS & MCCANN, 1999)
An einer Straße bei Iranduba (Manaus, Brasilien) ist die dunkle TERRA PRETA gut zu erkennen.
Wie entstand Terra Preta? In einer sauerstoffarmen Umgebung schwelen Pflanzenteile bei niedrigen Temperaturen langsam zu Kohle. Diese bindet im Boden Nährstoffe, die ansonsten rasch durch Regen ausgewaschen worden wären. Und sie bietet Mikroorganismen langfristig ein vorzügliches Habitat. Die Zugabe von Holzkohlepulver kann den Ertrag von Sorghum um mehr als das Achtfache steigern im Vergleich zu Flächen, auf denen nur Mineraldünger, nicht aber Holzkohle zugegeben wird. (STEINER et al., 2004: 191)
TERRA PRETA wird in einer Bananenplantage bei Hatahara archäologisch untersucht (Amazonas, Brasilien).
Eine These geht von einem ausgeklügelten Nutzungssystem aus, das zur Bildung von Terra Preta führte (PIEPLOW, 2010): Möglicherweise wurden Fäkalien, Siedlungsabfälle und Holzkohle in große Tongefäße gefüllt und für die Fermentation luftdicht verschlossen; Milchsäure konservierte die organische Substanz. Um das fermentierte Substrat reifen zu lassen, wurden nach der Öffnung Bodenlebewesen in die Gefäße eingebracht – man impfte mit einer Handvoll schon fertiger Terra Preta. Die Töpfe wurden anschließend eingegraben und bepflanzt. Die pflanzliche Kohle bietet Mikroorganismen einen optimalen Nährboden. Mykorrhizapilze, die mit den Feinwurzeln der Kulturpflanzen in Symbiose leben, erschließen die Nährstoffe, deren Auswaschung durch die Nutzung von Gefäßen minimiert wird.
Die Entwicklung von Terra Preta durch Menschen der Tieflandkulturen Amazoniens begann – so schätzt man heute – vor etwa 7000 Jahren. Bis zum frühen 16. Jh. hatten sich auf Basis der von Menschen erhöhten Fruchtbarkeit strukturierte, Ackerbau treibende Gesellschaften etabliert. Als die ersten Spanier 1542 und 1561 n. Chr. das Gebiet durchfuhren, lebten dort wohl etwa 5 bis 10 Millionen Menschen. Vor allem die von den Europäern mitgebrachten Krankheitserreger rafften in kürzester Zeit die meisten Einheimischen dahin, sodass Expeditionen ab dem späten 16. Jh. nur noch Wald und wenige Menschen antrafen. (ROOSEVELT, 1996; DENEVAN, 1998)
Lässt sich die Erfolgsgeschichte der Terra Preta wiederholen? Ein großräumiger Einsatz der Terra-Preta-Technik würde aufgrund höherer Erträge erlauben, mit kleinerer Anbaufläche auszukommen. Erforderlich ist ein Pflanzenkohlegehalt von etwa 20 bis 30% in den Oberböden. Die Kohle kann auch aus pflanzlichen Abfällen wie den Schalen von Kokos- oder Erdnüssen gewonnen werden. (BALLIETT, 2007; GLASER, 2007)
Ein Hektar mit einen Meter mächtiger Terra Preta kann etwa 250 Tonnen Kohlenstoff speichern – im Vergleich zu ungefähr 100 Tonnen eines normalen Bodens aus demselben Ausgangsgestein. Allein die Differenz von 150 Tonnen ist größer als der Kohlenstoffgehalt der Pflanzen, die in einem Hektar Regenwald wachsen. Terra Preta ist demnach eine hocheffektive Kohlenstoffsenke. In einer Zeit erhöhter Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre interessiert der dadurch mögliche Entzug von Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Der deutsche Bodenchemiker Johannes Lehmann berechnete, dass mit Terra-Preta- und Biotreibstoff-Projekten bis zum Ende des 21. Jh. jährlich etwa 9,5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gebunden werden könnten – mehr als heute durch die Nutzung fossiler Brennstoffe emittiert wird. Bislang fehlen allerdings technische Systeme, die eine preiswerte Großproduktion von Terra Preta ohne schädliche Beimengungen ermöglichen (GLASER et al, 2001; LEHMANN et al., 2006; MARRIS, 2006).
Terra Preta war in den Händen der lokalen Bevölkerung eine langfristige, in eine regionale Ökonomie eingebettete Erfolgsgeschichte. Vielleicht hat ihre Fortsetzung schon begonnen. Aber Sorgfalt tut not, will man lokal angepasste Verfahren in weltweitem Maßstab betreiben – allzu leicht kann es zu bislang unbekannten Nebenwirkungen kommen.
Von der Römischen Republik bis in das Spätmittelalter
Fisch war in der römischen Antike ein wichtiges Nahrungsmittel. Im 2. vorchristlichen Jahrhundert zogen römische Bauern Fische in kleinen, mit Süßwasser gefüllten Becken. Meeresfische wurden ab dem ersten vorchristlichen Jahrhundert als Speise wohlhabender Römer in befestigten Becken mit Meerwasser an den mittelitalienischen Küsten gezüchtet. In die Wände der Bassins wurden Tongefäße eingemauert, um bestimmten Fischarten Schatten und damit Schutz vor der intensiven Sonneneinstrahlung zu bieten. Gehalten wurden wohl unter anderem Seebarsche, Muränen, Plattfische und Meeräschen. Mit bronzenen Gittern versehene, ausgereifte Zu- und Ableitungssysteme sorgten für ausreichend Frischwasser.
Ab der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts ließen einige exzentrische Mitglieder der römischen Oberschicht wertvolle Zierfische in Becken mit Meerwasser halten. Der Censor Marcus Licinius Crassus soll als erster Muränen gezähmt haben, die er mit Schmuck verzierte. Dafür wurde er später von konservativen Mitgliedern der Oberschicht als dekadent verachtet. Doch hielt sich die Mode der Zierfischhaltung mehr als ein Jahrhundert. Die Teichwirtschaft hatte die Oberflächenformen, die oberflächennahen Gesteine und die Böden an den flachen, sandigen Abschnitten vorübergehend und an den felsigen Abschnitten der mittelitalienischen Küsten langfristig verändert. Die Kenntnisse der Römer zur Nutz- und Zierfischhaltung gerieten allerdings bald in Vergessenheit. (SCHMÖLCKE & NIKULINA, 2008)
In der späten Römischen Kaiserzeit und in den ersten Jahrhunderten des Frühmittelalters nahm die Bevölkerungsdichte nördlich der Alpen – befördert durch häufig kühle, feuchte und damit für den Ackerbau ungünstige Witterung – durch Seuchen und Migration wesentlich ab. In Mitteleuropa begann damit die letzte Phase ausgedehnter naturnaher Waldentwicklung. Der hohe Wasserverbrauch der sich ausbreitenden Gehölze ließ die Grundwasser- und Seespiegel sinken. Der mittlere Abfluss nahm ab und extreme Hochwasser wurden sehr selten. Anthropogene Kontaminationen betrafen nur noch die verbliebenen Siedlungsstandorte. Klares, sauberes Wasser bewegte sich in vielen Bächen und Flüssen meerwärts. Störe (Acipenser sturio), Alsen (Alosa alosa und Alosa fallax), Forellen (Salmo trutta), Flussbarsche (Perca fluviatilis), Hechte (Esox lucius) und andere Fischarten eroberten ihren Lebensraum von Ost- bis Westeuropa zurück. Viele Vogel- und Säugetierarten folgten ihnen als Prädatoren. Und die Menschen vermochten die Subsistenzfischerei zu intensivieren – mit der Christianisierung stieg der Fischkonsum an Freitagen und in der Fastenzeit an.
Illegalen Muschelfischern, die nach Perlen suchten, drohte die auf der Warntafel dargestellte drakonische Strafe. Spätestens 1641 waren derartige WARNTAFELN an den Ufern von Schwienau und Gerdau angebracht. Nur beamtete Perlenfischer im Auftrag des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg durften hier Muscheln ernten. (Kloster Ebstorf)
Im 8., 9. und 10. Jh. begann die Bevölkerung zunächst in Gebieten mit ertragreichen Böden zu wachsen. Die verbliebenen Wälder wurden weiträumig gerodet, um Ackerbau zu betreiben. Im Hochmittelalter wurden auch Standorte mit sandigen oder tonig-lehmigen Böden und in den tieferen Lagen der Mittelgebirge nördlich der Alpen intensiver genutzt. Hinzu kam dort die Grünlandnutzung. Im 14. Jh. nahm die Zahl der Menschen in Mitteleuropa durch ungünstige Witterung sowie durch Erosions- und Überschwemmungskatastrophen mit Ertragsausfällen und Hungersnöten sowie vor allem durch die Pestpandemie Mitte des 14. Jh. wohl um fast die Hälfte ab. (BORK et al., 1996; vgl. S. 20 und S. 22)
Die Ausbreitung intensiver Landnutzung im Laufe von Früh- und Hochmittelalter ließ die Grundwasserspiegel steigen, erhöhte den mittleren Abfluss und ermöglichte häufigere und stärkere Überschwemmungen. Gravierende Bodenerosion auf den steilen Hangabschnitten bedingte Ablagerungen auf den Unterhängen und in den Auen. Die Wasserqualität verschlechterte sich erheblich. Dessen ungeachtet blieb die Nachfrage nach Fisch hoch.
Eine Erfindung der Spätantike, die Mühle, begann begann im 10. Jh. ihren Erfolgszug von England und Frankreich über Deutschland, Italien und Polen bis nach Osteuropa. Sie ermöglichte eine starke Ausdehnung der Fischzucht. Zehntausende Wassermühlen zum Mahlen von Getreide wurden mitsamt der wasserzuführenden Mühlengräben und Mühlenstaus errichtet. Bäche und Flüsse wurden dabei stark verändert. Neue Habitate entstanden in den Mühlengräben mit langsam fließendem Wasser und in den Teichen der Mühlenstaue. Die Durchlässigkeit für flussaufwärts oder flussabwärts zu ihren Laichgebieten wandernde Fischarten endete mit dem Mühlenbau. Bald darauf klagen Chronisten über den Mangel an Lachsen in Schottland und am Niederrhein. Der Eintrag von Fäkalien, die Abwässer von Walkmühlen, Gerbereien, Brauereien und Flachsbearbeitung sowie die Schlachtung von Tieren an Ufern verschlechterten die Lebensbedingungen auch vieler stationärer Fischarten in den meisten Fließgewässern dramatisch. Zwar konnten sich viele arme Menschen kaum Fisch leisten; sie lebten hauptsächlich von Getreideprodukten. Vor allem Adlige, Mönche und Nonnen konsumierten regelmäßig Fisch. Der in vielen zeitgenössischen Quellen erwähnte, durch die Eingriffe bewirkte Niedergang der Binnenfischerei traf jedoch die zahlreichen Fischerfamilien hart.
Bereits im 8. Jh. waren in Mitteleuropa einzelne Teiche angelegt worden. Im 11. und 12. Jh. nahm die Bedeutung der Fischzucht in Teichen vor allem in den dicht besiedelten Regionen Europas zu. Die Nutzung von Mühlteichen und vor allem die Neuanlage von Teichen zur Fischzucht und ihre Bewirtschaftung durch erfahrene Fischer lösten die entstandenen Versorgungsprobleme. Fischarten, die in nährstoffreichen, warmen stehenden Gewässern zu laichen und gut zu wachsen vermochten, wurden in Mitteleuropa bevorzugt vermehrt. Fischteiche wurden im Hochmittelalter hauptsächlich auf Land eingerichtet, das weltlichen und geistlichen Grundherren gehörte. Aufgestautes Quell- oder Bachwasser oder abgeleitetes Flusswasser speiste diese Teiche. Nicht selten wurden nährstoffreiche Latrinenabwässer in die Teiche geleitet. Die Zu- und Abflüsse konnten spätestens ab dem 13. Jh. kontrolliert werden. Drei bis fünf Jahre nach dem Ansetzen von Laich oder dem Einbringen kleiner Fische wurde geerntet. Dazu wurde das Teichwasser abgelassen, der Schlamm beseitigt und der Teich eine Saison trocken liegen gelassen.
Die besten Teichbewirtschafter hielten Karpfen und Hechte: Zunächst wurden junge Karpfen einer Altersklasse eingebracht, die in den wenigen noch existierenden Wildflüssen gefangen oder als Brutbestände gezüchtet worden waren. Dann wurden Hechte eingesetzt, die die Nachkommen frühreifer Karpfen fraßen, ehe die Brut mit ihren Eltern um die Nahrung konkurrieren konnte. So waren in Mittel- und Westeuropa während des hohen Mittelalters unter Umgehung kontaminierter natürlicher Fließgewässer und Seen unzählige kleine, ertragreiche Stillwasserökosysteme durch Menschenhand entstanden. Manche wurden unter Konservierung der Formen im Laufe der Neuzeit mit Sedimenten vollständig überdeckt; sie sind im Verborgenen erhalten geblieben, manche existieren bis heute. (HOFFMANN, 1996)
Innenansicht der GROTTE DI PILATO (Höhlen des Pilatus). MURENARIO (Muränenfarm) auf der Insel Ponza im Tyrrhenischen Meer (1. Jh. n. Chr.). Vier aus der Steilküste gehauene Becken sind über kleine Tunnel verbunden, gegen das Meer sind sie über dem Meeresspiegel offen; unter diesem liegen verschließbare Kanäle.
Landwirtschaft in Eis und Schnee?
Waren die aus Island stammenden Grönländer im Mittelalter unfähig, sich an ihre neue Umwelt dauerhaft anzupassen? War die erstarkende Hanse daran schuld, dass keine Schiffe aus Norwegen mehr anlegten, um Eisen und andere dringend benötigte Ressourcen zu liefern - Ressourcen, ohne die die kleine Wikingerkolonie schwerlich auskommen konnte? Warum endete die europäische Besiedlung der arktischen Insel um das Jahr 1410? Jared Diamond (2011) hat dem Kollaps von Gesellschaften ein ganzes Buch und Grönland ein Kapitel gewidmet. Darin erklärt er das Ende der europäischen Besiedlung mit der Unfähigkeit der Siedler, sich wie die Inuit an die Umweltbedingungen erfolgreich anzupassen. Stur seien sie bei Ackerbau und Viehhaltung verblieben, die bei immer kälterem Klima immer schwieriger wurden – statt wenigstens Angelhaken zu schnitzen und ihre Subsistenz aus dem Wasser zu holen. Themen wie das Aussterben der Dinosaurier oder der »Kollaps« der Kultur der Maya auf Yukatan oder eben der europäischstämmigen Grönländer im frühen 15. Jh. üben auf viele Menschen eine große Faszination aus. Die Geschichte der europäischen Besiedlung Grönlands ist jedoch alles andere als eine Untergangsgeschichte.
Erik der Rote segelte um 985 n. Chr. mit einer Flotte von 25 Schiffen von Island nach Grönland. Einige erlitten Schiffbruch, andere kehrten um; immerhin 14 erreichten ihr Ziel. Sie fanden im Süden der größten Insel der Erde von Moosen bedeckte Landschaften mit Birken, Weiden und Mooren vor. Die Situation war ähnlich wie in ihrer Heimat. Die Kolonisten gründeten in einem südgrönländischen Fjord die Siedlung Garðar (heute Igaliku), die später auf 400 Häuser anwachsen sollte. 1124 wurde sie zum Bischofssitz mit Kathedrale. Der erste Bischof traf 1126 ein, der letzte bekannte, Alfur, starb 1378. Die letzte schriftliche Quelle aus Garðar ist ein Heiratsaufgebot aus dem Jahr 1409. Es gelang der kleinen Siedlergemeinschaft, mehr als vier Jahrhunderte unter harten Bedingungen durchaus gut zu (über-)leben. Die Neugrönländer bezahlten ihren Zehnten an die Kirche in Luxusgütern wie Walrosselfenbein, Häuten und Pelzen. Der Stall des Bischofssitzes konnte 100 Stück Vieh beherbergen.
Die Mär von der Weigerung der aus Island stammenden Grönländer, Fisch zu essen, ist widerlegt; archäologische Untersuchungen brachten Fischreste zutage; eine der Küstensiedlungen hat, so ist zu vermuten, besonders dem Kabeljaufang gedient. Die Wikinger hätten ohne die Nutzung des Kabeljaureichtums kaum so lange auf Grönland überleben können. Wie in Island und Norwegen üblich, trockneten sie den im Mai und Juni gefangenen Kabeljau zu Stockfisch. Diese lang haltbare Nahrung ergänzten sie mit Kulturpflanzen und Produkten von Rindern, Schafen und Ziegen. Sie kultivierten Flachs und Wurzelgemüse; Getreide reifte jedoch nicht. Auf Seehunde und Karibus machten sie Jagd. Die Überwinterung des Viehs erforderte eine aufwendige Heuwirtschaft. Die rasche Rodung der Birken und Weiden in der Umgebung der Siedlung Garðar zugunsten von Weiden und Wiesen ist archäobotanisch nachgewiesen.
Für die Ländereien des Bischofs lässt sich dank archäologischer, pollenanalytischer und paläoentomologischer Untersuchungen trotz fehlender Schriftquellen gut rekonstruieren, wie die Heuernte maximiert wurde. Wie jede andere von der Bodenfruchtbarkeit abhängige Gesellschaft mussten die Grönländer die dem Boden durch Heu entzogenen Nährstoffe wieder zuführen, um eine Abnahme der Erträge zu vermeiden. Wie andere Viehhalter düngten sie ihre Wiesen offenbar mit allem, was zu finden war: nachweisbar mit den Exkrementen ihrer Nutztiere und dem Abfall, der in den Häusern gesammelt wurde, und wohl auch mit Fischeingeweiden. Dank der ausgezeichneten Erhaltungsbedingungen kann durch den Fund von Fliegenmaden, bearbeiteten Holzstückchen und anderen archäologischen Kleinfunden die These erhärtet werden, dass Material aus Haus und Stall auf die Wiesen gebracht wurde. Der Fund spezialisierter Parasiten erlaubt zudem den Rückschluss auf die Ausbringung von Abfällen der Wollproduktion und menschlicher Exkremente. Die Bodenfruchtbarkeit wurde vermutlich auch erheblich erhöht, weil die Siedler Plaggen (Grassoden mitsamt humosem Boden) an Hängen abgestochen und an Feuchtstandorten in der Nähe der Gehöfte aufgebracht haben. Diese Plaggenwirtschaft ermöglichte den Grönländern eine wohl meist ausreichende Heuproduktion, um die Herden über den Winter zu bringen und sie hinterließ eindeutige Zeugnisse im Boden. Viele Befunde weisen darauf, dass die Wiesen des Bischofs ausgezeichnet mit Nährstoffen versorgt wurden; zudem waren sie im Sommer oft sehr feucht. Einige sommertrockene Standorte mit guten Böden wurden bewässert. Bereits zu Beginn des 20. Jh. waren Reste von Dämmen an einem Wasserlauf gefunden worden, der die Siedlung Garðar durchzieht. Das Grabensystem der bischöflichen Wiesen konnte ebenfalls teilweise rekonstruiert werden.
Hausfundamente der ehemaligen WIKINGERSIEDLUNG Brattahlíð im Süden Grönlands.
THJODHILDS KIRCHE. Rekonstruktion der Kapelle bei Brattahlíð. Die Kapelle war vermutlich das erste christliche Kirchengebäude in der Neuen Welt.
Warum mussten aber auf Grönland Standorte bewässert werden? Sommertrockenheit ist ein Merkmal der Hänge des subarktischen Ökosystems Südgrönlands und ein stark limitierender Faktor der Heuproduktion. Auf feuchten Wiesen kann erheblich mehr pflanzliche Biomasse erzeugt werden als auf trockenen. Da mit der Sense geerntet wurde, störte die erzeugte Nässe nicht. Weder niedrige Temperaturen noch eine kurze Vegetationsperiode begrenzten den Heuertrag, sondern der Mangel an Wasser im Sommer. Dem wurde mit Bewässerung abgeholfen.
Das komplexe System von Düngung und Bewässerung war wahrscheinlich keine Erfindung der Siedler im Süden Grönlands. Die Norweger hatten schon zuvor ähnliche Verfahren entwickelt. Mit dem ersten Bischof kam diese Innovation nach Grönland. Er war auch imstande, die nötige Arbeitskraft aufbringen zu lassen, denn die Erhöhung der Produktivität wurde mit beträchtlichem Arbeitsaufwand erkauft. Davor wurde, auch das zeigen die Bodenprofile, an dieser Stelle eher Torf gewonnen als Heuernten maximiert.
Auch die grönländische Viehwirtschaft beruhte auf der Kombination verschiedener Landnutzungsweisen. Eine so arbeitsaufwendige Bodenbearbeitung wie auf den Wiesen des Bischofs war nicht an vielen weiteren Standorten möglich. Rodungen in Tasiusaq, 20 km nördlich von Garðar, und die nachfolgende Landnutzung führten zur Abnahme der Verdunstung, zur Vernässung und Torfbildung an Talstandorten. Palynologische und paläoentomologische Untersuchungen belegen dort die Beweidung einer Fläche, die jedoch weder bewässert noch zusätzlich gedüngt wurde. Gelegentlich mag Heu geschnitten worden sein. Diese Nutzung war wohl typisch für weit vom Hof entfernte Flächen. Die Bodenprofile lassen zudem auf Torfgewinnung schließen, da die Torfe bestimmter Zeitabschnitte fehlen. Die Befunde aus Bischofssitz und Bauernhof ergänzen einander und belegen die Vielfalt der Nutzungsweisen.
Ebenso plötzlich wie gezielte Düngung und Bewässerung begonnen hatten, hörten sie wieder auf, wie der Aufbau der Bodenprofile zeigt. Ob aus dem plötzlichen Ende der intensiven Landwirtschaft auf das abrupte Ende der Besiedlung geschlossen werden kann, ist unklar. Vielleicht segelten die Nachfahren der ersten Siedler mit dem Hochzeitspaar von 1409 zurück nach Island. Ihre Spur verliert sich. Dass sie hilflos und elend zugrunde gegangen wären, darf bezweifelt werden. Vielleicht lockte grüneres Gras anderswo. Der Handel mit Walrosselfenbein war durch den steigenden Import von afrikanischem Elfenbein nach Europa vermutlich weniger lukrativ geworden; damit mag die ökonomische Basis sich verschlechtert haben. Die Witterungsverhältnisse waren bereits seit dem frühen 14. Jh. ungünstiger für Ackerbau und Tierhaltung; dennoch gelang über ein Jahrhundert offenbar eine ausreichende Anpassung. Beweise für kriegerische Auseinandersetzungen, Seuchen oder witterungsbedingte Hungersnöte fehlen. Die Nachfahren der aus Island stammenden Grönländer sind ausgewandert – ohne Nachricht zum Warum und Wohin zu hinterlassen. Dieses Rätsel hat zu vielen Theorien geführt. Interessanter als der Niedergang ist das lange Überleben der Isländer auf Grönland, das sie auch ihrer avancierten und gut an die besonderen lokalen Standortbedingungen angepassten Bewirtschaftungstechnik verdankten.
Die Siedlung Garðar, die über so lange Zeit Hunderte Familien ernährt hatte, wurde im 18. Jh. wieder entdeckt und neu besiedelt.
(BUCKLAND et al., 2009; DUGMORE et al., 2007; PANAGIOTAKOPULO et al, 2012; PANAGIOTAKOPULO et al, 2012; PANAGIOTAKOPULO und BUCKLAND, 2012; PERREN et al., 2012)
Die Umweltgeschichte der Niederlande
Vor etwa 5000 Jahren erreichte der Meeresspiegel fast seine heutige Höhe. An flachen Küsten wie der niederländischen verlagerte sich die Küstenlinie in den folgenden Jahrtausenden immer wieder. Menschen, die hier hauptsächlich vom Jagen, Fischen und Sammeln lebten, hatten sich an diese Dynamik angepasst. Neben den großen Flussmündungen von Rhein, Maas und Schelde und den Ausgleichsküsten mit aufgesetzten Dünen prägten ausgedehnte Moore die niederländischen Küstenlandschaften. Hochmoore entwickelten sich kissenförmig bis zu 5 m hoch auf den Ablagerungen der Flüsse Frühe Küstensiedlungen wurden dort errichtet, wo das Land etwas höher lag – seit den ersten nachchristlichen Jahrhunderten auch auf eigens geschaffenen Hügeln, den Wurten oder Warften. Die Römer, zu deren Imperium zwischen 50 und 400 n. Chr. der südlichste Teil der Niederlande gehörte, hatten dort erste Kanalbauten angelegt und im Wesentlichen die ausgedehnten Rheinauen als natürliche Grenze genutzt. Ab dem 9. Jh. kam es dann zu den Eingriffen, deren Nebenwirkungen die Niederlande bis in die Gegenwart prägen sollten. Unter dem Einfluss fränkischer Oberschichten begannen die Friesen, die das Gebiet zunächst für Vogelfang, Fischfang und ein wenig Viehhaltung genutzt hatten, mit dem Getreideanbau. Dafür wurden Moore trockengelegt. Hochmoore wachsen im humiden gemäßigten Klima langsam, aber stetig. Ihr innerer, höchster Teil ist unfruchtbar, nährstoffarm und hauptsächlich von Moosen bewachsen. Die Ränder sind etwas nährstoffreicher, hier wachsen Birken und Sträucher. Werden die Moorränder entwässert, entsteht dort mäßig fruchtbarer Ackerboden. Dafür braucht es keine großen technischen Bauten, weil das Wasser aus den hohen Moorkissen durch Schwerkraft abfließt. Da Moore zu etwa 90% aus Wasser bestehen, schrumpft bei der Trockenlegung ein Meter Torf auf nur zehn Zentimeter. Dieser Rest schrumpft fortan, weil die organische Substanz, die unter Luftabschluss im Moor in ihrer Struktur weitgehend erhalten bleibt, unter Sauerstoffeinfluss zu Mineralen abgebaut wird.
Maschine zum Anlegen von ENTWÄSSERUNGSGRÄBEN, Ost-Groningen, Niederlande. (Postkarte, 1920er-Jahre)
Die niederländischen Moore wurden dabei nicht von Anfang an bis zur ihrer Basis drainiert und so rasch um viele Meter geschrumpft. Vielmehr sanken sie durchschnittlich um etwa 1 cm pro Jahr, damit in einem Jahrhundert um 1 m. Die langsam versinkenden Niederländer mussten sich zunehmend durch Deiche vor den drohenden Sturmfluten schützen. Die Sturmflut von 1953 ist in das kollektive Gedächtnis als besonders dramatisch eingegangen, doch gab es in Abständen von einigen Jahrzehnten immer wieder bedrohliche Fluten. Schon im 14. Jh. wurden vielerorts Deiche und Schleusen gebaut. Die dafür nötigen organisatorischen Strukturen, die späteren Deichgenossenschaften, blieben bis weit in das 20. Jh. für die Erhaltung der Anlagen zuständig. Die Niederländer lernten viel über den Umgang mit dynamischem Wasser. Sie wurden in ganz Europa zu gesuchten Wasserbauexperten.
Die mittelalterlichen Eindeichungen waren durchaus erfolgreich. Bis ins 15. Jh. konnte etwa Holland, die zentrale Provinz der Niederlande, die Bevölkerung mit eigenem Getreide ernähren. Um 1500 aber waren die ehemaligen Hochmoore soweit abgesunken, dass sie das Grundwasserniveau erreichten – an nassen Standorten gedeihen aber weder Getreide noch Vieh. Die Nordsee, deren Wasserspiegel langsam weiter anstieg, lag schon fast auf gleicher Höhe wie die ehemals hohen Moore. Das führte dazu, dass bestehende Deiche erhöht und weitere gebaut werden mussten. In ihrer Ausdehnung schwankende Torfseen wurden zu wichtigen Landschaftsbestandteilen. Besonders heftige Stürme zu Beginn des 16. Jh. bewirkten südlich von Amsterdam eine Verbindung mehrerer großer Torfseen (im Niederländischen als »Meer« bezeichnet) zu einer riesigen Wasserfläche, dem Haarlemermeer. Dieses hatte durchaus malerischen Charakter. Flämische Landschaftsmaler wie Jan van Goyen verewigten das Miteinander von Wasser und Land.
Für die Bevölkerung war es aufgrund des zunehmenden Landmangels nach 1500 problematisch geworden, sich durch Landwirtschaft zu ernähren. Eine massive Abwanderung in die Städte folgte; damit war der Bedarf an Heizmaterial rapide gewachsen und Torf stand als Brennstoff zur Verfügung. Auch Bierbrauer, Ziegelöfen und Textilhersteller brauchten Torf, der zudem nach Antwerpen und in andere Städte in Flandern exportiert wurde. Viele Gemeinden hingen nunmehr ökonomisch völlig vom Torfabbau ab. Nachdem die Zentren der Moore, in denen der Torf mit dem besten Heizwert lag, abgebaut waren, kamen die weniger geeigneten Randgebiete an die Reihe. Zudem wurden zum Torftransport immer mehr Kanäle gebaut, die auch Deiche und Dämme durchstachen. Eine Kombination aus Sorglosigkeit, technischen Fähigkeiten und ökonomischer Marktlogik hatte trotz Verboten, Gerichtsverfahren und anderen Ordnungsversuchen zum Zusammenwachsen der Torfseen zum Haarlemermeer geführt. Die Stürme waren nur auslösend und nicht verantwortlich dafür.
Herstellung von TORFZIEGELN. (Postkarte nach 1928)
Der steigende Meeresspiegel und das Absinken des Landes führten dazu, dass die Grundwasserspiegel an oder gar über der Landoberfläche lagen: Seen und viele Flüsse flossen nur mehr ab, wenn der Wind in die richtige Richtung wehte. Die neuen Wasserflächen dienten der Entsorgung von Fäkalien und anderen Abfällen, damit drohten bei Regen gesundheitlich gefährliche Überschwemmungen. Daher wurde ab 1500 vermehrt mit den seit der Mitte des 15. Jh. errichteten Windmühlen, die heute zum touristisch geschätzten Bild der Niederlande gehören, Wasser abgepumpt. Der Wind war zum wichtigsten Helfer gegen die anthropogen bedingten Wasserprobleme geworden. Er wehte und weht in den Niederlanden verlässlich, allerdings zumeist vom Meer: Während die Gemeinden am Westufer der anthropogenen Wasserflächen einigermaßen sicher waren, wurden die Siedlungen am Ostufer der weichrandigen Torfseen von Erosion bedroht, einem Phänomen, das die Niederländer als »Waterwolf«, Wasserwolf, bezeichnen.
Die UMWELTGESCHICHTE DER NIEDERLANDE auf einen Blick: Von 1000 n. Chr. bis heute stieg der Meeresspiegel um etwa 1 m an, während die Landoberfläche der in den westlichen Niederlanden verbreiteten Torfe durch Entwässerung, Moorsackung und Torfabbau im gleichen Zeitraum im Mittel um etwa 4,5 m sank. Seit etwa 1600 n. Chr. liegt die mittlere Landoberfläche in den Moorgebieten unter dem Tidenniedrigwasser. Permanentes Abpumpen des Oberflächenwassers und seine Einleitung in das höhere Meer sind seitdem dort erforderlich. Dazu wurden zunächst Windmühlen und später maschinengetriebene Pumpwerke eingesetzt. Verändert nach VAN ASSELEN et al. (2009).
Viele Torfseen wurden trockengelegt und durch Eindeichung zu Poldern umgewandelt. Der erste, der Zijpepolder, wurde schon 1597 angelegt, das Gros folgte im 19. und 20. Jh. Bis zur Trockenlegung der Polder profitierten die Niederländer von einer positiven, nicht intendierten Wirkung der Seen: Diese boten Aalen gute Lebensbedingungen; Schleusen erwiesen sich als ideale Einrichtungen zum Fang der Fische. Wo es keinen Torf mehr gab, boten Aalfang oder die Heringsfischerei auf hoher See Einkommensquellen. Doch als die freien Niederlande nach der Abspaltung vom Habsburgerreich eine Handelsmacht wurden, gefährdete dies die Aale. Die Flotte der Niederländer brauchte Stoff für Segel. Daher wurde der Anbau von Flachs und Leinen forciert – Faserpflanzen, die erst durch Einweichen in Wasser verarbeitungsfähig werden. Fische können in dadurch verschmutzem Wasser nicht überleben. Die Segeltuchproduktion konkurrierte mit der Nutzung von Fisch und ein weiteres Konfliktfeld mit Regelungsbedarf entstand. Heute liegt ungefähr die Hälfte der Niederlande weniger als einen Meter über, rund ein Viertel des Landes unterhalb des Meeresspiegels. Die Deiche haben heute eine Länge von etwa 3000 km.
Die Geschichte der Niederlande ist lehrreich: Je mehr Natur wir in gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, desto mehr Aushandlungsprozesse zwischen Interessensgruppen sind die Folge. Technisch war und ist vieles machbar; Politik und Ökonomie lassen Praktiken klug erscheinen, deren ökologische Konsequenzen teuer und bedrohlich werden können. Häufig bringt gerade die auf den ersten Blick erfolgreiche Bewältigung eines Risikos unbekannte Risiken mit sich. In der Umweltgeschichte nennt man diesen Zusammenhang die »Risikospirale.«
(WOLFF, 1992; TE BRAKE, 2002; VAN TIELHOF und VAN DAM, 2006; VAN ASSELEN et al., 2009)
Die verborgenen Gärten der Osterinsel
Mitglieder der drei ersten europäischen Expeditionen, die Rapa Nui (»Osterinsel«) 1722, 1780 und 1784 besuchten, beschrieben die einsam im Ostpazifik liegende Insel als steinig und karg. Trotz einiger Aufforstungen im 20. Jh. vor allem mit Eukalyptus vermittelt die Osterinsel noch heute den Eindruck eines steinreichen, wenig fruchtbaren Graslandes. Hebt man jedoch zum Beispiel im Süden der Insel einige der zahlreichen Steine auf, so offenbart sich das Gegenteil: Fruchtbare Böden sind dort und anderswo großflächig verborgen. Offenbar irrten sich die frühen und auch spätere europäische Besucher, die meist nur wenige Tage auf der Insel blieben und lediglich einen oberflächlichen Eindruck mitnahmen.
Wie gelangten aber mehr als eine Milliarde faust- bis kopfgroßer Steine auf die Böden der Gärten? Vulkanismus als Quelle scheidet aus; in den vergangenen Jahrtausenden gab es hier keine Vulkanausbrüche. Fließendes Wasser oder andere natürliche Prozesse können die manchmal kopfgroßen Steine nicht auf die flachen Unterhänge gebracht haben, denn Abroll- und Abriebspuren fehlen. Forschungsgrabungen brachten weitere Überraschungen: Die fruchtbaren, stark humosen Böden unter der Steindecke besitzen eine oft halbkugel- bis zylinderförmige Untergrenze. Es handelt sich um ineinander verschachtelte Pflanzgruben, die zusammen Gartenböden bilden. Sie wurden von den polynesischen Bewohnern über Jahrhunderte geschaffen. Zwischen den aus Pflanzgrubensystemen bestehenden Gartenböden liegen meist im Horizontalabstand von 2 bis 4 m runde Bereiche mit Durchmessern von bis zu 2 m, die nicht gartenbaulich genutzt worden waren. Sie bestehen oben aus einer Holzkohlelage und darunter aus stets viele Meter in die Tiefe reichenden Palmwurzelröhren. Es sind die Relikte von Palmen.
Diese und zahlreiche weitere geoarchäologische Befunde belegen eine einzigartige Kultur- und Nutzungsgeschichte. Beginnen wir mit den ersten polynesischen Siedlern. Die polynesische Kolonisation hatte wahrscheinlich zwischen etwa 400 und 800 n. Chr. die östlichste und einsamste besiedelbare Insel Ozeaniens erreicht, die seit 1722 von Europäern als Osterinsel und von den Einheimischen als Rapa Nui bezeichnet wird. Die Polynesier fanden eine dicht bewaldete Insel vor. Im oberen Stockwerk des Waldes dominierten Palmen mit kleinen Nüssen, vergleichbar den chilenischen Honigpalmen der Art Jubaea chilensis. Zwischen den dicht stehenden Palmen wuchsen kleinere Bäume und Sträucher. Die Ankömmlinge beseitigten zunächst nur lokal in Küstennähe die zwischen den Palmen stehenden Gehölze und begannen im Palmenschatten die mitgebrachten Kulturfrüchte anzubauen: zahlreiche Varietäten hauptsächlich von Taro, Jams, Zuckerrohr und Banane. Der Anbau vollzog sich – in Abhängigkeit von der spezifischen Durchwurzelung der einzelnen Kulturpflanzenarten – in unterschiedlich großen Pflanzgruben. Als Werkzeug diente der Huki, der polynesische Grabstock.
Eine TARO-PFLANZE wächst durch die STEINMULCHUNGSDECKE bei Akahanga (Osterinsel).
Die polynesischen Siedler hatten selbst in den küstennahen Gunstlagen vorwiegend wenig bis mäßig fruchtbare vulkanische Verwitterungsböden vorgefunden. Zum Überleben war es dringend erforderlich, die Bodenfruchtbarkeit rasch und nachhaltig zu erhöhen. Die erhaltenen Relikte der frühen Gartenbaukulturen beweisen nachdrücklich, dass dies eindrucksvoll gelang. Die Einheimischen hatten in erheblichem Umfang organisches Material in die Pflanzgruben eingebracht. Sie erhöhten damit über viele Jahrzehnte den Humusgehalt und damit die Erträge ganz erheblich. Fruchtbare Gartenböden entstanden. So war für ausreichend Nahrung und eine prosperierende Gesellschaft gesorgt, die nun begann, zahlreiche steinerne Zeremonialplattformen mit monumentalen Steinstatuen zu errichten und zu nutzen.
Ein besonderes Merkmal der Insel machte sich aber mit der wachsenden Bevölkerung zunehmend negativ bemerkbar: Auf der gesamten Insel gab es keine dauerhaften Fließgewässer. Als Wasserreservoire dienten drei Süßwasserseen, der Rano Kau (Rano ist das polynesische Wort für See) im Südwesten, der am höchsten gelegene Rano Aroi im Zentrum und der Rano Raraku im Südosten, sowie wenige, von Salzspray kontaminierte, küstennahe Grundwasseraustritte. Zwar boten die drei Seen reichlich Wasser; mit dem Wachstum der polynesischen Bevölkerung war die Insel aber unter den Clans aufgeteilt worden und wahrscheinlich hatte nicht jeder unbegrenzten Zugang zu Frischwasser. Großvolumige Zisternen wurden nicht angelegt. Wasser, das sich in kleinen Vertiefungen auf dem Gestein sammelte, wurde wohl vorwiegend für rituelle Zwecke genutzt.
Gab der lokale Wassermangel Anlass für die systematische Rodung der Palmenwälder der Insel nach 1200 n Chr.? Jeder der über etwa vier Jahrhunderte abgeschlagenen 16 Millionen Palmstämme enthielt einige Hektoliter einer süßlichen Flüssigkeit, den Palmsaft. Über diesen Zeitraum hätten also jedem Rapanui täglich mehrere Liter nahrhaften Palmsafts zur Verfügung gestanden. Mit dem Ende der Rodungen versiegte die wohlschmeckende Palmsaftquelle. Die Rapanui waren wieder alleine auf das Wasser der drei Seen und das salzhaltige Quellwasser angewiesen.
Die Palmen wurden kurz über der Geländeoberfläche abgeschlagen, die Stümpfe verblieben im Boden. Sie wurden systematisch genutzt, um Nahrung zuzubereiten: Unmittelbar am Rand der Stümpfe wurden Gruben angelegt und zuunterst mit schützenden, großen Blättern, in der Mitte mit Kulturfrüchten wie Taro und Jams, mit Fisch und Huhn sowie darüber mit Blättern gefüllt. Die Gruben wurden mit Erde abgedeckt und die Stümpfe mithilfe von getrocknetem Gras angezündet. Das Kochgut am allmählich verkohlenden Stamm garte langsam und schonend. Vermutlich waren also die Nutzung des Palmsafts als gehaltvolles Getränk und der Palmstümpfe als Energiequelle zur Nahrungszubereitung Anlass für die vollständige Vernichtung der Wälder der Insel von etwa 1200 bis 1600 n. Chr.
Die Rodungen lösten Prozesse aus, die den Einwohnern unbekannt waren: Häufige Starkniederschläge trugen an einigen Ober- und Mittelhängen die fruchtbaren Gartenböden ab, spülten sie hangabwärts in Senken oder gar bis in das nahe Meer. Nunmehr auf den Hängen exponierte, wenig fruchtbare Verwitterungsprodukte der vulkanischen Gesteine wurden erodiert und auf den verspülten Gartenbodenresten in den Senken abgelagert. Der Gartenbau endetet hier zwangsläufig – nur wenige Jahrzehnte nach der Rodung.
Hätte sich diese Entwicklung ungehindert fortgesetzt, so wäre die kleine Population der Inselbewohner in ihrer Existenz bedroht gewesen. Doch sie fanden eine intelligente, hocheffektive Lösung zum Überleben. Sie nutzten ein Produkt, das auf der Insel im Übermaß vorhanden war: oftmals angewittertes vulkanisches Gestein. Sie begannen bald nach dem Einsetzen der starken Erosion, Steine an den Rändern der Lavadecken abzuschlagen und auf die nächstgelegenen, noch nicht erodierten Gartenböden zu legen. Oft in geringer Dichte, gelegentlich mehrlagig und somit mehrere Dezimeter hoch. Was für eine faszinierende Innovation, eine perfekte Überlebenssicherung! Wir bezeichnen diese effektive Bodenschutzmaßnahme heute als Steinmulchung. Die Steine schützten die Böden vor Windund Wassererosion; die dunkle Steindecke erwärmte die Gartenböden stärker und bis in die Abendstunden. Die Rapanui schätzten die Steindecke auch, weil sich nur die kräftigsten Kulturpflanzen gut zu entwickeln vermochten. Möglicherweise bewirkte die Verwendung angewitterter Basalte und Porphyre längerfristig eine mineralische Düngung. Steine vermögen also Reichtum zu verbergen!
Die kleine Population der Osterinsel ist nicht, wie Jared Diamond (2011) in seinem Bestseller »Kollaps« irrtümlich ausführt, selbstverschuldet kollabiert. Heute können wir den indigenen Kollaps widerlegen. Dennoch hat es einen Kollaps auf der Osterinsel gegeben. Etwa die Hälfte der Inselbevölkerung wurde in den Jahren 1863 und 1864 von Europäern und Südamerikanern nach Peru entführt und dort versklavt. Nach diplomatischen Interventionen kehrten die 15 noch lebenden Sklaven zurück nach Rapa Nui, wo sie die dort Verbliebenen – vor allem Kinder, Frauen und alte Menschen – mit Krankheiten ansteckten, gegen die die Inselbevölkerung keine Abwehrstoffe hatte (vgl. S. 70). Von etwa 4000 bis 4500 Bewohnern im September 1863 lebten einige Jahre später nur noch 110.
Die indigene Rapa-Nui-Kultur hat gravierende Umweltveränderungen nicht nur überlebt, sondern sehr erfolgreich gemanagt. Erst ein massiver externer Eingriff, die Versklavung, hat die einzigartige Kultur weitgehend zerstört und so auch die Steinmulchung beendet.
(BORK et al., 2004; MIETH & BORK, 2012)
STEINGÄRTEN bei Akahanga im Süden der Osterinsel.
Der Kampf der Venezianer um ihre Wälder
Ohne Wald ging gar nichts im vorindustriellen Europa. Bauern brauchten den Wald für die Gewinnung von Streu und Brennholz und als Waldweide; aus bäuerlichen Niederwäldern kamen Haselstecken für Zäune, Hopfenstangen und Weinberge. Bergwerke und Eisenhütten benötigten Brennholz ebenso wie Salz- und Seifensieder, Glasmacher oder Ziegelhersteller. Ohne Holz kein Bier, keine bunten Stoffe, keine Fahrzeuge. Holz war zudem eine strategische Ressource, ganz besonders für Staaten, die eine Flotte unterhielten. Das beste Holz wuchs sehr langsam: Eichen, die sehr haltbares Holz liefern, erntete man frühestens im Alter von 150 bis 200 Jahren.
Die Archive Europas enthalten zahlreiche Regelungen, Gerichtsakten und gelehrte Abhandlungen über die Nutzung und Vermehrung des Holzes. Waldordnungen zählen zu den wichtigsten Rechtsdokumenten der Vergangenheit. Während Regeln für die Nutzung erlassen werden konnten, Waldfrevel mit strengen Straften bedroht wurde und sich im 18. Jh. die Förster als eigene Expertengruppe konstituierten, wuchs der Wald nach seinen Gesetzen; die Steuerung des Waldwachstums durch Menschen erforderte entsprechend spezifisches, ökologisches Wissen.
Die Geschichte der Republik Venedig erlaubt einen Einblick in die Schwierigkeiten, vor die eine langfristige Holzverwaltung Regierungen stellte. Venedig steht auf Millionen Pylonen aus Eichen- und Lärchenholz; in zwei großen Speicherbauten hielt die Stadt – unter ständigen Schwierigkeiten – Feuerholz für die etwa 140.000 Einwohner vorrätig. Auch auf der Glasmacherinsel Murano wurden große Mengen Brennholz benötigt. Mit der Modernisierung des Militärwesens nach dem Ende der mittelalterlichen Ritterkämpfe stieg außerdem der Materialeinsatz der Heere beträchtlich. Für den Rumpf eines einzigen Kriegsschiffs wurden 80 Eichen verwendet.
Die Venezianer versuchten ihren Holzbedarf durch Regulierung des Markts zu sichern. Schon im Jahr 1350 wurde dem Arsenal, der militärischen Werft, das Vorkaufsrecht auf alle Eichen auf dem Markt eingeräumt; der Holzpreis wurde reguliert. Ab 1372 wurden Kapitäne bestraft, wenn sie mit gebrochenen Rudern in den Hafen zurückkamen. Ruder wurden aus Buchenholz hergestellt – aus einem besonders guten Buchenstamm konnten geschickte Handwerker gerade einmal sechs Ruder herstellen; schon eine kleine Galeere benötigte aber 180 Ruder. Holz war also knapp, der Bedarf riesig.
Seit dem 14. Jh. vergrößerte sich die Venezianische Republik durch Gebiete auf dem italienischen Festland, die Terraferma. Nun hatte Venedig erstmals eigenen Waldbesitz, den es zunächst ausschließlich über die Regulierung des Markts verwaltete. Der Markt reagierte auf den Bedarf: In großem Stil wurde abgeholzt, besonders entlang der Flüsse, wo der Transport am einfachsten war. Die Venezianer wurden rodungsbedingt mit einer Zunahme an Hochwassern und stark vermehrter Sedimentablagerung in der Lagune konfrontiert. Die Flüsse, auf denen Holz hätte transportiert werden können, wurden durch Sedimentation unpassierbar. Dies, so schrieb schon 1442 der Patrizier Marco Cornaro (1412–1464) in seiner Abhandlung über die Lagune, sei eine Ursache für die Knappheit an Feuerholz in Venedig. Er empfahl – wie schon eine Generation vor ihm ein anonymer Autor – das Ausheben der Wasserwege und die gezielte Aufforstung. Schon 1410 hatte der Doge die Erhebung einer Sondersteuer für die Reparatur von Dämmen und Schleusen an der Livenza bei Legnano dekretiert, weil Hochwasser und Sedimentation sonst den (Holz-)Handel schädigen würden (APPUHN, 2000: 869).
EICHENWALD bei CROCETTA DEL MONTELLO am Fluss Piave in den Domini di Terraferma in Oberitalien, die vom 15. Jh. bis 1797 zur Republik Venedig gehörten. (Karte aus dem 17. Jh.)
Um die Versorgung mit den für den Schiffsbau unverzichtbaren Eichen zu sichern, richtete der Senat nach Anfängen 1438 im Jahr 1458 eine eigene Behörde ein. Diese »Provveditori ai boschi« sollten nicht nur Zölle erheben, sondern auch den Bootsverkehr überwachen. Gegen Ende des 15. Jh. wurden sie schließlich auch mit der Holzernte betraut. 50 Jahre später waren sie Teil einer großen Zentralbehörde, die auf umfangreichen Inspektionsreisen sogar eigene Kartenzeichner beschäftigte, um den Überblick über die Reserven zu bewahren. Die so mögliche »rationale« räumliche Aufteilung verschiedener Nutzungen sollte über die nächsten Jahrhunderte verfeinert werden. Ab 1569 wurde ein eigenes Eichenkataster geführt, das alle 20 Jahre jede einzelne Eiche verzeichnete.
Im Jahr 1463 wurde ein Teil der Wälder für das Arsenal, reserviert und direkter staatlicher Kontrolle unterstellt. Den Kernbereich bildeten Eichenwälder bei Montello, Tannenwälder bei Pieve di Cadore in den Alpen und später auch ein Buchenwald bei Belluno; alle drei lagen verkehrsgünstig an der Piave.
1476 erließ der venezianische Senat dann sechs Regeln für die Nutzung der kommunalen Wälder in seinen Besitzungen auf der Terraferma, denn auch diese sollten Schiffsbauholz liefern. Der Senat verbot den Gemeinden die Waldweide, die Ernte von Feuerholz und das Legen von Feuern, um das Unterholz zu entfernen, und legte einen zehnjährigen Rotationszyklus für die Holzernte fest. Die bäuerliche Bevölkerung, die die kommunalen Wälder nutzte, wurde kriminalisiert, ohne dass die Maßnahmen aus der Sicht der Zentralbehörde Erfolg gezeigt hätten.
RESTWÄLDER bei CROCETTA DEL MONTELLO am Fluss Piave im östlichen Oberitalien. (Google Earth, 2013)
Mehr als 200 Jahre nach der ersten Forstordnung und nach weiteren Verschärfungen der Regulierung – sogar das Sammeln von Totholz war inzwischen verboten worden – kamen die Beamten der Signoria, dem »Ministerium« des Dogen, zum Schluss, dass sie in den Forsten nicht mehr, sondern weniger Ertrag an Eichen erzielten. Sie schoben die Schuld auf die Bauern, die die Wälder entgegen den Verboten genutzt hätten. Diese Ansicht vertrat etwa Leonardo Mocenigo in seinem Lehrbuch der Forsteinrichtung von 1704. Das Gegenteil war der Fall, wie der Vergleich staatlicher und kommunaler Wälder zeigt. Solange die Bauern bei der Nutzung des Waldes als Weide oder zur Feuerholzsammlung Unterholz und Bäume von geringerer Qualität entfernt hatten, war mehr Platz für einzelne Eichen, die dann zu den gesuchten großen Bäumen heranwachsen konnten. Hielten sie sich strikt an die Verbote, sank der Ertrag an Eichen.
Doch auch die Venezianer selbst spielten für den Eichenwald eine Rolle, die sie nicht erkannten. Solange das Arsenal der Venezianer genug Eichen verbrauchte, war der Eichenertrag noch einigermaßen akzeptabel; sobald der Bedarf nachließ, verblieben Unterholz und dünne Stämme, die bei der Eichenernte routinemäßig mit entfernt worden waren, im Wald und erstickten den Nachwuchs junger Eichen, die zu Bäumen für den Schiffsbau heranwachsen hätten können. Je mehr die Venezianer an Eichen sparten, umso schlechter sah es mit dem Nachwuchs aus.
Die immer sorgfältiger geschützten Staatswälder produzierten immer weniger Eichen, während die durch die Regelungen gegen Raubbau geschützten, aber vielfältiger Waldnutzung ausgesetzten kommunalen Wälder mehr Eichen liefern konnten. Die lokalen Administratoren verstanden die ökologischen Zusammenhänge überraschend gut. Bereits 1574 ist in einem Bericht des venezianischen Statthalters von Belluno, Marc’Antonio Miani, an den Senat zu lesen, dass eine Durchforstung nötig sei, weil Stämme minderer Qualität den guten den Raum zum Wachsen nähmen. Miani empfahl, daraus Holzkohle herzustellen und berechnete sogar, wie viel Steuereinnahmen dies erbrächte. Doch sein Wissen und das vieler anderer vor Ort wurde von der zentralen Behörde und den Gesetzgebern nicht zur Kenntnis genommen. Denn dies hätte bedeutet, in den Wäldern des Arsenals anderes als Schiffsbauholz zu ernten – das schien undenkbar. Wie so viele Zentralbehörden in der Geschichte der Nutzung natürlicher Ressourcen waren auch die Venezianer unfähig, lokale ökologische Erkenntnisse für ihre zentralistischen Überlegungen wertzuschätzen.
(APPUHN, 2000)
Wasser und Fäkalien in japanischen Städten
Sein Regime sollte eine neue Hauptstadt haben. Der Gründer der Tokugawa-Dynastie in Japan, Shogun Ieyasu, befahl 1590 seinem Gefolgsmann Okubo Togoro Tadayuki, dafür eine adäquate Wasserversorgung bauen zu lassen. Tadayuki reiste zu einer kleinen Burg inmitten von Fischerdörfern, dem späteren Edo (heute Tokio), um die Lage zu erkunden. Er fand hier einen Platz in strategisch günstiger Lage – allerdings mit denkbar schlechten Ausgangsbedingungen für die Wasserversorgung. Die künftige Hauptstadt sollte sich auf sumpfigem Marschland am Meer ausbreiten. Doch er löste die schwierige Aufgabe mit Bravour: Das Kanda-System, das er bauen ließ, leitete das Wasser einer östlich der Stadt gelegenen Quelle über offene Aquädukte zur Stadtgrenze und von dort weiter in unterirdischen gemauerten oder hölzernen Leitungen – insgesamt über eine Länge von mehr als 66 km.
Über 3000 Versorgungsleitungen verteilten das Wasser der Inokashira-Quelle in der Stadt. Das großartige System erreichte aufgrund des außerordentlich starken, vom Shogun erzwungenen Bevölkerungswachstums von Edo bereits Mitte des 17. Jh. seine Kapazitätsgrenze. 1652 musste eine neue Leitung gebaut werden. Diesmal wurde der Fluss Tama angezapft. Über 80 km war das neue Leitungssystem lang, das bis zum Eingang des Shogun-Palastes mehr als 40 km Entfernung überwand (STEELE, 2000).
1657 brannten zwei Drittel der Stadt Edo ab. Beim Wiederaufbau wurden vier neue Wasserleitungen angelegt. Doch kehrte man bis zur Mitte des 19. Jh. zu den beiden alten Systemen zurück, wohl wegen der besseren Wasserqualität. Strenge Nutzungsregelungen sorgten für einen sparsamen Umgang mit dem kostbaren Gut. Das System war denjenigen anderer japanischer Städte weit überlegen. Edo ist auch deswegen ein Sonderfall, weil die Wasserversorgung vom Hof des Shogun gemeinsam mit der Stadtverwaltung geplant und gebaut wurde.
Menschen in Städten müssen stets aus dem Umland versorgt werden – es geht nicht ohne Trinkwasser, Nahrung und Heizmaterial. Sie brauchen auch eine verlässliche Entsorgung. Wird Wasser in eine Stadt geleitet, entsteht Abwasser, für dessen Ableitung eine eigene Infrastruktur nötig ist, wie auch die »Cloaca maxima« des antiken Rom zeigt.
Die ältesten archäologisch nachgewiesenen Toilettenanlagen in Japan stammen aus dem 8. Jh. n. Chr. Administrative Dokumente aus dieser Zeit belegen, dass es im Herrscherpalast Toiletten mit einer Art Spülung durch extra eingeleitetes Wasser gab; Gefangene mussten am Morgen nach regnerischen Nächten die angesammelten Fäkalien entfernen. Bereits aus dieser Zeit existieren Dokumente, die die Applikation von menschlichen Exkrementen auf 16 von 25 Gartenpflanzen des nördlichen Residenzgartens der damaligen Fujiwara-Hauptstadt belegen. Ab dem 13. Jh. ging man an vielen Orten dazu über, die Fäkalien systematisch als Düngemittel zu sammeln. Der Jesuit Luis Frois, der im 16. Jh. Japan bereiste, berichtete, dass Bauern in die Städte kamen, um Exkremente zu sammeln. (MATSUI, 2003)
HANDARBEIT beim DRESCHEN VON REIS in Japan. (Postkarte, vermutlich vor 1930)
Am frühneuzeitlichen Osaka und Edo lässt sich der Kreislauf der Pflanzennährstoffe genauer verfolgen. Nur 15% der Fläche der gebirgigen Insel Honshū sind überhaupt für Landwirtschaft geeignet, guter Boden und Dünger waren hier knapp. Je mehr Mieter im frühen 18. Jh. in einem Haus in Osaka lebten, desto weniger Gesamtmiete war für das Haus zu zahlen – ein für Mitteleuropäer vollkommen unerwarteter Zusammenhang, der sich jedoch aus dem Wert von Fäkalien erschließt. Der Eigentümer hatte das Recht auf die festen Ausscheidungen seiner Mieter. Zehn Haushalte erbrachten pro Jahr etwa einen halben Gold-Ryo – die Hälfte der Summe, die man für eine Jahresversorgung einer Person mit Reis oder anderem Getreide rechnete. Je mehr Mieter, desto mehr Ausscheidungen, desto geringer konnte die Gesamtmiete sein. Den Urin durften die Mieter selbst verwerten; er hatte trotz seines hohen Nährstoffgehaltes wegen der komplizierteren Handhabung geringeren Wert.
Abnehmer für die Fäkalien und den Urin kamen aus den umliegenden Dörfern. Zwischen den Einwohnern von Yamazaki und Takatsuki kam es im Sommer 1724 gar zum Kampf um das Recht, Fäkalien in Osaka zu sammeln. Das Recht der Entleerung der auf den Straßen aufgestellten Urinsammelbehälter vergab der Magistrat von Osaka an die Einwohner des weiter entfernten Watanabe, die trotz Sabotage und Kaufanboten auf ihrem Recht beharrten. Mitte des 18. Jh. waren Fäkalien in Osaka so wertvoll, dass ärmere Bauern sie sich kaum leisten konnten. Diebstähle nahmen trotz strenger Strafen zu.
Das Geheimnis hinter dieser verblüffenden Geschichte kann nur durch einen Blick in die Bauernhöfe gelüftet werden: In der japanischen Landwirtschaft gab und gibt es kaum Vieh. Dünger konnte daher fast nur aus menschlichen Exkrementen kommen. Daher war er so rar und kostbar. In den ersten Jahrzehnten nach der Gründung war die Situation in Edo offenbar nicht so dramatisch wie in Osaka. Die Fäkalien der Adelssitze in Edo wurden später jährlich an interessierte Bauern versteigert, gegen Naturalien oder Geld. Es war bekannt, dass die Nährstoffgehalte der Exkremente von der Nahrung abhingen, die Düngerverwendung wurde in Handbüchern beschrieben. Letztlich bestimmten die Transportkosten, wie weit städtische Exkremente über Land transportiert werden konnten. Eigene Fässer, von denen je zwei mit Stangen zusammengebunden auf der Schulter getragen werden konnten, dienten dem Transport. Bezahlt wurde von den Bauern meist mit Reisstroh und landwirtschaftlichen Produkten. Der Preis schwankte je nach Saison, im Winter waren die Exkremente am billigsten. (TAJIMA, 2007)
In der Hauptstadt Edo wurde aus ästhetischen Gründen der Urin der Spaziergänger nicht wie in Osaka in Behältern auf der Straße eingesammelt. Ein Geschäftsmann, der 1789 eine Petition für ein Sammelsystem einreichte, begründete es mit glasklarer ökonomischer Logik: Könnte man den Urin sammeln, der an Straßen versickerte, würde durch die gesteigerte Menge an Dünger dessen Preis sinken: Dann könnten Bauern mehr Dünger verwenden, die Ernten würden ansteigen und die Preise für Nahrungsmittel generell sinken. Der Mann sah im Urin eine Geschäftsidee.
Heute sehen wir die epidemiologischen Effekte: Cholera kam erst im 19. Jh. nach Japan. In Edo und Osaka gab es kein durch Fäkalien verschmutztes Trinkwasser, wie es in Europas Städten zu dieser Zeit gang und gäbe war. Zu dieser erfreulichen Situation trugen religiös motivierte Reinlichkeitsvorstellungen bei. Der portugiesische Jesuit João Rodrigues, in Japan »Tçuzu« (Übersetzer) genannt, beschrieb die Hygienevorrichtungen mit Bewunderung: Nach dem Aufsuchen des Abtritts, der nach jeder Benutzung gereinigt wurde, wusch man sich die Hände. (COOPER, 1973)
BODENVORBEREITUNG UND UMSETZEN VON REIS IN JAPAN von menschlicher Hand. (Postkarte, vermutlich vor 1930)
Die Verwendung menschlicher Fäkalien hat allerdings eine negative Auswirkung: Parasiten werden ebenso im Kreislauf geführt wie Nährstoffe. Da japanische Bauern aber niemals frische Fäkalien verwendeten, weil diese als gefährlich galten, sondern sie mindestens einen Monat lagerten, konnte diese Nebenwirkung in Grenzen gehalten werden. Archäologische Ausgrabungen zeigen aber die weite Verbreitung von Parasiten wie dem Spulwurm bereits im 8. Jh. n. Chr. (MATSUI, 2003).
Im 17. und 18. Jh. war Edo mindestens so groß wie das damals größte urbane Zentrum Europas: London. Auch Osaka war mit über 400.000 Einwohnern Ende des 18. Jh. eine Metropole. Sanitär waren die japanischen Großstädte den europäischen weit überlegen. Die Gründe dafür sind aber nur zum Teil in den Städten zu suchen. Solange japanische Felder der Fäkalien der Menschen bedurften, gab es einen funktionierenden Markt. Der kostbare Dünger war viel zu wertvoll, um ihn in den Boden zu leiten. Daher blieb Trinkwasser aus Brunnen hygienisch unbedenklich. Diese Wirtschaftsweise kann nach heutigen Kriterien als wegweisend und nachhaltig gelten. (HANLEY, 1987)
Die globale Zuchtgeschichte des Hausschweins
Vor über 9000 Jahren wurden Schweine unabhängig voneinander in China und Europa unter sehr unterschiedlichen ökologischen und gesellschaftlichen Bedingungen domestiziert. Sie dienten als lebende Vorratskammern für Fleisch und Fett – eine wichtige Leistung in einer Zeit, in der es keine Kühlmöglichkeiten gab. Während dies für alle vorindustriellen Agrarökonomien gilt, hatte das Hausschwein in Europa und China sehr verschiedene Funktionen.
Europäische Schweine machten nicht verwertbare Pflanzennährstoffe für Menschen nutzbar, ihre Rolle als Abfallverwerter war bis in das 19. Jahrhundert unbedeutend. Die europäische Schweinemast des Mittelalters war eine Form der Waldnutzung. Ernährten sich die umherstreifenden Tiere von Eicheln und anderen Waldfrüchten, pumpte dies Nährstoffe aus Misch- und Laubwäldern über den Umweg von Speck, Schinken und Braten auf die Teller der Bauern und ihrer Herren. Allerdings war die Waldmast eine saisonale Angelegenheit, wollte man Schweine übers Jahr behalten, musste man sie anders durchfüttern, daher blieb ihre Anzahl kleiner gegenüber der anderer Nutztiere wie Rindern und Schafen, die mehr Nutzen hatten, indem sie auch noch als Zugtiere oder als Milch- und Wolllieferanten dienten. Die Eichelmast bedurfte ausgedehnter Wälder, mancherorts wurden Hutewälder dafür eigens angelegt, Eichen gehegt. Nach modernen Studien wandern Schweine in einem guten Eichenwald typischerweise bis zu 6 Kilometer pro Tag und verbrennen dabei etwa ein Drittel der Energie, die sie gerade erst aufgenommen haben. Sie wandeln dadurch Pflanzenkalorien mit einer Rate von nur etwa 10:1 in Fleisch und Fett um (im Gegensatz zu 3:1 in der modernen industriellen Produktion). Die Schweine wurden nach Ende der Eichelsaison geschlachtet, das Fleisch und Fett so gut wie möglich haltbar gemacht, nur wenige Exemplare wurden überwintert.
Flämische Darstellung der HERBSTLICHEN WALDMAST Ende des 15. Jahrhunderts.
Chinesische Schweine waren dagegen in ein intensiveres Nutzungssystem integriert, in dem sie als Abfallverwerter jene Biomasse, die anfiel, aber nicht direkt verwertet werden konnte, für menschlichen Genuss aufbereiteten. Daher waren Zuchtziele und Zuchterfolge der Schweinehalter verschieden und ebenso die resultierenden Schweine. Europäische Schweine wurden durch Zucht zwar langsamer und fetter, blieben aber hochbeiniger als ihre chinesischen Vettern. Da die Tiere frei im Wald weideten, war und blieb ihre Beweglichkeit von Bedeutung, gezüchtet werden konnte nur eine Kompromissvariante. Es kam auch immer wieder zu Einkreuzungen von Wildschweinen – was eine Züchtung, die auf Masterfolg optimierte, ebenfalls erschwerte. Den nötigen Kompromiss hatte schon der im ersten Jahrhundert nach Christus lebende römische Agrarschriftsteller Columella zusammengefasst, wobei er auch sehr detailliert auf die Anforderungen der Schweine hinsichtlich Lebensraum und Fütterung einging und damit einen guten Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen der Schweinezucht nach dem europäischen System gab (siehe KASTEN). Columella schrieb für und über große Gutswirtschaften, die ihre Produkte auf Märkten feilboten und nach ökonomischen Gesichtspunkten agierten. Das macht seine Empfehlungen erstaunlich modern. Nach dem Ende der Antike wurde die Viehzucht generell weniger elaboriert, in der Subsistenzökonomie der mittelalterlichen Bauern konnten die Schweine zwar mit Abfällen und landwirtschaftlichen Nebenprodukten ernährt werden, sie zu mästen, was der eigentliche Sinn der Sache war, gelang aber nur durch die Waldweide.
Im 19. Jahrhundert waren sich Fachleute der Unterschiede zwischen CHINESISCHEN UND EUROPÄISCHEN SCHWEINERASSEN bewusst und stellten sie einander gegenüber (Loudon, 1883)
Lucius Iunius Moderatus COLUMELLA, De Re Rustica, Buch 7, Kapitel 9, Auszüge aus 1–10.
[Man kört] Eber von großer Mächtigkeit des Gesamtkörpers, doch mehr von vierkantiger als langgestreckter oder rundlicher Gestalt, mit hervortretendem Bauch, großen Hinterbacken und folglich nicht sehr hohen Beinen und Zehen, mit kräftigem und muskulösem Nacken und kurzem, zurückgestülptem Rüssel; […] Die Säue wählt man mit möglichst langgestrecktem Körperbau, doch im übrigen ähnlich den geschilderten Ebern. Ist die Gegend kalt und regnerisch, dann wählt man eine Herde mit möglichst hartem, dichten und dunklem Borstenwuchs; ist sie mild und sonnig, kann man auch borstenlose und schneeweiße Mühlenschweine* weiden lassen. […] Dieses Tier gedeiht in jeder örtlichen Lage; es weidet ebensogut auf Bergen wie in der Ebene, doch besser auf feuchten als auf trockenen Böden. Am geeignetsten sind Wälder mit Beständen von Eichen, Korkeichen, Buchen, Zirneichen, Steineichen, wilden Olivenbäumen, Tamarisken, wilden Haselnussstauden und wilden Obstbäumen, wie Weißdorn, Johannisbrot, Wacholder, Judendorn, wilder Wein, Kornelkirschbäume, Erdbeerbäume, Pflaumenbäume, Judendornbäume und Wildbirnbäume. Deren Früchte reifen nämlich zu unterschiedlichen Zeiten und ernähren die Herde fast das ganze Jahr hindurch. Wo jedoch Bäume mangeln, wird man das Futter von der Erde nehmen und dabei einen feuchten Boden dem trockenen vorziehen, damit die Schweine im Morast wühlen, Regenwürmer ausgraben und im Schlamm suhlen können, was diese Tiere ungemein lieben. […] Trotzdem wird man darum nicht an dem sparen, was die Scheune zu bieten hat; denn oft ist Handfütterung nötig, wenn es im Freien an Futter fehlt, weshalb man reichlich Eicheln entweder in den Trögen ins Wasser wirft oder auf dem Boden im Rauch einlagern muß. Auch Bohnen und ähnliches Gemüse soll man sie, wenn es ein niedriger Preis ermöglicht, reichlich fressen lassen, vor allem im Frühjahr, wenn die jungen Gräser locken, die den Schweinen in der Regel schaden. Deshalb soll man sie morgens, ehe sie auf die Weiden gehen, mit eingelagertem Futter sättigen, damit sie nicht von unreifen Kräutern Durchfall bekommen und durch diese Störung abmagern.
* Bäcker hielten Schweine, an die sie die beim Mahlen anfallende Kleie verfütterten; hier handelt es sich um den chinesischen Rassen ähnliche Hausschweine, die nicht im Wald weideten.
Die chinesischen Rassen konnten wie die römischen Mühlenschweine auf schnelle und effektive Mast hin gezüchtet werden, denn sie wurden vorwiegend im Stall gehalten. Diese Hausschweine konnten daher auch das ganze Jahr über geschlachtet und das Fleisch frisch verarbeitet werden. Die Tiere waren so sehr Teil des Haushalts, dass das chinesische Schriftzeichen für »Heim« ein Dach, unter dem sich ein Schwein befindet, darstellt. Schweinefleisch war und ist die dominierende Fleischsorte der chinesischen Küche.
Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die Landnutzung in Teilen Europas intensiviert, und damit der Chinas ähnlicher. Die Bevölkerungsdichte in Europa war seit den Pestepidemien angestiegen, die Zentralräume Englands und Mitteleuropas waren weitgehend entwaldet. Während die Eichelmast immer schwieriger wurde, bildeten die rasch wachsenden Städte – ganz besonders die Metropole London – mit ihrem Abfall eine neue Nahrungsbasis für Schweine. Abfälle aus Molkereien und Brauereien standen als konzentrierte Futtermittel zur Verfügung. Dazu kam die aus Amerika eingeführte Kartoffel, die sich für die Schweinemast hervorragend eignete und dafür bereits verwendet wurde, ehe sie als Nahrung für Menschen salonfähig wurde.
Chinesische Zuchtschweine gelangten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nach England und Schweden und breiteten sich von dort aus, allerdings nur in Gegenden, in denen die ökologischen und ökonomischen Bedingungen dies förderten. Ende des Jahrhunderts äußerten sich englische landwirtschaftliche Schriftsteller begeistert über die nunmehr verfügbaren Kreuzungen, die die guten Eigenschaften der kleineren, rundbäuchigen, schwarzen chinesischen Schweine mit denen der größeren europäischen Rassen vereinten.
Ein Schwein schlachtreif zu machen, hatte in Europa zwei bis drei Jahre gedauert. Schweine wurden in den Subsistenzökonomien Europas im Herbst geschlachtet, frisches Schweinefleisch war ein saisonales Produkt. Nun reichten 18 Monate. Marktwirtschaftlich orientierte Agrarbetriebe, die die städtische Industriearbeiterschaft versorgen wollten, mussten Wege finden, Schweinefleisch ganzjährig anzubieten. Waldmast war dafür ungeeignet. Die Schweinezucht wurde zu einem wichtigen Teil der landwirtschaftlichen Modernisierung, der bislang weitgehend unbeachtet geblieben ist. Doch die Geschichte endet nicht hier.
Eisenbahnnetze, internationaler Handel, die zunehmende Kapitalisierung und Marktintegration der immer industrieller agierenden Landwirtschaftsbetriebe und das auf spezielle Eigenschaften hin optimierte Genom des chinesisch-europäischen Zuchtschweins bildeten gemeinsam die Basis für die industrielle Schweinefleischproduktion, die sich im 20. Jahrhundert, von den USA ausgehend, über die Welt verbreiten sollte. Ihre ökologischen und ökonomischen Folgen konnten die ersten Züchter verbesserter Schweine in England nicht ahnen. (WHITE, 2011)
Die Schweinezucht ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine globalisierte Industrie. Mit Zuchttieren und Samen gelangen auch Krankheitserreger um die Welt, einige davon, wie der Influenzavirus sind auch auf Menschen übertragbar.
ORANGENERNTE IN FLORIDA. Die Spanier brachten die Orange aus Asien bereits im 16. Jh. nach Florida. (Postkarte, gelaufen 1947)
GEBRAUCHSFERTIGE FARMEN in West-Kanada. Werbeplakat der Canadian Pacific Eisenbahngesellschaft.
1820 wird die große NATURALIENSAMMLUNG des schwedischen Freiherrn und Entomologen Gustaf von Paykull nach Stockholm zur Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften transportiert. Sie umfasste 80 Säugetierarten, 1362 Vogelarten und etwa 8600 Insektenarten. Gemälde von Gunnar Brusewitz. (Naturhistorisches Museum, Stockholm)
Von den vielen Technologien, die Menschen im Laufe der Jahrtausende erfunden haben, sind Transporttechnologien jene mit den größten Wirkungen auf Ökosysteme. So reisten mit den Europäern Tiere, Pflanzen und Mikroben über die Weltmeere. Diesen Handkoffer mit Lebewesen hat Alfred Crosby bereits 1972 als Grund dafür identifiziert, dass es »Neo-Europas« gibt. Aus Europa eingeschleppte Erreger von Pocken, Masern und weiteren Krankheiten dezimierten indigene Bevölkerungen Amerikas, Australiens und Neuseelands so sehr, dass die Nachkommen zunächst zahlenmäßig weit unterlegener europäischer Siedler heute dort die Mehrheit stellen.
Erreger von Viehseuchen waren ständig mit Nutztieren unterwegs. Schon im frühneuzeitlichen Europa wurde Vieh über weite Strecken gehandelt. Um die Ausbreitung von Seuchen zu verhindern, wurden Quarantänestationen errichtet und der Handel reglementiert. Der Aufwand dafür war beträchtlich und doch verbreiteten sich Viehseuchen immer wieder über Handelswege.
Eingeführte Pflanzen- und Tierarten prägen Kulturlandschaften. Die Geschichte der Baumwolle steht stellvertretend für viele. Ob Gummi, in dessen späterem Hauptanbaugebiet Malaysia der Anbau des aus Südamerika stammenden und über die Drehscheibe Kew Gardens (London) eingeführten Kautschukbaums erst Ende des 19. Jh. begann, oder Mais aus Amerika, ob ostasiatische Soja, die Ende des 18. Jh. in die USA gelangte, oder Kaffee, dessen Varietäten »Robusta« und »Arabica« aus Afrika kommen und von Menschen über die Tropen verbreitet wurden – sie alle veränderten die sozialen, ökonomischen und ökologischen Systeme, in die sie transportiert wurden.
Auf Galápagos ist der devastierende Effekt von invasiven, vom Menschen eingebrachten Tierarten besonders deutlich. In Australien wurden besonders viele Experimente mit eingebrachten Arten unternommen. Ein durch den Kontinent gezogener, letztlich wirkungsloser Kaninchenzaun ist sichtbarer Beweis für den Aufwand, den unbedachtes Freisetzen von Arten nötig machen kann.
Auch in Gewässern können eingebrachte Arten dramatisch wirken – gleich ob sie als blinde Passagiere unabsichtlich oder für den Handel absichtlich in Seen und Flüsse gelangen. Das Ökosystem des Victoriasees in Zentralafrika wurde durch den Besatz mit Nilbarschen tief greifend verändert. Endemische Arten starben aus, Wasserhyazinthen wuchsen ungestüm. Der See gilt als destabilisiert, die Lebensgrundlage der Bevölkerung ist gefährdet. Am Export verdienen nur wenige.
Der erste interkontinental gehandelte Dünger war peruanischer Vogelguano – nährstoffreiches Exkrement von Seevögeln auf Inseln vor der Küste Perus. Um durch Management der Vogelpopulationen die Bildung frischen Guanos zu steigern, wurden Experten von weither eingeladen. Nach anfänglichen Erfolgen brach die Seevogelpopulation zusammen, als mit der Einführung der Sardinenfischerei der Mensch zum Nahrungskonkurrenten der Vögel wurde. Da hatte synthetischer Mineraldünger den Guano aber bereits abgelöst.
Der größte Kran und das größte Schiff der Welt im HAMBURGER HAFEN. (Postkarte, gelaufen am 21.2.1914)
Von 1985 bis 2011 wuchs die Tonnage im Weltseehandel um mehr als 230%. Viele Schiffe fahren nur in eine Richtung mit Ladung. Um stabil zu bleiben, füllen sie ihren leeren Bauch mit Ballastwasser, das in dem Hafen, in dem sie neue Ladung aufnehmen, abgelassen wird. Die im Ballastwasser reisenden, oft konkurrenzstarken blinden Passagiere breiten sich in fremden aquatischen Ökosystemen, in denen sie nicht auf spezialisierte Feinde treffen, auf Kosten lokaler Arten aus.
Die mikrobielle Homogenisierung der Welt und die durch Transport und Handel verursachten Invasionen greifen in die Evolution ein. Sie verwandelten Ökosysteme; oft sind die Änderungen für Menschen nachteilig. Dieser Prozess begann mit der Ausbreitung von Getreide aus dem fruchtbaren Halbmond des Nahen Ostens im Zuge der Neolithisierung und wurde durch die koloniale Expansion europäischer Mächte in der frühen Neuzeit bereits massiv beschleunigt. Die Verfügbarkeit fossiler Energie für Eisenbahn, Dampfschiff, Pkw, Lkw und Flugzeug führte zu globalen Transfers in nie gekanntem Ausmaß und mit einer Geschwindigkeit, die heute auch sehr empfindlichen Arten weite Reisen ermöglicht.
Nicht nur der Gütertransport, auch Touristen bewirkten Transformationen an den Destinationen. Diesen zeigt das Beispiel der touristischen Umgestaltung von Landschaft und deren Einfluss auf Jagdpraxis und Leben der indigenen Bevölkerung am Banff-Nationalpark in Kanada.
Das EISENBAHNNETZ 1838, 1848 und 1858 im westlichen Gebiet des Deutschen Zollvereins sowie 1875 im westlichen Deutschen Reich.
1838, 1848 und 1858 kräftig grün: Gebiet des Deutschen Zollvereins; hellgrün: nicht zum Zollverein gehörende spätere Beitrittsgebiete
1875 Gebiet des Deutschen Reiches
Aus China kommend, wurden SOJABOHNEN (Glycine max) in Nachbarländer transferiert und um 1200 nach Indien. Sojabohnen trafen 1729 in Frankreich ein und wurden im Jardin des Plantes in Paris gepflanzt, 1790 in den Royal Botanic Kew Gardens (London). Ein pensionierter Seemann transferierte schon 1765 Sojabohnen nach Savannah in Georgia (Britisch-Amerika). Mitte des 19. Jh. sollen Sojabohnen als Futterpflanze von Indonesien über die Niederlande in den mittleren Westen der USA gelangt sein.
MAIS (Zea mays) ist eine einfach kultivierbare ertragreiche Kulturpflanze, die seit über 7 500 Jahren in Mexiko angebaut wird. Bald nach der Entdeckung Amerikas brachten Spanier Mais in den Mittelmeerraum, in ihre Kolonien in Amerika und auf den Philippinen; die Portugiesen transportierten ihn nach Westafrika und später wohl auch nach Ostafrika und auf die Insel Réunion. Der ausgedehnte Anbau von Mais trug wesentlich zum starken Bevölkerungswachstum im 20. Jh. in Afrika bei.
Die KAFFEEart Coffea arabica stammt wahrscheinlich aus dem südäthiopischen Hochland. Von hier gelangte sie in das Hochland Jemens, wo die Kultivierung wohl schon im ersten Jahrtausend begann. Im 16. Jh. war Kaffee als Getränk auf der Arabischen Halbinsel, bis nach Kairo und Konstantinopel bekannt. Um 1600 kam Arabica-Kaffee in Indien und Sri Lanka an und vor 1700 in Niederländisch Ostindien (dem heutigen Indonesien). Die Venezianer führten Arabica-Kaffee in Europa ein. Nachdem er 1643 Paris erreicht hatte, entstanden dort binnen eines halben Jahrhunderts etwa 250 Kaffeehäuser. 1650 öffnete das erste englische in Oxford, 1685 das erste in Wien. Die Niederländer sandten Arabica-Kaffee in den Botanischen Garten von Amsterdam; ab 1718 kultivierten sie die Abkömmlinge eines Arabica-Kaffeestrauches aus Amsterdam in Surinam. Von dort wurde Arabica-Kaffee nach Französisch-Guayana, in die Karibik, nach Mittelamerika und in den Nordwesten Südamerikas gebracht. Ein erheblicher Teil der heutigen Kaffeeproduktion in der Neuen Welt verdanken wir den Nachkommen des Kaffeestrauches aus Amsterdam.
Die Art Coffea canephora, bekannt als Robusta-Kaffee, kommt ursprünglich aus dem Kongobecken und dem ostafrikanischen Tiefland. Nachdem Arabica-Plantagen im späten 19. Jh. verbreitet von Blattrost befallen worden waren, begann die kommerzielle Kultivierung und Verbreitung der gegen Blattrost resistenten Art Coffea canephora in Südamerika und Südost-Asien.
Bis in das frühe 20. Jh. wurde nahezu der gesamte weltweit genutzte NATURGUMMI wilden Kautschukbäumen (Hevea brasiliensis) im Amazonasbecken entnommen. Da Gummiprodukte für Elektrizitätsprodukte, Fahrräder und Autos unersetzlich waren, explodierte der weltweite Bedarf bald. In Kew Gardens aus brasilianischen Heveasamen gezogene Setzlinge wurden 1878 nach Sri Lanka, Singapur und Java gebracht. Bedeutende Pflanzungen von Kautschukbäumen begannen auf der Malaiischen Halbinsel und Singapur Ende des 19. Jh. Bald darauf wurde Malaya (heute Malaysia) zum bedeutendsten Kautschukproduzenten. Der Kautschukstrauch wird auch in einigen Ländern Afrikas angebaut, jedoch nur in Liberia mit gewissem Erfolg.
(Natural History Museum, 2013; http://www.nhm.ac.uk/nature-online/life/plants-fungi/seeds-of-trade/page.dsml?section=crops)
Die Faser der Industriellen Revolution
Seit Jahrtausenden transportieren Menschen Pflanzensamen von Region zu Region. Gezielte Pflanzentransfers ermöglichten die polynesische Kolonisierung Pazifischer Inseln und später koloniale Eroberungen in Afrika, Asien und der Neuen Welt durch Europäer. In der zweiten Hälfte des 20. Jh. setzten international agierende Unternehmen wenige Hochleistungssorten in vielen Regionen der Erde durch; einheimische Sorten wurden so verdrängt. Drei Viertel der genetischen Diversität der Kulturpflanzen gingen verloren. Von etwa 30.000 verzehrbaren Kulturpflanzenarten werden heute nur 30 Arten genutzt, um 95% der Nahrungsmittelenergie für Menschen zu erzeugen. Mehr als die Hälfte davon kommt aus Reis, Weizen, Mais und Hirse. (IPBES, 2013)
Doch Pflanzen sind nicht nur Grundlage der Ernährung, sondern auch unserer Kleidung. Eine der Pflanzengattungen, deren Verbreitung erhebliche soziale und gesundheitliche Auswirkungen auf Menschen und bedeutende Umweltveränderungen zur Folge hatte, ist die Baumwolle, botanisch Gossypium. In den natürlichen Ökosystemen der Subtropen und Tropen gediehen mehrere Dutzend Baumwollarten. Es sind Kräuter oder Sträucher mit giftigen, kugeligen Samenkapseln, die etwa 1,5 bis 5 cm lange, zumeist weiß-graue Samenhaare enthalten: die Baumwollfasern. Diese bestehen aus zahlreichen gedrehten Zelluloselagen. Die längeren können zu dünnen, reißfesten, langlebigen und hautfreundlichen Baumwollfäden gesponnen werden, die Schmutz und ölige Flüssigkeiten aufnehmen und wieder abgeben können.
Schon früh erkannten Menschen den Nutzen der Faserpflanze. Mehrere Baumwollarten wurden offenbar unabhängig voneinander in Asien, Nord- und Südamerika domestiziert und als einjährige Pflanzen kultiviert. Wohl bereits um etwa 5.000 v. Chr. bauten Menschen den Baumwollstrauch Gossypium hirsutum auf der Yucatán-Halbinsel in Mittelamerika und die ausdauernde Art Gossypium barbadense in den westlichen peruanischen Anden an. Spätestens um 3000 v. Chr. wurde in Indien Gossypium arboreum domestiziert. Schon um 650 v. Chr. gelangte sie von dort nach Vorderasien und weiter nach Nordostafrika und Südosteuropa.
Die Verbreitung von BAUMWOLLARTEN.
Gossypium barbadense breitete sich im 17. Jh. von Peru bis Nordargentinien aus. Samen dieser Art wurden 1786 von Westindien nach South Carolina (USA) gebracht und hier zu der einjährigen Varietät »Sea Island Cotton« gezüchtet. Ihr Anbau erfolgte in den Küstenräumen von North und South Carolina, Georgia und Florida. Gossypium barbadense wurde auch aus der Karibik und von Ostbrasilien nach Westafrika gebracht, wo diese Art später die Basis des nigerianischen Baumwollanbaus bildete. Einige Pflanzen gelangten um 1820 – möglicherweise entlang von Sklavenhandelswegen – in den Sudan und in das ägyptische Niltal. 1850 wurden sie dort mit einjährigem »Sea Island Cotton« gekreuzt. So entstand eine haltbare einjährige Sorte, die bewässert werden konnte und einen höheren Preis erzielte als transatlantische Baumwolle. Gossypium hirsutum wurde dagegen bereits vor 1700 nach Westafrika eingeführt und südlich der Sahara verbreitet sowie um 1700 in die britischen Kolonien im Südosten Nordamerikas gebracht. Dort gedieh sie im Binnenland als »Upland Cotton« prächtig.
1793 entwickelte der Bauernsohn und Erfinder Eli Whitney offenbar mit Unterstützung der Plantagenbesitzerin Catherine Littlefield Green eine Entkörnungsmaschine (»Cotton Gin«), die den entscheidenden Engpass bei der Baumwollverarbeitung beseitigte und die Trennung der Baumwollfasern von den Samenkapseln und den Samen 50-mal schneller machte. Der Preis für Baumwolle sank daraufhin stark.
In England verbilligten mit Wasserkraft und später mit Dampfkraft betriebene Spinn- und Webmaschinen den Preis des Baumwolltuches der weltweit führenden englischen Textilindustrie weiter. Die nordamerikanischen und britischen Erfinder hatten derart günstige Verarbeitungsbedingungen geschaffen, dass ab 1840 mehr als die Hälfte des globalen Bedarfs an Baumwolltuch im englischen Lancashire unter Verwendung von Rohbaumwolle aus dem Südosten der USA produziert werden konnte. Diese Erfindungen waren zweifellos wichtig für die Massenproduktion von Baumwolltuch, es wird ihnen auch eine entscheidende Rolle bei der Industriellen Revolution zugesprochen. Doch ohne den massiven und brutalen Einsatz afroamerikanischer Sklaven auf den Baumwollfeldern hätte die Produktion im Südosten der USA nicht entscheidend gesteigert werden können. Der amerikanische Bürgerkrieg schnitt dann in den frühen 1860er-Jahren den Nachschub der US-Baumwolle nach England ab. Dadurch wurden Baumwollanbau und -verarbeitung in vielen anderen Gebieten der Erde stimuliert.
1892 wurde der Baumwollkapselkäfer (Anthonomus grandis) – von Mexiko kommend – zum ersten Mal in den USA gesichtet. 1920 waren alle Baumwollanbaugebiete in den USA infiziert; der Schädling breitet sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 190 km im Jahr aus. Die Ökonomie der Südstaaten war völlig auf Baumwolle zentriert. Der Schädlingsbefall hatte daher einen umfassenden Einfluss auf die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse und veränderte die Region tief greifend. Doch kaum war nach dem Zweiten Weltkrieg das Insektizid DDT verfügbar geworden, wurde es in großem Stil auf Baumwollplantagen ausgebracht. Mitte der 1950er-Jahre war der Käfer dagegen resistent geworden, die Erträge sanken wieder. In den 1970er-Jahren entwickelte die amerikanische Regierung ein Programm der integrierten Schädlingsbekämpfung, in dem Pheromonfallen eine wichtige Rolle spielen. Mit diesen Pflanzenhormonen können Käfer angelockt werden. Dazu kommen chemische Schädlingsbekämpfungsmittel und das Unterpflügen der Baumwollpflanzenreste, um ein Überwintern der Insekten zu verhindern. Baumwollfelder werden heute in den USA genauestens überwacht, um bei Schädlingsbefall sofort eingreifen zu können. Die USA haben durch ihr integriertes Monitoringprogramm den Verbrauch an Schädlingsbekämpfungsmitteln drastisch gesenkt und in einigen Gegenden den Käfer praktisch ausgerottet. Das »International Cotton Advisory Committee« bemüht sich um Wissenstransfer und Empfehlungen, doch wird es immer wieder zu Schädlingsproblemen kommen, solange es großflächige Monokulturen gibt. (SMITH, 2007; LANGE & RHODE, 2009)
Etwa jede zehnte Tonne der Gesamtmenge weltweit produzierter Pestizide wird heute auf Baumwolle ausgebracht, vor allem zur Bekämpfung der Schädlinge. Einige mechanisierte Großbetriebe, die zum Beispiel in Texas niedrig wachsende und daher besser gegen Sturmschäden geschützte Sorten anbauen (»Storm Proof Cotton«), nutzen Entlaubungsmittel, um vor der Ernte das grüne Kraut abzutöten und so eine Ernte mit Pflückmaschinen zu ermöglichen. Geringe Lohnstückkosten gehen hier vor Qualität, da handgepflückte Baumwolle meistens bessere Qualität aufweist als maschinengeerntete, die auch unreife, überreife und verschmutzte Samenkapseln enthält.
Baumwollverarbeitung um 1900 in Deutschland Einen großen Aufschwung verzeichnete die Baumwolle verarbeitende Industrie in der zweiten Hälfte des 19. Jh. auch in Mitteleuropa. Im frühen 20. Jh. arbeiteten im Deutschen Reich Menschen an 236.000 Baumwollwebstühlen und mit etwa 10 Millionen Spindeln. 1906 wurden 447 243 Tonnen Rohbaumwolle in das Deutsche Reich eingeführt. (Meyers Großes Konversations-Lexikon, 1909)
Der industrielle Anbau von Baumwolle geht mit weiteren erheblichen Umweltbelastungen einher. Obwohl der Wasserbedarf von Baumwolle hoch ist, wird sie seit dem 19. Jh. auch in subtropischen Trockengebieten angebaut. Wasser des Nils wird auf ägyptische und sudanesische Baumwollfelder geleitet. Der von der Regierung der Sowjetunion verfügte Aufbau eines gigantischen Baumwollanbausystems auf bewässerten Großfeldern in den ehemaligen Sowjetrepubliken Usbekistan, Turkmenistan und Kasachstan bewirkte durch die Entnahme von Bewässerungswasser aus den Zuflüssen Amudarja und Syrdarja die dramatische Schrumpfung des Aralsees und erhebliche Veränderungen nicht nur des regionalen Klimas seit den 1960er-Jahren (vgl. S. 118). Etwa 60.000 Fischer mussten ihre angestammten Siedlungen am Ufer des Aralsees verlassen. Viele wurden mangels Alternativen auf den Baumwollplantagen tätig. (BAINES, 1835; WENDEL et al., 2010)
BAUMWOLLERNTE durch Afroamerikaner in den USA. (Postkarte ca. 1915–1930)
Risikomanagement im frühneuzeitlichen Europa
In der traditionellen Landwirtschaft hatten Nutztiere viele Funktionen: Ihre Arbeitskraft war auf den Feldern ebenso nötig wie ihre Verdauungsprodukte, die als wertvoller Dünger unverzichtbar waren. Neben Nahrung lieferten sie auch viele Rohstoffe, etwa Wolle, Leder oder Horn. Tierseuchen waren daher eine große Bedrohung für die alteuropäischen Agrargesellschaften. Im Alten Testament (Ex. 9,1–12) ist als eine der ägyptischen Plagen eine Viehseuche beschrieben; der römische Dichter Vergil schilderte in den »Georgica« eine Tierseuche mit dramatischen Worten.
Der römische Dichter Vergil über eine schreckliche Viehseuche
Grimmvoll tobt und ans Licht aus stygischen Nächten gesendet,
Treibt vor sich die blasse Tisiphone Seuchen und Angst her,
Höher mit jedem Tag ihr gieriges Antlitz erhebend.
Jammergeblök der Herden und häufiges Brüllen erschallet
Ström’ und trockene Ufer entlang und Flächen der Berge
Und schon wütet in Scharen die Würgerin; selbst in den Ställen
Häuft sie die Leichen empor, von gräßlichem Moder zer fallen,
Bis man mit Erde zu decken sie lernt und in Gruben zu bergen.
Denn nicht war zum Gebrauche die Haut und die Menge des Fleisches, …
(VERGIL, Georgica, 3, 551–559)
Viehseuchen wirkten sich auf die wirtschaftliche Situation der Viehhalter massiv aus, da in den Herden ein Gutteil des agrarischen Kapitals gebunden war. Seuchen beeinflussten Handel und Gewerbe und bewegten deshalb die Gesellschaft. In der Frühen Neuzeit avancierte ihre Bekämpfung oder zumindest Eindämmung zu einem zentralen Anliegen vieler europäischer Staaten.
Magische Praktiken, Pülverchen und Tinkturen zweifelhafter Zusammensetzung – vom immerhin desinfizierend wirkenden, wenn auch giftigen Antimon über den Absud von Ameisenhaufen und Heusamen bis zu Bußen und Wallfahrten – sollten gegen die Viehseuchen helfen, deren Ursache bis zur Entdeckung der Krankheitserreger im Dunkeln blieb. Viele dieser Mittel blieben wirkungslos. Wie Kai Hünemörder zeigen konnte, war die Haltung der Obrigkeit zu diesen Praktiken keineswegs ablehnend: »In Norddeutschland wurden gegen die ›wahre Hornviehseuche‹ seit der ersten Seuchenwelle der 1710er-Jahre Hunderte überlieferter Hausrezepte erprobt. Die Landesadministrationen beförderten dies sogar noch, indem sie Rezepte sammeln und publizieren ließen. So empfahl Preußen 1745 in einem einzigen Avertissement gleich 26 verschiedene Rezepte. […] Friedrich II. [setzte] 1000 Ducaten auf ein wirksames Heilmittel gegen die Rinderpest aus. Unter den zahlreichen Einsendungen, die vom Generaldirektorium und Collegium Sanitatis bewertet und getestet wurden, befanden sich keineswegs nur des Aberglaubens unverdächtige Mittel. Im Ergebnis gelang es niemandem, die Wirkung seines Wundermittels durch ›bewährte Proben‹ zu beweisen.« (HÜNEMÖRDER, 2007: 25)
Als wirksam erwiesen sich Viehbeschau, Quarantäne und Einfuhrbeschränkungen. Die »Nachfahren« der damals erstmals eingesetzten Experten sind die Amtstierärzte, zu deren Kernaufgaben es bis heute zählt, die Ausbreitung von Tierkrankheiten zu verhindern. Quarantäne, die Abschottung infizierter Personen oder Tiere, war eine erfolgreiche, wenn auch oft schwer durchsetzbare Maßnahme. Das Wort stammt vom italienischen »quaranta« (auf Deutsch: vierzig) – so viele Tage dauerte die Anhalteperiode für Personen, die unter dem Verdacht standen, eine infektiöse Krankheit einzuschleppen. Im Januar 1748 verfügte der Provveditore generale, der venezianische Gouverneur des norditalienischen Friaul, dass acht Patrouillenboote nachts den Isonzo absichern mögen. Niemand sollte im Schutz der Dunkelheit den Fluss überqueren. Soldaten sollten in Wald und Flur nach Anzeichen von Eindringlingen suchen, alle Straßen wurden blockiert. Ziel dieser Anordnungen war nicht etwa ein feindliches Heer, sondern Vieh aus Ungarn. Eine Atemwegserkrankung war unter den Rindern im Friaul ausgebrochen und der Verdacht richtete sich auf importiertes Vieh als Überträger. Auch im Land musste der Seuche, wenn möglich, Einhalt geboten werden. Die routinierten Beamten brauchten nur zwei Wochen, bis jeder Stall im Friaul auf kranke Tiere untersucht war, schließlich war Ähnliches schon 1710 und 1711 geschehen.
Bereits 1687 war eine große Viehseuche auf venezianischem Territorium ausgebrochen, alle fünf bis zehn Jahre traten danach Seuchen auf. Im venezianischen Hafen von Marghera und auf dem Lido, wo Viehmärkte stattfanden, musste jedes einzelne Tier von einem geschulten Beamten überprüft und freigegeben werden. In der Praxis versuchten die Händler allerdings, möglichst noch vor der Überprüfung zu verkaufen.
Im 18. Jh. hatte der weiträumige Viehhandel von Mitteleuropa nach Süden und Westen ein bis dahin nie gekanntes Ausmaß erreicht. Über Venedig lief der Fernhandel nach Süden. Vieh aus der ungarischen Tiefebene wurde bis nach Neapel gebracht. Gleich, ob die mit Graurindern bestückten Viehweiden der Puszta unter osmanischer oder habsburgischer Herrschaft standen, hier lag das Zentrum der Viehhaltung und von hier aus konnten sich auch Viehkrankheiten ausbreiten.
Venedig hatte damals etwa 120.000 Einwohner. Im Jahr 1792 verarbeitete der Schlachthof in San Giobbe zwischen 300 und 350 Rinder pro Woche, also rund 18.000 Tiere pro Jahr. Mehr als 40.000 Stück Vieh durchliefen die beiden venezianischen Quarantäneplätze auf dem Weg in die Küchen und Gewerbebetriebe Norditaliens. Davon kamen 35.000 von außerhalb venezianischen Gebiets, die meisten über den Landweg aus dem europäischen Viehzuchtzentrum Ungarn, der Rest erreichte Venedig auf dem Seeweg. Habsburgische Exporte nahmen den Weg über den Isonzo, osmanische kamen über den Hafen von Zadar nach Venedig. Auch über den Brennerpass durch die Grafschaft Tirol wurde viel Vieh nach Venedig getrieben. Vom Umgang mit Viehseuchen in der Drehscheibe Venedig hingen nicht nur Venedig und sein Hinterland ab, sondern ein Großteil Italiens. Vieh aus verschiedenen Regionen Europas traf in Venedig zusammen, damit waren alle Voraussetzungen für die Ausbreitung von Viehseuchen gegeben. Die »Rinderpest« (der damalige Sammelname für alle Rinderkrankheiten) war im venezianischen Gebiet im 18. Jh. zum immer wiederkehrenden Problem geworden, ein fester Bestandteil ländlichen Lebens, so wie auch in Frankreich, Deutschland und Großbritannien.
Krankheitserreger folgten überall den weiträumigen Bewegungen großer Herden; die zunehmend überregional organisierte Versorgung beförderte die Ausbreitung von Viehseuchen. In Italien gefährdeten diese aber nicht nur die Fleischversorgung. Die italienische Landwirtschaft stützte sich fast ausschließlich auf Rinder als Nutztiere. Daher bedrohte eine außer Kontrolle geratene Seuche nicht nur Fleischkonsum und Milchproduktion, sondern auch die Fähigkeit, das Grundnahrungsmittel Getreide herzustellen. Im Licht dieser zentralen Bedeutung ist es kein Wunder, dass Venedig und andere italische Staaten ein unmittelbares Interesse an der Kontrolle der Verbreitung von Zoonosen entwickelten. Gab es Seuchenverdacht, mussten venezianische Diplomaten im Ausland über den Zustand des dortigen Viehs berichten. Bei begründetem Verdacht wurde ein Handelsembargo ausgesprochen, Grenzen wurden dichtgemacht und das Militär für die Grenzsicherung verwendet.
Die Viehbeschau wurde immer mehr zentralisiert. Die Venezianer übertrugen dem Provveditore alla sanità, jenem Beamten, der für den Umgang mit Pest und anderen menschlichen Krankheiten zuständig war, auch die Aufgabe der Kontrolle von Viehseuchen. Rinder, die an einer Tierseuche gestorben waren, wurden behandelt wie Pestleichen: Die Kadaver mussten in einer nicht weniger als acht Fuß tiefen Grube begraben und mit mehreren Zentimetern Kalk bedeckt werden, ehe die Grube wieder abgedeckt wurde. Der Boden von Ställen, in denen sich tote Tiere befunden hatten, musste abgegraben und mit Kalk und neuer Erde bedeckt werden. Weiden, auf denen betroffene Tiere gegrast hatten, waren für gesunde Tiere bis zum Ende der Seuche tabu. Hygienemaßnahmen wie diese, Quarantäne und Abriegelung des Territoriums blieben wirksame, wenn auch aufwendige Maßnahmen gegen die Verbreitung der Viehseuchen, zu einer Zeit als es weder Impfungen noch Heilmittel gab.
Der Kampf gegen Seuchen war nötig geworden, weil die Ausweitung der Handelsvolumina und der Wege auch den Pathogenen neue Verbreitungsmöglichkeiten erschlossen hatte. Er beförderte administrative Zentralisierung und territoriale Abgrenzung. Wir haben es auch in diesem Fall mit einer gesellschaftswirksamen Nebenwirkung der Wechselwirkung von Natur und Menschen zu tun. (APPUHN, 2010)
Ein typisches Rezept gegen Viehkrankheiten aus dem 18. Jahrhundert
»Man nimt 2 Pfund reife Wacholderbeeren, trocknet sie in einem ausgeheizten Ofen, auf Stroh oder einem Sieb, langsam und so gelinde, daß sie weder versengt noch verbrannt werden; dann stößt man sie zu Pulver, und siebt sie sorgfältig durch ein Haarsieb, damit keine groben Theile darunter kommen. Unter diese fein gestoßenen Beeren mischt man 1 Pfund pulverisirten grauen Roßschwefel, und 1 Pfund pulverisiertes Antimonium crudum. Diese Masse verwahrt man in einem glasirten Krug, oder in einer gut verkorkten Bouteille.« (OLOFSON, 1790: 477)
Traf Vieh auf engem Raum zusammen, etwa bei VIEHMÄRKTEN, kam es immer wieder zur Übertragung von Viehseuchen (Argentinien). (Postkarte, gelaufen am 18.4.1920)
Die Geschichte der Guanoproduktion in Peru
Justus von Liebigs (1803–1873) revolutionäre Entdeckung der ertragssteigernden Wirkung von Mineraldünger machten 1840 Stickstoff, Phosphor und Kalium weltweit zu überaus begehrten Substanzen. Guano, ein trockenes Vogelexkrement, enthält diese Elemente in hohen Mengen. In sehr niederschlagsarmen Klimaten kann der Guano sich über Jahrtausende viele Meter hoch an den Landstandorten von Seevögeln anreichern, ohne dass die begehrten Stoffe ausgewaschen werden. Besonders ergiebige Guanovorkommen besaßen daher die südliche Pazifikküste Perus und die vorgelagerten kleinen Inseln. Hier fließt der kalte, nährstoffreiche Humboldtstrom entlang der Küste nach Norden, sein Fischreichtum ernährt viele Seevögel. Unmittelbar nach der Entdeckung Liebigs begann hier die Plünderung der Guanovorkommen. Nach nur vier Jahrzehnten war das »weiße Gold« 1880 weitgehend abgebaut und hauptsächlich nach England exportiert worden. Die Produktion brach zusammen und im Salpeterkrieg (1879–1883) wurden die Gewinne schnell verbraucht.
Nach diesem ökonomischen Desaster suchte die peruanische Regierung nach Wegen, die darniederliegenden Staatsfinanzen zu sanieren. Dafür sollte wiederum Guano dienen. Heute ist bekannt, dass die Zahl der Guanovögel im Wesentlichen vom Nahrungsangebot an Fischen abhängt. Deswegen sinkt ihre Zahl während El-Niño-Ereignissen, einem Klimaphänomen, das in Abständen von mehreren Jahren jeweils über neun bis zwölf Monate zur starken Erwärmung des Meerwassers vor Peru, zu erheblich geringeren Nährstoffgehalten und damit zu einem Abwandern der Fischschwärme und der Seevögel führt.
In der ersten Hälfte des 20. Jh. wurde von der peruanischen Regierung ein ausländischer Experte nach dem anderen beauftragt, Wege zu finden, die Guanoproduktion zu steigern. Deren Empfehlungen hatten weitreichende ökologische Konsequenzen. 1906 wurde der US-amerikanische, auf Austern spezialisierte Zoologe Robert E. Coker (1876–1967) eingeladen, wissenschaftliche Prinzipien zum Schutz und zur Reproduktion von Guanovögeln zu formulieren. Coker war sicher: Wenn die Peruaner aufhörten, sich wie Raubtiere gegenüber den Guanovögeln zu benehmen, und sie als »Haus- und Nutztiere« betrachteten, wäre die Produktion ausreichend. Coker empfahl ein staatliches Monopol. Alle Inseln an der Küste müssten in ein Vogelschutzgebiet umgewandelt werden, private Nutzung müsste verboten werden. Eine Schonzeit sollte eingeführt werden, um die Vögel nicht beim Brüten zu stören; die Inseln sollten maximal jedes zweite Jahr beerntet werden. Coker schätzte auch erstmals den Wert der Vögel ab: Je Brutpaar entstünde Guano im Wert von 15 US-Dollar pro Jahr.
Die lokalen Fischer hatten vorher geglaubt, dass es eine Art »Abkommen« zwischen den Guanovögeln und den Seelöwen (Otaria flavescens) gäbe: Die Seelöwen griffen von unten an und trieben damit die Fische zur Oberfläche, wo die Guanovögel (und die Fischer) sie leicht erreichen konnten. 1896 hatte Peru aufgrund dieses Volksglaubens die Jagd auf Seelöwen verboten. Coker war der Ansicht, dass die Seelöwen keinen Einfluss hätten und daher aus der Sicht der Guanoindustrie keine Bedenken bestehen würden, ihre Häute, ihr Öl, Fleisch und ihre Barthaare ökonomisch zu verwerten. 1910 wurden die Jagd auf Seelöwen wieder erlaubt und in einer einzigen Saison 36 500 Seelöwen erlegt.
Guano produzierender BLAUFUSSTÖLPEL auf der Galápagos-Insel Floreana.
Weihnachten 1911 traf als nächster Experte der schottische Forscher Henry O. Forbes (1851–1932) ein. Er lieferte im Februar 1913 einen Bericht ab, der festhielt, dass El Niño, parasitische Insekten und Raubvögel Bedrohungen der Guano liefernden Vögel darstellten, wichtiger aber seien Fehler im Management. Küstenfischer und Guanoarbeiter würden Eier und Küken stehlen; die Ernte durch unabhängige Vertragsnehmer, die kurzfristigen Profit machen wollen, gefährde die Vögel. Eine bewaffnete Wächtertruppe mit Motorbooten sollte eine Sperrzone um die Inseln kontrollieren; die natürlichen Feinde der Guanovögel sollten systematisch vergiftet oder erschossen werden. Auch Empfehlungen aus dem »Forbes-Bericht« wurden umgesetzt. Es gab nun zwar keine Eindringlinge mehr, aber die Wächter selbst wurden zum Problem, denn sie wurden schlecht bezahlt und jagten zur Aufbesserung ihrer Ernährung die Vögel. Wirksam war dagegen der Kampf gegen Raubvögel: Allein im Februar und März 1917 wurden auf den südlichen Inseln mehr als 5000 Möwen geschossen, sie wurden ebenso wie andere Raubvögel systematisch bejagt.
Nach dem El-Niño-Ereignis von 1917 wurden dann die mikroskopischen Parasiten in den Blick genommen. Arbeiter warfen Tonnen von Steinen von den Inseln ins Meer, um Zecken, die unter den Steinen lebten und sowohl Arbeiter wie Vögel bissen, zu eliminieren. Es wurde vermutet, dass die Zecken über ihr Blut Parasiten weitergaben.
In den 1930er-Jahren wurde ein Ornithologe eingeladen, um die Guanoproduktion zu steigern: Der US-amerikanische Ornithologe William Vogt (1902–1968) interpretierte den klimatischen Einfluss von El-Niño-Ereignissen als Ursache von Nahrungsmangel. Die Vögel hungerten, da es weniger Fische gab.
Vogt evaluierte auch die Empfehlungen früherer Experten. Es gab, was er am eigenen Leib spürte, viele Zecken. Denn die Entfernung der Steine hatte auch den Unterschlupf von wesentlichen Räubern der Parasiten beseitigt: Spinnen und Eidechsen brauchen Steine, um ihre Körpertemperatur während des Tages zu regulieren. Er schlug nun vor, Hunderte kleiner »Betonschutzbauten« für die Fraßfeinde zu errichten, um die »natürliche Parasitenkontrolle« auf den Inseln zu unterstützen. Da Vogt auch festgestellt hatte, dass den Vögeln Wind gut tat, sprengte die verantwortliche Compañía Administradora del Guano (CAG) einige der Felsen, die den Wind abhielten. Das bei den Sprengungen abgelöste Gestein wurde zur Errichtung langer Trockenmauern verwendet, die durstige Küken davon abhalten sollten, sich ins Wasser zu stürzen (und darin umzukommen). Erwachsene Vögel sollten sich nicht mehr vom Klippenrand ins Meer stürzen können, da sie dabei ihre Exkremente abließen, die ins Meer fielen, und damit für die Guanoproduktion verloren waren.
Vogt hatte festgestellt, dass Nahrungsmangel und Konkurrenz um Nistplätze die wesentlichen begrenzenden Faktoren der Guanoproduktion waren. Während der El-Niño-Ereignisse zogen die meisten Vögel nach Süden, wo es allerdings keine guten Nistmöglichkeiten gab. Die CAG baute daraufhin von 1946 bis 1961 14 »Inseln«, indem sie Mauern um entsprechende Küstenstriche zog, die bereits von Guanovögeln benutzt wurden. Das wirkte sich aus: 1956 wurde die Rekordernte von 332 223 Tonnen frischen Guanos erreicht, der 6200 Tonnen Kalium, 31 600 Tonnen Phosphat und 47.000 Tonnen Stickstoff enthielt.
Der Zusammenbruch der Fischerei vor Kalifornien und der Glaube an den freien Markt bewirkten danach trotzdem ein schnelles Ende der Guanoindustrie. Der Internationale Währungsfonds und ein neoliberaler Ökonom, Pedro Beltrán, übernahmen 1959 die Planung der peruanischen Nationalökonomie. Der freie Markt sollte fortan über das Schicksal der marinen Umwelt Perus entscheiden; Fische waren mehr wert als Vögel. Fischereiausrüstung wurde nach dem Zusammenbruch der kalifornischen Fischbestände von dort nach Peru transferiert. Die peruanische Fischmehlindustrie erfuhr einen enormen Aufschwung. 1962 hatte Peru Japan als größten Fischmehlproduzenten abgelöst.
Nach einem starken El-Niño-Ereignis fiel die Vogelpopulation 1957 auf ein Drittel; tote Vögel wurden in Massen an den Strand gespült. Auch im Sommer 1965 führte ein El-Niño-Ereignis bei den nun knappen Fischressourcen zu einem massiven Vogelsterben, Tausende verhungernde Vögel stürzten sich auf Fische, die in Küstendörfern auf Marktständen zum Verkauf ausgelegt waren.
Der US-amerikanische Biologe Milner B. Schaefer (1912–1970) wurde in den 1960er-Jahren von der Fischereiindustrie beauftragt, Guanovögel in ein Populationsmodell der Anchoveta-Fischerei einzubeziehen. Er errechnete, wie viel Peru von einem Rückgang der Guanovögel profitieren würde. Die Mortalität von 1965 erklärte er mit dem El-Niño-Ereignis und bestritt, dass Nahrungskonkurrenz durch die Fischerei die Ursache sein könnte.
Mit seinen Berechnungen war das Schicksal der Vögel besiegelt. 1966 wurden alle Schutzregeln aufgehoben. Seitdem sind die Populationen der Guanovögel immer auf ähnlicher Höhe (wenige Millionen Individuen) geblieben. Die ehemalige Exportindustrie hat nur mehr Nischenbedeutung; das ökologische Erbe der Expertenempfehlungen ist allerdings weiterhin präsent.
(CUSHMAN, 2005; OLINGER, 1980)
Werbung der Firma Allison & Addison (Richmond, Virginia) für GUANO als Dünger für Baumwolle und Getreide aus dem Jahr 1884.
Empfindliche Ökosysteme im Zeitalter der Globalisierung
Die vulkanischen Inseln des Galápagos-Archipels säumen im östlichen Pazifischen Ozean 900 bis 1200 km westlich von Südamerika den Äquator. Normalerweise fallen dort in den tieferen Lagen Jahresniederschläge von wenigen Hundert Millimetern. Die Witterung ändert sich dramatisch, wenn es zu einem El-Niño-Ereignis kommt, der Jahresniederschlag ist dann bis zu zehnmal höher. Alle drei bis zehn Jahre um den Jahreswechsel tritt El Niño auf und dauert einige Monate. Oberflächennah wird der Pazifik in solchen Jahren bis zu 8 °C wärmer als in »Normaljahren«. Diese Klimabedingungen ließen ein einzigartiges Ökosystem mit zahlreichen endemischen Tier- und Pflanzenarten entstehen, die sich nicht selten von Insel zu Insel auf Art- oder Unterartniveau unterscheiden. Die regelmäßigen Wechsel zwischen »Normal«- und El-Niño-Jahren wirken sich stark auf die Lebewesen aus. Der Meeresleguan (Amblyrhynchus cristatus) beispielsweise ernährt sich von einer Grünalgenart (Ulva lactuca), die an die kühlen Wassertemperaturen der Normaljahre angepasst ist und im warmen Wasser der El-Niño-Jahre abstirbt. Algenarten, die für Meeresleguane unverdaulich oder gar toxisch sind, vermehren sich im warmen Meer dagegen stark. So ging die Population der Meeresleguane während des El-Niño-Ereignisses 1982/1983 auf Galápagos um etwa 60% zurück. In den folgenden Jahren wuchs sie wieder etwa auf die ursprüngliche Stärke an – ein typischer Lebenszyklus in diesem Ökosystem. Die auf den Inseln heimischen Arten sind an regelmäßig wechselnde Niederschlagsbedingungen angepasst. Greift der Mensch durch die Einbringung konkurrenzstarker Arten oder die Vernichtung endemischer Arten ein, verändert sich das Ökosystem dramatisch.
Touristen möchten das Außergewöhnliche erleben. Die Einzigartigkeit des Ökosystems des Galápagos-Archipels ist der Grund für seine Hauptgefährdung. Die erforderliche Tourismusinfrastruktur wurde geschaffen: Hotels, Restaurants, Geschäfte, Straßen und Hafenanlagen auf der Insel Santa Cruz, ein Flughafen auf der benachbarten Insel Baltra und auf zahlreichen Inseln Touristenpfade. Die Einwohnerzahl des Galápagos-Archipels erhöhte sich von etwa 1300 in den 1950er-Jahren auf 25 124 im Jahr 2010. Die Touristenzahlen wuchsen von etwa 2000 im Jahr 1969 auf 180 831 im Jahr 2012. Touristen verbrauchen Trinkwasser und erzeugen Abwasser und Abfall, doch nicht nur das.
Die Geschichte invasiver Tierarten auf den Galápagos-Inseln begann mit den ersten Europäern im 16. und 17. Jh. Ohne natürliche Feinde vermehrten sich eingeführte Tierarten explosionsartig, wodurch an vielen Standorten die ursprüngliche Vegetation weitgehend zerstört wurde.
Die Nationalparkverwaltung hat zwar eine starke Besucherlenkung und Beschränkung des Tourismus auf wenige Pfade erreicht. Dennoch stören Touristen trotz Begleitung durch ausgebildete Führer in Kolonien lebende Tierarten, die eine Hauptattraktion sind. Das langfristige Problem stellen aber die eingeschleppten Lebewesen dar. Nationalpark-Ranger versuchen, eingebrachte Arten unter Kontrolle zu bringen – in einem nahezu aussichtslosen Kampf, bei dem das Ökosystem zudem weiter verändert wird.
Wie etablieren sich von Menschen eingeführte Arten in einem fremden Ökosystem?
Etwa 90% der Arten, die ein neues Gebiet erreichen, überleben nicht. Die spezifischen Ansprüche einer Art müssen mit den Standortbedingungen des neuen Ortes weitgehend übereinstimmen. Erfolg stellt sich ein, wenn sich eine ausreichend große Individuenzahl einer neuen Art (eine Brückenkopfpopulation) an einem Standort in dem für die Art neuen Gebiet etabliert hat. Einige neue Arten können jedoch stark invasiv werden und das eroberte Ökosystem dauerhaft wesentlich verändern. Sie sind durch Unempfindlichkeit gegen Störungen, eine hohe Reproduktionsfähigkeit sowie eine Plastizität des Genoms gekennzeichnet. Da es am neuen Ort keine auf diese Art spezialisierten Feinde gibt, können sie sich zu Lasten konkurrenzschwächerer einheimischer Arten stark vermehren. (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, 2005: 12)
Durch natürliche Wanderungen gelangten Seevögel, Seelöwen und Seebären in den Galápagos-Archipel. Viele Pflanzenarten erreichten durch den Transport mit Wind und Wasser die Inseln. Andere wurden von Tieren herantransportiert (selbst Laich von Süßwasserfischen kann im Gefieder von Seevögeln über längere Strecken transportiert werden). Neben diesen Möglichkeiten natürlicher Verbreitung ist der Transport von Arten mit dem Menschen entscheidend für die Entwicklung von Ökosystemen geworden. Die Bekämpfung eingeschleppter Arten ist schwierig. Obgleich seit Jahrzehnten ihre verheerende Wirkung besonders auf Inselökosysteme bekannt ist, werden sie weiterhin gezielt oder aus Unüberlegtheit und Unkenntnis eingebracht. (vgl. S. 66)
Nachdem ein Rudel verwilderter Hunde 1970 in einer Bucht auf Isabela einen erheblichen Teil der Meeresleguane getötet hatte, wurden Hundelosungen auf Rückstände von Beutetieren untersucht (BARNETT 1986). Neben Meeresleguanen fanden sich Spuren endemischer Vogelarten und junger Seelöwen (SCHMANDT, 2010: 32). Verwilderte Katzen (die nur auf Baltra ausgerottet werden konnten) bedrohen unter anderem Blaufußtölpel (Sula nebouxii) und Galápagos-Pinguine (Spheniscus mendiculus). Sie fressen auch einheimische Reisfeldratten (Rattus argentiventer) und Eidechsen. So legten Ranger Giftköder aus, um Katzen und Hunde zu töten. In welchem Umfang dadurch auch einheimische Seevögel und Reptilien starben, ist unbekannt.
Verwildertes RIND im Hochland von Floreana.
ganz rechts Wilde ZIEGE, von den Bewohnern Floreanas zum Verzehr gefangen.
Die gefährdete MEERECHSE am Anleger von Puerto Velasco Ibarra auf der Insel Floreana (Galápagos).
Große Bestände der Wanderratte (Rattus norvegicus), der Hausratte (Rattus rattus) und der Hausmaus (Mus musculus) gefährden bodenbrütende Vögel, endemische Wirbellose, Reptilien und Reisfeldratten. Das Aussterben einer endemischen Geckoart und von sieben Landschneckenarten wird auf Wander- und Hausratten zurückgeführt. Deren Ausrottung ist daher für den Artenschutz sehr wichtig.
Im Jahr 2006 wurde die in Afrika heimische invasive Buntbarschart Oreochromis niloticus im See El Junco entdeckt, der im Hochland von San Cristóbal liegt. Ihre Etablierung hat den Bestand an kleinen Ruderfußkrebsen, die eine Massenvermehrung von Algen verhindern können, in dem See bereits stark geschädigt. Die Buntbarsche wurden schließlich vernichtet.
Auch Wirbellose verursachen Probleme. Zur Beseitigung der 1982 eingeschleppten Australischen Wollschildlaus (Icerya purchasi), eines kosmopolitischen Pflanzenschädlings, wurde der Marienkäfer (Rodolia cardinalis) etabliert. Ist dies eine Erfolgsgeschichte biologischer Schädlingsbekämpfung? Zwar hat sich der Marienkäfer bislang nicht offensichtlich negativ auf einheimische Arten ausgewirkt. Die langfristige Entwicklung bleibt jedoch unklar.
Zwei aggressive Feuerameisenarten (Solenopsis geminata und Wasmannia auropunctata) – sie zählen nach der »International Union for the Conservation of Nature« zu den schlimmsten invasiven Arten – haben sich vor allem während niederschlagsreicher El-Niño-Ereignisse derart stark ausgebreitet, dass auch sie zur Bedrohung einheimischer Arten geworden sind. Sie verdrängten auf Española offenbar die endemische Ameisenart Tetramorium bicarinatum. (CAUSTON et al., 2005)
Besonders der Flugverkehr trägt zur Einschleppung von Wirbellosen bei. Im statistischen Mittel brachte jedes Flugzeug 0,71 wirbellose Tiere (Fliegen, Spinnen, Mücken, Ameisen, Motten, Küchenschaben und so weiter) auf den Archipel. Im ersten Halbjahr 2006 waren das mindestens 779 Wirbellose (CRUZ MARTÍNEZ & CAUSTON, 2007: 29). Auch mit Schiffen werden Arten zwischen den Inseln verschleppt. Touristen benutzen vorwiegend Jachten zum Inselhüpfen. So verbreiten sich eingeschleppte Arten selbst auf entfernte Inseln.
Im Fokus der Bekämpfung eingebrachter Arten durch die Verwaltung des 1959 eingerichteten Nationalparks stehen neben einigen weiteren teilweise verwilderten Haustierarten die Ziegen. Auf Santiago wurden in den Jahren 2004 bis 2006 etwa 85.000 und auf Isabela ungefähr 135.000 Ziegen geschossen. Sämtliche auf der Insel Santiago lebende Ziegen, Esel und Schweine wurden inzwischen getötet. Mehr als die Hälfte der Pflanzenarten des Archipels sind heute dennoch bedroht.
Fraß durch eingeführte Tiere reduzierte das Nahrungsangebot derart, dass viele endemische Riesenschildkröten verhungerten; vier von 15 Unterarten sind ausgestorben. Verwilderte Ziegen und Esel sind heute noch auf drei Inseln, Schweine, Katzen und Hunde auf vier sowie Wanderund Hausratten auf 25 Inseln verbreitet. Verwilderte Rinder (Bos taurus) leben nur noch auf Floreana und Isabela. Auch sie werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren ausgerottet. Dann wird die aus Bonn stammende und seit 1932 auf Floreana ansässige Familie Wittmer den Touristen womöglich nicht mehr einen mit dem Fleisch geschossener wilder Rinder zubereiteten Rheinischen Sauerbraten anbieten können. Doch die Bekämpfung eingeführter Tiere wird höchstens schadensbegrenzend wirken. Das »ursprüngliche« Galapágos ist unwiederbringlich verloren. (CARRIÓN, 2009; SCHMANDT, 2010)
Mit der Eisenbahn in die Wildnis von Banff, Kanada
An vielen Orten in der Welt wurden und werden die Interessen von indigenen Menschen, die jagend und sammelnd Landschaften nutzten und nutzen, den Interessen territorial denkender Kolonialherren geopfert. In der kanadischen Provinz Alberta im heutigen Banff National Park war die Vernichtung der Lebensgrundlage oder der rechtliche Ausschluss von der Nutzung natürlicher Ressourcen ausschlaggebend für den Verlust der Identität, der Kultur und damit auch des lokalen Umweltwissens der indigenen Stoney (Nakoda). In der Geschichte des Naturschutzes wird dieser Aspekt der Nationalparkeinrichtung oft im Dunkeln gelassen. Die Rolle der Eisenbahn als treibende Kraft des Wandels wird ebenso kaum gesehen.
Mit der kolonialen Eroberung seit dem 16. Jh. und später dem Bau der Eisenbahnstrecken in den nordamerikanischen Westen, quer durch die Great Plains, die Grasländer des Mittleren Westens, wurden indigene Stämme sukzessive vertrieben. Durch die Dezimierung der Bisonherden entlang der neu verlegten Eisenbahnlinien hatten die Stoney und andere indigene Nationen keine Möglichkeit mehr, ihren Nahrungsbedarf in der Ebene der Great Plains zu decken. Sie mussten im Gebirge jagen und Fallen stellen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Seit den 1790er-Jahren hatten sich die Stoney in die Rocky Mountains zurückgezogen.
Der älteste kanadische Nationalpark, der Banff National Park, wurde 1887 eingerichtet. Er ist nach dem US-amerikanischen Yellowstone (1872) und dem Royal National Park (1879) in der Nähe von Sydney in Australien der drittälteste der Welt. Der etwa 66.000 km2 große Park wird heute jährlich von rund 4 Millionen Besuchern aufgesucht, die den Blick auf die Rocky Mountains genießen und sich an der »Wildnis« erfreuen. Diese Wildnis wurde für die »weiße« Bevölkerung konstruiert, die indigenen Einwohner mussten dafür vertrieben werden. Dabei ging es um die ökonomischen Interessen einflussreicher Touristen, um die Jagd und um die profitable Nutzung der neu erbauten Eisenbahnen.
Das Gebiet des Banff-Nationalparks war damals keineswegs unbewohnt. Dies galt – im Gegensatz zu heute – allerdings nicht als Problem. In neuen Parks wurden bis etwa 1930 sogar Siedlungen für Touristen errichtet. Im Banff-Park lebten 1887 etwa 650 Personen, 1911 waren es bereits 2000. 1904 wurde hier sogar nahe dem Minnewanka-See in Bankhead eine Kohlenmine eröffnet, die als Touristenattraktion angesehen wurde. Die Kohle wurde für den Betrieb der Eisenbahn – der Canadian Pacific Railway – benötigt. Die schlechte Qualität der Kohle und zahlreiche Streiks machten die Mine aber so unprofitabel, dass sie 1922 wieder geschlossen wurde. Heute ist Bankhead als Geisterstadt ein beliebtes Ausflugsziel. Der seit 1912 bestehende Stausee wurde 1941 durch einen neuen Damm vergrößert. Das 1888 am Ufer des viel kleineren, natürlichen Sees angelegte Dorf Minnewanka Landing ist ein beliebtes Ziel für Hobbytaucher.
Natürlichkeit und Menschenleere waren also in den ersten Jahrzehnten des Parks keineswegs ein Ziel der Parkverwaltung, vertrieben wurden nur ganz gezielt die Stoney. Dabei spielte der Antagonismus zwischen Indigenen, die jagten, um zu essen, und Touristen, die für Trophäen jagten, eine gewichtige Rolle. Verträge, die die kanadische Kolonialregierung mit den Vertretern der Stämme abschloss, regelten die Jagdrechte. Der Vertrag mit den Stoney von 1877 hält fest, dass diese das Recht hätten, ihre Jagd weiterhin auszuüben – allerdings mit der Einschränkung, dass dieses Recht wegen Besiedlung, Bergbau, Handel oder anderen Interessen der Regierung jederzeit eingeschränkt werden konnte. 1886 wurde in einer Revision des »Indian Act« festgehalten, dass sich die indigene Bevölkerung an die Jagdgesetze zu halten habe – die an der Trophäenjagd orientierten Gesetze machten aber die Subsistenzjagd nahezu unmöglich. Zu dieser Zeit lebten die Stoney bereits in einer Reservation außerhalb des Nationalparks am östlichen Rand der Rocky Mountains. Hier gab es Weideflächen, aber kein für den Ackerbau geeignetes Land, daher blieb die Jagd wesentlich für ihre Subsistenz.
Eine Ruine in der GEISTERSTADT Bankhead im Banff-Nationalpark.
HISTORISCHE PERSONENWAGEN der Canadian Pacific Railway an der Bahnstation Lake Louise im Banff-Nationalpark (Kanada).
Als 1883 die Eisenbahn durch das Reservat fertiggestellt worden war, wurde Jagdwild ausgesprochen rar: Funkenflug durch die Eisenbahn und mit der Bahn anreisende Besucher verursachten zahlreiche Waldbrände. Aus dem Osten eintreffende Fallensteller auf Pelzjagd taten ein Übriges: Das Wild zog sich zurück; die Wege, die die Stoney zurücklegen mussten, verlängerten sich, ihre Lebenssituation wurde immer prekärer.
Die Eisenbahngesellschaft war auch hier – wie in den USA – die treibende Kraft der Einrichtung eines Nationalparks. Dabei ging es nicht so sehr um den Schutz der Wildnis, sondern um die Zentralisierung der Kontrolle über die ökonomische Verwertung der Landschaften in den Händen der Eisenbahnen. Die Parks waren als elitäre Tourismusprojekte gedacht. Die Gäste der Eisenbahn kamen vorwiegend aus mittleren bis höheren Einkommensklassen. Diese wohlhabenden Touristen waren bereit, erhebliche Summen für einen von allen Anzeichen menschlicher Eingriffe gesäuberten Blick auf die Berge zu bezahlen. Subsistenzpraktiken der indigenen Bevölkerung wurden als Störung empfunden.
George Stewart, ein Bauingenieur und Landschaftsarchitekt, war ab 1887 der erste Leiter des Nationalparks. In seinem ersten Jahresbericht schrieb er, es sei von großer Bedeutung, dass die »Indianer« möglichst aus dem Park ausgeschlossen würden. Sie vernichteten Wild und richteten Verwüstungen unter den Zierbäumen an; dies mache ihre viel zu häufigen Aufenthalte im Park sehr störend.
TOURISMUSWERBUNG von Canadian Pacific Railway.
Hinter der immer weitergehenden Einschränkung der indianischen Jagd standen »weiße« Jäger, nicht Naturschützer. Der ethische Kodex der Freizeitjäger war den Bedürfnissen derer entgegengesetzt, die um ihren Lebensunterhalt jagten: Sich vom Fleisch der Tiere zu ernähren, die Trophäen liegen zu lassen oder diese über von »Weißen« betriebene Souvenirläden an weniger begabte Jäger zu verkaufen – letzteres war inzwischen eine wichtige Lebensgrundlage der Stoney geworden –, galt als unfein. Die Freizeitjäger legten auf »Fairness« wert: Wild musste gescheucht werden, damit man es »sportlich« erlegen konnte, Vögel sollten im Flug geschossen werden. Fische in der Nacht mit Licht anzulocken galt ebenso als unfair wie der Abschuss von weiblichen Tieren oder die Jagd außerhalb der Saison.
Der Park, der ursprünglich rund um heiße Quellen angelegt worden war, wurde mehrfach erweitert, was die Situation der Stoney immer schwieriger machte. Statt die Ursache der Verminderung des Jagdwilds in der Eisenbahn und den damit verbundenen Umweltveränderungen zu suchen, war es einfach, die indigene Bevölkerung zu beschuldigen. Die Regierung sah einen erfreulichen Nebeneffekt darin, die ihrer Lebensgrundlage beraubten Stoney sesshaft zu machen und zur Landwirtschaft umzuerziehen. Innerhalb des Parks wurden manche, die ihre traditionelle Lebensweise aufgegeben hatten, als folkloristisches Element zu einer Touristenattraktion.
Wer nordamerikanische Nationalparks aufsucht, bekommt heute oft auch Spuren indigener Nutzung als Teil der Parkgeschichte präsentiert. Die Idee unberührter Wildnis ist dennoch nach wie vor konstitutiv für die Identität der von europäischen Siedlern abstammenden nordamerikanischen Bevölkerung. (BINNEMA & NIEMI, 2006)
Invasive Spezies von Kaninchen bis Kröte
Australien bietet die spektakulärsten Beispiele von absichtlich eingebrachten Spezies, die lokale Ökosysteme schwer schädigen. Dies hat mit der Naturgeschichte des Kontinents zu tun, der niemals eine Landbrücke nach Asien hatte. Wie sonst auf Inseln hat sich hier auf einer Landmasse, die in der Geologie als Sahul oder Meganesia bezeichnet wird und Australien mit Tasmanien sowie Neuguinea mit einigen weiteren Inseln umfasst, über lange Zeit eine spezifische Flora und Fauna entwickelt. Beuteltiere sind die bekannteste endemische Artengruppe auf dem erst ab 1788 von Briten besiedelten Kontinent.
Die Kaninchenplage, die von Thomas Austin im Jahr 1859 in Geelong, Victoria, durch absichtlich für die Jagd ausgesetzte Tiere verursacht wurde, betrifft heute fast ganz Australien. Austin war Mitglied der australischen Akklimatisationsgesellschaft, die sich, wie ihre Schwestervereine in anderen Siedlergesellschaften, um die Einführung von Spezies aus der alten Heimat bemühte. Die Sehnsucht nach Singvögeln, aber auch der Wunsch, traditionelle Nahrung und Vergnügungen zu ermöglichen, trieben die Eingewöhnungsversuche an. Nicht alle Freisetzungen waren so erfolgreich wie die der Kaninchen. Zehn Jahre nach der Aussetzung der ersten Paare wurden bereits 2 Millionen Kaninchen pro Jahr erlegt, ohne dass die Population darunter nennenswert gelitten hätte. Sie breiteten sich mit großer Geschwindigkeit (über 100 km pro Jahr) aus, fraßen das Land kahl und galten bald als Problem für Landwirtschaft und Viehzucht, dem man 1907 mit einem Zaun quer durch den Kontinent vergeblich Herr zu werden versuchte. Pflanzennahrung für Schafe wurde knapper, die Schafhaltung war ökonomisch gefährdet. Die Siedler hatten die Tragekapazität des Kontinents für Schafe ohnehin überschätzt, zudem fressen Schafe und Kaninchen ähnliche Nahrung; eine Lösung musste gefunden werden.
Die Suche nach einem biologischen Mittel zur Bekämpfung der Kaninchenplage führte nach Südamerika. Hier ruft die Kaninchenpest (Myxomatose) bei brasilianischen Waldkaninchen (Sylvagus brasiliensis) nur milde Krankheitserscheinungen hervor, weil Krankheitserreger und Wirt aneinander angepasst sind. Ende des 19. Jh. starben dagegen Laborkaninchen in Uruguays Hauptstadt Montevideo, die vermutlich durch Moskitos mit Myxomatose infiziert worden waren, reihenweise an der Krankheit. Bereits Ende der 1920er-Jahre wurde daher vorgeschlagen, australische Kaninchen mit dem nur für Kaninchen gefährlichen Virus zu infizieren. Erste Versuche schlugen fehl, weil die Experimentatoren nicht bedacht hatten, dass Myxomatose eine von Insekten übertragene Krankheit ist. Erst als man durch intensive entomologische Studien die wenigen Insektenarten identifiziert hatte, die als Vektoren infrage kamen, erzielte man Erfolge; diese aber waren nur von kurzer Dauer. Virus und Kaninchen veränderten sich genetisch. Jene Varianten des Virus, die Kaninchen zwar krankmachten, sie aber am Leben ließen, konnten sich besser verbreiten als virulentere Varianten, einfach weil der Zeitraum, der einem Moskito zur Verfügung stand, den Erreger von einem kranken Kaninchen aufzunehmen und zu verbreiten, länger war. Zudem waren jene wenigen Kaninchen, die eine Infektion überlebten, die Eltern eines Großteils der nächsten Generation: So breitete sich Resistenz bereits in den späten 1950er-Jahren aus. Dort, wo es wegen Trockenheit zu wenige Vektoren gab, war die Infektion von vorneherein nur durch Fangen von Kaninchen und händische Übertragung des Erregers möglich gewesen. Eine Ausrottung der Kaninchen durch Myxomatose hätte man bei Berücksichtigung der biologischen Merkmale der beteiligten Arten für gänzlich unmöglich halten müssen (RATCLIFFE, 1959).
Inzwischen ist für eine weitere Krankheit klar geworden, dass auch sie nicht zur Ausrottung der Kaninchen in Australien führen wird: Der Erreger der Chinaseuche (RHD) breitet sich seit 1984 ausgehend von China aus. Seine Anwendung wurde später legalisiert. Die Krankheit dezimierte die Kaninchenpopulation zwar, doch liegt diese immer noch bei über 200 Millionen Tieren. Kaninchenbaue werden heutzutage mit Bulldozern eingeebnet, die Tiere werden vergiftet und gejagt, sind aber aus dem Kontinent nicht mehr entfernbar.
Auch Raubtiere werden der Kaninchen nicht Herr. Bereits in den 1840er-Jahren wurde der Fuchs für die traditionelle englische Fuchsjagd eingeführt. Füchse jagen zwar auch Kaninchen, doch haben sie etliche einheimische Spezies ausgerottet und damit mehr ökologischen als ökonomischen Schaden angerichtet. Über 7 Millionen Füchse wurden deshalb mit vergifteten Ködern – sehr beliebt ist Natriumfluoracetat – und von Jägern getötet, ebenfalls ohne die Hoffnung, sie ganz ausrotten zu können. Die Regierung setzt inzwischen auf »Management«: Auf Füchse werden Preise ausgesetzt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen vor, Nahrungskonkurrenten des Fuchses wie den australischen Wildhund (Dingo) zu verbreiten.
Auch Mitte des 19. Jh. entlaufene oder freigelassene Pferde (»Brumbys«) verwilderten und vermehrten sich so stark, dass sie durch gezielte Abschüsse kontrolliert werden müssen. Dromedare, ebenfalls Mitte des 19. Jh. als Lasttiere eingeführt, verwilderten ebenso wie Ziegen, Katzen und Schweine. Dromedare und Ziegen werden vom Helikopter aus abgeschossen. Zäune sollen die verwilderten Hauskatzen eindämmen, was vielleicht auf kleineren Inseln, nicht aber auf dem Kontinent funktioniert.
Nach anfänglichen, vermeintlich positiven Erfahrungen in den Plantagen von Puerto Rico wurde 1935 die Aga-Kröte (Bufo marinus) nach Ostaustralien importiert, um Schadinsekten wie den Zuckerrohrkäfer in den Zuckerrohrplantagen unter Kontrolle zu bringen. Zuckerrohr war in den Küstengebieten Ostaustraliens in den 1860er-Jahren als Nutzpflanze eingeführt worden. Die Kröten kamen auf einen bis dato krötenfreien Kontinent. Sie verzehrten indes kaum Zuckerrohrkäfer und blieben so nahezu wirkungslos, wurden aber wie zuvor die Kaninchen zur Landplage.
Aga-Kröten wurden in mehr als 30 Ländern eingeführt, um Pflanzenschädlinge unter Kontrolle zu bringen. In Australien haben sie sich als besonders gefährlich erwiesen, da es keine anderen Tiere mit ähnlichen Giften gibt, an die lokale Raubtiere angepasst sein könnten. Bufo marinus, die ein Gewicht von fast drei Kilogramm erreichen kann, und damit eine der größten Amphibien ist, schützt sich durch einen potenten Giftcocktail vor Feinden. Mit diesem Beutetier haben die australischen Raubtiere keinerlei Erfahrung. Sie attackieren die Kröte, die sie aufgrund des Aussehens für einen Frosch halten, und vergiften sich. Schlangen, Eidechsen und räuberische Beuteltiere sind damit in eine evolutionäre Falle geraten (SCHLAEPFER et al., 2005).
Die einheimischen Spezies reagieren auf den evolutionären Druck; an der Rotbäuchigen Schwarzotter (Pseudechis porphyriacus) wurde dies genau untersucht. Diese Spezies könnte sich auf verschiedene Weise anpassen: Die Schlangen könnten gegen den Giftstoff unempfindlicher werden, sie könnten Kröten als Nahrung vermeiden oder ihren Körper so verändern, dass sie zumindest große Kröten nicht mehr schlucken und sich vergiften können. Letzteres scheint in nur 23 Generationen von Schlangen tatsächlich geschehen zu sein: Die Kieferweite der Schlangen hat sich verringert, große Kröten, die eine tödliche Dosis Gift enthalten, können sie nicht mehr zu sich nehmen (PHILLIPS und SHINE, 2006). Doch nicht alle Predatoren werden im evolutionären Wettlauf die Oberhand behalten. Mehr als die Hälfte der Süßwasserkrokodile (Crocodylus johnstoni) in der Region Victoria River im Northern Territory verendete durch den Fraß der Kröten.
Veränderungen der Landschaft durch Menschen spielen für die Verbreitung der Kröten eine wichtige Rolle, wie eine Studie an der »Invasionsfront« zeigte. In den 1930er-Jahren breiteten sie sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 bis 15 km pro Jahr aus. Im Northern Territory, entlang der Nordküste des Kontinents, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit inzwischen auf 60 km pro Jahr angestiegen. Das hat mehrere Gründe. Kröten bewegen sich mit Vorliebe entlang von unbefestigten Straßen und Zäunen, an denen durch Viehtritt die Vegetation zurückgedrängt wird. Was Menschen die Bewegung ermöglicht, hilft auch den Kröten (BROWN et al., 2006; URBAN et al., 2008). Ökologisch bietet der tropische Norden bessere Bedingungen für die Kröten. An der Front ihrer Ausbreitung, wo sie kaum Nahrungskonkurrenz vorfinden und keine natürlichen Feinde haben, scheinen sie sich auch genetisch zu verändern: Längere Gliedmaßen erlauben ihnen eine raschere Fortbewegung, auch ihr Bewegungsverhalten hat sich geändert.
Blinde Passagiere mögen gefährlich sein (vg. S. 70), in Australien hat sich die absichtliche Einführung von Tierarten als das weit größere Problem erwiesen. Die Einführung von Arten ist wie die Büchse der Pandora: Einmal geöffnet lässt sie sich nicht mehr schließen. Sind Arten einmal eingeführt, gibt es kaum Hoffnung, sie wieder loszuwerden. (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2005; FENNESSY und MYKYTOYCZ, 1974; GRIGGS, 2007; MARKULA et al., 2010)
Der erste, über 1800 km lange KANINCHENSPERRZAUN durch Westaustralien stammt von 1901, doch wurden im Folgejahr Kaninchen westlich davon gesichtet. Daher wurde 1905 ein zweiter, über 1100 km langer Sperrzaun gebaut. Die Originalaufnahme zeigt den Zaun nördlich von Burracoppin (Westaustralien) in den 1920er-Jahren.
In kolonialer und postkolonialer Zeit
Keiner der großen Süßwasserseen hat in den vergangenen 50 Jahren eine dramatischere Veränderung erfahren als der Victoriasee in Zentralafrika. Nach dem Oberen See in Nordamerika ist der auf rund 1130 m Höhe gelegene Victoriasee mit fast 69.000 km2 der zweitgrößte Süßwassersee der Welt. Er ist durchschnittlich nur 45 m tief und damit relativ seicht. Kleine, flache Buchten und zahlreiche Feuchtgebiete säumen seine etwa 3500 km lange Küste. Der Victoriasee ist von entscheidender Bedeutung für den Lebensunterhalt von mehr als 30 Millionen Menschen, für Fischerei sowie die Bereitstellung von Trinkwasser und Strom aus Wasserkraft.
Die drastische Transformation des Sees wurde durch die Einführung fremder Arten und massive Eutrophierung infolge eines Landnutzungswandels im Einzugsgebiet des Sees bewirkt. Fische sind ohne Kühlung nur geräuchert haltbar. Daher wurde die Region über Jahrzehnte massiv entwaldet, um Feuerholz zum Räuchern zu gewinnen. Bodenerosion auf den Kahlschlägen und Äckern führte zum Eintrag von Bodenbestandteilen in den See; er wurde trüber. Etwa 50% der endemischen Fischarten sind inzwischen ausgestorben oder auf geringe Restbestände dezimiert. Der Klimawandel – die Umgebung des Sees wird trockener – führte zum Absinken des Seespiegels. Die im 19. Jh. als Zierpflanze nach Afrika eingeführte Wasserhyazinthe breitete sich, wohl gefördert durch den für andere Lebewesen mittlerweile gefährlichen Nährstoffreichtum des Sees, seit 1990 küstennah aus und bedeckte binnen weniger Jahre große Flächen. Seit ein spezialisierter Parasit, der Käfer Neochetina eichhorniae, eingeführt wurde, kann das Wachstum der Wasserhyazinthe einigermaßen kontrolliert werden. Ob dessen Einführung langfristig negative Folgen haben wird, ist nicht bekannt. Der Transformationsprozess der Fischfauna ist jedenfalls nicht zu stoppen. (OGUTUOHWAYO et al., 1997; HECKY et al., 2010)
Diese Transformation begann zu Beginn des 20. Jh. Britische Kolonialbeamte waren frustriert, dass in einem so großen See nur kleine Fische lebten. Neben Tilapias (Lokaler Name: ngege; Oreochromis esculentus) waren es meist kleine Buntbarsche (Haplochromine Cichliden), die die Beamten der Kolonialverwaltung als »Abfall« empfanden, die aber in der Subsistenzfischerei der Einheimischen eine große Rolle spielten und als Nahrung geschätzt waren. Seit den späten 1920er-Jahren wurde in Kolonialkreisen immer wieder diskutiert, ob die Fischerei durch Besatz verbessert werden könnte. Michael Graham, der den See zwei Jahre lang intensiv untersucht hatte, warnte 1929 zur Vorsicht: Im Victoriasee würde eine wertvolle Fischerei auf Tilapias in wünschenswerter Weise betrieben. Die Einführung eines großen Raubfisches aus einem anderen Gewässersystem könnte dieser Fischerei gefährlich werden und sollte jedenfalls vorab gründlich untersucht werden (GRAHAM, 1929: 23). Nichts dergleichen geschah.
Der VICTORIASEE.
In vorkolonialer Zeit war die Fischerei neben Landwirtschaft und Tierhaltung nur eine von mehreren Säulen der lokalen Wirtschaft gewesen. Unter der kolonialen Herrschaft der Briten wurde jedoch von 1895 bis 1901 die Ugandabahn von Mombasa nach Port Florence (heute: Kisumu) am Ufer des Victoriasees gebaut. Ab 1903 verkehrten auf dem See Linienschiffe, so wurden Deutsch-Ostafrika und Uganda in den Kolonialhandel eingebunden. Hatte bis zur Eröffnung der Bahnstrecke der Transport einer Tonne Güter durch Träger vom See zur Küste etwa 180 Pfund gekostet, nahm die Bahn nur ungefähr 17 Pfund pro Tonne (FORD, 1953; MEMON, 1973: 2).
Nun konnte auf Eis gelagerter Fisch aus dem Victoriasee bis nach Nairobi und weiter gebracht werden. Damit begann die marktorientierte Fischerei, die aber zunächst kleinteilig und auf regionale Märkte beschränkt blieb. Trotzdem war Ende der 1940er-Jahre klar, dass die Fischbestände des Sees übernutzt waren. 90% der Fischbiomasse bestand aus etwa 500 Arten der kleinen »Abfall«-Fische. Ein kommerziell interessanter Raubfisch, der diese scheinbar »nutzlose« Biomasse in handelbare Filets umwandeln würde, schien eine geradezu ideale Lösung. Einen solchen gab es aber im See eben nicht. (PRINGLE, 2005; GOUDSWAARD et al., 2008)
Vermutlich gelangten die ersten Exemplare des Nil- oder Victoriabarsches (Lates niloticus), eines im Nil heimischen, bis zu 2 m langen Raubfisches, 1954 in den See. Es ist umstritten, wer für die erste Aussetzung verantwortlich war. Nachdem bereits bekannt war, dass sich der Nilbarsch im See etabliert hatte, erfolgten in den 1960er-Jahren weitere offizielle Einbringungen. Als der erste Nilbarsch gefangen wurde, beunruhigte das den Fischer. Er erkundigte sich zunächst, ob die Spezies giftig sei. In der Wahrnehmung der einheimischen Fischer war der Nilbarsch zunächst kein wünschenswerter Fang: Sein fettes Fleisch verströmte einen unangenehmen Geruch. Die besonders großen Exemplare, die zu Beginn gefangen wurden, als Nahrung noch im Überfluss vorhanden war, waren sehr fettreich und damit geruchsintensiv. Insgesamt wurden im ersten Jahrzehnt nicht mehr als 100.000 Tonnen pro Jahr gefangen. Mitte der 1970er-Jahre änderte sich dies dramatisch, 1975 wurden bereits 335.000 Tonnen angelandet. Die Nilbarschpopulation wuchs weiterhin rasch, 1990 war der Höhepunkt der Fangmenge mit 380 776 Tonnen erreicht.
Als in den späten 1970er-Jahren ein globaler Markt für Victoriabarsche, wie sie dann genannt wurden, aufgebaut wurde und die Fischer begannen, mit diesem Fisch Geld zu verdienen, veränderte sich auch ihre Wertschätzung. Wenn die Europäer diesen Fisch mochten, musste er gut sein. Da der Fettgehalt der Fische abgenommen hatte, war der Geruch weniger penetrant. Die ursprünglich gefangenen und nun zunehmend rareren Arten blieben allerdings als »süßfleischig« insbesondere an Feiertagen die erste Wahl.
Der Süden Ugandas, Westkenia und Nordtansania wurden Teil des Weltmarkts und damit sozial und ökologisch transformiert. Verarbeitungsbetriebe entstanden; die Fische wurden so rasch wie möglich filetiert, gekühlt und nach Israel und Europa ausgeflogen. Der Boom der 1980er-Jahre ist allerdings längst vorbei. Die Gewinne sind, wie in solchen Fällen immer, auf wenige Reiche konzentriert. Diejenigen, denen das Kapital für Boote, die nötigen starken Netze und Außenbordmotoren fehlten, konnten nur eine marginale, stets prekäre Existenz am Rand des Sees fristen. Der für den Export bestimmte Fisch wurde für die Einheimischen zu teuer. Sie konkurrieren mit den ansässigen Fischmehlfabriken nur mehr um die Karkassen der Fische. Entsprechend hat der Proteinmangel zugenommen, wobei hier nach Geschlecht und sozialer Stellung differenziert werden muss. Frauen und vor allem Kinder leiden darunter. Die Fischerei wird von Männern betrieben und kontrolliert. Sie verwenden ihre Einkünfte oft anders als für die Ernährung ihrer Familien. (GEHEB et al., 2008; JOOST-BEUVING, 2010)
Zu Beginn des 21. Jh. ist die Ökologie des Victoriasees im Vergleich zu der Zeit vor 1954 vollkommen verändert. Der Anteil der Buntbarsche an der Fischmasse ist von 90% auf 1% gefallen. Die Eutrophierung hat weiterhin zugenommen. Das Nahrungsnetz des Sees ist nun auf weit weniger Arten aufgebaut. Über 200 Fischarten sind ausgestorben – eine der größten Ausrottungen der Menschheitsgeschichte. Wenn der Phosphoreintrag in den See nicht reduziert werden kann, wird auch die jetzige Situation nur ein Durchgangsstadium sein, der See könnte »kippen«. Das wäre mehr als das Ende der Fischerei: Millionen Menschen, die vom See und seinem Wasser abhängig sind, würden ihren Lebensunterhalt verlieren und zu Umweltflüchtlingen werden.
Frauen warten am UFER DES VICTORIASEES auf die Rückkehr der Fischer mit dem Tagesfang.
Darwins Albtraum: NILBARSCHE aus dem Victoriasee.
Ökologische Folgen des globalen Transports
Bei der Einreise in die Vereinigten Staaten von Amerika oder nach Kanada müssen Flugpassagiere ein Zolldokument ausfüllen. Sie werden gefragt, ob sie in den letzten zwei Wochen auf einem Bauernhof waren und ob sie landwirtschaftliche Produkte mitführen. Dieser Fragebogen ist Ausdruck der Sorge, dass Viehkrankheiten oder Pflanzenschädlinge ins Land gelangen könnten. Auf Flügen nach Australien wird die Passagierkabine vor der Landung mit einem Insektizid besprüht – kein Insekt soll lebend den Kontinent erreichen. Die Sorge ist durchaus verständlich, denn invasive Arten verursachen jährlich weltweit Kosten von etwa 137 Milliarden US-Dollar (PIMENTEL, 2005).
Die Verbreitung von Spezies durch den Menschen hat eine lange Geschichte. Bei der Besiedelung der »Neo-Europas«, das sind jene europäischen Kolonien (vor allem Australien, Neuseeland und Nordamerika), die heute vorwiegend von Nachfahren europäischer Kolonisten bevölkert sind, brachten die Siedler ihre Nutzpflanzen und -tiere mit. Mit Samen, Pflanzen und Boden, in und auf den Nutztieren reisten und reisen an die Wirte angepasste Krankheitserreger und Parasiten. Der »Columbian Exchange«, wie Alfred Crosby den Austausch von Lebewesen in Folge der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus nannte, veränderte die Ökosysteme der beteiligten Kontinente tief greifend und langfristig. Holsteinrinder grasen heute in Wisconsin; Europäer bauen Mais, Tomaten und Paprika an; Weizen ist Basis des Brotes in den Neo-Europas; Tabak hat sich weltweit verbreitet. Mit den Nutzpflanzen kamen die »Un«kräuter. Den Wegerich, eine Pflanze, die, wie ihr Name sagt, in Europa die Wege säumt, nannte die indigene Bevölkerung Nordamerikas den »Fuß des weißen Mannes«. Edgar Anderson hatte bereits 1952 von den »vom Menschen transportierten Landschaften« gesprochen und damit auf das Transformationspotenzial hingewiesen, das von Menschen mitgebrachte Spezies haben (ANDERSON, 1952; CROSBY, 1991).
Auch die Menschen brachten ihre Krankheitserreger mit – für sie relativ harmlose Kinderkrankheiten wie Masern, aber auch Pocken. Diese erwiesen sich als potente Waffe der Kolonisation Amerikas. Die indigene Bevölkerung hatte keinerlei Immunabwehr gegen diese Erreger, ein Massensterben war die Folge. Die mitgebrachten Krankheitserreger hatten entscheidende Bedeutung dafür, dass die indigene Bevölkerung durch wenige, schlecht ausgerüstete Europäer dezimiert und verdrängt werden konnte. In den asiatischen Kolonien wie Indien oder Indonesien sind die gleichen Infektionskrankheiten wie in Europa endemisch. Daher war die Kolonisierung durch Europäer dort nicht mit einer solchen demographischen Katastrophe verbunden.
Der französische Historiker Emmanuel Le Roy Ladurie nannte die Verbreitung von Krankheitserregern auf allen Kontinenten »l’unification microbielle du monde« (etwa: mikrobielle Vereinheitlichung der Welt); William McNeill schrieb den ansteckenden Krankheiten in seinem Klassiker »Die großen Epidemien« Geschichtsmächtigkeit zu. Dies ist nachvollziehbar, wenn wir bedenken, dass die Pest die Bevölkerung Europas 1347 bis 1351 dezimierte (vgl. S. 22). mit weitreichenden Folgen für Wirtschaft, Politik und Umwelt und dass die »Spanische Grippe« als weltweite Epidemie 1918 / 1919 mehr Menschenleben forderte als der Erste Weltkrieg.
Der Erfolg neuer Krankheitserreger ist nur ein Spezialfall. Kommen Spezies in ein neues Ökosystem, finden sie dort oft keine auf sie spezialisierten Feinde vor, sie breiten sich daher stärker aus als Arten, die in Nahrungsnetze eingebunden sind Sie können »invasiv« werden, gleich ob sie absichtlich oder unabsichtlich eingeführt wurden (vgl. S. 62). Ihre Gefährlichkeit hängt von der Art ab. Unter den 100 von der IUCN (International Union for the Conservation of Nature) als besonders gefährlich eingestuften invasiven Spezies finden sich Mikroorganismen, Pilze, Land- und Wasserpflanzen, Wirbellose, Fische, Vögel und auch Säugetiere. Viele von ihnen wurden absichtlich eingeführt, als Ziergewächse oder um eine unerwünschte, lokale Art zu bekämpfen, nicht immer erfolgreich (vgl. S. 66). So werden Moskitofische bis heute etwa in Kalifornien ausgesetzt, obwohl sie nicht mehr Moskitoeier fressen als einheimische Fische; sie fressen aber die Eier anderer Fischarten und reduzieren damit die Vielfalt in Ökosystemen.
Der HUDSON RIVER im Mondschein. Floß, Schiff und Bahn – potenzielle Transportmedien für »blinde Passagiere«. (Postkarte, nach 1907)
Die biologische Durchmischung der Welt nimmt mit dem globalen Handelsvolumen zu. Dem Wassertransport kommt besondere Bedeutung für die Homogenisierung der Ökosysteme der Erde zu – neben der Habitatvernichtung sind invasive Spezies die größte Bedrohung einer hohen Biodiversität. 80% der Güter verbringen zumindest einen Teil ihrer Reise auf dem Wasser. Von 1985 bis 2011 wuchs die Tonnage im Weltseehandel um mehr als 230%. Da sich leere Schiffe nicht gut steuern lassen, werden sie nach der Entladung mit Ballastwasser gefüllt. In jenem Hafen, in dem sie neue Ladung aufnehmen, wird es wieder abgelassen. Schätzungen zufolge werden dadurch täglich etwa 3000 Spezies von einem aquatischen Ökosystem in ein anderes transportiert. Von Pflanzen über Parasiten und Krankheitserreger bis zu Fischen, Mollusken und Wirbellosen reist so eine Armada potenziell gefährlicher Organismen um die Welt.
In der Bucht von San Francisco fand sich von 1851 bis 1960 etwa eine neue Spezies pro Jahr. Von 1961 bis 1995 waren es schon fast vier pro Jahr (COHEN & CARLTON, 1998). Kanäle, die aquatische Lebensräume verbinden, die sich über Tausende Jahre getrennt entwickelt hatten, besitzen einen ähnlichen Effekt auf die Verbreitung von Neobiota, wie die neu eingewanderten Spezies genannt werden. Seit 1800 sind fast 140 neue Spezies in den Großen Seen angekommen, die meisten davon unabsichtlich. Ein Drittel davon kam seit der Eröffnung des St.-Lawrence-Kanals im Jahr 1959, durch den Hochseeschiffe in die Großen Seen gelangen können. Die im Kaspischen Meer heimische Zebramuschel (Dreissenia polymorpha) kam mit Ballastwasser in die Großen Seen. Von 1988 bis 2002 hatte sie sich in den Gewässern der Vereinigten Staaten bis zum Golf von Mexiko ausgebreitet. Da sie nicht in Nahrungsnetze eingebunden ist (»keine natürlichen Feinde hat«) breitet sie sich auf Kosten einheimischer Spezies weiter aus. Der Eriekanal verbindet seit 1823 die durch die Wasserscheide der Alleghenies getrennten Gewässersysteme, Fische und Mollusken sind so aus den Großen Seen in den Hudson gelangt.
Etwa 14% der weltweit transportierten Fracht gehen durch den Suezkanal, der Mittelmeer und Rotes Meer verbindet, und damit Schiffen aus Asien und Europa die Umrundung Afrikas erspart. Die beiden Meere waren 20 Millionen Jahre getrennt, ehe sie 1869 vom Menschen verbunden wurden. Seitdem sind mindestens 300 Spezies aus dem Süden ins Mittelmeer gelangt, darunter die Rotmeerqualle Rhopile manomadica, die an den Ostküsten des Mittelmeers inzwischen im Sommer schwarmweise auftritt.
Quallen sind auch für die Dezimierung der biologischen Vielfalt des Schwarzen Meeres verantwortlich. In dem sauerstoffarmen Gewässer wurde in den späten 1970er-Jahren durch Ballastwasser die Meerwalnuss (Mnemiopsis leidyi), eine Rippenquallenart, eingeschleppt. Auf jeden Kubikmeter kamen im Jahr 1988 500 Quallen, hochgerechnet auf das Schwarze Meer ergibt das 900 Millionen Tonnen Biomasse – zehnmal so viel wie der weltweite Fischfang in diesem Jahr. Im Schwarzen Meer gab es kaum mehr Fische, weil die Quallen das Zooplankton auffraßen. Sie machten auf der Höhe ihrer Verbreitung 95% der gesamten Biomasse des Schwarzen Meeres aus. Auch wenn ihre Zahl danach wieder um die Hälfte abnahm – weil es keine Nahrung mehr gab und sie von der Qualle Beroe ovata gejagt werden – haben sie das Schwarze Meer langfristig verändert. Und sie breiten sich weiter aus. Mittlerweile gelangte die Meerwalnuss bis in die Ostsee.
Auch im Ladegut reisen gefährliche Passagiere. Der Erreger der Ulmenkrankheit kam mit Furnieren nach Nordamerika; inzwischen sind die Ulmen dort praktisch ausgerottet. Die asiatische Tigermücke (Aedes albopictus, früher Stegomyia albopicta) findet ein exzellentes Habitat in den um die ganze Welt verschifften alten Autoreifen, in denen sich oft etwas Wasser sammelt: eine ideale Brutstätte für das Insekt, das mit der Ausbreitung mehrerer Tropenkrankheiten, darunter Gelbfieber, in Verbindung gebracht wird (vgl. S. 76). Die Geschichte des globalen Transports zeigt, dass sich die Menschen als evolutionäre Kraft etabliert haben. Ob zu ihrem Vorteil, darf bezweifelt werden. (LOWE et al., 2004)
Die 1913 vom Stapel gelaufene »IMPERATOR« der Hamburg Amerikanischen Paketfahrt Actien Gesellschaft (HAPAG). – Etwa ein Jahr war sie das größte Schiff der Welt. (Postkarte, gelaufen am 23.8.1913)
Forellen am falschen Ort
Das Wirtschaftswachstum, der wachsende Wohlstand und das erfolgreiche Agieren der Gewerkschaften ermöglichten in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg eine Kürzung der Arbeitszeit von 12 auf 8 Stunden pro Tag, die Wochenenden waren nun frei und bezahlter Urlaub kam hinzu. Auch der durch den Zweiten Weltkrieg angekurbelte technische Fortschritt wirkte bis in das Privatleben. Effiziente Anglerausrüstung aus neuen Materialien wie Fiberglas stand kostengünstig zur Verfügung – und die USAmerikaner hatten Freizeit. Sie angelten fortan in Scharen an Seen und Flüssen. Im Jahr 1955 verbrachten 21 Millionen Menschen 400 Millionen Tage damit, Fische zu fangen.
Als die Nachfrage nach angelbarer aquatischer Fauna über das natürliche Angebot stieg, entwickelte sich der Besatz von Gewässern mit Fischen zu einer Freizeittechnologie mit dramatischen Umweltfolgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zahlreiche nicht mehr benötige Militärflugzeuge und viele beschäftigungslose Piloten. Einer war Al Reese. Er begann für das Department of Fish and Game des Bundesstaats Kalifornien zu arbeiten. Er wollte bis dahin fischlose abgelegene Bergseen in der Sierra Nevada mit Forellen auffüllen; dies konnte, so war er überzeugt, aus der Luft gelingen. Zunächst versuchte Reese, Jungfische in Eisblöcken einzufrieren und sie in Eisbehältern, die mit kleinen Fallschirmen versehen waren, abzuwerfen. Dies misslang. Reese und seine Assistenten experimentierten daraufhin mit einem wassergefüllten 20 Liter-Kanister, in den sie 50 Forellen gepackt hatten. Sie warfen ihn aus dem Flugzeugfenster in Richtung eines kleinen Sees, den sie gerade in 100 m Höhe überflogen. Der Kanister verfehlte den See und zerschellte an einem Felsen, doch eine Nachprüfung am Aufprallort erbrachte Überraschendes: 16 Forellen hatten in einer Lache des Containerwassers überlebt!
Nun untersuchte Reese, ob die Fische auch ohne den Schutz von Wasser und einem Kanister einen Abwurf überleben würden. Er beschleunigte ein Auto auf 120 km/h und hielt Forellen zwei Minuten aus dem Fenster. Sie überlebten auch diese Tortur. Reese überzeugte seine Vorgesetzten, die daraufhin ein C-45 Transportflugzeug aus Militärbeständen erwarben und mit Carol Faist einen weiteren Piloten einstellten. Im Juli 1949 flogen Reese und Faist mit ihrer Maschine los. Sie war mit Forellen vollgepackt. Über einem alpinen See in der Sierra Nevada warfen sie aus einer Höhe von 60 m bei einer Geschwindigkeit von mehr als 300 km/h die Masse an Fischen erfolgreich ab, wodurch diese mit etwa 50 km/h auf den See prallten. Viele starben beim Aufprall. Andere sanken geschockt und bewegungslos auf den Seeboden, wo sie verendeten.
ANGLER in der Sierra Nevada in der Nähe einer warmen Quelle.
Für Reese und Faist war das Experiment dennoch ein Erfolg. Denn diese Behandlung überlebten immer noch mehr Fische als den stundenlangen Transport in Wasserkanistern auf dem Rücken von Maultieren. Außerdem war der Landtransport teurer – erfolgreiche Fischabwürfe aus Flugzeugen kosteten nur ein Fünftel. Nur in Nationalparks wurde 1972 der Besatz mit fremden Arten verboten. Zur Wiederherstellung einer einheimischen Art dürfen Fische oder Laich ausnahmsweise ausgesetzt werden. Natürlich fischfreie Gewässer dürfen nicht mit einheimischen oder exotischen Fischarten besiedelt werden. (NPS 1975).
Die Sierra Nevada
Die Sierra Nevada liegt im Osten Kaliforniens. Mit einer Länge von mehr als 600 km und einer mittleren Breite von gut 100 km bedeckt sie etwa 63.000 km2 und ist damit fast so groß wie Bayern. Die Gesteine der Sierra sind 80 bis 120 Millionen Jahre alt, graumelierte Granite dominieren. Die Hebung der riesigen Gesteinsplatte begann vor mehreren Zehnermillionen Jahren. Sie war im Osten weitaus stärker als im Westen. Seit dem Beginn der Hebung hat die starke Abtragung die außergewöhnlichen Oberflächenformen der Sierra Nevada herauspräpariert, besonders markant ist der berühmte Half Dome im oberen Yosemite-Tal. Die Sierra kulminiert im Mt. Whitney im Osten in einer Höhe von 4.421 m ü.d.M. Die Hebung hält bis heute an, wovon zahllose Erdbeben zeugen.
Mehr als 2.000 Süßwasserseen liegen verstreut über die Oberfläche der Sierra. Die Hohlformen, die heute mit Seen gefüllt sind, entstanden aus Kuhlen, die vor allem in der High Sierra Gletscher in der letzten Kaltzeit geschürft hatten. Oft sind sie perlschnurartig untereinander gereiht, weshalb sie auch als Paternoster-Seen bezeichnet werden. Sie sind häufig über Wasserfälle miteinander verbunden. Andere Seen, besonders in tieferen Lagen, befinden sich oberhalb von Endmoränenzügen, die Täler blockieren und Flüsse aufstauen. Kleine Toteisseen sind in allen Höhenlagen häufig. Sie entstehen, indem isolierte Eisblöcke von Schmelzwassersedimenten überschüttet werden; zum Ende der Kaltzeit taut das Eis und ein Kessel verbleibt, der sich allmählich mit Grundwasser füllt. Der Tulainyo Lake, ein Toteissee nördlich des Mt. Whitney in 3.900 m ü.d.M., ist einer der höchstgelegenen Seen Nordamerikas. Tektonische Bewegungen können ebenfalls Hohlformen schaffen. Das Becken des Lake Tahoe, der mit einer Fläche von 497 km2 der größte See der Sierra ist, entstand durch tektonische Bewegungen. Er liegt 1.897 m ü.d.M. und ist beachtliche 501 m tief. Blockieren Erdrutsche Täler, so bilden sich meist für kürzere Zeiträume kleinere Seen. Hinzu kommen menschengemachte Stauseen wie der Oroville-See in der nördlichen und der Lake Isabella in südlichen Sierra.
Natürliche Barrieren wie eben die Wasserfälle hatten verhindert, dass Fische in die höheren Lagen der Sierra Nevada vordringen konnten. So etablierten sich dort einzigartige Ökosysteme. Ohne viele natürliche Feinde entwickelte sich in den Feuchtgebieten der Sierra Nevada eine große Population des dort endemischen Gelbbeinigen Gebirgsfrosches (Rana muscosa). Die Forellenabwürfe griffen drastisch in das natürliche Räuber-Beute Verhältnis in den Seen der Sierra ein.
Im Jahr 1953 prasselten fast 3 Millionen Jungforellen aus Flugzeugen in 662 Seen der Sierra – das freute Millionen Freizeitangler und vielleicht auch die Forellen. Die Kalifornier hatten der Welt die Fischhaltung der Zukunft gezeigt. Andere US-Staaten folgten und bald waren zahllose zuvor fischlose Seen im Westen der USA reich an Regenbogenforellen.
Im Jahr 2006 angelten 6,75 Millionen Menschen in den USA an 75 Millionen Tagen nach Forellen. Diese Fischer haben höhere Einkommen und eine bessere Ausbildung als der Durchschnitt der US-Amerikaner. Doch die wenigsten von ihnen wollen wissen, welchen ökologischen Preis ihr Freizeitvergnügen hat.
Das Ausbringen der Forellen mit Flugzeugen hat die Seeökosysteme drastisch verändert. So ist etwa der Gelbbeinige Gebirgsfrosch inzwischen stark gefährdet. Versuche, einige Seen wieder forellenfrei zu machen, verliefen zwar erfolgreich. Die weitere Entwicklung hängt – wie immer in solchen Fällen – davon ab, ob ein ausreichendes politisches Interesse und Durchsetzungsvermögen an der vollständigen Ausrottung der Forellen in den Gebirgsseen der Sierra Nevada besteht und die zuständigen Behörden ausreichend finanziert werden. Das wiederum hängt davon ab, ob sich die Interessen von Anglern oder die von Naturschützern durchsetzen.
(OWEN, 2012: 70–75, HALVERSON, 2010: 88–91)
HEUTIGE VERTEILUNG VON FORELLEN in den Seen der Einzugsgebiete des Upper Piute Creek und des French Creek (Sierra Nevada)
Die SPEICHERSTADT in Hamburg.
KAFFEEPLANTAGE Bom Sucesso des Chocolatiers Claudio Corallo auf São Tomé.
SKLAVEN PRESSEN ZUCKERROHR. Beschönigendes Gemälde im Government House (Charlotte Amalie, St. Thomas, US Virgin Islands, USA).
RAFFLES HOTEL aus der britischen Kolonialzeit in Singapur.
ALLEE IM SÜDEN VIETNAMS. (Postkarte, gelaufen am 26.9.1912)
Werbepostkarte der Firma Lipton. TEEERNTE auf einer Plantage auf Sri Lanka. (Postkarte vor 1908)
1 Dieser und zahlreiche weitere Begriffe werden im Internet-Glossar erläutert. Es ist auf der Homepage des Verlags unter www.theiss.de oder auf der Internetseite der WBG unter www.wbg-wissenverbindet.de auf der Produktseite dieses Titels zu finden.
1 Kursive Zeitangaben beziehen sich auf den Radiokohlenstoffkalender, vgl. Glossar in diesem Buch.