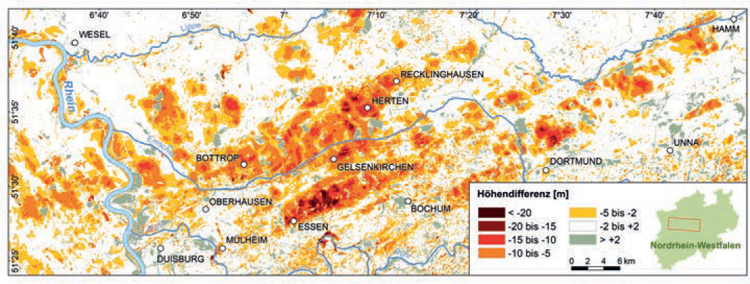
Die Ewigkeitskosten der Steinkohle
Am 21. Dezember 2018 endete mit der Schließung der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop der Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet. Seit dem Jahr 1792 werden die Abbaumengen verzeichnet, in den 227 Jahren seitdem wurden im Ruhrgebiet gut 9,9 Milliarden Kubikmeter Steinkohle abgebaut, an das Tageslicht befördert und verbrannt. Allein zum kriegsbedingten Höhepunkt der Produktion, im Jahr 1939 wurden in 151 Zechen 130 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. Unter der Oberfläche gleicht die Region einem Schweizer Käse. Unter Städten und Dörfern, Straßen und Bahnstrecken, Äckern und Wäldern, Flüssen und Teichen liegen Hohlräume von rund 7,4 Mrd. m3 oder 7,4 km3. Würde man dieses riesige Volumen gleichmäßig über das ganze Ruhrgebiet mit seinen etwa 4.435 km2 verteilen, wäre eine 167 cm dicke Schicht abgetragen worden. Der Abbau erfolgte nicht gleichmäßig, daher betragen die Mächtigkeiten der Hohlräume lokal ein Vielfaches davon. (STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V., 2018, unveröffentlicht)
Ein Teil der bergbaubedingten Hohlräume ist mittlerweile eingesunken oder eingefallen. So stürzte beim Abriss der Tagesanlagen des 1905 stillgelegten Förderschachtes 4 des Steinkohlebergwerkes Vereinigte Maria Anna Steinbank in Wattenscheid-Höntrop ein schwerer Stahlblock etwa 40 m tief in den Schacht. Der ehemalige Schacht wurde daraufhin mit Schutt verfüllt. Wohnhäuser entstanden in der Umgebung. 1991 erfolgte eine Stabilisierung mit Betoninjektionen. Über der gesicherten Schachtfüllung wurde die Emilstraße, eine Sackgasse, angelegt. In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 2000 brach der Wendehammer der Emilstraße auf einer Fläche von rund 500 m2 ein. Eine Garage versank mit einem Fahrzeug in dem mehrere Zehnermeter tiefen »Krater von Höntrop«; am Folgetag verschwand eine weitere. 22 Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Verfüllung mit ca. 7.500 m3 Beton kostete fast 6 Mio. Euro.
Auch in der Bottroper Zeche Prosper-Haniel stürzten immer wieder aufgelassene Schächte und Stollen ein. Dadurch entstanden Spannungen im hangenden, darüber liegenden Gestein, die sich ruckartig lösten und als leichte bergbaubedingte Erdbeben erhebliche Schäden verursachten: Die Geländeoberfläche sank ein, Hauswände rissen auf, Gebäude sackten oft einseitig ab und gerieten so in Schieflage, manche versanken vollständig. Allein in Bottrop traten von 2012 bis 2018 zehn von Bergbauunternehmen indirekt verursachte Erdbeben auf. Sie erreichten Stärken von bis zu 3,0 auf der Richter-Skala. Über die Weihnachtszeit des Jahres 2003 sank ein bewaldetes Gebiet in der Kirchheller Heide bei Bottrop ab. Grundwasser flutete die ausgedehnte Mulde, der Wald starb in dem neuen »Weihnachtssee« ab. (HARNISCHMACHER, 2012; HARNISCHMACHER & ZEPP, 2010)
Bergsenkungen, die auf den ausgedehnten Steinkohlebergbau zurückzuführen sind, veränderten die Topographie des Ruhrgebietes auch an vielen anderen Orten – besonders seit der Mitte des 19. Jh. – merklich. Kartenanalysen und Vermessungen belegen, dass die Geländeoberfläche des Ruhrgebietes seit 1892 großflächig um bis zu 25 m abgesunken ist. Besonders stark sinken Gebiete in Bottrop, nördlich und nordöstlich des Stadtzentrums von Essen, in der Emscherniederung nordöstlich Gelsenkirchen, in Herten, im Südwesten von Recklinghausen sowie im Norden von Dortmund. Das Einsinken unbekannter Stollen beeinträchtigte immer wieder den Bahnverkehr im Hauptbahnhof Essen. (HARNISCHMACHER, 2012; HARNISCHMACHER & ZEPP, 2010)
Veränderungen der GELÄNDEHÖHEN im Ruhrgebiet vom späten 19. Jh. bis heute. Berechnungen und Graphik von Stefan Harnischmacher, Universität Marburs (2019).
Ein Gutteil – rund 40% – des Ruhrgebiets liegen heute etliche Meter unter dem Niveau des mittleren Grundwasserspiegels. Um zu verhindern, dass das Gebiet zu einem riesigen See wird, müssen mehr als 100 Pumpwerke dauerhaft Grund- und Oberflächenwasser in die eingedeichte Emscher fördern. Damit die Emscher überhaupt noch genügend Gefälle hat, um in den Rhein zu fließen, wurde ihre Mündung um etwa 10 km nach Norden verlegt, vom Duisburger in das Dinslakener Stadtgebiet. Nur durch die Eindeichung der Emscher auf etwa 40 km Länge sowie des Rheins bei Düsseldorf und Duisburg und nur durch das aufwendige Abpumpen großer Wassermassen auf »ewig«, das heißt, so lange der »Ruhrpott« für Menschen bewohnbar sein soll, bleibt das Gebiet trocken. Sonst wäre es wohl nur mehr als Heimstatt für Wasservögel geeignet.
Der Umgang mit Bergschäden ist eine bedeutende, gutartige Ewigkeitsaufgabe. Beständig treten neue Bergsenkungen auf, oft an Standorten, unter denen keine Hohlräume bekannt sind, denn viele der vor 1945 angelegten Stollen und Schächte sind in keiner Karte oder Skizze festgehalten worden.
Die GREGORSCHULE in Bottrop-Kirchhellen ist auf einer Seite um mehr als einen Meter abgesunken. Sie wird nach dem Ende der Bergsenkung im Herbst 2014 mit 120 hydraulischen Pressen über Wochen wieder in die Horizontale gehoben
Die eigens dafür gegründete RAG-Stiftung betreut Bergschäden auch nach Ende des Abbaus – jährlich gehen rund 25.000 Schadensmeldungen ein. Dafür wendete der Betrieb alleine im Jahr 2015 etwa 170 Mio. Euro auf, die Ewigkeitskosten betragen schätzungsweise 220 Mio. Euro pro Jahr. Bereits 2018 müssen rund 7.400 bekannte alte Bergwerkszugänge und ca. 30.000 ha Fläche mit oberflächennahen Abbauen gesichert werden. Die Reinigung von Gruben- und Grundwasser zum Trinkwasserschutz und das Management von Grund- und Oberflächen wasser zählen zu den weiteren Ewigkeitsaufgaben des Unternehmens. An fast 100 Standorten betreibt die RAG-Stiftung 2100 Messstellen, die kontinuierlich die Grundwasserqualität beobachten. Mehr als 20 Sanierungs- und Pumpanlagen mit über 80 Förderbrunnen bzw. Drainagen waren 2018 in Betrieb, ein ungeheurer Aufwand ist nötig, um das Ruhrgebiet bewohnbar zu halten (RAG, 2018). Auf »ewig« wird dadurch mehr Energie nötig, als aus der Kohle kam.
Die Gregorschule in Bottrop-Kirchhellen wird über ZWEI ACHSEN gehoben
Richland, Osjorsk und das heiße Erbe des Kalten Kriegs
Die kritische Masse für einen nuklearen Sprengkopf aus Plutonium, dem hochgiftigen, künstlich hergestellten Element 239 liegt bei etwa 6 Kilogramm. Derzeit gibt es auf der Welt etwa 2000 Tonnen, davon, jedes Jahr kommen etwa 70 dazu (CLARKE, 2006). Mit einer Halbwertszeit von gut 24000 Jahren bleibt das Schwermetall ein sehr langfristiges Erbe unserer Zeit. In ihrem Buch Plutopia hat Kate Brown die beiden großen Plutoniumfabriken Hanford im Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA und Majak am südlichen Ural in der UdSSR erstmals vergleichend untersucht. Die dafür aus dem Boden gestampften Städte Richland und Osjorsk sind bis heute bewohnte Denkmäler einer jegliche Vorsicht vermissenden militärischen Mentalität, die im Namen der Sicherheit zu einer dauerhaften Bedrohung der Menschheit führte.
BANNER an der Hanford Site (WA, USA). Aufgenommen im Mai 2005 von Jan Wiederhold.
Einer der für Los Alamos typischen RINGE AUS ELEKTRORAFFINIERTEN WAFFENFÄHIGEM PLUTONIUM. Das Material hat eine Reinheit von 99,96%. Der Ring wiegt 5,3 kg und hat einen Durchmesser von ca. 11 cm, genug Plutonium für eine Bombe. Die Ringform erhöht die Kritikalitätssicherheit.
In Hanford wurden von 1944 bis 1987 rund 55 Tonnen Plutonium produziert, mehr als die Hälfte der gesamten US-Produktion stammt aus den neun Reaktoren am Columbia River. Die flüssigen Abfälle lagern bis heute in unterirdischen Tanks, als hochbrisante Mischung weitgehend unbekannter Zusammensetzung. Majak produzierte Plutonium ab 1948 – bis zur endgültigen Stilllegung 1990 wurden dort etwa 56 Tonnen waffenfähiges Plutonium produziert. Die Sedimente des Columbia River und seines sowjetischen Gegenstücks, der Techa, sind radioaktiv verseucht, auch noch Jahrzehnte nach dem Ende der Produktion, und sie werden das weiterhin sein, am Techa ist die Situation allerdings ungleich schlimmer.
Hanford gilt als die teuerste Altlast der USA. Seit 1989 wird sie saniert, das Ende der Aufräumungsarbeiten wird bei jeder neuen Prognose weiter in die Zukunft verschoben, je nach verfügbarer Finanzierung wird es jedenfalls bis 2062 dauern, bis die Gefahr eingedämmt sein soll. Ein Endlager für die dann immerhin transportierbar gemachten hoch radioaktiven Abfälle ist bislang nicht in Sicht.
Richland, die für die Familien der in Hanford Beschäftigten gebaute Stadt, und das für die sowjetische Atomanlage Majak gebaute Osjorsk waren einander erstaunlich ähnlich. Die Anlagen unterlagen strengster Geheimhaltung, das wirkte sich auf die Auswahl des Personals aus. Zuverlässigkeit ging vor. Richland sollte als Heimat von Kernfamilien dienen, die unverheirateten und daher mobilen Arbeiter(inne)n vorzuziehen waren. Der vergleichsweise gut bezahlten Arbeiterschaft wurde durch günstige Mieten der Eindruck vermittelt, sie hätte den sozialen Aufstieg in den Mittelstand geschafft. Das Freizeitangebot konnte sich sehen lassen, auch eine eigene Zeitung existierte. Zufriedene Arbeiter(innen) kündigen nicht. So lange sie blieben, war das Sicherheitsrisiko für den Verrat von militärischen Geheimnissen geringer. Durch das tägliche Einsammeln von Urinproben wurden sie andererseits selbst in Sicherheit gewiegt, was ihre Gesundheit anging.
Auch das sowjetische Osjorsk funktionierte als Insel von Konsum und städtischen Freizeitangeboten in einer an George Orwell erinnernden Blase von Geheimhaltung und Lügen. In Osjorsk gab es Fernsehapparate, Radios, ausländisches Schuhwerk, Kaviar. Dafür durften Einwohner die Stadt nicht einmal zu Familienfeiern verlassen.
Am 29. September 1957 kam es zu einem folgenschweren Unfall, doch auch dieser änderte nichts. Die Kühlung eines unterirdischen Tanks war ausgefallen, der radioaktive Inhalt eingetrocknet, ein Funke löste eine Explosion aus, die unter »Unfall von Kyschtym« in Expertenkreisen bekannt ist. Der Wind verbrachte radioaktiven Staub über 400 km nach Nordosten, 20.000 km2 wurden kontaminiert, obwohl 90% der Belastung auf dem Werksgelände verblieben. Diese Katastrophe wurde ebenso verschwiegen wie der »Green Run«, die absichtliche Freisetzung von radioaktivem Jod aus Hanford im Jahr 1949.
Karte der Gebiete, die durch den NUKLEARUNFALL VON KYSCHTYM kontaminiert wurden. Je kräftiger das Rot ist, desto stärker ist die radioaktive Kontamination. 1 Curie (Ci) entspricht 3,7· 1010 Becquerel (37 GBq).
»… wenn wir es gewusst hätten«
Der in Hanford für die Entwicklung von Messmethoden für radioaktive Belastung zuständige Chemieingenieur John W. [Jack] Healy erinnert sich in einem Interview 1994 an die absichtliche Freisetzung von radioaktivem Jod, den »Green Run« von 1949: »Jod galt damals als weniger gefährlich als andere Radionuklide. Es war ernst, aber nicht so gefährlich wie einige der anderen. Zum einen können die meisten Schilddrüsenkrebsarten behandelt werden. […] Und das größte Problem, wie sich auf lange Sicht herausstellte, war, dass Herb [Herbert M. Parker, Leiter der Abteilung für gesundheitliche Aspekte] und ich den Milch-Mensch-Pfad nicht sahen.«
Das Problem der Anreicherung von radioaktivem Jod-131 über die Nahrungskette war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Es wurde erst nach dem schweren Unfall in der Atomanlage von Windscale im Nordwesten Englands am 10. Oktober 1957 erkannt. Healy wunderte sich damals, dass die Briten sehr niedrige Grenzwerte setzen, bis er den Grund dafür erfuhr. Auf Nachfragen bekräftigte er: »wenn ich nicht so ignorant gewesen wäre und den Luft-Gras-Kuh-Weg erkannt hätte, denke ich, dass der Green Run nie stattgefunden hätte. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir eine Biologie-Gruppe. Sie war damit beschäftigt, Jod an Schafe zu verfüttern. Aber niemand, der wirklich im Geschäft war, dachte an sowas […]. Eine von Parkers großen Sorgen galt den freilaufenden Tieren, nicht so sehr den Menschen, denn die herumstreunenden Tiere konnten durch das Fressen der Vegetation sehr hohe Dosen für ihre Schilddrüsen abbekommen.« [Übersetzung V.W. auf Basis von www.DeepL.com] (https://www.orau.org/ptp/Library/oralhistories/healy.pdf)
Der vermeintliche Wohlstand reichte aus, damit die Bewohner nichts von der Gefahr für ihre Gesundheit wissen wollten, der sie ausgesetzt waren. Die am stärksten verstrahlten wurden oft am schlechtesten überwacht und dekontaminiert. In beiden Städten sprachen sich die Einwohner lange nach dem Kalten Krieg sogar für einen neuen Reaktor und den Erhalt der Anlage aus: Das Recht, zu konsumieren, wohlhabend zu werden und es zu bleiben, war den Menschen in der unmittelbaren Umgebung wichtiger als weitgehend unbekannte Krankheiten und Spätfolgen.
Ihre Privilegien hatten einen hohen Preis. Die Menschen tauschten ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit ein gegen Statuskonsum und Wohlstand. Die Laboratorien des Kalten Kriegs waren auch Experimente zur Konsumgesellschaft. Richland war der Geburtsort der Konsum-Familie, ihrer Einfamilienhäuser und Garagen, ihrer Ziele und Sehnsüchte, ihres Fortschrittsglaubens und ihrer Loyalität zu Privilegien und Arbeitsplätzen. Strahlend erlagen sie der militärischen Sicherheitslogik und deren Menschenverachtung. Seitdem sind alle Menschen, ob sie es wollen oder nicht, BürgerInnen von »Plutopia«, einer Welt, aus der Plutonium und seine Gefahren nicht mehr entfernt werden können. (BROWN, 2013)
Nordseite der SCHANZE bei Düppel. Foto von Friedrich Brandt, Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek Kiel (Idstedt Gedächtnishalle).
Werbung für LEIBNIZ-KEKS, Darstellung des Aushebens eines Schützengrabens. (Feldpostkarte, gelaufen am 3.1.1916)
»Vom siegreichen Vordringen in Rumänien«. Zensierte deutsche Postkarte des ERDÖLFELDS von Prahova (Ploies¸ti), Rumänien, vermutlich 1940/41.
PANZERFORT Loucin der Festung Liège (Lüttich), Belgien. (Postkarte aus dem 1. Weltkrieg)
Das GIFTGAS Turpinite als französische Waffe gegen als Insekten mit Pickelhauben dargestellte Deutsche. (Propagandapostkarte 1915)
BAHNHOF-SAAL in den Vogesen. (Postkarte aus dem 1. Weltkrieg)
Der Zugang zu Ressourcen ist Grundlage von Macht. Daher ist Natur Materie der Politik, seit es Politik gibt. Viele Umweltgeschichten dieses Buches könnten also auch in diesem Kapitel »2.6. Natur und Politik« Platz finden. Die wenigen hier versammelten beleuchten die vielfältigen Ausprägungen des Verhältnisses von Natur und Mensch und der Verstrickungen von Natur und Politik.
Natur- und Umweltschutz sind im Vergleich zu Wirtschafts- und Sozialthemen eine zweitrangige Politikmaterie. Den sozialen Bewegungen, die sich Ende des 19. Jh. formierten, verdanken wir den Beginn des Natur- und Umweltschutzes in Mitteleuropa. Von den ästhetisch orientierten Prinzipien des frühen Naturdenkmalschutzes ist der heutige Naturschutz weit entfernt, einige Schritte dieses Weges skizzieren wir.
Stehen imperiale Interessen hinter staatlichem Naturschutz, wie im Fall des Lhalu-Nationalparks in der tibetischen Hauptstadt Lhasa, ist dieser kritisch zu hinterfragen. Naturschutz wird wie so oft auch in diesem Fall als Trennung von Natur und menschlich überformter Umwelt verstanden und die indigene Bevölkerung im Namen des Naturschutzes von der Ressourcennutzung ausgeschlossen.
Naturschutz kann aus ökologischen Gründen nicht auf einzelne Flächen in öffentlichem Eigentum beschränkt sein. Behörden sind auf die Kooperation mit privaten Eigentümern angewiesen. Wissenschaftlich fundierte Direktiven werden benötigt, etwa wenn es um die naturgemäße Beweidung von Berghängen oder Feuchtwiesen geht. Wissenschaftliches Wissen ist zeitgebunden und immer vorläufig. Seine Umsetzung beendet zwangsläufig die Vorläufigkeit. Der Kampf gegen Eichen auf privaten Weiden in Kalifornien, der sich im Laufe von Jahrzehnten zu einem Kampf für den Schutz der Eichen wandelte, regt zum Nachdenken über die Rolle von Experten an.
Ob Meer oder Fluss – auch vor Gewässern macht die Politisierung nicht Halt. Wer wo mit welcher technischen Ausrüstung wie viele Gelbe Quakfische im Gelben Meer fangen konnte und welche Märkte ihm offenstanden, war Gegenstand eines Kampfes um Hegemonie zwischen China und Japan. Die Gelben Quakfische wurden dabei massiv dezimiert.
Macht über die Natur zu demonstrieren, war (und ist) eine Möglichkeit, politische Macht zu artikulieren. Schon Jean-Jaques Rousseau wetterte in sozialreformatorischer Absicht gegen diejenigen, die in Glashäusern der Natur zur Unzeit geschmacklose Früchte abtrotzten. Wir diskutieren Macht über die Natur am Beispiel der Rheinregulierung nach den Plänen von Johann Gottfried Tulla.
Die Wirkungen der Dynamik eines großen Stroms auf Kriegshandlungen und Schlachtenglück an den Ufern und im Wasser lassen sich für die Donau erzählen, eine über Jahrhunderte umkämpfte Grenze. Eis, Hoch- und Niedrigwasser sind Faktoren, die zu ignorieren sich niemand leisten konnte. Die Donau blieb neutral: Ihre Dynamik konnte sich für Belagerte und Belagernde, für habsburgische wie osmanische Truppen als Glück oder Unglück erweisen.
Krieg ist in vielerlei Hinsicht negativ für die Umwelt. Die Wirkungen beginnen bei der Ressourcenextraktion für kriegswichtige Materialien. Diese zeigen wir für Salpeter, der als Bestandteil des Schießpulvers schon in der Frühen Neuzeit eine begehrte Ressource war, in Konkurrenz zu seiner Verwendung als Dünger.
Fallstudien zu zwei Diktaturen des 20. Jh. verdeutlichen, wie der Drang nach totaler Kontrolle über Menschen und Natur totale Zerstörung nach sich ziehen kann. Die nationalsozialistische Diktatur zeigt auch die Janusköpfigkeit solcher Regime. Der deutsche Wald wurde einerseits ideologisch überhöht und andererseits der Kriegsmaschinerie bedenkenlos geopfert. In den Konzentrationslagern wurde Natur zum Hilfsmittel der Folterknechte. Ergebenheit gegenüber einem Diktator führte in China zusammen mit Kontrollfantasien zur größten durch Menschen jemals verursachten Hungerkatastrophe und zu Umweltproblemen, die bis heute bestehen.
Demokratie und die mit ihr verbundene Meinungsfreiheit schützen allerdings nicht vor kriegsbedingten Umweltzerstörungen, wie der Einsatz des Herbizids Agent Orange durch US-Truppen zeigt. Die Belastung mit Dioxin hat langfristige Effekte auf Menschen und ihre Umwelt.
Die Politik der USA war im 20. Jh. imperialistisch, ob in Korea oder Vietnam, ob beim Rennen um die erste Wasserstoffbombe oder den Kampf um die symbolische Hoheit im Weltall und auf dem Mond. Der Kalte Krieg führte nicht nur zu weitgehender Umweltzerstörung auf Schlachtfeldern und beim Uranabbau in den Reservationen etwa der Navajo, sondern auch zum Entstehen einer gegen Umweltzerstörung und Krieg gerichteten Bewegung. Mit dem ersten Earth Day 1970 etablierte sich in den USA eine zunächst erfolgreiche Massenbewegung.
Ob internationale Gewässer oder Feuchtgebiete, ob Regulierung oder Modernisierung auf Kosten von Menschen und Natur, politische Interessen und Machtkalküle sind umweltwirksam. Das gesellschaftliche Projekt der nachhaltigen Entwicklung wird ohne Berücksichtigung dieser Dimension nicht erfolgreich sein.
Das GREENPEACE-SCHIFF Rainbow Warrior im Hafen von Genua im Juni 2006.
»QUAKKARTE« des Kernenergiekritikers Wilfried Zeckai (1980).
ZWÖLFHUNDERTJÄHRIGE EICHE in Thüringen. (Postkarte; gezeichnet 1909, gesendet 1919)
Ein besonders prägnantes Beispiel POLITISIERTER NATUR. (Postkarte, gelaufen 1934)
Ausbringung von ENTLAUBUNGSMITTELN am 26. Juli 1969 im Mekong-Delta (Vietnam) durch einen Hubschrauber der US-amerikanischen 336. Aviation Company.
WACHTURM im Konzentrationslager Auschwitz II (Birkenau).
Wurzeln und Entwicklung des Naturschutzes in Deutschland
Mit den im 18. Jh. in Europa aufkommenden Gelehrtengesellschaften und wissenschaftlichen Akademien wuchs die ökonomische und naturwissenschaftliche Forschung. Der merkantilistische Staat als Akteur ging mit Natur planerisch um. Dies führte auch bei der Waldnutzung zu einem Paradigmenwechsel, der sich in dem bereits 1713 von Carl von Carlowitz geprägten Begriff der »nachhaltigen Forstwirtschaft« und 1816 in der Gründung des Forstwirtschaftlichen Instituts im sächsischen Tharandt artikulierte. Wald war fortan da, um Holz zu produzieren; Nebennutzungen wurden bekämpft. Die Bauern, deren gemeinschaftliche Nutzungsrechte einer Maximierung des Holzertrags entgegenstanden, wurden vertrieben.
»Wir alle brauchen nicht nur Brot, sondern auch Schönheit, Orte zum Spielen und zum Beten, wo die Natur uns heilen und aufmuntern und unserem Körper und unserer Seele gleichermaßen Kraft verleihen kann.« John Muir (zitiert in STEINER, 2011: 4)
Für die städtischen Arbeiterinnen und Arbeiter des 19. Jh. war die ländliche Natur nicht mehr Produktions-, sondern Erholungsraum. Organisierte sportliche Aktivitäten sowie Wanderungen »in der Natur« begannen. Der Österreichische Alpenverein (1862), der Schwarzwaldverein (1864), der Taunus Club (1868) und der Deutsche Alpenverein (1869) wurden gegründet. Tourismus wurde zum Wirtschaftsfaktor; häufig aufgesuchte Landschaften wurden dafür massiv verändert. Forderungen zum Schutz der »ursprünglichen Natur«, der »gestalteten Natur« der Gärten und gesamter Kulturlandschaften kamen auf. Der Tierpräparator und Museumspädagoge Philipp Leopold Martin (1815–1885) legte ein umfassendes Natur schutzkonzept vor und prägte 1871 erstmals den Begriff »Naturschutz« (Koch & Hachmann, 2011). Um 1900 konstituierten sich Organisationen von Naturfreunden in Österreich und Deutschland, die sich vehement gegen Veränderungen der Kulturlandschaften durch die Industrie, das Wachstum der Städte und die Verkehrsinfrastruktur sowie gegen den stark erhöhten Flächenbedarf des Militärs wandten. (RÖSCHEISEN, 2005: 44–47)
Die LORELEY am Mittelrhein – die Wiege des Naturdenkmalschutzes.
Der Professor für Klavier und Orgel Ernst Rudorff (1840–1916) gründete 1904 den »Bund Heimatschutz« zur Bewahrung von Sitten, Gebräuchen und Landschaften (RUDORFF, 1880; BFN, 2006: 2). Dieser und ähnliche Versuche, zivilisationskritisch-romantische und vorindustriell-feudale Wertvorstellungen zum »Schutz der Heimat« mit denjenigen zum »Erhalt der Natur« zu verbinden, erwiesen sich nicht als tragfähig. Die Interessen von Naturschützern blieben darin peripher. Sie organisierten sich daher bald in Naturschutzvereinen, deren zentrale Strategie im Kauf kleiner Flächen oder einzelner Kulturlandschaftselemente (»Naturdenkmale«) bestand, die dann geschützt wurden. Landkäufe durch den 1909 gebildeten Verein »Naturschutzpark« ermöglichten 1921 die Etablierung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide. Naturschutz schützt in Europa meistens Kultur: Die Erhaltung von Heideflächen, also von Auswirkungen traditioneller Nutzung als Weiden, stand im Fokus. Geschützt wurde eine Kulturlandschaft. (RÖSCHEISEN, 2005: 44–47; BFN, 2006)
Ein Meilenstein des deutschen Naturschutzes ist die 1904 vom Botanikprofessor Hugo Conwentz (1855–1922) vorgelegte Denkschrift »Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung«. Er wurde daraufhin 1906 zum Leiter der neuen »Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen« berufen. Ihre Aufgaben bestanden in der Dokumentation der Naturschätze, Forschung und Beratung. Conwentz baute rasch ein Netzwerk ehrenamtlicher Kommissionen und Beratungsgremien auf, aus denen sich »Stellen für Naturdenkmalpflege« entwickelten. Zu geringe Ausstattung und Kompetenzen der Staatlichen Naturschutzstellen vermochten wenig gegen den Landnutzungswandel zu Ungunsten naturnaher Standorte auszurichten. Der Dichter Herrmann Löns verhöhnte 1911 den »conwentzionellen Naturschutz« als »Pritzelkram«; Conwentz habe die »Naturverhunzung en gros« nicht verhindert. (KNAUT, 1993; UEKÖTTER, 2003: 35; BFN, 2006: 3)
»Tritt dem Bund NATURSCHUTZ in Bayern bei!« (Werbepostkarte des 1913 gegründeten Bund Naturschutz)
Naturschutz wurde zur Gesetzesmaterie. 1888 war das Reichsvogelschutzgesetz in Kraft getreten. In der Weimarer Verfassung von 1919 waren der Schutz und die Pflege von Natur und Landschaft durch den Staat unverbindlich verankert. Das 1920 erlassene Preußische Feld- und Forstpolizeigesetz ermöglichte die Ausweisung von Naturschutzgebieten. Als Erstes wurde 1921 das Neandertal bei Düsseldorf unter Schutz gestellt. (BFN, 2006: 4)
1922 übernahm Walther Schoenichen (1876–1956) die Leitung der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege. Er stand dem völkischen Flügel der Naturschützer nahe, für den »intakte« Natur Grundlage für »gesundes Volkstum« war (SCHMOLL, o. J.). Schoenichen mangelte es an Fachkenntnis. Er bewunderte die gepflanzten Hutewälder mit ihren knorrigen Eichen und Buchen als »Urwaldwildnis«.
Während im frühen 20. Jh. zivilisationskritische Romantiker wie Ernst Rudorff und nüchterne Naturwissenschaftler wie Hugo Conwentz um den »richtigen« Naturschutz stritten, konkurrierten in der nationalsozialistischen Zeit der »Reichslandschaftsanwalt« Alwin Seifert (1890–1972) mit Landschaftsarchitekten wie Heinrich Wiepking-Jürgensmann (1891–1973). Der organisierte Naturschutz blieb über Jahrzehnte »national, staatshörig, konservativ und elitär« (UEKÖTTER, 2003: 35f.).
1933 erfolgten die Gleichschaltung der Naturschutzverbände und der Ausschluss der jüdischen Mitglieder. Das 1935 von Reichsforst- und -jägermeister Hermann Göring durchgesetzte Reichsnaturschutzgesetz regelte erstmals den Ausgleich nach Eingriffen durch private Personen – nicht jedoch durch Großvorhaben des Staates. Für »jagdbare« Tiere galt das Gesetz nicht. Zwar war es aus naturschutzfachlicher Sicht fortschrittlich und in Westdeutschland bis zum Erlass des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 1976 nahezu unverändert gültig. Die Präambel zeigt jedoch deutlich den ideologischen Charakter des Gesetzes: Erst die »Umgestaltung des deutschen Menschen« hätte die »Vorbedingungen für wirksamen Naturschutz« geschaffen. Die Institutionen des Naturschutzes dienten der ideologischen Sicherung der nationalsozialistischen Herrschaft, nicht dem Schutz der Natur. (BFN, 2006: 4f.; RADKAU & UEKÖTTER, 2003; RADKAU, 2011: 96ff.; SCHMOLL, o. J.)
In den 1960er- und 1970er-Jahren begann in der Bundesrepublik Deutschland ein von Luftverschmutzung, Atomkraftwerken und dem Kampf gegen Aufrüstung und das Establishment stimulierter Umbruch (RADKAU, 2011). Die Umweltpolitik der von Willy Brandt geführten sozial-liberalen Koalition und die Gründung der Partei DIE GRÜNEN holten die Naturschutzinstitutionen aus ihrem Dornröschenschlaf. Bis dahin hatten sie auf die Erhaltung von Kulturlandschaftselementen und bedrohten Tier- und Pflanzenarten gezielt. Prozessschutz statt Objektschutz wurde danach zur Maxime. Es galt, der Natur ihren Lauf zu lassen. Trotz dieses Umbruchs ist die Segregation, die Orientierung an einzelnen zu schützenden und spezifisch zu nutzenden Raumausschnitten, Basis des Naturschutzes geblieben. So verwundert es nicht, dass Schneider (2004: 7–8) den postmodernen, staatlichen Naturschutz als ahistorisch, asozial, autoritär und in der »Tradition patriarchal strukturierter Allegorien über die Natur« verharrend charakterisiert. Ob der Naturschutz eine Zukunft hat? Nicht als Segregationsideologie, aber als wichtiger Teil einer umfassenden Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft.
Früher Naturschutz in den USA
Mitte des 19. Jh. erfasste der kalifornische Goldrausch das Yosemite-Tal in Kalifornien. Die US-Armee begann dort indigene Bewohner zu jagen. Aufzeichnungen dieser Gefechte und erste Touristen machten die überwältigend schöne Landschaft bekannt; kommerzielle Interessen erregten bald Besorgnis. Nach Forderungen durch prominente Persönlichkeiten beschloss der US-Kongress 1864 die Unterschutzstellung: Als Park des Bundesstaates Kalifornien wurde Yosemite zum ersten größeren von der Bundesregierung der USA unter Schutz gestellten Gebiet, das dem Naturschutz und dem Naturerleben diente. 1872 folgte Yellowstone in Wyoming. Der Naturenthusiast und Universalwissenschaftler John Muir (1838–1914) förderte die Naturschutzbewegung in den USA wesentlich. Er gründete 1892 gemeinsam mit anderen den Sierra Club, eine bis heute bedeutende Naturschutzorganisation. Präsident Theodore Roosevelt sorgte 1906 auf Anregung Muirs für die Vergrößerung, Rückübertragung in die Bundeszuständigkeit und Ausweisung als Nationalpark. (BOWLER, 1997: 208f.; WORSTER, 2005; STEINER, 2011)
Das Lhalu-Feuchtgebiet in Tibet
»Bang mdzod phyi ma« (Schatzkammer im Freien) nannte die tibetische Regierung noch Anfang des 20. Jh. das Lhalu-Feuchtgebiet im Nordosten der Hauptstadt Lhasa. Ein eigenes Büro für Grasmanagement kümmerte sich um die Ernte des Riedgrases für die Pferde in Regierungsdiensten. Wächter waren rund um das Moor verteilt, Aufsichtspersonen aus dem nahegelegenen Dorf für die Ernte verantwortlich. Die nötige Arbeit wurde von Dorfbewohnern als Steuerleistung erbracht.
Bis in die 1950er-Jahre stand das Wasser im Feuchtgebiet zeitweise hüfthoch, das Riedgras wuchs übermannshoch. Das Riedgrasland war mit kleinen offenen Seen und Quellen durchsetzt. Bei der Ernte ließ man rund um diese einen Ring aus Gras stehen, damit niemand hineinfiel. Grassoden dienten als Baumaterial, und der dicke oberste Bodenhorizont aus Torf (tibetisch: lama) lieferte getrocknet kostbaren Brennstoff. Von März bis Mai, wenn der Wasserstand am niedrigsten lag und Insekten die Ernte weniger erschwerten, durfte »lama« gestochen werden. Aufseher sorgten dafür, dass die Stiche jährlich ihre Position wechselten. Daneben wurden im Frühjahr an bestimmten Plätzen Dämme aus Torf errichtet, die das Wasser daran hindern sollten, rasch in den Kyichu-Fluss abzufließen. Das vergrößerte die Schilfproduktion im unteren Teil des Feuchtgebietes. Zu Beginn der Regenzeit wurden die Dämme wieder abgetragen. Die in der Umgebung lebenden Familien mussten sich zudem an der jährlichen Räumung des »Sandkanals«, eines Sedimentabscheiders für zwei Flüsse mit hohen sommerlichen Sedimentfrachten, beteiligen.
Dieser Sandkanal wurde Anfang der 1970er-Jahre zugeschüttet, um Bauland für die Stadterweiterung von Lhasa zu gewinnen. Zwei stark Sediment führende Flüsse wurden an die Nordostecke des Gebietes umgeleitet. Schnell wurde dieser Teil des Moors unter einer Sandschicht begraben. Die 20 Jahre später gegrabenen Rückhaltebecken erwiesen sich als zu flach, der Sand breitete sich weiter aus. Später sollte ihn die lokale Bevölkerung zum Teil abbauen und als Baumaterial verkaufen. Zeigt sich an Lhalu eine typische Geschichte von Nutzungswandel durch Modernisierung?
Im März 1959 war außerdem der tibetische Aufstand gegen die chinesische Herrschaft gescheitert, der Dalai Lama geflohen. Die Aufständischen wurden zu Zwangsarbeit verurteilt. Eines der mit Zwangsarbeitern durchgeführten chinesischen Projekte war die Trockenlegung des Feuchtgebietes. Die chinesische Führung wollte die Bedeutung der bisherigen Nutzung nicht wahrnehmen: Für die Han-Chinesen handelte es sich um ein großes Stück unproduktiven Sumpfes, der – trockengelegt – als Getreideanbaufläche produktiv werden würde. Zwangsarbeiter gruben zwei Hauptkanäle und eine Reihe kleiner Seitenkanäle entlang der künftigen Feldgrenzen. Nach drei Jahren wurde das Gebiet als ausreichend trocken für Getreidebau eingeschätzt. Es erwies sich jedoch als völlig ungeeignet und die Versuche wurden in den späten 1960er-Jahren eingestellt – die Trockenlegung war allerdings unumkehrbar. Sie wurde fortan als heroisches Projekt der Urbarmachung eines unfruchtbaren Sumpfes gefeiert, bei dem Soldaten der Volksarmee mit von Blutblasen bedeckten Händen für den kommunistischen Sieg über eine feindliche Natur erfolgreich geschuftet hatten. Diese Art Mythos war zentral für die kommunistische Ideologie: Im Kampf gegen die Natur sollte der kommunistische Mensch geschaffen werden; aus einer tibetischen Wildnis sollten moderne, nach wissenschaftlichen Grundsätzen bewirtschaftete, zivilisierte chinesische Felder werden.
Sandablagerungen am rechten Rand des LHALU-FEUCHTGEBIETS, eingerahmt von der Stadt Lhasa.
Getreidebau blieb unmöglich, die Gewinnung von »lama« hingegen boomte in den 1960er- und 70er-Jahren weiterhin. Bis zum Aufstand waren nomadische Viehhalter in die seit den 1940er-Jahren wachsende Stadt Lhasa gekommen und hatten getrockneten Yakdung als Brennstoff verkauft. Derartige individuelle Wirtschaftstätigkeit war unter kommunistischer Herrschaft verpönt. Das Ausbleiben der Yakfladen führte zu Brennstoffmangel, und so begann die vermehrte private Gewinnung von Torf im inzwischen trockengelegten ehemaligen Feuchtgebiet. Am stadtfernen Rand wurde ein Granitsteinbruch angelegt; Staub und Lärm ließen Anrainer (vergeblich) protestieren. Die Armee hatte das Jagdrecht, aber auch Privatpersonen betrieben illegale Jagd auf die noch immer zahlreichen Zugvögel. Der Schwarzhalskranich (Grus nigricollis) verschwand.
Mitte der 1980er-Jahre wurde das Land im Zuge ökonomischer Reformen reprivatisiert, nur um es anschließend als Bauland zu requirieren. Wieder wurde ein Stück Feuchtgebiet drainiert – bis 1996 war nahezu das gesamte landwirtschaftliche Land in seiner Umgebung als Bauland ausgewiesen. Für die nun landlosen ehemaligen Bauern wurden Rinder aus Ostchina importiert, Lhalu bot sich als Weideland an. Teile des ehemaligen Moores wurden für den Gemüseanbau genutzt, Fischteiche angelegt und für Touristen Reitausflüge angeboten. Diese Nutzungen wurden allerdings zunehmend eingeschränkt, denn ein neues staatliches Paradigma geriet mit den ökonomischen Plänen in Konflikt: Mitte der 1990er-Jahre wurde das Gebiet unter Naturschutz gestellt. Es war zu diesem Zeitpunkt nur mehr halb so groß wie zur Zeit der Riednutzung. Dazu war es weitgehend ausgetrocknet.
1992 war mit Mitteln des UN World Food Programms der »Mittelkanal« gebaut worden, der am südlichen Rand von Lhalu verläuft. Diese als Stadtverschönerung geplante Maßnahme hatte weitere tief greifende Wirkungen auf die Feuchtgebietsreste. Der Wasserspiegel im Kanal liegt tiefer als das Moor, 70% des verbliebenen Gebietes wurden so ausgetrocknet.
Paradoxerweise wurde gleichzeitig mit der faktischen Austrocknung Lhalu erstmals offiziell als Feuchtgebiet wahrgenommen. Der Weg in eine wünschenswerte, moderne Welt führte nun über den Naturschutz. Das »TAR Environmental Protection Bureau« (EPB) untersuchte erstmals 1995 das Gebiet. 1997 bis 1998 verbot die lokale Abteilung des EPB eine weitere Gewinnung von Ackerland, das Waschen von Wäsche, die Gewinnung von Torf für Rasen, das Fischen und den Anbau von Feldfrüchten. 7500 Kiefern und Weiden wurden entlang des Hauptkanals gepflanzt, das Reiten wurde verboten. Mehr als 20 Tafeln, die das Naturschutzgebiet ausweisen, wurden aufgestellt. Für 12 Millionen US-Dollar wurde ein Zaun um den kläglichen Rest des Feuchtgebiets errichtet. Durch Demarkation sollte »Natur« produziert werden, die Nutzungsgeschichte musste dafür verdrängt werden. In radikaler Umkehr der Ideologie der 1960er-Jahre galt es nun als kommunistisches Projekt, »Wildnis« zu schützen. Diese war allerdings nicht mehr vorhanden: Getreide wurde angesät, um die durch die Trockenlegung verschwundenen Zugvögel anzulocken, eine zeitlose, von Menschen unberührte Landschaft sollte konstruiert, die Nutzungsgeschichte vergessen werden.
Warum ist dies so wichtig? Naturschutz ist hier zutiefst politisch. Lhalu dient als Argument nationalistischer Ansprüche von chinesischer und (exil-)tibetischer Seite. Letztere argumentiert, dass Tibeter als Buddhisten mit der Natur in Harmonie gelebt hätten, während unter chinesischer Herrschaft die Natur zerstört worden sei. Die chinesische Regierung setzt diesem Argument »modernen« Naturschutz entgegen, um die tibetische Kulturgeschichte von Lhalu zu überschreiben. Die neu geschaffene Wildnis ist Teil des Programms der Assimilierung der autonomen Provinz Tibet. (YEH, 2009)
Der von der chinesischen Regierung errichtete ZAUN um das Lhalu-Feuchtgebiet verhindert die früher üblichen Nutzungen. Er wird von Anrainern selbst als Ressource betrachtet, wie die FEHLENDEN ZAUNFELDER in der großen Abbildung zeigen.
Wissenschaft und Weideland in Kalifornien
Vor 1870 waren Rinder und auch Schafe in einem saisonalen Zyklus durch die Landschaften Kaliforniens gezogen. Den Winter verbrachten sie auf Wiesen im Tal, Frühling und Herbst in den Ausläufern der Wälder, den Sommer in den Nadelwäldern und Almen der Höhenlagen. Während der 1870er- und 1880er-Jahre konsolidierten mächtige Agrarkonzerne von San Francisco aus – unter effektiver Nutzung der neuen Verkehrsnetze und der technischen Innovation des Stacheldrahts – ihre Kontrolle über die fruchtbaren landwirtschaftlich genutzten Täler. Sie beeinflussten die Gesetzgebung, wodurch Ackerbau gegenüber Viehhaltung priorisiert wurde. Damit waren die weiträumigen Weidezyklen nicht mehr möglich. Die hoch gelegenen Wälder wurden unter staatlichen Schutz gestellt, die Täler intensiv ackerbaulich genutzt. Den Viehhaltern blieb nur noch die trockene mittlere Höhenstufe. Sie sahen sich fortan der schwierigen Aufgabe gegenüber, eine tragfähige Viehhaltungsindustrie auf eichenreichem Grasland aufzubauen, das sonst niemand nutzen wollte.
Doch die Viehhalter erhielten Hilfe aus der Wissenschaft. Arthur Sampson, der erste Professor für Weidemanagement an der Universität von Kalifornien, nutzte das ländliche Fortbildungsprogramm seiner Universität, um eine seiner Meinung nach naturschutzorientierte Nutzung der im Privatbesitz befindlichen laubholzbestandenen Weiden der mittleren Höhenstufe durchzusetzen. Bis zum Ende der 1930er-Jahre wurden – entsprechend den Forschungsergebnissen – in fast allen Bezirken Kaliforniens Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Gehölzen in Grasland ergriffen, indem jährlich kontrollierte Feuer gelegt wurden.
In den 1950er-Jahren stieg der Bedarf an Fleisch. Viehhalter suchten nach Möglichkeiten, die Produktivität ihrer Weiden zu steigern. Eine eben gegründete, von der University of Califonia in Davis betriebene Forschungsstätte wurde zum Zentrum einer neuen Vision wissenschaftlich geplanter Viehhaltung. Das Land sollte regelrecht transformiert werden, »unordentliche« grasreiche, mit einzelnen Bäumen bestandene Flächen sollten geordneten, homogenen Weiden zur Erzeugung von Tierfutter weichen. Die Produktion sollte massiv gesteigert werden, das knappe Wasser möglichst hochproduktiven Futtergräsern zugutekommen. Auf der Hopland-Versuchsfarm wurden dafür große Flächen von Gehölzen »befreit«. Zehntausende Eichen wurden mit Herbiziden behandelt und verbrannt. Die Forscher säten danach Grassamen und beobachteten deren Produktivität. Der Wasserhaushalt wurde untersucht, da Eichen verdächtigt wurden, in erheblichem Maße Bodenwasser zu verbrauchen. Zunächst stieg die Produktivität auf den eichenfreien Versuchsflächen tatsächlich an, und die lästigen Gehölze schienen dauerhaft vertrieben. Mit einer Kombination aus schweren Maschinen, kostengünstigen Chemikalien und kontrolliertem Abbrennen konnten – das schien der Versuch bewiesen zu haben – Viehzüchter ihr Land schnell und kostengünstig in homogene Hochertragsweiden verwandeln.
Schafe weiden zwischen Baumstümpfen. KAHLSCHLAG wurde für die kalifornischen Weiden von Experten empfohlen.
Informationsmaterialien, Besichtigungstage und Kurse für verschiedene Zielgruppen sowie Vor-Ort-Beratungen durch Experten – alles auf freiwilliger Basis – beeinflussten die Entscheidungen der Viehzüchter. Eine Broschüre aus dem Jahr 1956 empfahl, einen potenten Cocktail von Herbiziden über eine enorme Fläche zu versprühen. Dieser sollte Eichen, Kiefern, Beifuß und Chaparralbüsche großflächig absterben lassen, um Millionen Hektar unproduktives Land in nutzbringende Weiden zu verwandeln.
Die Forscher der Versuchsstation waren nicht die Einzigen, die gegen Eichen vorgingen. Das Landwirtschaftsministerium hatte bereits jahrzehntelang die Beseitigung von Eichen aus landwirtschaftlichen Flächen in den Tälern gefördert – sie galten als Bewirtschaftungshindernis. Mittels Sprengstoff und schwerem Gerät wurden ab 1947 Eichen mit Regierungshilfe vernichtet. In den 1960er- und 1970er-Jahren stieg zudem der Bedarf an Holzkohle und Feuerholz. Ölpreiskrise, Campingboom und die Grillplätze der suburbanen Villen trugen dazu bei, Eichen aufgrund ihres vermarktbaren Holzes zu fällen.
Bis in die 1970er-Jahre koordinierte die University of California in Davis immer wieder staatlich geförderte Eichenentfernungsprogramme, die von der Industrie gesponsert, von der Bundesregierung bezahlt und mit Hilfe der lokalen Viehzüchtervereinigungen auf privaten Grundstücken umgesetzt wurden. Von 1951 bis 1973 führten diese Programme zur Rodung von Eichen auf einer Fläche von etwa 360.000 Hektar. Dies entspricht 10% der Fläche, auf der ursprünglich Eichen in Kalifornien wuchsen.
In den Augen der Forscher waren grasreiche Laubwälder ein Natursystem, das zur Degradation neigte und des beständigen menschlichen Arbeitseinsatzes bedurfte, um produktiv zu bleiben. Die starke Erosion und der Verlust an Lebensraum für Wildtiere durch die Rodung der Eichen fielen schon bald auf, doch ließen sich die Wissenschaftler davon zunächst nicht beirren. Die große Vision blühender Weiden mit plätschernden Bächen statt verbuschtem Ödland mit staubigen Trockentälern wurde durch die Nebenwirkungen der Rodung zunächst nicht zerstört.
Die Untersuchungsflächen der University of California in Berkeley standen im Zentrum des Wandels dieser Vision. Dort wurden keine Rodungsversuche angestellt, sondern die vorhandenen eichenreichen Ökosysteme in ihrer Entwicklung beobachtet. Ein schon in den 1930er-Jahren beschriebenes Phänomen wurde nun systematisch betrachtet: Im homogenen Grasland gab es praktisch keine jungen Eichen, weil vor allem durch die Beweidung Eichensprößlinge nicht heranwachsen konnten.
FORTBILDUNGSVORTRAG für Landbesitzer in einem kurz zuvor gerodeten Wald – die Baumstümpfe sind deutlich zu sehen.
Auf 738 Seiten widersprach 1973 ein Doktorand der herrschenden Ansicht fundamental. Vorcie Loies Hollands Untersuchung unter einzelnen Eichen ergab, dass unter ihnen die Futterproduktivität erhöht und nicht vermindert war. Das lag an kühleren Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und an Nährstoffen, die die Eichen über Laubstreu einbrachten. Holland zeigte außerdem, dass ein gewisses Maß an Beschattung das Wachstum von Nutzpflanzen fördert. Nach der Rodung verschwanden lebenswichtige Nährstoffe aus dem Boden, der anfängliche Anstieg der Grünlandproduktivität wich einem unvermeidlichen Niedergang.
Während Gemeinden enthusiastisch reagierten und Regeln zum Schutz von Eichen erließen, waren die Weidebesitzer verärgert und frustriert. Sie hatten neueste wissenschaftliche Erkenntnisse umgesetzt, und nun sollte das Gegenteil richtig sein? Zudem fürchteten sie gesetzliche Eingriffe in ihre Besitzrechte. Die anschließende politische Debatte führte schließlich 1985 zur Einrichtung eines »Integrierten Laubholz-Weide-Management-Programms«. Es bot Gemeinden, Weidebesitzern, Alteingesessenen und neu Zugezogenen gemeinsame Anknüpfungspunkte und führte zu Maßnahmen für die Wiedereinführung von Eichen.
Binnen weniger Jahrzehnte hatten sich die Wahrnehmung dieser langlebigen Bäume und damit die Weidelandschaften Kaliforniens vollkommen gewandelt. Das Wachstum der neu gepflanzten Eichen wird weitaus mehr Zeit benötigen als der Wandel menschlicher Wahrnehmungen und Bewertungen.
(ALAGONA, 2008)
Der Kampf um den Gelben Quakfisch
Sie mögen stumm sein, aber sie sind nicht lautlos. Die Trommler oder Quakfische schlagen in der Paarungszeit mit ihren Bauchmuskeln gegen die Schwimmblase, was ein dumpfes Geräusch erzeugt. Von 1925 bis 1935 rückten die als Speisefisch in China geschätzten Großen und Kleinen Gelben Quakfische unversehens in das Zentrum einer diplomatischen Verwerfung zwischen China und Japan. Kleine Gelbe Quakfische sind auf dem Festlandsockel in Asien weit verbreitet, große Bestände gibt es im Ostchinesischen und im Gelben Meer. Ihre großen Verwandten finden sich daneben auch noch im Südchinesischen Meer und südwestlich von Südkorea. Die Gewässer rund um Chinas Zhoushan-Archipel bilden einen der wichtigsten Laichgründe für beide Arten. Große wie Kleine Quakfische verbringen den Winter in tiefen Gewässern vor der Küste der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Im Frühjahr, wenn die Wassertemperaturen steigen, verlassen sie ihre Winterquartiere und ziehen in seichte Küstengewässer, um zu laichen.
Wie die Populationen vieler anderer Meerestiere wurden die Bestände des Gelben Quakfisches bereits Anfang des 20. Jh. übernutzt: In den 1890er-Jahren wurden am Shengsi-Archipel vor der ostchinesischen Küste 310 Fischerboote gezählt; 1930 waren es schon etwa 1800. Ursprünglich wurde vor allem der in Küstennähe zu findende Große Gelbe Quakfisch gefangen. Nach 1917 wanderte das Zentrum der Fanggebiete nach Nordosten, wo vorwiegend der Kleine Quakfisch gefangen wurde. Fischerboote wagten sich in Gebiete, die bis zu 100 nautische Meilen von der Küste entfernt lagen. Wie auch bei anderen Fischereien wurde die Abnahme der Bestände zwar bemerkt, aber nicht in Beziehung zur Überfischung gesetzt (vgl. S. 108). Eine Beschreibung der Fischerei aus dem Jahr 1920 hält fest, dass diejenigen, die bereits lange Zeit in der Fischwirtschaft arbeiteten, behaupteten, dass 30 oder 40 Jahre zuvor Große Gelbe Quakfische den Gezeiten gefolgt und zu den Inseln nahe der Küste gekommen seien. Zu dieser Zeit habe es nicht viele Boote gegeben, die Fangmethoden wären primitiv gewesen und trotzdem sei der Fang von Fischen relativ einfach gewesen. Nun habe die Zahl der Fischerboote zugenommen, das Fanggerät sei besser, die Fische aber würden sich in der Tiefe verstecken.
Die Segel-Dschunken der chinesischen Fischereiflotte waren technisch veraltet. Aber auch diese scheinbar primitive Fangmethode hatte Auswirkungen auf die marinen Ressourcen im Zhoushan-Archipel. Netze mit extrem kleinen Maschenweiten erfassten viele Jungfische und Laich. Junge Große Quakfische, im Volksmund als »Pflaumen« bekannt, hatten als Nahrungsmittel wenig Wert. Stattdessen verkauften Fischer sie getrocknet als Dünger. Eine Ausbeutungsspirale wurde in Gang gesetzt: Kleine Fische erzielten auf dem Markt niedrige Preise, Fischer mussten daher größere Mengen fangen, um ihre Ausgaben für Arbeit und Kapital abzudecken. Der Fang von Jungfischen führt rasch zur Überfischung, da er die Fortpflanzung der Fische bedroht.
Bereits in den frühen 1930er-Jahren warnten chinesische Fischereiexperten, dass bei einer Fortsetzung dieser Praxis die Gelben Quakfische binnen weniger Jahrzehnte aus dem Meer verschwunden sein würden. Die Expertenmeinungen verhallten ungehört, denn es ging bald um hegemoniale Ansprüche Chinas gegenüber Japan, dem östlichen Nachbarn mit Weltmachtambitionen.
Der Große Gelbe QUAKFISCH in einer Darstellung aus dem Jahr 1940.
Die japanische Fischereiflotte war als Teil des politischen Weltmachtprogramms früh auf Dampfschiffe umgestellt worden. Schon 1911 war den modernen Schiffen zur Vermeidung von Konflikten mit traditionellen Fischerbooten die Nutzung der Küstengewässer untersagt worden, 1912 wurden sie auf das Gebiet westlich des 130. Längengrades beschränkt. Seit 1920 wurden zunehmend Schleppnetze eingesetzt, deren Nutzung aber ebenso räumlich beschränkt wurde. Die japanische Regierung löste einen lokalen ökologischen Konflikt durch Verschieben der Ausbeutung in weiter entfernte Fanggründe. Doch mit der technischen Aufrüstung der Flotte kam, was kommen musste: Die Fänge an Seebrassen, dem beliebtesten Fisch, gingen zurück. Die Regierung limitierte daraufhin die Anzahl der Schiffe. Von 1925 bis 1927 entdeckten motorisierte Fischer mit ihren Flotten den Gelben Quakfisch, der zwar als minderwertig erachtet wurde, aber doch ökonomische Chancen bot. Die japanische Regierung förderte die Bewegung der Fischereiflotte in neue Gebiete und fremde Gewässer durch die Gewährung von Subventionen.
Das OSTCHINESISCHE MEER bei Putuo Shan in der Nähe von Shanghai.
Von 1921 bis 1929 stieg der Anteil der Quakfische auf 20 bis 30% der gesamten Fangmenge japanischer Trawler; im Jahr 1937 hatten sie einen Anteil von über 40%. Überfischung erschöpfte die küstennahen wirtschaftlich wichtigen Fischbestände. Daher rückte die japanische Flotte immer näher an die Fischgründe vor den äußersten Inseln des chinesischen Zhoushan-Archipels.
So kam es ab Mitte der 1920er-Jahre zum Konflikt mit China. Aufgrund internationaler Verträge, die Japan bevorzugten, durften japanische Fischer ihren Fang in Shanghai verkaufen. Die chinesischen Fischer fühlten sich dadurch massiv bedroht, die chinesische Regierung sah eine Bedrohung ihrer Souveränität. Seemacht und Fischerei territorien seien direkt miteinander verknüpft, hatte bereits 1907 ein reformorientierter Politiker argumentiert. 1931 eskalierte der Konflikt. China plante, die Häfen für japanische Fischer mit der Begründung zu sperren, es existiere kein Fischereiabkommen. Zölle sollten erhoben werden. Nun wurde Natur zum politischen Argument. Japanische Diplomaten erklärten, man sei zur Zusammenarbeit mit chinesischen Fischern bei der Entwicklung der praktisch unerschöpflichen Fischgründe nahe der chinesischen Küste zur Versorgung des chinesischen Markts bereit und habe keine Ambitionen, diese Fischgründe zu monopolisieren. China habe gar nicht die Kapazität, von dieser »unerschöpflichen« Ressource zu profitieren, daher hätten japanische Fischer jedes Recht, sie zu nutzen. Daneben machte Japan klar, dass es zu einem bewaffneten Konflikt bereit wäre – es ging ja schließlich um die Nation als Seemacht. Um eine bewaffnete Konfrontation mit Japan zu vermeiden, forderte das chinesische Finanzministerium die Regierung auf, die Einführung der Zollschranken zu verzögern und eine diplomatische Lösung zu suchen. Innerhalb der Regierung herrschte also Uneinigkeit. Japans diplomatische und militärische Überlegenheit machte es der chinesischen Regierung unmöglich, den japanischen Zugriff auf die Quakfischbestände zu begrenzen.
ANZAHL DER BOOTE UND FANGMENGEN (in 1000 Tonnen) von Brassen und Quakfischen der japanischen Trawler im Ostchinesischen Meer und im Gelben Meer 1921 bis 1928 (aus MUSCOLINO, 2008: 312).
Das setzte eine Ausbeutungsspirale in Gang. Angesichts des anhaltenden Wettbewerbs war es für chinesische Unternehmen plausibel, so viele Fische wie möglich zu fangen, bevor die Japaner sie wegfischten. Die Modernisierung der Flotte schien eine logische Lösung des diplomatischen Konflikts. Die technologisch moderne japanische Fischereiflotte war allerdings in der Lage, größere ökologische Verwüstungen anzurichten. Während die japanische Fischerei immer höheren Druck auf die Quakfischbestände ausübte, betrieb die chinesische Regierung eine Politik der Begrenzung ausländischer Konkurrenz durch Steigerung der inländischen Fischproduktion. Wie ihr japanisches Pendant verstand die chinesische Führung eine Kontrolle über die Meere und ihre Ressourcen als ein entscheidendes Mittel zur Stärkung der Nation. Die Erhaltung der Quakfische war demgegenüber nebensächlich, Natur wurde als unerschöpflich gedacht, um sie nationalistisch nutzen zu können; der Fischbestand hat sich bis heute nicht erholt, die chinesische Fischereiflotte fängt allerdings weiterhin Gelbe Quakfische.
(MUSCOLINO, 2008)
Johann Gottfried Tulla und die Bändigung des wilden Rheins
Der südliche Oberrhein war bis in das 19. Jh. ein natürlicher Fluss mit einer Vielzahl verzweigter Arme und Tausenden Inseln. Er wurde als schwer zu überwindendes und (auch politisch) kaum zu kontrollierendes Hindernis wahrgenommen, durch das mehrere Staatsgrenzen liefen. Illegale Grenzgänger, Gesetzlose und Missetäter fanden in diesem Labyrinth Verstecke.
Hochwasser veränderten die Flussarme und die Zahl, Lage und Größe der Inseln. Im zentralen und nördlichen Teil des Großherzogtums Baden veränderten sich die Rheinmäander beständig. Nachdem Hochwasser immer wieder ganze Dörfer zerstört hatten, baten Gemeinden um Verlegung an sichere Standorte. Meist kam es nach langwierigen Verhandlungen mit der Obrigkeit zum Umzug. Einzelne Mäander des Rheins wurden unkoordiniert durchstochen, um die Hochwassergefährdung bestimmter Gemeinden zu mindern. Andere waren danach verstärkt Hochwassern ausgesetzt. Die politische Zersplitterung am Oberrhein verhinderte koordinierte regionale Wasserbaumaßnahmen.
Johann Gottfried Tulla
Die Rentkammer der Markgrafschaft Durlach förderte ab 1789 die Ausbildung eines jungen, an Mathematik und Angewandten Naturwissenschaften sehr interessierten Mannes. Johann Gottfried Tulla (1770–1828) studierte am Markgräflichen Lyzeum in Karlsruhe und von 1792 bis 1794 bei dem Ingenieur und Mathematiker Karl Christian von Langsdorf (1757–1834) in Gerabronn (Hohenlohe). Danach besuchte Tulla namhafte Wissenschaftler sowie bedeutende Wasserbauprojekte am Niederrhein und in den Niederlanden. 1796 wurde er – nach einem vorzüglich bestandenen Ingenieursexamen – im Bezirk Rastatt verantwortlich für Wasserbauten am Rhein. Nach einer Reise durch das von Napoleon beherrschte Frankreich arbeitete er ab 1807 für fünf Jahre in der Schweiz (das Großherzogtum Baden beurlaubte ihn aufgrund fehlender Mittel gerne). Im Jahr 1812 stellte Tulla eine Denkschrift zur Begradigung des Oberrheins vor. Diese hatte zum Ziel, »daß dem Rhein ein ungeteiltes, in sanften der Natur angepassten Bögen oder auch [...] da, wo es tunlich, ein in gerader Linie fortziehendes Bett angewiesen wird« (J. G. Tulla, zitiert in BLACKBOURN, 2007: 113f.). Der Rhein würde dadurch deutlich schneller, tiefer und kürzer, die Grundwasserspiegel absinken und die Umwandlung vernässter Standorte in fruchtbare Äcker möglich. Tulla verstarb 1828 lange vor der Vollendung des Projekts. Als Bändiger des Rheins wurde er posthum berühmt. (BLACKBOURN, 2007: 106–114)
Der RHEINLAUF bei Karlsruhe vor 1819 und nach der Korrektion.
Die Eroberung linksrheinischer deutscher Gebiete durch die französische Armee nach der Französischen Revolution änderte die Situation grundlegend. Baden okkupierte rechtsrheinische Fürstentümer, Reichsritterschaften und Freie Reichsstädte. Es verfügte nun über eine geschlossene Fläche von der Landesgrenze zur Schweiz im Süden bis zur Grenze zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt im Norden. Die Verwaltung der einverleibten Territorien wurden reorganisiert und zentralisiert, die neuen Gebiete kartiert, das Rechtssystem und die Größenmaße vereinheitlicht. Damit wurden die gesellschaftlichen Voraussetzungen für das Großprojekt einer Rektifikation (Berichtigung) des Rheinlaufs an der westlichen badischen Landesgrenze nach den Plänen von Johann Gottfried Tulla geschaffen.
Die Verlagerung des Rheins durch Hochwasser hatte immer wieder dazu geführt, dass Gemeinden von der badischen auf die französische Rheinseite und umgekehrt gelangten. Das war politisch inakzeptabel und hatte Johann Gottfried Tulla 1812 bewogen, eine erste Denkschrift zur Rheinbegradigung mit dem Ziel der Schaffung eines festliegenden Flussbettes zu verfassen. Nach der französischen Besetzung linksrheinischer Gebiete konnten Frankreich und Baden die Details zur Rheinkorrektion ohne Einbeziehung weiterer Landesherren aushandeln. Tullas Denkschrift wurde dem Magistrat du Rhin in Straßburg vorgelegt, einer Kommission, die für hydrologische und territoriale Grenzfragen zuständig war, und von diesem gebilligt. Der Zusammenbruch des napoleonischen Reichs 1814 verzögerte die Umsetzung des Plans, doch Überschwemmungen beschleunigten dann die Verhandlungen zwischen Bayern (dem nun die Rheinpfalz gehörte) und Baden. Beide Staaten vereinbarten 1817, fünf Rheinmäander zu durchstechen, 1825 vereinbarte man weitere 15. Der 1840 von Frankreich und Baden unterzeichnete Grenzvertrag eröffnete die Möglichkeit der Rheinbegradigung an der gemeinsamen Grenze. (BLACKBOURN, 2007: 98–110, 116–122)
Zwischen jeweils zwei Rheinmäandern gruben Hunderte Arbeiter einen bis zu 24 m breiten Durchstich. Diese Verkürzung des Fließweges erhöhte die Fließgeschwindigkeit, wodurch der Fluss den Graben rasch verbreiterte und vertiefte. Ein solcher Durchstich, der bis über die Mitte des 19. Jh. hinaus ausschließlich in Handarbeit ausgeführt werden musste, dauerte zumeist mehrere Jahre. Standen dichte tonige Ablagerungen an, wurde tiefer abgegraben; nach dem Durchstich dauerte es dann gelegentlich mehrere Jahrzehnte, bis sich der Fluss ein breites Bett geschaffen hatte. Die neuen Böschungen wurden mit Hunderttausenden Faschinen gesichert.
Der Oberrhein verlor durch Wasserbaumaßnahmen zwischen Basel und der Grenze zu Hessen 81 km oder 23% seiner Länge. Ungefähr 5 Millionen m3 Erdaushub (dieser würde einen 750 km langen Güterzug füllen) wurden zwischen Basel und Straßburg auf einer Länge von 240 km zu Deichen aufgeschüttet. Mehr als 2000 Flussinseln verschwanden. Die Absenkung des Grundwasserspiegels machte, wie Tulla prognostiziert hatte, im Süden des badischen Oberrheins aus nassen Standorten trockene. Die Regulierungen führten zu einem Zusammenbruch der früher ertragreichen Goldwäscherei und der Vogeljagd. Der Niedergang der Rheinfischerei, einer wichtigen Erwerbsquelle vieler Dorfbewohner, beruhte allerdings nicht nur auf der Zerstörung der Habitate von Lachsen, Stören, Alsen und Neunaugen durch die Rheinregulierung, sondern auch auf der zunehmenden Gewässerbelastung durch die aufkommende Industrie. Stattdessen wurden Zander mit einigem Erfolg ausgesetzt. Aale gediehen ebenfalls. Städte am Mittel- und Niederrhein waren durch die beschleunigte Wasserführung am Oberrhein stärker von Hochwassern betroffen als zuvor. (BLACKBOURN, 2007: 102–122, 130–135; TÜMMERS, 1994: 145)
Trotz des Einsatzes Tausender Arbeiter und Soldaten konnte das 1817 begonnene Vorhaben erst 1879 abgeschlossen werden. Bewohner einzelner Dörfer, die Nachteile befürchteten, behinderten vereinzelt Arbeiten durch Handgreif lichkeiten. Neben naturräumlichen Besonderheiten ver lang-samten die ungeheuren Massen an Boden und Flusssedimenten, die mit der Hand ab- und aufgetragen werden mussten, sowie die auf Durchstiche folgende, lange währende Erosionsarbeit des Flusses das Projekt. Tulla selbst sah in unfähigen oder uneinsichtigen Fachkollegen besonders auf bayerischer Seite und den Meinungen fachfremder badischer Parlamentarier und Finanzbeamter Gründe für Bauverzögerungen. (BLACKBOURN, 2007: 123–127, TÜMMERS, 1994: 147)
Die Französische Revolution und Napoleon bewirkten eine staatliche Neuordnung Mitteleuropas und machten die Korrektur des Rheinverlaufs zur Festlegung der Staatsgrenzen erst möglich. Ein einzigartiges artenreiches Auenökosystem ging seit dem frühen 19. Jh. durch die Rheinbegradigung primär zur Schaffung unveränderlicher Landesgrenzen, also vor allem aus politischen Gründen, weitgehend verloren. Unerwartet starke Tiefenerosion des Rheins hatte die Grundwasserspiegel erheblich gesenkt. Zusammen mit weiteren Meliorationsmaßnahmen wurden bis in die zweite Hälfte des 20. Jh. mehr als vier Fünftel der vielfältigen Auwälder und Feuchtstandorte in eine artenarme agroindustrielle Landschaft verwandelt.
Die Begradigung hatte aber auch positive Wirkungen für die am Oberrhein lebenden Menschen. Viel neues fruchtbares Ackerland war geschaffen worden. Die westliche Landesgrenze lag fest und Hochwasser waren in diesem Abschnitt seltener geworden. Vor der Flussbegradigung hatten Typhus, Ruhr und besonders Malaria viele Menschen dahingerafft. Die meisten Brutstätten der Anophelesmücken waren beseitigt und Malaria wurde Ende des 19. Jh. selten – was die Menschen am Oberrhein auch Tulla zu verdanken hatten.
Durchstich des Mäanders des KÜHKOPFS am hessischen Oberrhein. (Ausschnitt aus einer topographischen Karte um 1729)
Die Donau als Kriegsschauplatz im 18. Jahrhundert
In einer Mitte des 4. Jh. n.Chr. gehaltenen Lobrede auf die Kaiser Constantius II. und Constans berichtet der berühmte Redelehrer Libanios über ihren Kampf gegen die Goten. Wäre der Fluss zugefroren, hätten die Goten über die Donau in die römische Provinz Dakien im heutigen Serbien und Rumänien eindringen können, wovor nur die Kaiser schützten (THOMPSON, 1956, FATOUROS et al, 2002).
Die Donau war nicht nur zur Römerzeit Militärgrenze. Das mittelalterliche ungarische Reich reichte bis an Donau und Save. Die Donau wurde zur Grenze zwischen Osmanischem Reich und Habsburgermonarchie und ist bis heute Grenzfluss, etwa zwischen Rumänien und Bulgarien (AGOSTON, 2009). Immer wieder war sie umkämpft, sei es in der berühmten Schlacht um Belgrad 1717, die von Prinz Eugen für die Habsburger entschieden wurde, sei es die obere Donau im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714). Bei den Belagerungen von Wien war das nördlich der Stadt ausgebreitete, veränderliche Geflecht aus Flussarmen, Inseln und Auen Teil der Stadtbefestigung, das den Aufmarsch größerer Armeen von Norden verhinderte.
Nicht nur für die Römer waren Witterung und Flusszustand strategisch wichtig. Immer wieder beeinflusste die witterungsbedingte Dynamik der Donau den Ausgang von Schlachten und spielte damit in Kriegen eine aktive Rolle. Ob Niedrigwasser die Verteidigung einer Festung erschwerte oder Nebel die Angreifer zurückhielt, ob Hochwasser den Transport von Verpflegung und Kriegsmaterial verhinderte oder die wertvollen Geschenke eines Gesandten auf dem Weg zu Friedensverhandlungen in der Donau versanken, die schwer kontrollierbare Natur des mächtigen Stroms musste berücksichtigt werden, wollte man in den Krieg ziehen.
Anfang März 1698 verhinderte dickes Eis im Krieg gegen die Osmanen habsburgische Truppentransporte auf der Donau. Am 5. Februar 1703 berichteten britische Zeitungen, dass die Truppen im Spanischen Erbfolgekrieg über Land transportiert werden mussten, da der Fluss zugefroren war. Die Leitha, ein Nebenfluss der Donau, war wenige Tage vor dem Jahresende 1704 zugefroren. Das erlaubte den Rebellen des ungarischen Magnatenaufstands, bis vor die Tore Wiens zu ziehen. 10.000 von ihnen überquerten wenig später die Donau bei Komarom. Ein Jahr später gelangten sie über den zugefrorenen Fluss auf die Insel Torsalva und stahlen dort 52 Ochsen.
Je später der Winter, desto riskanter ist das Begehen von Eis. Im Februar 1705 wollte eine Gruppe von 700 Rebellen auf Pferden die gefrorene Donau überqueren. Das Eis brach und 400 Mann ertranken. 5000 Rebellen hatten die gefrorene Donau am 26. Februar 1705 überquert. Dann taute das Eis und verhinderte ihren Rückzug, Ähnliches passierte wenige Wochen später wieder. Im März 1710 wurde die ungarische Rebellenarmee daran gehindert, in Kroatien und in der Steiermark einzufallen, weil das Eis zu tauen drohte, das ihnen den Übergang über die Donau ermöglicht hätte. 30 türkische Schiffe froren im Januar 1715 in der Donau bei Temes Capi ein. Ende 1716 war die Insel in der Nähe von Orsawa in türkischem Besitz und die kaiserlichen Truppen bereit, sie anzugreifen, um freie Fahrt auf dem Fluss zu ermöglichen. Aber Eis auf der Donau machte jede Truppenbewegung gefährlich. Ende Februar 1717 wurden die kaiserlichen Truppen vor türkischen Einfällen geschützt, weil das Eis angetaut war, und etwa 400 Türken ertranken, als es unter ihnen brach. Im Januar 1717 verwendeten Türken und Tataren das Eis, um die Donau zu überqueren und weit in das Reichsgebiet einzudringen. Wie der Wind konnte Eis beiden Seiten nutzen.
EISSTOSS in Wien. (Postkarte, 1929)
Am 5. Januar 1718 hielten die Verantwortlichen in Buda den britischen Botschafter an, der als Vermittler in den Friedensverhandlungen zwischen dem Osmanischen Reich und dem Habsburgerreich dienen sollte, aus Angst, die gefrorene Donau könne seine Sicherheit gefährden. Die Kälte war in diesem Februar »so schlimm wie seit vielen Jahren nicht, sie zwingt die Wölfe aus den Wäldern, die an vielen Orten Untaten gegen Menschen und Vieh verüben«, wie die britische Zeitung »Daily Courant« am 18. Februar 1718 zu berichten wusste. Den Februar über blieb der Transport von Material, um die Befestigungsanlagen von Belgrad wieder herzustellen, unmöglich. Das war kein Einzelfall. Auch Ende Januar 1739 waren Donau und Save zugefroren, sodass die kaiserlichen Truppen in türkisches Territorium vordringen konnten.
Die Schlacht um Belgrad 1717 zeigt, wie sich die Natur auf die frühneuzeitliche Kriegsführung auswirkte. Brücken über die Donau zu schlagen war immer wieder nötig, um Truppenteile zu verbinden oder in Feindesland vorzudringen. Solche Schiff- oder Pontonbrücken wurden aus Booten gefertigt, die aneinandergereiht und mit Planken versehen, für die Überquerung taugten. Sie zu zerstören, war ein wichtiges Ziel der jeweiligen Gegner.
Schiffmühlen lagen vielerorts am Ufer vertäut und eigneten sich als Waffe gegen Pontonbrücken. Am 22. Juni 1717 hatten die kaiserlichen Truppen oberhalb von Belgrad eine solche Brücke errichtet. Die Osmanen ließen drei brennende Schiffmühlen auf die Brücke zutreiben, doch konnten sie von den kaiserlichen Truppen abgefangen werden. Am 7. Juli versuchten es die Osmanen erneut. Gegen 10 Uhr abends ließen sie eine mit Balken verstärkte und mit Sprengstoff gefüllte Schiffmühle, an der außen mehrere Anker befestigt worden waren, gegen die Brücke treiben. Der Wind kam den kaiserlichen Truppen zu Hilfe: Ein plötzlicher Windstoß trieb das Schiff an Land, wo es unschädlich gemacht werden konnte. Doch manchmal funktionierte die Strategie: Die osmanischen Truppen schnitten wenige Tage später oberhalb Peterwardein liegende Schiffmühlen los. Diese trieben, von einem starken Wind beschleunigt, mit großer Gewalt gegen die kaiserliche Schiffbrücke, die dadurch schwer beschädigt wurde. (HAYNE, 1783: 261)
Hochwasser war immer gefährlich. Auf dem reißenden Strom konnten dann keine Schiffe verkehren; Nachschub zu organisieren wurde schwierig. Napoleon verlor im Mai 1809 in der Nähe von Wien die Schlacht von Aspern, unter anderem da Hochwasser das Brückenbauen für die Überquerung der Donau erschwerte. Doch auch das Gegenteil konnte kriegswichtig werden. Die Kapitulation der Feste Orsowa oberhalb des Eisernen Tores im Jahr 1783 wurde auf ein plötzlich einsetzendes Niedrigwasser zurückgeführt. Osmanische Truppen konnten über Sandbänke bis an die Festung gelangen. Zeitgenössische Zeitungen beklagten, dass nur zwei Tage nach der Eroberung das Wasser wieder anschwoll. Hätten die Belagerten nur ein wenig länger ausgehalten, so wäre die osmanische Armee ohne Chance gewesen.
War die Dynamik der Donau kriegsentscheidend? Diese Frage ist ex post schwer zu entscheiden, doch spricht vieles dafür, sie stärker als bisher in Erklärungen einzubeziehen. Durch die Quellen aus den Kriegen wird die Dynamik des Naturraums deutlich sichtbar, der als Grenze weit stabiler imaginiert wurde, als er war (HOHENSINNER et al, 2013).
Blick von der FESTUNG von Belgrad zur Donau. (Postkarte, um 1920)
Die Geschichte der Salpeternutzung
Kaliumnitrat – ein Salz der Salpetersäure – hatte schon die Alchemisten fasziniert. Das Salz kühlte die Zunge, wenn man es kostete – das war einzigartig. Da es beim Verbrennen verpuffte, lag der Verdacht nahe, dass es sich um die »quinta essentia« – die alchemistische Quintessenz – handeln könnte. Auch später verlor es seine Faszination nicht. Zwei der drei Hauptnährstoffe der Pflanzen sind im Kalisalpeter gebunden: Stickstoff und Kalium. Kalisalpeter war daher ein effektives, konzentriertes Düngemittel, doch gab es schon im 17. Jh. eine konkurrierende Anwendung. Vermischt mit gemahlener Holzkohle und Schwefel wurde er mittels Zündfunken zum explodierenden Schwarzpulver – jenem Stoff, den Chinesen für ihre Feuerwerke entwickelt hatten und der später in Europa mit der Einführung von Schusswaffen kriegswichtig werden würde.
In Europa war Kalisalpeter in geringen Mengen verfügbar. Er bildet sich durch die Zersetzung stickstoffhaltiger Tierexkremente besonders in kalkhaltigen Böden von Ställen; an Stallwänden blühten Kaliumnitratkristalle aus. Salpetersieder zogen von Dorf zu Dorf – bevollmächtigt durch die jeweiligen Landesherren –, um die Kalisalzkristalle von den Stallwänden zu kratzen und die Böden für die Gewinnung von Natriumnitrat rigoros herauszureißen und mitzunehmen. In ihren Hütten wuschen die Salpeterer die Böden aus und erhitzten die entstehende salzhaltige Lösung in Sudpfannen mit kaliumhaltiger Pflanzenasche. Beim Abkühlen kristallisierte als Erstes das Kaliumnitrat, das verkauft wurde. Die Landesherren erhielten ihren Anteil.
Der französische Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794) war an der Schaffung von effektiven Salpeterplantagen beteiligt, die die verfügbare Menge an Schießpulver Ende des 18. Jh. massiv vergrößerte. Die Plantagen waren überdachte, offene Plätze, auf denen Erde regelmäßig mit stickstoffhaltigen Substanzen wie Urin, Exkrementen vor allem von Rindern, aber auch mit städtischen Abfällen gemischt wurde. Bodenbakterien, die in Exkrementen vorhandenen Ammoniak zu Nitrat oxidieren können, taten im Lauf von ein bis zwei Jahren ihre Arbeit. Schlussendlich konnte die Erde ausgewaschen, die nitrathaltige Flüssigkeit aufgefangen und eingedampft werden. Allerdings erhielt man überwiegend Natriumnitrat, das sich nicht für Schießpulver eignet, da es schnell feucht wird. Also musste die gereinigte Lauge noch mit Pottasche (Kaliumcarbonat) versetzt werden, um einen Kaliumüberschuss zu erzeugen und Kaliumnitrat auszukristallisieren. Pottasche wurde aus Holz gewonnen und war bereits im 18. Jh. ein wichtiger protoindustrieller Massenrohstoff. Sie war auch für die Glasherstellung unverzichtbar.
Kaliumnitrat und Natriumnitrat
Mit dem Trivialnamen Salpeter (Felsensalz) werden seit Jahrhunderten Salze der Salpetersäure (HNO3) wie Kaliumnitrat und Natriumnitrat bezeichnet. Eigenschaften und Wirkungen von Kaliumnitrat (KNO3; Trivialname: Kalisalpeter) wurden vermutlich schon vor fast zwei Jahrtausenden in China entdeckt. Die Expansion der Mongolen machte Kalisalpeter im 13. Jh. in Vorderasien und in Europa bekannt. Abbaugebiete von Kalisalpeter befanden sich früher besonders in Indien und China. Die indischen Lagerstätten sind heute fast vollständig ausgebeutet. Das bei Weitem bedeutendste Vorkommen von Natriumnitrat (NaNO3; Trivialnamen: Natronsalpeter oder Chilesalpeter; als Gestein: Caliche) liegt in der nordchilenischen Atacama. Die Bildung des Natriumnitrats, die sich offenbar über Zeiträume von vielen Jahrhunderttausenden bis mehreren Millionen Jahren vollzog, ist nach wie vor nicht aufgeklärt. Sulfate, Chloride, Natrium, Kalzium, Magnesium und Kalium gelangten im Norden Chiles wahrscheinlich mit dem Oberflächen- und Grundwasser in etwas niederschlagsreicheren Zeiträumen des Pleistozäns von der Kordillere und dem Altiplano in die Atacama. Nach ERICKSEN (1983) reicherten sich in diesen feuchteren Phasen über Stickstofffixierung und Nitrifikation von Ammonium durch Blaualgen und Bakterien Nitrate in den abflusslosen intramontanen Senken der Kordillere und der Vorkordilleren an. Winde verlagerten diese mitsamt Schluffen und Sanden schließlich bis in die Atacama, wo die Salpetersalze allmählich in das oberflächennahe Lockergestein verlagert wurden. Die Oxidation von Ammonium im Spray der Küste wird als eine weitere, wohl weitaus weniger bedeutende Nitratquelle angeführt. Biogeochemische Zersetzungsprozesse von Vogelkot könnten in begrenztem Umfang zur Entstehung des Nitrats beigetragen haben. Die Caliche-Schicht ist in der Atacama bis zu 2 m mächtig.
Die Kalisalpeterproduktion hatte gravierenden Einfluss auf die landwirtschaftlichen und die Waldökosysteme: Nicht nur wurden dem Nährstoffkreislauf zwei Hauptnährstoffe, Stickstoff (aus Exkrementen) und Kalium (aus Holzasche) entzogen; die Herstellung brauchte viel Energie, die ebenfalls aus Holz kam. Es lag nahe, sich nach außereuropäischen Quellen für Salpeter umzusehen.
Zunächst kam Salpeter aus dem britischen Indien. Später wurde Südamerika zum Lieferanten. In der extrem trockenen nordchilenischen Atacama liegt östlich des Küstengebirges in einer etwa 700 km langen tektonischen Senke oberflächennah ein Schatz, der in den 1830er-Jahren geopolitisch bedeutend wurde: Natriumnitrat. Um ihn nutzen zu können, war die Entwicklung eines Verfahrens zur Umwandlung in Kaliumnitrat erforderlich. Diese Innovation gelang dem in Nordböhmen geborenen Mediziner, Geographen, Chemiker und Botaniker Thaddäus Xaverius Peregrinus Haencke (1761–1816), den mehrere Forschungsreisen in den Pazifischen Raum und nach Südamerika, darunter auch in die Atacama, geführt hatten. Haencke wurde zum Begründer der südamerikanischen Salpeterindustrie.
»Krupp-Kanonen u. Knorr-Suppen – auf die können wir uns verlassen«. Deutsche Feldpostkarte gelaufen am 2.8. 1916 (Ausschnitt). OHNE PULVER sind KANONEN unbrauchbar.
Das Natriumnitrat der Atacama wurde so wichtig, dass ein Krieg um die Lagerstätten ausbrach. Die Beschlagnahmung der von Chilenen geführten Salpeterwerke durch die bolivianische Regierung nach einem Steuerstreit 1879 war Anlass für den Salpeterkrieg zwischen Bolivien und Peru auf der einen und Chile (mit britischer Unterstützung) auf der anderen Seite. Durch den Friedensvertrag von 1884 wurde die Provinz Tarapacá mit großen Salpetervorkommen chilenisches Staatsgebiet und Bolivien ein Binnenstaat.
1890 exportierte Chile bereits 1 Million Tonnen Salpeter, 1905 waren es mehr als 1,5 Millionen Tonnen (BAUMANN, 2011: 40). Der Salpeterhandel brachte einigen Familien großen Wohlstand. So machte er den Unternehmer Henry Brarens Sloman vor dem Ersten Weltkrieg zu einem der wohlhabendsten Hamburger. Sloman ließ 1922 bis 1924 in Hamburg ein bemerkenswertes Kontorhaus errichten, dem er zur Erinnerung an seine Tätigkeit in der Atacama den Namen »Chilehaus« gab. Um 1900 wurde Chile-Salpeter in Deutschland zu etwa 80% als Dünger genutzt. Das verbleibende Fünftel verwendete die Industrie vor allem zur Herstellung von Explosivstoffen auf der Basis von Salpetersäure. Längere Kriege erforderten eine gute Planung der Munitionsversorgung und damit verlässliche Salpeterlieferungen aus Chile, das machte Krieg abhängig von Importen. Im frühen 20. Jh. befürchtete die Regierung des Deutschen Reichs eine baldige Erschöpfung des Chile-Salpeters. Jetzt schlug die Stunde einiger bekannter deutscher Chemiker. So forderte der Leipziger Professor Wilhelm Ostwald 1903, unverzüglich Salpetersäure aus dem Ammoniak einheimischer Steinkohle zu gewinnen, um Salpeter für Munition herstellen und eine für möglich gehaltene Blockade umgehen zu können. (BAUMANN, 2011: 13f., 40)
Die Chemiker und späteren Nobelpreisträger Carl Bosch (1874–1940) und Fritz Haber (1868–1934) entwickelten ein Verfahren zur synthetischen Herstellung von Stickstoffdünger aus dem chemisch äußerst trägen, aber in großer Menge vorhandenen Luftstickstoff, das 1910 durch die Badische Anilin-&Soda-Fabrik (BASF) zum Patent angemeldet wurde. Mit dem Aufbau einer synthetischen Produktion verlor der Natursalpeter rasch an Bedeutung. Abbau und Verarbeitung in der Atacama wurden aufgegeben. Heute zeugen eindrucksvolle rostende Anlagen und Geisterstädte von dem Boom, den der Bedarf nach Kriegsmaterial ausgelöst hatte. Bis heute sind organische Stickstoffverbindungen Bestandteil vieler Sprengstoffe. Der Stickstoff dafür kommt allerdings aus der Luft.
Vorschlag zu einer Salpeteranlage
»[...] Zuerst soll man eine reine Erde nehmen, […]. Von dieser Erde wird gegen Michaelis in einem Schaafstall, [...], ein Salpeterbeet auf 2 Schuhe hoch zubereitet, auf dieses läßt man den Winter über die Schafe hinein pfärchen. Dieses geschieht darum, weil der Schaaf- und Ziegenurin den meisten Salpeter mit sich führt, und hiedurch also der Salpeterstoff mit der Salpeterblurne [sic!] geschwängert wird, welches ein großer Vortheil ist, und weil dieser Urin auf keine andere Art zu bekommen, so ist diese Weise die beste, sich denselben zu verschaffen. – Gehen sodann die Schaafe im Frühjahr aus dem Stall, so läßt man die Oberfläche, worinn die Düngung sich befindet, ganz sauber von der Salpetererde ab, und läßt sie zur Düngung auf die Aekker führen. Aus der zurückgebliebenen Erde wird ein ordentliches Beet formirt; [...] Gleichwie nun dieses Geschäft blos darauf beruht, daß oben beschriebene Erde mit einer Flüssigkeit gesättigt werde, die eine salpetrige Eigenschaft habe, und den Salpeter aus der Luft anziehe, so konnte ich aus dem Naturreich auf kein besseres Mittel denken, als auf den schon von Glauber sogenannten Holzessig, wenn solcher mit thierischem Urin vereinigt zur Befeuchtung der Erde gebraucht wird. Der Holzessig wird durch den Ofen A bereitet und mit Urin von Pferden und Kühen vereinigt, sodann das Salpeterbeet Morgens und Abends aus der Vorlage begossen, aber jedesmal nicht mehr, als das Salpeterbeet einzuschlukken vermag, daß oben keine Nässe bleibt. […] Ist nun die 3 bis 4 Monat während Fäulniß vorbei, so schreitet man zur Anblümung, worinn es wieder 3 Monate stehen muß; da man hernach den Salpeterstoff in Pyramiden aufthürme, und sodann alle Schaltern aufmacht, damit die Luft desto besser sich eindränge, nur muß man die Mittagsseite wohl verwahren, weil diese Luft allzu räuberisch ist. Ist nun die Erde wohl gefault, so wird man auch eine reiche Ausbeute finden, da die Haufen oder Pyramiden alle Morgen wie überschneiet aussehen werden. Nun folgt die Auslaugung, Versiedung und Kristallisirung, wozu nothwendig Holzasche oder Alkali erfordert wird. [...] P. – o –« (ELWERT, 1786: 202–206).
Nationalsozialismus und Natur
Hunger. Durst. Kälte. Hitze. Krankheiten. Ungeziefer. Appelle, bei denen stundenlanges Stillstehen ohne Möglichkeit, die Notdurft zu verrichten, Teil der täglichen Qual war. Hunde. Peitschen. Schwerstarbeit. Schlafentzug. Medizinische Experimente. Dazu der blaue Himmel oder der Regen, der Schnee, Vogelgezwitscher, Regenwürmer, Löwenzahn. In den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten spielte die Natur eine wichtige Rolle. Die menschliche Natur war das Ziel von Folter und Qual, Natur wurde als Folterinstrument eingesetzt. Medizinische Versuche waren ein logischer Teil des nationalsozialistischen Programms der umfassenden Kontrolle über die »Volksgemeinschaft«, deren »arische Reinheit« angeblich jede Gewalt rechtfertigte.
Der industriell organisierte Massenmord wurde nach umfänglichen Versuchen auf Basis moderner Technik bewerkstelligt. Zunächst hatte man Lastwagen zu Mordinstrumenten umgerüstet; die Einleitung von Abgasen in die abgedichteten Wagenkästen führte zur Kohlenmonoxidvergiftung. Die Gaskammern im Lastwagen funktionierte zwar, doch wurde die Tötung technisch weiter entwickelt. Für die Gaskammern der Vernichtungslager wurde Blausäure (HCN) verwendet, die unter dem Namen Zyklon B für die Schädlingsbekämpfung vertrieben wurde. Die erste Massenvergasung von Menschen in Auschwitz-Birkenau fand Ende 1941 statt. Bis Ende November 1944 (zu diesem Zeitpunkt ließ Himmler die Gaskammern von Auschwitz sprengen) perfektionierten die Nationalsozialisten den so möglichen Massenmord, der Munition sparte und das Morden effizienter machte. Die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, in dem sich Giftgas als wirksames Kriegsmittel erwiesen hatte, lieferten die Idee. Neben Juden traf es unter anderem auch die »Zigeuner« genannten Roma und Sinti, Homosexuelle, Kommunisten und Zeugen Jehovas. Die Leichen wurden in eigens gebauten Krematorien verbrannt. So gelang die fast vollständige Vernichtung der Getöteten. Die Tausenden von Menschen, die an jedem einzelnen Tag vergast und verbrannt wurden, sind in der Menschheitsgeschichte ein zutiefst erschütternder Sonderfall. Sie sind aber nicht unerklärbar, sondern passen zur inneren Logik des Nationalsozialismus. Dessen Konzeption von Natur und ihre Nutzung zur Legitimierung von Gewalt spielt eine wichtige Rolle dabei.
Die »nordische Rasse« angeblicher »Übermenschen« von »Verunreinigungen« zu befreien, bedurfte nicht nur der Tötung von Menschen, die von den Nationalsozialisten als unwert erachtet wurden, sondern auch der Kontrolle über die Fortpflanzung. 400.000 Personen (etwa zur Hälfte Männer und Frauen) wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft zwangssterilisiert, nur 10 bis 30% der Frauen wurden als fortpflanzungswürdig erachtet, ebenso viele galten als fortpflanzungsunwürdig (BOCK, 1993).
Die ideologische Basis der unfassbaren Gewalttaten war ein mystisches, heidnisches Weltbild (als »Weltanschauung« bezeichnet), in dem Wälder eine wichtige Rolle spielten. Sie wurden als »Naturdome« zum Gegenmodell christlicher Kirchen. Insbesondere Linden und Eichen wurden zu urgermanischen Bäumen stilisiert. Der Weihnachtsbaum bewies, dass das Weihnachtsfest als »Schöpfung unserer arteigenen nordischen Weltanschauung« zu gelten habe, wie die NSDAP-Reichsleitung 1938 in einer Broschüre verkünden ließ. Die Deutschen sollten als angebliche Nachfahren der Germanen als genuines Waldvolk gedacht werden, als tief im Wald verwurzelt und in Kultur und Religion vom Wald geprägt. Mit der Machtübernahme wurden diese Versatzstücke einer Pseudo-Naturreligion zur Grundlage staatlicher Politik (ZECHNER, 2010).
Die auf Zuschreibungen an Natur aufgebaute rassistische Fundierung der nationalsozialistischen Ideologie ist besonders augenfällig in ihrer Nutzung des modernsten Mediums, das damals verfügbar war, des Films. 1936 kam »Ewiger Wald« in die Kinos. Der Film beruhte auf der in den 1920er-Jahren formulierten Ideologie von »Blut und Boden«, die davon ausging, dass das »reine« Blut deutscher Bauern, insbesondere, wenn sie auf »ihnen gemäßer Scholle« saßen, für die wirtschaftliche wie »rassische Gesundheit« der Volkswirtschaft verantwortlich sei. Die Wurzeln einer waldbasierten Ideologie – die als Gegenentwurf zu den Prinzipien der Französischen Revolution auf Ungleichheit und Unveränderlichkeit abzielte – sind im deutschsprachigen Diskurs des 19. Jh. zu verorten. Der Wald wurde von den Nationalsozialisten als »Erzieher« betrachtet, er war Teil des Entwurfs eines idealen Staates, in dem die »germanische Waldnatur« dem »Wüstenvolk« der Juden entgegengestellt wurde. Der Wald wurde damit antisemitisch aufgeladen (ZECHNER, 2006).
Nach fast zehn Minuten einer Eingangssequenz aus Bildern mit Musik erscheint im Film »Ewiger Wald« ein Text, der sich direkt an die Betrachter richtet: »Euch, die ihr kamt, im Bilde das Gleichnis zu schauen / Das die Natur euch lehrt im ›Stirb‹ und ›Werde‹ / Volk, dir, das sucht, kämpft und ringt, das unvergängliche Reich zu bauen / Ist dieses Lied gewidmet.« Danach erfolgt die Gleichsetzung, von der der Film handelt: »Ewiger Wald, ewiges Volk«. Der Film erzählt völlig ahistorisch die mystisch aufgeladene Geschichte des imaginierten »germanischen Volkes« seit prähistorischer Zeit als eine Geschichte der Gewalt und der Wiedergeburt des Volkes – nicht des Individuums. Der Film hat eindeutig anti-christliche Tendenzen. Die Natur des Waldes soll sich dem Christentum gegenüber als ideologischer Halt bewähren. Die Wikinger werden wegen ihrer Holzschiffe als Waldmenschen in die germanische Ahnenschar integriert. Mittelalterliche Szenen stellen bäuerliche Waldschützer gegen profitgierige Grundherren. Der Film kulminiert in der Geburt des »Dritten Reichs« aus der Schmach des Ersten Weltkriegs, die von romantischen Szenen eingeläutet wird.
Die Förster der 1930er-Jahre hatten das Managementkonzept des »Dauerwaldes« entwickelt. Es beruhte auf dem Fällen einzelner schwacher oder kranker Bäume und nicht auf Kahlschlägen – in dem Glauben, dass damit die stärksten, besten Bäume übrig blieben und eine dauerhafte Verbesserung der Waldsubstanz erreicht werden könnte. Der Film fordert dazu auf, die kranken und »artfremden« Elemente aus dem Wald zu entfernen, um eine neue, auf den Prinzipien des ewigen Waldes beruhende Gesellschaft zu errichten. Eine Maibaumszene beschließt den Film, der auf der Herstellung einer Analogie von Natur und Gesellschaft beruht und diese in einer eindringlichen Bildsprache transportiert (LEE & WILKE, 2005).
Der zu gründende rassistische nationalsozialistische Staat wollte eine Lebensführung garantieren, die auf einem »Recht der Natur« beruht. Die »nordischen« Menschen seien »von Natur aus« die »Herrenrasse« und damit im »Kampf ums Dasein« mittels des Rechts des Stärkeren legitimiert, Kriege zu führen, qua Naturgesetz zu siegen (SCHMITT, 2010). Es ist legitim, den Nationalsozialismus als mystische Pseudo-Naturreligion aufzufassen, auch wenn die Nationalsozialisten keinen offenen Kampf gegen die christlichen Kirchen führten (POIS, 1986). Adolf Hitler glaubte an strenge Naturgesetze und an deren Anwendung auf Menschen. Natur und ihr imaginiertes Gegenteil, die »Widernatürlichkeit« wurden zu zentralen Legitimierungsfiguren des Regimes. Auf diesen Prämissen beruhte auch die anti-urbane Einstellung, Städte mit ihrer Durchmischung wurden als »Rassengrab« wahrgenommen (SIEFERLE, 1992). Letztlich, in der konsequenten Anwendung eines wahnsinnigen Rassismus, sollten »Naturgesetze« die Vernichtung der Juden ebenso wie die von Homosexuellen, Sinti und Roma rechtfertigen.
Die Zuschreibung gesellschaftlicher Phänomene (von Tischsitten bis zu Sexualpraktiken, von Berufen bis zu Ernährungsgewohnheiten) zu »Natur« oder »Kultur« ist ein politischer Akt. Natürlichkeit – die immer kulturell definiert wird und sich keineswegs aus der Natur ergibt – wird zur Legitimierung gesellschaftlich gewünschter Zustände benutzt. Diese Nutzung hat eine lange Tradition. Sie lässt sich bis in die antike Philosophie zurückverfolgen und findet sich in der Diskussion um das Naturrecht auch in der christlichen Theologie und bei Denkern wie Thomas von Aquin, der alle menschlichen Gesetze nur insoweit als legitimes Recht ansah, als sie dem Naturrecht nicht widersprechen. Für einige mittelalterliche Theologen waren die Ordnungen des Naturrechts dem Menschen eingeschrieben, er musste seine inhärente Neigung zum naturgemäß Richtigen allerdings über den Gebrauch der Vernunft pflegen. Die nationalsozialistische Diktatur berief sich – wie andere totalitäre Regime auch – auf die Natur, um Krieg, Gewalt und Massenmord zu legitimieren. Sie nutzte dabei eine sehr konkurrenzorientierte Lesart der modernen biologischen Theorie des Darwinismus als Argumentationsgrundlage.
Ein WERBEPLAKAT für den Film »Ewiger Wald« von 1936.
Natur taugt nicht zur Blaupause für Gesellschaft. Was immer wir in ihr sehen, haben wir selbst zuvor hineingedacht. Schutz der Natur und legitimatorische Bezüge zwischen Natur und Gesellschaft sind zwei verschiedene Aspekte, deren Vermischung Ideologie ergibt, eine Ideologie, die – in konsequenter Wahnhaftigkeit – bis zum Versuch der Legitimierung von Massenmord gehen kann, wie – hoffentlich einmalig in der Geschichte – die Handlungen der Nationalsozialisten eindringlich zeigen.
In der Volksrepublik China
Ein totalitäres System hat, wie sein Name sagt, die totale Kontrolle des Staates zum Ziel. Kontrolliert werden sollen dabei nicht nur Körper und Geist der Menschen, sondern immer auch die Natur. Das kommunistische China tat sich bei diesem Versuch ganz besonders hervor – mit dramatischen Effekten auf Bevölkerung und Natur. Massenkampagnen prägten das erste Jahrzehnt des jungen Staates. Von 1950 bis 1952 wurden Grundbesitzer, die ihr Land verpachtet hatten, enteignet. Viele wurden in Schauprozessen angeklagt und zumeist zum Tode verurteilt. Wohl weit mehr als 1 Million Menschen wurden hingerichtet. Kampagnen gegen sogenannte Konterrevolutionäre, gegen Korruption, Verschwendung und Bürokratie, gegen Bestechung und Steuerhinterziehung, gegen Veruntreuung von Staatseigentum und gegen Verrat von Staatsgeheimnissen folgten. Die Umerziehung der Intellektuellen hatte eine »Gedankenreform« zum Ziel. (BECKER, 1996; YANG, 1996)
Allen Kampagnen zum Trotz war die Landwirtschaft der Volksrepublik 1957 rückständig, die Erträge gering und die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln in vielen Regionen unzureichend. Gravierende, von Mao Zedong ausgelöste Verstimmungen in den Beziehungen Chinas zur Sowjetunion führten zum Rückzug sowjetischer Experten und zum Ausbleiben sowjetischer Lieferungen. Dadurch blieb China hinter den hochgesteckten Zielen des Fünfjahresplans zum Industrieaufbau zurück.
In dieser ökonomisch wie politisch überaus angespannten Situation propagierte die Führung der Kommunistischen Partei (KP) Chinas 1958 den »Großen Sprung nach vorn«. In den ländlichen Räumen wurden Volkskommunen etabliert, denen die lokale Landwirtschaft, sämtliche Handwerks- und Industriebetriebe, meist neu gebaute Zentralküchen und -kantinen mit Propagandabeschallung sowie Einrichtungen des Erziehungs- und Gesundheitswesens zugeordnet wurden. Das Leben auf dem Land änderte sich binnen weniger Wochen radikal. Millionen Bauern hatten nunmehr in den Bereichen Handwerk oder Industrie der Volkskommunen zu arbeiten; Bäuerinnen mussten die Feldarbeit übernehmen – der Staat »entlastete« sie, in dem er die Verpflegung der Familien der Kommunarden und die Erziehung der Kinder übernahm. Großen Wert wurde auf die politische Bildung im Sinne der KP gelegt; eine Alphabetisierungskampagne lief an. (YANG, 1996; SHAPIRO, 2001)
Das Programm zur Kontrolle der Natur war eines der industriellen Modernisierung. Zur Erhöhung der Agrarproduktion sollten riesige Flächen bewässert und mineralisch gedüngt werden. Die Umgestaltung von Landschaften mit Baggern, Spaten und Schaufel begann, um größere, besser zugängliche, mit Maschinen zu bewirtschaftende und bewässerbare Äcker zu schaffen. Der einsetzende Kampf gegen »Nahrungskonkurrenten« des Menschen hatte die Vernichtung der Spatzen und einiger anderer Vogelarten zum Ziel. Tatsächlich wurden jedoch in einigen Regionen sämtliche Vogelarten fast ausgerottet. Dadurch schwollen die Insektenpopulationen gewaltig an. Im April 1960 musste die Partei diesen Teil der Kampagne beenden: Vögel wurden nunmehr gezüchtet, um der selbst erzeugten Insektenplage Herr zu werden. Weitere neue Züchtungen sollten die Pflanzen- und die Tierproduktion entscheidend steigern. Vielen Verantwortlichen fehlten jedoch Grundkenntnisse in Biologie, Ökologie, Bodenkunde und Agrarwissenschaften. Daher waren viele Maßnahmen unsinnig und schlugen fehl. Kulturpflanzen sollten um ein Vielfaches dichter als üblich gepflanzt und Schweine gezüchtet werden, die vor dem Erreichen der Geschlechtsreife Ferkel werfen sollten. (BECKER, 1996; SHAPIRO, 2001)
Der gleichzeitige Ausbau von Klein- und Großindustrien führte zu einem großen Energiebedarf. Riesige Flächen wurden abgeholzt, unter anderem um Millionen ineffektiver Hinterhofschmelzöfen zu betreiben; meist wurde dort nur minderwertiges Eisen produziert. Selbst die großen Stahlkombinate erreichten häufig nicht die notwendige Effektivität. Die Tücken der Planwirtschaft führten zu weiterer Ressourcenverschwendung, so wurden zum Beispiel Tausende Großpflüge produziert. Sie erwiesen sich im Alltagseinsatz als ungeeignet und mussten wieder eingeschmolzen werden.
Die Führung der KP hatte die Landbewohner zu einem Großexperiment mit ungewissem Ausgang zwangsverpflichtet, in dem die meisten Akteure praktisch keine Korrekturmöglichkeiten hatten. Widerstand führte direkt in Zwangslager oder Gefängnis.
HINTERHOF-SCHMELZÖFEN, die während der Massenkampagne des »Großen Sprungs nach Vorne« errichtet wurden.
Im Jahr 1958 im Rahmen der Massenkampagne des »Großen Sprungs nach Vorne« im nordchinesischen Lößplateau bei Yan’an errichteter ERDDAMM GUZHANGZI, dessen Reservoir schon 1962 mit Bodensediment verfüllt worden war, das Starkniederschläge auf den steilen Hängen seines Einzugsgebietes erodiert hatten.
Nach dem in einigen zentral- und südchinesischen Regionen über Jahrtausende bodenschonend erfolgreich Nahrungsmittel produziert worden waren (vgl. S. 34), herrschte nunmehr blankes Chaos. Massive Abholzungen, unangepasste Landbautechniken, unsinnige Maßnahmen und vor allem die unzureichenden Bemühungen um den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit ermöglichten während heftiger Niederschläge starke Abflussbildung und eine gravierende Bodenzerstörung durch Erosion. In einigen Gebieten erhöhten sich die Bodenerosionsraten um mehr als das Hundertfache (DAHLKE & BORK, 2004, 2006). Sie konnten zum Teil bis heute nicht entscheidend reduziert werden – und dies in einer Gesellschaft, die den Böden eigene Altäre gewidmet und Opfer gebracht hatte (WINIWARTER & BLUM, 2006).
Obgleich die hier nur zusammenfassend genannten Fehlschläge den politischen Entscheidungsträgern Angst einflößen hätten müssen, geschah das Gegenteil. Da die Maßnahmen von dem für viele Landbewohner (fast) gottgleichen Mao Zedong verordnet oder zumindest maßgeblich unterstützt worden waren, unterblieb Kritik. Parteimitglieder und Journalisten ergingen sich in Lobgesängen. Staatliche Presseorgane verkündeten schon im Herbst 1958, dass der »Große Sprung nach vorn« zu einer Erhöhung der Ernten um mehrere Tausend Prozent geführt haben sollte – die Ernte nach altem Muster war zum Zeitpunkt der Etablierung der Maßnahmen oft schon eingefahren. Die verführten Landbewohner glaubten der Propaganda; doch waren Nahrungsmittel noch rationiert. Diese Rationierung musste gelockert werden, um den Erfolg zu dokumentieren. Qing-shi, der Führer der KP Shanghais, propagierte, dass die Menschen so viel essen sollten, wie ihr Magen fassen konnte. Anfang 1959 waren bereits einige Speicher leer und die größte Hungersnot der Menschheitsgeschichte nahm ihren Lauf. An ihrem Ende waren Millionen Tote zu beklagen. (BECKER, 1996; SHAPIRO, 2001)
Zwar wurden die Entscheidungen der Massenkampagne des »Großen Sprung nach vorn« durchaus mit dieser Katastrophe in Verbindung gebracht. Als wesentlicher Verursacher der Hungersnot wurde jedoch schlechtes Wetter ausgemacht. Kann in einem Land, das 90% der Ausdehnung Europas und unterschiedliche Klima- und Agrarzonen umfasst, eine derartige Hungersnot durch ungünstige Witterung ausgelöst werden? Wohl kaum. Auch die Wetterdaten weisen keine ausgedehnte extreme Trockenheit in den Hungerjahren 1959, 1960 und 1961 aus.
Der »Große Sprung in den Hunger« mit vielleicht 30 oder gar 40 Millionen Toten ist das Resultat eines fehlgeschlagenen gesellschaftlichen Experimentes. Unmittelbar und alleine verantwortlich ist die damalige Führung der KP der Volksrepublik China.
Lokales Expertenwissen zu ignorieren und partizipative Entscheidungsfindung unmöglich zu machen, kann zu Katastrophen führen. Eine breite und konsensuale Nutzung dieses Wissens kann sie verhindern. Totalitäre Regime wie jenes der KP der chinesischen Volksrepublik mit ihrem Anspruch umfassender Kontrolle scheitern früher oder später an ihrem Krieg gegen die Natur – auch deswegen, weil sie differenziertes Wissen zugunsten von Propaganda igno rieren.
Chinesische Propaganda
Propagandaplakate an Hauswänden beschwören den Sieg über die Natur:
»Nicht vom Himmel abhängig«
»Von Dazhai* lernen, Berge zu versetzen«
»Berge versetzen, um Felder zu schaffen«
»Die Köpfe der Berge beugen und den Flüssen Raum schaffen«
»Blüten und Früchte duften im alten Bett des Gelben Flusses«
»Wolken und Regen erzeugen und reiche Ernte erkämpfen«
»Mit vollem Einsatz Küchenwasser sammeln und die Schweinezucht unterstützen«
»Dünger sammeln«
»Alle machen sich an die Arbeit, um gegen die vier Plagen zu kämpfen«
»Alle kommen, um gegen Spatzen zu kämpfen«
»Großer Kampf gegen krumme Täler und Flüsse«
»Hohe Berge werden zu Kornkammern«
*Dazhai war eine Vorzeigevolkskommune
(LANDSBERGER, 1996)
Die Natur als Gegner
Kurz vor Ende des chemischen Luftkriegs in Vietnam fasste 1971 ein Leitfaden für die Truppen zusammen, was sich das Militärkommando der USA vom taktischen Einsatz von Herbiziden (Unkrautvernichtungsmitteln) versprach. Diese Chemikalien sollten die Sicherheit der USTruppen steigern, indem sie Hinterhalte ermöglichende Vegetation beseitigen und freie Flächen schaffen würden, die gut zu verteidigen seien. Sie würden damit die militärische Aufklärung und auch die Herstellung besserer Karten erleichtern. Da nach ihrem Einsatz Verstecke des Feindes sichtbar würden, verminderten sie den feindlichen Widerstand. Sie sparten Personal, das sonst mit der mechanischen Schaffung von Wegen beschäftigt wäre, erhöhten die Kampfstärke der Truppe und erleichterten die Logistik, da Nachschub leichter herangeschafft werden könnte. (OATSVALL, 2008)
Von Januar 1962 bis Februar 1971 hatten Flugzeugbesatzungen der US-Streitkräfte im Rahmen eines »technischen Hilfseinsatzes« für die südvietnamesische Regierung über 10% der Oberfläche des damaligen Südvietnam mit etwa 72 Millionen Liter verschiedener Herbizide besprüht (STELLMAN et al., 2003). Die Regierung der USA klassifizierte ihre Flüge als technische Hilfsmission und achtete darauf, dass immer südvietnamesische Soldaten an Bord waren. Die Entscheidungen trafen aber amerikanische Militärs. Nach Ansicht der amerikanischen Regierung handelte es sich nicht um die geächtete »chemische Kriegsführung«, da die Herbizide nicht gegen Menschen, sondern »nur« gegen die Laubdeckung der Tropenwälder gerichtetseien (MEYERS, 1979). Neben der Entlaubung der Wälder sollte die Vernichtung von Kulturpflanzen die Nahrungsbasis der nordvietnamesischen Guerilla, der Vietcong, zerstören. Menschen waren – diplomatisch spitzfindig – »nur« indirektes Ziel.
Die nach der Farbe der Identifizierungsstreifen auf den Fässern benannten Herbizidmischungen »Agent Orange« (eine Mischung der n-Butyl-Ester der 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure [2,4,5-T] und 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure [2,4-D]), »Agent White«, »Agent Green« »Agent Purple«, »Agent Pink« und »Agent Blue« waren mit Dioxin (2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin) verunreinigt. Dioxin ist eines der langlebigsten Umweltgifte. Die Halbwertszeit des giftigsten Dioxins (2,3,7,8 TCDD) beträgt im Körperfett des Menschen etwa sieben Jahre. Es ist 500-mal giftiger als Strychnin oder das Pfeilgift Curare und schon in winzigen Mengen gefährlich. Als »Sevesogift« erlangte es durch einen Unfall in der zum »Hoffmann-La Roche«-Konzern gehörenden chemischen Fabrik von Meda (Norditalien), bei dem am 10. Juli 1976 einige Kilogramm Dioxin in die Umgebung gelangten, traurige Berühmtheit.
Fische im Mekong waren nach der Agent-Orange-Vergiftung mit Dioxin belastet. Traditioneller FISCHFANG. (Postkarte, datiert 17.7.1953)
MANN DER CHO-MA auf der Suche nach Honig im Süden von Vietnam. Die tropischen Wälder wurden vielfältig genutzt. Ihre Zerstörung nahm den Menschen die Lebensgrundlage. (Postkarte, 1923/24)
Der Dioxingehalt der in Vietnam eingesetzten Herbizide schwankte. Ehe das weniger stark mit Dioxin belastete Agent Orange, das mit 60% der Gesamtmenge den Hauptanteil der verwendeten Herbizide stellte, zum Standard wurde, bewirkten die von 1961 bis 1965 verwendeten, hoch verunreinigten »Agent Purple«- und »Agent Pink«-Mischungen eine hohe Freisetzung von Dioxin in die Naturkreisläufe Vietnams, in denen sich das fettlösliche Gift in der Nahrungskette bis heute anreichert. Schätzungen, mit wie viel Dioxin die Umwelt Vietnams insgesamt verseucht wurde, gehen auseinander. Eine in der angesehenen Zeitschrift »Nature« publizierte Arbeit geht von bis zu 366 Kilogramm aus – einer enormen Menge eines so wirksamen Gifts (STELLMAN et al., 2003).
Diese Chemikalien wurden euphemistisch als »Entlaubungsmittel« bezeichnet, weil binnen weniger Wochen die Blätter der behandelten Pflanzen abfallen. Mangrovenwälder werden bereits bei einmaliger Anwendung so stark geschädigt, dass sie absterben. Bei mehrfacher Anwendung sterben auch andere Wälder; viele Gebiete wurden mehrfach überflogen und besprüht.
James W. Gibson beschrieb 1986 den Vietnamkrieg als einen »Technokrieg«. Die USA gingen davon aus, dass ihnen ihre technische Überlegenheit gegenüber den scheinbar »primitiven« Vietkong zum Sieg verhelfen würde. Wo immer möglich, substituierten sie Soldaten durch Gerät. Um den technisch weniger avancierten Feind zu treffen, der die Landschaft militärisch zu seinen Gunsten nutzte, von ihren Produkten aber auch mehr abhängig war, wurde die Natur bekämpft. Die Herbizide sollten bei Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen für Menschen und Tiere ungefährlich sein, es handelte sich ja um ursprünglich landwirtschaftlich verwendete Mittel. Die in Vietnam verwendete Konzentration an Herbiziden betrug etwa das 10-Fache der in der Landwirtschaft empfohlenen Menge. Trotzdem machte der Einsatz von Chemikalien, die für den zivilen Gebrauch zugelassen waren, den Krieg scheinbar »sauberer« und damit politisch leichter durchsetzbar. Gegenüber der Öffentlichkeit betonten die USA, dass kein »chemischer Kampfstoff« eingesetzt werde, weil nur Pflanzen das Ziel waren. Doch wurde auch durch wissenschaftliche Arbeiten Anfang der 1970er-Jahre der öffentliche Druck in den USA so groß, dass die Vergiftungsflüge 1971 eingestellt wurden. (WESTING, 1971; BUI, 2003; OATSVALL, 2008)
Da war Vietnam aber bereits langfristig geschädigt. Die unter dem Codenamen »Ranch Hand« (»Landarbeiter«) laufende Aktion sollte nordvietnamesische Kommunisten treffen – Opfer wurden zu einem Gutteil südvietnamesische Zivilisten. Das schnell wachsende Bambusdickicht, das in den zerstörten Wäldern aufwuchs, machte die Landschaft für die dort lebenden Menschen wertlos. Die für das Mekong-Delta wichtigen Mangrovenwälder starben, Erosion war die Folge. Diese veränderte die Fischfauna. Damit ging die Fischerei ebenso zugrunde wie die Landwirtschaft.
Der militärische Eingriff in die Ökosysteme Vietnams war beabsichtigt, die Kontamination weiter Teile des Landes und die chronische Vergiftung vieler Menschen mit Dioxin war eine ungeplante Nebenwirkung. Viele Untersuchungen, etwa der Muttermilch vietnamesischer Frauen, zeigten in den Jahren nach dem Krieg hohe Belastungen. Ein Zusammenhang zwischen der hohen Rate an missgebildeten Kindern in Vietnam und der Dioxinverseuchung ihrer Eltern ist höchst wahrscheinlich und gilt als weitgehend gesichert. Die schleichende humanitäre Katastrophe vollzieht sich jenseits medialer Aufmerksamkeit.
Bei der Beladung der Flugzeuge und Helikopter kam es immer wieder zu Unfällen. Herbizide gelangten dadurch lokal auch konzentriert in den Boden. Eine der größten Havarien passierte auf dem Luftwaffenstützpunkt Bien Hoa nahe Saigon; allein am 1. März 1970 wurden dort mehr als 28.000 Liter »Agent Orange« verschüttet. Böden und Lebewesen an (ehemaligen) Luftwaffenstützpunkten enthalten daher lokal bis heute sehr viel Dioxin (DWERNYCHUK, 2005; DWERNYCHUK et al., 2006). Die USA haben ihre Schuld an der Umweltkatastrophe bislang nicht eingestanden, es gibt weder Entschädigungszahlungen noch eine Dekontamination besonders belasteter Standorte (QUICK, 2008).
Politische Hintergründe
Die politische Geschichte von Agent Orange beginnt mit dem Indochinakrieg (1946–1954). Frankreich kämpfte gegen eine kommunistische Unabhängigkeitsbewegung um die Wiedererlangung seiner Kolonie Französisch-Indochina (heute: Vietnam, Kambodscha, Laos), die im Zweiten Weltkrieg von Japan besetzt worden war. Seit 1950 halfen die USA, zu deren antikommunistischer Politik die Niederschlagung einer solchen Bewegung gut passte, den ehemaligen Kolonialherren. Die Viêt-Minh-Kämpfer hingegen erhielten Unterstützung aus dem inzwischen unter kommunistischer Führung stehenden China. Im Frühling 1954 erlitt die französische Armee eine vernichtende Niederlage. Auf der daraufhin einberufenen Konferenz in Genf wurden am 21. Juli 1954 die drei Staaten als unabhängig anerkannt, Vietnam aber entlang des 17. Breitengrades geteilt, um eine Beruhigung zu bewirken. Der Nordteil (später Nordvietnam) stand unter Führung des Kommunisten Ho Chi Minh, der Südteil (später Südvietnam) wurde von Präsident Ngô Đình Diệm regiert, einem von den USA unterstützten, autoritär regierenden Antikommunisten, der 1963 bei einem Putsch getötet wurde. Die Teilung sollte nur vorübergehend sein. Für 1956 waren gemeinsame Wahlen vorgesehen, die aber nie stattfanden. Stattdessen kam es zum Vietnamkrieg. Seit 1955 gab es kriegerische Auseinandersetzungen zwischen kommunistischen Vietkong-Kämpfern und der südvietnamesischen Regierung, in die ab 1965 immer mehr US-Bodentruppen involviert waren. Am Höhepunkt des Kriegs kämpften Ende 1968 mehr als eine halbe Million amerikanische Soldaten in Vietnam. Am 15. August 1973 endete das militärische Engagement der USA; 1976 wurden Norden und Süden als sozialistischer Staat vereinigt, die Odyssee der Flüchtlinge (boat people) aus dem Süden begann. Die USA hatten ihr Ziel, die Niederschlagung der kommunistischen Bewegung, nicht erreicht.
Erst nach jahrelangen Rechtstreitigkeiten wurden Veteranen im Jahr 2006 finanziell dürftig abgefunden – obwohl die amerikanische Umweltschutzagentur bereits im Jahr 2000 in einem Bericht festhielt, dass Dioxine beim Menschen krebserregend sind, das Immunsystem und den Hormonhaushalt schädigen, Effekte auf Reproduktion, Embryonalentwicklung und Nervensystem haben, den Fettstoffwechsel verändern, die Leber schädigen und die berüchtigte Chlorakne verursachen.
Krieg war und ist umweltschädlich. Wie weit dieser Umweltschaden gehen kann, wenn eine demokratisch legitimierte Regierung in bedenkenloser Technikgläubigkeit versucht, Soldaten durch Chemikalien zu ersetzen, zeigt die Geschichte der langfristigen Dioxinverseuchung Vietnams. (OATSVALL, 2008)
Umweltschutz als Reaktion auf den amerikanischen Imperialismus
Neapel, Winter 1943: Die Amerikaner hatten die Stadt erobert und die deutsche Wehrmacht vertrieben. Von Läusen übertragenes Fleckfieber (Erreger: Rickettsia prowazeki) brach unter der Zivilbevölkerung aus. In und um Neapel erkrankten schließlich etwa 2000 Menschen; die Mortalität lag bei ungefähr 20%. Im Vergleich zu den ebenfalls im Jahr 1943 gemeldeten 27 340 Erkrankten in Französisch-Nordafrika war dies eine geringe Fallzahl, obwohl die Bedingungen in Neapel für Lausbefall und Übertragung durch seltenen Kleiderwechsel, überfüllte Quartiere und mangelnde Hygienemöglichkeiten günstig waren. Wie war die Eindämmung gelungen? Das Militärkommando der Alliierten hatte sich mit der Bitte an die »International Health Division« der amerikanischen Rockefeller-Stiftung gewandt, für die Entlausung der Bevölkerung zu sorgen. Mit dem recht neuen »Wundermittel« DDT konnten die Amerikaner die Epidemie stoppen.
Postkarte der ANTI-ATOMKRAFTBEWEGUNG von 1980.
Japan, August 1945: Das US-Militär warf zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Mehr als 200.000 Menschen wurden sofort getötet oder verwundet. »The Bomb« wurde im nächsten Jahrzehnt als Metapher Teil des öffentlichen Diskurses. In einem Pamphlet hatte der amerikanische Industrielle Hugh Everett Moore den Begriff »Population Bomb« als Metapher für die drohende Überbevölkerung der Erde mit Menschen erstmals 1954 veröffentlicht. Bis 1967 war seine Streitschrift über die Kontrolle des Bevölkerungswachstums zwölfmal neu aufgelegt worden – 1,5 Millionen Exemplare fanden Abnehmer.
Sardinien, 1946 bis 1950: Rockefeller-Stiftung und Alliierte ließen in einem großen Feldversuch DDT über Sardinien versprühen, um dort durch Vernichtung der Anophelesmücke die Malaria auszurotten, mit zunächst positiver Bilanz.
Bikini-Atoll, 1. Juli 1946: Die USA begannen, das abgelegene Inselparadies für oberirdische Atombombentests zu nutzen. Der »Atompilz« wurde zum Symbol militärischer Überlegenheit. Mit dem Versprechen, in wenigen Monaten zurückkehren zu können, waren die 167 Bewohner der Insel Bikini auf das unwirtliche Rongelak umgesiedelt worden. Diejenigen, die nach einigen Wochen zurückkehrten, mussten nach zehn Jahren, als sie wegen der Strahlenbelastung Krebs entwickelt hatten, wieder evakuiert werden. Bikini kann bis heute nur für Kurzbesuche betreten werden.
USA, Juli 1969: Von 1959 bis 1962 betrieb die NASA das Mercury-Programm mit dem Ziel, einen Mann ins Weltall zu befördern. Die Sowjetunion war um einen Monat schneller. Daraufhin planten die USA, Menschen auf den Mond zu bringen. Der Architekt Buckminster Fuller (1895–1983) hatte schon 1967 den Begrenztheit, Gefährdung aber auch Steuerbarkeit suggerierenden Begriff vom »Raumschiff Erde« (Spaceship Earth) geprägt. Das am 24. Dezember 1968 aus der Apollo-8-Kapsel bei einer Mondumrundung aufgenommene Bild der kahlen, sterilen Mondoberfläche, über der die Erde als blauer mit weißen Wolkenbändern überzogener Planet in einem nachtschwarzen All aufging, visualisierte diesen Begriff eindrucksvoll. Am 20. Juli 1969 betrat der erste Mensch einen anderen Himmelskörper. Die Mondlandung war das erste globale Medienereignis. 93,9% der 53,5 Millionen amerikanischen Haushalte mit TV verfolgten die Landung der Apollo-11-Mission.
Was haben diese Ereignisse gemeinsam? Sie sind Teil des Ringens um Hegemonie auf der Weltbühne. Ihre mediale Umsetzung prägte das kollektive Gedächtnis. Die USA verstanden sich als Verteidiger von Freiheit und Demokratie mit allen Mitteln. Sie kämpften auf der Erde und im Weltraum um die Vormachtstellung gegenüber dem Ostblock. Wirtschaftswachstum auf der Basis von Erdöl und Erdgas war für die USA das wichtigste Mittel zur Überzeugung der eigenen Bevölkerung. DDT, neuartige Waschmittel, die reines Weiß verhießen, und eine wachsende Zahl weiterer Haushalts- und Agrarchemikalien und Medikamente versprachen den Sieg über äußere und innere Natur, so wie das Waffenarsenal jenen über die Kommunisten.
Doch bald traten in der schönen neuen Welt der technokratischen Supermacht Risse zutage. 1962 erschien Rachel Carsons »Silent Spring«, ein Buch über die ökologischen Wirkungen von Pestiziden wie DDT. Die Folgen des technischen Fundamentaloptimismus wurden in schäumenden Flüssen ebenso sichtbar wie beim Sommersmog über großen Städten wie Los Angeles, der vom Autoverkehr verursacht worden war.
Als der demokratische Senator Gaylord Nelson (1916–2005) im September 1969 ankündigte, 1970 einen »Earth Day« zu veranstalten, hatte er sich bereits einen Namen als Umweltschützer gemacht. Er war am 1972 in den USA in Kraft getretenen Verbot von DDT beteiligt, hatte gegen biologisch nicht abbaubare Waschmittel und für die Reinigung der Großen Seen gekämpft. Er fand nur wenige Unterstützer; »Umweltexperten« gab es damals noch nicht. Jedoch begann die Diskussion, ob die von Rachel Carson öffentlich gemachte Umweltkrise ihren Grund in Bevölkerungswachstum, Religion, Kapitalismus, Technologie, Reichtum oder in der menschlichen Natur hatte.
Nelsons Earth Day mobilisierte zur allgemeinen Überraschung mehr Teilnehmende als die Protestmärsche gegen Vietnam oder für die Emanzipation der Frauen. Der 22. April 1970, der eigentliche Earth Day, war Teil von Aktionswochen. Ungefähr 1500 amerikanische Colleges und etwa 10.000 Schulen beteiligten sich. Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner waren dabei; 35.000 Vortragende beschäftigten sich mit Umweltthemen; Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Politiker und Politikerinnen, darunter einige Gouverneure, sprachen. Der amerikanische Kongress setzte seine Sitzung aus, um Mitgliedern die Teilnahme an Aktivitäten zu ermöglichen; zwei Drittel von ihnen machten davon Gebrauch. Alle großen Naturschutzorganisationen und eine unüberschaubare Zahl an kleineren, lokalen Gruppen von Umweltaktivisten beteiligten sich an Programm und Organisation. Die Dachorganisation der amerikanischen Kirchen empfahl ihren Mitgliedern, Gottesdienste am Sonntag vor dem Earth Day dem Umweltschutz zu widmen.
»Environmental Action«: Titelseite des Newsletters des Vorbereitungskommittees für den ersten EARTH DAY 1970. Darstellung der Problematik der Überbevölkerung.
Gaylord Nelson betrieb nur ein kleines Koordinationsbüro. Die Aktivitäten wurden nicht »von oben«, sondern von lokalen Komitees geplant und stellten die Umweltprobleme der jeweiligen Region in den Mittelpunkt, dadurch wurde der Earth Day vielerorts zu einem Wendepunkt. Tausende Teilnehmer wurden zu Umweltaktivisten. Studiengänge wurden eingerichtet und erstmals wurde in Washington auch Lobbying für den Umweltschutz betrieben.
Dieser Erfolg kam nicht von ungefähr und ist auch nicht mit der »Gunst der Stunde« allein zu erklären. Die Massenmedien, allen voran das Fernsehen, berichteten nicht nur in den Nachrichten ausführlich über Earth-Day-Aktivitäten. Sogar die Kinderserie »Sesamstraße« widmete dem Umweltschutz Sendezeit. So wurden noch weit mehr Personen erreicht als bei den Veranstaltungen. Die von Nelson eingesetzte Koordinationsgruppe entschloss sich, weiter zusammenzuarbeiten. Die Mitglieder gründeten »Environmental Action«, die das beim Earth Day entstandene Netzwerk lokaler Umweltinteressierter für Lobbying in Washington nutzten. Ihr erster Erfolg war, 1970 den »Clean Air Act« mehrheitsfähig gemacht zu haben. Sie koordinierten ihr Netzwerk auch, als es galt, Überschallflugzeuge zu verhindern, und machten mit einer Kampagne bei allen Wahlen darauf aufmerksam, welche Kandidaten für den Kongress sich besonders wenig um Umweltbelange kümmerten. Ihr riesiges Netzwerk machte vieles möglich: Sieben der von ihnen als »dreckiges Dutzend« öffentlich gemachten Kandidaten verloren 1970 bei den Wahlen gegen Kandidaten mit weißerer (Umwelt-)Weste.
Seit »Silent Spring« war klar, dass Bücher über Umweltund Naturschutz wirtschaftlich erfolgreich sein konnten. Diese Chance nutzten viele Verlage, um das Thema in die Buchläden und Regale der Amerikaner zu bringen. Die Umweltschutzorganisation »Friends of the Earth« publizierte zu Beginn des Jahres 1970: »The Environmental Handbook«. Bis Ende April wurden davon mehr als 1 Million verkauft. Im Dezember 1970 richtete Präsident Nixon die amerikanische Umweltbehörde EPA ein und gab damit der Umweltpolitik und dem Umweltschutz eine institutionelle Heimat.
Die grundsätzlichen Probleme eines an Wirtschaftswachstum geknüpften industriellen Lebensstils blieben ungelöst. Die Institutionalisierung von Umweltthemen in der politisch-administrativen Sphäre, in der Erziehung und in den Medien zumindest in Nordamerika und in Europa hat zu einer wesentlichen Minderung vieler Umweltprobleme geführt. Auch für die Umweltgesetzgebung wirkte der Earth Day als Katalysator.
Heute haben viele Industrieunternehmen die Massenproduktion von Gütern einschließlich der resultierenden Umweltschäden in Länder der Tropen und Subtropen mit fehlender oder schwächerer Umweltgesetzgebung verlagert. Dadurch ist die direkte, sichtbare Betroffenheit der in Europa und Nordamerika lebenden Menschen deutlich zurückgegangen. Die globale Umweltbewegung erfuhr dadurch eine (wohl vorübergehende) Schwächung. (ROME, 2010)
Was wir engagierten Frauen verdanken
Diese Seite ließe sich ausschließlich mit Namen und Daten zu Frauen füllen, die in der Geschichte des Naturund Umweltschutzes eine wichtige Rolle gespielt haben bzw. noch spielen. Wir haben in Form einer Welle auf der gegenüberliegenden Seite 86 Frauen vor den Vorhang gebeten, deren Engagement einen Unterschied zum Besseren gemacht hat, nur wenige sind allgemein bekannt. Vier Frauen wollen wir näher vorstellen, sie repräsentieren das ganze Spektrum weiblicher Leistungen für den Schutz von Natur und Umwelt.
Karoline (Lina) Hähnle, die Gründerin des Deutschen Bundes für Vogelschutz, steht für die erste fassbare Generation an Frauen, die sich engagierten (WÖBSE 2003). Geboren am 3.2.1851 in Sulz am Neckar als Tochter eines Salineninspektors, heiratete sie mit zwanzig Jahren ihren 13 Jahre älteren Vetter. Hans Hähnle hatte sich vom Färbergesellen zum Geschäftsmann hochgearbeitet und eine erfolgreiche Filzfabrik gegründet. Das Fabrikantenehepaar zählte zu den fortschrittlichen und sozialen Arbeitgebern. Lina Hähnle gebar 8 Kinder, von denen 6 das Erwachsenenalter erreichten. Ihre Naturliebe führte sie auf Spaziergänge mit ihrem Vater zurück. Im mittleren Alter schloss sie sich dem leider nur kurzlebigen Verein der Österreichischen Vogelfreunde an. Daher gründete sie den Deutschen Bund für Vogelschutz. Dieser wurde unter Hähnles Leitung, die ihn effizient und mit Sachverstand führte, rasch zum größten deutschen Naturschutzverein, er zog auch sehr viele weibliche Mitglieder an. Als Lina Hähnle am 1.2.1941 starb, hatte sie den 1899 gegründeten Bund 38 Jahre lang geleitet, bis Ende 1937 als Vorsitzende, danach als Ehrenvorsitzende. Die jüngere Forschung (FROHN & ROSEBROCK, 2017) macht auf die erstaunliche Kontinuität aufmerksam, die den Bund unter Hähnles Leitung auszeichnete: Gegründet im deutschen Kaiserreich, blieb er in der Weimarer Republik ebenso erhalten wie während der nationalsozialistischen Herrschaft.
Wieso lag Frauen der Vogelschutz nahe? Marie Antoinette, die Frau des französischen Königs Ludwig XVI., wird oft als die genannt, die populär machte, Vogelfedern im Haar zu tragen. Doch sind Federn als Schmuckelemente schon in zahlreichen indigenen Kulturen verankert. Am Ende des 19. Jahrhunderts fielen dem nun auch bürgerlichen Hutschmuck Abertausende Vögel zum Opfer. Das rief Gegenbewegungen hervor: Frauen, die sich verpflichteten, keine Hüte mit Vogelfedern zu tragen. Zehn Jahre vor dem Deutschen Bund hatte Emily Williamson in London die Royal Society for the Preservation of Birds gegründet, mit dem Ziel, die Nutzung von Vogelfedern für Modewaren zu unterbinden. Doch noch im Jahr 1911 wurden die Federn von 129.000 Silberreihern, 13.598 Fischreihern, 20.698 Paradiesvögeln, 41.090 Kolibris, 9.464 Adlern, Kondoren und anderen Greifvögeln sowie 9.472 anderen Vögeln in London für das Hutmacherhandwerk versteigert (DOUGHTY, 1975; PRICE, 1999). Der Vogelschutz kann als eine frühe Form einer an nachhaltigem Konsum orientierten Bewegung verstanden werden, gleichzeitig aber ist er eine Wurzel des umfassenden Natur- und Umweltschutzes.
Die britische Ökonomin und Journalistin Barbara M. Ward, Baroness Jackson of Lodsworth DBE (23.5.1914–31.5.1981), war eine der einflussreichsten Denkerinnen in der Umwelt- und Entwicklungspolitik. In den 1960er und 1970er Jahren trat sie als Autorin erfolgreicher Sachbücher an die Öffentlichkeit, sie war Universitätslehrerin und Direktorin des bis heute erfolgreichen IIED, des »International Institute for Environment and Development«. Ward stammte aus einer gläubigen Familie und war selbst gläubige, wenn auch kritische Katholikin. Sie war die erste Frau, die vor einer katholischen Bischofssynode sprechen durfte. Für sie wurden bei mehreren UNO-Konferenzen die offiziellen Abläufe unterbrochen, damit sie, obwohl keine Delegierte, vor den Versammlungen sprechen konnte. Ihr verdanken wir die heutigen »Standardverfahren« in internationalen Verhandlungen zu Umwelt und Entwicklung: Sie beginnen mit Vorbereitungen in kleinen, mutigen ExpertInnengruppen, die Forderungen in Memoranden und ähnliche Dokumenten aufzubereiten. Diese werden danach in der großen Gruppe diskutiert und oft auch verabschiedet. Im Vorfeld der ersten Umweltkonferenz der Vereinten Nationen wurde sie gemeinsam mit dem Naturwissenschaftler René Dubos beauftragt, ein international abgestimmtes Buch als Vorbereitung zu schreiben. »Only One Earth« erschien 1972. Das Konzept einer »nachhaltigen Entwicklung« wird darin bereits beschrieben, 15 Jahre vor dem ebenfalls unter weiblicher Leitung (Gro Harlem Brundlandt) entstandenen Bericht »Our Common Future«, der den Begriff definierte und zum Standard machte. Barbara Ward arbeitete bereits an der gemeinsamen Verantwortung der Menschheit für eine Erde, als Umweltschutz und Entwicklungspolitik noch in den Kinderschuhen steckten und nicht als zusammengehörig gedacht wurden. Ihre Begabung als Rednerin, ihre umfangreiche Korrespondenz mit zahlreichen Politikern, die vielen Jahre, die sie in Ghana verbrachte, wo sie postkoloniale Strukturen direkt beobachten konnte, aber auch ihre persönliche Bescheidenheit waren Teil ihres Erfolgs.
Donella H. (Dana) Meadows wurde am 13.3.1941 in Elgin, Illinois, geboren. Ausgebildet in Chemie und Biophysik begann sie als Wissenschaftlerin am Center for Population Studies der Harvard University und am Department of Nutrition am MIT. Dort arbeitete sie an der Entwicklung eines Computermodells für den »Club of Rome« mit, die Grundlage für das Buch »Die Grenzen des Wachstums«, dessen Hauptautorin sie war. Meadows schrieb eine wöchentliche Zeitungskolumne mit dem Titel »The Global Citizen«. Das »Sustainability Institute«, das die Erforschung globaler Systeme mit der praktischen Erprobung nachhaltigen Wohnens verband, ist ihre Gründung. Als produktive Schriftstellerin veröffentlichte sie jahrzehntelang über Umweltthemen. Von 1988 bis 1990 entstand die TV-Serie »Race to Save the Planet«; dazu schrieb sie ein Lehrbuch mit dem Titel »A Sustainable World: an Introduction to Environmental Systems«. Donella Meadows starb am 20.2.2001. Sie war nicht nur die erste Umweltsystemwissenschaftlerin, sondern auch eine erfolgreiche Kolumnistin und Erproberin eigener Erkenntnisse, eine transdisziplinäre Expertin der ersten Stunde.
Die 1940 geborene kenianische Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai war als Professorin für Veterinäranatomie eine Pionierin in vieler Hinsicht. Nach Studien in Atchison, Kansas und Pittsburgh (USA) sowie Aufenthalten in Deutschland promovierte sie 1971 als erste Frau an der Universität Nairobi, wo sie danach auch lehrte. 1976 hatte sie die Idee, insbesondere mit den Frauen ihres Landes Bäume zu pflanzen, um die Umwelt zu schützen und die Lebensqualität zu verbessern. Durch das »Green Belt Movement« wurden mehr als 20 Millionen Bäume auf Bauernhöfen, Schulen und Gemeindegeländen gepflanzt. 1984 wurde sie dafür mit dem Right Livelihood Award (dem »Alternativen Nobelpreis«) geehrt. Zwei Jahre danach gründete die kenianische Organisation ein »Pan African Green Belt Network«, das sich über Tansania, Uganda, Malawi, Lesotho, Äthiopien und Simbabwe weiter verbreitete und bis heute besteht (MAATHAI, 2003).
Im Dezember 2002 wurde Wangari Maathai, die sich auch für Menschenrechte und gegen politische Willkür einsetzte, in das kenianische Parlament gewählt und zum stellvertretenden Minister für Umwelt, natürliche Ressourcen und Wildtiere ernannt. Sie und das »Green Belt Movement« haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Friedensnobelpreis 2004, den sie für ihren ganzheitlichen Zugang zur nachhaltigen Entwicklung der Demokratie, Menschenrechte und insbesondere Frauenrechte umfasst, erhielt. Für die Rechte afrikanischer Frauen einstehend, war sie die erste Afrikanerin, die den Preis erhielt. Sie starb am 25.11.2011 in Nairobi an Krebs. (vgl. EHLERT, 2004)
FRAUEN, DIE DIE UMWELT BEWEGTEN UND BEWEGEN – Diese unvollständige Zusammenstellung reicht von Aktivistinnen über Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen bis zu Unternehmerinnen. Wir bitten damit 86 Frauen vor den Vorhang, die sich für die Umwelt eingesetzt haben oder das noch tun. Die Welle ist chronologisch geordnet. (vgl. BRETON, 2000; MERCHANT, 2005; BMU 2013)
Uran aus Sachsen für die erste Atombombe der UdSSR
Am 29. August 1949 zündeten Techniker erfolgreich RDS-1 – die erste Atombombe der Sowjetunion – auf dem Testgelände von Semipalatinsk in der Kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Über Jahre war der Sowjetunion der Weg zur Atommacht versperrt gewesen, denn es fehlte an Uran. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte die sowjetische Atomforschung begonnen; kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges war sie eingestellt worden. Nach dem Sieg von Stalingrad befahl Stalin die Einrichtung eines geheimen Uran-Komitees in der Akademie der Wissenschaften. Nach dem Abwurf US-amerikanischer Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 forcierte er das Atombombenprogramm nochmals. Südlich von Nishni Nowgorod entstanden die mit Zwangsarbeitern betriebenen Atomkomplexe „Tscheljabinsk-40“ mit einem Reaktor zur Herstellung von Plutonium und „Arsamas-16“ (heute Sarow), dem Pendant zu Los Alamos in den USA.
Mit der Besetzung Ostdeutschlands eröffneten sich der Sowjetunion neue Möglichkeiten, ihre „Uranlücke“ zu schließen. Sowjetische Geologen wurden im Erzgebirge fündig. Sie meldeten reiche Vorkommen an „A-9“, neben „Wismut“ einem der Decknamen für das unter strengster Geheimhaltung dort in der Folge abgebaute Uran. Das Innenministerium der Sowjetunion (NKWD) ließ bereits im Frühjahr 1946 Uranerz aus einem reaktivierten Altbergwerk im sächsischen Johanngeorgenstadt fördern. Bald wurden weitere Altbergwerke im Erzgebirge aktiviert. (KARLSCH, 2003: 142)
Im Jahr 1947 gründet die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) die „Sowjetische Staatliche Aktiengesellschaft der Buntmetallindustrie Wismut“ (SAG Wismut). Sie befand sich vollständig in sowjetischem Eigentum, ihre Aufgabe war der Abbau von Uranerz.
Die gefährlichen Folgen radioaktiver Strahlung für die Kumpel in den sächsischen Uranbergwerken waren den Verantwortlichen der SAG Wismut und der SMAD durchaus bekannt. Warnungen der Bergleute vor den Gesundheitsgefahren unterblieben. (KARLSCH, 2003: 54) Fotos von der Prospektion und den ersten Abbauversuchen aus den Anfangsjahren der Wismut sind selten, galt die Anlage doch als besonders geheimhaltungspflichtig.
Besonders in den ersten Jahren waren die Arbeitsbedingungen desaströs. Proteste der Gewerkschaft verbesserten die Situation der Bergleute untertage etwas, ein warmes Mittagessen, höhere Bezahlung und bald verbesserte Gesundheitsversorgung wurden erkämpft. Die gravierende Strahlenbelastung untertage hielt jedoch an. (SCHÜTTERLE, 2010: 31)
Das in Sachsen gewonnene Uranoxid ging vollständig in die UdSSR. Die SAG Wismut lieferte in den ersten Jahren ihres Bestehens mindestens zwei Drittel des Urans für das sowjetische Atombombenprojekt, von 1947 bis 1953 insgesamt 9.500 t. Im thüringischen Ronneburg wurde ab 1949 ebenfalls Uranerz abgebaut. Betriebe im sächsischen Crossen und im thüringischen Seelingstädt verarbeiteten es zu leuchtend gelbem Uranoxid, der im englischen Sprachraum als „Yellow Cake“ bekannten Ausgangssubstanz für Bomben. (KARLSCH, 2007: 63–64, 150)
In den 1950er Jahren wurden unrentabel gewordene Uranbergwerke geschlossen. Die aufgegebenen ungesicherten, nicht sanierten Betriebsgelände gingen an Kommunen und ehemalige Privatbesitzer über, die sich über die von ihnen übernommenen Risiken zwar beschwerten, aber keine Unterstützung erhielten. (SACHAROW, 2011: 32)
Die am 1. Januar 1954 in die „Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut“ (SDAG Wismut) umgewandelte SAG Wismut entwickelte sich zum zeitweise drittgrößten Uranproduzenten weltweit. (SCHÜTTERLE, 2010: 36–37, 42; KARLSCH, 2007: 112, 117, 150)
Die Feinstaub- und Strahlungsbelastung der Bergleute in den sächsischen und thüringischen Uranbergwerken war sehr hoch. Erst Mitte der 1960er Jahre wurde sie durch die Orientierung an internationalen Standards erheblich geringer. Im Zeitraum von 1946 bis 1990 wurden bei 16.692 Bergleuten Silikosen/Siliko-Tuberkulosen und bei 7.693 Bergleuten Krankheiten durch Strahlung (überwiegend Lungenkrebs) als Berufskrankheiten anerkannt. Die Dunkelziffer dürfte jedoch hoch sein. (KOPPISCH et al., 2004)
Wo Uran gefördert wird, steigen auch die obertägigen Konzentrationen der Zerfallsprodukte, die teils wesentlich gefährlicher sind als Uran selbst, allen voran das Edelgas Radon. In den Bergbauorten lebende Menschen atmeten es ein. Landwirtschaftsbetriebe nutzten einen Teil des aus den Bergwerken gepumpten kontaminierten Wassers zur Bewässerung ihrer Felder, ein anderer gelangte in die Fließgewässer. Nach der Aufbereitung wurden nicht nutzbare Erze mit Urangehalten unter 0,05% als Abraum in offenen Halden gelagert. Der Wind wehte uranhaltige Stäube von den Halden in benachbarte Siedlungen und auf die Äcker. Regen wusch radioaktive Verbindungen daraus in die unterliegenden Böden, das Grundwasser und die Fließgewässer. Abfallerze der Uranaufbereitung wurden im Straßenbau oder für Hausfundamente eingesetzt. Erst ab 1974 waren dafür Genehmigungen erforderlich. Bis 1990 wurden rund 12 Mio. t von der Halde der Aufarbeitungsanlage Crossen abgetragenes uranhaltiges Material in Bauwerken verarbeitet. (BELEITES, 1992: 76)
In den 1970er Jahren verbesserte die SDAG Wismut die Schachtbewetterung in ihren Bergwerken, wodurch die Radonwerte untertage immerhin um ca. 80% zurückgingen. (KARLSCH, 2007: 169)
HALDENLANDSCHAFT bei Schlema im Jahr 1965 (© Archive Wismut)
Ende 1990 endete nach 54 Jahren der Uranerzbergbau in Sachsen und Thüringen. Etwa 1,2 Mrd. t Gestein waren bewegt und 231.000 t Uran abgebaut worden. Es fielen ca. 175 Mio. t Aufbereitungsrückstände an.
Seit 1991 ist die Bundesrepublik Deutschland für die ehemaligen Bergwerke, Halden und Betriebsgelände der SDAG verantwortlich. Sie hat die mit ganz erheblichen personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattete Wismut GmbH gegründet, die mittlerweile sämtliche Schächte dauerhaft und verschlossen und gesichert, die Halden, Schlammteiche und Betriebsgelände weitgehend saniert und die Strahlenexposition der Bevölkerung entscheidend vermindert hat. Eine bedeutende Daueraufgabe bleibt die Behandlung und das Management der weiterhin anfallenden kontaminierten Bergbauwässer und der Haldensickerwässer. Deren chemische Charakteristika schwanken gewaltig, wie schon die zwischen 3 und 9 variierenden pH-Werte deutlich machen. Die Wismut GmbH betreibt sechs Wasserbehandlungsanlagen. Dort werden Uran, Radium-226, Arsen, Mangan, Eisen sowie weitere Schwermetalle abgetrennt, in unlösliche Form verwandelt und abgelagert. Von 2010 bis 2014 wurden jährlich im Mittel 20 Mio. m3 kontaminierte Wässer behandelt, aus denen etwa 25.000 m3 Rückstände verblieben. Von 1990 bis 2014 wurden die Uranemissionen um 93% sowie die Radiumemissionen um 98,5% reduziert. Bis spätestens 2027 soll ein „guter Zustand“ der Gewässer gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sichergestellt sein. Leider ist zu erwarten, dass dies nicht durchgängig gelingen wird und dann weniger strenge Bewirtschaftungsziele zugrunde gelegt werden müssen. (PAUL et al., 2015)
Bis Ende 2017 beliefen sich die Sanierungskosten auf 6,2 Mrd. Euro. Hunderte weitere Millionen Euro werden hinzukommen. (BMWI, 2011)
Aufruf zur ARBEIT IM URANBERGBAU, Ende der 1940er Jahre. Foto: Norbert Kaiser