1. FELIZ NATAL – Weihnachten in Rio
Renzo und ich laufen die abendliche Strandpromenade an der Copacabana entlang. Es regnet in Strömen. Wenn wir nicht den Sonnenschirm aus seinem Apartment mitgenommen hätten, wären wir jetzt nass bis auf die Haut.
Renzo ist Italiener und mein Nachbar. Mitte dreißig und klein. Leicht gewelltes Haar, schiefe, vorstehende Zähne und eine Hakennase mit einem bläulichen Fleck genau auf dem Knick. Er erinnert mich an Roberto Benigni. Nicht gerade ein Adonis, aber er hat Charme. Die Frauen mögen ihn.
Renzo kennt auf der Copacabana fast jeden, und alle kennen ihn. Er kommt schon seit zehn Jahren immer wieder nach Rio. Acht Monate im Jahr arbeitet er als Maschinist auf Handelsschiffen, die restlichen vier Monate verbrät er sein Geld an der Copacabana.
"Seit ich siebzehn bin, arbeite ich auf Schiffen", sagt Renzo. "Ich war fast überall auf der Welt. Singapur, Java, Borneo, Yokohama, San Francisco, Los Angeles, ganz Südamerika. Doch als ich das erste Mal nach Rio kam, habe ich sofort gesagt: Hier. Das ist es! Hier will ich bleiben."
Die Strandpromenade ist wie ausgestorben. Alle Kioske geschlossen, alle Kneipen zu. Nur ein einsamer Jogger trabt durch den Regen, und ein paar Straßenkinder suchen Schutz unter einer Open Air Bühne.

Copacabana bei Einbruch der Dunkelheit
Der Regen allein ist nicht schuld an der einsamen Stimmung denn sonst ist hier immer die Hölle los, auch nachts. Menschenmassen schieben sich über die hellerleuchtete Promenade, vorbei an eleganten Hotels, teuren Apartmenthäusern und Straßenrestaurants. Verkäufer bieten ihre Waren an, Performance-Künstler versuchen ein bisschen Kleingeld zu verdienen, und am Strand wird auf spontanen Partys getanzt. 364 Tage im Jahr, quasi nonstop. Nur heute nicht, denn heute ist:
Weihnachten.
Weihnachten in Rio. Der einzige Tag, an dem alles anders ist. Alle Läden und Restaurants sind geschlossen.
"Weihnachten spürst du hier schon weit im Voraus", sagt Renzo. "Wenn du zum Beispiel am Strand bist, siehst du Mädchen im Bikini, die diese rot-weißen Weihnachtsmann-Mützen aufhaben, und im Supermarkt tragen die Kassiererinnen sie auch. Es ist der wichtigste Feiertag in ganz Brasilien. Alle Familien sind zu Hause. Man spürt es hier mehr als in Europa, mehr als in Amerika, mehr als überall sonst. Alle Läden sind geschlossen."
Wir haben versucht, ein Taxi zu stoppen, ohne Erfolg. Die wenigen Taxis sind besetzt. Die Insassen werfen uns neugierige Blicke zu: Zwei Gringos mit einem Sonnenschirm im strömenden Regen auf der Avenida Atlantica.
Eine junge Brasilianerin kurbelt das Autofenster herunter und spitzt die Lippen zu einem Luftkuss.: "Feliz Natal!"
"Feliz Natal" ruft Renzo und schickt ebenfalls einen Luftkuss durch den Regen.
Dann deutet er auf das Ende der Copacabana. "Da hinten ist es", sagt er, "Da müssen wir hin!"
Der einzige Laden, der heute an der Copacabana aufhat, heißt "Bei Willi" und ist ausgerechnet eine deutsche Kneipe. So hatte ich mir Weihnachten in Rio eigentlich nicht vorgestellt. Doch Renzo beruhigt mich. "Bei Willi" sei völlig okay, und außerdem hätten wir sowieso keine andere Wahl.
Die Kneipe liegt in einer Seitenstraße und ist eine Mischung aus deutscher Eckkneipe und brasilianischem Strandkiosk. Massive Holztische und gläserne Bierhumpen kombiniert mit Palmwedeln und Bambus, die brasilianische Flagge in trauter Zweisamkeit mit dem Banner des 1. FC St. Pauli, deutscher Schlager alternierend mit Samba. In einer Ecke steht ein Weihnachtsbaum aus Plastik, und unter der Decke schweben bunte Luftballons. Am Büffet gibt es Schweinebraten.
Das Publikum passt zur Einrichtung und zur Musik. Etwa zwanzig deutsche Männer machen Konversation mit brasilianischen Mulatas, einige tanzen auch.
Hinter der Bar steht Willi und zapft Bier. Groß und dünn, Dauerwelle, kalte, blaue Augen. Früher war er Gebrauchtwagenhändler in Hamburg. Mit 100.000 Euro Erspartem ist er irgendwann nach Rio gegangen und hat die Kneipe aufgemacht.
Plötzlich taucht Ana Luisa auf. Betrunken. "Brasilien ist super", sagt sie. "Einfach das schönste Land der Welt. Klar, wir haben ein paar kleine Probleme, aber die Leute sind trotzdem glücklich, alle sind fröhlich, oder?"
Ana Luisa trägt eine rotweiße Weihnachtsmann-Mütze und eine über dem Bauch verknotete Bluse, die mit Rotweinflecken besudelt ist. Sie hat eine enorme Oberweite, und ihre Bluse sitzt knapp. In den USA, wo ich im Moment lebe, würde sie in diesem Aufzug wahrscheinlich für indecent exposure verhaftet werden, doch hier ist das normal.
Ana-Luisa ist hübsch. Eine klassische brasilianische Mischung: weiß, schwarz und Indio. Sie hat drei Kinder, zwei von einem Dänen, eins von einem Deutschen. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, und ausgerechnet heute hat es Knatsch gegeben. Einziger Ausweg: Willi.
Ana-Luisa ist so betrunken, dass sie Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht hat. In diesem Zustand fängt sie immer davon an, wie schön Brasilien ist, sagt Renzo. Sie hat ein paar Jahre in Europa gelebt, dort aber Depressionen bekommen.
Trotz ökonomischer Misere und sichtbarer Armut ist fast jeder hier Patriot. Und alle haben ansteckend gute Laune. Gelegentlich gibt es einen Moment der Melancholie, doch der kommt eher von der Erschöpfung nach zu viel Samba und Alkohol. Sobald sich der Körper erholt hat, geht die Party weiter.
Renzo deutet auf die jungen Brasilianerinnen an den Tischen. "Die haben alle schon Kinder. Und sie kriegen sie sehr früh, mit fünfzehn oder sechzehn. Und keine ist verheiratet, weil der Brasilianer, äh … er mag es, mit einer Frau zusammen zu sein, aber heiraten mag er nicht so gern."
Plötzlich wechselt Willi die Musik: "Stille Nacht, Heilige Nacht", gesungen von den Schöneberger Sängerknaben. Er verteilt Wunderkerzen, und die deutsch-brasilianische Kundschaft schwenkt die Stäbchen in der Luft hin und her.
Isabel, eine der Frauen vom Nebentisch, setzt sich zu uns. Ihre dunkle Haut wird kontrastiert von einem weißen Top mit der Aufschrift: No Stress . Sie trägt knallenge Hotpants und schwindelerregende Plateauschuhe.
"Quatro bambini", flüstert Renzo. "Vier Kinder!"
Isabel hat einen starken Überbiss und ein fliehendes Kinn. Ihr gegeltes, schwarzes Haar glänzt im Licht der Wunderkerzen. Sie fragt mich, wo ich herkomme.
"Mexiko", sagt Renzo.
Er macht sich immer den Spaß, mich als Mexikaner vorzustellen, weil ich Spanisch spreche, und das ist fast so gut wie Portugiesisch. Deutsche und Amerikaner sind in Rio nicht besonders angesagt, weil die Kommunikation nicht funktioniert. Mexikaner dagegen sind cool. Besonders deshalb, weil es kaum welche gibt.
"Mexiko?" Isabel sieht mich ungläubig an. Es scheint, als versuche sie, in meinen Gesichtszügen den Mexikaner zu erkennen. Auch Ana-Luisa sieht mich prüfend an. Plötzlich hebt sie ihr Glas, wobei sie fast die Hälfte verschüttet und noch einen Rotweinfleck auf ihre Bluse macht. "Feliz Natal e viva México!"
Der nächste Morgen.
Ich sitze in meinem Klappstuhl am Strand und lasse mir die Sonne auf den Pelz brennen. Inzwischen bin ich schon eine Woche in Rio und nicht mehr ganz so bleich wie am Anfang. Ich trinke Kokosmilch gegen den Weihnachts-Kater.
Am Strand wimmelt es von fliegenden Händlern, und ein paar Typen spielen Beachvolleyball.
Und dann ist da noch die Strandpolizei. Ich habe noch nie so gutaussehende Polizisten gesehen. Ihre Uniform besteht aus hautengen Unterhemden, Shorts und coolen Sonnenbrillen. Und natürlich sind sie durchtrainiert bis in die Zehenspitzen. Kein Wunder, dass immer ein Fanclub von Beach-Bunnys um sie herum ist. Eigentlich könnte man jetzt denken, dass das der Traumjob ist, aber die Jungs gehören nicht gerade zu den Großverdienern. Sie verdienen das Mindestgehalt: Etwa 300 Dollar im Monat.
Plötzlich tauchen Renzo und Ana-Luisa auf. Sie ist nicht nach Hause gegangen und hat bei ihm übernachtet.

Ana Luisa und Renzo am Strand
Während Renzo zu einem der Strandkioske läuft, um etwas zu trinken zu besorgen, massiert Ana Luisa ihre Schläfen. Ihr Gesicht ist etwas aufgedunsen. Außerdem hat sie diesen melancholischen Blick, den ich bei Brasilianern morgens schon oft bemerkt habe. Sonst redet sie wie ein Wasserfall, doch jetzt ist sie still. Vielleicht denkt sie an ihre drei Kinder. Die Geschenke werden in Brasilien unters Bett gelegt und am Morgen des 25. Dezember verteilt. Doch wegen des Knatsches gestern am Weihnachtsabend wollte sie wohl nicht nach Hause.
Ana Luisa starrt aufs Meer. "Silvester in Rio. Eine irre Party. Denk an meine Worte. Alle tragen weiße Klamotten, alles ist weiß. Eigentlich weiß ich gar nicht genau wieso, ich glaub’, sie bedeuten Frieden, die weißen Sachen."
Renzo kommt mit einer aufgeschlagenen Kokosnuss und einer Dose Bier wieder. Ana-Luisa öffnet die Dose und nimmt einen tiefen Schluck. "Frühstücksbier", sagt sie und grinst. Sie gibt Renzo einen Kuss. "Obrigado, meu amor."
Die beiden schmusen. Schmusen ist in Rio Volkssport. Noch nie habe ich so viel küssende Paare auf der Straße gesehen. Und zwar von 15 bis 75. Immer und überall. Man verliebt sich ständig aufs Neue, und das allgemeine Motto ist: "Morgen ist wieder ein Tag."
Mir fällt eine Mulata mit weißer Zipfelmütze auf. Darauf in goldener Schrift : "Feliz Reveillon" – Fröhliches Silvester. Auch ein paar andere Mädchen tragen die weißen Zipfelmützen. Es ist irre, gestern war noch Weihnachten mit rotweißen Mützen, jetzt sind wir bereits bei Silvester.
Ein Brasilianer mit grauen Haaren zeigt auf Ana Luisas leere Bierdose. "Kann ich die haben?"
"Klar doch". Sie wirft die Dose in einen Plastiksack, in dem sich bestimmt schon mehrere hundert Dosen befinden. Der Mann schultert den Sack, größer als er selbst, und läuft weiter den Strand entlang. Für jede Dose gibt es drei Centavos.
Etwas später sind wir in Tabajaras, einer Favela, die direkt hinter der Copacabana liegt. Ana Luisas Cousin, Carlos, lebt dort. Er und seine Frau waschen für andere Leute Wäsche. Und das zu viel günstigeren Preisen als im Waschsalon.

Favela in Rio de Janeiro
Im Wohnzimmer von Carlos läuft der Fernseher, wie überall in Rio. Während sich seine Frau um unsere Wäsche kümmert, trinken wir brasilianischen Rotwein aus einer Ballonflasche. Er ist süß und schmeckt scheußlich, doch ich lasse mir nichts anmerken.
Carlos ähnelt Ana Luisa. Auch er ist eine Mischung aus weiß, schwarz und Indianer. Dunkelbraune Haut, Mandelaugen, leicht gekräuseltes Haar. Er trägt nur Gummilatschen und Shorts, wie die meisten Männer in der Favela bei dieser schwülen Hitze. Carlos' linke Gesichtshälfte bleibt starr, wenn er redet. Sie ist seit einem Autounfall gelähmt.
Überall springen Kinder herum. Sie laufen durchs Wohnzimmer und tollen auf dem Hof. Carlos selbst hat vier, obwohl er erst 28 ist, der Nachbar hat fünf.
Wir sehen eine Fernsehshow, bei der man Preise gewinnen kann. Die Assistentin des Showmasters ist eine brasilianische Blondine mit beeindruckenden Rundungen. Sie trägt fast nichts, ihr Bikini besteht aus Zahnseide - fio dental – in Rio die Bezeichnung für superknappe Tangas. Das größte Bekleidungsstück der Fernsehschönheit ist ein durchsichtiger Schleier vor dem Gesicht. Carlos belehrt mich mit Kennermiene, dass nicht nur der Busen, sondern auch der Po der Dame silikonverstärkt sind.
Carlos’ Familie ist gut ausgestattet: DVD, Stereoanlage, schnurloses Telefon, ein Gasherd mit sechs Flammen. Eigentlich ist alles da, was man braucht. Auch wenn das Haus von außen nicht verputzt ist, innen ist es picobello.
Wir stehen mit unserer Wäsche vor Carlos’ Haus und warten auf den Transporte Alternativo, einen weißen VW Bus, der in der Favela hin- und herfährt und überall hält, wo jemand winkt.
Das Besondere an einer Favela ist, dass sie meist auf einem der felsigen Berge liegt, von denen Rio umgeben ist. Je weiter oben, desto ärmer die Bewohner. Die Häuser sind improvisiert und an den Berg angepasst. Die Favelas haben meist nur eine befestigte Zufahrtstrasse, von der aus die Häuser über kleine Gassen und Treppen zu erreichen sind. Ansonsten gibt es aber fast alles: Apotheken, kleine Supermärkte, Zeitungsläden, Arztpraxen.
Während wir auf den Bus warten, sehe ich mich um. Vor einer kleinen Bodega stehen ein paar Männer und trinken Bier. Ein räudiger Hund humpelt über die Straße, und zwei Jungen spielen Fußball. Die Atmosphäre ist dörflich, und man hat das Gefühl, dass jeder jeden kennt.
Zwei Buchstaben deuten allerdings darauf hin, dass es hier nicht immer so idyllisch zugeht, wie es anmutet. An jeder Straßenecke haben sie C.V. an die Wand gesprüht: Comando Vermelho – rotes Kommando. Es ist das Zeichen eines Drogenkartells, das diesen Teil der Favela kontrolliert. Wer hier Drogen verkauft und nicht zum Comando Vermelho gehört, wird umgelegt.
Der nächste Morgen.
Renzo steht am Fenster und raucht eine Zigarette. Unsere Apartments grenzen aneinander. Renzos Fenster und meins liegen über Eck und zeigen beide in den Innenhof. Wir können uns gegenseitig ins Wohnzimmer gucken. Wir haben unsere möblierten Ein-Zimmer-Wohnungen von einer Agentur gemietet. Ich zahle dreißig Dollar am Tag, Renzo nur zwanzig, weil er besser verhandelt hat.
Ich habe Kopfschmerzen von dem billigen Rotwein.
"Wie spät?"
"Keine Ahnung", sagt Renzo. "Spielt das eine Rolle?"
"Nein, eigentlich nicht."
Ich suche nach meinen Kopfschmerztabletten. Das Mobiliar und auch die Farbgebung meiner Wohnung hat den Charme der siebziger Jahre. Die Stereoanlage und der Fernseher könnten aus der Produktion der DDR stammen. Dass hier schon Legionen von Durchreisenden gewohnt haben, lässt sich am Bücherregal erahnen. Der abgeworfene Ballast besteht aus: "Budhism for Beginners", "Die Deutschstunde" von Siegfried Lenz und einem politischen Pamphlet von Rush Limbaugh, einem konservativen, amerikanischen Radiomann. Titel: "The way things ought to be".
Renzo und ich gehen Mittagessen. Gleich an der Ecke gibt es ein kleines Restaurant bei dem man draußen sitzen kann. Das Inventar der Straßenkneipe besteht aus Plastiktischen und Plastikstühlen. Trockenfische baumeln von einem Balken über der Theke. Ein paar Typen stehen an der Bar und trinken Bier.
Das Essen in den einfachen Kneipen ist billig. Ein Steak mit Kartoffeln, Zwiebeln und schwarzen Bohnen und dazu eine Halbliter-Flasche einheimisches Bier kosten zusammen so um die fünf Dollar.
Die drei großen brasilianischen Biermarken heißen "Skol", schwedisch für "Prost", "Antarctica", und "Brahma", so wie der hinduistische Gott. Was brasilianische Biere mit Schweden, der Antarktis und einem Hindu-Gott zu tun haben, ist mir zwar nicht klar, ist aber auch nicht so wichtig.
Die Kneipe hat zwei Wanduhren. Eine über dem Eingang zur Toilette, eine hinter der Bar. Die eine zeigt 9 Uhr, die andere 15 Uhr 40. Beide gehen falsch. Selbst die Digitaluhren an der Strandpromenade gehen falsch, weil sie niemand wartet.
"Die Zeit ist hier ein relativer Begriff," sagt Renzo. "Es spielt keine Rolle, was es für ein Tag ist, Montag, Dienstag, Mittwoch, ob es fünf, sechs oder drei Uhr nachts ist. Es spielt keine Rolle, weil hier einfach immer irgendwo was los ist."
Renzo hat recht. Rio hat auch mich schon in sich eingesogen. Am ersten Tag bin ich noch früh ins Bett gegangen, weil ich vom Flug erschöpft war. Seit dem zweiten Tag war mein Aufenthalt eine ununterbrochene Party. Ich habe vergessen, was es für ein Wochentag ist, und meine Armbanduhr trage ich auch nicht mehr.
Ein kleiner Junge, ungefähr acht Jahre alt, steht neben Renzo und mir am Tisch und starrt auf den Boden. Er ist barfuß und trägt nur verblichene Shorts. Mir ist nicht gleich klar, was er will, doch Renzo hat es kapiert. Er winkt dem Kellner und lässt ihn die Reste von unserem Mittagessen auf einen Pappteller kippen. Der Junge nickt stumm zum Dank und geht wieder. Nach ein paar Schritten stopft er sich gierig das Essen in den Mund.
31. Dezember.
Schon am Nachmittag geht die Party los. Samba-Bands ziehen die Strandpromenade entlang, gefolgt von Tausenden Tänzern. Es regnet wieder. Doch das scheint niemand zu stören.
Renzo packt mich am Arm und zieht mich mitten ins Getümmel. Ich wippe zunächst verhalten, dann nach und nach mit mehr Schwung im Rhythmus der Musik.
Renzo hat die Augen geschlossen und zappelt ekstatisch hin und her. Er ist leicht neben dem Beat, aber das macht hier nichts.
"Feliz ano novo!" Isabel, die Mulata aus der deutschen Kneipe, fällt mir plötzlich um den Hals und drückt mir einen feuchten Kuss auf den Mund, der nach Apple-Cider schmeckt. Wir haben Isabel und Ana Luisa zufällig im Samba Zug getroffen.

Der Autor im Neujahrstrubel
An der Copacabana feiern schätzungsweise zweieinhalb Millionen Menschen. Wir können uns kaum bewegen, denn alle wollen das Feuerwerk sehen. Es ist die beste Pyro-Show, die ich je gesehen habe. New York ist nichts dagegen. Direkt vor der Copacabana liegen mehrere Ozeandampfer vor Anker, auf denen die Passagiere das Spektakel vom Meer aus betrachten.
Überall Pärchen, die sich umarmen und küssen. Fast alle tragen weiße Kleidung, die vom Regen durchnässt ist und beinahe durchsichtig an der nackten Haut klebt. In unserer Nähe steht eine Gruppe von etwa hundert jungen Schwulen, die sich ebenfalls küssen.
Renzo hat Ana Luisa im Arm und winkt mir zu: "Feliz ano novo!"
Isabel streckt mir eine Flasche Sekt entgegen und wünscht mir "Saude, paz e dinheiro!" – Gesundheit, Frieden und Geld! Ich bin schon ziemlich betrunken. Auf unserem Samba-Trip haben Renzo und ich so manche Bierdose gekippt und zwischendurch auch noch ein paar Caipirinhas.
"Warum eigentlich nicht auch Amor?"
"Wie?" - Isabel versteht nicht, was ich meine.
Ich will wissen, wieso sich die Brasilianer Gesundheit, Frieden und Geld wünschen, aber nicht auch Liebe? Isabel lacht und breitet die Arme aus: "Liebe? Schau dich doch mal um! - Davon haben wir doch genug!"

Neujahrs-Feuerwerk, Copacabana
Isabel und ich stehen am Strand und werfen jeweils eine weiße Orchidee ins Meer. Ich habe die Blumen für den Wahnsinnspreis von 10 Dollar gekauft. Je näher Mitternacht kommt, desto teurer werden die Blumen. Dasselbe gilt für die Taxipreise.
Im Meer schwimmen tausende Blumen. Einige Leute sind im Wasser. Nicht ganz ungefährlich, denn die Wellen sind meterhoch.
Renzo und Ana Luisa sind plötzlich verschwunden. Keine Chance, die beiden im Neujahrsgewimmel wiederzufinden.
"Vamos!" – Isabel zieht mich mit sich ins Meer. Nass vom Regen sind wir ja ohnehin schon, also was soll's. Wir planschen ausgelassen im lauwarmen Ozean. Auf einmal holt uns eine starke Welle von den Beinen und spült uns an den Strand. Wir lachen und umarmen uns. Und plötzlich küssen wir uns auch. Stimmt eigentlich. Liebe gibt es genug in Rio.
Erster Januar am Nachmittag.
"Porca Madonna!" Renzo flucht den Geldautomaten an, denn Konto ist bis zum Anschlag überzogen, und er bekommt keinen Cent.
Auch ich checke mein Konto. Ebenfalls Flaute. Ich habe mein Geld in Rio mit vollen Händen ausgegeben und auch nicht weiter drüber nachdenken wollen.
Renzo und ich sitzen am Strand und trinken Dosenbier aus dem Supermarkt. Kneipen sind passé. Wir starren schweigend aufs Meer. Wie immer schiebt sich ein Strom von Passanten die Strandpromenade entlang. Einige Pärchen tanzen zur Musik aus einem Radiorecorder, und allerlei buntes Volk versucht, irgendetwas zu verkaufen: von der Sonnenbrille bis zu gegrillten Shrimps am Holzspieß.
Renzo nimmt einen Schluck Bier und fischt seine letzte Zigarette aus der Packung. So still habe ich ihn noch nie erlebt. Der blaue Fleck auf seiner Hakennase wirkt heute dunkler als sonst. Übermorgen muss er wieder aufs Schiff, und bis zum nächsten Hafen kann es Wochen dauern.
"Hey", sagt Renzo. "Wir haben noch gar keine Adressen ausgetauscht." Er lässt sich am Strandkiosk etwas zu schreiben geben und kritzelt seine Email-Adresse auf eine Serviette. "In ein paar Monaten bin ich wieder hier. Vielleicht kommst du dann ja auch vorbei."
Ein paar Tage später.
Ich bin wieder zu Hause im winterlichen New York. An einem kalten Abend höre ich auf der Straße plötzlich vertraute Klänge. Die drei dick eingepackten Figuren vor mir – zwei Männer und eine Frau – sprechen Portugiesisch. Sie sind anscheinend gerade angekommen, ziehen ihre Koffer hinter sich her und haben sich verlaufen. Als sie sich umdrehen, sehe ich ihre dunkelbraunen Gesichter. Die drei bewegen sich ungelenk in ihren Wintersachen und fallen im verschneiten New York genauso auf wie die bleichen Gringos an der Copacabana.
2. ANYTOWN, USA – Ein Ausflug in die Provinz
"Natürlich kann man es Fly-Over-Land nennen", sagt Jenny wütend. "Aber wenn die Leute von der Ostküste oder der Westküste mal herkommen würden, um uns kennenzulernen, dann würden sie merken, dass es sich lohnt. Das hier ist das Heartland . New York und Los Angeles sind nicht Amerika. Das hier ist Amerika."
Ich sitze in "Maggie's American Bar and Grill" in Ashland, Kentucky. Mehr als 1000 Kilometer von New York entfernt. Auf eigenen Antrieb wäre ich wahrscheinlich nie hier gelandet, doch die Redaktion des Radiosenders, für den ich arbeite, wollte eine Story über die amerikanische Provinz. Eine Geschichte über einen Flecken weit ab vom Schuss. Wie lebt es sich dort, und wie ticken die Menschen? Örtliche Vorgaben lieferte die Redaktion nicht, also habe ich einfach einen Dart-Pfeil in die Mitte einer Amerika-Karte geworfen. Bei Ashland, Kentucky, ist er steckengeblieben.
Ich bin mit dem Auto gefahren, denn ich wollte die Entfernung spüren. Tausend Kilometer durch New Jersey, Pennsylvania, Maryland, West Virginia und Ohio.
Pennsylvania ist fast ausschließlich flach, und ich habe auch ein paar von den Amish am Straßenrand gesehen, die noch immer wie im 19. Jahrhundert leben. In Maryland wurde es dann langsam hügelig, und West Virginia besteht ausschließlich aus Wald und Hügeln. Über 400 Kilometer. Ich dachte immer, nach dem nächsten Hügel müsse irgendwas kommen, doch da war wieder nur ein Hügel.
Nun bin ich also in Ashland und trinke in "Maggie's American Bar and Grill" ein Bier.
"Ashland ist Smalltown, USA", sagt Jenny, die neben mir an der Bar sitzt. "Jeder kennt jeden. Und wenn du nicht jeden kennst, dann hast du einen Verwandten, der jeden kennt. Es ist sehr überschaubar."
Jenny hat ein attraktives Gesicht, wiegt aber mindestens 30 Kilo zu viel. Irgendwie erinnert sie mich an Miss Piggy.
Ashland liegt im Nord-Osten von Kentucky an der Grenze zu Ohio. Der Ohio River bildet die Grenze zum Nachbarstaat.
"In Ashland musst du vor allem eins wissen", sagt sie. "Es gibt einen großen Unterschied zwischen Kentucky und Ohio. Die Brücke allein macht schon den Unterschied. Die Leute in Ohio fühlen sich mehr nördlich. Die halten uns für Hillbillys , degenerierte Asoziale und nehmen uns nicht ganz für voll, weil Ohio ein reicherer Bundesstaat ist. Die halten sich für so 'ne Art von Elite."
Jim, der neben Jenny sitzt, stimmt zu. "Wir nennen die Angeber aus Ohio blöde Buckeyes , die haben auch einen anderen Akzent, sobald du über der Brücke bist, ändert sich die Stimmlage."

Brücke, die Kentucky mit Ohio verbindet
Mir ist aufgefallen, dass es im Radio fast ausschließlich Country Sender gibt. Warum eigentlich?
"Eine Menge Country-Sänger kommen hier aus der Gegend," sagt Jim. "Und Billy Ray Cyrus ist sogar in Ashland geboren. Irgendwie passt die Musik auch zur Stimmung. Das wirst du merken, wenn du dich ein bisschen umguckst."
Jenny stöhnt auf. "Genau. Immer singen sie darüber, dass die Frau sie verlassen hat und dass der Hund gestorben ist. Und wie besoffen sie sind. Ich mag eigentlich keine Country Musik, aber ich bin mit Billy Ray Cyrus zur Schule gegangen und seine Musikkarriere, die verfolge ich schon."
Billy Ray Cyrus, Billy Ray Cyrus … Plötzlich fällt der Groschen. Das ist doch der Vater von Miley Cyrus. Ich wusste nicht, dass der aus Ashland kommt. Irgendwann hatte er mal eine Fernsehserie: Country Boy studiert Medizin, kommt in die große Stadt und arbeitet dort in der Notaufnahme. Ab und zu singt er auch zur Westerngitarre. Es hatte damals diesen vorne kurz, hinten lang Haarschnitt. Inzwischen hat er seinen Stil geändert und posiert mit seiner Tochter, weil sie viel bekannter ist als er.

Billy Ray und Miley Cyrus.
Ich sehe mich in der Kneipe um. Die Frauen sind bei weitem in der Überzahl. Die Kerle nippen an ihrem Bier und sind nicht besonders gesprächig.
"Die Männer hier tragen alle Baseball-Kappen", sagt Valerie, die neben Jim sitzt. Sie ist etwa Mitte vierzig und im Gegensatz zu Jenny gertenschlank. "Die haben immer ihren Hund dabei und fahren einen Pick-up Truck. Die sind alle Rednecks. Mit Ausnahme natürlich von Jim hier."
Mein Barnachbar Jim ist tatsächlich mehr up-to-date als die meisten anderen Typen in der Bar. Seine kurzen Haare hat er mit Gel gestylt. Er trägt ein Seidenhemd und riecht nach Aftershave. Er ist ohne Zweifel hier der Hahn im Korb, eine Rolle, die er zu genießen scheint.
Jim fährt mit einem Truck Getränke aus, Jenny arbeitet in einer Schule für schwererziehbare Kinder, und Valerie war mal bei der Army und ist frühpensioniert. Sie hat einen Kurzhaarschnitt und erinnert mich entfernt an Jamie Lee Curtis.
Nach meiner Ankunft in Ashland bin ich die Hauptstraße entlanggelaufen. Außer ein paar Fast Food Restaurants, drei Kirchen und einem christlichen Buchladen gibt es eigentlich nichts. Die einzige Kneipe ist "Maggie's American Bar and Grill". Außerdem habe ich bisher nur Weiße gesehen.
"Minderheiten gibt es hier kaum", sagt Jim. "Gibt schon ein paar, aber ganz wenige. Früher war es hier wirklich ausschließlich weiß. Ich wünsche mir eigentlich mehr Buntheit, es wäre gut für unsere Gemeinschaft, ich hoffe, dass es mehr wird."
Ich habe Hunger und lasse mir die Karte geben. Nur Hamburger und Sandwiches. Meine tausend Kilometer lange Reise war kulinarisch gesehen ein Trauerspiel. Immer wieder Hamburger, Hot Dogs und labberige Pizza.
Nur bei meinem Zwischenstopp in Pennsylvania hatte ich Glück. Nach angestrengter Suche war ich auf ein einsames mexikanisches Restaurant gestoßen. Nicht gerade der höchste kulinarische Genuss, aber besser als Hamburger und Hotdogs.
"Nein, nein, wir haben noch mehr", sagt die Bedienung. "Blättern Sie um, Sir!"
Zwei Seiten der Speisekarte sind leicht zusammengeklebt. Ich fummele sie auseinander und stoße auf das Hauptmenü. Aha, es gibt doch noch etwas Anderes: T-Bone Steak, Barbeque Chicken und Wildkaninchen mit hausgemachtem Kartoffelbrei.
Jenny rät mir, das Wildkaninchen zu nehmen. Die werden Hier in der Nähe geschossen und sind ganz frisch.
Als das Essen kommt, bin ich überrascht. Das Wildkaninchen ist wirklich gut. Das Fleisch zergeht auf der Zunge, und auch die Soße haben sie hingekriegt. Ich frage, ob der Koch aus der Gegend ist.
"Nicht direkt", sagt die Bedienung. "Er kommt aus Peru."
Auf dem Weg zur Toilette werfe ich einen Blick in die Küche. Aha, dort sind sie also, die Minderheiten. Die Bedienungen sind zwar alle weiß, doch die Küche ist fest in lateinamerikanischer Hand. Der Koch gibt einige Anweisungen auf Spanisch, rührt in einem Topf, schmeckt ab, würzt nach. Seine Gesichtszüge sind die eines Indios aus den Anden. Ich schätze ihn auf Anfang 30. An den Ohren trägt er massive Goldringe.
"Der Hase war wirklich gut!" rufe ich in die Küche.
"Das Nationalgericht bei uns in Peru ist Cui", sagt der Koch. "Fast so ähnlich wie Hase."
Ich habe davon gehört. Ein Cui ist eine Art Meerschwein, nur etwas größer. Was habe ich da eigentlich gegessen, einen Wildhasen oder ein Meerschwein?
"Nein, nein", sagt der Koch. "Es war natürlich ein Hase. Cuis gibt es hier ja gar nicht."
Ich sitze wieder an der Bar.
Kentucky, Kentucky, Kentucky... Was fällt mir zu Kentucky ein? Kentucky Fried Chicken! Und sonst? Nicht besonders viel.
"Wir haben die besten Pferde im Land", sagt Jenny. "Vielleicht sogar die besten in der Welt. Kentucky ist berühmt für Pferdezucht und Pferderennen. Immer am ersten Samstag im Mai haben wir das Kentucky Derby, und das ist das bekannteste Pferderennen im ganzen Land."
Genau, jetzt erinnere ich mich. Das Kentucky Derby! Das ist sogar in New York bekannt.

Kentucky Derby
Was kann man in Ashland eigentlich am Wochenende sonst so machen, außer an der Bar zu sitzen?
"Du kannst zum Bowling gehen, ins Einkaufszentrum oder ins Kino", sagt Jim. "Es gibt auch einen kleinen Laden, in dem man tanzen kann, aber 'Disco' kann man es eigentlich nicht nennen."
Es ist kurz vor Mitternacht. Die meisten der Typen in der Bar, bisher eher wortkarg, sind jetzt betankt und quatschen Frauen an.
Jim scheint auf die schlanke Valerie aus zu sein. Er küsst sie auf den Hals. Wieviel haben die beiden getrunken? Mindestens fünf Bier und ein paar Tequila. "Maggie's" macht um eins zu. Wer nicht bald jemanden findet, geht allein nach Haus.
Die dicke Jenny sitzt noch immer neben mir und ist wie alle hier angeheitert. Sie rückt immer näher, doch sie ist nicht mein Typ. Vielleicht wenn sie ein paar Kilo weniger hätte …
Ich gehe zurück zum Hotel. Es ist nur ein paar Schritte entfernt. Mein Zimmer ist in dunklen Brauntönen gehalten. Eiche rustikal. Allerdings habe ich Blick auf den Ohio River, der jetzt im Dunkeln kaum zu erkennen ist.
Ich lege mich aufs Bett. Irgendwie kann das nicht alles gewesen sein. Da war doch noch die kleine Disco ...
"Disco?" Der Portier im Hotel sieht mich fragend an. "Also, wir haben eine kleine Disco hier im Haus, aber sonst?"
Das "Rainbow" in meinem Hotel ist DIE Disco in Ashland. Mir wird plötzlich klar, dass das der Laden ist, von dem Jim gesprochen hatte. Nachdem ich fünf Dollar Eintritt bezahlt habe, treffe ich wieder dieselben Leute aus der Kneipe. Valerie, Jim und Jenny sitzen am anderen Ende der Bar. Ich nicke ihnen zu. Kommunikation ist bei der lauten Musik kaum drin.
Ich bestelle ein Bier. Auf der winzigen Tanzfläche hüpfen ein paar Leute herum. Der Discjockey schaltet ein Stroboskop ein, das die Bewegungen der Tänzer zerhackt. Eine öde Atmosphäre. Ich haue ab.
Sonntagmorgen. Ich sitze im Frühstücksraum des Hotels, löffle ein paar Cornflakes und trinke einen Kaffee. Der Raum ist wie mein Zimmer in dunklen Brauntönen gehalten. Die Bedienung ist eine ältere Dame, die leicht hinkt. Sie trägt einen Arbeitskittel und ein Haarnetz. Ich sehe auf den schmutzig braunen Fluss und die Brücke, die hinüber nach Ohio führt. In der Ferne bewegt sich etwas im Wasser. Schwimmt da etwa jemand in dieser Brühe?
Die Bedienung, klärt mich auf. "Es gibt eine Menge Rehe hier. Manchmal schwimmen sie über den Fluss. Von Kentucky nach Ohio und umgekehrt."
Die Bedienung sieht müde aus. Sie bleibt eine Weile neben meinem Tisch stehen und stützt sich auf einen Stuhl. Wie alt wird sie sein? 65? Sie erzählt mir, dass es hier schwierig ist, einen einigermaßen gut bezahlten Job zu finden. "Ich habe zwei Jobs. Tagsüber arbeite ich hier im Hotel, und nachts putze ich Büros. Ich brauche diese zwei Jobs, um über die Runden zu kommen."
Ich laufe die Hauptstraße von Ashland entlang und bin die einzige Seele, die hier am Sonntagmorgen zu Fuß unterwegs ist. Die Stadt wirkt wie ausgestorben. Nur ab und zu rauscht ein Auto an mir vorbei.
Ich bleibe einen Moment vor dem Touristenbüro von Ashland stehen. Im Schaufenster hängen Fotos von Billy Ray Cyrus und ein paar anderen Country Stars. Außerdem sind da eine signierte Western Gitarre, ein Cowboyhut und zwei Katzen, die zwischen den Auslagen herumklettern. An der Tür hängt ein Foto der Katzen. Darunter steht: "Wir gehören zum Laden - kein Grund zur Besorgnis!"
Ich schlendere weiter die Straße entlang, komme an einer Kirche vorbei und werfe einen kurzen Blick durch die Eingangspforte. Es ist Gottesdienst. Familien im Sonntagsstaat beten. Ich laufe weiter und komme an einer zweiten Kirche vorbei. Hier wird gesungen.
Das Einkaufszentrum am Stadtrand ist der einzige Ort, an dem sonntags etwas los ist. Ich schlendere durch das Walmart Super Center. Eine riesige Halle mit zehn Meter hoher Decke. Hier gibt es von der Zahnbürste bis zur Couchgarnitur einfach alles. Sogar Pflanzen und Haustiere. Außerdem einen Optiker, einen Friseur, einen Schönheitssalon, eine Apotheke, ein Fotostudio und verschiedene Arztpraxen. One-Stop-Shopping nennt man das. Fahr zu Walmart, und du findest alles, was du brauchst, sogar einen Zahnarzt! Und genau deshalb ist das Stadtzentrum tot.
Ich nutze die Gelegenheit und halte nach einer Klobrille Ausschau. Auf einer Party bei mir zu Hause ist eine der Plastikverankerungen abgebrochen, so dass die Brille jetzt immer verrutscht. Bisher hatte ich noch keine Zeit, mir eine zu besorgen.
Die Preise bei Walmart sind unglaublich günstig. Ich entdecke ein paar coole Bermudashorts für 6 Dollar 86. Ich kaufe gleich drei. Dann komme ich an den Telefonen vorbei. Ein schnurloses Telefon kostet nur unglaubliche 9 Dollar 96. Es wandert in meinen Einkaufswagen.
Dann die Haustierabteilung. Eine riesige Aquarien-Wand mit Zierfischen. Ich traue meinen Augen kaum: Es gibt hier "Bala-Sharks". Die sehen fast genauso aus wie richtige Haie, sind aber nur so groß wie mein kleiner Finger!

Bala Shark
Ich wollte schon immer ein Aquarium haben. Es ist so beruhigend. Und bei meiner nächsten Party wären die Mini-Haie der Hit. Nach kurzem Überlegen verwerfe ich die Idee wieder. Ich bin zu oft unterwegs. Die Fische würden bald eingehen.
Schließlich die Badabteilung. Ich entscheide mich für das einfachste Model mit dem Namen "Basic". Weiß, aus solidem Hart-Plastik. Fühlt sich fast an wie Porzellan. 4 Dollar 67.
An der Kasse erwartet mich eine Überraschung. Direkt vor mir in der Schlange steht Valerie mit einem vollbepackten Einkaufswagen. Beinahe hätte ich sie nicht erkannt, denn sie trägt einen Jogging-Anzug und ist ungeschminkt. Sie sieht trotzdem gut aus. Wieder erinnert sie mich an Jamie Lee Curtis.
Valerie wirft einen Blick auf meine Einkäufe und sieht mich skeptisch an. "Du kommst aus New York und kaufst hier in Kentucky eine Klobrille und ein Telefon? Bist du sicher, dass du nicht vielleicht in einem Trailer-Park in Ashland wohnst?"
Ich erkläre ihr, dass das nur Zufall ist, weil ich nun schon mal hier bin. Und außerdem gibt es keinen Walmart in New York.
Valerie stutzt. "Kein Walmart in New York?"
"Nein."
Valerie packt ihre Einkäufe auf das Band an der Kasse. Ich frage, ob ich sie zum Mittagessen einladen kann. Sie zuckt die Schultern. "Okay, warum nicht."
Das "Outback Steakhouse" ist gleich gegenüber. Ich fühle mich fast wie zu Hause, denn auch in New York gibt es ein Outback, ganz in der Nähe meiner Wohnung. Es sieht in diesen Restaurants überall gleich aus, rustikale Holztische, ein paar Bumerangs an der Wand, Bilder von Kängurus, ein ausgestopftes Krokodil. Corporate Identity nennt man das. Doch die Steaks sind wirklich gut.
Plötzlich fängt es an zu regnen. Valerie und ich beobachten die Leute, die über den Parkplatz laufen und schnell die Einkäufe in ihren Autos verstauen. Wir sind froh, dass wir im Trocknen sitzen.
Wir bestellen ein "Prime Minister's Prime Rib". Das ist der Renner im Outback. Dazu möchte ich ein australisches Bier vom Fass. Die Bedienung schaut mich verdutzt an. "Heute ist Sonntag, Sir."
Ich verstehe erst nicht, was sie meint, doch gleich darauf geht mir ein Licht auf. Wir befinden uns ja im sogenannten "Bible Belt". In Kentucky und den angrenzenden Staaten gibt es besonders viele Religionsgemeinschaften. Und die bestimmen hier die Politik.
"Sonntags kein Alkohol?"
"Sehr richtig, Sir, sonntags nicht."
Im Outback ist offensichtlich Australien das Programm, eine wirkliche Verbindung zu "Down Under" gibt es aber nicht. Die Kette gehört amerikanischen Investoren. Es war eine Marketing Idee. Das erste Outback hat aufgemacht, als die Crocodile Dundee Filme in Mode waren.
Das "Prime Minister's Prime Rib" wird serviert. Es gleicht aufs Haar dem in New York. Das ist zwar langweilig, hat aber den Vorteil, dass man genau weiß, was einen erwartet. Valerie und ich hauen rein.
Ich folge Valeries Wagen durch Ashland. Sie hat mich zum Kaffee eingeladen. Es regnet noch immer. Wir fahren an gepflegten Holzhäusern vorbei. In einem der Vorgärten stehen ein paar "Pink Flamingos", das amerikanische Pendant zum Gartenzwerg.
Wir passieren Fast-Food Restaurants, Tankstellen und dann einen Trailer-Park. Einen Trailer bekommt man schon für ein paar tausend Dollar, es ist eine Art Container mit Fenstern. Wenn man hier wohnt, ist man automatisch "Trailer-Trash".

Trailer Park
Wir biegen in Valeries Einfahrt ein. Sie wohnt in einem kleinen Zweifamilienhaus. Auf der Eingangsveranda hält sie plötzlich inne. "Heutzutage weiß man nie", sagt sie. "Kann ich vielleicht mal deinen Ausweis sehen?"
"Meinen Ausweis?"
"Nur um zu wissen, ob du die Wahrheit gesagt hast."
Ich zücke meine Ausweiskarte, auf der meine New Yorker Adresse steht. Valerie nickt. "Okay."
Valeries Sohn guckt Fernsehen, die Tochter sitzt am Computer. Er ist sechszehn, sie fünfzehn. Ich sage hallo, bekomme jedoch nur ein leicht gelangweiltes Nicken zurück. Der Sohn hat einen Ring in der Unterlippe, die Tochter trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift: Some girls do, some girls don't ... I might .
Der Sohn steht auf und geht in sein Zimmer. Kurz darauf schaltet die Tochter den Computer ab und verschwindet ebenfalls. Habe ich irgendwas falsch gemacht?
"Sie nehmen nur Rücksicht", sagt Valerie. "Schließlich braucht Mutti auch mal ein bisschen Privatsphäre."
Valerie macht Kaffee. In der Schrankwand stehen ein riesiger Fernseher und eine Stereoanlage. Daneben ein paar Fotos von Valerie in Air Force Uniform und einige Bilder ihrer Kinder, als sie noch klein waren. Ein Foto des Vaters gibt es nicht.
Eine Glastür führt auf eine Veranda und in den Garten. Dahinter beginnt schon der Wald. Idyllisch. Ich frage Valerie, ob der Kamin funktioniert.
"Klar funktioniert er", ruft sie aus der Küche, "Ich hab nur kein Holz."
Schade, jetzt wo es draußen so ungemütlich ist, würde sich ein Kaminfeuer wirklich gut machen.
"Moment, vielleicht hab ich doch was." Valerie zieht den Vorhang zu einer Abstellkammer zurück und kramt ein paar alte Bretter hervor. "Ist nicht besonders schick, brennt aber auch."
Sie drückt mir zwei Zeitungen in die Hand, und ich mache Feuer.
Wir sitzen auf der Couch, trinken Kaffee und sehen in den Kamin. Valerie erzählt, dass sie nur 400 Dollar Miete zahlt. Dafür bekommt man in New York noch nicht mal einen Autostellplatz.
"Willst du einen Brandy? Hab leider nichts Anderes im Haus."
Wir trinken Brandy.
Am Waldrand tauchen zwei Rehe auf.
"Putzig", sage ich.
"Die sind gar nicht putzig", sagt Valerie. "Wegen der Biester kann ich überhaupt nichts anpflanzen, die fressen alles weg."
Es regnet in Strömen. Ich sehe aus dem Fenster. An einer Stelle der Straße hat sich ein Teich gebildet. Ob ich da mit dem Wagen durchkomme?
"Ein Problem mit der Kanalisation", sagt Valerie. "Alles verstopft. Einmal bin ich in so einer Riesenpfütze steckengeblieben. Danach war der Motor hin. Wenn du willst kannst du hierbleiben und auf der Couch schlafen. Morgen ist bestimmt alles wieder okay."
Wir trinken noch einen Brandy und sehen ins Kaminfeuer. Ich werfe einen Blick auf Valeries Beine. Fast wie die von Jamie Lee Curtis. Sie steht plötzlich auf und holt Bettzeug. "Schöne Träume."
Sie verschwindet, und ich mache mein Bett auf der Couch. Ich kann nicht einschlafen. Die Couch ist unbequem und auch etwas zu kurz. Ich kann die Beine nicht ganz ausstrecken.
Plötzlich kommt Valerie zurück. "Unbequem?"
Ich nicke.
"Ich habe ein King Size Bett. Wenn du schön auf deiner Seite bleibst und dich benimmst, kannst du mit mir im Bett schlafen."
Wir liegen in Valeries Bett. Das Ding ist riesig und die Matratze gut gefedert. Plötzlich spüre ich ihre Hand auf meinem Oberschenkel. "Hey, hast du nicht gesagt, ich soll mich benehmen?"
"Sicher. Du, ja." Sie grinst mich an. "Aber wer hat gesagt, dass ich mich benehmen werde?"
Der nächste Morgen. Strahlender Sonnenschein. Ich bin auf dem Rückweg nach New York. Als ich durch West Virginia fahre, läuft im Radio ein Song, der irgendwie zum Thema passt: Country roads, take me home …, to the place I belong … West Virginia, Mountain mama, take me home, country roads.
Der Song ist die inoffizielle Hymne von West Virginia und der größte Hit von John Denver. Kurioserweise war John Denver vor der Aufnahme des Songs noch nie in West Virginia, und der Verfasser der Lyrics kam eigentlich aus Massachusetts. Doch West Virginia war rhythmisch einfach besser.
Wenn Valeries Kinder Schulferien haben, bleiben sie bei den Großeltern, und Valerie wird ihre Schwester in Pennsylvania besuchen. Vielleicht kommt sie dann auch mal in New York vorbei.
3. HAITI, CHERIE – Ein Land in Unruhe
Jean-Robert rast mit seinem klapperigen Jeep durch die engen, holprigen Straßen von Port-au-Prince. Es geht einen steilen Berg hoch, dann wieder runter. Wenn er nicht alle Schleichwege kennen würde, wären wir aufgeschmissen.
"Dieser gewisse Herr war ein Symbol für alle Haitianer", sagt er und meint damit Jean-Bertrand Aristide. "Wir haben geglaubt, er sei ein Schüler von Martin Luther King und Gandhi und dass er die Lösung für die Probleme Haitis ist, doch er hat sich als das Gegenteil entpuppt."
Durchs Stadtzentrum von Port-au-Prince zieht eine Demonstration. Wenn wir es nicht schaffen, zur Bank nach Petionville zu kommen, sitzen wir übers Wochenende auf dem Trockenen. Jean-Robert braucht dringend Medizin für seine achtjährige Tochter, und ohne Bargeld bin ich in Port-au-Prince aufgeschmissen. Selbst im Hotel geht ohne Cash nichts mehr. Die Telefonleitungen sind unterbrochen und Kreditkarten wertlos.
Haiti war eine Idee der Redaktion, weil das Land im Moment ständig in den Schlagzeilen ist. Haiti ist nur drei Flugstunden von New York entfernt und die Unterkunft relativ günstig. 60 Dollar die Nacht.
Die Lage im Land ist prekär. Fast jeden Tag gibt es Auseinandersetzungen, und es kann schnell gefährlich werden.

Unruhen in Port-au-Prince
Jean-Robert brettert über die Schlaglöcher. Seine Brille rutscht ihm ständig von der Nase, und er schiebt sie immer wieder hoch.
Wir passieren die Demonstration vor uns grade noch rechtzeitig und schaffen es zur Abfahrt nach Petionville. Die Stimmung im Volk ist inzwischen klar gegen den früheren Hoffnungsträger. An fast jeder Wand sehe ich das kreolische Grafitti Aba Aristide! – Nieder mit Aristide!
"Das größte Problem ist, dass man keine Gesundheitspflege bekommt, wenn man krank wird", sagt Jean-Robert. "Die meisten Kinder gehen gar nicht oder nicht viel länger als vier Jahre zur Schule. Und es gibt nicht genug zu essen, Nahrung ist einfach zu teuer. Gleichzeitig machen sich Aristide und seine Entourage die Taschen voll. "
Plötzlich tritt Jean-Robert abrupt auf die Bremse. Der entgegenkommende Jeep wäre um ein Haar frontal mit uns zusammengestoßen. Der Fahrer hupt wie ein Verrückter. Wir sitzen da wie gelähmt. Jean-Robert ist zu schnell um eine Kurve gefahren. Unser Wagen ist durch die Bremsung nah an eine Wand geschliddert. Obwohl es eindeutig Jean-Roberts Fehler war, regt sich zunächst niemand auf. Die Leute sind zu geschockt.
Jean-Robert knallt den ersten Gang rein und fährt weiter. Eine Frau ruft uns einen Fluch hinterher, und der Fahrer des Jeeps macht eine obszöne Geste in unsere Richtung.
Petionville. Wir haben es geschafft. Hier leben die meisten Ausländer, und es gibt auch eine amerikanische Bank. Doch dann eine Überraschung. Dort, wo die Bank stehen sollte, klafft eine Baulücke. Die Filiale ist vor ein paar Monaten umgezogen, doch keiner weiß, wohin. Vielleicht haben sie auch einfach ihre Koffer gepackt. Bei der heiklen Lage im Moment wäre das denkbar. Die Zeit wird knapp, und wir beschließen, es ein paar Häuser weiter bei der haitianischen Nationalbank zu versuchen.
Die Bank wird von bewaffneten Sicherheitskräften bewacht. Am Eingang werde ich durchsucht. Jean-Robert bleibt im Auto, nickt mir noch einmal kurz zu und streckt den Daumen in die Luft. " Bon chance – Viel Glück."
Das Innere der Bank ist gepflegt und kühl temperiert. Ich habe das Gefühl, mit einem Schritt die Barriere zwischen der dritten und der ersten Welt zu passieren. Die haitianischen Bankangestellten sind adrett gekleidet, die Damen dezent geschminkt.
An den Schaltern stehen lange Schlangen, und ich gehe zur Information. Vor mir sind zwei Haitianer dran, die ein Problem mit einem Scheck haben. Ein gravierendes Problem, denn die beiden sind aufgeregt. Ich ahne, dass das lange dauern könnte, denn in Haiti dauert alles lange. Sehr lange.
Doch es kommt anders. Ein Manager hat mich entdeckt – ich bin der einzige Weiße in der Bank – und kommt auf mich zu. Ich erkläre ihm, dass ich ein amerikanisches Konto habe und dass ich Geld brauche.
"Haben Sie ihren Pass dabei, Monsieur?"
Ich gebe ihm den Pass. Er geht hinter den Infostand und deutet auf eine Maschine: "Ziehen Sie die Karte durch und geben Sie Ihren PIN Code ein."
Meine Scheckkarte hat leider etwas gelitten. Zwei Tage lang hatte ich sie lose in der Tasche, in der Hoffnung irgendwo an einem Geldautomaten vorbeizukommen, nur um festzustellen, dass es in Haiti keine Geldautomaten gibt. Die Karte muss sich durch die Sonnenbestrahlung in meiner Tasche erwärmt und verbogen haben. Ich ziehe den Magnetstreifen an der Seite der Maschine entlang. Auf dem Display erscheint die Meldung: Attendez s’il vous plaît .
Ich warte.
Eine unendlich lange Zeit passiert gar nichts. Dann die Meldung: Carte invalide – Karte ungültig.
Ich versuche es nochmal. Dasselbe Resultat. Der Manager zeigt mir den Weg zur Tür.
Jean-Robert hupt wie ein Wahnsinniger, damit die Leute uns durch den Straßenmarkt lassen. Er hat in der Zwischenzeit - in schlauer Voraussicht - die neue Adresse der Citibank herausgefunden. Doch um dort hinzugelangen, müssen wir einen übervölkerten Markt passieren.

Markt in Port-au-Prince
Der Markt ist Chaos pur. Jeder baut seine Waren dort auf, wo gerade Platz ist. Die Tische sind überladen mit Töpfen, Kesseln, Nahrungsmitteln, Kleidung. Einige Frauen strecken lebende Hühner vor sich aus. Sie haben sie an den Füssen gepackt, halten sie mit dem Kopf nach unten. Einige Händler haben Planen auf der Straße ausgelegt und dort ihre Waren aufgebaut, so dass in der Mitte nur noch ein schmaler Streifen für den Durchgangsverkehr übrigbleibt.
Jean-Robert kennt keine Gnade. Er lässt den Motor aufheulen und bohrt sich unbarmherzig durch die Menge. Einige Leute springen verängstigt zur Seite. Eine Frau trägt eine schwere Last auf dem Kopf. Auch sie springt aus dem Weg, behält jedoch das Gleichgewicht.
Während wir uns durch den Markt schieben, bemerke ich neugierige Blicke. Weiße sind selten in Haiti und werden bestaunt. Ein Mädchen streicht mir über den Arm, den ich auf die Leiste des Autofensters gelegt habe. Zwei kleine Jungs zeigen mit dem Finger auf mich und rufen auf Kreolisch: "Blan, blan!" – Ein Weißer, ein Weißer!
Seltsam. Ein paar Kilometer von hier findet eine Demonstration statt, auf der möglicherweise Menschen ums Leben kommen, und hier ist davon nichts zu spüren. Man würde nie glauben, dass nicht weit entfernt eine Art Bürgerkrieg tobt.
Die Dame am Informationsstand der Citibank sieht mich bedauernd an. "Sorry, Monsieur. Ich kann Ihnen nicht helfen."
"Aber ich habe ein Konto bei der Citibank, wieso kann ich kein Geld kriegen?"
"Wir sind ein haitianischer Ableger, Monsieur, der nicht mit der amerikanischen Citibank verbunden ist. Sie können hier nur Geld kriegen, wenn sie ein haitianisches Konto haben."
Die Stimmung in der Bank ist gereizt. Die Räume sind überfüllt. Die Leute versuchen, so viel Geld wie möglich abzuheben. Ich bin kurz davor auszurasten. Endlich habe ich es in meine Hausbank geschafft, von der ich sonst fast überall in der Welt problemlos Geld bekomme, und jetzt das.
"Zwei Straßen weiter gibt es einen Geldautomaten haben Sie es da schon versucht?"
Will die Informationsdame mich abwimmeln? Ich habe schon mehrmals gehört, dass es in ganz Haiti keinen einzigen Geldautomaten gibt, und jetzt soll es nur zwei Straßen weiter einen geben? Der Herr hinter mir nickt und bestätigt, dass der Geldautomat existiert. Er ist soll sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums befinden.
Ich stehe in der Schlange vor dem Geldautomaten. Es ist der erste und einzige in ganz Haiti. Im Einkaufszentrum gibt es Läden für die Reichen - importierte Waren der Luxusklasse: Schmuck, Designerklamotten, Delikatessen. Auch hier sichern Männer mit Maschinenpistolen das Terrain.
Der Geldautomat ist auf der Rückseite der SOGE Bank, die eine Filiale im Gebäude hat. Die Schlange rückt langsam vor, und ich schöpfe wieder Hoffnung, denn der Automat gibt Geld aus. Schließlich bin ich dran und schiebe nervös meine verbogene Karte in den Schlitz. Ich habe Angst, dass die Maschine meine gewellte Karte vielleicht als defekt einzieht, doch die Angst war unbegründet. Der Automat fragt nach meiner PIN Nummer und dem Betrag, den ich abheben will. Alles geht glatt, bis es zur Auszahlung kommt: Nous sommes désolés. Cette transaction ne peut pas être conclue.
Ich versuche es nochmal mit einem niedrigeren Betrag, nur um wieder abgewiesen zu werden.
Die Menge hinter mir wird unruhig: "Monsieur, dépêchez-vous! - Hier sind auch noch andere Leute!"
"Okay, okay, ich bin fertig."
Ich gebe auf. Es war klar, dass ich kein Geld an dem verdammten Automaten bekommen würde.
Jean-Robert gießt Wasser auf ein Tuch und tupft sich Stirn und Glatze ab. Er scheint Zweifel an meiner Finanzkraft zu haben, wirkt nervös. Mir fällt ein, dass ich von einem American Express Büro Bargeld bekommen kann, wenn ich einen amerikanischen Scheck und meinen Pass vorlege. Jean-Robert macht eine müde, wegwerfende Handbewegung: "Ça ne marche pas."
Er erklärt, dass das American Express Büro auf der anderen Seite der Stadt liegt, nicht weit entfernt vom Hotel. Erstens würden wir wahrscheinlich nicht durch die Demo kommen und zweitens macht das Büro in zwanzig Minuten zu.
"Warum hast du nicht gleich gesagt, dass Amex in der Nähe des Hotels ist?"
"Du hast mich nicht gefragt, du wolltest zur Citibank."
Jean-Robert hat eine andere Idee. Ganz in der Nähe gibt es eine kanadische Nova Scotia Bank. Dort sollen einige Ausländer schon mal Geld bekommen haben. Wir müssen uns beeilen, denn Nova Scotia schließt ebenfalls in zwanzig Minuten.
Jean-Robert rast über eine holperige Straße. Die Klappe des Handschuhfachs geht auf. Er schlägt sie zu, doch kurz darauf klappt sie wieder auf. Der Wagen stottert und bleibt stehen. Kein Benzin mehr. Jean-Robert stößt einen kreolischen Fluch aus. Die Bank macht gleich zu.
Da die Filiale nur noch ein paar hundert Meter entfernt ist, beschließe ich zu rennen. Es ist heiß, und ich bin nassgeschwitzt. Die Haitianer am Wegesrand grinsen. Einer ruft auf Englisch. "Go, man, go!"
Ein Bankangestellter will die Tür gerade schließen. Auch hier stehen wieder bewaffnete Security-Leute am Eingang.
"Je vous en prie, Monsieur", bettle ich. "Laissez moi entrer!"
Der Typ mit dem Schlüssel scheint Mitleid mit mir zu haben und lässt mich rein. Meine nassen Haare klatschen am Kopf, Schweiß rinnt mir in die Augen.
In der Bank befinden sich noch einige Kunden, die abgefertigt werden. Auf einer Seite des Raums ist bereits das Licht ausgeschaltet, die Jalousien sind heruntergelassen. Ich lande wieder bei der Information und erkläre, dass ich ein amerikanisches Konto habe und 500 Dollar abheben möchte.
Die Bankangestellte erklärt mir, dass ich im Voraus 275 haitianische Gourdes – etwas sieben Dollar - bezahlen muss, damit sie einen Telefonanruf nach Kanada machen kann, um mein Konto zu verifizieren. Sollte sich herausstellen, dass irgendetwas nicht stimmt, sind die 275 Gourdes futsch. Ich krame ein paar Scheine aus der Tasche. Meine letzten 350 Gourdes.
Die Bankangestellte geht in den hinteren Bereich und wählt eine Telefonnummer. Ich schließe kurz die Augen und sammle mich. Noch nie war ich in einem so chaotischen Land, in dem fast nichts funktioniert. Die Straßen sind ein Alptraum, und ständig fällt der Strom aus. Im Hotel, für das ich immerhin 60 Dollar am Tag zahle, funktioniert das warme Wasser nicht. Auf eine Tasse Kaffee muss ich nicht selten eine dreiviertel Stunde warten, und die Versorgung ist katastrophal. Beispiel:
"Ich hätte gern ein Avocado Sandwich."
"Können wir machen, nur haben wir im Moment keine Avocados."
"Dann nehme ich einen Fruchtsalat."
"Muss ich nachfragen, Moment. – Pardon, aber Früchte kommen erst morgen wieder".
Und das in einem Land, in dem es Avocados und Früchte eigentlich im Überfluss geben müsste. Doch die herrschende Elite hat das Land abgewirtschaftet. Es ist mit Abstand das ärmste in der westlichen Hemisphäre.
"Okay", sagt die Bankangestellte und gibt mir meinen Pass zurück. "Ihr Konto ist in Ordnung."
Dann eine neue Hürde: Sie versucht die erhöhten Nummern meiner Karte mit einer mechanischen Kreditkartenmaschine auf ein Kohlepapier-Formular durchzupausen. Doch da das Plastik verbogen ist und die Karte nicht sauber aufliegt, streikt die Maschine. Die Bankangestellte versucht es erneut, rutscht aus und murmelt etwas auf Kreolisch. Ich biete an, die Karte mit beiden Zeigefingern auf die Unterlage zu drücken, während sie den Schlitten der Maschine über das Formular zieht. Wir arbeiten uns gemeinsam Millimeter für Millimeter vor. Schließlich erscheinen die Nummern auf dem Papier.
Ich bekomme einen Zettel mit einer Wartenummer und darf in den abgesperrten Bereich. Dort befindet sich eine vergittere Tür, die von einem Sicherheitsmann bewacht wird. Vor der Tür kauert eine Frau, die den Inhalt ihrer Handtasche auf dem Boden ausgeleert hat: Schlüssel, Sonnenbrille, ein paar zerknitterte Geldscheine, Schminkutensilien, eine Packung Tampons. Hat sie ihre Wartenummer verloren?
Im hinteren Bereich der Bank entdecke ich ein paar ausrangierte Safetüren und ein kaputtes Toilettenbecken. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder kein Geld bekommen werde.
Doch als ich dran bin, schiebt mir der Mann im Sicherheitsbereich fünf Hundert-Dollar-Scheine durch die Öffnung im Panzerglas. Ich bin überrascht, denn bisher habe ich im Ausland immer nur Geld in der Landeswährung bekommen. Ausgerechnet fünf Hunderter. Ich möchte es etwas kleiner haben, doch es gibt kein Wechselgeld. Sind die Hunderter vielleicht falsch?
Ich bin wieder draußen. Die fünf Hunderter stecken in meiner Unterhose. Jean-Robert hat einen Typen aufgetrieben, der uns bis zur nächsten Tankstelle schleppen wird. Der Wagen, der uns mit einem fusseligen Hanfseil zieht, ist ein verrosteter Lada. Obwohl wir auf einer relativ ebenen Straße sind, fährt dieses Fossil quasi ständig durch Schlaglöcher, denn die Räder sind verbogen und eiern. Außerdem hat der Motor Zündaussetzer, und der Auspuff feuert alle paar Sekunden eine schwarze Rauchwolke. Das Rückfenster hat einen Riss und wird an der kritischen Stelle mit einem Aufkleber zusammengehalten. Darauf steht: Jesú est le sauveur – Jesus ist der Retter.
Wir tanken zwei Liter Benzin mit meinen letzten 75 Gourdes. Natürlich kann niemand hundert Dollar wechseln.
Jean-Robert fährt in das Viertel mit den Schwarz-Wechslern. Hier kriegt man 42 Gourdes für einen Dollar, im Hotel zahlen sie nur 35. Wir halten an einem heruntergekommenen Haus im Kolonialstil. Jean-Robert hupt dreimal. Kurz darauf taucht ein Typ auf, der einen Schlapphut mit der Aufschrift "Yogi Bear" trägt.
Ich ziehe drei Hunderter aus der Tasche, und der Wechsler prüft sie gegen das Licht. Wenn sich jetzt herausstellt, dass mir die Bank Blüten angedreht hat, bin ich erledigt. Jean-Robert würde mich erwürgen.
Der Wechsler macht mit einem schwarzen Filzstift einen Strich auf jeden Schein und reibt mit dem Daumen über die markierte Stelle. Schließlich drückt er mir ein dickes Bündel mit abgegriffenen Gourde-Noten in die Hand und lässt mich nachzählen. Es dauert ewig, denn es sind mindestens zweihundert Scheine.
Eine halbe Stunde später sitze ich mit Kimmy, einer Fotografin aus Miami, auf der Veranda vor unseren Zimmern und trinke einen Scotch. Wir wiegen uns in Schaukelstühlen, sind umgeben von tropischer Vegetation und sehen in der Ferne das Meer. Langsam lässt die Anspannung in meinem Kopf nach, und ich fühle mich relaxt.

Hotel Oloffson – Veranda mit Schaukelstühlen
Das Hotel Olofsson - ehemals eine herrschaftliche Residenz mit dem Charme einer vergangenen Epoche – liegt auf einer Anhöhe. Alles ist noch so wie Ende des 19. Jahrhunderts, nur hier und da wurde mal übergestrichen.
Kimmy nippt an ihrem Drink und atmet einmal tief durch. Sie war unterwegs, um die Unruhen zu fotografieren, und ich sehe ihr an, dass sie ähnlich erschöpft ist, wie ich. Sie arbeitet freiberuflich für den Miami Herald und ist im Oloffson gelandet, weil sie von der Geschichte des Hotels gelesen hatte.
"Das Ambiente ist magisch, finde ich," sagt sie. "Man spürt die Leute, die hier gelebt und gearbeitet haben, es ist mehr als ein Hotel, mehr als nur ein Kolonialbau."
Stimmt. Beispielweise wohnt Kimmy im "Graham Greene" Zimmer und ich wohne im "Mick Jagger" Zimmer.
Kimmy trägt ein weißes Männerhemd und Militärhosen mit Seitentaschen. Sie hat einen burschikosen Kurzhaarschnitt.
"Damit das gleich klar ist," sagt sie. "Ich steh' auf Frauen, ok?"
Ich kippe meinen Scotch ab und gehe in mein Zimmer. Über dem Bett hängt ein Bild von Mick Jagger. Er sitzt auf der Veranda des Hotels in einem ähnlichen Schaukelstuhl, in dem auch ich grade gesessen habe. Unter dem Foto ist sein Autogramm. Ich gehe etwas näher ran. Das Bild ist eine Fotokopie, klar. Ein Original würde wahrscheinlich geklaut werden.
Ich sehe auf mein Bett. Ist das wirklich das Bett in dem auch Jagger gepennt hat? Möglich wäre es. Der Rahmen besteht aus massivem Holz, und das hält ewig. Nur die Matratze haben sie wahrscheinlich ausgewechselt, obwohl ich mir da nicht so ganz sicher bin, denn das Ding scheint uralt zu sein und ist in der Mitte durchgelegen. Theoretisch könnte es sogar noch dieselbe sein, auf der Mick sich mit Bianca vergnügt hat.
Ich gehe runter an den Pool und nehme an der Bar noch einen Drink. Über die Soundanlage läuft "Haiti, Cherie" von Harry Belafonte.
Das Wasser des Schwimmbeckens kommt aus dem Maul eines steinernen Fisches gesprudelt, der am Kopfende des Pools installiert ist. Das Hotel Oloffson und sein Pool sind deshalb berühmt, weil Graham Greene hier seinen Spionagethriller Die Komödianten geschrieben hat. In einer Szene des Buches findet sich ein Toter im Schwimmbecken.

Pool im Hotel Oloffson
Die Komödianten wurde mit Richard Burton und Elizabeth Taylor in den Hauptrollen verfilmt und hat das Hotel international bekannt gemacht. In den sechziger Jahren ist dann auch Mick Jagger vorbeigekommen. Er soll damals sogar spontan im Hotel aufgetreten sein.
"Noch einen Drink?"
Ich nicke und die Bedienung schenkt mir noch einen Scotch ein. Ich habe mich mit Kerline angefreundet, denn sie arbeitet an der Poolbar. Sie ist 28 und hat einen achtjährigen Sohn. Kurz vor der Geburt des Kindes hat sich der Vater verabschiedet und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden, was in Haiti ziemlich häufig vorkommt.
Kerline schiebt mir eine Serviette über den Tresen, auf die sie ein paar Sätze in holprigem Englisch gekritzelt hat. Sie schreibt, dass sie Mitglied einer Tanztruppe ist, gern ins Kino geht und Englischunterricht nimmt.
Sie zeigt mir ein Foto von einer Freundin, die einen Amerikaner geheiratet hat und inzwischen in Texas lebt. Zuerst ist mir Kerline nicht besonders aufgefallen, doch jetzt, wo ich sie schon ein paar Tage kenne, finde ich, dass sie eigentlich hübsch ist.
Haiti hat eine turbulente Geschichte. Zusammen mit der Dominikanischen Republik liegt es auf der Karibikinsel Hispaniola. Santo Domingo wurde von Kolumbus entdeckt und war die erste europäische Siedlung auf dem amerikanischen Kontinent.
Ursprünglich war die gesamte Insel eine spanische Kolonie, doch 1625 wurde ein Drittel von den Franzosen übernommen. Sie brachten afrikanische Sklaven mit und bauten Kaffee und Zuckerrohr an – ein sehr profitables Geschäft. Kleines Problem: Das Verhältnis von Sklaven zu Franzosen war 10 zu 1, und 1804 kam es zu einem erfolgreichen Aufstand.
Haiti wurde nach den Vereinigten Staaten das zweite freie Land in der westlichen Hemisphäre. Die Macht wurde von den hellhäutigen Nachkommen französischer Kolonisten und Sklavinnen übernommen, die etwa 10% der Bevölkerung ausmachten. Und das ist auch heute noch Teil des Problems: Macht und Geld sind in den Händen einiger weniger Korrupter.
"Une bière, s'il vous plait", sagt Kimmy.
Die Fotografin aus Miami steht an der Bar. Sie hat sich umgezogen und trägt jetzt Bermuda-Shorts und ein weißes Männerunterhemd. Sie läuft barfuß. Ich hatte keine Ahnung, dass Kimmy so gut Französisch spricht. Für eine Amerikanerin recht ungewöhnlich.
Kerline gibt ihr das Bier. Kimmy nimmt einen kräftigen Schluck aus der Flasche und springt dann mit einer Arschbombe in den Pool. Das Wasser spritzt bis zur Bar.
"Sie guckt mich immer so an," flüstert Kerline. "Irgendwie ist mir das unangenehm."
Plötzlich taucht Richard auf, der Manager des Hotels. Ich schätze ihn auf Anfang vierzig. Sein Vater ist Haitianer, seine Mutter Amerikanerin, und er ist in Connecticut aufgewachsen. Er ist etwas untersetzt und trägt Dreadlocks, die ihm bis über die Schultern fallen. Er ist der Leadsänger einer Band, die haitiweit bekannt ist. Ein passender Manager für ein Künstlerhotel.
"Ein Wasser," sagt er auf Französisch zu Kerline. Doch plötzlich ändert er seine Meinung. "Ah, putain, gib mir einen Rotwein."
Richard hat ein Notizbuch dabei. "Ist mir tierisch peinlich, denn dein Zimmer ist ja schon im Voraus bezahlt, doch in der jetzigen Situation brauchen wir dringend Cash. Könnte ich vielleicht die Extra-Kosten kassieren?"
Das Frühstück ist im Zimmerpreis inbegriffen, doch ich habe auch oft im Hotel zu Mittag und zu Abend gegessen. Außerdem sind da die Drinks. All das ging bisher auf meine Zimmernummer.
"Wieviel?"
Richard zeigt mir einen Zettel. Die Preise sind höher als ich erwartet hatte. Ich zahle ihn aus.
"Danke, Mann," Richard trinkt seinen Rotwein aus, klopft mir kurz auf die Schulter und geht zu Kimmy, die inzwischen unter dem Fisch steht, der das Wasser in den Pool spuckt.
Kerline hat Feierabend, und wir gehen zu einem Protest- Konzert, das in einem Park nicht weit vom Hotel stattfindet. Zwischen den Zuschauern sitzen Typen, die Bier verkaufen, das sie in Plastikeimern mit Eis kühlen. Ein paar Frauen bieten Fleisch-Spieße an, ein kleiner Junge verkauft Süßigkeiten. Ich bin wie immer der einzige Weiße und werde bestaunt.
Es ist ein Konzert, das von der Opposition organisiert wird. Ein Transparent hinter der Bühne fordert freie Wahlen.
Die Band spielt Twoubadou , ein Haiti-eigenes Musikgenre. Es ist das kreolische Wort für Troubadour. Wie die Lieder der mittelalterlichen Sänger handelt das haitianische Twoubadou von Liebe, oft mit suggestiven und anstößigen Texten.
Der Name der Band ist Ti-Coca , was auf kreolisch "Kleine Cola" heisst. Irgendwie ein seltsamer Name, aber die Band ist gut und scheint auch sehr bekannt zu sein. Das Lied heißt "Twa Fey". Keine Ahnung, was das bedeutet, aber der Song geht ins Blut. Die Musiker haben es raus, LEISE zu spielen. Im Publikum sind mehr als tausend Menschen, und alle sind still und lauschen. Ein sehr intimer Moment. Einige Paare beginnen Wange an Wange zu tanzen.
Kerline steht auf und bewegt sich im Rhythmus. Sie nimmt meine Hand und zieht mich hoch. Wir bewegen uns gemeinsam zur Musik. Nach einer Weile habe ich den Schritt raus, und Kerline grinst. "Hey, du kannst ja tanzen."
Plötzlich eine Explosion, klirrendes Glas und Schreie.
Kerline schnappt meine Hand und fängt an zu rennen. Ein paar Typen haben Molotow-Cocktails in die Menge geschmissen. Wahrscheinlich Agenten der Geheimpolizei.
Wir hetzen in eine Seitenstraße, in der es vollkommen dunkel ist. Ganz Port-au-Prince ist nachts dunkel, denn es gibt nur in der Nähe des Präsidentenpalastes ein paar Laternen.
Kerline führt mich über Schleichwege zurück zum Hotel. Wir umarmen uns spontan, und ich spüre ihr Herz schlagen.
"Ich weiß, dass du nicht wiederkommen wirst", sagt sie. "Keiner kommt wieder. Wegen dieser verdammten Gewalt."
Sie macht sich von mir los und verschwindet in der Dunkelheit. An der Hotelbar läuft "Haiti, Cherie." Anscheinend spielen sie immer wieder dieselbe CD.
4. EIN TÜRKE IN NEW YORK – Die Welt von Hausmeister Jimmy
Ich sitze mit Jimmy im Heizungskeller. Er ist Türke und ein Geschenk des Himmels, denn er leiht mir 50 Dollar. Gelegentlich bekomme ich meine Journalistenhonorare erst mit Verspätung, und im Moment bin ich blank. Jimmy war noch nie in Deutschland, spricht kein Wort Deutsch und ist trotzdem eingefleischter Deutschlandfan. Ohne ihn wäre ich aufgeschmissen, denn finanziell sieht es bei mir ziemlich eng aus. Und genau deshalb wohne ich auch in diesem Industriegebäude im Garment District, das eigentlich zum Wohnen gar nicht zugelassen ist.

Garment District in New York
Jimmy trägt seine Hausmeister-Uniform: eine dunkelblaue Arbeitshose und ein blauweiß gestreiftes Hemd. Der Heizungskeller ist komplett in Industrie-Grau gestrichen, auch der Boden und die Decke. Irgendwie praktisch, denn man braucht beim Streichen auf keine graden Kanten zu achten.
An einem Blechschrank klebt eine Liste mit den nationalen Feiertagen und das Pin-Up einer Blondine.
Über uns ziehen sich unzählige Rohre an der Decke entlang und gelegentlich zischt es, doch Jimmy meint, das ist normal.
Über Freunde bin ich hier in einer Fabriketage untergekommen, die als Aufnahmestudio einer Jazzrockband fungiert. Ich bin sozusagen der Wachmann für das Equipment im Studio, denn außer mir wohnt niemand im Gebäude.
Jimmy nippt an seinem Bier. "Als ich das erste Mal von Deutschland gehört habe, war ich noch ein Kind. Ein paar meiner Verwandten haben in Deutschland gearbeitet, in Köln, Berlin, Frankfurt. Na ja, und sie haben damals diese Radios mitgebracht und elektronische Sachen. Das absolut beste Gerät zu der Zeit war das Grundig Kurzwellen-Radio, es war sehr, sehr begehrt als Geschenk. Und dann waren da noch die Autos. Es gab Typen die sind mit nichts nach Deutschland gegangen, und mit einem Mercedes zurückgekommen. War ein gebrauchter, klar, aber ein Mercedes. Und mit einem Diesel Motor laufen die praktisch ewig."
Natürlich heißt Jimmy eigentlich nicht Jimmy, sondern Hayrun, doch wir sind eben in New York, und da ist für komplizierte Namen keine Zeit. Nach einigen vergeblichen Versuchen seiner Kollegen, sich den türkischen Namen zu merken, haben sie ihn kurzerhand Jimmy getauft. Er sieht auch eigentlich nicht aus wie ein Türke, eher wie ein Mongole.
"Meine Vorfahren kommen aus Turkestan, einer Gegend in China", sagt Jimmy. "1948 sind sie in die Türkei gekommen. Ich bin in der Türkei geboren, sehe aber asiatisch aus. Meistens denken die Leute, dass ich ein Chinese bin oder sowas, doch natürlich bin ich Türke. Absolut 100% Türke."
Wir trinken ein Beck’s Bier, denn Jimmy schwört einfach auf alles, was deutsch ist. Früher hat er immer Heineken getrunken in der Annahme, es komme aus Deutschland. Erst vor kurzem hat er das Kleingedruckte auf der Flasche entziffert und herausbekommen, dass Heineken aus Holland stammt. Danach ist er auf Beck’s umgestiegen.
"Also vor zwei Jahren hatte ich wahnsinniges Glück", sagt Jimmy. "Eines Tages lauf' ich in Coney Island rum. Es gibt da einen Flohmarkt, und an einem Stand entdecke ich einen Grundig Weltempfänger. Obwohl das Radio ungefähr 25 Jahre alt ist, weiß ich: das ist ein top Gerät. Ich checke die Rückseite, und da steht Made in West Germany . - Ich frage: Wieviel? Der Typ sagt, 40 Dollar, das Radio funktioniert einwandfrei. - Ich sage: 40 Dollar ist zu teuer, wir sind hier auf dem Flohmarkt, ich gebe dir 5 Dollar. Er sagt erst nein, aber als ich gehen will, ruft er mich zurück: Okay, es gehört dir."

Grundig Weltempfänger
Der Heizungskeller ist Jimmys Reich. Hierhin zieht er sich zurück, wenn er Pause hat, hört Musik, liest Zeitung und zischt gelegentlich ein Bierchen. Eigentlich darf er bei der Arbeit kein Bier trinken, doch nach sieben ist kaum mehr jemand im Gebäude.
Das 15-stöckige Gebäude mit seinen über 30 Firmen wirft so einiges ab, vor allem, wenn jemand auszieht. Alles, was noch irgendwie verwertbar ist, verkloppt Jimmy weiter. Im Haus gibt es Import-Export Geschäfte, eine Marketingagentur, zwei Kleiderhersteller, einen Zeitungsverlag, ein Fotostudio und eine Firma, die Kronleuchter anfertigt. Und dann natürlich noch das Musikstudio, in dem ich die Abstellkammer belege. Das Gebäude ist ein Universum für sich. Jimmy hat sich einmal die Mühe gemacht, alle Nationen im Haus zu zählen. Er ist auf über dreißig gekommen. Sogar ein Maori aus Neuseeland ist dabei.
Wir fahren mit dem Lastenaufzug aufs Dach. Obwohl ich im Gebäude wohne, war ich dort noch nie, denn man kommt nur mit einem Spezialschlüssel dorthin.
Das Fabrikgebäude wurde in den zwanziger Jahren gebaut und ähnelt einer Burg. Die 15 Stockwerke verjüngen sich nach oben hin, und in den höheren Etagen gibt es sogar Terrassen.
Auf dem Dachgarten haben wir einen Rundumblick auf die Skyline von Manhattan. Fast alle Gebäude in der Gegend gleichen mittelalterlichen Burgen, nur dass sie viel grösser und höher sind. Die verwitterten Fassaden sind mit Stuck verziert, einige Dächer haben sogar Zinnen.
Vom Dachgarten aus kann man auch in die Fenster der umliegenden Gebäude blicken. In den meisten Stockwerken sind Büros oder Werkstätten, doch in manchen Fabriketagen wird auch gewohnt. Die riesigen Lofts sind heiß begehrt, denn man lebt mitten in der Stadt mit viel Platz.
In den Siebziger Jahren war die Gegend um den Madison Square Garden und die Penn Station so gefährlich, dass Firmen scharenweise abgewandert sind. Um Leerstand zu vermeiden, haben die Hausbesitzer an Künstler vermietet, obwohl die Fabriketagen eigentlich nicht zum Wohnen zugelassen sind.
Jimmy zeigt rüber in die 28. Straße. Dort liegen seine Anfänge in New York, denn dort hatte er mit seinem älteren Bruder Akif eine Lederwerkstatt. Spezialität: Motorradjacken. Akif ist über die Greencard Lotterie in die USA gekommen und hat schließlich einige Familienangehörige nachgeholt. Unter anderem auch Jimmy.
"Die absolut besten Nähmaschinen kommen von Pfaff", sagt Jimmy. "Natürlich aus Deutschland. Die Maschine ist unverwüstlich. Wenn du einmal mit einer Pfaff 545 gearbeitet hast, willst du keine andere mehr."

Industrielle Pfaff Nähmaschine 545
Jimmy sagt, dass die Pfaff Maschinen die besten, aber auch die teuersten sind. Irgendwann haben die Japaner Maschinen entwickelt die fast genauso gut sind, aber ein Drittel weniger kosten.
"Wir konnten es nicht fassen", sagt Jimmy. "Beide Maschinen sind sich wahnsinnig ähnlich, weil die Japaner natürlich abgekupfert haben. Wie haben sie es geschafft, so viel billiger zu produzieren?"
Jimmy sieht mich fragend an. Natürlich weiß ich die Antwort nicht.
"Wir haben die Maschinen aufgemacht und reingeguckt. Bei der deutschen Maschine war das Blech auch innen emailliert und alle Teile aus Edelstahl. Bei den Japanern war innen alles roh."
Und genau deshalb ist Jimmy ein beinharter Deutschlandfan.
Er hat Vertrauen in deutsche Produkte gewonnen. Im Prinzip könnte man ihn fast als Werbeträger einsetzen. Und dieses Vertrauen hat sich irgendwie auf mich übertragen. Sonst hätte er mir wahrscheinlich nicht die 50 Dollar geliehen. Natürlich hat er keine Ahnung, dass sich das mit dem Vertrauen in jüngster Zeit etwas verwässert hat. Auf höherer Ebene gibt es im Moment ständig Korruptionsskandale in Good Old Germany. Doch das sage ich ihm lieber nicht, denn dann will er vielleicht seine 50 Dollar wiederhaben.
Ich frage ihn, was aus der Lederwerkstatt geworden ist.
"Im Prinzip dasselbe Problem wie mit den Pfaff Maschinen", sagt Jimmy. "Die Hersteller in Asien haben ähnliche Motorradjacken viel billiger angeboten. Unsere waren besser, aber irgendwann war die Konkurrenz zu groß.
Ein schöner Samstagnachmittag.
Jimmy und ich fahren mit der U-Bahn rüber nach Brooklyn. Er will mir sein Zuhause zeigen. Der Q-Train rattert über die Manhattan Bridge und überquert den East River. Unter uns fahren ein paar Schiffe durch, und in der Ferne kann man die Freiheitsstatue erkennen.

Manhattan Bridge
Jimmy hat eine Drei-Zimmer-Wohnung in Sheepshead Bay. Außer seiner Frau und seinen beiden Töchtern wohnt dort auch noch seine Mutter. Von Manhattan dauert es mit der U-Bahn fast zwei Stunden bis hier her.
Auf dem Großbild-Fernseher läuft die türkische Hitparade über Satellit. Jimmy hat sich mit alten Lautsprechern eine Surround-Sound Anlage gebastelt. Wenn man sich richtig positioniert, hat man tatsächlich das Gefühl, dass man mitten im Konzertsaal sitzt.
Im Wohnzimmer stehen drei identische rot-gold gestreifte Sofas in einer Hufeisenformation um den Fernseher. Ich habe noch nie ein Wohnzimmer mit drei Sofas gesehen, doch irgendwie sieht es gar nicht schlecht aus. Es macht sich gut, wenn Besuch kommt.
Während Jimmy im Nebenzimmerzimmer verschwindet, serviert seine Frau mir ein Glas Tee. Sie ist Ende dreißig, wirkt aber eher wie fünfzig, was vielleicht auch daher kommt, dass sie ein Kopftuch trägt. Sie lächelt mir zu, doch eine Konversation ist nicht drin, denn sie spricht kaum Englisch.
Jimmys Mutter setzt sich zu uns. Auch sie trägt ein Kopftuch. Sie hat dieselben asiatischen Gesichtszüge wie ihr Sohn, und einer ihrer Schneidezähne ist aus Gold.
Jimmy kommt mit seinem Grundig Weltempfänger an. Jetzt hat er natürlich türkisches Satellitenfernsehen, doch in seiner Anfangszeit in Amerika war das Radio sein einziger Draht zur Heimat. Jimmy küsst das Gerät und hält es in die Luft. Auch jetzt benutzt er es noch häufig. Vor allem, wenn es ein wichtiges Fußballspiel in der Türkei gibt. Dann nimmt er das Radio sogar mit zur Arbeit.
Plötzlich kommen Jimmys Töchter nach Hause. Die ältere der beiden ist neunzehn und eine Schönheit.
"Wir wollen, dass Shirin heiratet", sagt Jimmy. "Aber sie mag einfach keinen, den wir ihr vorstellen."
"Ja, klar", sagt Shirin. "Weil sie nicht zu mir passen, ganz einfach."
"Wir wollen sie nicht zwingen", sagt Jimmy. "Und es muss nicht unbedingt ein Türke sein, aber unsere Tradition verlangt einen Muslim. Es muss ein Muslim sein."
"Aber ein Konvertit würde auch gehen", sagt Shirin. "Oder?"
Jimmy verzieht das Gesicht: "Zur Not, ja. Hauptsache er ist Muslim."
Ich will wissen, wie das abläuft mit der Konvertierung.
"Ist ganz einfach," sagt Shirin und zieht eine Broschüre aus ihrer Handtasche. "Hier steht's drin."
Ich werfe einen Blick auf die Bedingungen. Ist tatsächlich überraschend einfach. Im Prinzip muss man nur erklären, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohamed sein Prophet ist. Und das auf Arabisch. Der arabische Satz steht in der Broschüre, man muss ihn nur nachsprechen.
"Äh, wenn ich den Satz jetzt sprechen würde, dann wäre ich also bereits ein Muslim?"
Shirin nickt. Komischerweise steht nichts von Beschneidung in der Broschüre. Ich dachte immer, man müsste auch beschnitten sein. Ich behalte die Frage für mich. Sie passt nicht in die Runde.
Jimmy stellt den Weltempfänger auf ein Regal. "Lass uns ein bisschen rausgehen. Will dir meine Freunde vorstellen."
Wir nehmen den Aufzug und landen im … Heizungskeller. Haki, der Hausmeister ist ebenfalls Türke und hat nach und nach immer mehr türkische Mieter ins Haus gebracht. Dennoch sind die meisten der Bewohner Russen, denn Sheepshead Bay, ähnlich wie das angrenzende Brighton Beach, wird von Russen dominiert.
Doch der Heizungskeller ist fest in türkischer Hand. Oder besser gesagt in pan-türkischer Hand, denn die Türken hier kommen nicht nur aus der Türkei, sondern aus allen Ecken des ehemaligen Osmanischen Reiches: Rumänien, Bulgarien, Ukraine, Aserbeidschan, Turkmenistan. Ihre Verbindung ist die türkische Sprache. Obwohl in den Ländern verschiedene türkische Dialekte gesprochen werden, kann man sich ohne Probleme verständigen.
"Unser Heizungskeller ist eine Art türkisches Clubhaus", sagt Jimmy. "Ein paar Gartenstühle, ein Kühlschrank und Musik, mehr braucht es dazu eigentlich nicht."
Die nackten Betonwände fallen irgendwann nicht mehr auf, denn die ausgelassene Runde erzählt sich bei Raki und Bier Abenteuer aus aller Welt. Jimmy genießt die familiäre Atmosphäre. Außerdem kann er hier trinken. Zu Hause rührt er keinen Alkohol an.

Raki und Bier
Ständig kommen neue Typen rein, bringen türkische Leckereien und Getränke mit. Natürlich ist der Heizungskeller eine reine Männerangelegenheit. Undenkbar, dass hier eine der türkischen Ehefrauen auftauchen würde.
Ich sage, dass ich aus Berlin komme und dort sogar ein paar Worte Türkisch aufgeschnappt habe. Zum allgemeinen Erstaunen weiß ich, was otuz-bir bedeutet. Otuz-bir heißt wörtlich einfach nur "31", hat aber auch noch schlüpfrige Bedeutung, die in einer türkischen Männerrunde ein garantierter Lacherfolg ist. Sie können alle kaum fassen, dass ich den Bingo-Witz kenne, bei dem die Gewinn-Nummer ausgerechnet otuz-bir ist.
Im Radio läuft ein türkischer Hit, und einige der Männer singen mit. Ich bin schon etwas betrunken. Bier und Raki, Raki und Bier. Eine ziemlich potente Mischung. Mir geht Jimmys hübsche Tochter nicht aus dem Kopf.
"Wie ist das eigentlich mit der Beschneidung?"
"Beschneidung?"
"Ja, ein echter Muslim muss doch beschnitten sein, oder?"
Jimmy nickt.
"Also nicht einfach nur der Satz …"
Jimmy nimmt einen Schluck Raki. "Nein. Der Imam checkt dich durch. Der will Beweise sehen, dass du es ernst meinst."
"Tut das weh mit der Schnippelei?"
"Ich war ja noch ein Kind und kann mich kaum dran erinnern", sagt Jimmy. "Aber ich kenne einen Fall, ein erwachsener Konvertit, der konnte dann zwei Wochen lang nicht laufen …"
5. GELIEBTE MUMPIES – Dick sein ist schön: auf Jamaika
"Gut, ich bin ein schlanker Mann," sagt Charles, "aber ich mag einfach dicke Frauen. Ich mag sie fleischig, kräftig mit einem großen Hinterteil, verstehst du? Das turnt mich total an. Also eine dünne Frau hat absolut keine Chance bei mir."
Ich fahre mit Charles in seinem Minibus durch Downtown Kingston. Charles ist 49, könnte aber auch für 35 durchgehen. Ein drahtiger Kerl mit einem verschmitzten Lächeln. Das Weiße in seinen Augen schimmert bräunlich, denn er zieht sich alle paar Stunden eine Tüte Ganja rein. Zum Relaxen, wie er sagt.
Ich bin einem seltsamen Phänomen auf der Spur. Ganz im Gegensatz zum weltweiten Trend liebt es der jamaikanische Mann fleischig. Wenn es in Amerika heißt: "You can never be thin enough!", würde das jamaikanische Motto lauten: "You can never be fat enough!"
"Wir jamaikanischen Männer reagieren einfach gut darauf, wenn sie dick sind", sagt Charles. "Oder zumindest viele von uns. Wenn wir zum Beispiel sagen würden: Alle, die dicke Frauen mögen, auf die eine Seite, alle, die schlanke Frauen mögen, auf die andere, dann ist es ganz klar, dass viel mehr Männer auf der Seite für die dicken stehen."
Der Minibus holpert über eine unebene Straße. Kingston ist heruntergekommen. Einige Häuser sind eingefallen oder ausgebrannt, auf freien Flächen haben sich ein paar Leute Holzhütten gezimmert. An jeder Ecke gibt es kleine Märkte, wo von der Banane bis zur Autobatterie fast alles verkauft wird. Viele Leute laufen barfuß.
"Da, ein Mumpy !" ruft Charles. Er deutet in Richtung einer Bushaltestelle, und seine Augen beginnen zu glänzen. Ich verstehe nicht, was er meint. Ein Mumpy ? Was ist ein Mumpy ?
"Na ja, wir haben verschiedene Ausdrücke für die Dickerchen. Einige nennen sie einfach Fatty , aber die meisten sagen Mumpy . Einige sind sehr fett, aber sie sehen gut aus. Wenn sie gute Proportionen haben, dann sprechen ziemlich viele Männer auf sie an."
Ich schaue rüber zur Bushaltestelle. Die meisten Frauen dort sind schlank, doch eine hat enorme Ausmaße, vor allem der Hintern. Ist das ein Mumpy?

Mumpy-Proportionen
Charles nickt enthusiastisch. "Ja, Mann! Aber das ist noch gar nichts, warte, bis du Melody siehst."
Wir fahren am Hafen von Kingston vorbei. Es ist der siebtgrößte Hafen der Welt und hat gigantische Ausmaße. Kingston ist einer der größten Umschlagplätze für Öl in der Karibik. Es riecht nach Bier. Eine holländische Brauerei hat hier einen Ableger. Sie brauen unter anderem die jamaikanische Marke "Red Stripe".
Umgeben von den malerischen Blue Mountains, ist Kingston selbst zu großen Teilen eine hässliche Industriestadt. Zum nächsten Strand braucht man mit dem Auto fast zwei Stunden. Die Hauptstadt hat nichts von dem Inselparadies, das man sich unter Jamaika vorstellt.
Melody ist nicht zu Hause. Stattdessen treffen wir ihre Cousine Taneesha. Sie ist hübsch und gertenschlank und sieht ein bisschen aus wie Naomi Campbell. Ich frage sie nach den Präferenzen der jamaikanischen Männer.
"Stimmt schon, viele Männer mögen lieber dicke Frauen", sagt sie. "Und manchmal, wenn ich die Straße entlanggehe, dann rufen sie: 'Hey, Magermädchen'. Das ist so ihr Spruch. Sie sagen: 'Du bist einfach zu dünn.' die meisten Jamaikaner wollen eine dicke, eine sehr dicke Frau."
Wir sitzen in einem Straßencafé und warten auf Melody. Charles will sie mir unbedingt vorstellen. Das Café ist mehr oder weniger ein Loch in der Wand mit ein paar Plastikstühlen davor. Hinter der abgegriffenen Theke stehen ein alter Kühlschrank und ein Glaskasten mit Zigaretten.
Die Besitzerin hat zwei Schneidezähne aus Gold und ein blutunterlaufenes Auge. Sie ist kräftig gebaut, mit ausladender Oberweite. Charles kennt sie und hat sie gleich umarmt. Er trinkt ein Red Stripe Bier und zündet sich einen Ganja Joint an - und das, obwohl er als Taxifahrer arbeitet.
"Also, meine Mutter, die ist klein und dick", sagt Taneesha. "Und sie hat große Brüste. Und meine Schwester ist auch dick. Sie nehmen diese Hühnerpillen, die machen deine Brüste und deinen Hintern größer."
Taneesha hat auch versucht zuzunehmen. Sie hat Burgers und Pommes Frites gefuttert, aber kein Gramm zugenommen. Sie hat auch die Hühnerpillen probiert, doch sie verträgt die Hormone nicht. Sie bekommt Kopfschmerzen, Durchfall, und ihr wird schwindlig.
Die Hühnerpillen sind dazu da, in relativ kurzer Zeit Geflügel zu mästen, sie enthalten Testosteron, das in großen Dosen zu Brustkrebs führen kann. Die Pillen werden in Geschäften für Tierfutter verkauft. Ein Dutzend kostet umgerechnet etwa 12 Dollar.

Markt in Kingston
Taneesha sagt, dass es vor kurzem zu einem Engpass gekommen ist. Die Hühnerpillen waren in ganz Kingston ausverkauft. Die Tierfuttergeschäfte verlangen jetzt den Nachweis, dass die Käufer der Pillen auch tatsächlich eine Hühnerfarm haben. Was wiederum dazu geführt hat, dass viele Frauen nun zu Hause Hühner halten, um offiziell als Hühnerzüchter zu gelten.
Melody ist plötzlich im Straßencafé aufgetaucht. Sie kommt vom Einkaufen, schleppt zwei große Tüten. Sie ist ganz in weiß gekleidet: weiße, knallenge Jeans und ein weißes T-Shirt. Melody ist gewaltig: ich schätze sie auf 150 Kilo bei einer Größe von vielleicht 1,55 Meter.
Melody hat einen reichen Freund, der zwar verheiratet ist, es sich aber leisten kann, sie noch zusätzlich auszuhalten.
Charles streicht zärtlich über ihre Wange. "Sie ist nicht nur ein Mumpy, sie ist auch noch ein Browny, ein Mumpy-Browny sozusagen."
Ein Browny? In den USA ist das ein Schokoladenkeks. Was ist ein Browny in Jamaika?
"Ein Browny ist eine Frau mit heller Haut", sagt Melody, "also eben nicht dunkel. Wenn deine Hautfarbe nicht schwarz ist, sondern eher hell."
"Die Cremes heißen Mercury oder Lexus", sagt Taneesha. "Wir mixen die Cremes zusammen, füllen sie in ein Glas und schmieren uns damit zweimal am Tag ein. Davon bekommt man dann eine schöne Farbe. Es dauert ungefähr eine Woche, dann hast du diese Farbe. Bei mir dauert es ungefähr zwei Wochen, und es sieht sehr gut aus."
"Aber in der Sonne funktioniert es natürlich nicht", ergänzt Melody. "Du darfst nicht mehr in die Sonne, du musst immer schön im Schatten bleiben."
"Ich fühle mich gut, wenn ich bleache", sagt Taneesha. "Ich schwitze auch nicht mehr so sehr. Und meine Haut wird hellbraun, fast weiß. Es sieht sehr gut aus, weißt du. Die Männer in Jamaika lieben es. Es ist einfach eine schöne Farbe."
Sie sagt, dass die Cremes für jamaikanische Verhältnisse nicht gerade billig sind. Deshalb konzentrieren sich viele Frauen beim Bleaching nur auf das Gesicht. Einige Frauen haben auch einfach nicht das Geld, um sich die teuren Cremes zu kaufen. Sie benutzen eine hausgemachte Mixtur aus Currypulver, Zahnpasta und Toilettenreiniger.

Hausgemachtes Bleich-Pulver
"Ein Typ hat sogar einen Song über das Bleachen gemacht", sagt Melody. Sie singt ihn mir vor: "Them-a-bleach, them-a-bleach for favor browning…"
Taneesha zeigt mir das Foto auf ihrer Ausweiskarte. Vor dem Bleaching. "Guck mal, wie hässlich ich war", sagt sie. Das Foto wurde vor einem Jahr aufgenommen. Taneesha mit makelloser dunkelbrauner Haut. Jetzt ist ihre Haut fleckig beige - im Gesicht sind einige Stellen heller, andere etwas dunkler.
Donnerstagabend. Ladies Night im "Asylum", der beliebtesten Diskothek in Kingston. Das Asylum liegt am Knutsford Boulevard, der Hauptstraße der Stadt. Am Donnerstag ist der Eintritt für Frauen frei und das Etablissement dementsprechend gut besucht. An der Tür gibt es einen knallharten Sicherheitscheck. Zwei Bodyguards und ein Mumpy tasten jeden nach Waffen ab. Kingston ist ein hartes Pflaster, und erst vor ein paar Tagen sind bei einer Schießerei zwölf Menschen ums Leben gekommen. Es ging um Straßenhändler. Die Polizei wollte sie von einem lukrativen Ort vertreiben, weil sie keine Lizenzen hatten.
Das Asylum ist proppenvoll. Der DJ ist ein Star in der jamaikanischen Musikszene. Zwei Kamerateams laufen in der Disco herum, nehmen den DJ auf und ein paar halbnackte Mumpies mit blonden Perücken, die sich auf der Tanzfläche rekeln.
Melody und Taneesha sind mit ins Asylum gekommen. Melodys Gönner hat familiäre Verpflichtungen, und Taneesha ist ohnehin auf der Suche nach einem Mann.
Die dicke Melody wird von vielen Männeraugen gierig angestarrt. Für Taneesha interessiert sich eigentlich keiner so richtig. Melody bekommt auch gleich einen Drink spendiert, lässt den Typen dann aber einfach stehen.
Melody trägt ein schräges Outfit: Hautenge Jeans, die in der Hüftgegend abgeschnitten sind und die obere Hälfte ihres enormen Hinterns und einen winzigen G-String sehen lassen. Dazu hat sie eine blinkende Lichterkette um die Hüften gewickelt.

Nightclub-Szene in Kingston
Ich bin der einzige Weiße in der Disko und falle natürlich dementsprechend auf. Außer mir ist da nur noch ein chinesisches Teenagerpärchen, das in der schwarzen Masse etwas verloren wirkt. Es gibt in Jamaika eine chinesische Minderheit die sich irgendwann auf der Insel niedergelassen hat.
"Buy me a drink, handsome?" Ich drehe mich um. Hinter mir steht eins von den platinblonden Mumpies, das in dem Videoclip mitgewirkt hat. Sie trägt nur einen knappen Bikini und Schuhe mit Plateausohlen. Ich kaufe der Dame einen teuren Drink, der bei den Jamaikanerinnen sehr beliebt ist. Es ist eine Mischung aus Fruchtsäften und Cognac und heißt "Alyssé".
Das Mumpy schmiegt sich an mich. "Thanks, baby. – Really like your blue eyes!"
Natürlich denkt die Dame, dass sie wahnsinnig attraktiv ist, weil hier fast alle Männer nach ihren üppigen Formen gieren, aber ich spreche eher auf den schlanken Typ an. Ich bemerke, dass Taneesha zu mir rüberguckt. Wenn sie wüsste, dass sie mir viel besser gefällt als die Mumpies. Nur ihre fleckige Haut mag ich nicht.
Am nächsten Nachmittag treffe ich Taneesha an ihrem Arbeitsplatz: Kentucky Fried Chicken. Sie trägt die Arbeitsuniform des Ladens und serviert mir ein Hühnchenmenü.
Amerikanische Fast Food Restaurants prägen das Bild in Kingston. Auf ein jamaikanisches Restaurant kommen mindestens zehn amerikanische Fast Food Läden. Auch das Fernsehen ist beinahe komplett amerikanisch. Jamaika liegt in derselben Zeitzone wie die Ostküste der USA, und als Amerikaner kann man in Jamaika Urlaub machen, ohne auch nur eine einzige Folge seiner geliebten Sitcom zu verpassen.
Samstagnachmittag. Charles, Taneesha und ich sind bei einem "Outdoor-Bash". DJs legen auf einer Open-Air Bühne Platten auf, und das Publikum tanzt dazu im "Mud Slide" – der Schlammrutsche.
Taneesha und ich klettern eine Blechleiter hoch und gleiten gemeinsam die Rutsche runter in einen riesigen Pool mit Seifenblasen. Hunderte Pärchen tanzen in einem Bassin mit meterhohem Schaum. Über der feuchtfröhlichen Tanzfläche hängt ein gewaltiger Schlauch, durch den immer wieder neuer Schaum gepumpt wird. Das ist im Moment der neueste Schrei. Ich habe zwar keine Ahnung, was das Ganze mit Schlamm zu tun hat, denn es ist ja nur Schaum, aber ich schätze, das ist irgendwie egal.

Tanzendes Paar bei der Schaum Party
Die meisten Pärchen ziehen hier eine irre Show ab. Alles reibt sich so eindeutig aneinander, dass es schon fast an Pornographie grenzt. Aber das ist auf Jamaika normal. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nach dem Tanzen auch so weitergeht. Es gibt Paare, die auf der Tanzfläche eine eindeutige Show abziehen und danach wortlos auseinandergehen, weil sie sich überhaupt nicht kennen.
Taneesha und ich tanzen eng aneinandergeschmiegt, und ich gebe mir Mühe, dieselben Balzbewegungen zu machen wie die Jamaikaner. Der Schaum durchnässt nach und nach die Klamotten, und die Sache bekommt die Qualität eines Nassen-T-Shirt-Wettbewerbs.
Taneesha sieht mir plötzlich tief in die Augen, ein Blick, der mehr als nur tanzen meint. "Weißt du, einige Männer mögen auch dünne Mädchen. Sie finden die dünnen sind einfacher zu manövrieren als eine dicke Frau." Sie lacht. Wir klopfen uns den Schaum von den Sachen und trinken ein Bier. Wir sind pitschnass, mein Hemd und meine Hose klatschen an der Haut.
Ich sehe, dass Charles im Schaumbad mit einem Mumpy tanzt. Er ist vollkommen nass, schmiegt sich eng von hinten an die Frau und genießt die üppigen Formen.
Ein paar Tage später. Charles fährt mich zum Flughafen. Ich habe Taneesha meine Adresse in New York gegeben. Sie will jetzt unbedingt in die USA kommen, denn ich habe ihr erzählt, dass ihr Typ dort sehr gefragt ist. Vor allem, wenn sie mit dem Bleaching aufhört.
"Ich warte natürlich darauf, dass ich endlich mal Glück habe", sagt Charles. "Ich arbeite schon viele Jahre, aber irgendwie ist nie etwas übriggeblieben. Ich habe kein Haus, und im Moment sieht's auch nicht so rosig aus, aber ich kaufe täglich Lottoscheine. Doch ich denke nicht negativ. Ich spüre, dass meine Träume irgendwann wahr werden, ich weiß bloß noch nicht, aus welcher Richtung das Glück kommen wird."
Charles tritt auf die Bremse. Seine Augen haben auf einmal wieder diesen besonderen Glanz. Auf der anderen Straßenseite steht ein Mumpy an einer einsamen Bushaltestelle.
Charles erklärt mir, dass die Busfahrer im Moment grade streiken. Er steigt aus und redet mit der fülligen Dame. Sie trägt ein Stretchkleid unter dem sich ihre Speckrollen abzeichnen, einen Cowboyhut und Cowboystiefel mit Fransen. Charles redet auf sie ein und bringt sie zum Lachen.
Ich verstehe kein Wort. Wer denkt, dass auf Jamaika Englisch gesprochen wird, hat sich gewaltig getäuscht. Auf Jamaika wird Englisch verstanden, aber nicht unbedingt gesprochen. Jamaikaner unterhalten sich untereinander auf Patois: ein eigenartiges Slang-Englisch mit eigener Syntax und afrikanischen Lehnwörtern.
Die Dame, die Charles an der Haltestelle angequatscht hat, steigt in unseren Wagen. Sie heißt Victoria und will eigentlich in die Stadt, doch Charles hat sie davon überzeugt, kurz mit zum Flughafen zu kommen.
Am Terminaleingang klopft Charles mir auf die Schulter. "Mach's gut, Mann. Und komm bald wieder. Ich glaub, du bringst mir Glück." Er lacht.
6. DIE HUMMERFALLE – Ein Festival der etwas anderen Art in Rockland, Maine
Ich höre lautes Scheppern, komme hoch und stoße mir den Kopf. Ich sehe Sterne und weiß zunächst nicht, wo ich bin. Als der Schmerz nachlässt, wird mir langsam klar: Ich bin in Rockland, Maine, und stehe mit meinem Leihwagen an der Straße, auf der die "Hummerparade" stattfindet. Direkt neben mir spielt eine Marschkapelle.

Marschkapelle auf dem Hummer-Festival
Drei Kinder starren mich durchs Seitenfenster an. Ich schneide eine Grimasse, und die Kids verschwinden.
Ich bin nachts angekommen und konnte keine Unterkunft finden. Auch keinen Parkplatz. Mein Wagen steht am Ortseingang auf dem Seitenstreifen. Ein Wunder, dass sie mich noch nicht abgeschleppt haben.
Ich habe nur meine Unterhose an und zwänge ich mich von der Rückbank, auf der ich gepennt habe, durch die Lücke zwischen den Vordersitzen hinters Lenkrad. Dabei stoße ich mir wieder den Kopf. Ein günstiger Leihwagen ist eben kompakt.
Plötzlich erinnere ich mich, dass ich den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen habe. Also noch mal nach hinten, den Schlüssel aus der Ritze des Rücksitzes fischen und wieder nach vorn.
Ich fahre langsam parallel zur Parade auf dem Seitenstreifen entlang und biege in eine Nebenstraße. Nach ein paar hundert Metern komme ich an einen Waldweg und stelle den Wagen ab. Jetzt nur noch einen Kaffee!
Nachdem ich zwanzig Minuten in dem Städtchen rumgelaufen bin, lande ich in der Wartehalle des Fährterminals. Alle Cafés sind voll besetzt, und die Leute stehen Schlange, um einen Tisch zu bekommen. Einzige Option: Der Kaffee-Automat im Fährterminal. Allerdings brauche ich Kleingeld oder einen einzelnen Dollarschein, habe aber nur einen Zwanziger.
Zum Glück treffe ich Nancy, die mir den Schein wechseln kann. Sie wartet im Fährterminal auf ihren Neffen, der auf einer der Inseln wohnt, die vor Rockland liegen. Nancy ist ungefähr sechzig und trägt einen Hut aus Filz, der aussieht wie ein Hummer – vorn hat er Kugelaugen und oben stehen zwei Scheren raus und zwei Fühler.
Ich schiebe einen Dollarschein in den Kaffee-Automaten, drücke auf die Optionen extra strong und with milk . Natürlich ist die Milch irgendein Pulver.
Ich werfe einen Blick auf den Automaten mit den Snacks. Fast leer. Es gibt nur noch Salzbrezeln und eine Süßigkeit mit dem Namen "Whooppie Sandwich". Ich ziehe das "Whoopie Sandwich" aus dem Automaten. Es ist schwarz mit einer weißen Füllung. Die chemische Zusammensetzung der Zutaten nimmt fast die gesamte Rückseite der Verpackung ein.

Whoopie- Sandwich
Ich nehme einen Schluck Kaffee und beiße ins "Whoopie Sandwich". Eigentlich gar nicht so übel. Ich sehe auf den Hafen von Rockland. Einige Boote schippern die Bay entlang, und die Sonne glitzert auf den Wellen.
Nancy sitzt noch immer auf der Bank neben mir und wartet auf die Fähre mit ihrem Neffen. Ich sage, dass mir ihr Hut gefällt. Sie demonstriert, was man mit dem Ding alles machen kann.
"Die Scheren kannst du in alle möglichen Richtungen drehen. Auch die Fühler. Und wenn du ein bisschen angeheitert bist, dann kannst du die Dinger so drehen, dass es crazy aussieht. Es macht einfach Spaß mit dem Hut. Schließlich sind wir auf dem Hummerfestival."
Ich liebe Hummer und wollte schon immer mal an die Quelle, genauer: an die Küste von Maine. Hier kommen die meisten der Hummer her, die in der Welt verkauft werden, und hier sind sie auch viel billiger als überall sonst. Deshalb habe ich mir den Wagen geliehen und bin vom 700 Kilometer entfernten New York zum "Hummerfestival" aufgebrochen. Ich konnte nicht ahnen, dass das Fischerstädtchen um diese Zeit aus allen Nähten platzt.
Um aufs Festivalgelände zu kommen, muss ich wieder an der Parade vorbei. Ich passiere ein Defilee aus Go-Karts, die von Kriegsveteranen gesteuert werden. Die Veteranen tragen eine Art türkischen Fez auf dem Kopf und haben Mühe, die Beine in den kleinen Fahrzeugen unterzubringen.
Dann eine Kostümgruppe, die das Thema "Hummer" zelebriert. Ein riesiger Hummer aus Pappmaché wird von Leuten in Hummerkostümen an Metallstangen in die Luft gehalten.
Danach ein offener Sportwagen mit der Schönheitskönigin: "Miss Hummerfestival". Eine junge Dame in greller Aufmachung: Glitzerndes Kleid mit Handschuhen, die bis zu den Ellenbogen reichen, die volle Ladung Make-up und ein breites Lächeln mit superweiß gebleichten Zähnen.

Hummerfestival in Rockland, Maine
Auf dem Festivalgelände ist bereits die Hölle los. Auf dem Rummel gibt es außer Autoskootern und Schießständen auch einen Clown, der über einem Schwimmbassin thront und die Passanten beschimpft.
Wenn man mit dem Ball eine Zielmarke trifft, dann fällt der Clown ins Wasser. Ich kenne das aus Filmen, wusste aber nicht, dass es das immer noch gibt.
"Platsch!"
Ein junger Mann hat es geschafft, den Clown zu versenken. Mühsam klettert der arme Tropf wieder auf seinen Fallsitz. Er ist jetzt triefend nass, fängt aber gleich wieder an, die Passanten zu beschimpfen.
Das Festivalzelt ist bestückt mit langen Klapptischen und Holzbänken. Es ist fast bis auf den letzten Platz mit Leuten besetzt, die sich den Bauch mit Hummer vollschlagen. Ich stelle mich in die Schlange, denn hier ist Selbstbedienung.
"Single, double oder tripple?"
"Tripple."
Kurz darauf habe ich ein Menü mit drei dampfenden Hummern vor mir stehen. Wow! Drei Hummer für zwanzig Dollar.
Dazu gibt es einen Plastiklatz, ein Schälchen zerlaufene Butter, einen gekochten Maiskolben und einer Tüte Maine Coast Kartoffelchips. Das Ganze wird auf einem grauen Tablett aus Recycling-Pappe serviert. Nicht gerade besonders ansprechend, doch was soll's. Hummer ist Hummer. Ich binde mir das Lätzchen um und lege los.
Die Schale meines Hummers lässt sich überraschend einfach knacken. Sie ist nur etwa so dick wie die Schale einer Erdnuss, und ich brauche keine Zange. Das habe ich aus Restaurants anders in Erinnerung. Dort waren die Schalen immer äußerst schwierig zu knacken.
Mein Tischnachbar sagt, dass das "Abwerfer" sind, weil sie gerade ihre alte Schale abgeworfen haben. Die Hummer machen das jedes Jahr, damit sie größer werden können.
Ein Glas Weißwein würde jetzt gut zum Menü passen, doch Alkohol gibt es auf dem Festivalgelände nicht. Mein Nachbar zeigt auf ein Restaurant außerhalb der Absperrung: "Da kriegst du was."
"Conti's" ist ein ziemlich schräger Laden. Im Innern sieht es aus wie in einem gestrandeten Schiff. Fischernetze hängen von der Decke, in einem Regal stehen alte Navigationsinstrumente, und die Beleuchtung besteht aus Kerzen und Sturmleuchten. Es gibt keine einzige elektrische Lampe, und die Tischdecken sind alte Zeitungen.
Zu meiner Überraschung treffe ich wieder Nancy. Inzwischen hat sie ihren kleinen Neffen dabei, der ebenfalls einen Hummerhut trägt. Nancy arbeitet gelegentlich im Restaurant als Bedienung. Heute hat sie jedoch frei. Dennoch ist sie bei Conti's, weil sie ein Bier trinken wollte.
"Der Koch ist gleichzeitig auch der Besitzer", sagt Nancy. "John Conti. Er steht allein am Herd, und niemand darf seinen Kreationen zu nahekommen, weil er dich sonst nämlich erschießt." Sie lacht, und die Fühler an ihrem Hummerhut wackeln.
Nancy wohnt schon seit dreißig Jahren in Rockland. Kennt sie jemanden, der mich mal mit raus aufs Meer nehmen könnte? Ich würde gern wissen, wie man die Hummer eigentlich fängt.
"Mein Ex ist Hummerfischer. Er ist ein bisschen schwierig, aber ich kann ihn fragen, okay?"
Ich bestelle ein Glas Chardonnay. Die Bedienung ist eine Nichte von Nancy und trägt ebenfalls einen Hummerhut. Julie hat ihr Haar zu zwei Zöpfen geflochten und ist ausnehmend hübsch. Sogar der Hummerhut steht ihr. Als Nancy ihr erzählt, dass ich Journalist bin, zieht sie ihre Tasche unter der Theke hervor und zeigt mir ein paar Fotos von Studenten-Aufführungen: Julie als Hexe, als Krankenschwester im amerikanischen Bürgerkrieg und als Prostituierte mit Strapsen und tiefem Ausschnitt. Sie kann auch singen und will unbedingt zum Theater.
Ich sage, dass ich einen Gitarristen kenne, der am Broadway im Orchestergraben spielt. Julie will meine Telefonnummer haben. "Irgendwann komme ich nach New York, und dann rufe ich dich an."
Ich nippe an meinem Wein. Auf dem Bootssteg vor dem Restaurant spielt eine Steelband. Die karibischen Klänge der Steeldrums und der malerische Blick aufs Wasser sind entspannend. Allerdings ist da ein interessantes Detail: Es gibt keinen einzigen Schwarzen in der Band. Einwanderer aus der Karibik sind hier selten.
Julie will wissen, warum ich eigentlich keinen Hummer-Hut aufhabe. Sie hat ein paar unter der Theke. Zehn Dollar das Stück. Ich kaufe einen, setze ihn auf und gucke in den Spiegel. Ich sehe total bescheuert aus, aber was soll's? Was tut man nicht alles um dazuzugehören.
Ich erinnere mich an meinen Leihwagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich in dem kleinen Waldweg parken darf. Ich gehe vorsichtshalber zurück und bekomme einen Schock. Direkt vor dem Waldweg steht ein Polizeiwagen mit Blaulicht.
Der Polizist hat bereits die Nummer aufgeschrieben. Er fragt mich nach meinem Führerschein. Ich ziehe meine deutsche Pappe aus der Tasche und zeige sie vor. Da ich ganz selten Auto fahre, habe ich noch den uralten grauen Führerschein. So einen hat der Maine State Trooper wohl noch nie gesehen. "Was ist das?"
"Ein deutscher Führerschein."
Ich ziehe die beglaubigte Übersetzung des deutschen Konsulats aus der Tasche, in der steht, dass der Führerschein auch in den USA gilt. Der Beamte überfliegt das Dokument und sieht mich skeptisch an.
"Sie sind Deutscher, fahren einen Wagen mit einem Kennzeichen aus Florida und parken in einem Waldweg in Maine?"
"Es ist ein Leihwagen."
Ich fummele den Vertrag aus der Tasche, in dem auch meine New Yorker Adresse steht.
"New York, ha?"
Der Beamte sieht mich prüfend an. Sein Trooper Hut hat vorn einen goldenen Anstecker in der Form eines Adlers, und das Hutband ist eine Kordel, die in zwei goldenen Metallstiften ausläuft. Viele Amerikaner verstehen nicht, wie man freiwillig nach New York ziehen kann, eine Stadt, in der das Chaos regiert und der Wahnsinn Methode hat. Ich habe die Befürchtung, dass der Trooper mir eins überbraten könnte, nur, weil ich aus New York komme.
"Sie sind hier zum Hummerfestival?"
Ich nicke, und die Fühler an meinem Hummerhut wackeln ein wenig. Ich hatte völlig vergessen, dass ich noch immer den Hut aufhabe. Der Beamte grinst plötzlich.
"Weil mir Ihr Hut gefällt, drücke ich noch mal ein Auge zu. Aber verschwinden Sie schleunigst von hier. Um ein Haar hätte ich Sie abschleppen lassen."
Sechs Uhr morgens. Ich fahre mit Nancys Ex-Freund Richard raus zum Hummerfischen. Ich bin noch müde, denn ich habe natürlich wieder nicht besonders gut geschlafen in dem winzigen Auto. Glücklicherweise habe ich diesmal aber wenigstens einen vernünftigen Parkplatz gefunden.
Richard ist ein dünner, wortkarger Mensch. Er hat seine zerzausten Haare unter eine alte Baseballmütze geklemmt, trägt eine braune Latzhose und braune Gummistiefel. Das Hummerboot ist etwa zehn Meter lang und wird von einem tierisch lauten Dieselmotor angetrieben. Die Holzbank auf der ich sitze vibriert.
Am Führerhaus des Bootes klebt ein Sticker mit dem Spruch: Stop the talkin' and do the walkin'! , was frei übersetzt etwa so viel heißt wie: "Halt die Klappe und fass mit an."
Richard steht am Steuer und macht ein genervtes Gesicht. Ich habe das Gefühl, dass er mich lieber nicht mitgenommen hätte.
Zum Glück ist sein junger Gehilfe etwas gesprächiger. "Hummer fängt man mit dem stinkigsten, verfaultesten Fisch, den man sich vorstellen kann," sagt Troy. "Wir nehmen Fischabfälle, die kein Mensch essen würde und die noch nicht mal die anderen Fische fressen. Doch die Hummer sind wie versessen auf den verfaulten Fisch und krabbeln in die Falle."
Troy lässt mich einen Blick in einen Eimer mit Fischabfällen werfen. Das Zeug stinkt entsetzlich. "Wenn du einen Hummer isst, dann musst du immer daran denken, wovon die sich eigentlich ernähren. Du isst also im Prinzip so was."
Troy ist circa 35. Er hat seine schulterlangen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. In seiner Freizeit spielt er Gitarre in einer Heavy Metal Band.
Wir fahren immer weiter aufs Meer hinaus. Überall schwimmen Bojen. Jeweils nach ein paar hundert Metern ändert sich ihre Farbe, was anzeigt, dass die Fallen die an den Bojen befestigt sind, einem anderen Hummerfischer gehören. Troy sagt, dass vor der Küste von Maine mehr als zwei Millionen Fallen ausliegen.

Hummerboot mit Hummerfalle
"Maine ist abgelegen", sagt Troy. "Eigentlich muss hier keiner durch. Maine liegt einfach zu nirgendwohin 'auf dem Weg', noch nicht mal nach Kanada. Es ist der einzige Bundesstaat, der nur eine einzige Grenze hat - mit New Hampshire. Maine überlebt durch den Tourismus, durch Leute wie dich, die gern Hummer essen. Jedenfalls im Sommer."
Okay, und im Winter?
"Im Winter, hauen alle Touristen ab, dann sind wir ganz allein. Was uns Hummerfischer angeht: Es ist verdammt kalt hier im Winter, also fischen wir nur von März bis November. Anschließend verkaufen wir Weihnachtsbäume, das geht bis Ende Dezember. Und danach verschwinden wir für zwei Monate. Wir sitzen zu Hause am Ofen und warten auf den Frühling."
Schließlich erreichen wir Richards Fischgründe. Er stoppt den Motor. Seine Bojen sind alte Waschmittel-Kanister. Die regulären Bojen kosten zwanzig Dollar.
Troy hievt mit einer Seilwinde eine Hummerfalle hoch. Es sind Drahtkisten, deren Boden mit Beton beschwert ist, damit sie besser sinken. In den Kisten krabbeln einige Hummer verschiedener Größe herum. Ein paar von den größten wirft Troy gleich wieder ins Meer. Es sind paarungsfreudige Männchen, die der Arterhaltung dienen. Einige sind tragende Weibchen mit dunkelrotem Roggen an den Bäuchen. Die wandern auch sofort zurück ins Meer. Der restliche Fang kommt in einen Container.
Die Fallen sind ziemlich raffinierte Gebilde. Es gibt einen Einstieg der durch ein konisch zulaufendes Netz führt. Wenn der Hummer in den so genannten "Salon" gelangt, dann kommt er von dort nicht wieder heraus. Es sei denn, er ist ein Baby-Hummer und so klein, dass er aus dem Ausstiegsloch kriechen kann.
Wer stellt eigentlich sicher, dass die Fangregeln alle eingehalten werden? Wer kann schon kontrollieren, ob jemand auf hoher See nicht doch die großen Männchen und die Rogen tragenden Weibchen behält?
"Es gibt eine Küstenwache", sagt Troy. "Die tauchen plötzlich wie aus dem Nichts auf mit ihren Schnellbooten, und wenn sie dich erwischen, bist du dran. Wenn sie dich mit einem zu großen oder zu kleinen Hummer erwischen, verlierst du deine Lizenz."

Frisch gefangene Hummer
Ein paar Stunden später sind wir wieder zurück und liefern die Hummer beim Festival ab. Sie wandern in den "größten Hummerkocher der Welt". Als die Tiere in dem dampfenden Topf landen, höre ich lautes Zischen, das sich ein bisschen anhört wie erstickte Schreie. Wie ist das eigentlich, empfinden Hummer Schmerzen?
"Nein, sie sind sehr primitive Tiere, so wie ein Wurm oder eine Spinne", sagt Troy. "Sie haben kein zentrales Nervensystem und empfinden deshalb auch keinen Schmerz."
Hummer haben keine Stimmbänder und können deshalb auch keine Geräusche machen. Das Zischen kommt von der Luft, die beim Erhitzen aus den Schalen entweicht.
Der letzte Tag des Hummerfestivals. Langsam wird es etwas ruhiger, da viele Leute bereits nach Hause aufbrechen. Ich leiste mir nochmal das Tripple Menü für zwanzig Dollar.
Plötzlich steht Julie neben mir, die angehende Schauspielerin. Sie fragt, wann ich zurück nach New York fahre. Könnte sie für ein paar Tage bei mir unterkommen? Ich bin etwas überrascht. Ich erkläre ihr, dass ich in einem Zimmer in einer Fabriketage wohne. Und das ist im Prinzip schon für eine Person zu klein. Julie lacht und sagt, dass es nur Spaß war.
Nach einer weiteren Nacht auf dem Rücksitz des Leihwagens, trete ich die Rückreise an. Ich biege auf die Hauptstraße von Rockland in Richtung New York.
Dann eine Überraschung: Am Ortsausgang steht Julie mit einer Reisetasche und bedeutet mir, dass ich anhalten soll. Ich kurbele das Fenster runter. Sie zeigt aufs Autokennzeichen. "Du Lügner, du kommst aus Florida!"
"Quatsch, es ist ein Leihwagen."
Ich zeige ihr den Vertrag der Autovermietung. Julie sagt, dass sie eine Freundin hat, die an der NYU studiert, und dass sie dort erstmal unterkommen kann. Sie braucht nur jemanden, der sie mitnimmt.
Ich lasse sie einsteigen, und gebe Gas.
7. AUF DEN HAHN GEKOMMEN – Unerwartete Begegnungen in Puerto Rico
Fünf Uhr morgens. Kurz vor Sonnenaufgang. Das Konzert der Hähne hat begonnen und wird jetzt noch stundenlang so weitergehen. Einer der Vögel scheint zudem noch ein psychisches Problem zu haben: Er macht fast den ganzen Tag lang weiter und hört erst um drei Uhr nachmittags auf. Wahrscheinlich übt er noch. Sein Schrei klingt heiser und bricht manchmal mittendrin ab.
Ich bin in Puerto Rico. Nicht in San Juan, der Hauptstadt, sondern auf der anderen Seite der Karibikinsel, in Aguadilla. Oder noch genauer gesagt in Rincon, was auf Spanisch so viel heißt wie "kleiner Winkel".

Ferienanlage in Rincon, Puerto Rico
Ich gehe auf die Terrasse und schaue auf Palmen, Strand und Meer. Die Sonne geht auf und glitzert in den Wellen. Ein paradiesischer Ausblick. Wenn da nicht der Soundtrack wäre.
Auf den Fotos sah alles hervorragend aus: Ein Zimmer mit Balkon und Blick aufs Meer für 60 Dollar am Tag. Die Optik ist top, aber die Akustik nicht.
Neun Uhr. Ich bin auf dem Weg ins Dorf. Von meinem Apartment sind es etwa 15 Minuten zu laufen. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es nicht. Die Landschaft ist hügelig und bewaldet, auf einer Wiese weiden Pferde. Die Straße wird von Mangobäumen gesäumt. Die Früchte sind reif, einige sind auf die Straße gefallen und strömen einen intensiven Duft aus. Die Mangos sind kleiner als die, die ich aus dem Supermarkt kenne - etwa doppelt so groß wie eine Pflaume.
Schon als ich vom Flughafen kam, hatte ich mich gewundert, warum keiner die Mangos aufsammelt. Wahrscheinlich gibt es einfach zu viele. Ich habe keine Tüte, aber auf dem Rückweg werde ich ein paar mitnehmen.
Rincon besteht aus einer Kreuzung und ein paar Seitenstraßen. Ein Supermarkt, eine Bäckerei, eine Apotheke. Außerdem noch zwei Kneipen, ein Imbiss und eine Autowerkstatt.
Ich gehe in die Apotheke und schaue mich um. Ohropax kann ich nirgends entdecken. Mir fällt das spanische Wort für "Ohrstöpsel" nicht ein, also versuche ich es mit "Earplugs". Doch die Dame hinter der Verkaufstheke spricht kein Englisch. Ich stecke mir die Zeigefinger in die Ohren. " Protección para las orejas ", sage ich. Schutz für die Ohren.
"Ah, tapones!"
"Si, si, tapones!"
Die Dame bedauert, leider habe sie keine, denn es würden so selten welche verlangt. Sie empfiehlt mir, zum Shopping-Center ins 20 Kilometer entfernte Mayaquez zu fahren.
Wieder zu Hause angekommen habe ich Glück. Carmen und Vivien, die im Apartment neben mir wohnen, wollen mit ihrem Mietwagen nach Mayaguez fahren, um dort einige Sachen im Shopping-Center zu kaufen. Die beiden sind Puertorikanerinnen, die in New York wohnen. Das Ferienapartment haben sie gemeinsam gekauft, um hier gelegentlich abzuspannen. Sie nehmen mich mit.
Der Shopping Komplex in Mayaguez sieht fast genauso aus wie der an der Route 17 in New Jersey. Um einen riesigen Parkplatz gruppieren sich die einschlägigen Kaufhäuser. JC Penny's, Kmart, Marshall's … Carmen und Vivien gehen zu Kmart und ich zur Apotheke.
In der Apotheke gibt es nur Schaumstoffstöpsel, wie man sie auch im Flugzeug bekommt. Die Dinger dämpfen kaum und fallen außerdem ständig aus den Ohren. Ich will welche aus Wachs. Doch die sind ausverkauft. Wann sie wieder hereinkommen – Schulterzucken. Es werden so selten welche verlangt. Ich kaufe Watte und ein paar Kerzen. Vielleicht kann ich mir damit meine eigenen Wachsstöpsel basteln.
Eine halbe Stunde später sind wir wieder auf dem Ferienanwesen. Carmen, Vivien und ich spielen Volleyball am Strand. Oder besser gesagt, wir versuchen den Ball zwischen uns so lange wie möglich in der Luft zu halten. Die Damen sind Anfang 50, wirken aber jünger. Beide haben eine enorme Oberweite. Carmen hat einen hellen Teint und trägt einen Kurzhaarschnitt. Vivien ist gut gebräunt und hat ihre blondierten Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Beide sind Single und haben erwachsene Kinder in New York. Sie sind in den USA aufgewachsen und sprechen besser Englisch als Spanisch.
Ich bemerke die interessierten Blicke der puertorikanischen Familienväter, die mit Frau und Kindern auf der Terrasse sitzen. Die meisten Wohnungen im Ferienkomplex gehören wohlhabenden Familien, die aus Ponce oder San Juan kommen und hier ihre freie Zeit verbringen. Die restlichen Apartments gehören Amerikanern und Puertorikanern, die in den USA leben.
Wir sind alle drei erschöpft und lassen uns in die Liegestühle auf der Terrasse fallen. Zeit für eine Piña Colada . Es gibt eine kleine Bar, die vom Manager und seiner Frau betrieben wird. Natürlich haben sie dort auch Piña Colada , das Nationalgetränk von Puerto Rico: Ein Mixgetränk aus Rum,
Kokosnusscreme und Schlagsahne. Dazu gibt es ein Stückchen Ananas.

Piña colada
Auf dem Weg zur Toilette treffe ich Luis, den Hausmeister. Er grinst mich an und klopft mir auf die Schulter. "Du bist wirklich ein Glückspilz."
Ich verstehe nicht ganz, was er meint.
"Also, bevor ich verheiratet war, hatte ich auch mal eine " Ménage-à-trois ", das war ‛ne tolle Sache. Die ganzen Typen hier sind neidisch auf dich."
Auf der Toilette sehe ich mich im Spiegel an. Sie denken also, ich habe eine Ménage-à-trois mit Carmen und Vivien. Eine interessante Idee. Zurück auf der Terrasse spüre ich, dass uns die Familienväter noch immer neugierig beäugen.
Kurz darauf fahren wir mit Carmens Mietwagen zu einer Open Air Bar, die auf einem Hügel liegt. Von hier aus hat man einen schönen Blick aufs Meer. Außerdem ist es der beste Platz, um den Sonnenuntergang zu genießen. Es gibt ein Live-Band. Ich hätte Salsa oder Merengue erwartet, doch die Band besteht komplett aus Amerikanern. Der Großteil ihres Repertoires sind gecoverte Santana Songs. Auch nicht schlecht.
Wir trinken "Rum Punch", Rum gemischt mit Fruchtsaft. Es ist der Drink der Stunde, einfach zu machen und geht schnell in den Kopf. Außerdem kostet er nur zwei Dollar. Ich sehe mich um. Fast alle Gäste sind amerikanische Surfer. Bermuda-Shorts, verspiegelte Sonnenbrillen, Tattoos. Aus einer Ecke weht Marihuanageruch herüber.
Puerto Rico gehört irgendwie zu den USA, irgendwie aber auch nicht. Es gab zwei Volksabstimmungen bei denen die Puertorikaner entschieden haben, diesen Status beizubehalten.
Zuerst tanze ich mit Vivien, dann mit Carmen. Dann sind wir alle drei auf der Tanzfläche und tanzen zusammen. Wir haben die Arme umeinander gelegt und unsere verschwitzten Gesichter sind sich ganz nah. Vielleicht ist es der Rum-Punch, vielleicht auch die anything goes Stimmung der Surfer, doch plötzlich kommt mir die Ménage-à-trois gar nicht mehr so abwegig vor.
Wir lösen uns voneinander, und ich tänzele elegant um Vivien und Carmen herum, mache einen Hüftschwung hier, einen Ausfallschritt dort. Doch dann stolpere ich im Eifer des Gefechts über das Bein eines Barhockers und falle beinahe auf die Nase. Glücklicherweise fange ich mich wieder und tue so, als ob die Einlage quasi zur Performance gehört.
Wir sitzen wieder an der Bar und genießen den Sonnenuntergang. Die gelbe Scheibe versinkt langsam im Meer.

Sonnenuntergang in Rincon
Vivien rückt etwas näher und schaut mich über den Rand ihrer Brille an. Ich spüre, dass sie schon etwas betrunken ist. "Meinst du, dass ich meine Brüste verkleinern lassen sollte?"
Ich bin etwas überrascht über ihre Offenherzigkeit.
"Sie sind zu groß", erklärt sie. "Sie belasten die Wirbelsäule."
Ich sage, dass die meisten Männer das wahrscheinlich für ein Verbrechen halten würden.
Vivien lächelt. "Das habe ich schon öfter gehört."
Als sie uns für einen Moment verlässt, rutscht Carmen etwas näher. "Wir haben noch ein bisschen Curryhuhn im Kühlschrank. Wenn du Hunger hast, könnten wir das nachher in der Mikrowelle warm machen."
Halb fünf. Wieder reißen mich die Hähne aus dem Schlaf. Ich habe entsetzliche Kopfschmerzen von dem Rum-Punch. Eine Ménage-à-trois hatten wir nicht. Nach dem Curryhuhn waren wir alle drei auf einmal hundemüde.
Ich schlucke ein Aspirin und trinke eine halbe Flasche Wasser. Ich krame die Watte aus der Einkaufstüte, zünde eine Kerze an und träufle Wachs auf die Watte. Plötzlich fängt die Watte Feuer. Geschockt lasse ich alles fallen. Glücklicherweise ist das Feuer nach ein paar Sekunden gelöscht. Dennoch stinkt es entsetzlich.
Ich öffne die Tür zum Balkon, doch jetzt ist das Krähen der Hähne noch lauter. Ich schließe die Tür wieder, lasse mich aufs Bett fallen und drücke mir das Kopfkissen auf die Ohren.
Etwas später werde ich von der Türklingel geweckt. Das muss Hausmeister Luis sein. Ich hatte ihn gebeten, mich zum Hahnenkampf mitzunehmen. Ich wickle mir ein Handtuch um die Hüften und schleppe mich zur Tür. Meine Kopfschmerzen sind noch immer ziemlich heftig.
"Was ist los, Mann, ich denke du wolltest mit zum Hahnenkampf?"
Ich sage, dass ich vorher noch einen Kaffee brauche. Ich schalte die Kaffeemaschine an, werfe noch eine Aspirin ein und schäle eine von den Mangos, die ich am Vortag aufgelesen habe. Dabei schneide ich mir in den Finger. Ich stille das Blut mit einem Papierhandtuch.
"Sag mal, es riecht ein bisschen verbrannt, brennt hier was?"
Ich erkläre Luis, dass ich versucht habe, mir Wachsstöpsel für die Ohren zu basteln und dass ich dabei die Watte angekokelt habe.
"Ohrstöpsel? Wofür brauchst du Ohrstöpsel?"
"Für die verdammten Hähne, Mann."
Luis schüttelt verständnislos den Kopf. "Ihr Gringos und die Hähne. Die hört man doch kaum."
Während ich meinen Kaffee schlürfe, erzählt mir Luis, dass er schon mal in den USA war.
"Einmal war ich für zwei Wochen in Chicago. Mir ist aufgefallen, dass dort einige Sachen billiger sind als hier, aber die Miete ist viel höher. Außerdem ist es in den USA einfacher, Arbeit zu finden. Wir haben hier eine Krise im Moment."
Luis gießt sich ebenfalls einen Kaffee ein. Er nimmt drei gehäufte Löffel Zucker. "Wenn ich in den zwei Wochen in Chicago gleich einen super Job gefunden hätte, dann wäre ich vielleicht geblieben, aber so schnell geht das natürlich nicht. Und dann ist Puerto Rico auch ein tropisches Land, und ich habe ja einen Job. Ich bleibe lieber hier."
Luis und ich sind auf dem Weg zur Hahnenkampfarena. Auf der Rückbank seines verbeulten Kleinwagens steht der Drahtkäfig mit seinem Hahn.
Es riecht nach Hühnerstall. Auf dem Armaturenbrett steht "Jesús te ama!" - Jesus liebt dich. Daneben klebt ein Abziehbild der Cartoon-Figur "Willie Koyote".
"Du bist übrigens gesehen worden", sagt Luis. "Der Typ aus 6D hat dich gestern Nacht um halb zwei aus 6F kommen sehen."
"Wir haben nur was gegessen", sage ich, "Curryhuhn, sonst nichts."
Luis sieht mich ungläubig an.
Wir sind bei der Arena angekommen, und Luis parkt auf einem staubigen Sandplatz. Er muss sich beeilen. Sein Hahn ist gleich dran.
"Es gibt zwei Arten von Arenen", sagt er. "Die einfachen nennt man "Gallera", die besseren nennt man "Club Deportivo". Eine "Gallera" ist praktisch nur eine Hütte, in einem "Club Deportivo" gibt es Air Condition, und die Einrichtung ist modern. In einem Club ist einfach mehr Geld da."
Wir sind in einer "Gallera". Es ist stickig. Nur ein paar Ventilatoren bringen etwas Abkühlung. Während bereits ein Kampf läuft, gehen Luis und ich mit seinem Hahn. in einem Nebenraum.
"Kannst du ihn mal festhalten?" Luis drückt mir das Tier in die Hände. Ich halte den Hahn fest. Er zittert etwas, und ich spüre sein Herz schlagen. Luis kürzt dem Hahn die Nägel und bringt dann hinten am Fußgelenk eine künstliche, sehr spitze Spore an. Das ist die Waffe des Hahns. Luis befestigt sie mit Klebeband.
Die Arena ähnelt einer Zirkusmanege. Der Kampfplatz hat einen Durchmesser von fünf Metern und wird von einer Barriere begrenzt. Dahinter gibt es in Stufen aufsteigende Sitzbänke.
Neben der Arena sitzt der Schiedsrichter. Er spricht seine Anweisungen in ein Mikrophon, das von einer verzerrten Lautsprecheranlage verstärkt wird. An diesem Tag sind nur etwa 20 Männer und ein paar kleine Jungs in der "Gallera".
"Meist stirbt einer der Hähne, aber nicht immer", sagt Luis. "Der Kampf dauert fünfzehn Minuten. Wenn einer der Hähne in dieser Zeit stirbt oder auf dem Boden liegenbleibt, dann ist der Kampf entschieden"
Der Kampf beginnt. Mit einer Seilwinde wird ein Plexiglaskasten von der Decke herabgelassen. Der Kasten hat in der Mitte eine Trennscheibe und auf jeder Seite eine Einstiegsklappe.
Luis schiebt seinen Hahn in die eine Hälfte des Kastens, der des Gegners kommt in die andere. Kurz darauf wird der Kasten vom Schiedsrichter mit einem Ruck hochgezogen.
Die Hähne stehen da und beäugen sich. Als sie auch nach ein paar Sekunden nicht aufeinander losgehen, schnappt sich der Schiedsrichter einen Gummihahn und springt in den Ring. Er reizt die Hähne mit der Attrappe, bis beide auf sie einpicken.
Die Tiere gehen nun tatsächlich aufeinander los. Gelegentlich flattern sie hoch, um den Gegner mit den Sporen zu verletzen. Doch auf einmal büchst Luis' Hahn aus und flattert über die Barriere. Luis fängt ihn wieder ein und setzt ihn zurück in den Ring.

Hahnenkampf in Puerto Rico
Der Kampf wird härter . Einige Männer feuern die Hähne an und rufen "Pica, pica!" - Hack ihn! - Schließlich duckt sich unser Hahn und berührt mit dem Bauch den Boden. Luis feuert ihn an, doch er rührt sich nicht. Dann ein Gong. Der Hahn von Luis hat verloren, ist aber noch am Leben. Technischer K.O.
Ich bin wieder zurück auf dem Ferienanwesen. Vivien und Carmen grillen auf dem hauseigenen Barbeque-Grill, der gleich neben der Terrasse steht. Der Typ aus 6D, ein Familienvater Mitte 60, schwänzelt um die beiden herum. Er hat eine Flasche Bier in der Hand. Als er mich kommen sieht, lächelt er mir wissend zu und sagt etwas zweideutig auf Englisch: "Puerto Rico very beautiful, no?"
Carmen trägt eine Sonnenbrille. Vivien drückt sich hin und wieder einen Eisbeutel an die Stirn. Anscheinend haben die beiden den Rum-Punch vom Vorabend auch noch nicht ganz verarbeitet. Carmen bietet mir einen Fleischspieß an, und ich trinke ein Bier. So langsam fühle ich mich wieder fit.
Plötzlich prasselt ein warmer Sommerregen herab. Die Bewohner, die es sich auf der Terrasse bequem gemacht hatten, schnappen ihre Sachen und laufen zum Haus. Vivien nimmt ihr Bier und läuft kreischend durch den Regen zum Whirlpool.

Whirlpool mit Meeresblick
Der Whirlpool steht etwas erhöht im Garten. Von dort aus kann man das Meer sehen. Vivien winkt uns, dass wir auch kommen sollen. Eine tolle Sache. Wir sitzen zu dritt im Whirlpool, ich in der Mitte. Von unten blubbert die Wassermassage, von oben prasselt warmer Regen auf uns herab. An einigen Stellen bricht die Sonne durch die Wolken, und über dem Meer bildet sich ein Regenbogen.
Ich bemerke den Mann aus 6D, der uns von seinem Fenster aus beobachtet.
"Es gibt hier so ein Gerücht", sage ich. "Man munkelt, wir hätten eine Ménage-à-trois ."
Vivien nimmt einen Schluck Bier, rückt etwa näher und schmiegt sich an mich. "Diesem Gerücht müssen wir unbedingt Nahrung geben!"
Auch Carmen schmiegt sich an mich. Ich fühle mich plötzlich ein bisschen wie James Bond. Ich sehe kurz auf die enorme Oberweite rechts, dann auf die enorme Oberweite links. "Eigentlich ist es das Paradies hier", sage ich. "Das einzige Problem sind die Hähne morgens."
Zwei Tage später bin ich wieder in New York. Ich wache um halb sechs auf, denn die Müllabfuhr steht vor der Tür und macht Lärm. Inzwischen bin ich umgezogen. Ich wohne nicht mehr in der Musikerloft im Garment District, sondern in einer kleinen Einzimmerwohnung in der 56th Street. Ich schaue aus dem Fenster. Der puertorikanische Hausmeister, der schon seit 30 Jahren in New York lebt, stellt die Mülltüten auf die Straße. Interessanterweise heißt er Jesus. In Puerto Rico kein ungewöhnlicher Name.
Ich rufe ihm zu, dass ich gerade aus Puerto Rico zurück bin und dass es toll war. "Nur die Hähne haben genervt."
"Hey", sagt Jesus. "Man kann nicht alles haben. Hier hast du dafür die Müllabfuhr."
Jesus hat Recht. Jeden Montag und Donnerstag macht der Müllwagen einen ohrenbetäubenden Lärm. Und es dauert fast eine halbe Stunde, bis er außer Hörweite ist. Deshalb habe ich immer Ohropax neben dem Bett liegen. Doch die hatte ich in Puerto Rico vergessen.
Ich stopfe sie in die Ohren und schlummere ein. Ich träume von Vivien und Carmen und dem Whirlpool, von Curryhuhn und eisgekühlten Pina Colladas. Und was das Allerschönste ist: In meinem Traum habe ich meine Ohropax dabei!
8. POINT BARROW, ALASKA – Am nördlichsten Punkt der USA
"Im Frühling warten wir mit unserem Umiak an der Eiskante", sagt Banna. "Das Boot ist mit Tierhäuten bespannt und extrem leicht. Wir benutzen Paddel um voranzukommen, denn wir müssen möglichst leise sein."
Banna ist 27 Jahre alt und ein Inupiat-Eskimo. Er hat seine schulterlangen Haare in der Mitte gescheitelt, und sein Handgelenk schmückt ein Armband aus Walross-Elfenbein.

Umiak - Boote
"Bei größter Anstrengung schaffen wir circa 150 Meter in der Minute", sagt Banna. "Wenn in unserer Nähe ein Wal auftaucht, dann können wir ungefähr abschätzen, wo er beim nächsten Mal Luftholen hochkommt. Wenn er flach auftaucht und einen gemächlichen Atemzug nimmt, wird er nach 50 Metern erneut Luft schnappen. Dann springen wir ins Boot und versuchen, ihn zu kriegen. Aber wenn er hoch aus dem Wasser kommt und einen tiefen Atemzug nimmt, dann taucht er ab. Also paddeln wir erst gar nicht los, denn den sehen wir frühestens im nächsten Jahr wieder."
Ich bin in Barrow, Alaska, dem nördlichsten Ort der USA. 4000 Einwohner, davon 65% Eskimos. Mittlere Jahrestemperatur: 2 Grad unter null. Im Winter ist es fast drei Monate lang ununterbrochen dunkel, im Sommer ständig hell. Barrow hat das härteste Klima der USA, San Diego – 5000 Kilometer entfernt und genau am entgegengesetzten Ende des Landes - das Beste.
"Wir hatten einen hervorragenden Walfänger mit dem Namen Malik", sagt Banna. "Seine Spezialität war es, vom Boot aus mit der Harpune auf den Rücken des Wals zu springen und ihn dann zu erledigen. Leider haben wir Malik letztes Jahr verloren, doch nicht bei der Jagd, sondern beim Abschleppen des erlegten Wals. Maliks Boot war im Schlepptau mit anderen Booten, um den Wal an die Küste zu bringen. Sein Boot kenterte, und wir konnten ihn nicht schnell genug aus dem Wasser kriegen. Malik ist erfroren."
Die Inupiat jagen die Wale noch genauso wie vor 5000 Jahren, als ihre Vorfahren von Asien aus in die Gegend eingewandert sind - mit Paddelbooten. Dafür gibt es vor allem einen Grund: Die Wale werden von Motorengeräuschen verscheucht.
Die meisten Eskimos sind wortkarg. Fast alle tragen dunkle Sonnenbrillen und wirken ziemlich cool. Banna dagegen ist eine Plaudertasche und hat zu jeder Frage eine Geschichte parat oder einen witzigen Spruch. Nicht umsonst ist er deshalb der offizielle Touristenführer von Barrow, denn er kennt einfach alles und jeden. – Das Problem: Es gibt im Moment kaum Touristen. Die einzigen Kandidaten für Bannas "Artic Tour" sind Jeff, ein Vogelliebhaber aus Massachusetts, und ich. Die Tour ist für übermorgen angesetzt. Banna macht sie nur einmal die Woche.
Ich bin in meinem Hotelzimmer und sehe aus dem Fenster. Es ist Anfang Juni, also die Zeit, in der die Sonne hier nie untergeht. Leider ist es ständig bewölkt, so dass man die Sonne eigentlich nie zu Gesicht bekommt. Tage- und nächtelang ein einziges, eintöniges Grau. Auch die Aussicht, angepriesen als "Meeresblick" ist nicht gerade umwerfend. Das "Top of the World Hotel" ist nicht viel mehr als eine zweistöckige Baracke. Von meinem Zimmer im ersten Stock schaue ich auf einen Schotterweg, auf dem gelegentlich ein Bagger entlangfährt. Dahinter der Arktische Ozean. An der Küste liegt noch etwas Schnee. Für die Eskimos ist dieser Schneestreifen eine Art Autobahn, auf der sie mit ihren Motorschlitten entlangdüsen.
Auf dem Fernseher meines Zimmers läuft der lokale Radiosender. Interessanterweise heißt er "Eskimo Channel". Ich war eigentlich davon ausgegangen, das "Eskimo" politisch nicht ganz korrekt ist.
"Früher hat uns der Ausdruck Eskimo schon gestört," sagt Banna. "Weil er eigentlich nicht aus unserer Sprache kommt. Es ist ein Ausdruck der Indianerstämme, die weiter südlich leben und heißt übersetzt: Die Menschen, die rohes Fleisch essen . Und das sind wir auch, denn wir essen rohes Wal- und Rentier-Fleisch. Inzwischen stört es uns nicht mehr, und wir nennen uns auch untereinander Eskimos. Doch lieber wäre es uns, wenn man uns Inupiat nennen würde, was übersetzt so viel heißt wie die Menschen ."
Ich gehe zum Supermarkt. Es gibt hier zwar auch Restaurants, doch die sind sündhaft teuer. Obwohl es Anfang Juni ist und offiziell Sommer, trage ich eine Winterjacke, denn die Temperatur ist nur kurz über dem Gefriergrad.
Ich laufe eine Schotterstraße entlang. Der Supermarkt liegt am anderen Ende des Ortes, ein paar Kilometer entfernt. Auf einem Spielplatz tollen Eskimo-Kinder. Zwei Jungs fahren mit BMX-Rädern herum. Einige von ihnen tragen nur T-Shirts und Shorts. Offensichtlich ist ein Grad Celsius hier sommerlich. Der Spielplatz ist nicht gerade der Knaller: eine Rutsche, zwei Schaukeln, ein Klettergerüst. Außerdem ist da noch ein Plastikdinosaurier auf Sprungfedern, der wackelt, wenn man darauf reitet.
Die Architektur von Barrow ist nüchtern: ein- bis zweistöckige Holzhäuser, die alle irgendwie grau wirken. Überall liegt Schrott und altes Holz herum. Einige Häuser sind mit Walknochen und Rentier-Geweihen verziert. Es gibt keinen einzigen Baum, noch nicht mal einen Strauch. Die Vegetation besteht aus Tundra-Grass. Hier und da liegt noch ein Haufen schmutzigen Schnees.

Straße in Barrow
Die Arktis hat im Sommer absolut nichts von dem weißen Zauber, den man gemeinhin mit der Welt der Eskimos verbindet. Im Moment sieht es hier eher aus wie auf einem verstaubten Schrottplatz.
Auf dem Weg zum Supermarkt treffe ich Joe. Er füttert seine Schlittenhunde, die neben dem Haus angekettet sind. Joe ist klein und dünn und trägt einen grau-blonden Pagenkopf-Haarschnitt. Sein buschiger Schnurrbart hängt an den Seiten herab. Er erinnert mich an Asterix.
"Jetzt gibt es neuerdings auch Hausnummern hier", sagt Joe. "Als ich hergezogen bin, gab’s das noch nicht. Früher sagtest du einfach: Du gehst die Straße mit dem roten Haus lang, dann gehst du noch drei Häuser weiter. Mein Haus hat zwei Motorschlitten davor, der Nachbar hat nur einen."
Joe kommt aus Oregon und wohnt schon seit zwanzig Jahren in Barrow. Er ist zusammen mit seiner Mutter Besitzer eines Restaurants. Er war einer der ersten Leute, die ich hier kennengelernt habe.
Barrow erstreckt sich über eine Fläche von zehn mal zehn Kilometern. Es gibt keine Straßenverbindungen zu anderen Orten. Die nächste Eskimo-Siedlung ist nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Theoretisch wäre auch eine Fahrt mit dem Motorschlitten möglich, doch das würde Tage dauern.
Alle Waren kommen per Luftfracht oder per Schiff. Doch das Schiff legt nur zweimal im Jahr an. Jedes Auto ist ungefähr 3000 Dollar teurer als gewöhnlich, denn es kostet 3000 Dollar Fracht, den Wagen hier hoch zu schaffen. Selbst eine Schrottschüssel, die man noch reparieren muss, damit sie fährt, kostet 3000 Dollar, weil jemand die Frachtkosten dafür bezahlt hat.
Zwischen den Häusern von Barrow stehen hier und da Holzkreuze oder Grabmonumente aus Walknochen. Der Friedhof ist voll, und die Toten werden deshalb dort beerdigt, wo Platz ist. Allerdings beginnt schon kurz unter der Oberfläche der Dauerfrost. Die Gräber müssen aus dem steinharten Boden gemeißelt werden, und die meisten Leichen sind deshalb genauso gut erhalten wie bei ihrem Tod: Gefroren im ewigen Eis.
Endlich bin ich beim Supermarkt angekommen. Der A&C Value Mart ist riesig, die Preise sind gepfeffert. Alles ist ungefähr doppelt so teuer wie in New York. Ich entscheide mich für Toastbrot und ein paar Becher Joghurt. Ich habe plötzlich Heißhunger auf Leberwurst. In der Fleischabteilung entdecke ich - kaum zu glauben - Braunschweiger Leberwurst, importiert aus deutschen Landen. 100 Gramm für 9 Dollar 99. Wow!
Etwas später sitze ich in Joes mexikanischem Restaurant. Das Lokal heißt "Pepe’s" und wirbt mit dem Slogan "Tacos in the Tundra". Das Restaurant ist mit Sombreros und bunten Papier-Eseln dekoriert. Auch die Kundschaft ist überraschend bunt: Zwei Männer aus Samoa, ein Kroate und ein Jamaikaner. Im Hintergrund läuft Mariachi-Musik.
Die Kellnerin kommt aus den Philippinen. Linda ist schon etwas älter, hat aber schöne Hände mit perfekt lackierten Fingernägeln. Es sitzen nur Männer im Restaurant, und immer, wenn sie bedient, dann folgen ihr die Blicke. Es gibt einen starken Männerüberschuss in Barrow.
Joes Mutter Fran ist im Moment gerade in Fairbanks, um dort Restaurantbedarf einzukaufen. Dennoch ist sie präsent, denn überall hängen Fotos von ihr. In der Anfangsphase hatte sie sich allerhand einfallen lassen, um Kundschaft anzulocken. An Weihnachten spielte sie den Weihnachtsmann, an Ostern den Osterhasen, und als es einmal besonders schlecht lief, kellnerte sie sogar in einem knappen Bikini.
Fran ist inzwischen eine Legende und war sogar schon in der "Late Night Show" im Fernsehen zu Gast. Neben der Kasse hängt ein Artikel des "Wall Street Journals" mit dem Titel "Tacos in the Tundra".
Joe sitzt zusammen mit Banna am Tisch neben der Theke. Barrow ist überschaubar, und man läuft sich ständig über den Weg. Ich setze mich zu ihnen und bestelle Rentier-Tacos. Schmeckt wie Rindfleisch ist aber billiger, weil es nicht eingeflogen werden muss. Ein Bier würde jetzt gut zu den Tacos passen, doch Alkoholverkauf ist in Barrow verboten.
"Als ich vor 20 Jahren hergekommen bin, da gab es eine Bar und auch einen Laden, in dem man Alkohol kaufen konnte", sagt Joe. "Aber wir hatten einfach zuviel Probleme mit Alkohol."
Banna nickt. "Der Alkoholismus hatte überhandgenommen. Als ich ein Kind war, war der Alkoholismus einfach überall."
"Das schlimmste hier ist die Dunkelheit im Winter", sagt Joe und zwirbelt an seinem Asterix Bart. "Es ist so verdammt kalt, und so verdammt dunkel. Wenn du keinen Job hast, dann sitzt du zu Hause rum und fängst an zu trinken und zu rauchen. Du musst dir irgendwas einfallen lassen, irgendwas womit du dich beschäftigen kannst. Neuerdings ziehen eine ganze Menge neuer Leute hier hoch, weil es Arbeit gibt wegen dem Öl. Doch sie rechnen nicht mit den harten Bedingungen im Winter. 65 Tage Dunkelheit, mittlere Temperatur 30 Grad Minus, das ist nicht gerade jedermanns Sache."
"Meistens kommen fünf neue Familien im Sommer", sagt Banna "Doch während des Winters geben drei von den fünfen auf, weil sie es einfach nicht aushalten: Depressionen, Schlaflosigkeit, Gereiztheit. Man nennt es Saisonbedingte Verwirrung – Also hauen sie wieder ab. Es ist sozusagen natürliche Auslese. Das Leben hier oben ist nicht jedermanns Sache, du musst schon ein verdammt harter Knabe sein."
Aufgrund des Alkoholproblems gibt es jeden Oktober eine Abstimmung in Barrow, ob das folgende Jahr "trocken" oder "feucht" sein soll. Die letzten Jahre war die Stadt "trocken". Alkohol war illegal. Doch jetzt ist sie "feucht", das heißt man kann Alkohol zu Hause trinken, darf ihn aber nicht verkaufen. Um an Alkohol zu kommen, muss man sich einem Background-Check bei der Polizei unterziehen. Die Stadtverwaltung bestimmt dann, wieviel Alkohol man bestellen darf. Man muss eine Sammelbestellung in Fairbanks aufgeben und kann auch nur einmal im Monat bestellen.
Beim Bezahlen steckt mir die philippinische Kellnerin einen Zettel zu: "Wohne im ersten Stock. Bei Bedarf habe ich Drinks."
Ich bin wieder im "Top of the World" Hotel. Der Eskimo-Channel ist nicht besonders abwechslungsreich. Entweder spielen sie Eskimo-Musik, sagen den Wetterbericht durch oder bringen ein paar Oldies im Stil von "Love letters in the sand". Für den nächsten Samstag haben sie eine Tanzveranstaltung im Gemeindehaus angesagt. Es gibt hier Frauenmangel, und deshalb bekommt jede Frau eine Rose geschenkt. Eine ziemlich edle Geste, wenn man bedenkt, dass die Rosen eingeflogen werden müssen.
Ich sehe aus dem Fenster. Noch immer derselbe bewölkte Himmel, noch immer dasselbe Grau. Es ist bereits nach Mitternacht, sieht jedoch ganz genauso aus wie drei Uhr nachmittags.
Auf dem schmalen Schneestreifen vor meinem Fenster ist reger Motorschlittenverkehr. Die Eskimos haben Anhänger an die Fahrzeuge gekuppelt und transportieren irgendetwas. Sind das Teile eines erlegten Wals? Ich weiß inzwischen, dass die Hundeteams des Ortes eigentlich nur noch aus Tradition gehalten werden. Motorschlitten sind einfach schneller und auch billiger. Mit den Hundeschlitten fährt man nur zum Spaß oder zu einem besonderen Anlass, einem Eskimofestival beispielsweise.
Ich erinnere mich an meine Ankunft auf Barrows kleinem Flughafen und an die Konversation mit dem Taxifahrer. Ich hatte den Mann mit der schmalen Sonnenbrille zunächst für einen Eskimo gehalten. Auf dem Weg zum Hotel entpuppte er sich jedoch als Filipino, der nicht besonders gut auf Eskimos zu sprechen ist. "Die sind alle Alkoholiker", sagte er mit einer wegwerfenden Handbewegung. "Und wegen denen muss ich jetzt hundert Dollar für eine Flasche Wodka zahlen."
Ich lege mich hin und versuche zu schlafen. Es klappt nicht. An den Seiten der Vorhänge dringt noch immer genügend Licht durch, um mir das Gefühl zu geben, dass es helllichter Tag ist. Außerdem rauschen ständig Motorschlitten vorbei. Ich beschließe, mir noch etwas die Füße zu vertreten. Vielleicht werde ich dann endlich müde.
Auf dem Spielplatz ist reger Betrieb. Ich sehe auf die Uhr: kurz vor zwei Uhr nachts. In den Sommerferien lassen die Eltern ihre Kinder spielen solange sie wollen. Sie haben ein ganz eigenes Zeitgefühl und spielen einfach solange bis sie müde werden.
Die Kids spielen "Eskimo-Trampolin". Das Trampolin besteht aus einem runden Ledertuch. Am Rand hat es Haltegriffe, ähnlich einem Sprungtuch der Feuerwehr. Ein Kind steht in der Mitte des Tuches, während die anderen die Griffe halten. Das Tuch wird zweimal leicht angefedert und dann auf drei mit einem Ruck glattgezogen, was den Springer mit einem plötzlichen Satz ein paar Meter nach oben katapultiert.
Ich laufe am Rathaus vorbei, ein Holzbau, der, wie die anderen Häuser auch, ziemlich verstaubt ist. Auf dem Vorplatz steht ein Pfeiler mit Schildern, die in verschiedene Richtungen zeigen: Los Angeles, Paris, Chicago. Alles tausende von Kilometern entfernt. Von Barrow aus ist einfach alles weit weg.

Pfeiler mit Kilometerangaben
Ich stehe vor Joes Restaurant. Es ist bereits zu. Doch im ersten Stock brennt noch Licht. Ich nehme einen kleinen Stein und werfe ihn ans Fenster. Kurz darauf erscheint Linda, die philippinische Bedienung. Als ich bei ihr im Zimmer bin, öffnet sie einen massiven Schrank aus Eisenblech. Darin ein Arsenal von Spirituosen: Wodka, Whisky und Brandy. Alles Billigmarken. Ich zeige auf eine Flasche Whisky. "Was kostet die hier?"
"200."
Ich falle fast um. Dieselbe Flasche kostet in New York ungefähr 30.
Ich zeige auf eine Flasche Wodka. "Und die hier?"
"100."
Genau der Preis den mir der Taxifahrer genannt hatte. In New York kostet die Marke 10.
"Kennst du den Taxifahrer?" frage ich.
"Na klar, wir sind die einzigen Filipinos hier. Aber er ist neu und hat keine Alkohol-Lizenz."
Wodka putscht mich auf und bringt nichts. Mit einem Whisky würde ich garantiert wunderbar einschlafen. Ich krame in meiner Brieftasche.
"Ich hab nur 150 im Moment."
"Ist okay. Den Rest kannst du morgen vorbeibringen."
Sie gibt mir die Flasche Whisky. Linda ist etwa Mitte fünfzig und hat schütteres Haar. Mir fallen wieder ihre rot manikürten Fingernägel auf.
"Wollen wir ein Glas zusammen trinken?" frage ich.
"Klar, wieso nicht?"
Sie holt zwei Gläser und ein paar Eiswürfel.
Ich will wissen, wie sie in Barrow gelandet ist. Sie erzählt, dass sie zunächst als Kindermädchen zu einem Lehrerehepaar aus Kalifornien gekommen ist. Nach zwei Jahren hatte das Ehepaar ein attraktives Arbeitsangebot aus Alaska bekommen, und sie war im Schlepptau mitgereist. Die Lehrer konnten die extremen Bedingungen nicht ertragen und sind inzwischen wieder in Kalifornien. Linda dagegen ist geblieben. Wieso?
"Klar ist es hart", sagt sie. "Aber ich verdiene hier fast zwanzig Mal so viel wie zu Hause."
Sie zeigt mir ein paar Fotos von ihrer Familie in einem Armenviertel in Manila. Auf allen Fotos sind Geräte, die Linda finanziert hat: Kühlschränke, Fernseher, Sofas …
"Natürlich will ich zurück", sagt sie. "Aber meine Familie braucht mich. Ein bisschen bleibe ich noch, obwohl es verdammt hart ist im Winter."
Wir stoßen mit dem Whisky an. Es ist jetzt fast vier Uhr morgens und noch immer taghell. Linda zieht ihre blickdichten Vorhänge zu und zündet ein paar Kerzen an. "Wie ist das?" fragt sie.
"Schön dunkel."
Wir trinken noch ein Glas Whisky, und ich werde langsam müde
Es ist endlich soweit. Ein paar neue Touristen sind angekommen, und wir haben genügend Teilnehmer für Bannas "Arctic Tour". Außer mir und Jeff, dem Vogelliebhaber aus Massachusetts sind da jetzt noch ein älteres Pärchen aus Connecticut, zwei Damen aus Tennessee und Ryan, ein Afro-Amerikaner aus Maryland.
Bannas uralter Bus rumpelt über Barrows Schotterstraßen und zieht eine Staubwolke hinter sich her. Eigentlich gibt es nicht viel zu sehen, doch Banna präsentiert trotzdem stolz alle Institutionen der Stadt: das Feuerwehrhaus, die Polizei mit angeschlossenem Mini-Gefängnis, die Kirche, die Krankenstation, den Zahnarzt, den Chiropraktiker und sogar die Trockenreinigung. Alles ist einfach deshalb eine Sehenswürdigkeit, weil es überhaupt existiert.
Besonders stolz ist Banna auf die neue Schule. Die angegliederte Turnhalle hat sogar eine Kletterwand, an der man das Bergsteigen üben kann. Der höchste "Berg" hier ist allerdings ein zehn Meter hoher Schotterhaufen. Der Schulkomplex hat 75 Millionen Dollar gekostet, da jeder einzelne Stein eingeflogen werden musste.
Jeder Einwohner von Barrow bekommt einen Zuschuss vom Bundesstaat Alaska. Etwa 1800 Dollar pro Jahr. Die Eskimos bekommen noch zusätzliche Zuschüsse von Eingeborenen-Verbänden. 5000 Dollar pro Jahr und Person. Wenn man eine Eskimo-Frau heiratet und mehrere Kinder mit ihr hat, kann man bis zu 50 000 Dollar Unterstützung erhalten. Die Zuschüsse haben etwas mit dem Öl zu tun, das in der Nähe gefördert wird. Sie sind Teil eines Deals für die Schürfrechte.
Wir holpern mit dem Bus durch die Tundra. Darauf haben die Teilnehmer ungeduldig gewartet. Jeff, der Vogelkundler, zieht sein Fernglas aus der Tasche und einen Fotoapparat mit einem imposanten Teleobjektiv. Auch die anderen Teilnehmer machen ihre Fotoausrüstung schussfertig, und Banna holt sein Fernglas aus dem Handschuhfach. Es geht darum, seltene Vögel zu sichten, die Schnee-Eule beispielsweise. Außerdem freuen sich alle darauf, vielleicht einen Eisbären oder ein Walross in freier Wildbahn zu erleben.
Das Problem: Die Tundra ist wie ausgestorben. Weit und breit nicht das kleinste Vögelchen, absolut null Zeichen von Leben. Jeff, der Vogelkundler, erklärt mir, dass das Teil der Faszination ist. Gerade weil die Vögel so selten sind und weil sie es schaffen, in dieser extremen Umgebung ohne einen einzigen Baum zu überleben, sind sie so interessant für Ornithologen.
Banna stoppt plötzlich abrupt den Bus, reißt das Fernglas an die Augen und zeigt nach rechts: "Da! Ein paar arktische Schnepfen."
In der Ferne entdecke ich zwei kleine Punkte, mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Die Gruppe zückt Fotoapparate und Ferngläser. Jeff zoomt mit seinem Objektiv und schießt Fotos als gehe es um Leben und Tod. "Wunderbar...", stöhnt er. "Ah, unglaublich ..."
Ich werde neugierig. Ich borge mir das Fernglas und sehe in Richtung der Vögel. Sie sind ziemlich klein, nicht viel grösser als Spatzen. Auch ihr Federkleid ist nicht besonders aufregend: Braun mit ein paar weißen Flecken. Sie picken eine Weile in der Nähe einer sumpfigen Stelle herum und flattern dann weg.
Banna fährt weiter. Sein Blick schweift über das Panorama, gierig darauf, irgendein Lebewesen zu entdecken.
"Ich hatte schon mehrere Begegnungen mit Eisbären", sagt Banna. "Letzten Oktober bin ich mit meinem Bus in der Stadt rumgefahren, und als ich an der Felsenküste angekommen bin, guckt plötzlich ein Eisbär ins Fenster. Da hat mein Herz schon ein paar Schläge ausgesetzt. Letztes Jahr hatten wir über 80 Bären in der Stadt. Sie waren einfach überall, und die Eisbären-Patrouille, zusammen mit der Naturschutzbehörde und der Polizei, hatte alle Hände voll zu tun, die Tiere von der Stadt fernzuhalten."
Eisbären sind Nomaden und unberechenbar. Manchmal tauchen mehrere gleichzeitig auf, manchmal lassen sie sich wochenlang nicht sehen. In Barrow gibt es ein kleines Privatmuseum mit ausgestopften Tieren und antikem Eskimo-Werkzeug. Dort steht auch ein imposantes Exemplar eines ausgestopften Eisbären, das dem Museum einmal einen lukrativen Nebenverdienst eingebracht hat.
"Die Coca-Cola Leute sind hergekommen, um einen Werbefilm zu drehen", sagt Banna. "Sie sind raus aufs Eis gegangen, um nach Eisbären zu suchen, konnten aber keine finden. Dann haben sie unserem Museum gehört. Wir haben den ausgestopften Bären runter zum Strand gebracht, und sie haben dort ihr Set aufgebaut, und den Bären gefilmt. Unser Eisbär war der Bär im Original Coca-Cola Werbespot, bevor sie die Trickfilm Version eingeführt haben."
Banna bremst plötzlich wieder und zeigt nach links. Eine Gruppe arktischer Enten. Jeff, der Vogelliebhaber aus Massachusetts, schießt ein Foto und zuckt dann mit den Schultern. "Die hab’ ich schon."
Schließlich halten wir an einem Hinweisschild mitten in der Tundra. Keine Ahnung, warum sie es ausgerechnet hier aufgestellt haben, denn sonst gibt es weit und breit nichts zu sehen. Das Schild zeigt die Schnee-Eule, die Barrow seinen Eskimonamen gegeben hat: "Der Ort, an dem die Schnee-Eule gejagt wird."

Schnee-Eule
Die Eulen wiegen in etwa drei Kilo und sollen so ähnlich schmecken wie Hühnchen. Doch inzwischen ist die Jagd nach ihnen verboten, denn sie stehen unter Naturschutz. Unter der Abbildung der Schnee-Eule befindet sich eine Zeichnung eines traditionellen Iglus, das nicht aus Schneeblöcken gebaut wurde, sondern aus Lehm.
Banna räumt nun mit ein paar Eskimo-Mythen auf. Erstens: Eskimos haben nie in Schnee-Iglus gewohnt. Die haben sie nur als Notunterkünfte gebaut, wenn sie in der freien Wildbahn von einem Sturm überrascht wurden. Zweitens: Eskimos haben nie ihre Nasen zum Gruß aneinander gerieben. Und drittens: Kein Eskimo hat jemals dem Gast die eigene Frau angeboten. Banna breitet grinsend die Arme aus: "Sorry, Leute, es ist alles B.S. – Bull Shit!"
Wir holpern weiter über die unbefestigte Straße. Banna zeigt auf die zugefrorene Küste. "Eine Robbe!"
In etwa zwei Kilometer Entfernung ein winziger dunkler Punkt auf dem Eis. Alle zücken ihre Fotoapparate, und ich borge mir wieder das Fernglas. Die Robbe bewegt sich nicht und ist auch nicht klar zu erkennen. Es könnte auch ein alter Autoreifen sein.
Schließlich sind wir mit dem Bus an Point Barrow angelangt, einer Landzunge, die ins arktische Meer ragt. Wir befinden uns auf dem nördlichsten Flecken Festland in den USA.
"Wale!" ruft Banna plötzlich und zeigt auf den Ozean. Wir zücken unsere Ferngläser und tatsächlich: In der Ferne ziehen majestätisch ein paar Wale vorbei und blasen Fontänen in die Luft. Doch kurz darauf sind sie wieder weg. Abgetaucht.
Banna setzt sein Fernglas ab und sieht in die Runde. "Hört ihr das?"
Die Teilnehmer der Tour spitzen die Ohren und sehen sich verständnislos an. Was meint er nur? Banna kostet den Augenblick ein paar Sekunden aus.
"Stille!" flüstert er plötzlich. "Arktische Stille!"
Niemand bewegt sich. Banna schließt die Augen, und wir tun es ihm gleich. Ein magischer Moment. Absolute Stille.
9. GO GREYHOUND – Mit dem Bus von New York nach Atlanta
J-55 ist ein hellhäutiger Afroamerikaner mit Sommersprossen. Er sitzt auf dem Platz neben mir, hat seine Baseballmütze schräg nach hinten gezogen und trägt Baggy-Pants. Der Ghetto Blaster auf seinem Schoss hat schon ein paar Beulen, und hinter seinem Ohr steckt eine halb gerauchte Zigarette.
Wir sind mit dem Greyhoundbus von New York nach Atlanta unterwegs, und wir wissen beide, dass wir eine lange Nacht vor uns haben. Der Bus ist die billigste Art der Fortbewegung in den USA, aber auch mit Abstand die Härteste, denn es gibt unzählige Stopps auf der Route.

Greyhound – Bus
J-55 wohnt in Brooklyn und heißt natürlich anders, doch in der Hip-Hop-Szene braucht man einen Spitznamen, wegen der Street-Credibility. Er erzählt, dass er sich mit ein paar Kumpels im Songschreiben und Mixen versucht und dass er auf der Jagd nach einem Plattenvertrag ist. Bisher jedoch mit mäßigem Erfolg.
Mit mir reisen außerdem: Eine ältere Dame mit eingefallener Oberlippe und Perücke, ein Rockmusiker mit dünnem Haar und zerfetztem Gitarrenkoffer und ein Mexikaner, dessen Gepäckstück eine prall gefüllte Mülltüte ist.
Ich sehe mir den Fahrplan an. Die Stopps auf dem Weg nach Atlanta sind wie folgt: Baltimore, Richmond, Greensboro, Louisville, Charlotte, Salem und Lynchburg. LYNCHBURG??? Ich schaue noch mal genauer hin. Nein, ich habe mich nicht verguckt, die Stadt heißt tatsächlich Lynchburg.
J-55 fixiert zwei schwarze Mädchen der Reihe vor uns. Er grinst mich an und sagt, dass die beschwerliche Reise auch manchmal ihre angenehmen Seiten hat. Wie meint er das? Hat er schon mal jemanden kennengelernt?
"Ja klar, Mann," sagt er. "Du lernst Frauen im Bus kennen, logisch. Es passiert meist beim Umsteigen, da kommt man sich näher. Irgendwie ist jeder auf der Durchreise. Du willst ja nicht wirklich jemanden kennenlernen und du weißt auch nicht, was die Leute so in ihrem Leben für Probleme haben. Es ist eine Busliebe, quasi ein kurzer Stop."
J-55 erzählt mir hinter vorgehaltener Hand ein paar erotische Details seiner Abenteuer auf den Bussitzen, und ich frage mich, ob er nicht ein bisschen aufschneidet. Aber selbst wenn er übertreibt, ich bin mir sicher, dass in den Bussen, die oft die ganze Nacht durchfahren, schon so einiges passiert ist.
22 Uhr 45. Wir sind drei Stunden von New York entfernt, und der Bus macht den ersten Stopp in Pennsylvania. Die meisten Raststätten haben keine Namen, doch diese hier ist nach dem amerikanischen Poeten Walt Whitman benannt, den jeder kennt und fast jeder hasst - weil er Schullektüre ist. Die Raststätte macht Walt Whitman nicht gerade Ehre: ein Fast Food Restaurant mit außerordentlich dicken Bedienungen, ein Stand mit Reisebedarf, und ein paar Automaten mit Plastikspielzeug.
"Kann's gar nicht abwarten nach Atlanta zu kommen", sagt J-55. "Die Mädchen da tragen viel kürzere Röcke und so, verstehst du? Wenn du's richtig anstellst, dann kannst du gleich in der ersten Nacht was klarmachen. Ich meine, du musst nur gut quatschen können, verstehst du? In New York sind die Mädchen viel schwieriger zu kriegen, es kann dir passieren, dass du 'hi' sagst, und die läuft einfach an dir vorbei und guckt dich mit einem bösen Blick an, so als ob du schmutzig wärst oder so. Aber in Atlanta, Mann …"
J-55 beißt in seinen Double-Cheeseburger, den er sich vom Fastfood-Stand besorgt hat. In der Wartschlange für den Burger hat er versucht, mit den beiden Frauen aus dem Bus ins Gespräch zu kommen, doch es hat nicht geklappt.
Mitternacht. Wir sind inzwischen irgendwo in Maryland. Die meisten Fahrgäste sind eingenickt, und es ist merklich stiller geworden im Bus.
Auch J-55 hat sich zur Seite gedreht und seine Baseballmütze ins Gesicht gezogen. Er schnarcht leise. Ich bin müde, kann aber nicht einschlafen. Es ist so unbequem im Sitzen. Wenn ich mich nur irgendwo ausstrecken könnte...
Travel Plaza Baltimore. Der Busbahnhof liegt in der Nähe eines Sportstadions. Es ist inzwischen kurz vor zwei, und ich habe immer noch kein Auge zugetan. Ich habe Glück. Ein paar Leute sind ausgestiegen, so dass neben dem Klo zwei Sitze freigeworden sind. Ich wechsle den Platz.
Ich muss es irgendwie schaffen, in eine horizontale Lage zu kommen. Das ist nicht so einfach. Ich kann meinen Oberkörper halbwegs auf den beiden Sitzen ausstrecken, aber mit den Beinen habe ich Probleme. Sie reichen über den Gang bis zur gegenüberliegenden Sitzreihe. Ich blockiere jetzt den Durchgang zum Klo, doch das ist mir inzwischen egal. Wer aufs Klo muss, soll eben über meine Beine steigen. Aus der chemischen Toilette, deren Tür nicht richtig schließt, dringt ein unangenehmer Geruch.
Ich schlafe ein paar Minuten ein, doch dann katapultiert mich ein Schlagloch in die harte Greyhound-Realität zurück. Die kantige Armlehne hat sich in meinen Oberschenkel gebohrt. Es tut so weh, dass ich laut aufstöhne und dabei die Russin aufwecke, die vor mir sitzt. Sie sieht mich an, als ob ich sie unzüchtig im Schlaf berührt hätte.
"Sorry", sage ich. "Versuche nur zu schlafen, sonst nichts."
Halb vier Uhr morgens, Busbahnhof Richmond/Virginia. Unser Bus hat einen Maschinenschaden. Deshalb müssen alle raus und auf den Anschlussbus warten. Doch der ist natürlich schon voll, und außerdem ist es ein sogenannter "Local". Der hält in jedem Dorf und soll angeblich später in Atlanta ankommen als der Expressbus, der in etwa zwei Stunden abfährt.
Der Busbahnhof in Richmond ist eine Mischung aus Obdachlosenasyl und Bonny's Ranch. Mir gegenüber sitzt ein etwa fünfzigjähriger Mann mit frischgenähter Kopfwunde und einem Krankenhaus-Identifikationsband ums Handgelenk. Er macht den Eindruck, als sei er gerade vom Operationstisch gesprungen.
Außerdem ist da noch der Provinzpunk mit Irokesenschnitt, bunt bemalter Lederjacke und viel zu großen Turnschuhen. Dazu kommen ein paar Penner, die hier die Nacht verbringen, und eine Gruppe Chinesen mit riesigen Taschen und Kartons.
Die meisten Leute sitzen nicht auf den Bänken, sondern auf ihrem Gepäck direkt vor den Bussteigen. Bei Greyhound geht es nach der Devise "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Wer hinten in der Schlange steht, kommt vielleicht nicht mit und muss dann stundenlang auf den nächsten Bus warten.
J-55 kauert in der Warteschlange vornüber auf seinen Rucksack gebeugt und schnarcht. Er scheint überall schlafen zu können, der Glückliche. Ich sitze direkt hinter ihm auf meinem Koffer und stütze das Gesicht in die Hände.
Plötzlich wird unser Bus ausgerufen, und es kommt Bewegung in die Warteschlange. Ich kann es kaum fassen, doch ich bin tatsächlich der letzte, der noch einen Platz bekommt. Die Leute hinter mir müssen drei Stunden auf den nächsten Bus warten.
Acht Uhr morgens. Wir fahren durch Charlotte/North Carolina. Eine gepflegte Stadt mit Häusern im Kolonialstil. Dann eine Frühstückspause in einer Raststätte. Ich hole mir Rühreier und Bratkartoffeln vom Buffet und trinke einen Kaffee. J-55 zischt ein Bier. "Von Kaffee kriege ich Sodbrennen", sagt er und grinst. Er scheint gut ausgeschlafen zu sein und wirkt frisch.
Ein paar Stunden später sind wir endlich in Atlanta.
J-55 wird von ein paar Kumpels in einem offenen Wagen abgeholt. Er springt mit einem eleganten Satz auf den Rücksitz des Cabrios. Er hat mir erzählt, dass er zu einer Pool Party eingeladen ist, und ich sehe ihm an, dass er es kaum erwarten kann, mit den Girls am Pool zu flirten. Er hatte mir angeboten, mitzukommen, doch ich will nur noch ins Bett. Alles andere ist mir im Moment egal.
Ganz in der Nähe entdecke ich ein "Super 8" Motel. Eine Billig-Herberge. Die Kette wurde Anfang der 70er Jahre gegründet, und der Name kommt daher, dass ein Zimmer damals 8 Dollar 88 gekostet hat. Jetzt ist es natürlich teurer aber immer noch eine der günstigsten Optionen: 45 Dollar die Nacht. Ich checke ein.
Beim Ausfüllen des Gästeformulars fallen mir fast die Augen zu, doch dann bin ich endlich auf dem Zimmer. Die Möbel sind schon etwas abgegriffen, doch wenigstens ist es sauber. Das Fenster zeigt auf einen düsteren Hinterhof. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wenigstens kein Lärm. Jetzt nur noch eine Dusche!
Das Bad wurde nachträglich eingebaut und liegt etwas erhöht. Ich stolpere über eine Stufe und falle vornüber. Dabei schneide ich mir den Finger an der scharfen Kante der Duschtür. Blut tropft auf den Boden. Ich fluche und verbinde die Wunde notdürftig mit Klopapier. Zum Teufel mit der Dusche! Ich falle ins Bett und penne ein.
Am späten Nachmittag wache ich auf. Die Schnittwunde tut weh, doch es blutet nicht mehr. Ich nehme eine Dusche und achte darauf, dass der verletzte Finger nicht nass wird. Ich bin jetzt wieder frisch und fühle mich besser. Atlanta kann kommen!

Downtown Atlanta am Wochenende
Auf der Straße erwartet mich eine Überraschung. Es ist Samstagnachmittag, und die Straßen von Downtown Atlanta wirken wie ausgestorben. Neben einer U-Bahnstation sitzt ein einsamer Obdachloser. Ich frage ihn, warum alle Läden geschlossen sind.
"Downtown ist Business, Mann," sagt er. "Wusstest du das nicht? Am Wochenende ist hier Totentanz."
Ich fahre zum Geburtshaus von Martin Luther King. Die Gedenkstätte ist wegen Renovierung geschlossen. Die Gegend um die Auborn Avenue ist kleinbürgerlich und ebenfalls wie ausgestorben. Gepflegte Häuschen mit Vorgarten.
Es gibt kein Restaurant in der Nähe. Nur einen Fast Food Laden mit Fried Chicken. Nicht grade mein Fall, doch ich habe Hunger. Ich knabbere an einem Hühnchenschenkel und trinke Cola aus der Dose.
Ich fummle die Nummer von J-55 aus der Tasche und rufe ihn an. Im Hintergrund höre ich Party Geräusche. "Klar, Mann" sagt er. "Komm vorbei, hier tobt der Bär!"
"Bankhead?" sagt der Taxifahrer ungläubig. "Sind Sie sicher, dass sie nach Bankhead wollen?"
Der Fahrer erklärt mir, dass die Gegend ein Slum ist. Und ein Drogenumschlagplatz. Nach einer halben Stunde sind wir da. Die Gegend hat wirklich schon bessere Zeiten gesehen. Viele der Einfamilienhäuser sind verbarrikadiert, bei einigen ist das Dach eingebrochen.

Häuser in Bankhead
Auf den Grünflächen liegt Müll, und an einer Straßenecke parkt ein Streifenwagen mit blinkenden Lichtern. Die Polizeibeamten tragen schutzsichere Westen.
Vor einem Getränkeladen stehen ein paar abgerissene Typen und trinken. Es sind nur Männer auf der Straße, und alle sind schwarz. Im Kontrast zu der heruntergekommenen Stimmung steht das Wetter: Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel mit ein paar weißen Wölkchen.
Wir kommen an einer Reihe von braunen Klinkerhäusern vorbei. Sozialbauten. Auf einem Spielpatz toben Kinder herum, und hier gibt es auch Frauen und Jugendliche. Alle sind schwarz. In einer Grünanlage steht eine Gruppe junge Männer. Sie sind auf Hip-Hop gestylt: Baggy Pants, Baseball Caps, massive Goldketten. Bei einem steckt eine Pistole im Gürtel.
Der Taxifahrer hält an. "Hier ist es."
Ein Einfamilienhaus mit Eingangspforte. Die Fensterläden sind geschlossen. Auf der Freifläche neben dem Haus steht ein verrosteter Kühlschrank. Nach einer Party sieht es hier nicht grade aus.
Der Taxifahrer sieht mich besorgt an. "Sind Sie sicher, dass Sie hier aussteigen wollen? Mit Ihrem blassen Gesicht sind Sie hier eine wandelnde Zielscheibe."
Er hat nicht ganz unrecht. Ich zücke mein Handy und rufe J-55 an. Kurz darauf kommt er aus der Tür. "Willkommen, Mann, gut dich zu sehen!"
Das Innere des Hauses ist gepflegt und sauber. Mittelklasse. Die Party findet draußen statt. Der Garten ist mindestens 1000 Quadratmeter groß und mit einer hohen Mauer umgeben. In der Mitte gibt es einen Pool, und aus den Lautsprechern dröhnt Hip-Hop.

Party in Bankhead
Die Frauen tragen Bikinis und sitzen am Pool. In einer Ecke steht ein Typ an einem Barbecue Grill auf dem Fleisch bruzzelt. Es riecht gut. Auch hier bin ich wieder der einzige Weiße. Ich spüre, dass mich einige der Typen argwöhnisch beäugen. Denken sie ich bin ein Spitzel?
J-55 stellt mich dem Gastgeber vor: P.J. Er ist fast zwei Meter goss und hat ein breites Grinsen im Gesicht.
"Mein Kumpel hier ist ein Journalist aus Europa," sagt J-55. "Wir haben uns im Bus kennengelernt."
P.J. klopft mir auf die Schulter. "Willkommen, Mann."
Ich fühle mich besser. Keiner sieht mich mehr schräg an.
"Ist ein Gemeinschafts-Event hier", sagt J-55 und hält mir eine Blechdose hin. "Jeder steuert bei, was er kann."
Ich werfe 20 Dollar in die Dose.
Ich setze mich an einen Plastiktisch und trinke ein Bier. J-55 quatscht mit den Frauen am Pool. Die Typen auf der Party sind ähnlich gestylt wie die, die ich grade im Park gesehen habe. Nur, dass keiner eine Waffe hat. Zumindest keine sichtbare. Die Typen ignorieren mich und tun so, als ob ich gar nicht da bin. Eine der Frauen wirft mir einen kurzen Blick zu, doch ich bin da lieber vorsichtig.
Plötzlich steht der Gastgeber neben mir und schiebt mir einen Teller mit Barbecue-Fleisch zu. "Atlanta ist klasse, oder?" P.J. zeigt auf die Bikini-Girls und den Pool. "Ein kleines Paradies, oder?"
Ich nicke. Hier im Garten ist es wirklich nicht schlecht.
"T.I. und Andre 3000 kommen aus Bankhead. Wusstest du das?"
Wusste ich nicht. Die beiden Pop-Stars sind inzwischen weltbekannt.
"CNN, Coca-Cola und die Olympiade. Das ist nur ein Teil von Atlanta", sagt P.J. "Wieso schreibst du nicht mal was über Bankhead?"
Ich sage, dass ich genau das vorhabe.
"Okay", sagt P.J. "Was willst du wissen?"
Ich frage ihn, wie er sich das Haus und den Garten leisten kann. P.J. sagt, dass er eine KFZ Werkstatt betreibt. "Wenn die Leute Bankhead hören, dann denken die immer Drogen, aber das stimmt nicht, mein Freund. Es gibt auch ein paar Leute, die ihr Geld ehrlich verdienen."
P.J. erzählt mir, dass er vom schlechten Image des Viertels profitiert. Nur deshalb hat er sich das Haus und den großen Garten leisten können, denn hier sind die Grundstückpreise moderat.
P.J. kippt seinen Cola-Whisky ab und zieht sein Hemd aus. 'Verdammt warm, heute." Er springt in den Pool. Sofort sind ein paar Bikini-Mädchen bei ihm. P.J. ist hier der Hahn im Korb, und ich kann verstehen, warum Bankhead für ihn das Paradies ist.
Plötzlich sitzt die junge Frau neben mir, die mir zuvor einen Blick zugeworfen hatte. "Wenn du Journalist bist, wieso machst du dann keine Fotos?
"Bin mir nicht sicher ob das hier angesagt ist."
"Quatsch. PJ kennst du ja schon, und der ist der Boss hier."
Die junge Dame macht eine Pose. Sie zeigt ihren Bikinihintern und schaut über die Schulter. Ich schieße ein Foto mit meinem Handy. Sie macht noch ein paar andere Posen, und ich fotografiere.
"Lass mich gucken." Sie will die Fotos sehen, und ich zeige sie ihr. Die Schnappschüsse sehen gar nicht schlecht aus. Eine hübsche Frau in der Sonne geht immer.
"Okay, und wo kann ich die Fotos dann sehen?"
Ich kann ihr unmöglich sagen, dass ich für einen deutschen Radiosender arbeite. Zwar gibt es dort auch Fotos, um das Programm im Internet anzukündigen, doch das hat von Amerika aus gesehen kein Gewicht. Also lüge ich ein bisschen.
"NPR", sage ich. "National Public Radio."
"Oh, NPR, das ist gut. Willst du ein bisschen Spaß haben? P.J. hat ein Gästezimmer. Aber ganz umsonst ist das natürlich nicht."
Ich sage, dass ich nur ein begrenztes Budget habe. Ich frage mich, ob P.J. außer der KFZ Werkstatt nicht vielleicht auch noch ein anderes Business betreibt.
Die Frau zeigt mir ihre lackierten Fingernägel, die mindestens drei Zentimeter lang sind. "Der Schönheitssalon kostet, Honey, und dafür brauche ich einen kleinen Beitrag, verstehst du?"
Als sie merkt, dass ich kein Interesse habe, zieht sie wieder ab.
J-55 kommt auf mich zu. "Hey, Mann, Keisha ist total heiß. Wieso willst du nicht mit ihr aufs Zimmer?"
"Kein Geld, Mann. Wäre ich sonst mit dem Bus gefahren?"
J-55 grinst. "Stimmt. Aber genau deshalb bin ich eben auch mit dem Bus gefahren. Damit ich noch was übrighabe, um hier einen Beitrag zum Schönheitssalon zu leisten. Also, wenn du nicht willst, dann geh ich mit ihr aufs Gästezimmer, okay?"
J-55 quatscht ein bisschen mit Keisha, und kurz darauf verschwinden die beiden im Haus.
10. FUNNY MUSST DU SEIN! – Auf Jobsuche in Tokio
"Du brauchst eine Krawatte, Mann", sagt George. "Hat dir das keiner gesagt?"
George kommt aus Nigeria und lebt mit mir in einem sogenannten Gai-Jin House – Ausländer Haus. Es ist eine billige Pension, in der die meisten Ausländer landen, wenn sie nach Tokio kommen. George ist quasi mein Tutor in Sachen japanischer Etikette. Er ist schon viel länger hier als ich und kennt sich aus. Außerdem spricht er überraschend gut Japanisch. Ein Sprachentalent.
George sieht ein bisschen aus wie ein schwarzer Meister Proper: Er trägt zwei goldene Ohrringe und hat seinen Schädel glattrasiert. Er hat die Krawatten-Jobs hinter sich und legt inzwischen in einem Underground-Club in Shinjuku Platten auf. Dort kann er tragen, was er will. Er leiht mir eine seine Krawatten und klopft mir auf die Schulter: Viel Glück!
Ich bin diesmal auf eigene Faust unterwegs und bekomme keine Spesen von der Redaktion. Also muss ich mich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen. Allerdings habe ich eine lockere Zusage, dass der Sender die Story vielleicht nimmt, wenn sie gut ist.
Die S-Bahn gleitet fast lautlos von Tokio aus in Richtung Yokohama. Ich habe einen Standplatz, halte mich an einem Haltegriff fest und sehe über die Köpfe der Japaner. Hier bin ich größer als der Durchschnitt, und da die Japaner alle ungefähr gleich groß sind, bilden ihre schwarzen Haare eine fast gleichmäßige Fläche. Im prall gefüllten Wagon ist es seltsam ruhig. Niemand unterhält sich, viele haben die Augen geschlossen.

S-Bahn in Tokio
Ein bewölkter, düsterer Tag. Links und rechts der S-Bahn überall nur Häuser. Zwischen Tokio und Yokohama gibt es kilometerlang kaum ein freies Feld.
Der Zug hängt voller Werbeplakate, jede freie Fläche wird ausgenutzt. Quasi als Sport versuche ich einige der Schriftzeichen zu entziffern. Ich habe mal einen Japanisch-Kurs gemacht und kann mich einigermaßen verständigen.
Endlich hält der Zug an der Vorortsiedlung, an der ich aussteigen muss. Es nieselt, und ich werde nass. Weil die Straßen hier keine Namen haben, hat der Typ von der Arbeitsvermittlung mir einen Plan aufgezeichnet. Die Nachhilfe-Schule liegt nur ein paar hundert Meter von der S-Bahnstation entfernt.
Noch drei Minuten bis zum Vorstellungsgespräch.
Ich renne los. Zuspätkommen ist in Japan absolut nicht angesagt. Doch nach ein paar Metern merke ich, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ich renne in die entgegengesetzte Richtung und trete in eine Pfütze. Dreckwasser spritzt an meine Hose. Mist. Aber jetzt bin ich wenigstens richtig. Ich erkenne den Supermarkt, den der Boos der Agentur auf dem Plan eingezeichnet hat, dann auch den Gemüseladen. Die Japaner mustern mich, als ich an ihnen vorbeilaufe. Ausländer sind in den Außenbezirken selten.
Schließlich komme ich in der Nachhilfeschule an. Fünf Minuten zu spät und patschnass. Die Schule ist klein. Ein privates Nachhilfeinstitut, das in einer Vier-Zimmer-Wohnung untergebracht ist. Im Flur toben ein paar Schüler herum, und ich muss daran denken, was der Boss der Agentur mir gesagt hat: "Funny!" hat er gesagt. "Du musst funny sein! Der Rest ist nicht so wichtig."
Funny ...? Was ist in Japan funny?
Die Schule läuft auf privater Basis und ist auf die Schüler angewiesen. Sie müssen gerne kommen, sonst bitten sie ihre Eltern vielleicht, sie auf eine andere Nachhilfeschule zu schicken. Fünf kleine Jungs laufen auf mich zu. "Ein Amerikaner!" rufen sie. "Ein Amerikaner." Einer klammert sich an mein Bein.
Funny, ich muss jetzt funny sein. Aber wie? Ich ziehe wie ein Westernheld zwei imaginäre Colts aus der Hüfte und feure ein paar Schüsse ab.
Stille.
Zuerst denke ich, dass ich alles falsch gemacht habe, aber dann imitieren mich die Jungs und ballern auch in der Gegend herum.
Hinter dem Empfangstresen steht Tanaka, der Chef der Nachhilfeschule. Er ist klein und untersetzt. "Mister Miller?"
"Ja."
"Willkommen."
Tanaka hat ein Formular vor sich. "Darf ich fragen, welche Staatsangehörigkeit Sie haben? Es ist nur für unsere Statistik, wissen sie."
Die Schulen wollen nur Lehrer mit der Muttersprache Englisch, und da muss ich eben mogeln.
"USA."
"USA?"
"Ja, New York. USA."
Tanaka presst seine Zunge zwischen die Lippen und notiert. "New York, USA. Mister Miller. - Vorherige Anstellung?"
Ich zähle ein paar Schulen auf, die der Boss der Agentur mir genannt hat. In Wirklichkeit ist es mein erster Job als Englischlehrer.
Ich sitze im Unterricht. Eine Menge Bänke, aber nur zwei Schüler. Das überrascht mich. Ich habe eine ganze Klasse erwartet. Der eine Schüler hat einen Pagenschnitt und sitzt etwas gebückt am Tisch. Seinen dicken Anorak hat er angelassen. Die Haare des anderen sind zentimeterkurz und auf seinem T-Shirt steht "Tokyo Tigers".
Ich lasse die beiden die Bücher aufschlagen und eine Leseübung machen. "Jim, Peter and Mary live in San Francisco ..."
Während des Unterrichts bin ich etwas unsicher. Ich habe noch nicht den richtigen Dreh raus und komme öfter ins Stocken. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Boss hinter der Tür steht und horcht. Nach einer Stunde habe ich die Sache hinter mir und fahre mit der S-Bahn zurück nach Tokio.
"Na, alles geklappt?" fragt Meister Propper George.
"Weiß noch nicht."
Ich mache seine Krawatte ab und werfe sie ihm zu. "Danke."
Ich stehe in der Gemeinschaftsküche der Pension und mache mir etwas zu essen. Während ich koche, spielt der zehnjährige Sohn des Herbergsvaters mit einem ferngesteuerten Feuerwehrauto. Ab und zu fährt das Auto gegen meine Füße. Im Gemeinschaftsraum gucken zwei Argentinier Fernsehen: eine nervige Game Show. Die Wände sind dünn und man kriegt fast alles mit, was die anderen zwanzig Leute machen, die auch noch hier wohnen.
Mein Zimmer ist zwei Meter breit, zwei Meter lang und einen Meter zwanzig hoch. Ich kann darin nicht stehen, nur aufrecht sitzen. Eigentlich ist es mehr ein Schlafsarg, denn ein Fenster habe ich auch nicht. Und dafür 500 Dollar. Aber das ist eben Tokio.
Am nächsten Tag bin ich mit der U-Bahn auf dem Weg nach Shimbashi. Inaba, der Chef der Arbeitsagentur, hat mich angerufen. Ich soll bei einer Privatstunde einspringen, denn einer der Lehrer ist kurzfristig ausgefallen. Inaba hatte mir auch den Job in der Nachhilfeschule in Yokohama vermittelt, der Boss dort hat sich allerdings nicht mehr gemeldet. Wahrscheinlich war ich nicht funny genug.
Inabas Agentur liegt im zweiten Stock eines grauen Bürogebäudes. Über der Eingangstür ein Plastikschild: "Future Communication Center". Die Agentur besteht aus einer Lobby und zwei kleinen Unterrichtsräumen. Inaba vermittelt Sprachlehrer und Übersetzungsaufträge und bietet auch private Sprachkurse in seiner Agentur an. Er sitzt seiner Sekretärin gegenüber an einem gewaltigen Schreibtisch, der das kleine Büro fast ausfüllt. Der Tisch liegt voller Listen und Papierkram.
Inaba trägt eine blau getönte Pilotenbrille, die leicht schief auf seiner Nase sitzt, seine Haare hat er zu einer Brücke über die fast kahle Schädeldecke gekämmt. Die Sekretärin hat ein hübsches Gesicht, aber stark abstehende Ohren.
"Hello, Mr. Miller", sagt Inaba und zeigt auf eins der Unterrichtszimmer. "Die Schülerin ist schon da. Fortgeschritten. So viel wie möglich Englisch reden." "Funny?"
"Funny!"
Ich sitze mit der Schülerin im Unterrichtszimmer und mache englische Konversation. Haruko ist 25 und arbeitet in einer Bank. Sie hat Pauspacken, wulstige Lippen und eine Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen. Englisch lernt sie nur zum Spaß. Sie plant eine Reise nach Kalifornien.
"Do you like to go to the Disco?" frage ich.
"Oh, yes", sagt Haruko und kichert. "I love dance. Can ask where you from?"
"New York."
"New York?"
"Yes."
Irgendwie komme ich mir vor wie ein Pausenclown. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass die Japaner nur Englischstunden nehmen, weil sie sehen wollen, wie ein Ausländer sich abstrampelt.
Als ich mit dem Unterricht fertig bin, will ich, dass Inaba mich auszahlt. Auch für die Sache in Yokohama schuldet er mir noch das Geld.
"Bei uns ist immer am zehnten Zahltag", sagt Inaba und zeigt auf den Kalender. "Heute ist der 28."
"Ja okay, sage ich. "Aber kann ich nicht ausnahmsweise einen Vorschuss kriegen?"
Inaba verzieht das Gesicht und sieht zu seiner Sekretärin. "Wieviel haben wir in der Kasse?"
Die Sekretärin zieht eine Schublade auf und nimmt ein dünnes Bündel Geldscheine heraus, das mit einer Büroklammer zusammengehalten wird. Inaba zählt das Geld unter dem Tisch. Dann gibt er mir einen 10.000-Yen-Schein - Ungefähr 100 Euro.
Im Hallenbad läuft leise Instrumentalmusik. Die Umkleidekabine ist voller japanischer Männer, die sich stumm umziehen. Sie schieben ihre Sachen vorsichtig in die Schließfächer, so, als würde irgendwo in der Nähe ein Kind schlafen, das sie nicht aufwecken wollen. Als ich mich ausziehe, bemerke ich einige verstohlene Blicke. Die meisten Japaner sind neugierig, wie ein Ausländer unten herum aussieht.
Ich bin aufgeregt, denn heute ist der große Tag. Mit Inabas sporadischen Aufträgen verdiene ich einfach nicht genug, und deshalb habe ich mich noch für einen anderen Job beworben: Heute Abend werde ich das erste Mal als Animateur und Eintänzer in einem Animierlokal in Roppongi arbeiten. Das stelle ich mir aufregend vor. Man plaudert mit japanischen Damen, tanzt mit ihnen, bekommt Freidrinks und kriegt das Ganze dann auch noch bezahlt. Wenn ich meine Sache gut mache, stellt Shima mich ein. Und genau deshalb bin ich auch im Schwimmbad. Ich weiß, dass ich nach ausgiebigem Schwimmtraining einfach frischer aussehe.
Am Eingang der Schwimmhalle wate ich durch ein fast kniehohes Wasserbecken. Automatisch sprühen zwei Duschstrahlen von links und rechts auf mich ein. Eine Art Menschen-Waschanlage. Man kann unmöglich ins Schwimmbad kommen, ohne vorher abgeduscht zu sein.
Das Bad ist gut besucht. Außer mir kein einziger Ausländer. Ich fixiere einige hübsche Japanerinnen und stelle mir vor, dass ich heute Abend mit der einen oder anderen von ihnen tanzen und flirten werde. Ich nehme mir vor, an diesem Tag nichts mehr zu essen. Ich werde höchstens noch einen Tee trinken. Mit leerem Magen sehe ich einfach besser aus!
Als ich meinen Fuß ins Wasser setze, um eine Runde zu schwimmen, höre ich plötzlich einen schrillen Pfiff und eine Ansage durch Megaphon:
"Gai-jin san - Herr Ausländer, bitte zum Bademeister kommen."
Dann noch einmal: "Herr Ausländer, bitte kommen Sie zum Bademeisterstand!"
Die Bademeisterloge ist am Kopfende des Beckens. Ein Typ mit Trillerpfeife sitzt zusammen mit einer Assistentin auf einem zwei Meter hohen Podest. Er zeigt auf meinen Hals. Ich weiß zuerst nicht, was er meint, verstehe dann aber, dass ich die Halskette ausziehen soll. Sicherheitsvorschrift. Ich gehe zurück in die Kabine und schließe das Kettchen ein. Als ich wieder in die Schwimmhalle komme, muss ich nochmal durch die automatische Dusche.
Ich bin kaum im Becken, als ich plötzlich wieder eine Durchsage höre, die ich nicht richtig verstehe. Innerhalb von ein paar Sekunden ist das Schwimmbecken leer. Ich bin der einzige, der noch darin herumpaddelt.
Wieder eine Durchsage: "Herr Ausländer, bitte verlassen Sie das Becken!"
Ich schwimme an den Rand, setze mich auf eine Bank neben dem Schwimmbecken und sehe mich um. Ein paar Leute machen Gymnastik. Ich frage meinen Nebenmann, was los ist. Er kreuzt die Zeigefinger. "Yasumi!" - Pause!
Jede volle Stunde wird einmal für fünf Minuten ein Break eingelegt. Sicherheitsvorschrift. Damit sich niemand überanstrengt.
Dann dürfen wir wieder ins Wasser. Nach und nach kommen immer mehr Besucher, und die Schwimmhalle ist extrem voll. Trotzdem bleibt alles unter Kontrolle: Die Bahnen sind mit Schwimmbojen voneinander abgetrennt, und man darf nur hintereinander schwimmen.
Am Anfang der Bahn muss ich Schlange stehen und warten, bis ich drankomme. Dann kann ich ungefähr zehn Meter schwimmen und stoße auf die Schlange auf der anderen Seite. So geht das immer im Kreis. Zehn Meter schwimmen, zwei Minuten Schlange stehen, zehn Meter schwimmen, zwei Minuten Schlange stehen. Das Wasser im Schwimmbecken reicht nur bis knapp über den Bauchnabel. Sicherheitsvorschrift. So ist ein Ertrinken praktisch ausgeschlossen.
Ich fahre mit der U-Bahn ins Roppongi-Viertel. Freitagabend. Das Abteil ist voller Leute, die sich herausgeputzt haben. Es riecht nach Duschgel und Eau de Toilette.
Ich mustere ein paar Frauen. Zwei Office-Ladies Anfang zwanzig, eine Mitvierzigerin mit Hut, eine ältere Dame im Kimono. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was für ein Typ von Frau in so eine Animier-Bar geht. Ich bin auf einmal unsicher. Wie soll ich mich dort verhalten? Soll ich auf die Frauen zugehen, sie zum Tanzen auffordern? Kommen sie auf mich zu? Oder soll ich erst einmal Kommunikation machen?
Beim Austeigen in Roppongi reihe ich mich in die nach unten Schlange ein. Man kann hier nicht einfach laufen, wo man will. Die Treppe des U-Bahnhofs ist durch ein Geländer in nach unten und nach oben geteilt. Bei der Masse der Menschen, entstünde sofort ein Chaos, würde man die Flussrichtung nicht beachten. Ein eindrucksvolles Bild: vor mir hunderte von eng nebeneinander laufenden Japanern. Da sie alle schwarze Haare haben, entsteht beim Hinunterlaufen eine Art schwarze Welle.

Tokio bei Nacht
Die Straßen in Roppongi wimmeln von Menschen. Das nächtliche Vergnügungsviertel ist von Neonreklamen hell erleuchtet. Aus einer Spielhalle klingt das Rattern von Pachinko-Kugeln. Pachinko ist eine Art japanischer Flipper, bei dem man Preise gewinnen kann. An fast jeder Ecke in Tokio gibt es so eine Pachinko-Halle.
Das "Outline" ist ein schon etwas heruntergekommener Hostess-Club. Die Überzüge der Bänke haben an manchen Stellen Brandlöcher. Doch im Dunkeln fällt das nicht so auf.
Die meisten Hostess-Clubs in Tokio sind nur für Männer. Im "Outline" dagegen verkehrt gemischtes Publikum. Deshalb brauchen sie eben auch einen Eintänzer.
Es sind noch keine Gäste da. Am Tisch neben dem Eingang sitzen drei rausgeputzte Asiatinnen. In der hintersten Ecke des Raumes blättert der Boss in einer Zeitschrift, macht eine fast unmerkliche Bewegung mit dem Kopf. Ich soll zu ihm kommen.
Shima zieht an seiner Zigarettenspitze und mustert mich. Er trägt ein sandfarbenes Jackett und College-Schuhe aus Straußenleder. Seine Augen sind schmal und kalt. Eidechsenaugen. Er will, dass ich mich einmal im Kreis drehe. Dann will er, dass ich mich hinsetze. Er sieht auf meine Schuhe, schiebt dann plötzlich mein linkes Bein nach unten, das ich über das rechte geschlagen habe. "Hier hast du so zu sitzen, klar?!"
Shima demonstriert in welchem Abstand ich die Beine hinstellen soll. "Und jetzt zeig mir deine Finger!"
Er begutachtet meine Fingernägel, schüttelt den Kopf. "Das geht so nicht!" Er gibt mir eine Nagelfeile. "Die müssen besser manikürt werden!"
Ich stehe am Waschtisch in der Toilette und feile meine Fingernägel. Shima geht mir ziemlich auf den Zeiger, aber was soll ich machen?
Schließlich der erste Gast. Eine Frau. Als sie reinkommt, müssen sich die Hostessen und ich in einer Reihe neben der Tür aufstellen. Die Frau ist Anfang dreißig und arbeitet in der Werbebranche. Eine Stammkundin. Sie trägt eine ausgewaschene Jeansjacke und macht einen coolen Eindruck.
Shima ist wie verwandelt. Wenn die Frau etwas sagt, lacht er andauernd. Er winkt, dass ich zu ihm kommen soll.
"Ein Neuer. Gefällt er dir?"
Die Frau mustert mich kurz und zieht an ihrer Zigarette.
"Willst du mit ihm tanzen?"
"Nein. Im Moment nicht."
Dann kommt eine Gruppe rein. Zwei Frauen und drei Männer. Die Männer sind schon ziemlich betrunken. Der eine hat seinen Schlips wie ein Stirnband um den Kopf gebunden, sein Kollege trägt das Jackett falsch herum. Es sieht aus, als ob er in einer Zwangsjacke steckt. Der dritte hat seine Hose bis über die Knie gekrempelt und läuft barfuß. Die Schuhe sind mit den Schnürsenkeln zusammengeknotet und hängen über seiner Schulter. Die Gruppe findet das anscheinend witzig. Sie lachen ständig.
Ich hatte es befürchtet. Shima lässt mich singen. Ausgerechnet "My way" von Frank Sinatra. Ich kann nicht besonders gut singen, und "My way" gehört auch nicht gerade zu meinem Repertoire, doch ich komme nicht darum herum. Karaoke ist in Japan Nationalsport, da muss jeder mal ran.
Der Text des Songs flimmert vor mir auf einem Bildschirm, und ich singe das Lied runter so gut ich kann. Nach einer Weile werde ich sicherer und gestalte die ganze Sache mit dem Arm. "And though mistakes I've made a few, I did it myyyy way ...!"
Zu meiner Überraschung bekomme ich Applaus. Vielleicht war ich doch nicht so schlecht.
Eine der Hostessen, eine hübsche Thailänderin, setzt sich auf den Schoss des Typen mit dem Schlips-Stirnband. Sie krault sein Kinn, zieht sie ihn dann hoch zum Tanzen. Auch die anderen Hostessen tanzen mit den Gästen.
Shima macht mir ein Zeichen: "Los, du auch!"
Ich schiebe eine kleine Dicke übers Parkett. Sie hat eine goldene Schleife im Haar, kichert andauernd und fragt, ob ich in dem Club angestellt bin. Ihre Freundin sieht etwas besser aus, trägt ein konservatives, blaues Kostüm.
Ich tanze abwechselnd mit den beiden Cha-cha-cha. Ich bin eigentlich nicht schlecht in Latino-Tänzen, doch die beiden Damen stehen meist auf dem falschen Fuß. Egal, ich hample ein bisschen mit ihnen rum und mache Konversation. Ich bekomme mit, dass sie auf dieselbe Schule gegangen sind und jetzt in einem Kaufhaus arbeiten. Sie kennen sich sogar schon aus dem Kindergarten. In ihrer Freizeit spielen sie zusammen Tennis und den jährlichen Urlaub verbringen sie auch zusammen.
Die männlichen Kollegen der beiden Damen kennen sich auch bereits aus dem Kindergarten. Nur, dass sie nicht Tennis, sondern Baseball spielen. Natürlich im selben Verein. Alle sind Anfang zwanzig und noch solo.
Ich spüre, dass beide Frauen es auf den Typen mit dem Schlips-Stirnband abgesehen haben. Er ist wohl eine Art Abteilungsleiter.
Die hübsche Thailänderin und der Typ mit dem Schlips machen ein Spiel. Sie zeigen mit den Händen "Papier", "Schere", "Stein" oder "Brunnen". Wer einen Durchgang verliert, muss ein Kleidungsstück abgeben. Weil der Typ schon ziemlich betrunken ist, verliert er fast jedes Spiel. Er ist schon halb nackt, als die Thailänderin gerade mal ihr Armband abgelegt hat. Schließlich steht er nur noch in Unterhose da.
Die beiden schaukeln wieder die geballten Fäuste vor sich hin und her: "Eins - zwei - drei!"
Der Japaner zeigt "Papier", die Thailänderin "Schere". Jetzt wäre im Prinzip die Unterhose des Typen dran. Die kleine Dicke mit der Goldschleife im Haar bricht das Schweigen und ruft: "Der Moment der Wahrheit, er ist da!" Sie will dem Mann die Unterhose ausziehen, doch er hält sie fest. "Das gilt nicht, das gilt nicht!"
"Verzeihung, aber das ist meine Sache!" Die Thailänderin schiebt die Japanerin weg, nimmt einen Glas-Aschenbecher und drückt ihn mit der Öffnung vorne auf die Unterhose des Japaners. Sie klopft mit dem Zeigefinger auf den Boden des Aschenbechers, so als wolle sie horchen, ob es dahinter hohl ist. Die ganze Gesellschaft lacht. Sie drückt einen Kuss auf den Boden des Aschenbechers, so dass der Abdruck ihrer roten Lippen zurückbleibt.
Die versammelte Mannschaft klatscht und ruft: "Ichi ban!" - Super!
Der Japaner steckt den Aschenbecher als Souvenir in sein Jackett.
Ich stehe in der Toilette am Waschbecken und sehe mich im Spiegel an. Ich habe den ganzen Tag über kaum etwas gegessen. Mir ist auf einmal entsetzlich schlecht. Plötzlich steht die Thailänderin hinter mir. "Wo bleibst du denn? Wenn du solange wegbleibst, kriegst du kein Geld."
"Egal."
Ich stehe vor dem Outline auf der Straße, bin einfach abgehauen. Es ist plötzlich sehr kalt geworden. Ich friere. Dennoch, die frische Luft tut gut. Es ist dunkler jetzt, denn die meisten Neonreklamen sind ausgeschaltet. Ich lockere den Schlips, öffne den Knopf am Hals und atme einmal tief durch.
Die U-Bahn fährt nicht mehr, und ein Taxi kommt nicht in Frage. Viel zu teuer. Ich weiß ungefähr, wo ich bin und beschließe, nach Hause zu laufen. Einige Betrunkene torkeln die Straße entlang. Einer singt ein japanisches Marschlied. Vor einem Nudelimbiss spült der Besitzer die Straße mit einem Wasserschlauch.
Mein Heimweg zieht sich länger hin als gedacht. Nach einer halben Stunde habe ich erst etwa ein Drittel der Strecke geschafft. Die Füße tun mir weh, und ich bleibe stehen. Eine öde Gegend. Alles dunkel. Auf einer Hochstraße fahren Laster vorbei.
Mir fallen wieder die Fahrräder auf, die überall herumstehen. Einige sind nicht abgeschlossen und stehen bestimmt schon jahrelang an derselben Stelle. Die Sattel sind verstaubt, und in den Körbchen auf den Gepäckträgern liegt Müll.
Die Fahrräder hier haben eine Nummer auf dem Rahmen. Sie sind registriert, und man kann leicht feststellen, wem das Rad gehört. Deshalb werden die Fahrräder meist nur für eine Fahrt gestohlen und dann wieder irgendwo abgestellt. An fast jeder Straßenecke steht eins. Die Polizei sammelt sie nicht ein. Es sind einfach zu viele.
Ich schnappe mir ein Fahrrad, in dessen Körbchen Müll liegt. Es ist nicht angeschlossen, auf den Reifen ist noch Luft.
Ich bin kaum losgefahren, da gehen hinter mir ein paar Scheinwerfer an. Dann eine Megaphon-Ansage. "Hier spricht die Polizei. Bleiben Sie stehen, Herr Ausländer, und steigen Sie vom Fahrrad ab!"
Zwei Polizisten steigen aus ihrem Einsatzwagen und kommen auf mich zu. Sie haben hinter mir gestanden und nur darauf gewartet, dass ich das Fahrrad nehme. Sie führen mich ab. Die Polizeistation ist nur fünfzig Meter entfernt.

Streifenwagen in Tokio
Der leitende Beamte im Polizeirevier ist circa sechzig und hat graue Haare. Auf seinem Schreibtisch stehen mehrere kleine Sumo-Ringer aus Plastik. Daneben liegen zerfledderte Manga , japanische Comic-Books.
Als er hört, was passiert ist, grinst er. Wegen Diebstahls kann man ziemlich viele Schwierigkeiten kriegen und auch sofort ausgewiesen werden. Er fragt, was ich mache, und wieso ich Japanisch spreche. Für einen Ausländer ist das relativ ungewöhnlich.
Ich sage, dass ich an der Uni einen Sprachkurs gemacht habe. Ich bekomme eine Tasse Tee.
"Was haben Sie sich nur dabei gedacht, Herr Ausländer? Ein junger Mann mit Universitätsausbildung. Mit so etwas können Sie sich alles verbauen, alles!" - Ich sage, dass ich meinen Fehler einsehe und es nie wieder tun werde.
Die beiden Polizisten, die mich festgenommen haben, fahren mich mit dem Streifenwagen nach Hause. Der eine fragt mich, was ich für eine Blutgruppe habe. In Japan gibt es eine Untersuchung, die den wirtschaftlichen Erfolg der Deutschen und Japaner darauf zurückführt, dass es in beiden Ländern relativ viele Leute mit der Blutgruppe "A" gibt.
Ich kenne meine Blutgruppe gar nicht und sage: "Null."
"Null?"
"Ja."
Der Beifahrer dreht sich zu mir um. "Wir haben nämlich beide A."
Wieder zuhause im Gai-jin House lasse ich mich erschöpft auf meinen Futon fallen. Mein Zimmer liegt über dem Gemeinschaftsraum und irgendein Mitbewohner muss natürlich um diese Uhrzeit noch Fernsehen gucken.
Plötzlich klopft es an meiner Schiebetür: Mister Proper mit einer Flasche Suntory Whisky, der japanischen Nationalmarke. Er hat seine schwarze Glatze frisch poliert, und sie glänzt im Licht der nackten Glühbirne.
Wir trinken ein Glas Whisky, und George schwärmt wieder von Japan. Verglichen mit Nigeria geht es ihm hier ziemlich gut, und weil er monatlich Geld nach Hause schickt, ist er jetzt dort der King.
Er will wissen, ob ich bei meinem Job als Eintänzer jemanden kennengelernt habe. Ich schüttle den Kopf und erzähle ihm, dass die ganze Sache nicht gerade der Hit war.
"Als Ausländer musst du funny sein", sagt George. "Hast du versucht, funny zu sein?"
"Irgendwie schon."
"Okay, aber vielleicht warst du nicht funny genug …"
Wahrscheinlich hat er recht. Ich war einfach nicht funny genug.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gut fürs Karma
Frage: Wie kann ich die Welt ein kleines bisschen besser machen?
Antwort: Indem ich für dieses Buch einen Leserkommentar hinterlasse! Oder eine Sternebewertung! Ein paar Klicks, und schon ist das Karma gerettet!
Und hier geht's zum Kommentar bei Amazon.
Falls der Link nicht funktioniert, hier der Pfad zum Kopieren in den Browser:
https://www.amazon.de/review/create-review/?asin= B07XWNFZD7
Oder einfach Buchtitel bei Amazon eingeben.
Sowas wie das folgende Beispiel (frei nach Goethe) genügt völlig:
Mehr davon!
"Flotte Geschichten, die einen rund um den Globus führen."
Du kannst es kurz machen wie im obigen Beispiel oder auch ganz anders und viel mehr schreiben. Wir freuen uns über jeden Kommentar, auch wenn er kritisch ist. Kritik kann manchmal sehr hilfreich sein!
Wem ein Kommentar zu viel Arbeit ist, der kann auch nur eine Sterne-Bewertung hinterlassen ohne Kommentar. Verbessert die Welt ebenfalls und ist gut fürs Karma!
___________________________________________
Fragen, Zweifel, Anregungen ...
Bei Fragen jedweder Art einfach eine E-Mail an:
Wir antworten garantiert innerhalb von 24 Stunden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
M ehr vom Autor:
Die Welt ist meine Auster – Reiseberichte (Teil 2)

Ein Gartenzwerg am Broadway, ein Elvis Imitator, der alle seine Freundinnen "Engelchen" nennt und ein gefälschtes Zebra in Tijuana. Der Gürtel des heiligen David, zwei verschollene Sakkos in L.A. und die Feinheiten des Klopapiers in Kairo. Ein Song, der russische Mafiosi zum Weinen bringt, ein Huhn, das monatelang ohne Kopf überlebt und ein jamaikanischer Cowboy, der singt wie John Denver. – Das alles und noch viel mehr erlebt Matthias Drawe im zweitenTeil seiner Reiseberichte.
"Noch schräger als der erste Teil!"
"Storys, die man in einem normalen Reiseführer nicht finden würde."
"Herkömmliche Sehenswürdigkeiten tauchen bei Drawe fast gar nicht auf. Er konzentriert sich auf die Menschen und fährt in Gegenden, in denen ein normaler Tourist nie landen würde."
(Leserkommentare bei Amazon)
1. DIE MOSKITOS VON MOSKAU – Kontaktsport mit russischen Blutsaugern
Bsss, bsss, bsss … Die verdammten Moskitos machen mich wahnsinnig. Ich ziehe die Bettdecke über den Kopf, doch jetzt kriege ich keine Luft mehr. Außerdem habe ich das Gefühl, dass mich die Viecher sogar durch die Decke stechen.
Die Moskitos hier sind mörderisch. Sie sind mindestens doppelt so groß wie die deutschen und wahnsinnig blutrünstig.
Zwar hat meine Ferienwohnung Moskito-Gitter vor den Fenstern, doch sie sind nicht dicht. Irgendwo muss ein Loch sein, das ich noch nicht entdeckt habe. Oder vielleicht sind einige der Maschen zu groß, so dass die Biester dort durchschlüpfen können.
Jedenfalls kann ich so viele Moskitos killen, wie ich will, es kommen immer neue. Und die Fenster schließen kann ich auch nicht. Der Sommer in Moskau ist einfach zu heiß. Man stirbt vor Hitze, wenn man die Fenster nicht aufmacht.
Es ist jetzt der dritte Tag, an dem ich kaum ein Auge zugetan habe. Ich bin vollkommen zerstochen und muss mich ständig jucken.
Am Anfang habe ich versucht zu kämpfen. Bei eingeschaltetem Licht habe ich sie mit einem vergilbten russischen Modejournal stundenlang nachts gejagt. Wieder und wieder habe ich das Journal gegen die Decke geklatscht, bis schließlich eine Art "Moskitomuster" entstanden ist. Aber wenn ich das Licht ausmache, weil ich denke, ich habe sie alle erledigt, summen ein paar Minuten später neue Sturzflieger auf mich nieder.

Ferienwohnung in Moskau
Das Mobiliar meiner Wohnung scheint noch aus Sowjet-Zeiten zu stammen. Ist irgendwie okay, denn schließlich bin ich aus Neugier hier. Ein bisschen Patina kann nicht schaden.
Anhand von Statistiken hat die russische Hauptstadt inzwischen die höchste Milliardärsdichte der Welt. Doch in meiner Wohnung scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Vielleicht war sie auch deshalb so günstig.
Besonders ein Detail ist interessant: Das Radio. Es stammt ebenfalls noch aus Sowjetzeiten und hat nur einen einzigen Knopf: den zum ein- und ausschalten. Daher kann man auch nur einen Sender empfangen: Das Staatsradio. Irgendwie praktisch, denn dann muss man nicht lange rumsuchen.

Sowjet-Radio mit nur einem Knopf
Ein Aspekt der russischen Ingenieurskunst fasziniert mich: Die Einfachheit. Da ist zum Beispiel der Wettlauf ins All. Die Amerikaner hatten damals Sensorschalter. Wenn die ausfallen, dann ist eine Reparatur unendlich schwierig. Die Russen hatten mechanische Kippschalter. Die kann man mit einem Schraubenzieher auswechseln. Die Amerikaner hatten Probleme mit ihren Kugelschreibern, denn die funktionieren in der Schwerelosigkeit nicht. Die Russen haben Bleistifte benutzt.
"Bsss, bsss, bsss …" Die Moskitios sind jetzt auch am Tag aktiv. Ich kann mich praktisch nicht in der Wohnung aufhalten, denn sie attackieren mich von allen Seiten.
Ich muss etwas gegen die Biester tun, sonst werde ich verrückt. Aber was? Der Fahrstuhl in dem riesigen Wohnkomplex ist schon sein Tagen kaputt, also laufe ich die Treppe runter.
Ich frage die Concierge unten an der Tür. Leider spricht sie nur Russisch. Ich versuche es mit nonverbalen Mitteln. Ich summe wie ein Moskito: Bsss..., bsss..., steche dann mit meinem Fingernagel in meinen Arm und drehe mich wie ein Tanzbär im Kreis, um deutlich zu machen, dass mich die Viecher zur Raserei bringen.
Die Concierge nickt. Sie hat verstanden. Sie trägt eine Kittelschürze, und die obere Reihe der Schneidezähne ist aus Gold.
"Mosqui-go. Irish House!" sagt sie. Sie zeichnet einen Straßenplan. Anscheinend gibt es im Irish House , was immer das auch sein mag, ein Mittel gegen Moskitos.
Auf der Straße ist wie immer viel Verkehr. Ich verstehe einfach nicht, wo in dieser Steinwüste die vielen Moskitos herkommen. Aus der Moskwa? Aus dem Gorki Park? Oder gibt es vielleicht einen Sumpf hier in der Nähe? Vielleicht ist es auch ein undichter Wassertank auf dem Dach. Egal, wo immer die Viecher auch herkommen, ich kann das Problem nicht lösen, also bleibt nur ein Mittel mit dem ich zumindest meine Wohnung moskitosicher machen kann.
Das Irish House befindet sich in einem sozialistischen Plattenbau in einer belebten Einkaufsstraße. Es ist ein Laden mit einem Sammelsurium von Billig-Waren.
Ende der Vorschau für dieses Kindle eBook.
Details dieses eBooks im Kindle Shop anzeigen
Die Welt ist meine Auster – Reiseberichte (Teil 3)

Ein Balanceakt auf dem Äquator, das Geheimnis der schwarzen Amex Karte und der Zahn des Buddha. Eishockey in Miami, Komiker in New York, die es verdammt ernst meinen und eine original chinesische Akupunktur beim Karneval in Rio. Nächtliche Gesänge in Helsinki, ein stinkender Haufen in Versailles und das Wunder von Mailand. – Das alles und noch viel mehr erlebt Matthias Drawe im dritten und (vorerst) letzten Teil seiner Reiseberichte.
"Hab's in einem Stück gelesen, da es mich nicht losgelassen hat"
"Tolle Reiseberichte. Gut gefallen haben mir auch die Hintergrundinfos, die bei den Berichten enthalten war."
"Witzige und lustige Anekdoten. - Infektionsgefahr Reisefieber!!"
(Leserkommentare bei Amazon)
Leseprobe:
1. ZEIG MIR DEINE SCHUHE, UND ICH SAGE DIR, WER DU BIST – Schuhverkäufer in Manhattan
"Bei uns kommen Millionäre und jede Menge Popstars rein", sagt Micky. "Und dann kommen, unter Anführungsstrichen, unsere Lieblingskunden: die Cash Bezahler, die Drogenhändler." Er lacht. "Und die sind meistens relativ groß und relativ breit, wahrscheinlich genauso lang wie breit, und die marschieren dann bei uns rein mit Turnschuhen, T-Shirts, riesigen Sonnenbrillen, und draußen steht vielleicht der Ferrari oder so, wir sehen das ja nicht ..."
Willkommen, Damen und Herren! Wir befinden uns in den heiligen Hallen eines internationalen Modedesigners, dessen Name hier leider ungenannt bleiben muss. Nur so viel: Manhattan, 5th Avenue. Und: der ehemalige Papst Benedikt hat eine Vorliebe für die Marke. Außerdem soll sogar der Teufel sie tragen!
Micky, ein Österreicher, der hier als Schuhverkäufer arbeitet, hat seine wenigen Haare komplett abrasiert und die Glatze auf Hochglanz poliert. Er trägt wie die anderen Verkäufer einen schwarzen Designeranzug, ein schwarzes Hemd, eine schwarze Krawatte und schwarze Designerschuhe. Natürlich die Hausmarke. Micky hat Charme und ein sympathisches Lächeln. Sein Wiener Schmäh kommt selbst auf Englisch durch: Er spricht mit österreichischem Akzent.
"Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo fünf von diesen Schränken reinkamen", sagt Micky, "und alle mindestens zusammen über dreitausend Kilo schwer waren und einkaufen wollten. Und jeder hatte mindestens Schuhgröße 46 oder 47, so groß waren diese Typen. Und wir haben die natürlich bedient und alles rausgebracht, und das passt, und das passt, und die wollen immer mehr und mehr, und dann waren wir irgendwann bei Schuh 25, und die haben gesagt: Okay, jetzt reicht’s, wir wollen bezahlen. 25 Paar Schuhe, das sind zwölftausend Dollar mindestens. Und da haben wir natürlich gefragt: Kreditkarte? - Nein, nein, wir bezahlen Cash. Und die haben dann lauter Bündel von Zwanzig-Dollar-Scheinen und Fünf-Dollar-Scheinen und Zehn-Dollar-Scheinen rausgeholt. Das war mindestens ein halbes Kilo Geld, das wir da zählen mussten, bis wir dann endlich an den zwölftausend dran waren. Es war so viel Geld, das hat gar nicht in die Kasse reingepasst. Diese Typen kommen einfach rein, die haben Kohle, die schauen gefährlich aus, aber letztendlich sind sie auch Kunden, die bedient werden müssen und Schuhe brauchen."
Drei junge Damen treten ein, und Micky bedeutet mir, dass ich ihn kurz entschuldigen soll. Er legt sein charmantes Lächeln auf und fragt, ob er behilflich sein darf. Die drei bejahen – dem Akzent nach sind es Brasilianerinnen - und haben eine ziemlich genaue Vorstellung, was sie wollen. Sie zeigen Fotos von Damenschuhen auf ihren Handys. Micky nickt. Kein Problem.
Ich nehme auf einem der eleganten Sitzelemente Platz und lasse den Laden auf mich wirken. Die Einrichtung ist durchgängig in creme-weiß, braun-schwarz und Chrom gehalten. Überall scharfe Kanten. Der Boss des Modehauses richtet seine Flagship Stores persönlich ein. Er mag keine abgerundeten Ecken. Sogar die Monitore, auf denen Videos von Fashion Shows laufen, sind mit cremefarbenen, scharfkantigen Säulen verkleidet.

Damenschuhe im Flagship Store
Micky balanciert ein paar Schuhkartons durch den Gang und lässt seinen Charme spielen, während er die drei Brasilianerinnen bedient. Er macht einen kleinen Witz, präsentiert mit einer schwungvollen Geste einen eleganten Sommerschuh und lobt bewundernd die schlanken Fußgelenke der Damen. Ein Kompliment, das dankbar entgegengenommen wird.
Der Store-Manage, der ein futuristisches Phone-Headset auf dem Kopf trägt, steht plötzlich neben mir. "You need help, sir?"
”I’m with Micky”, sage ich . "We are friends." Der Manager mustert mich kurz, wirft einen Blick auf meine Schuhe und ignoriert mich ab jetzt.
Meine ausgetretenen Budapester scheinen hier keinen besonderen Eindruck zu machen. Meine Klamotten sind auch nicht gerade hip, sondern eher ein Ensemble, dass sich in die Straßenszene in Manhattan einpasst, ohne weiter aufzufallen: helles Sakko, schwarzes Hemd, schwarze Anzughose und eben die Budapester.
Ich brauche dringend ein Update. Deshalb bin ich hier. Ich will mir Anregungen holen, um mir später beim Discounter etwas Ähnliches zu besorgen.
Ich schlendere durch die Herrenabteilung und betrachte die Schuhe. Ein Paar gefällt mir besonders gut. Schlicht, elegant, stylisch. Preis: 490 Dollar.

Herrenschuhe im Flagship Store
Micky steht neben mir. Er zeigt zur Kasse: die Drei Brasilianerinnen haben jeweils ein paar Schuhe gekauft. Das freut ihn, denn er arbeitet auf Kommissionsbasis.
Ich erzähle ihm, dass der Store-Manager meine Schuhe gecheckt.
Micky grinst. "Jeder, der reinkommt, wird beobachtet, und das erste, auf das wir natürlich schauen, sind die Schuhe. Und wenn jemand reinkommt mit einem Billigschuh, dann können wir annehmen, dass das wohl jemand ist, der nicht so viel für einen Schuh bei uns ausgeben möchte."
Stimmt. Jedenfalls habe ich noch nie 490 Dollar für ein Paar Schuhe ausgegeben. Ganz einfach deshalb, weil ich fast immer knapp bei Kasse bin.
Micky hat erwähnt, dass auch Popstars im Laden einkaufen. Wer denn zum Beispiel?
"Die ganzen Hip-Hop Stars: P. Diddy, Snoop Dogg, mein Gott, wie die auch alle heißen, Jennifer Lopez, Lady Gaga, alles Mögliche, was wirklich Rang und Namen hat. Eigentlich haben wir fast jeden Tag solche Kaliber. Aber für mich ist das eine ganz normale Geschichte. Die kommen rein, die werden bedient, die kaufen ein, und dann sind sie eben wieder weg."
Szenenwechsel.
Nur zwei Straßen weiter ist Bergdorf Goodman, seit den dreißiger Jahren eine New Yorker Institution und eine völlig andere Welt als der auf cool gestylte Designerladen, in dem Micky arbeitet.

Eingangspforte von Bergdorf Goodman
Bergdorf Goodman, ein Kaufhaus der Luxusklasse, nimmt einen ganzen Häuserblock ein, ist konservativ, barock, plüschig und sündhaft teuer. Macy’s und Bloomingdale’s sind nichts dagegen.
Distinguierte Damen und Herren von Mitte vierzig an aufwärts - gekleidet in feinstes Tuch und ausgestattet mit teuren Accessoires - wandeln durch die eleganten Verkaufsräume. Wer hierher kommt, hat es geschafft und macht das auch nach außen deutlich. Selbst astronomisch hohe Preise lösen nicht mal ein Wimpernzucken aus. Doch der Schein trügt, wie ich ziemlich schnell erfahren werde.
Ende der Vorschau für dieses Kindle eBook.
Details dieses eBooks im Kindle Shop anzeigen
Fast ganz oben (Roman)

Jungfilmer Hardy ist kurz davor, wahnsinnig zu werden. In "Fast ganz oben" erzählt er seine unglaubliche Geschichte. Und zwar so, wie es wirklich war. Die nackte Wahrheit. Ohne Blümchenmuster.
"Kompromisslos, ehrlich und ohne Rücksicht auf Verluste."
"Wunderbar schräge Szenen."
"Könnte sein, dass du danach eine Zigarette brauchst."
(Stimmen zur englischen Ausgabe bei Amazon.com)
Leseprobe:
1. ALLES NORMAL
"DANKE, DANKE, DANKE!!!" Ich strecke die Arme gen Himmel und starre auf das einzige weiße Wölkchen da oben. In meiner Hand die Notiz von Floyd Burns.
Ich stehe am Ufer des East Rivers in Brooklyn. Barfuß und halbnackt. Bin ich verrückt geworden? Gut möglich nach allem, was passiert ist. Eigentlich halte ich mich für normal, doch alle Verrückten halten sich für normal. Es sind immer die anderen, die verrückt sind. Nein, wahrscheinlich bin ich noch normal. Allein der Gedanke, dass ich verrückt sein könnte, macht mich normal. Ein Verrückter hält sich ja nicht für verrückt. Fazit: Mein analytischer Geist funktioniert einwandfrei, also bin ich normal. Jedenfalls den Umständen entsprechend.
Ein junges Pärchen mit einem Kinderwagen steht hinter mir. Sie starren mich an und denken wahrscheinlich, dass ich aus der Klapsmühle abgehauen bin, aber das ist mir egal. Ich weiß, dass ich normal bin, und das ist alles was zählt. Plötzlich drehen sie um und gehen zurück in Richtung Williamsburg.
Ich werfe einen Blick auf die Skyline von Manhattan. Fast unglaublich, dass dort drüben irgendwann mal Indianer rumgesprungen sind.

Eigentlich wohne ich dort drüben, mitten im Gewimmel. In Williamsburg war ich noch nie, obwohl es schon eine ganze Weile hip ist. Ich bin hier, weil das Büro von Floyd Burns in Williamsburg liegt. In einer umgebauten Fabriketage. Äußerst cool, klar. Und deshalb ist Floyd Burns auch in Williamsburg. Manhattan ist out, eine Fabriketage in Williamsburg extrem in. Floyd Burns! Eigentlich ist er an allem schuld. Ohne ihn wäre ich niemals durch die Hölle gegangen.
Nein, stopp, Burns ist NICHT an allem schuld. Wenn ich das denken würde, wäre ich wahrscheinlich verrückt. Aber ich bin nicht verrückt. Nein, nein, ich bin nicht verrückt, und ich bin an den meisten Sachen selbst schuld. Kein Mensch hat mich gezwungen, in die Haut von Steven C. Cornfield zu schlüpfen, Gott hab ihn selig. Und niemand hat mich dazu gezwungen, mit Jackie in das Hotelzimmer am Times Square zu gehen oder mit Kristen bei der Beerdigung eine ganze Flasche Tequila zu kippen. Nein, das waren alles meine Entscheidungen und nicht die von Burns.
Aber so einfach ist es wieder auch nicht. Denn schließlich führt immer eins zum anderen, und unter den Umständen waren meine Entscheidungen nicht verrückt, sondern normal. Oder zumindest verständlich. Ja, verständlich, das ist das richtige Wort. Normal war das sicherlich alles nicht.
Ich starre auf die Notiz von Burns. Er hat sie auf ein kleines, gelbes Post-It gekritzelt. Dazu hat er wahrscheinlich drei Sekunden gebraucht. Drei Sekunden seiner kostbaren Zeit als Antwort auf monatelange, schweißtriefende Arbeit. Ich habe die Notiz schon mindestens zwanzig Mal gelesen und weiß noch immer nicht ob ich lachen oder weinen soll.
Ich kann das hingeworfene Gekrakel nicht mehr sehen. Mit einer energischen Geste zerknülle ich das Papier und katapultiere die Kugel in den Mund. Das Zerkauen der Notiz wirkt beruhigend. Als ich den Papierbrei gut eingespeichelt habe, schlucke ich ihn runter und rülpse einmal genüsslich.
Ich spüre plötzlich den Drang, jemandem meine Geschichte zu erzählen. Alles zu beichten sozusagen. Wie bei der Konfession in der Kirche. Ich bin zwar im Prinzip katholisch, war aber noch nie bei der Beichte. Und ein Pfarrer würde das alles auch gar nicht verstehen wahrscheinlich. Oder er würde es einfach abnicken und mich zwanzig Vater-Unser sprechen lassen, denke ich mal. Ein Pfarrer hätte auch gar keine Zeit, sich diese verzwickte Geschichte anzuhören. Wie lange hat man wohl bei der Beichte. 20 Minuten? Keine Ahnung, denn ich war ja noch nie bei der Beichte. Aber viel mehr als 20 Minuten hat man sicher nicht. Und in 20 Minuten kriege ich die Geschichte nicht unter. Dazu ist sie zu kompliziert.
Ich muss es aufschreiben. Als Therapie sozusagen. Nur so werde ich nicht verrückt. Aber wo fange ich an? Am besten in Franciscos Büro. Bis dahin war noch alles einigermaßen normal. Den Umständen entsprechend. Nein, natürlich war es schon vorher nicht normal. Wenn ich normal sage, dann meine ich immer den Umständen entsprechend, denn so richtig normal im normalen Sinne war es eigentlich nie.
Ich sehe Franciscos Büro vor mir, als ob es gestern gewesen wäre, obwohl es schon fast neun Monate her ist. Es war an einem von diesen frostigen Wintertagen, an denen die Kälte bis in die Knochen zieht.
2. FRANCISCOS BÜRO
Franciscos Büro ist schön warm, aber unaufgeräumt. Wie immer. An der Wand hängt ein Poster von La Dolce Vita , und auf einer Ablage steht ein kleiner Safe. Francisco ist Kolumbianer und Ende vierzig. Unrasiert, rundliches Gesicht, Kugelbauch.
Er ist am Telefon und bedeutet mir, dass ich mich setzen soll. Ich spüre, dass etwas nicht stimmt und werde nervös.
"Ja doch", sagt Francisco in den Hörer. "Das Fax vom Konsulat ist eingegangen, aber ich kann's nicht finden." Er verdreht die Augen. "Klar ist das peinlich, aber was soll ich machen? Sag doch einfach, sie sollen es nochmal schicken."
Francisco leitet ein Off-Kino im East Village und ist gut vernetzt. Er ist nicht nur mein bester, sondern auch mein einziger Kontakt in New York. Zumindest in der Filmszene. Er präsentiert die Reihe New Talent, Fresh Faces und lädt dazu Filmemacher aus aller Welt ein. Oft besorgt er auch die Visen, und deshalb hat er ein Fax. Die meisten Konsulate kommunizieren noch immer über Fax.
Vor drei Wochen hat er versprochen, mein neues Drehbuch an Floyd Burns weiterzugeben, doch wenn ich im Kino anrufe, ist die Leitung besetzt. Oder Jimmy nimmt ab. Und Jimmy hat keine Ahnung. Außerdem kann er mich nicht leiden. Und ich ihn auch nicht. Jimmy dreht Kurzfilme. Schlechte Kurzfilme. Und genau deshalb kann er mich nicht leiden, denn mein Film ist schon in der Reihe New Talent, Fresh Faces gelaufen, seine Kurzfilme dagegen nicht. Und das, obwohl er die rechte Hand von Francisco ist. Jimmy hat kein Talent, und wahrscheinlich weiß er das sogar selbst. Deshalb ist er auch einer der Vorführer im Kino: Er denkt, dass er besser wird, wenn er sich so viele Filme wie möglich reinzieht. Nun ja, vielleicht lernt er was, könnte schon sein. Bisher hat sich das aber noch nicht in seinem Werk niedergeschlagen. Selbst ein dreiminütiger Kurzfilm von Jimmy dauert gefühlt eine Ewigkeit.
Ende der Vorschau für dieses Kindle eBook.
Details dieses eBooks im Kindle Shop anzeigen
W ilde Jahre in West-Berlin (Roman)

Die Irrungen und Wirrungen junger Hausbesetzer in West-Berlin. Liebe, Verrat und Straßenschlacht. Hoffnung, Tränen und Punk. Und mittendrin der Spastiker Heiner, der unbedingt dazugehören will.
"Mit viel Ironie und Witz schildert Drawe das Unverständnis zwischen den Generationen. Ein Zeitdokument."
"Eine Studie zum Gruppenverhalten, die beweist, dass man Schokopudding nicht im Gemeinschaftskühlschrank aufbewahren sollte."
"Vorsicht: Es könnte das Bedürfnis entstehen, ein Haus zu besetzen!"
(Rezensionen bei Amazon)
Nach Heiners Sturz war alles aus. Zwei Tage nachdem die Feuerwehr ihn abtransportiert hatte, rückten die Bullen an. Fünf Uhr morgens. Zehn Wannen.
Der Donnerschlag, mit dem die Ramme die Eingangstür aus den Angeln sprengt, weckt mich auf. Das ganze Haus erzittert, sogar das Wasser in der Flasche neben meinem Bett. Ich höre Stiefel die Treppe hochstampfen und verzerrte Schreie durch ein Megaphon. Sekunden später fliegt die Tür auf: drei Bullen in Kampfuniform. Sie bauen sich in einer Dreiecksformation vor meinem Bett auf, doch ich sage nur: "Okay, Leute, ich komm ja schon."
Ich höre, wie Lilly nebenan schreit. Ihr Körper schlägt gegen die Wand, und Glas klirrt zu Boden. Lilly ist dünn, doch wenn sie wütend wird, kann sie unwahrscheinliche Kräfte entwickeln. Die Bullen zerren sie auf den Flur. Sie kreischt, zappelt hin und her und beißt um sich, doch schließlich wird sie an allen vieren den Korridor entlanggetragen. Ihr Nachthemd ist bis über die nackte Scham hochgerutscht.
Die Bullen zerren uns auf die Straße. Sie bilden einen Kreis um uns damit keiner abhaut. Ein paar Nachbarn glotzen aus den Fenstern. Es ist kalt.
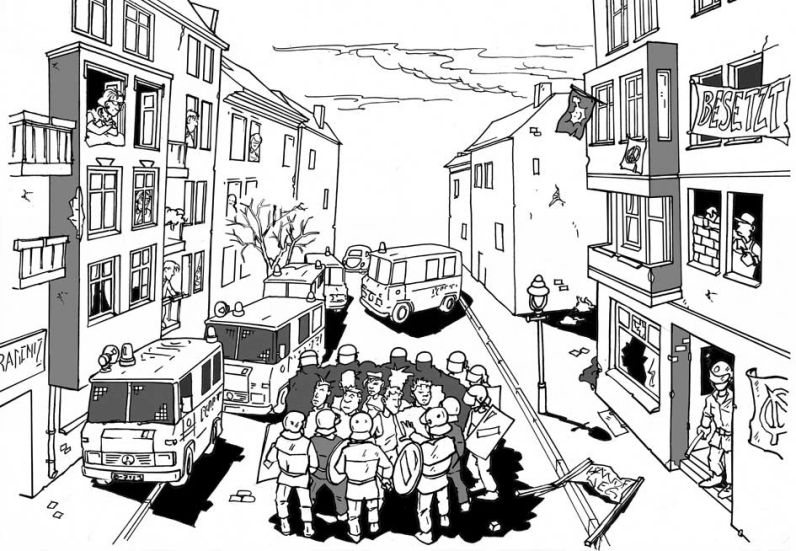
"Richtig so", ruft die Alte von gegenüber. "Endlich wird dieses Gesocks eingelocht."
Gerlinde Steinmöller hockt wie immer an ihrem Fenster im 3. Stock und mischt sich in alles ein. Manchmal benutzt sie sogar ihr Opernfernglas, um zu checken, was es bei uns zum Mittagessen gibt.
Candy streckt ihr den Finger hin. "Besorg's dir selber, du alte Qualle!"
Lilly heult, und Falk umarmt sie. Kermit, Pflaume und Carla stehen regungslos da und verziehen keine Miene. Kugelblitz spuckt auf den Boden.
Diesmal haben die Bullen auch Maurer dabei. Während sie die Fenster verbarrikadieren, lässt der Oberhäuptling uns noch mal rein. Einzeln. Und nur drei Minuten. Wir sollen unsere Sachen holen.
Ich renne die Treppe hoch, schnappe meine Gitarre und den Verstärker und werfe einen letzten Blick auf meine Habseligkeiten: die roten Vorhänge mit dem Anarcho-A, das Schlafpodest, das ich aus Holzresten gebaut habe, und mein altes Röhrenradio. Unmöglich, dass ich das alles in drei Minuten rauskriege. Also bye-bye.
Mist, ich hab das Sex Pistols Poster vergessen! Es ist mehr wert als alles andere.

Ich löse das Plakat vorsichtig von der Tür, rolle es zusammen und stecke es ins Hemd.
Vor ein paar Jahren bin ich mit nur zwanzig Mark in der Tasche nach Amsterdam getrampt, um mir eins der ersten Pistols Konzerte reinzuziehen, als sie in Deutschland noch kein Schwein kannte. Steve Jones höchstpersönlich hat das Poster signiert!
Als ich an der Küche vorbeikomme, erinnere ich mich an unsere gemeinsamen Mittagessen, an die frischen Eier aus dem Hühnerstall und daran, wie wir das Haus wieder in Schuss gebracht haben.
Ich sehe die Straßenschlacht vor mir, die brennenden Autos und die Wasserwerfer. Ich erinnere mich an den wahnsinnigen Auftritt unserer Band, die schrägen Kostüme auf der Jubiläumsparty und an den Apfelkuchen, den Kugelblitz zur Science Fiction Nacht gebacken hat ...
Doch jetzt soll das alles auf einmal vorbei sein. Und warum? Heiner ist schuld. Es hat alles vor einem halben Jahr angefangen, als dieser Idiot plötzlich auf unserem Plenum auftauchte.
2. PLENUM
Zehn vor neun sehe ich durch die halboffene Tür des Gemeinschaftsraums: Nichts. Ich gehe in die Küche, doch da ist auch niemand. Das Plenum ist eigentlich immer montags um acht, doch das heißt bei uns, dass es so gegen neun anfängt.
Ich setze mich auf eine Matratze im Gemeinschaftsraum und drehe mir eine. Einer muss schließlich der erste sein. Fast der ganze Raum ist mit alten Matratzen ausgelegt, und in der Mitte steht ein flacher Tisch mit einem herzförmigen Aschenbecher drauf. Die Fenster sind an manchen Stellen mit Plastikfolie geflickt, und das Ofenrohr haben wir durchs halbe Zimmer verlegt. Das gibt mehr Wärme so.
Ich blase Rauchkringel in die Luft und betrachte meine Füße. Hab mir ein Paar Doc Martens besorgt. Second-Hand. Sind zwar schon etwas ausgelatscht, doch das ist sogar besser so. Meine Jeans sind an einigen Stellen aufgerissen, und auf meinem selbstgemachten T-Shirt steht : NeVEr mINd thE bOLLOCkS.
Ende der Vorschau für dieses Kindle eBook.
Details dieses eBooks im Kindle Shop anzeigen
Englisch lernen mit moderner Literatur

Einfache Sprache und jugendliches Thema — ideal für Fortgeschrittene. Zweisprachiges Layout und Illustrationen erleichtern das Verständnis. Kein Wörterbuch erforderlich!
Die Geschichte wird aus der Ich-Perspektive im Präsenz erzählt. Der Held benutzt genau die Sprache, die man im täglichen Umgang braucht. Historischer Kontext von West-Berlin im Nachwort.
Die Story ist ein eBook Bestseller: Die Irrungen und Wirrungen junger Hausbesetzer. Liebe, Verrat und Straßenschlacht. Hoffnung, Tränen und Punk. Und mittendrin Spastiker Heiner, der unbedingt dazugehören will.
"Eine gute Lektüre zum Formen und Festigen der Englischkenntnisse."
"Für Fortgeschrittene zum Englischlernen optimal."
"Aufgrund der kurzen, farblich unterschiedlichen Paragraphen (erst Englisch, dann Deutsch) braucht man kein Wörterbuch! Zeichnungen lockern das Ganze gekonnt auf."
(Kundenrezensionen, Amazon)
1. JUDGMENT DAY – DER JÜNGSTE TAG
_____
After Heiner’s fall, it was all over. Two days after the ambulance picked him up, the cops moved in. At five o'clock in the morning. Ten combat units.
Nach Heiners Sturz war alles aus. Zwei Tage nachdem die Feuerwehr ihn abtransportiert hatte, rückten die Bullen an. Fünf Uhr morgens. Zehn Wannen.
_____
The battering ram knocks our front door off its hinges, jolting me awake. The entire house shakes. Even the water in the bottle beside my bed.
Der Donnerschlag, mit dem die Ramme die Eingangstür aus den Angeln sprengt, weckt mich auf. Das ganze Haus erzittert, sogar das Wasser in der Flasche neben meinem Bett.
_____
I hear boots pounding up the stairs and distorted yelling through a loudspeaker. Moments later, my door pops open: three cops in combat uniforms. They form a battle triangle in front of my bed, but I just say: "Easy guys, I’m coming."
Ich höre Stiefel die Treppe hochstampfen und verzerrte Schreie durch ein Megaphon. Sekunden später fliegt die Tür auf: drei Bullen in Kampfuniform. Sie bauen sich in einer Dreiecksformation vor meinem Bett auf, doch ich sage nur: "Okay, Leute, ich komm ja schon."
____
I hear Lilly screaming next door. Her body hits the wall, and glass shatters.
Ich höre, wie Lilly nebenan schreit. Ihr Körper schlägt gegen die Wand, und Glas zerbricht.
_____
Lilly is skinny, but when angry, she can develop unbelievable strength. The cops drag her into the hallway.
Lilly ist dünn, doch wenn sie wütend wird, kann sie unwahrscheinliche Kräfte entwickeln. Die Bullen zerren sie auf den Flur.
_____
She keeps screaming and wriggling back and forth, biting around. But eventually, they subdue her and haul her away by the outstretched arms and legs. Her worn-out nightie rides up, exposing her vagina.
Sie kreischt, zappelt hin und her und beißt um sich, doch schließlich wird sie an allen vieren den Korridor entlanggetragen. Ihr schlabbriges Nachthemd ist bis über die nackte Scham hochgerutscht.
____
The cops drag us out on the street, encircling us, so no one can escape. The neighbors stare out the windows. It's cold.
Die Bullen zerren uns auf die Straße. Sie kreisen uns ein damit keiner abhaut. Die Nachbarn glotzen aus den Fenstern. Es ist kalt.

_____
"Great!" yells the old hag from across the street. "Finally, this ragtag will be locked up."
Gerlinde Steinmöller always sits by her window on the 4th floor and meddles in just about anything. Occasionally she even uses her opera binoculars to check what we are having for lunch.
"Richtig so", ruft die Alte von gegenüber. "Endlich wird dieses Gesocks eingelocht."
Gerlinde Steinmöller hockt wie immer an ihrem Fenster im 3. Stock und mischt sich in alles ein. Gelegentlich benutzt sie sogar ihr Opernfernglas, um zu checken, was es bei uns zum Mittagessen gibt.
_____
Candy flips her the bird. "Screw yourself, sweetie."
Candy streckt ihr den Finger hin. "Besorg's dir selber, du alte Qualle!"
_____
Lilly sobs, and Falk gives her a hug. Kermit, Carla and Pflaume stand motionless while keeping a straight face. Kugelblitz spits in the gutter.
Lilly heult, und Falk umarmt sie. Kermit, Candy und Pflaume stehen unbeweglich nebeneinander und verziehen keine Miene. Kugelblitz spuckt auf den Boden.
_____
This time, the cops have brought bricklayers. As the windows are cemented shut, the head honcho lets us in again to get our stuff. Separately. Just three minutes each.
Diesmal haben die Bullen auch Maurer dabei. Während sie die Fenster zuzementieren, lässt der Oberhäuptling uns noch mal rein, damit wir unsere Sachen holen können. Einzeln. Und nur jeweils drei Minuten.
____
I jump up the stairs and grab my guitar and the amp. I cast one last look at my belongings: the red curtains with the anarchist-A, my sleeping platform, built from scrap wood, and my old tube radio.
Ich renne die Treppe hoch, schnappe meine Gitarre und den Verstärker und werfe noch einen letzten Blick auf meine Habseligkeiten: die roten Vorhänge mit dem Anarcho-A, das Schlafpodest, das ich aus Holzresten gebaut habe, und mein altes Röhrenradio.
_____
There's no way I can get it all out in three minutes, so I just have to kiss it good-bye.
Unmöglich, dass ich das alles in drei Minuten rauskriege. Also, bye-bye.
_____
Shoot, I forgot the Sex Pistols poster! It's worth more than anything! I carfully loosen it from the door and slide it into my shirt.
Mist, ich hab das Sex Pistols Poster vergessen! Es ist mehr wert als alles andere. Ich löse es vorsichtig von der Tür und stecke es ins Hemd.

_____
Some years ago, I hitchhiked with only twenty marks in my pocket to Amsterdam to check out one of the first Pistols concerts. They were virtually unknown in Germany at the time. I even managed to get Steve Jones's autograph on the poster!
Vor ein paar Jahren bin ich mit nur zwanzig Mark in der Tasche nach Amsterdam getrampt, um mir eins der ersten Pistols Konzerte reinzuziehen, als sie in Deutschland noch kein Schwein kannte. Steve Jones höchstpersönlich hat das Poster signiert.
____
As I walk past the kitchen, I remember our joint lunches, the fresh eggs from the chicken coop and how we fixed up the house.
Als ich an der Küche vorbeikomme, erinnere mich an unsere gemeinsamen Mittagessen, an die frischen Eier aus dem Hühnerstall und daran, wie wir das Haus wieder in Schuss gebracht haben.
_____
I see the street riot in front of me, the burning cars and the water cannons. I remember the insane gig with our band, the hilarious costumes at the anniversary party and the apple strudel that Kugelblitz used to bake for sci-fi night …
Ich sehe die Straßenschlacht vor mir, die brennenden Autos und die Wasserwerfer. Ich erinnere mich an den wahnsinnigen Auftritt unserer Band, die schrägen Kostüme auf der Jubiläumsparty und an den Apfelstrudel, den Kugelblitz zur Science Fiction Nacht gebacken hat ...
_____
But now, it all seems to have come to an end. And why? It's Heiner's fault. It all started when this idiot suddenly showed up at our community meeting half a year ago.
Doch jetzt soll das alles auf einmal vorbei sein. Und warum? Heiner ist schuld. Es hat alles vor einem halben Jahr angefangen, als dieser Idiot plötzlich auf unserem Plenum auftauchte.
Ende der Vorschau für dieses Kindle eBook.
Details dieses eBooks im Kindle Shop anzeigen
ÜBER DEN AUTOR
Weitere Informationen über den Autor auf Wikipedia .

Matthias Drawe