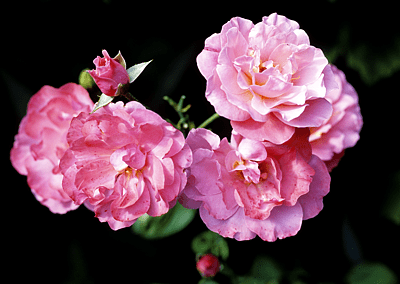2 Natur, Architektur, Sachen und Tiere
Vom Hausrecht bis zur Panoramafreiheit
»Solange ich keine Menschen oder deren Eigentum fotografiere, ist doch alles okay.« – Ist das tatsächlich so einfach, und gibt es ein Recht am Bild der eigenen Sache? In diesem Kapitel geht es um die Sachfotografie im weitesten Sinne, und ich werde die Frage beantworten, ob die Rechtslage tatsächlich so ist, wie sie von vielen eingeschätzt wird.
Wenn ich Fotoclubs besuche und meinen Vortrag zu Foto- und Bildrecht halte, zeige ich zu Beginn regelmäßig einige Beispielfotos aus unterschiedlichen Genres, verschiedene Sachaufnahmen, vorwiegend aus dem Bereich der Architektur, aber auch Aufnahmen, auf denen Personen teilweise deutlich, teilweise weniger deutlich zu erkennen sind. Ich bitte die Teilnehmer, die zu diesem Zeitpunkt noch nichts von den rechtlichen Inhalten meines Vortrags gehört haben, darum, mir ihre Einschätzung mitzuteilen, ob die gezeigten Fotos ohne Einschränkung überhaupt gemacht werden und später dann auch ohne Zustimmung Dritter veröffentlicht werden durften. Sehr oft fallen die Antworten der Teilnehmer recht sicher und relativ einhellig aus, dass man nämlich in der Regel alles fotografieren dürfe, solange man die Fotos nur für sich privat mache. Wenn es sich um reine Sach- oder Landschaftsaufnahmen ohne abgebildete Personen handelt, wird zumeist auch die anschließende Verwertung der Fotos für völlig unproblematisch gehalten. Die Teilnehmer sehen es also fast ausnahmslos als unkritisch an, Fotografien, auf denen keine Personen zu sehen sind, sowohl anzufertigen als auch zu verwerten und auch gewerblich zu nutzen.
Bei Fotos, auf denen Personen abgebildet sind, sind die Teilnehmer dann doch schon etwas zurückhaltender und unsicherer in ihrer Meinung und meist der Auffassung, dass die Herstellung der Fotos zwar rechtlich unproblematisch sei, wenn sie zu privaten Zwecken angefertigt und nicht veröffentlicht würden, die Verwertung eines solchen Fotos aber möglicherweise kritisch und von einer Genehmigung oder Einwilligung der abgebildeten Person abhängig sein könnte.
Abbildung 2.1 Niemand zweifelt an der Zulässigkeit dieses Fotos. Zu Recht?
Fasst man die Meinungen der überwiegenden Zahl von Amateuren, aber auch von nicht wenigen Berufsfotografen zusammen, ergibt sich nach meiner Erfahrung ungefähr folgende Aussage:
Niemand kann es dem Fotografen in der Regel verbieten, Sachaufnahmen herzustellen und zu verwerten, bei Personenaufnahmen darf das Foto zwar gemacht, aber nicht ohne Zustimmung der fotografierten Person verwertet werden.
Diese Aussage klingt zunächst ganz plausibel, aber stimmt das auch so? Leider ist die fotografische Freiheit in der Realität deutlich eingeschränkter, als es zunächst scheint. Denn schon bei der Herstellung eines Fotos kann es Einschränkungen oder sogar Verbote geben, die bei Nichtbeachtung zu unangenehmen Konsequenzen führen können, mit denen wir uns auch an späterer Stelle in diesem Buch (siehe Kapitel 6, »Rechte schützen«) noch eingehend beschäftigen werden. Dies gilt erst recht für die unautorisierte Verwertung eines ohne Genehmigung hergestellten Fotos. Doch genug der Vorrede, sehen wir uns nun die Details an!
2.1 Natur, Architektur, Sachen und Tiere fotografieren
Niemand wird ernsthaft auf die Idee kommen, einem Fotografen zu sagen, dass er einen Pilz wie in Abbildung 2.2 nicht einfach fotografieren darf, sondern dazu zunächst die schriftliche Genehmigung der jeweiligen Forstverwaltung einholen muss.
Das Gleiche gilt für die Aufnahme von Vögeln auf den Bäumen und allem, was einem in der Natur ansonsten so vor die Linse kommt.
Abbildung 2.2 Nur mit Genehmigung der Forstverwaltung zu fotografieren?
[ ! ] Freie Landschafts- und Naturfotografie
Solange man Landschaften und die freie Natur, ihre Pflanzen, Bäume und Tiere fotografiert, gibt es in der Tat keinerlei rechtliche Probleme. Alles, was man frei zugänglich und ohne ein fremdes Hausrecht zu verletzen fotografieren kann, darf man auch fotografieren. Niemand kann einen daran hindern, denn die freie Natur und alles, was man dort an meist »herrenlosen« Motiven findet, unterliegen selbstverständlich keinem urheberrechtlichen Schutz.
Schwieriger wird es schon, wenn es um die Frage geht, ob die unbeschränkte Freiheit zu fotografieren auch dann gilt, wenn Sachen fotografiert werden, die sich nicht in der freien, jedermann zugänglichen Landschaft, sondern eindeutig auf Privatgelände befinden, d. h. auf Grund und Boden, der der Öffentlichkeit nicht oder nur eingeschränkt zugänglich ist. Hier könnten gleich mehrere Schutzbereiche betroffen sein, nämlich das Eigentumsrecht, das Hausrecht oder auch das Urheberrecht, gegebenenfalls auch noch das Markenrecht – viele Aspekte, mit denen wir uns im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch ausführlich befassen werden.
[zB] Ihre nette Nachbarin etwa, eine begeisterte Rosenzüchterin, hat in ihrem Vorgarten wunderschöne Sträucher dieser Königin der Blumen. Sie möchten die Blütenpracht gerne fotografisch festhalten und fotografieren vom Bürgersteig oder von Ihrem Grundstück aus in den Vorgarten der Nachbarin hinein, ohne diesen zu betreten.
Abbildung 2.3 Der Stolz der Nachbarin, aber frei fotografierbar?
Die Nachbarin erweist sich nun als doch nicht so nett, wie Sie immer gedacht haben, denn sie ist der festen Meinung, Sie begingen mit der Fotografie ihrer Rosen eine Rechtsverletzung, denn die Blumen stünden auf ihrem Eigentum, und deshalb dürfe nur sie selbst, andere jedoch nur mit ihrem Einverständnis, die Rosen fotografieren. Ist sie damit im Recht?
[zB] Der Eigentümer eines ausgefallenen und gepflegten Oldtimers, den Sie vor einem Haus sehen, versucht Ihnen klarzumachen, dass Sie sein Fahrzeug nur gegen Zahlung einer Gebühr ablichten dürften. Darf er das tatsächlich?
Abbildung 2.4 Kann der Eigentümer die Fotografie von einer Gebühr abhängig machen?
Mit anderen Worten: Die Eigentümer einer Sache machen ihr Eigentumsrecht als Begründung dafür geltend, dass Sie deren Sachen nicht fotografieren dürfen. Sie reklamieren für sich als Eigentümer somit ein »Recht am Bild der eigenen Sache«. Gibt es das überhaupt, und wie ist die Rechtslage? Zu der Frage, ob Gegenstände, die keinen anderen geschützten Rechten (wie Hausrecht, Urheberrecht etc.) unterliegen, frei fotografierbar sind, gibt es eine völlig eindeutige und über Jahre gefestigte Rechtsprechung. Schon mehrfach haben sich Gerichte, bis hin zum Bundesgerichtshof (BGH), dem höchsten deutschen Zivilgericht, mit der Frage befasst, ob durch das Fotografieren einer Sache das Recht des Eigentümers verletzt werde.
Da mit einer Fotografie die Substanz der Sache nicht angegriffen und die Verfügungsbefugnis des Eigentümers nicht beeinträchtigt wird, stehen dem Eigentümer die Abwehr- und Unterlassungsansprüche, die in §§ 903, 1004 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt sind, nicht zu (im Wortlaut nachzulesen unter www.gesetze-im-internet.de/bgb). Ansprüche auf Abwehr und Unterlassung stehen nur demjenigen Eigentümer zu, der durch Eingriffe von außen in seinem Eigentumsrecht unmittelbar beeinträchtigt wird, etwa indem jemand von außerhalb des Grundstücks Gegenstände auf sein Grundstück wirft. Liegt dieser Fall vor, hat der Eigentümer natürlich einen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch. Das bloße Fotografieren einer Sache stellt jedoch eine solche Einwirkung nicht dar. Das heißt also, dass der Eigentümer das Fotografieren seines Eigentums dulden muss.
Wegweisend für diese völlig herrschende Meinung ist die Entscheidung des BGH (Urteil vom 09.03.1989 – I ZR 54,87 – »Friesenhaus«), der folgender Fall zugrunde lag:
Ohne Zustimmung des Eigentümers wurde ein 1740 auf Sylt erbautes Haus im friesischen Stil, mit Sprossenfenstern, Reetdach und Dachgauben, fotografiert, und die Fotos wurden anschließend in einer Werbebroschüre auch verwertet. Der Eigentümer des Hauses machte urheberrechtliche Ansprüche (er hatte die Fassade des Hauses gerade renoviert, was er als schützenswertes Werk ansah) und eigentumsrechtliche Ansprüche geltend. An dieser Stelle interessieren uns zunächst nur die Eigentumsrechte, zumal der BGH in dem konkreten Fall Urheberrechte an der frisch renovierten Fassade wegen mangelnder Schöpfungshöhe ohnehin verneint hatte. Der Eigentümer war der Meinung, bereits mit dem Fotografieren seines Hauses werde sein Eigentum verletzt. Der BGH hat sich in dieser Entscheidung sehr ausführlich mit dem Eigentumsrecht auseinandergesetzt und festgestellt, dass der Eigentümer zwar mit seinem Eigentum nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen könne, da das Eigentumsrecht das umfassendste Herrschaftsrecht an einer Sache sei, das unsere Rechtsordnung kenne. Gleichzeitig hat das Gericht jedoch festgestellt, dass das Fotografieren des Hauses ein Vorgang sei, der die Verfügungsbefugnis des Eigentümers nicht im Mindesten tangiere und keinerlei Auswirkung auf die Nutzung der Sache habe. Deshalb sei das Fotografieren des Hauses vom Eigentümer hinzunehmen.
In einer Reihe weiterer Entscheidungen, die auf Basis dieser Friesenhaus-Entscheidung ergingen und in denen es auch um ohne Genehmigung fotografierte Gebäude ging – einmal war es eine Jugendstilvilla, ein anderes Mal ein Fachwerkhaus –, wurde die Rechtsprechung des BGH immer wieder bestätigt. Auch das Foto einer Segeljacht oder eines sonstigen Gegenstandes darf ohne Einwilligung des Eigentümers hergestellt und in einer Werbebroschüre verwendet werden.
[ ! ] Kein Recht am Bild der eigenen Sache
Frei fotografierbar sind somit in der Regel alle Sachen, auch alle architektonischen Werke wie Häuser, Burgen, Kirchen, Brücken u. Ä. Dies gilt auch für Gegenstände, die sich auf fremdem Grund und Boden befinden, solange man beim Fotografieren den fremden Grund und Boden nicht ohne Erlaubnis des Eigentümers oder des berechtigten Besitzers (zum Beispiel des Mieters) betritt.
Es gibt zwar ein Recht am eigenen Bild, das uns in Kapitel 3, »Menschen«, beschäftigen wird, aber unsere Rechtsordnung kennt grundsätzlich kein Recht am Bild der eigenen Sache!
Für die zuvor angeführten Beispiele gilt also: Sie dürften sowohl die Rosen im Garten der Nachbarin als auch den Oldtimer genehmigungsfrei fotografieren.
Auch Gegenstände, die zur Privatsphäre eines anderen gehören, können dann, wenn sie in der Öffentlichkeit frei sichtbar sind, frei fotografiert werden. Auch die zum Trocknen auf der Leine aufgehängte Wäsche der Nachbarin oder des Nachbarn können Sie, wenn diese für Sie ein reizvolles Motiv abgibt, fotografieren, solange Sie dazu das fremde Grundstück nicht betreten.
Von wo aus diese Sachaufnahmen gemacht werden, ist im Übrigen völlig unerheblich. Dies kann von der Straße oder vom eigenen Grundstück aus geschehen. Sobald sich allerdings der Nachbar durch geeignete Sichtschutzmaßnahmen (wie etwa durch einen hohen Zaun) davor geschützt hat, dass sein Eigentum für alle sichtbar (fotografierbar) ist, stellt die bewusste Umgehung dieser Sichtschutzvorrichtungen im Zweifel eine Verletzung des Hausrechts und ein unzulässiges »Eindringen« in die Privatsphäre dar. Sie sollten – unabhängig von allen Fragen des Takts und Anstands – in solchen Fällen besser auf die Aufnahme(n) verzichten, wenn Sie sich nicht unnötigen rechtlichen Ärger einhandeln wollen. Keinesfalls sollten Sie jedoch versuchen, die Sichtschutzvorrichtung gezielt dadurch zu umgehen, dass Sie durch Astlöcher im Holzzaun fotografieren oder Leitern und sonstige Hilfsmittel benutzen.
Eine Teilnehmerin an meiner Vortragsveranstaltung erzählte, sie sei auf einer Veranstaltung gewesen, bei der es um Pferde ging. Der Veranstalter hatte keinerlei Fotografierverbot verfügt, man konnte dort also überall fotografieren. Sie sei zu der auf dem öffentlich zugänglichen Veranstaltungsgelände liegenden Koppel gegangen, um dort eines der Pferde zu fotografieren, als plötzlich die Eigentümerin des Pferdes wütend auf sie zugelaufen gekommen sei und ihr lautstark zu verstehen gegeben habe, dass es verboten sei, ihr Pferd zu fotografieren. Es sei beinahe zu Handgreiflichkeiten gekommen, als die Fotografin diesem Verbot nicht nachkommen wollte. Letzten Endes hat sie auf eine Aufnahme verzichtet.
Gilt also für Tiere etwas anderes als für Sachen? Muss man mit dem Besitzer eines Tieres etwa ein Model Release oder ein Property Release abschließen, bevor man die Kamera auslösen darf?
[+] Model und Property Release
Ein Model Release ist ein Vertrag mit einem Model, in dem die Fotografiererlaubnis und Art und Umfang der späteren Bildnutzung geregelt werden.
Unter Property Release versteht man in erster Linie einen Vertrag mit einem Eigentümer, der dem Fotografen das Recht verleiht, auf dessen Grund und Boden zu fotografieren. Darüber hinaus wird dieser Begriff auch zur Bezeichnung eines Vertrags verwendet, mit dem ein Urheber dem Fotografen gestattet, sein urheberrechtlich geschütztes Werk zu fotografieren.
In Kapitel 7, »Vertragsrecht«, werde ich auf beide Begriffe noch im Detail zurückkommen. Vertragsvorlagen für beides können Sie unter www.rheinwerk-verlag.de/recht-fuer-fotografen_4375 herunterladen.
Abbildung 2.5 Ist für dieses Foto ein »Model Release« oder ein »Property Release« erforderlich?
Bis August 1990 galten Tiere noch als Sachen. Als solche hat für sie zweifellos nichts anderes gegolten als für Rosenblüten, Oldtimer und Wäsche auf der Leine. Im Zuge der Stärkung des Tierschutzes und einer damit verbundenen Novellierung des Tierschutzgesetzes (TierSchG) gelten seit dem 01.09.1990 Tiere zwar ausdrücklich nicht mehr als Sachen, dies steht so in § 90a BGB. Da sie damit aber auch noch nicht Mensch geworden sind, werden die zivilrechtlichen Vorschriften, die für Sachen gelten, jedoch weiterhin auf Tiere angewandt. Auch dies ergibt sich unmittelbar aus der Vorschrift des § 90a BGB. Somit gilt das oben Gesagte, also die freie Fotografierbarkeit, ebenso wie für die Rosen und den Oldtimer auch heute noch für Haus- und Nutztiere.
[+] Informationsquelle »Internet«
Der eine oder andere von Ihnen wird durch die vorangegangenen Ausführungen vielleicht verwirrt sein, haben Sie doch verschiedentlich schon etwas völlig anderes in verschiedenen Internetbeiträgen gelesen. In der Tat findet man im Netz, aber leider auch in einigen Sachbüchern zum Thema Fotografie, deren Verfasser keine Juristen sind, die Aussage, dem Eigentümer eines Tieres stünde das Verfügungsrecht über sein Eigentum zu, weshalb auch nur er darüber entscheiden könne, ob sein Eigentum fotografiert werden dürfe oder nicht. Derartige, grundlegend falsche Aussagen sind leider in erheblichem Maße verantwortlich für bestehende Unsicherheiten, was man denn nun fotografieren darf und was nicht. Diese Auffassung ist jedoch rechtlich völlig haltlos. Sie ignoriert nicht nur die eindeutige Rechtsvorschrift des § 90a BGB, sondern steht auch im diametralen Gegensatz zur ständigen Rechtsprechung des BGH, insbesondere zur dargestellten Friesenhaus-Entscheidung.
Wenn nach dem Gesetz für Tiere die Vorschriften über Sachen entsprechend anzuwenden sind, dann gelten für das Fotografieren von Tieren natürlich ebenfalls die vom BGH getroffenen Feststellungen in der oben zitierten Friesenhaus-Entscheidung, wonach die Verfügungsrechte des Eigentümers gerade nicht durch den Realakt des Fotografierens berührt werden können.
Mit anderen Worten: Haus- und Nutztiere können ohne Genehmigung des Eigentümers oder Besitzers fotografiert werden. Ansonsten müsste man auch konsequent einen Unterschied machen zwischen herrenlosen Tieren einerseits, die frei fotografierbar sind und für die es naturgemäß gar keine Einwilligung geben kann, und solchen Tieren andererseits, die einem bestimmten Eigentümer oder Besitzer zugeordnet werden können. Woher weiß man aber, ob das Kaninchen auf der Wiese ein wildes und damit herrenloses Kaninchen ist oder ob es sich um »Bunny« handelt, der gerade vor einer halben Stunde seinem Besitzer ausgebüxt ist? Eine solche Unterscheidung innerhalb der Tierwelt ist aus fotografischer Sicht natürlich nicht möglich.
Abbildung 2.6 Gleichgültig, ob Tiere in der Wildnis, wie hier die Wildpferde auf Sardinien, …
Abbildung 2.7 … oder domestizierte Tiere – alle dürfen frei fotografiert werden.
Eine Ausnahme von der Fotografierfreiheit gilt auch für Tieraufnahmen nur dann, wenn man zum Fotografieren eines Tieres unbefugt ein fremdes Grundstück oder Gebäude betritt und damit das Hausrecht verletzt, auf das ich im nächsten Abschnitt noch ausführlich eingehen werde. Frei fotografierbar ist das Tier natürlich auch dann nicht mehr, wenn es nicht fotografiert werden kann, ohne dass der Halter auf dem Foto erkennbar ist. Aber dann wären wir ohnehin schon im Bereich der Personenaufnahmen und dem damit verbundenen Aspekt der Erkennbarkeit, der erst in Kapitel 3, »Menschen«, Thema ist.
Die Teilnehmerin also, die im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschichte vom Pferd erzählt hat, hat sich völlig zu Unrecht einschüchtern lassen. Selbstverständlich durfte sie das Pferd auf der Koppel fotografieren, und zwar auch gegen den Willen der Eigentümerin.
Aber gerade an solchen Beispielen zeigt sich auch das Dilemma, das dadurch entsteht, dass nicht nur die Fotografen häufig über ihre Rechte nur unzureichend informiert sind, sondern auch Eigentümer oder Besitzer oft die Tragweite ihrer Eigentums- bzw. Besitzrechte völlig überschätzen. Vor Ort werden sie sich wohl auch vom Fotografen nicht überzeugen lassen, da dieser in ihren Augen wahrscheinlich ohnehin nur als rechtlich ahnungsloser Störenfried angesehen wird.
Aber was macht der angefeindete Fotograf, insbesondere der Amateur, in einer solchen Situation? Das Mitführen und Hochhalten dieses Buches wäre zugegebenermaßen wohl nicht besonders praktikabel. Man sollte vielleicht besser versuchen, dem jeweiligen »Rechtsinhaber« mit freundlichen Worten zu erklären, wie die Rechtslage ist, ihm schmeicheln, indem man die Schönheit und Seltenheit des zu fotografierenden Objekts lobt, und ihm kurz erklären, warum man es überhaupt fotografieren will und er keine Nachteile dadurch hat. Man könnte auch ein Foto auf dem Display der Kamera zeigen und das Zusenden einiger Fotos anbieten. Mit etwas Glück beruhigt sich der aufgebrachte Eigentümer oder Besitzer, es kommt möglicherweise sogar noch zu einem recht netten Gespräch über das Wetter, die Fotografie und andere Dinge. Wenn man dagegen Pech hat, ist nach halbstündiger und fruchtloser Diskussion nicht nur der Spaß am Fotografieren, sondern auch das schöne Licht für die Aufnahme verschwunden und der Tag verdorben. Da eher wahrscheinlich ist, dass jemand, der so energisch auftritt und seine vermeintlichen Rechte mit Drohgebärden verteidigt, von seiner Meinung nicht abzubringen sein wird, werden viele Fotografen es möglicherweise doch vorziehen, ihre Kamera einzupacken und auf die Aufnahme zu verzichten. Einige wenige werden vielleicht dennoch gegen den Willen des Eigentümers oder Besitzers ihre Fotos machen, auch wenn dieser mit der Polizei oder gar mit Handgreiflichkeiten droht.
Wie Sie im Einzelfall am besten reagieren, müssen Sie situationsbedingt selbst entscheiden. Es kommt sicherlich auf den jeweiligen Einzelfall und auch ein wenig auf die Wichtigkeit der Aufnahme an, Patentrezepte für solche Situationen, die leider immer wieder vorkommen, kann es natürlich nicht geben.
[ ! ] Herstellung von Sachfotos
Die Herstellung von Natur-, Sach- und Tieraufnahmen ist grundsätzlich erlaubt und verletzt weder das Eigentum noch das Persönlichkeitsrecht des jeweiligen Eigentümers, solange die Aufnahme entweder von einem Ort außerhalb des fremden Grund und Bodens oder mit Zustimmung des jeweils Berechtigten hergestellt wurde und solange ausschließlich die jeweiligen Sachen bzw. Tiere und keine dazugehörenden Personen auf dem Foto dargestellt sind.
Wenn im Text häufiger das Wort »grundsätzlich« auftaucht, bedeutet dies für den Juristen immer ein »ja, aber«, im Übrigen eine Redewendung, die uns Juristen ebenso wichtig ist wie die Aussage »das kommt darauf an«. Aber in der Tat ist es auch hier so, dass es zu dem Grundsatz auch Ausnahmen gibt, also solche Fälle, in denen bereits die Herstellung eines Fotos entweder verboten, zumindest aber rechtlich problematisch ist. Die grundsätzlich freie Fotografierbarkeit von Sachen kann durch folgende Aspekte beschränkt sein:
Diesen Ausnahmen werden wir uns nun im Einzelnen zuwenden.
2.1.1 Hausrecht
Eine ganz wesentliche Einschränkung beim Fotografieren von Sachen ist durch das Hausrecht gegeben, mit dem ein Eigentümer oder aktueller Besitzer (wie etwa Mieter, Pächter, Entleiher) Regeln setzen kann, die der freien Anfertigung eines Fotos entgegenstehen können.
Das Hausrecht ist von der Rechtsprechung immer wieder als ein kaum einschränkbares Recht anerkannt worden, das ausschließlich demjenigen zusteht, der de facto über ein bestimmtes Gebäude oder Grundstück verfügen kann, also dem Eigentümer oder dem aktuellen Besitzer. Der jeweilige Hausrechtsinhaber kann allein bestimmen, wer sein Eigentum oder seinen Besitz betritt und was er dort machen darf und was nicht. Allenfalls dann, wenn es sich um ein der Allgemeinheit zugängliches Gelände, zum Beispiel einen zoologischen Garten, handelt, und dort aus völlig sachfremden oder willkürlichen Gründen oder sogar völlig grundlos einzelnen Personen der Zugang verweigert wird, während allen anderen Personen der Zugang gestattet ist, wird man die Ausübung eines Hausrechts rechtlich angreifen können.
Abbildung 2.8 Hier bestimmt der Eigentümer des Kaufhauses Lafayette in Paris, ob man fotografieren darf oder nicht. Ich habe gefragt und durfte. Nicht immer allerdings – wie hier – wird man die Einwilligung auch schriftlich erhalten, was in einem etwaigen Streitfall später die Beweisführung erschweren kann.
Der Hausrechtsinhaber kann für das Betreten seines Eigentums bzw. Besitzes Regeln aufstellen und jeden rechtlich verfolgen oder von seinem Eigentum/Besitz verweisen, der die Regeln nicht einhält. Anders, als der Name vermuten lässt, setzt das Hausrecht auch kein Haus im eigentlichen Sinne voraus, auch auf einer freien Wiese hat der jeweilige Eigentümer oder Besitzer ein Hausrecht.
Daraus folgt ganz eindeutig, dass derjenige, der das Hausrecht hat, auch allein darüber entscheidet, ob und in welchem Umfang und zu welchem Zweck auf seinem Gelände fotografiert werden darf. Die Rechtsprechung geht sogar noch einen Schritt weiter und qualifiziert Aufnahmen unter Verstoß gegen das Hausrecht als Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
[ ! ] Hausrecht
Das Hausrecht ist ein geschütztes Recht, das aus dem Grundsatz der Unverletzlichkeit der Wohnung resultiert, wobei das Hausrecht nicht auf private Räumlichkeiten begrenzt ist, sondern gleichermaßen für gewerbliche und behördliche Räume gilt.
Jeder, der als Eigentümer oder Besitzer die Sachherrschaft über Räumlichkeiten oder Grundstücke hat, kann allein und frei darüber bestimmen, welche Regeln dort gelten. Insbesondere kann er bestimmte Personen von der Nutzung ausschließen oder die Nutzung an Bedingungen knüpfen.
Das Hausrecht kann auf Dritte, wie zum Beispiel den aktuellen Besitzer (Mieter, Pächter, Entleiher etc.), übertragen werden.
Dieses gilt im Übrigen nicht nur für natürliche Personen, sondern auch juristische Personen haben, wie von der Rechtsprechung festgestellt, ein sogenanntes Unternehmenspersönlichkeitsrecht. So hat das KG Berlin (Urteil vom 30.11.1999 – 9 U 8222/99) das Hausrecht der Deutschen Bahn AG bestätigt, als es darum ging, die Herstellung von Fotos mittels versteckter Kamera in ihren Zügen zu verbieten.
Zum Hausrecht gibt es eine ganze Reihe von grundlegenden Entscheidungen. Im Dezember 2010 erging die viel beachtete Entscheidung des BGH im Fall Schloss Sanssouci, die für mächtigen Wirbel gesorgt hat, allerdings galt hier »viel Lärm um nichts«, wie Sie noch sehen werden. Denn die Sanssouci-Entscheidung stellt nur eine Fortsetzung der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Hausrecht dar, weshalb sie im Ergebnis im Grunde genommen auch nicht überraschen konnte.
[+] Nochmals: Informationsquelle »Internet«
Wie immer, wenn lieb gewonnene Gewohnheiten oder vermeintliche Rechte infrage gestellt werden, gab es auch im Zusammenhang mit der Sanssouci-Entscheidung des BGH eine ganze Reihe von Äußerungen, nicht zuletzt in zahlreichen Internetforen. Ich kann allerdings auch hier nur dringend davor warnen, sich rechtliche Informationen »stückweise« aus solchen Quellen zusammenzusuchen. Neben der fehlenden Gesamtdarstellung sind viele Kommentare und Schlussfolgerungen schlichtweg falsch.
[zB] Der Entscheidung des BGH (eigentlich sind es drei Parallelverfahren mit ähnlich gelagerten Sachverhalten, 17.12.2010 – V ZR 44/10, 45/10 und 46/10) liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Klägerin war die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, die aufgrund eines Staatsvertrags die Aufgabe hat, die ihr übergebenen Kulturgüter zu pflegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das umfasst über 150 historische Gebäude und ca. 800 Hektar Gartenanlagen in Berlin und Brandenburg, zu denen auch Schloss Sanssouci gehört. Die Stiftung wehrte sich dagegen, dass Foto- und Filmaufnahmen der Kulturgüter auf ihrem Grundbesitz – hier dem Schlosspark von Sanssouci – ohne ihre Genehmigung angefertigt und vermarktet wurden, und verlangte Unterlassung und Auskunft zur Feststellung des entstandenen Schadens. Sie war der Meinung, das Fotografieren von einer an die Zahlung eines Entgeltes geknüpften Zustimmung abhängig machen zu können. Eine Agentur hatte in dem einen der drei Verfahren Fotos von Schloss Sanssouci ohne Genehmigung und ohne Zahlung des Entgeltes auf dem Schlossgelände angefertigt und anschließend verwertet.
Das LG Potsdam (21.11.2008 – 1 O 175/08) hatte als erste Instanz der Klägerin zunächst recht gegeben, das OLG Brandenburg (18.02.2010 – 5 U 12/09) hat aber im Berufungsverfahren das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen, u. a. mit dem Argument aus der Friesenhaus-Entscheidung des BGH, die Sie schon kennen. Kurz rekapituliert: Weder das Fotografieren von Eigentum noch die gewerbliche Nutzung solcher Fotos stelle einen Eingriff in das Eigentumsrecht dar. Deshalb stehe das Verwertungsrecht dem Urheber der Aufnahmen zu. Zwar sei die Stiftung Eigentümer, dies rechtfertige jedoch nicht, das Fotografieren und gewerbliche Verwerten der Fotos zu untersagen. Die entscheidende Überlegung des OLG Brandenburg war, dass der Stiftung die Kulturgüter übertragen wurden, um sie der Öffentlichkeit ohne Eintritt zugänglich zu machen, was sich aus dem Staatsvertrag ergebe. Dies beinhalte auch das Recht, unentgeltlich zu fotografieren und die Fotos anschließend gewerblich zu nutzen.
Der BGH hat dieses Urteil mit der oben erwähnten Entscheidung am 17.12.2010 aufgehoben und – wie bereits die erste Instanz – der Klägerin recht gegeben. Dabei hat der BGH im Wesentlichen ausgeführt:
Der Eigentümer könne die Herstellung und Verwertung von Fotos untersagen, wenn sie – wie hier – von seinem Grundstück aus aufgenommen worden seien. Dies sei eine unmittelbare Folge des Eigentumsrechts. Der Eigentümer könne bestimmen, ob und – wenn ja – unter welchen Voraussetzungen jemand sein Grundstück betreten und was er dort machen dürfe. Dem Eigentümer stehe das ausschließliche Recht zur Anfertigung und Verwertung von Fotografien zu, die von seinem Grundstück aus aufgenommen werden.
Damit hat der BGH ein weiteres Mal das Hausrecht, denn nichts anderes ist das Bestimmungsrecht des Eigentümers darüber, was auf seinem Besitz geschieht und was nicht, ausdrücklich bestätigt.
Schon 1974 hat der BGH sich in seiner »Schloss-Tegel«-Entscheidung (Urteil vom 20.09.1974 – I ZR 99/73) mit dem Hausrecht auseinandergesetzt. Damals ging es um einen ganz ähnlichen Fall wie im Fall Sanssouci. Auch hier wurden im Auftrag eines Bildverlags Aufnahmen von Schloss Tegel angefertigt, die nur möglich waren, wenn man das Grundstück, das sich im Privatbesitz befindet, betreten hat; von außen waren diese Aufnahmen gar nicht möglich. Der Bildverlag verwendete die Aufnahmen dann für Ansichtskarten, die er auch verkaufte.
Auch hier hat der BGH bereits ganz eindeutig Position bezogen und festgestellt, dass die Eigentümerin ohne Weiteres berechtigt sei, die Besichtigung oder den Zutritt nur unter der Bedingung zu gestatten, dass dort nicht oder ausschließlich zu privaten Zwecken fotografiert werde. Die den Besuchern erteilte Fotografiererlaubnis enthalte nicht die Befugnis einer gewerblichen Verwertung der Aufnahmen. Auch die Sozialbindung des Eigentums, die Gewährung von Subventionen und der Denkmalschutz hinderten die Eigentümerin nicht, das Fotografieren des Schlosses zu verbieten oder einzuschränken.
Vor dem Hintergrund dieser und einiger anderer Entscheidungen, in denen die Gerichte dieselben Grundsätze angewandt haben, war die Sanssouci-Entscheidung bei genauer Betrachtung keine allzu große Überraschung, sondern nur eine erneute Bestätigung einer seit Jahrzehnten bestehenden Rechtsprechung, die immer wieder das Hausrecht als unantastbares und hochwertiges Rechtsgut herausgestellt hat. Es war schon eher überraschend, dass das OLG Brandenburg anders entschieden hat, weshalb auch bei aufmerksamer Lektüre der Urteilsbegründung eigentlich damit gerechnet werden musste, dass der BGH dieses Urteil wieder aufhebt.
Abbildung 2.9 Durchaus vergleichbar mit dem Sanssouci-Fall ist diese im botanischen Garten der Universität, also auf Privatgelände, gemachte Aufnahme des Poppelsdorfer Schlosses in Bonn (Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Abteilung Presse und Kommunikation der Universität Bonn).
Ob man diese Entscheidung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, das Fotografieren von mit erheblichen Steuergeldern finanzierten bzw. erhaltenen Kulturgütern zu verbieten bzw. von einem Entgelt abhängig zu machen, für politisch richtig hält, ist eine Frage, über die man sicherlich endlos und mit unterschiedlichen Argumenten und Interessen streiten kann. Das bringt uns jedoch nicht wirklich weiter und soll deshalb hier auch nicht weiter vertieft werden. Denn juristisch ist es jedenfalls eindeutig so, und auch schon immer so gewesen, dass allein der Eigentümer bestimmt, ob überhaupt und für welchen Zweck auf bzw. von seinem Grundbesitz fotografiert werden darf. Dieses Hausrecht muss der Fotograf respektieren, will er nicht riskieren, vom Gelände verwiesen und möglicherweise mit rechtlichen Auseinandersetzungen konfrontiert zu werden.
Auch wenn man beim ungenehmigten Fotografieren vielleicht nicht ertappt wird, ist spätestens bei der Veröffentlichung der Aufnahmen die Gefahr recht groß, Anwaltspost mit Unterlassungs- und Zahlungsaufforderungen zu bekommen. Um die in Betracht kommenden rechtlichen Ansprüche, die in solchen Fällen geltend gemacht werden können, geht es ausführlich in Kapitel 6, »Rechte schützen«.
Festzuhalten ist, dass sich beide hier behandelten Entscheidungen – Schloss Sanssouci und Schloss Tegel – mit dem Verbot der gewerblichen Fotografie befassen, Aufnahmen für den privaten Gebrauch sind davon nicht betroffen. In der Entscheidung zu Schloss Tegel ist sogar ausdrücklich die Rede davon, dass die Anfertigung von Fotos zum Privatgebrauch dort jedermann gestattet wird. Auch in Sanssouci darf zu privaten Zwecken fotografiert werden.
In der praktischen Konsequenz bedeutet die Einschränkung »nur zum privaten Gebrauch«, dass Sie für die eigene Nutzung und die Nutzung durch Ihre Familie und engsten Freunde Fotos anfertigen können. Veröffentlichen dürfen Sie die Bilder jedoch nicht! Auch dann nicht, wenn damit keine kommerziellen Interessen verfolgt werden. Es sind mehr oder weniger nur Erinnerungsfotos zulässig, die danach ihr Dasein im Fotoalbum oder auf der Festplatte fristen.
[+] Zu privaten Zwecken
Die Formulierung zu privaten Zwecken, die oft in diesem Zusammenhang verwendet wird, existiert im Urheberrecht nicht. Man wird aber davon ausgehen können, dass dieser Ausdruck mit der gleichen Bedeutung verwendet wird wie die Formulierung privater Gebrauch. Hier handelt es sich um einen Begriff unmittelbar aus dem Urheberrechtsgesetz (siehe § 53 UrhG – im Wortlaut nachzulesen unter www.gesetze-im-internet.de/urhg). Was darunter zu verstehen ist, habe ich Ihnen in Kapitel 1, »Urheberrecht«, bereits erläutert, nämlich Gebrauch in der Privatsphäre durch einen selbst oder durch Personen, mit denen man durch ein persönliches Band verbunden ist.
Streng genommen dürfen Sie mit dieser Einschränkung hergestellte Bilddateien oder Dias auch nicht in einem Fotoclub zeigen, es sei denn, dieser bestünde nur aus Familienmitgliedern, was äußerst selten vorkommen dürfte. Allerdings meine ich, dass man hier mit viel Wohlwollen eine Zulässigkeit noch bejahen kann, da eindeutig keine Erwerbsabsicht besteht und Rechte nicht unmittelbar verletzt werden. Bei einem Herumzeigen im Fotoclub liegt zwar sicherlich nach dem Wortlaut des Gesetzes eine Veröffentlichung vor, die den Interessen des Hausherrn jedoch nicht zuwiderlaufen kann, abgesehen davon, dass hier sicherlich das Risiko, rechtlichen Ansprüchen des Eigentümers ausgesetzt zu sein, durchaus kalkulierbar erscheint. Bei einer Ausstellung im Rahmen eines Fotowettbewerbs ist dies sicher schon anders. Hier sollten Sie in jedem Fall nur die Bilder einreichen, für die Sie zuvor eine Veröffentlichungsgenehmigung eingeholt haben, die häufig auch erteilt wird, wenn Sie freundlich nachfragen und den Verwendungszweck (Teilnahme am Fotowettbewerb) angeben. Zu späteren Beweiszwecken oder zum Nachweis der Berechtigung entsprechend den Teilnahmebedingungen sollten Sie sich die Veröffentlichungsgenehmigung in jedem Fall schriftlich geben lassen.
Zwingend ist die Erlaubnis, zu privaten Zwecken auf fremdem Eigentum zu fotografieren, jedoch keineswegs. Aus der Tatsache, dass der Eigentümer frei bestimmen kann, wie die Fotografierrechte ausgestaltet werden, sind alle möglichen Varianten denkbar und in der Praxis auch üblich. Es kann ein völliges Fotografierverbot für gewerbliche und private Aufnahmen ausgesprochen werden, es kann aber auch, und so ist es vielfach geregelt, lediglich die gewerbliche Fotografie verboten oder von einem Entgelt oder einer ausdrücklichen Genehmigung abhängig gemacht werden.
Wird die Anfertigung privater Aufnahmen von der Zahlung eines zusätzlichen Entgeltes abhängig gemacht, was in der Praxis durchaus vorkommt und was ich erst kürzlich wieder selbst erlebt habe, ist dies jedenfalls rechtlich nicht zu beanstanden. Auch wird die Regelung praktiziert, dass man zwar generell fotografieren darf, vor einer Veröffentlichung oder vor einer gewerblichen Nutzung jedoch die Bilder dem Eigentümer zur Genehmigung vorlegen muss, wobei aber auch dann auf die Erteilung der Genehmigung keinerlei Rechtsanspruch besteht. Außerdem kann die Genehmigung von der Erfüllung bestimmter Auflagen abhängig gemacht werden, zum Beispiel Zahlung eines Entgeltes, Veröffentlichung nur im Rahmen eines bestimmten Zeitungsartikels oder Buches etc. Auch Vorschriften, wie zu fotografieren ist oder welches Fotoequipment benutzt oder besser nicht benutzt werden darf (kein Stativ, kein Blitzlicht oder beides), findet man nicht selten. Gleichgültig jedoch, welche Regelung im Einzelfall besteht, rechtlich ist sie nicht angreifbar, weil der Eigentümer – wie nun schon mehrfach festgestellt – das alleinige und umfassende Bestimmungsrecht hat.
Lediglich für die Presse gibt es in den einzelnen Landespressegesetzen einen Anspruch auf Gewährung des Zutritts für Fotojournalisten (nicht für Privatpersonen!) zu öffentlichen Einrichtungen, wenn es sich um die tagesaktuelle Berichterstattung und um eine Information der breiten Öffentlichkeit über Vorgänge von allgemeiner Bedeutung handelt (Stichwort »Pressefreiheit«). Bei privaten Veranstaltern kann ein Zutrittsrecht zum Fotografieren generell nicht rechtlich durchgesetzt werden, weil dafür keine Rechtsgrundlage gegeben ist. Da hilft nur der Verzicht auf die Aufnahme.
Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte in zoologische oder botanische Gärten in Deutschland ist grundsätzlich keine generelle Fotografiererlaubnis verbunden, eine ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Fotografiererlaubnis beinhaltet auch nicht gleichzeitig das Recht, die Aufnahmen später zu veröffentlichen. Meist wird durch einen Aushang am Eingang darauf hingewiesen, welche Fotografiervorschriften bestehen, häufig wird schon durch ein Hinweisschild an Kasse oder Eingang darauf hingewiesen, dass Aufnahmen zu gewerblichen Zwecken einer besonderen Genehmigung bedürfen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass für private Aufnahmen ohne Genehmigung fotografiert werden kann.
[+] Fotografieren in Zoos und Tierparks – Liste im Internet
Für fast alle zoologischen Gärten und Tierparks in Deutschland finden Sie im Internet unter www.zoo-infos.de eine erst 2016 aktualisierte, alphabetisch nach Orten aufgelistete Übersicht, der Sie entnehmen können, ob Sie auf den jeweiligen Geländen überhaupt fotografieren dürfen, ob die Verwendung eines Blitzgeräts erlaubt ist und ob die Bilder – kommerziell oder nicht kommerziell – veröffentlicht werden dürfen. Sicherheitshalber sollten Sie die Korrektheit der Angaben durch einen Anruf oder vor Ort überprüfen.
Erheiternd fand ich im Zusammenhang mit dem Thema Zoofotografie die Frage eines Lesers, der wissen wollte, ob beim Ableben eines im Zoo fotografierten Tieres das Hausrecht des Zoos nach zehn Jahren erlischt und das Foto von dem Tier dann ohne Genehmigung zu gewerblichen Zwecken verkauft werden könne.
Zwar bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Frage tatsächlich ernst gemeint war, dennoch möchte ich die Antwort darauf nicht schuldig bleiben: In dieser Frage werden offensichtlich die Hausrechtsverletzung und die zehnjährige Frist, innerhalb derer Angehörige der Veröffentlichung eines Bildnisses von einem Verstorbenen einwilligen müssen (§ 22 KUG, Kunsturhebergesetz, auch KunstUrhG, im Wortlaut unter www.gesetze-im‐internet.de/kunsturhg), womit wir uns jedoch erst im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit der Personenfotografie näher befassen werden, vermischt.
Tiere werden, wie Sie inzwischen wissen, wie Sachen behandelt und genießen (jedenfalls noch) keinen postmortalen Persönlichkeitsschutz. § 22 KUG ist deshalb auf Tiere mit Sicherheit nicht anwendbar. Ob man den jeweiligen Zooleiter als Angehörigen des Tieres betrachten kann, was je nach der Art des verstorbenen Tieres ja auch durchaus als Beleidigung empfunden werden könnte, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Die Zehn-Jahres-Frist hat mit dem Hausrecht nichts zu tun, weshalb auch nach zehn Jahren ein Foto nicht veröffentlicht werden darf, das nach der Hausordnung nicht gemacht oder nicht veröffentlicht werden darf. Der Tod des Tieres heilt natürlich nicht eine frühere Verletzung einer Hausordnung. Ob allerdings nach zehn Jahren noch irgendjemand ernsthaft danach fragt, ob das Bild veröffentlicht werden durfte, wage ich sehr zu bezweifeln, weshalb ich hier selbst als Jurist keine Probleme mit einer Veröffentlichung hätte.
Das Hausrecht gilt auch auf Bahnhöfen, und Sie sollten fragen, ob Sie fotografieren dürfen, sofern es keine Hinweisschilder oder ausgehängten Nutzungsbedingungen gibt.
Abbildung 2.10 Auf diesem Bahnhof in Arzana (Sardinien) wurde das Fotografieren und Veröffentlichen auf entsprechende Frage gestattet.
Die Hausordnung der Deutschen Bahn (DB), die auch im Internet veröffentlicht ist und für das gesamte Gelände der DB gilt, enthält zum Beispiel die Regelung, dass gewerbliche Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen nur nach vorheriger Genehmigung durch das Bahnhofsmanagement gestattet sind. Auch hier gilt im Umkehrschluss: Das Fotografieren für private Zwecke wird somit geduldet. Während das Fotografieren von Eisenbahnen in Bahnhöfen demnach nur für private Zwecke gestattet ist, dürfen auf freier Strecke Eisenbahnen ohne Einschränkung fotografiert und die Fotos verwertet werden, es sei denn, es bestehen andere Rechte, wie etwa Designrechte (bis Februar 2014 noch »Geschmacksmusterrechte«). Dazu erfahren Sie mehr, wenn es um Marken- und Designrechte geht (siehe Abschnitt 2.2.8, »Marken- und Designschutz«, in diesem Kapitel).
Das Hausrecht gilt natürlich auch für das Fotografieren in Straßenbahn, Bus, Flugzeug und Kabinenseilbahn sowie auf dem Schiff und für Aufnahmen im Stadion, auf einem privaten Festplatz etc. Überall dort gibt es natürlich auch ein Hausrecht, das vom Fotografen zu beachten ist.
Vielfach wird das Fotografieren auch toleriert, weil man seitens des Hausrechtsinhabers oder seiner Vertreter einen rein privaten Gebrauch unterstellt und keine gewerbliche Absicht vermutet. Bei einer Zugfahrt wird die DB kaum etwas dagegen haben, wenn der Freund oder die Freundin auf einem Erinnerungsfoto während einer Zugreise abgelichtet wird, obwohl sie es natürlich verbieten könnte. Eine über den Privatgebrauch hinausgehende Fotografie in Zügen ist dagegen grundsätzlich nicht erlaubt. Wenn Sie mit professioneller Kameraausrüstung durch den Zug gehen und fotografieren, also nicht erkennbar ein Erinnerungsfoto von Ihren Lieben im Zug machen, werden Sie sich sicherlich die Frage gefallen lassen müssen, ob Sie dazu eine Genehmigung haben.
Natürlich gibt es durchaus auch Eigentümer, denen es völlig gleichgültig ist, ob auf ihrem Grundbesitz fotografiert wird oder nicht, und die deshalb die Fotografen gewähren lassen. Allerdings sollten Sie aus einem fehlenden Hinweisschild auf ein Fotografierverbot niemals den Schluss ziehen, es liege eine unbeschränkte, stillschweigend erteilte Fotografiererlaubnis vor. Grundsätzlich gilt nämlich nicht der Grundsatz, dass das, was nicht ausdrücklich verboten wurde, erlaubt ist. Wenn dagegen – wie bei der DB – bestimmte Dinge verboten oder unter Erlaubnisvorbehalt gestellt sind, dann können Sie davon ausgehen, dass das, was in diesem Zusammenhang nicht genannt wurde, auch fotografiert werden darf. Es gilt grundsätzlich das Hausrecht, und als Fotograf müssen Sie sich informieren, ob, in welchem Umfang und zu welchem Zweck Sie fotografieren dürfen.
Es ist deshalb in jedem Fall empfehlenswert, sich beim Betreten eines fremden Grundstücks über die dort geltenden Regelungen zu informieren, insbesondere dann, wenn Sie beabsichtigen, Aufnahmen nicht nur zur privaten Verwendung zu machen. Sie können sich natürlich später in einem möglichen Rechtsstreit nicht darauf berufen, es sei kein Schild vorhanden gewesen, das Ihnen das Fotografieren verboten habe, und Sie hätten auch nicht gewusst, dass Sie dort nicht hätten fotografieren dürfen. Ein Fotograf, der trotz unklarer Rechtslage auf Privatgelände fotografiert, handelt leichtsinnig und trägt das volle Risiko einer rechtlichen Inanspruchnahme.
Die Tatsache, dass die meisten Eigentümer das Fotografieren, zumindest aber die gewerbliche Nutzung der Fotos, von einer Genehmigung abhängig machen, hat zwei Gründe. Zum einen möchte jeder Eigentümer gerne unter Kontrolle haben, was mit Fotos seines Eigentums geschieht, und nicht befürchten müssen, dass diese Fotos unkontrolliert kursieren. In vielen Fällen ist andererseits das kommerzielle Interesse des Eigentümers jedoch der stärkere Aspekt, denn einerseits kann er die Fotografiergenehmigung von der Zahlung einer in sein Ermessen gestellten Gebühr abhängig machen, andererseits möchte er vielleicht Bilder seines Eigentums selbst vermarkten. Je größer die kommerziellen Interessen eines Eigentümers an einer Eigenvermarktung durch Postkarten, Bildbände, Broschüren etc. sind, desto strikter sind im Allgemeinen die Regelungen und desto höher ist das Risiko für den Fotografen, dass der Eigentümer seine Rechte auch durchsetzt. So war der Hintergrund der Schloss-Tegel-Entscheidung etwa, dass die Schlossverwaltung selbst Ansichtskarten an ihre Besucher verkauft hat und deshalb dem Bildverlag, der die ohne Genehmigung erstellten Aufnahmen als Ansichtskarten herausgegeben hatte, keine Möglichkeit geben wollte, dazu in Konkurrenz zu treten.
[+] Das Hausrecht sollte man ernst nehmen
Wie die Sanssouci-Entscheidung zeigt, empfiehlt es sich, ein Hausrecht unbedingt ernst zu nehmen, die Folgen eines Verstoßes gegen die Hausordnung können sehr teuer werden.
Im Übrigen wird nicht selten die Einhaltung von Fotografierregeln zumeist durch Aufsichtspersonal auch kontrolliert. Mir selbst ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich von Aufsichtspersonen bzw. Hausrechtsinhabern angesprochen wurde, als ich mit einer Großformatkamera fotografiert habe. Im Botanischen Garten in Bonn zum Beispiel, der zur Universität gehört und in dem das Fotografieren für private Zwecke zwar erlaubt ist, für gewerbliche Zwecke jedoch der Genehmigung der Universitätsverwaltung bedarf, wurde ich von einem der Parkwächter sehr freundlich angesprochen und gefragt, für welche Zwecke ich die Aufnahmen machen würde. Als ich ihm – zutreffend – sagte, dass ich rein privat fotografiere, und wir ein paar nette Worte gewechselt hatten, war die Sache für ihn erledigt, und ich bekam sogar noch ein paar Tipps, an welcher Stelle sich besonders fotografierenswerte Pflanzen gerade in Blüte befanden.
Ich will mit diesem Beispiel zum Ausdruck bringen, dass das jeweilige Aufsichtspersonal anhand der Ausrüstung, die der Fotograf mit sich führt, oft abschätzt, ob privat oder gewerblich fotografiert wird. Jemand, der mit einer Kompaktkamera unterwegs ist, wird wohl kaum angesprochen werden, jemand der mit Spiegelreflexkamera und gegebenenfalls einem Stativ herumläuft, schon eher, derjenige aber, der mit einer Großformatkamera, Stativ und Einstelltuch auftritt, ganz sicher. Überhaupt habe ich die Erfahrung, nicht nur in Deutschland, gemacht, dass in vielen Fällen schon die Benutzung eines Stativs mit professioneller Fotografie in Zusammenhang gebracht wird. Gerade an touristisch stark frequentierten Orten hebt man sich mit einem Stativ sehr schnell von der Masse derer ab, die ihre Aufnahmen mit der Systemkamera oder dem Mobiltelefon aus der Hand machen und meist vom Aufsichtspersonal unbehelligt bleiben, vermutlich sogar oft gar nicht wahrgenommen werden. Je professioneller die Ausrüstung wirkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, sich bezüglich des Verwendungszwecks der Aufnahmen rechtfertigen zu müssen. Können Sie die jeweilige Aufsichtsperson nicht überzeugen, dass Sie in rein privater Mission unterwegs sind, werden Sie sich einem ultimativ ausgesprochenen Fotografierverbot oder gar einem Platzverweis fügen müssen. Verlassen Sie trotz Aufforderung nicht unverzüglich fremdes Privatgelände, sondern beginnen sinnlose Diskussionen, ist dies im Übrigen auch strafrechtlich relevant, weil derjenige, der ein Grundstück gegen den Willen des Eigentümers betritt oder dort verweilt, nach § 123 StGB einen Hausfriedensbruch begeht (den Gesetzestext des Strafgesetzbuches finden Sie im Wortlaut unter www.gesetze-im-internet.de/stgb). So weit sollten Sie es nun wirklich nicht kommen lassen, schon gar nicht als Hobbyfotograf.
Vielerorts ist aus meiner Sicht allerdings eine große Toleranz, insbesondere gegenüber vermeintlichen Amateurfotografen, festzustellen. In Deutschland wurde ich auf meinen unzähligen Fototouren nur selten angesprochen und nach meinen fotografischen Absichten gefragt. Die wenigen Male, bei denen das passiert ist, war ich mit der Großformatkamera unterwegs. Vor etlichen Jahren habe ich die letzten Altbau-Elektro-Lokomotiven, die zu Beginn der 1980er Jahre im bayrischen Raum noch im Einsatz waren, ausgiebig fotografiert. Dazu stand ich häufig, teilweise auch mit Stativ, auf den Bahnsteigen in Würzburg, Bamberg, Regensburg und anderswo und wartete auf den ein- oder abfahrenden Zug. Nicht ein einziges Mal wurde ich dabei von Bahnmitarbeitern angesprochen, obwohl ich mich beim Fotografieren in keiner Weise versteckt gehalten, sondern mich ganz offen gezeigt habe.
Damit will ich sagen, dass das Fotografieren vielfach geduldet wird, auch wenn man dabei streng genommen gegen das Hausrecht verstößt, solange man als Amateur angesehen wird. Ein paar freundliche Worte vor Beginn der fotografischen Tätigkeit, spätestens aber dann, wenn man angesprochen wird, verfehlen auch hier ihre Wirkung nicht. Viele zeigen dann Verständnis, einige interessieren sich sogar für die Aufnahmen und die mitgeführte Ausrüstung, man kommt in ein nettes Gespräch und darf unbehelligt fotografieren – vielleicht sogar dort, wo es anderen, die ein weniger verbindliches Auftreten zeigen, nicht gestattet ist. Allerdings müssen Sie auch damit rechnen, dass das Aufsichtspersonal abgelöst wird und der nächste Mitarbeiter vielleicht nicht so tolerant ist. Dann werden Sie kaum Fotografierrechte für sich in Anspruch nehmen können, nur weil der Vorgänger ein bis zwei Augen zugedrückt hat.
Die Konsequenz wird in der Regel beim Amateur allenfalls ein Platzverweis, meist aber zunächst nur die Aufforderung sein, das Fotografieren zu unterlassen. Danach werden Sie als Fotograf natürlich unter besonderer Beobachtung des Aufsichtspersonals stehen, ob Sie nicht doch heimlich weiterfotografieren. Dass allerdings ein Amateur den Film herausgeben oder die Speicherkarte unter Aufsicht löschen musste, habe ich persönlich – zumindest bei Sachaufnahmen – noch nie gehört oder erlebt.
[+] Wohlwollen und Toleranz sind keine Rechte
Auch als der an seiner Ausrüstung erkennbare Fotoamateur können Sie sich auf Wohlwollen und Toleranz nicht verlassen. Sie können sich auch als Amateur durchaus und ebenso schnell erheblichen Ärger einhandeln, wenn Sie unter Verstoß gegen das Hausrecht fotografieren.
War bislang überwiegend von Außenaufnahmen auf Privatbesitz die Rede, gilt das dazu Gesagte logischerweise auch für Innenaufnahmen von Gebäuden. Auch hier ist es allein das Hausrecht des jeweiligen Eigentümers, das vorgibt, ob und in welchem Umfang im Gebäude fotografiert werden darf. Auch hier haben Sie mit dem Erwerb der Eintrittskarte zum Beispiel zu einer Hallensportveranstaltung nicht das Recht erworben, frei zu fotografieren.
In der Regel haben Sie im Inneren von Gebäuden auch als Amateur deshalb mit deutlich weniger Toleranz der Eigentümer zu rechnen, wenn Sie ohne Genehmigung fotografieren. Dies gilt im Übrigen nicht nur für private Räumlichkeiten, sondern auch für öffentliche Gebäude, die normalerweise frei zugänglich sind, also Kirchen, Schulen, Behörden, Theater und Veranstaltungsräume etc. – unabhängig davon, wie und von wem sie finanziert wurden, und gleichgültig, ob Sie für den Zutritt Eintritt zahlen müssen oder nicht.
[ ! ] Grundsätzliches Fotografierverbot bei Innenaufnahmen
Gegenüber Außenaufnahmen gilt bei Innenaufnahmen, auch bei Aufnahmen für den privaten Gebrauch, ein striktes Fotografierverbot, solange keine ausdrückliche Fotografiererlaubnis erteilt wurde.
Auch wenn man ein Hotelzimmer gemietet hat – und damit während der Mietdauer berechtigter Besitzer des Zimmers ist – und dort mit einem Model ein Shooting macht, heißt dies nicht in jedem Fall, dass man die dort vom Model hergestellten Aufnahmen auch ohne Weiteres verwerten darf. Solange auf den Fotografien nur das Model und allenfalls eine Wand im Hintergrund oder die Bettlaken, auf denen das Model vielleicht posiert, sichtbar sind, ist eine Veröffentlichung im Hinblick auf das Hausrecht sicherlich unproblematisch. Wenn aber Teile der Zimmereinrichtung zu erkennen sind und damit möglicherweise erkennbar ist, in welchem Hotel die Aufnahmen gemacht wurden, sollte vor der Veröffentlichung unbedingt die Einwilligung des Hausrechtsinhabers eingeholt werden. Aus Imagegründen könnte die Hotelleitung durchaus ein Interesse daran haben, nicht mit Aktaufnahmen, die in einem der Hotelzimmer gemacht wurden, in Verbindung gebracht zu werden.
Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass sich möglicherweise urheberrechtlich geschützte Gegenstände wie Designermöbel, Malereien, Fotos etc. im Zimmer befinden können, deren Ablichtung ebenfalls problematisch ist, wie Sie in Abschnitt 2.1.2 noch sehen werden.
Auch wenn Sie durch Mietzahlung vorübergehend rechtmäßiger Besitzer eines Hotelzimmers geworden sind, heißt dies noch lange nicht, dass Sie Fotos des Hotelzimmers, die Sie als Erinnerungsfotos für private Zwecke sicherlich anfertigen dürfen, auch veröffentlichen dürfen. Dies kann ohne Genehmigung des Hausrechtsinhabers unzulässig sein.
[ ! ] Fotosession im Hotel
Bei Fotosessions im Hotelzimmer sollten Sie also in jedem Fall vorher die Zustimmung der Hotelleitung einholen, wenn auf den Fotos erkennbar ist bzw. Rückschlüsse darauf gezogen werden können, in welchem Hotel die Fotos gemacht wurden, oder wenn urheberrechtlich geschützte Gegenstände auf dem Foto zu erkennen sind.
Auch bei Innenaufnahmen mögen Sie sich vor Ort die Frage stellen, ob es denn jemand merkt, wenn Sie schnell ein paar Aufnahmen machen. Es erscheint fraglich, ob ein Interesse der jeweiligen Kirchenverwaltung daran besteht, einen Amateur rechtlich zu verfolgen, der ohne Genehmigung in ihrer Kirche fotografiert. Vielfach wird, jedenfalls solange die Aufnahmen nicht veröffentlicht werden, gar nichts passieren. Das sollte jedoch nicht zu der Annahme führen, man begehe mit den Aufnahmen keine Rechtsverletzung. Denn Schweigen bedeutet nach unserem Recht keine Zustimmung. Deshalb kann auch hier aus der Tatsache, dass nicht nein gesagt wurde, nicht gefolgert werden, dass stillschweigend ja gesagt wurde. Dann müssten schon konkrete Anhaltspunkte dafür vorhanden sein, dass eine stillschweigende Duldung vorliegt.
[+] Verschärftes Hausrecht bei Innenaufnahmen
Der Grund für diese Verschärfung gegenüber Außenaufnahmen liegt darin, dass man mit ungenehmigten Innenaufnahmen eine ungleich stärkere Verletzung des Hausrechts begeht, als wenn man nur in einem privaten Park die ungenehmigte Außenaufnahme eines Gebäudes macht.
Abbildung 2.11 Als Gast in Privaträumen müssen Sie immer fragen, ob gegen das Fotografieren Einwände bestehen, auch wenn keine Personen abgebildet werden.
Bei Innenaufnahmen von öffentlichen Gebäuden wird das Fotografieren oft auch aus praktischen Erwägungen oder Sicherheitsgründen verboten oder eingeschränkt. Solche Einschränkungen findet man häufig bei Theater- und Konzertveranstaltungen, bei denen das Fotografieren schon deshalb verboten ist, weil die Künstler und auch die Zuschauer durch ständiges Blitzlicht gestört werden. Eigene Vermarktungsinteressen des Theaters an Bühnenaufnahmen kommen oft hinzu. Im Übrigen haben die Künstler gemäß § 77 UrhG das ausschließliche Recht, ihre Darbietung auf Bild- und Tonträger aufzunehmen. Das Fotografieren bei Konzerten oder im Theater erfordert deshalb nicht nur die Genehmigung des Hausrechtsinhabers, sondern auch die Genehmigung durch den oder die Künstler.
Abbildung 2.12 Veranstalter und die Mitglieder des Trios »Musica tre« hatten keine Einwände gegen die Aufnahmen während der Zugaben.
Für die Presse gilt auch hier wieder eine Besonderheit, denn ein generelles Fotografierverbot würde zu einer Einschränkung der Pressefreiheit führen, weil die aktuelle Tagesberichterstattung ohne bildliche Darstellung nicht mehr möglich wäre. Die Bebilderung der Berichterstattung wurde vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinem Urteil »Caroline von Monaco – II« 15.12.1990 – 1 BvR 653/96), auf das wir im Zusammenhang mit den Personenaufnahmen noch zurückkommen werden, ausdrücklich als Teil der Pressefreiheit nach Art. 5 Grundgesetz (GG) anerkannt (im Wortlaut finden Sie den Artikel unter www.gesetze-im-internet.de/gg). Deshalb wird akkreditierten Fotografen meist gestattet, ihre Fotos zu machen, wenn dadurch das Konzert nicht gestört wird, also unmittelbar vor und unmittelbar nach der Darbietung, auch während der Zugaben wird gelegentlich das Fotografieren gestattet. Dies gilt in der Regel jedoch nicht für Privatpersonen. Letztlich kommt es jedoch auf den jeweiligen Veranstalter als Hausrechtsinhaber an.
[ ! ] Keine »Drei-Lieder-Regel«
Die landläufige Meinung, es gebe eine Regel, nach der während der ersten drei Lieder eines Konzerts fotografiert werden darf, ist unzutreffend.
In Museen oder Innenräumen von Schlössern und Burgen etc. ist Fotografieren als solches häufig gestattet, jedoch wird die Verwendung von Blitz und Stativ untersagt. Das Blitzlicht könnte stören und unter Umständen sogar empfindliche Exponate – etwa alte Gemälde – beschädigen. Mit einem Stativ könnte zum Beispiel ein wertvoller Parkettboden in Mitleidenschaft gezogen werden, und es könnte in Räumen mit größerem Besucherandrang eine potenzielle Stolperfalle für andere Besucher sein.
Abbildung 2.13 Zarskoje Selo bei Sankt Petersburg. Drinnen darf man nur ohne Stativ und Blitz fotografieren.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich im analogen Zeitalter in Zarskoje Selo, der ehemaligen Zarenresidenz bei Sankt Petersburg, mit dem 20er Weitwinkel und Blende f2,8 mit mäßigem Erfolg versucht habe, halbwegs vernünftige Innenaufnahmen hinzubekommen, weil sowohl Stativ als auch Blitzlicht nicht verwendet werden durften.
[+] Vorteile der digitalen Fotografie
Zu analogen Zeiten führten Einschränkungen bei der Verwendung von Blitz und Stativ dazu, dass das Fotografieren in vielen Fällen nahezu unmöglich war, wenn man nicht zufällig einen hochempfindlichen Film in der Fototasche hatte. Im digitalen Zeitalter hilft in solchen Fällen oft die Erhöhung der ISO-Zahl oder eine nachträgliche Bildbearbeitung.
Bei öffentlichen Versammlungen in geschlossenen Räumen gibt es ebenfalls kein allgemeines Zutrittsrecht. Auch hier kann der Veranstalter bestimmte Personen ausschließen, zum Beispiel solche, die dort fotografieren wollen. Für die Presse gibt es auch hier wieder Sonderregelungen, da aufgrund der Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG der Presse ein generelles Zugangsrecht zu öffentlichen Versammlungen zusteht. Für Journalisten ist es bei der Ausübung ihrer Tätigkeit von grundsätzlicher Bedeutung, Zugang zu Informationsquellen aller Art zu haben, wozu auch der Zugang zu öffentlichen Versammlungen gehört. Im Übrigen werden die gesetzlichen Grundlagen für öffentliche Versammlungen in den einzelnen Bundesländern – in NRW z. B. in § 6 VersammlG – unterschiedlich geregelt, worauf an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen werden kann. Vertreter der Presse sind in der Regel auch gut über ihre Rechte im einzelnen informiert.
Achtung: Für private Versammlungen von Vereinen, Parteien oder Verbänden etc. gilt diese Ausnahmeregelung jedoch nicht. Das BVerfG hat in zwei Beschlüssen (12.07.2001 – 1 BvQ 28/01 und BvQ 30/01) klargestellt, dass auch Volksfeste und Vergnügungsveranstaltungen, entschieden am Beispiel der Loveparade, nicht als öffentliche Versammlungen anzusehen sind.
[ ! ] Das Wichtigste zum Hausrecht
- Auf jedem Grundstück und in jedem Gebäude steht dem Eigentümer das uneingeschränkte Hausrecht zu. Das gleiche Recht haben diejenigen, denen der Eigentümer ein Besitzrecht eingeräumt hat, zum Beispiel der Mieter oder der Pächter. Mit dem Beginn des Vertragsverhältnisses geht das Hausrecht automatisch auf den Mieter, Pächter etc. über. Das Hausrecht umfasst die Befugnis, über die Ausgestaltung der Nutzung frei zu bestimmen, u. a., ob auf dem jeweiligen Gelände überhaupt fotografiert werden darf oder nicht und welche Ausrüstungsgegenstände (Stativ, Blitz etc.) gegebenenfalls nicht verwendet werden dürfen.
- Die Ausübung des Hausrechts ist rechtlich nicht überprüfbar, es sei denn, sie erfolgt willkürlich, wenn zum Beispiel nur farbigen Menschen der Zutritt verwehrt wird.
- Die Missachtung des Hausrechts ist Hausfriedensbruch!
- Eine Zutrittsgewährung, auch wenn diese gegen Eintritt erfolgt, beinhaltet nicht automatisch das Recht zum Fotografieren. Eine Fotografiererlaubnis zu privaten Zwecken oder die Duldung dazu beinhaltet wiederum noch nicht das Recht, die Fotos auch gewerblich zu verwerten.
- Bei Außenaufnahmen ist es möglich, später noch eine Genehmigung einzuholen, bei Innenaufnahmen herrscht auch für Aufnahmen zum privaten Gebrauch striktes Fotografierverbot, solange die Einwilligung dazu durch den Hausrechtsinhaber nicht vorab erteilt wurde.
2.1.2 Urheberrechtlich geschützte Werke
Wenn es sich bei Gegenständen um solche handelt, die als schöpferische Leistung und damit als urheberrechtlich geschützte Werke anzusehen sind, ist schon das Recht, diese überhaupt zu fotografieren, also die bloße Herstellung der Aufnahme, von der Zustimmung des jeweiligen Rechtsinhabers abhängig, soweit die Aufnahme nicht zu ausschließlich privaten Zwecken erfolgt.
[ ! ] Unzulässiges Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter Sachen
Eine ohne Zustimmung gemachte Aufnahme ist bei urheberrechtlich geschützten Sachen rechtswidrig, weil sie eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Denn – wie Sie bereits in Kapitel 1, »Urheberrecht«, erfahren haben – das Abfotografieren ist eine Vervielfältigung, die ausschließlich dem Urheber zusteht (§ 16 UrhG).
[zB] Steht im Garten Ihres Nachbarn eine Skulptur eines noch lebenden Bildhauers, die Sie als Fotograf von Ihrem Grundstück aus fotografieren, begehen Sie eine unzulässige Vervielfältigung, wenn der Urheber diese Aufnahme nicht gestattet hat. Etwas anderes würde natürlich gelten, wenn der betreffende Künstler bereits vor mehr als 70 Jahren verstorben und der Urheberschutz erloschen wäre. Dann hätten wir es – wie in Kapitel 1 im Zusammenhang mit der Erörterung der Schutzfristen gesehen – mit einer erlaubnisfreien Sachaufnahme zu tun.
Eine Ausnahme vom Verbot des Fotografierens von Sachen, die dem Urheberrecht unterliegen, bietet – wie ebenfalls bereits in Kapitel 1 dargestellt – § 53 UrhG, der die einzelne Vervielfältigung eines Werkes zu ausschließlich privaten Zwecken erlaubt.
Für das Beispiel mit der Skulptur heißt dies: Macht der Fotograf die Aufnahme der geschützten Skulptur, weil er Bilder von den verschiedenen Kunstwerken dieses Künstlers sammelt, die er in ein Album klebt, das er bei sich zu Hause aufbewahrt, oder schmückt er mit dem gerahmten Bild dieser Skulptur sein Schlafzimmer, ist im Hinblick auf die eindeutige Privatnutzung trotz Vervielfältigung eines urheberrechtlich geschützten Werkes die Fotografie auch ohne Genehmigung des Künstlers zulässig. Verschickt der Fotograf dagegen die Datei mit dem Foto von der Skulptur gleich an mehrere gleichgesinnte Sammlerfreunde, ist der Anwendungsbereich des § 53 UrhG zweifellos überschritten, dann wäre bereits die Herstellung der Fotos unzulässig, weil eine nicht genehmigte und damit unzulässige Fotografie eines urheberrechtlich geschützten Werkes vorliegt, ohne dass die Privilegierung, also das Sonderrecht, des § 53 UrhG (Vervielfältigung für den privaten Gebrauch) greift.
Auch das Abfotografieren eines Fotos stellt ohne jeden Zweifel eine Urheberrechtsverletzung dar, wenn keine Genehmigung des Urhebers des Fotos vorliegt. Deshalb ist auch beim sogenannten Abzug vom Bild, wenn also keine Negative mehr vorhanden sind, höchste Vorsicht geboten, wenn man nicht selbst der Urheber ist. Dies gilt auch für Röntgenbilder, die aufgrund fehlender Schöpfungshöhe nur einfache Lichtbilder und keine Lichtbildwerke sind. Dennoch bedarf eine Vervielfältigung oder gar Veröffentlichung der Genehmigung des Urhebers der Aufnahme, auch wenn es sich um Aufnahmen des eigenen Körpers handelt.
Der BGH hat in einer Entscheidung vom 24.06.1993 (I ZR 148, 91 – »Dia-Duplikate«) einen Urheberrechtsverstoß in dem Fall angenommen, dass jemand sich heimlich in den Besitz von Dias gesetzt hat, die einem anderen gehörten, und davon Duplikate erstellen ließ. Ein privater Gebrauch der Duplikate konnte in diesem Fall eindeutig ausgeschlossen werden, sodass die Ausnahmeregelung des § 53 UrhG nicht zum Tragen kam.
Was ist zu beachten, wenn ich Briefmarken fotografieren will, die ich in einem Haufen wild durcheinanderliegender Marken oder in einem aufgeklappten Briefmarkenalbum auf meinem Aufnahmetisch drapiert habe? Begehe ich dann nicht bereits eine Urheberrechtsverletzung durch eine unberechtigte Vervielfältigung? Denn es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass eine Briefmarke ein Werk darstellt, das zum Beispiel von einem Designer entworfen wurde, eine gewisse Schöpfungshöhe hat und demzufolge urheberrechtlichen Schutz genießen kann. Resultieren daraus somit Einschränkungen oder Verbote aus fotografischer Sicht? Das Landgericht München hat bereits im Jahr 1986 (LG München – 21 S 20861/86) Briefmarken als »amtliche Werke« klassifiziert. Daraus folgt, dass sie nach § 5 UrhG gar keinen urheberrechtlichen Schutz genießen. Wir Juristen haben dazu den schönen Begriff gemeinfrei erfunden, was nicht etwa heißt »frei von Gemeinheiten«, sondern »für die Gemeinschaft oder Allgemeinheit frei nutzbar«.
Das gilt zum Beispiel auch für Geldscheine, von denen Fotos generell unproblematisch sind (siehe den Kasten »Vorsicht beim Fotografieren von Geldscheinen!« für eine wichtige Ausnahme).
[ ! ] Vorsicht beim Fotografieren von Geldscheinen
Bei der Ablichtung von Geldscheinen und Wertpapieren ist eine gewisse Vorsicht geboten. Diese dürfen nämlich, so ist es in § 128 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG – im Wortlaut unter www.gesetze-im-internet.de/owig_1968) geregelt, nicht so abgebildet werden, dass die Abbildungen mit Papiergeld verwechselt werden können. Fotografien im Maßstab 1:1 auf einem Papier, das dem Geldscheinpapier ähnlich ist, sollten Sie also nicht anfertigen. Das gilt auch für Fremdwährungen.
Die von Stockagenturen gerne genommenen Aufnahmen mit Bündeln von Geldscheinen oder die Aufnahme eines Sparschweins, in dessen Einwurfschlitz die Geldscheine nur zur Hälfte gesteckt wurden, begegnen keinen rechtlichen Bedenken, Aufnahmen von Münzgeld ebenfalls nicht, da auch Münzen gemeinfrei sind und im Übrigen durch eine Fotografie von Münzen naturgemäß keine Fälschungsgefahr droht.
[ ! ] Stockagenturen
Das sind Agenturen, die auf Vorrat, also ohne konkreten Auftrag gefertigte Fotos, sogenannte Stockfotos (vom englischen Begriff »stock« = Vorrat, Bestand) annehmen und vermarkten.
Für Fotografen ergeben sich drei relevante Ausnahmen von dem Verbot, urheberrechtlich geschützte Werke ohne Genehmigung des Urhebers zu vervielfältigen und zu veröffentlichen, aus:
- dem Aspekt »unwesentliches Beiwerk« (§ 57 UrhG)
- der Vervielfältigung und Verbreitung zu Veranstaltungszwecken (§ 58 UrhG)
- der bereits angesprochenen Panoramafreiheit (§ 59 UrhG)
Da diese Ausnahmetatbestände aber viel eher bei der Veröffentlichung relevant werden und weniger bei der Herstellung der Fotos, gehe ich darauf erst im Zusammenhang mit den Problemen bei der Veröffentlichung und Verwertung von Fotos in Abschnitt 2.2 ausführlich ein.
2.1.3 Privat- oder Intimsphäre
Nach überwiegender Rechtsmeinung ist – wie Sie bereits erfahren haben – bei Aufnahmen, die unter Verletzung der Privat- oder Intimsphäre zustande kommen, schon deren Herstellung rechtswidrig. Die zutreffende Begründung dafür ist, dass mit der Aufnahme die Kontrolle des Berechtigten über die weitere Verwendung der Fotos nicht mehr gegeben ist. Keiner, dessen Wohn- oder Schlafzimmer fotografiert wurde, kann abschätzen, was später mit den Bildern gemacht wird, ob sie nicht möglicherweise bei Facebook oder anderen Netzwerken wieder auftauchen. Überhaupt sind die sozialen Netzwerke, in denen sich manch einer in intimen Details präsentiert, nicht unproblematisch, insbesondere dann, wenn dort eingestellte Bilder weiterzirkulieren.
Nur nebenbei: Wer sich heute über eine bestimmte Person informieren will, schaut zuerst im Internet nach. Dies tun insbesondere auch gerne Personalleiter von Unternehmen, die sich so über Stellenbewerber informieren wollen. Eine zu offene Preisgabe von Fotos aus der Privat- oder Intimsphäre, zum Beispiel durch Partyfotos zu fortgeschrittener Stunde und bei fortgeschrittenem Alkoholkonsum, erweist sich oft als gefährlicher Bumerang.
[ ! ] Unzulässige Fotos in die Privatsphäre hinein
Fotos in Fenster hinein, auch wenn sich in dem Zimmer keine Personen befinden, Aufnahmen in sichtgeschützte Gärten unter Umgehung des Sichtschutzes oder Innenaufnahmen fremder Wohnungen ohne Genehmigung des Betroffenen sind als Verletzung der Privatsphäre und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unzulässig und sollten für seriöse Fotografen absolut tabu sein.
Die Rücksichtnahme auf die Privat- oder Intimsphäre gilt insbesondere dann, wenn auch noch Personen auf den Aufnahmen zu erkennen sind. Dann allerdings wären diese Aufnahmen als Personenaufnahmen, mit denen wir uns im Einzelnen in Kapitel 3, »Menschen«, befassen werden, ohnehin rechtswidrig, sofern die Einwilligung der Personen nicht vorliegt. Wenn wir das Beispiel mit dem Rosenstrauch im Garten der Nachbarin etwas abwandeln und den Fall so bilden, dass die Nachbarin gerade in dem Moment, als der Rosenstrauch fotografiert wird, unmittelbar neben diesem auf ihrer Liege ein Sonnenbad nimmt und dadurch unvermeidlich zu einem Bildbestandteil wird, ist wohl jedem klar, dass dann die Grenzen des Zulässigen bereits deutlich überschritten sind. Es wird ohne jeden Zweifel unmittelbar und sehr massiv in die Privat- und Intimsphäre eingegriffen.
2.1.4 Gesetzliche Fotografierverbote
In bundesdeutschen Gesetzen sind einige Fotografierverbote geregelt, die Sie beachten sollten, wenn Sie sich nicht großen Ärger, bis hin zu einer strafrechtlichen Verfolgung und sogar einer Einziehung der Kamera als Tatwerkzeug, einhandeln wollen.
Militärische Anlagen | Am bekanntesten unter diesen Verboten ist sicher das Verbot des Abbildens militärischer Einrichtungen, geregelt in § 109g Abs. 1 StGB. Allerdings ist eine Aufnahme militärischer Anlagen nur dann kritisch und insbesondere strafrechtlich relevant, wenn dadurch die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder die Schlagkraft der Truppe gefährdet wird. Entsprechend gilt dies für die Einrichtungen der NATO auf dem Gebiet der Bundesrepublik. In diesen Fällen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, die Kamera kann nach § 109k StGB als Tatwerkzeug eingezogen werden.
[ ! ] Nur das sicherheitsgefährdende Abbilden ist verboten
Bei dem Verbot, militärische Anlagen zu fotografieren, geht es also ausdrücklich immer nur um das »sicherheitsgefährdende Abbilden«, das bloße Abbilden, ohne dass dadurch die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet werden, ist also zulässig.
Da es nur um das »sicherheitsgefährdende Abbilden« geht, hat man noch keine Probleme zu erwarten, wenn man ein im Kieler Hafen liegendes Schiff der Bundesmarine fotografiert, da sich daraus noch keine Gefährdung für die Bundesrepublik oder die Truppe ableiten lässt.
Außerdem gibt es ein Schutzbereichsgesetz (SchBerG) aus dem Jahr 1956, dessen eigentlicher Titel »Gesetz über die Beschränkung von Grundeigentum für die militärische Verteidigung« lautet und das in § 5 das Verbot enthält, ein ausdrücklich als Schutzbereich ausgewiesenes Gebiet oder seine Anlagen ganz oder teilweise ohne Genehmigung zu fotografieren (im Wortlaut unter www.gesetze-im-internet.de/schberg). Hier wird die mögliche Gefährdung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Schlagkraft der Truppe von vorneherein unterstellt.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen empfehlen, sich vor Antritt einer Reise in andere Länder ganz genau zu erkundigen, was dort zu den militärischen Einrichtungen gehört und deshalb im Zweifel nicht fotografiert werden darf. Mir ist es hier nicht möglich, auf all die vielen unterschiedlichen und vielschichtigen Regelungen in den einzelnen Ländern einzugehen, die sich zudem kurzfristig ändern können. Neben guten Reiseführern erteilen aber die Botschaften oder Konsulate der jeweiligen Länder oder die deutschen Konsulate im jeweiligen Ausland bereitwillig Auskunft. In China oder Weißrussland etwa gibt es sehr strenge Fotografierverbote, deren Missachtung äußerst unangenehme Folgen nach sich ziehen kann. Auch in liberalen Ländern werden zu den militärischen Anlagen oft auch Objekte gezählt, von denen man dies zunächst gar nicht vermutet und die man hier in Deutschland völlig sorglos fotografieren kann, wie zum Beispiel Brücken, Eisenbahntrassen o. Ä. Auch das im Hafen ankernde Schiff der Marine eines anderen Landes sollten Sie nicht überall bedenkenlos fotografieren.
[ ! ] Militärische Anlagen im Ausland
Die Ablichtung von Objekten, die im Ausland als militärische Anlagen gelten, sollten Sie unbedingt vermeiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie das Hauptmotiv eines Bildes darstellen und deutlich zu erkennen und nicht nur unwesentliches Beiwerk sind. Wegen Spionageverdachts in einem fremden Land zunächst einmal verhaftet zu werden dürfte kaum zur Urlaubserholung beitragen.
Luftaufnahmen | Luftaufnahmen sind Aufnahmen aus Flugzeug, Hubschrauber, Freiballon etc. sowie vom Multicopter aus. Auch hier handelt es sich nach herrschender Meinung regelmäßig um Lichtbilder nach § 72 UrhG – waren nach dem Luftverkehrsgesetz bis zum Jahr 1990 nur mit einer Genehmigung der jeweils zuständigen Behörden zulässig und mussten auch zur Veröffentlichung freigegeben werden. Der eine oder andere von Ihnen erinnert sich vielleicht noch an früher zwingend erforderliche Bildunterschriften mit dem Text »Luftbild freigegeben durch …«.
Heute dürfen Luftaufnahmen, sofern sie nicht wiederum urheberrechtlich geschützte Objekte abbilden, unter Beachtung der luftverkehrsrechtlichen Vorschriften genehmigungsfrei erstellt und verwertet werden.
Auch hier gibt es jedoch zwei Ausnahmen: Die eine bezieht sich wiederum auf militärische Anlagen (zum Beispiel Militärflughäfen, Marinestützpunkte, Übungsgelände), die nach § 109g Abs. 2 StGB nur dann fotografiert werden dürfen, wenn damit die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und die Schlagkraft der Truppe nicht beeinträchtigt werden. Die oben bereits dargestellte Regel über das Fotografierverbot von Schutzbereichen gilt natürlich oder gerade auch bei Luftaufnahmen.
Die andere Ausnahme bezieht sich auch hier auf den Eingriff in die Privatsphäre. Ist Privatbesitz gegen Einblicke von ebener Erde geschützt, dann ist es natürlich insbesondere verboten, mithilfe von Hubschraubern, Ballons oder unbemannten Fluggeräten Aufnahmen von fremdem Besitz darzustellen, wenn der jeweilige Eigentümer und Besitzer durch die Einfriedung gerade signalisiert hat, dass er von fremden Blicken unbehelligt bleiben möchte. Solche Fälle dürften sich jedoch – trotz der zunehmenden Verbreitung von Multicoptern – eher im Bereich der Presse, insbesondere der Regenbogenpresse, abspielen (Stichwort »Paparazzi«).
Bei Aufnahmen aus dem Flugzeug oder einem anderen Flugobjekt, das sich in Reiseflughöhe befindet, mag zwar zwangsläufig auch das eingefriedete Grundstück zu sehen sein, aber hier sind Details im Zweifel nicht erkennbar, da es sich um eine Übersichtsaufnahme handelt. Außerdem ist das einzelne Grundstück nicht das Motiv der Aufnahme, sofern es nicht bewusst mit einem langbrennweitigen Teleobjektiv »herangeholt« wird, was wiederum unzulässig wäre. Es erscheint mir allerdings fraglich, ob dies aus einem sich bewegenden Fluggerät überhaupt so möglich ist, dass man auf der Aufnahme später Details erkennen kann.
Verbotene Tieraufnahmen | Wie wir bereits festgestellt haben, dürfen Tiere frei fotografiert werden, und zwar sowohl Wildtiere als auch Haus- und Nutztiere. Es gibt jedoch auch hier Ausnahmen, die allerdings nichts mit der Einwilligung des jeweiligen Eigentümers zu tun haben, sondern deren Begründung im Natur- und Tierschutz liegt. So enthält etwa § 42 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG – den Wortlaut finden Sie unter www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009) das Verbot, besonders geschützte Tierarten und europäische Vogelarten in bestimmten Situationen (bei Fortpflanzung, Aufzucht etc.) zu stören. Es ist damit zum Beispiel untersagt, mit Leitern oder anderen Hilfsmitteln zu Vogelnestern emporzusteigen, um Jungvögel im Nest oder Altvögel bei der Brut zu fotografieren. Aber als Tierfotograf sollten Sie ohnehin auch gleichzeitig Tierfreund sein und die Aufnahmen mit einem starken Teleobjektiv so machen, dass Jung- und Altvögel nicht gestört werden. Wenn das nicht möglich ist, sollten Sie definitiv auf die Aufnahme verzichten!
Gerichtsverhandlungen | Jemand, der in den letzten Jahren einmal bei Gericht war, wird es vielleicht erlebt haben (die Praxis ist allerdings von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich), dass Mobiltelefone am Eingang abzugeben sind und erst beim Verlassen des Gerichtsgebäudes wieder in Empfang genommen werden können. Damit soll nicht das Telefonieren unterbunden werden, vielmehr geht es darum, ein gesetzliches Verbot durchzusetzen und zu überwachen.
In § 169 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG – www.gesetze-im-internet.de/gvg) ist geregelt, dass zwar Verhandlungen grundsätzlich öffentlich sind, wenn nicht in bestimmten Fällen, die sich auch im Einzelnen aus dem GVG ergeben, die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, dass jedoch Ton- und Filmaufnahmen in jedem Fall unzulässig sind. Von jeher wird diese Bestimmung aber auch auf Fotos analog angewandt. Da heute fast jedes Mobiltelefon eine eingebaute Kamera sowie einen Video- und einen Sprachaufnahmemodus besitzt, soll mit der Abgabe der Mobiltelefone am Eingang verhindert werden, dass unbemerkt Fotos oder Film- bzw. Tonaufnahmen angefertigt werden.
Nun werden Sie vielleicht einwenden, dass man doch im Fernsehen immer wieder sehen kann, wie der Angeklagte, oft geschützt durch einen vor das Gesicht gehaltenen Aktendeckel oder mit nachträglich gepixeltem Gesicht, um die Erkennbarkeit auszuschließen, in den Verhandlungssaal geführt wird. Oft sieht man auch die Richter in ihren Roben beim Einzug in den Gerichtssaal. Die Zulässigkeit solcher Aufnahmen ergibt sich aus einem Sonderstatus, den die Presse im Hinblick auf ihre Berichterstattungspflicht und ihre Pressefreiheit hat. Vor Beginn der Verhandlung ist es der Presse deshalb erlaubt, Film- und Fotoaufnahmen für die aktuelle Berichterstattung zu machen. Niemals wird man jedoch sehen, dass während der Verhandlung gefilmt wird oder Fotos gemacht werden. Bei bedeutenden Prozessen, wie etwa bei den RAF-Prozessen, war immer ein Zeichner im Gerichtssaal, der von den beteiligten Personen Porträtzeichnungen angefertigt hat, weil Fotos verboten waren.
In den USA hingegen – dies sei nur am Rande bemerkt – ist die Liveübertragung von Gerichtsprozessen nichts Ungewöhnliches.
2.1.5 Marken- und Designrechte
Auch Marken- und Designrechte (bis Februar 2014 noch »Geschmacksmusterrechte«) des Eigentümers oder berechtigten Nutzers einer Sache können eine Einschränkung oder ein Verbot für den Fotografen bedeuten. Auch hier treten die Probleme jedoch kaum bei der Herstellung, sondern fast ausschließlich bei der Veröffentlichung der Fotos auf. Deshalb geht es erst im folgenden Abschnitt 2.2 um diese Problematik.