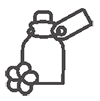Waldpflanzen
IM FRÜHLING
Schöner Frühling, komm doch wieder,
lieber Frühling, komm doch bald.
Bring uns Blumen, Laub und Lieder,
schmücke wieder Feld und Wald.
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN,
»DIE SEHNSUCHT NACH DEM FRÜHLING«
Der Schnee ist endlich weggetaut. Die Sonne hat den Boden nun genügend erwärmt und weckt das neue Leben. Die jungen Blätter der Buchen und anderer Laubbäume sind noch klein und zart, sodass sie das sprossende Grün zu ihren Füßen nicht zu sehr beschatten. Nun wagen sich die Frühlingsblumen aus dem dunklen Waldboden hervor – Buschwindröschen, Zahnwurz, Knoblauchhederich, Aronstab, Bärlauch, Bingelkraut, Sauerklee, Waldpestwurz und das Goldene Milzkraut. Der Wald wird bunt, liebliche Düfte locken nun Bienen, Käfer und Hummeln an und laden sie zum Nektartrunk.
Adlerfarn
(Pteridium aquilinum)
EIN FLUG IN URZEITWELTEN
Die Kraft, mit der andere Pflanzen blühen,
mit der sie Samen und Früchte bilden,
behält der urzeitliche Farn noch zurück
und schickt sie in sein Blätterwunder.
So bleibt dieses lebende Fossil
dem Tautropfen und dem Boden verbunden,
den Mysterien von Nebel und Nacht,
den Geheimnissen von Feuchtigkeit und Dunkel,
der Magie von Zurückhaltung und Unsichtbarkeit.
FRANK MEYER UND MICHAEL STRAUB,
»DIE MAGISCHEN 11« (2011)
Die Welt der Farne lässt uns in die Urzeiten blicken, ins Erdaltertum, als unsere biologischen Vorfahren noch als Lurche (Amphibien) unterwegs waren. Damals, vor rund 300 Millionen Jahren, gab es weder Blumen noch Schmetterlinge und Bienen. Es war auch lange vor dem Zeitalter der Riesenechsen, der Dinosaurier, deren Futter aus Koniferen, Gingkobäumen und anderen Nacktsamern bestand. In den dampfenden Sümpfen des frühen Steinkohlezeitalters gab es riesige Wälder aus Farnen, Bärlapp und Schachtelhalmgewächsen. Diese Pflanzen waren, neben den Lurchen, die fortgeschrittensten Lebewesen der damaligen Zeit. Sie hatten weder bunte Blüten noch Samen. Sie pflanzten sich mittels winziger Sporen fort, die sich in kleinen Kapseln auf der Unterseite der Blätter oder an ihrem Rand entwickelten. Wenn diese Sporen auf den feuchten Boden fielen, keimten sie und es entwickelte sich ein kleiner – beim Adlerfarn ein fingernagelgroßer – Vorkeim mit einerseits weiblichen Geschlechtszellen (Archegonien) und andererseits Antheridien, aus denen schwimmende männliche Keimzellen (Schwärmer) ausschwärmen. Bis heute sind diese Geschlechtszellen bei den Farnen haploid, das heißt, sie enthalten jeweils nur einen einfachen Chromosomensatz. Mithilfe kleiner Geißeln bewegen sich die Schwärmer auf der Suche nach weiblichen Fortpflanzungszellen und befruchten diese. Erst dann entsteht der diploide1 Farn mit seinen grünen Wedeln, so wie wir ihn kennen. Beim damaligen Stand der Evolution waren die Pflanzen für ihre Fortpflanzung also ebenso auf Wasser angewiesen wie die Amphibien. Noch heute müssen deren Nachfahren, die Frösche, Kröten und Lurche, zur Begattung zum Tümpel zurückkehren.

Im Frühling sprießen aus den Wurzelstöcken des Adlerfarns Schösslinge senkrecht empor, die Wedel zunächst noch eingerollt.

Ganz allmählich entrollen sich die Schnecken und werden zu mächtigen, dreifach gefiederten Wedeln.
Es ist also der tau- und regenfeuchte Humusboden selber, der die »Blüte« der Farne ausmacht und in dem die Befruchtung stattfindet. Erst den Nacktsamern und den Reptilien gelang es später, sich für die Fortpflanzung vom Wasser zu emanzipieren und dadurch die trockeneren Landstriche zu besiedeln.
Botaniker machen rund 10 000 Arten dieser blütenlosen, schattenliebenden echten Farne (Polypodiopsideae) aus, die gegenwärtig die Erde besiedeln. Unter ihnen ist der Adlerfarn – er gehört zu den Tüpfelfarnen (Polypodiaceae) – eine äußerst erfolgreiche Spezies, ein Weltbürger, der praktisch überall auf der Erde zu Hause ist: in den gemäßigten Zonen, in den Subtropen wie auch in den Tropen. Bei uns findet man ihn in den Wäldern, auf Kahlschlägen und Waldlichtungen. Steppen und Wüsten meidet er.
Dieser Farn vermehrt sich nicht nur über Sporen, sondern bildet kriechende Wurzelstöcke, die bis zu 60 Meter lang werden können. An günstigen Standorten erreichen seine gestielten Wedel über drei Meter Höhe. Er hat nicht nur eine lange Ahnenreihe, er wird auch so alt wie Methusalem: In Finnland fand man Adlerfarne, die ein nachgewiesenes Alter von 1500 Jahren aufweisen.

Der Adlerfarn kann ausgewachsen übermannshoch werden, sogar Größen von über zwei Metern Höhe sind keine Seltenheit.
NAMEN UND BRAUCHTUM
Wie die Flügelschwingen eines Riesenvogels breitet dieser Waldfarn seine gefiederten, grünen Blattwedel über den Boden aus. Da ist es verständlich, dass die häufigste Benennung dieses Farns Adlerfarn ist. Auch der lateinische Name Pteridium aquilinum deutet das an. Pteridium lässt sich auf griechisch pterón (»Feder, Flügel«) zurückführen und der Beiname aquilinium auf das lateinische Wort für den Adler, aquilia. Adlerkraut, Adlerwurz, niederländisch adelaarsvaren, auch französisch fougère à l’aigle unterstreichen diesen Zusammenhang. Der westgermanische Name farn (niederländisch varen; englisch fern) bedeutet ebenfalls »Flügel« oder »Feder«. Es heißt auch, wenn man einen schrägen Querschnitt durch den Wurzelstock oder den unteren Teil des Blattstiels mache, dann könne man einen Doppeladler sehen, das Symbol des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und des Habsburger Kaisertums. Manche führen den Namen Adlerfarn auf dieses angebliche Adlerbild im Querschnitt zurück. Wenn Franzosen die Leitbündel schräg durchschneiden, sehen sie dagegen die Fleur-de-Lis, die dreifache Lilie, das Symbol des französischen Königtums.

Die kriechenden Wurzelstöcke erreichen 60 Meter Länge, sodass etwa aufgelassene Almwiesen schnell zu Adlerfarnwäldern werden.
Fromme Gemüter entdecken jedoch ein I und ein C in dem Schnitt, also die Initialen des Heilands, Jesu Christi. Daher die Benennungen Jesus-Christ-Wurzel in manchen Gegenden, oder – in Irland – Gottesfarn (fern of God). Deswegen, so heißt es, fürchten sich Hexen und Teufel vor diesem, aber auch vor anderen Farnen.
Hildegard von Bingen (Physica XLVII) schreibt: »Der Farn ist sehr warm und trocken und hat nur wenig Saft. Aber er enthält viel Kraft, und zwar solche Kraft, dass der Teufel ihn meidet. Die Wärme des Farns bezieht ihre Kraft von der Wärme der Sonne, und der hat bestimmte Kräfte, die der Kraft der Sonne ähneln. Denn wie die Sonne das Dunkle erhellt, so verjagt er die Wahnbilder, und daher sind ihm die bösen Geister gram. Wo er wächst, führt der Teufel nur selten seine Täuschungen durch. Er meidet und verabscheut das Haus und den Ort, wo ein Farn ist.« (Riethe 2007: 388)
Da dieser Farn der größte unserer einheimischen Farne ist, nannte man ihn hier und da Groß Farnkraut (französisch grande fougère), Großer Waldfarn, Ochsenfarn, Rossfarn oder Stockfarn. Da man fürchtete, es könnten sich Nattern unter den ausladenden Wedeln verstecken, bezeichnete man die Pflanze auch als Schlangenkraut, Otternkraut, niederdeutsch Snakenkruud (Snake = Schlange), niederländisch addervaren, englisch adder-spit, dänisch snogblad.
Als Bräuwurzel kannten hessische Bauern diesen Farn, denn er sollte die Schweine vor der »Bräune« (Milzbrand, Schweinerotlauf) schützen.
Hurenwurz, ein aus Niederbayern überlieferter Name, weist darauf hin, dass der Farn als Abtreibungsmittel benutzt wurde. Als Würmwurz benutzte man ihn, ähnlich wie den Wurmfarm (Aspidium oder Dryopteris filix-mas), im Berner Land zum Austreiben von Eingeweidewürmern. Vielerorts, besonders in Ost- und Mitteldeutschland, war er der Flohfarn, den man unter das Bett legte, in den Strohsack stopfte, in die Hundehütte oder sogar ins Hühnerhaus streute, um die lästigen Flöhe zu vertreiben. Als Wanzenkraut soll der Farn auch diese kleinen Blutsauger abhalten. Streukraut ist ein weiterer Name für den Adlerfarn, da man ihn als Einstreu für das Vieh verwendete. Glasaschenwurz hieß er bei den Glasbläsern, da die kalireiche Asche als Lauge bei der Glasherstellung gebraucht wurde.
In der Antike unterschied man »weibliche« Farne von »männlichen«. Mit dem kleineren »Männerfarn« war der Wurmfarn gemeint; der Name »Weiberfarn« oder »Nymphenfarn« bezog sich dagegen auf den Adlerfarn.
Interessant ist der englische Name des Adlerfarns, braken (schwedisch bräken, dänisch bregne). Diese Benennung geht auf das protogermanische *brak (Gestrüpp, Unterholz) zurück, also etwas, was beim Fortbewegen bremst (englisch to brake = bremsen).
Wie der Wurmfarn, spielte auch der Adlerfarn eine große Rolle in der Johannisnacht, im Sommersonnwendbrauchtum. Daher Namen wie Johanneskraut – nicht zu verwechseln mit dem echten Johanniskraut (Hypericum perforatum) –, Johannesfarn oder auch Minutenkraut, da es, wie der Volksglaube besagt, in der Mitternachtsstunde am Johannistag nur eine Minute lang blüht, ehe es versamt.

Ein Farn ist auch die Nationalpflanze Neuseelands. Er galt schon den Ureinwohnern als Glück bringend und ziert Grußkarten wie etwa hier zu Weihnachten.
Die magische Johannisnacht
Die Sommersonnenwende galt, wie auch die im Jahreskreis gegenüberliegende Wintersonnenwende, als besonders heilig. Zwischen dem aufsteigenden und dem absteigenden Jahr steht hier für einen kurzen Moment das Jahresrad still. Nichts ist fix in diesem magischen Zwischenraum, alles ist möglich. Wunder geschehen, Götter und Naturgeister erscheinen und spontane Heilungen finden statt. Die Christen hielten an dem ursprünglich heidnischen Sonnenwendkultus fest, nur weihten sie ihn dem heiligen Johannes, der, wie sie glaubten, zu Mittsommer geköpft wurde.
Fast universal war man in ganz Europa, aber besonders in den östlichen Ländern, davon überzeugt, dass zu Johanni, in der Mitternachtsstunde, der Farn für einen kurzen Augenblick goldgelb, blutrot oder regenbogenfarbig aufblüht und dann winzige schwarze Samen abwirft. Diese Samen haben magische Kräfte. Wer sie besitzt, hat Glück in der Liebe, beim Kegeln oder Kartenspiel; er kann die Sprache der Tiere verstehen, die Heilkraft der Pflanzen erkennen, stich- und hiebfest werden, Reichtum erlangen, Schlösser öffnen, seine Speisekammer füllen, als Alchemist unedle Metalle in Gold verwandeln und vieles mehr. Unters Schießpulver gemischt, macht er den Schuss unfehlbar und den Jäger zum Freischützen. Von jemandem, der Schweineglück hat oder zu plötzlichem Reichtum gekommen ist, sagen die Schwaben noch immer: »Der hät de Fahrsame g’holt!«
»Wer den Samen besitzt, der kann den Teufel zwingen, ihm den Tisch zu decken«, behauptete ein Aargauer 1596 und wurde für eine derartig verwegene Aussage vom Gericht mit zwei Pfund Bußgeld bestraft.
...
Mit einem Säckchen Farnsamen auf der Brust kann man sich nach altem Glauben für Feinde unsichtbar machen. Auch Shakespeare erwähnt das in seinem Drama »Henry IV«: We have the receipt of fern seed, we walk invisible (»Wir besitzen das Farnsamenrezept, unsichtbar wandeln wir.«).
...
Den Samen zu erlangen ist jedoch alles andere als einfach. Gen Mitternacht begibt sich der Farnsamensammler zu einem Farn, am besten einem, der auf einer Wegkreuzung oder -gabelung steht. Mit einem Hasel-, Ebereschen- oder Wacholderstockmuss er einen Schutzkreis ziehen und splitternackt in den Kreis eintreten. In Tirol hieß es, der Sammler sollte sieben grüne Holunderzweige kreisförmig um den auserwählten Farn stecken. Nun muss er sein Hemd, ein weißes Leintuch, in Schlesien die Haut einer einjährigen schwarzen Ziege, am besten aber das Blatt einer Königskerze unter die Farnpflanze legen, um die Samen aufzufangen. In katholischen Regionen nahm man gerne ein heimlich entwendetes, geweihtes Tuch, mit dem der Abendmahlkelch bedeckt wird, um den Samen aufzufangen, denn der Farnsamen sei so glühend heiß, dass er sich durch ein gewöhnliches Tuch hindurchfresse. Während der gefährlichen Handlung muss der Zauberer absolut schweigen und den Blick ununterbrochen auf das Farnkraut richten. Sofort erscheint nämlich eine Schar Teufel oder wilder Waldgeister, manchmal auch Schlangen und Nattern. Diese versuchen den wagemutigen Glücksjäger (oder die mutige Zauberfrau) abzulenken und zum Sprechen zu bringen. Wenn es ihnen gelingt, dann verliert er seine Seele an den Teufel. Oft donnert oder blitzt es, wenn Schlag Mitternacht die Blüte hervorbricht. Meistens soll der Samensammler bis Sonnenaufgang am nächsten Morgen in dem Zauberkreis verweilen und dabei Zauberlieder singen. Die Zaubersamen können dann unter dem Hut, in einem Säckchen auf der Brust oder in der rechten Achselhöhle fortgetragen oder aufbewahrt werden. Das Ritual des Aufspürens von Farnblüte und -samen ist von Region zu Region, von Land zu Land verschieden.
Frühe Naturwissenschaftler, wie die Botaniker und Kräuterbuchautoren Otto Brunfels (1488–1534) und sein Zeitgenosse Hieronymus Bock hielten nicht viel von diesem Brauchtum. Für sie war es »lauter Gaukelwerk« und »kein natürlich Ding«. Die politischen Autoritäten sahen das jedoch anders. Sie und ihre gelehrten Ratgeber glaubten daran und sahen in dem Sammeln des Johannissamens eine Bedrohung. Was wäre, wenn Diebe oder Meuchelmörder in den Besitz dieser »pflanzlichen Tarnkappe« kämen, mit der sich zudem noch Schlösser aufsprengen ließen? Das musste strengstens unterbunden werden (Meyer/Straub 2011: 111). Die Inquisition kannte kein Pardon: Wer so etwas tat, wurde hingerichtet. Auch die Protestanten waren da nicht zimperlich. Im Jahr 1601 wurde in Erfurt ein Mann mit dem Schwert hingerichtet, der in der Achselhöhle Farnsamen verborgen hatte, die ihn – wie er glaubte – hieb- und stichfest machen sollten. Pech gehabt.
Der bayerische Herzog Maximilian (1573–1651), späterer Kurfürst, erließ 1611 ein »Landesgebot wider Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere Teufelskünste«, wonach das Holen von Farnsamen unter Strafe gestellt wurde. Im Jahr darauf verfügte die Kirchensynode von Ferrara ebenfalls ein Verbot des Farnsamensammelns zu Johanni. Besonders gefährlich war es für den Sucher der magischen Samen, wenn das Ritual erforderte, dass der Möchtegernzauberer sich eine Zeit lang weder wusch noch Fingernägel und Haare schnitt noch Weihwasser berührte, denn dann war es den Tugendwächtern klar, dass er ein Hexer sein musste.
Trotz Acht und Bann, trotz dem Gespött aufgeklärter Zeitgenossen, suchte man im ländlichen Raum, insbesondere in den slawischen Ländern, vielerorts noch lange nach der mysteriösen Farnblüte in der Johannisnacht. Im Baltikum ist dieser Brauch, wenn auch auf spielerische Art, noch lebendig. Da wird zwar weniger der Zaubersame gesucht, sondern man versucht das Wunder des Aufblühens der Blume zu erleben. Die lettische Ethnologin Dr. Ieva Ancevka erklärte: »Selbstverständlich gibt es keine wirklichen Blüten beim Farn. Die Sonnenwende ist jedoch ein reales kosmisch-terrestrisches Ereignis, das man auch in der eigenen Seele – besonders in der Stille der Nacht, in einsamer Natur – spüren kann. Die ›Blüte‹ ist eine seelisch-ätherische. Im Moment der Sonnenwende küsst der Himmel die Erde, dann leuchtet die Blüte in der mystischen Schau auf.« (Storl 2020d: 135)
Auch sonst spielt der Farn im Volksbrauchtum zu Johanni noch immer eine Rolle: Die Slowenen streuen in der Johannisnacht Adlerfarnwedel auf den Boden, damit der Täufer darauf schlafen kann. In Frankreich wird der Farn vor Sonnenaufgang am Johannistag gesammelt; er schützt gegen Zauber – ein Brauch, der auf römisch-gallische Zeiten zurückgeht. Im Vogtland wird die Wurzel zu Mittag am Johannistag gegraben und dem Vieh gegen Behexung eingegeben.

Im Herbst weicht das Grün aus den Adlerfarnwedeln, es dominieren Braun-, Rot- und Gelbtöne, bis sich der Farn im Winter in die Erde zurückzieht.
HEILPFLANZE
Der Adlerfarn ist, wie erwähnt, ein Kosmopolit, der praktisch überall auf der Erde wächst. Daher liegen uns etliche ethnobotanische und ethnomedizinische Berichte aus verschiedenen Kulturkreisen vor:

Der Wurmfarn ist im Gegensatz zum dreifach gefiederten Adlerfarn nur zweifach gefiedert, die Blätter stehen in einer Rosette.
In Europa
Von einer heilkundlichen Verwendung des Adlerfarns ist aus der Antike wenig überliefert. Der Römer Plinius schreibt: »Farne vertreiben Eingeweidewürmer, und zwar von diesen die Bandwürmer, wenn man ihn drei Tage lang in süßem Honigwein trinkt.« Wahrscheinlich meinte er weniger den Adlerfarn als den Wurmfarn (Aspidium oder Dryopteris filix-mas). Als Abortivum kannte man den Wurmfarn ebenfalls im alten Rom.

Sehr feuchte und schattige Standorte liebt der Hirschzungenfarn, dessen Blätter nicht gefiedert, sondern vollständig geschlossen sind.
Im deutschsprachigen Raum war es Hildegard von Bingen, bei der dieser Farn erwähnt wird und in deren Schrift das erste Zeugnis von der Zauberkraft des Farns zu finden ist. Sie schöpfte wahrscheinlich aus dem allgemeinen Volksaberglauben, wenn sie sagt, dass der Teufel den Farn flieht. Deswegen solle sich die Frau, die ein Kind gebäre, mit Farn umgeben, wie auch die Wiege damit umlegen, in der das Kind ruhe. Jemand, der an Gicht leide, sagt die kräuterkundige Heilige, solle grünen Farn kochen und in dem Sud baden. Auf die Augen gelegt reinige der Farn diese.
Culpeper, der Meister der astrologischen Heilkräuterkunde, stellt den »weiblichen Farn«, den braken fern, unter die Herrschaft des Merkur. Die in Met gekochten Wurzeln treiben, wie er schreibt, »die langen, flachen Würmer« aus dem Körper und helfen bei Schwellungen und Verhärtungen der Milz. Auch bei Rudolf Steiner finden wir den Hinweis auf die Milzwirksamkeit: »Adlerfarnpräparate unterstützen und harmonisieren die rhythmischen Prozesse in Milz und Darm.« (Pelikan II 1977:23)
Weiter schreibt Culpeper, »cholerische und wässrige Humore« im Magen könnten durch das Essen der Blätter purgiert und ausgetrieben werden. Die zerstampften, in Öl oder Schmalz gekochten Wurzeln würden Wunden heilen und äußerlich aufgetragen bei Knochenbruch, Prellungen und Hexenschuss helfen, gepulvert und aufgestreut reinigten sie eitrige Geschwüre. Culpeper warnt jedoch, dass der Braken-Farn eine abtreibende Wirkung habe und von Schwangeren gemieden werden solle.
In der heutigen Phytotherapie spielt der Adlerfarn praktisch keine Rolle mehr. Er steht inzwischen nämlich unter dem Verdacht, bei innerer Anwendung karzinogen zu wirken (siehe unten: Wildgemüse). Auch auf die anthelminthische (wurm- und parasitenabtötende) Wirkung der Farne wird heutzutage verzichtet, da es viel bessere pharmazeutische Mittel gibt, mit weniger toxischen Nebenwirkungen. Noch immer kennt man die Adlerfarnwedel als wirksames Hilfsmittel bei Gicht und rheumatischen Erkrankungen, wenn man sie unter das Bettlaken oder in die Matratze legt. Die Volksmedizin verordnet noch immer einen Adlerfarnessig, der bei Gicht und Rheuma eingerieben wird. Dafür lässt man die klein gehackten Blätter und Wurzeln drei Tage lang in Apfelessig ziehen, ehe das Mittel abgefiltert wird.
In Nordamerika
Die Indianer Nordamerikas kennen viele Anwendungen – zu viele, um sie hier alle zu erwähnen. Hier einige Beispiele: Verschiedene Stämme kannten Abkochungen des Wurzelstocks als Gesundheitstonikum, als Krebsmittel und »um das Blut zu verbessern«. Zur Stärkung des Haarwuchses wusch man sich mit dem Farn-Dekokt die Haare. Bei den Menominee tranken stillende Mütter diesen Sud, um den Milchfluss zu verbessern. Auch Salben aus der Pflanze waren bekannt, die wundheilend wirken sollten. Bei heftigen Kopfschmerzen wurde mit dem Kraut geräuchert (Moerman 1999: 452f).
In Neuseeland
Neuseeland ist ein Land der Farne. Bei den eingeborenen Maori spielt der Adlerfarn (Rahurahu oder Aruhe) als Heil- und Zaubermittel eine hervorragende Rolle. Viele Anwendungen ähneln denen der nordamerikanischen Indianer. Die Wurzelstöcke wurden innerlich gegen Durchfall und Dysenterie eingesetzt, Frauen verwendeten Abkochungen, um die Periode oder bei stillenden Müttern den Milchfluss anzuregen. Äußerlich stäubte man die Asche der verbrannten Wedel auf Brandwunden. Erhitzte Wurzeln wurden auf schmerzende Stellen des Körpers gelegt, um die Krankheitsdämonen (Taipó) aus ihnen zu vertreiben.
Vor allem aber wurde Rahurahu von den Heilern und Priestern (Tohunga) magisch verwendet. Krankheit galt meistens als Folge von Tabubrüchen. In dem Fall musste der Übeltäter Farnwedel in der Hand halten, während der Priester Zauberlieder sang. Die Blätter wurden anschließend mitsamt der Sünde ins Wasser eines Flusses geworfen und auf diese Weise entsorgt. Die Priester benutzten den Adlerfarn in vielen schamanischen Ritualen, um Verbindung mit Geistern und Göttern aufzunehmen. Die Wurzel galt als würdiges Opfer für die Götter (Riley 1994: 390ff).
In Russland
In der Volksmedizin der Bewohner der endlosen Taiga gilt der Adlerfarn (Orlyak) als wichtiges Heilkraut bei einer ganzen Palette von Krankheiten, darunter Migräne, Krampfadern, Hämorrhoiden, Arthritis, Wurmbefall, Gelenkschmerzen, Durchfall, Rachitis und andere. Es heißt, Adlerfarnmedikamente normalisierten die Verdauung und wirkten günstig bei Diabetes, sogar vor radioaktiver Verstrahlung sollen sie schützen.2
IN DER KÜCHE
Bei den Maori
Als Nahrungspflanze ist der Adlerfarn traditionell bei vielen Völkern beliebt. Bei den Maori Neuseelands waren die stärkehaltigen Sprossachsen (Wurzelstöcke) wie auch die jungen Triebe lange ein Grundnahrungsmittel. Als diese seefahrenden Polynesier das »Land der langen weißen Wolke« – so nennen die Maori Neuseeland – vor 1200 Jahren mit ihren Booten erreichten und besiedelten, mussten sie feststellen, dass es dort für den Anbau ihrer wichtigsten Nahrungspflanzen, der Brotfrucht und der Kokospalme, zu kalt war. Einzig die Süßkartoffel gedieh dort noch.3 In der Denkweise der Maori galt die Süßwurzel (Kumara), die in Gärten angebaut werden muss, als Friedensnahrung. Der überall wild wachsende Farn, der Aruhe, war dagegen Kriegsnahrung, denn mit seinen Wurzeln konnten sich die Krieger auf ihren Feldzügen überall ernähren.
Den Ursprung des Adlerfarns erklärten die Maori wie folgt: In der Urzeit lagen der Himmelsvater Rangi und die Erdmutter Papa in inniger Umarmung verschmolzen. Die Kinder, die Papa gebar, fristeten ihr Dasein in der Dunkelheit zwischen den beiden; sie hatten kaum Raum zum Atmen. Da stemmte sich Tane, der spätere Gott des Waldes und der Vögel, mit seinen kräftigen Beinen gegen Rangi; es gelang ihm auf diese Weise, das Urpaar auseinanderzuschieben. Einer der Söhne, der kleine Haumia, klammerte sich an den Himmelsvater, fiel jedoch herunter, durchbrach die dunkle Haut der Erdmutter und versteckte sich darin. Nur sein Haarbüschel – das sind die grünen Farnwedel – ragte über die Oberfläche heraus. Als Tawhiri, der ewig zornige Gott der Winde, Stürme und des Gewitters, dieses Haarbüschel fand, riss er es heraus und entdeckte, dass dessen im Erdboden verborgener Teil gut schmeckte. Haumia, der sich immer wieder im Erdenschoß neu verkörpert, wurde zum Gott der wild wachsenden Nahrungspflanzen.
Da auf diese Weise für die Maori ein mystischer Zusammenhang zwischen Farnwedeln und dem Schopfhaar der Menschen besteht, fügen sie den beim Haareschneiden abgeschnittenen Haaren immer Adlerfarnwedel hinzu, ehe sie diese entsorgen.
Die Maori sammeln die Wurzelstöcke des Adlerfarns im Sommer, trocknen sie und bewahren sie für den Winter auf.
Bei den Japanern
Die Japaner schätzen den Adlerfarn (Warabi) ebenfalls als Speise. Die jungen Blätter mit den noch eingerollten Spitzen, die Blattschnecken, werden zuerst vorsichtig mit frischem Wasser gewaschen, für etwa zwei Minuten in kochendem Salzwasser oder Wasser mit Aschelauge gekocht und anschließend für mehrere Stunden in kaltes Wasser gelegt. Sie können dann unmittelbar in der Küche verwendet oder in der Sonne getrocknet und für spätere Verwendung aufbewahrt werden. Die Sprosse werden auch in Salz eingepökelt oder in Reiswein (Sake) oder vergorener Sojasauce (Miso) haltbar gemacht.
Für eine Mahlzeit werden sie eine Stunde eingewässert, dann zwei Minuten lang gekocht, das Wasser wird abgegossen, erst dann kommen sie in die Gemüsepfanne oder werden wie Spinat gekocht. Aus der aus dem Wurzelstock extrahierten Stärke stellen die Japaner eine beliebte geléeartige, weiche Süßigkeit her, das sogenannte Warabi-Mochi. Die alte Hauptstadt Nara ist für ihre besonders leckeren Warabi-Mochi bekannt. Auch für andere Völker Ostasiens, für Koreaner und Chinesen, sind die Adlerfarnsprosse ein beliebtes Frühjahrsgemüse. Gerichte aus Adlerfarn galten in diesen Ländern als würdige Opfer für die Ahnen.

In Japan wird der Adlerfarn als Gemüsepflanze angebaut. Die jungen Farnwedel sind in Fernost als Frühlingsgemüse beliebt.
Bei den Guanchen
Die gerösteten Wurzelstöcke des Adlerfarns waren auch für die Guanchen, die indigenen Bewohner der Kanarischen Inseln, ein Hauptnahrungsmittel. Diese steinzeitlichen Ureinwohner stellten für ihr Frühstück und als Wegzehrung ein Röstmehl her, welches sie Gofio nannten. Brot kannten sie nicht. Gofio bestand in vorspanischen Zeiten aus Gerste, Adlerfarn-Rhizomen, den Beeren des Gagelbaumes (Myrica faya) und denen des Mocán-Baumes (Visnea mocanera); die letzteren sind Bäume, die nur in den kanarischen Lorbeerwäldern zu Hause sind. Diese Zutaten wurden geröstet und mit steinernen Handmühlen gemahlen. Das Mehl wurde aufbewahrt und bei Bedarf mit Ziegenmilch, Fleischbrühe oder auch Wasser gemischt und in einem Ziegenbalg so lange geknetet, bis eine homogene Masse entstand. Bei den Hirten, die oft tagelang in abgelegenen Bergen unterwegs sind, und bei den Mago, den einfachen Bergbauern, ist das bis zum heutigen Tag noch immer eine tägliche Speise – eine sehr gut schmeckende, wie ich persönlich erleben durfte.
Auch in den modernen Supermärkten auf den Kanaren kann man inzwischen Gofio kaufen. Es ist aber nicht mehr authentisch. Es besteht heutzutage aus gemahlenem, geröstetem Mais, Weizen und Hülsenfrüchten und schmeckt demzufolge anders; es hat auch keine vergleichbare Nährkraft.

Farne lieben schattige Standorte, vorzugsweise in Laub- oder Mischwäldern. Nur der Adlerfarn findet sich auch auf teils besonnten Almwiesen.
Bei den amerikanischen Ureinwohnern
Für die Indianer der pazifischen Nordwestküste Amerikas, von Oregon bis hinauf nach Alaska, war der Adlerfarn ebenfalls eine wichtige Nahrungsquelle. Getrocknete Lachse und die getrockneten Farnwurzeln und -triebe gehörten zu den wichtigsten Wintervorräten. Die zarten, im Frühling gesammelten Fiedelköpfe (fiddleheads) wurden geschält, beziehungsweise der pelzige Belag abgerieben, und bei Bedarf wie Spargel gekocht. Auch hier wurde das Wasser zwischendurch gewechselt. Die langen Rhizome röstete man und zerstampfte sie, bis sie weich waren, und verzehrte sie dann insbesondere mit fettigem Fisch oder dem Kaviar der Salme.
Bei den Ojibwa, einem am Lake Superior lebenden Volk, aßen die Jäger im Frühling, wenn sie auf die Pirsch gingen, fast ausschließlich Adlerfarnsprossen. Damit änderten sie den Geruch ihres Atems und ihrer Körperausdünstung, sodass die white tail deer, die »Rehe«, die zu dieser Zeit ebenfalls an den Farnsprossen knabbern, sie nicht witterten. So konnten die Jäger sich bis auf fünf Meter an ihre Beute heranpirschen und sie mit Pfeil und Bogen erlegen. Mit den Schusswaffen, die heutzutage zur Verfügung stehen, ist der Brauch veraltet.
In Europa
In Europa aß man den Adlerfarn vor allem in Not- und Hungerzeiten. Gelegentlich wurden die getrockneten und gemahlenen Wurzeln mit Getreidemehl gemischt und ins Brot gebacken oder im Mehlbrei gekocht.
Adlerfarn galt als minderwertige Nahrung. Es wird berichtet, dass der Herzog von Orleans im Jahr 1745, als Hungersnöte und Nahrungsmittelverteuerung das französische Volk bedrängten, dem verschwendungsfreudigen französischen König Ludwig XV. ein aus Farnmehl gebackenes Brot mit den Worten überreichte: »Eure Majestät, Eure Untertanen ernähren sich hiervon.« (Hedrick 1919: 470)
In Sibirien und auch in Norwegen wurden die jungen, noch eingerollten Wedel oder die stärkehaltigen Wurzeln beim Bierbrauen verwendet.
GIFTWIRKUNG
Als ich als mittelloser Schriftsteller mit meiner Familie auf einen Berg ins Allgäu zog, waren Wildpflanzen ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Im Frühling kamen dann immer die jungen, noch aufgerollten Blätter, die fiddleheads, mit in die Pfanne. Sie schmeckten gut, aber leider wussten wir noch nicht, dass diese inzwischen als problematisch gelten. Als giftig!
Rinder, Pferde und Ziegen meiden angeblich instinktiv die Pflanze. Nur in Zeiten der Dürre, wenn kein anderes Grünfutter erhältlich ist, wagen sie sich an die Adlerfarnsprossen und -wedel. Wenn sie sehr viel davon fressen, wird es für sie gefährlich. Geis-tödt-i, nennt man den Farn in Graubünden, da er für die Ziegen giftig ist. Die Milch von Kühen, die den Farn gefressen haben, wird bitter im Geschmack. Wildschweinen dagegen scheint die Pflanze nicht zu schaden; im Herbst fressen sie die Wurzelsprossen leidenschaftlich gerne.
Wissenschaftler haben folgende Giftstoffe im Adlerfarn entdeckt:
- ⬥ Thiaminase, ein Enzym, welches Vitamin B1 zerstört. In Japan, Neuseeland und bei den Indianern werden die Fiedelköpfe oft roh im Wildsalat gegessen, was bei zu häufigem Verzehr möglicherweise zu Beriberi, einer auf dem Mangel von Vitamin B1 beruhenden Krankheit, führen kann. Kochen jedoch zerstört das Enzym. Tiere, die über längere Zeiträume aus Mangel an anderen Futterquellen den Farn fressen, bekommen Nervenschäden, sie taumeln, haben Zuckungen und können im Extremfall sogar sterben.
- ⬥ Ptaquilosid ist ein instabiles Glykosid, das, wie Tests an Laborratten 1984 bestätigten, mit der Entstehung von Magen- und Speiseröhrenkrebs einhergeht. Es ist jedoch noch unklar, ob gekochte, alkalisch aufbereitete Adlerfarngerichte bei Menschen karzinogen wirken, wie es oft behauptet wird.4 Weidetiere, die Adlerfarn fressen, entwickeln nach einigen Monaten wegen dem Glykosid »Stallrot«, das ist blutiger Stuhl und Harn. Kälber, die jeden Tag mit Adlerfarn gefüttert wurden, bekamen nach ungefähr zwei Monaten dieses hämorrhagische Syndrom. Das Enzym ist im Farn je nach Jahreszeit, Standort oder Teil der Pflanze in unterschiedlichen Mengen vorhanden. Besonders die Sporen enthalten viel von dem Glykosid. Bei den noch jungen, aufgerollten Wedeln, die noch keine Sporangien haben, ist das weniger ein Problem. Ptaquilosid wird größtenteils durch kochendes Wasser und Lauge abgebaut. Nach dem ersten Kochvorgang sollte das Wasser abgegossen werden.
- ⬥ Steroidhormone, die bei Insekten zu unkontrollierbarer Häutung führen, sind ebenfalls vorhanden. Wissenschaftler untersuchen zurzeit eine mögliche Anwendung dieser Adlerfarn-Hormone als Insektizide.

Gehäckselte Adlerfarnwedel werden wohl schon seit Beginn der Viehhaltung als Ungeziefer abwehrende Stalleinstreu verwendet.
NUTZPFLANZE
Der Adlerfarn hat – abgesehen von seiner Rolle als Wildgemüse oder Heilpflanze – noch etliche weitere nützliche Eigenschaften.
- ⬥ Stalleinstreu: Die im Spätsommer geernteten Blattwedel geben eine hervorragende Einstreu für die Tiere im Stall. Schon die alten Kelten verwendeten sie in dieser Weise. In kelto-baskischen Gegenden heißt der Monat September Girailla, »Farnkrautmonat«, denn da wurde die Einstreu geerntet (Höfler 1911: 266). In Schottland und Wales verwenden die Farmer den dort üppig wachsenden Farn noch immer dafür. Vorteilhaft ist auch, dass der Farn Läuse, Zecken und anderes Ungeziefer vom Stallvieh – und, in Kissen gestopft, auch vom Nachtlager der Menschen – fernhält. Auch im Hühnerstall bewährt sich der Farn als Bodenbedeckung.
- ⬥ Als Streu in Hundehütten hält der Farn Flöhe und Parasiten ab.
- ⬥ Kaliumquelle: Adlerfarn enthält viel Kalium (K; Pottasche). In der Asche der Sommerwedel sind bis zu 20 Prozent dieses Elements enthalten. Deswegen konnten Glasmacher dieses »Glasaschenkraut« auch zum Glasmachen verwenden; der Zusatz von Kalium senkt die Schmelztemperatur des Kieselsteins. Auch zur Herstellung von Seife, wobei Fette in Kalilauge gekocht werden, hat man den Adlerfarn verwendet.
- ⬥ Dünger: Die gut kompostierte Stalleinstreu aus Adlerfarn ist ein hervorragendes Düngemittel, insbesondere für Wurzelgemüse wie Kartoffeln, Sellerie oder Rote Bete, und auch für Porree. Wenn Pottasche fehlt, sehen die Blätter der Gemüse schlaff aus und bilden tote Randstreifen (Nekrosen), Früchte werden weich und reifen unregelmäßig, Möhrenblätter kräuseln sich, Rote Bete formen sich zu Zapfen und die Wurzelgemüse werden anfällig für Fadenwürmer (Nematoden).
- ⬥ Der geerntete Adlerfarn eignet sich bestens als Bodenbedeckung in den Kartoffelbeeten. Dieser Mulch schützt und hält nicht nur den Boden feucht – was Kartoffeln sehr mögen –, sondern er liefert langsam das für gesundes Kartoffelwachstum notwendige Kalium nach.
- ⬥ Lagerung von Obst: Äpfel und anderes Obst hält sich länger frisch, wenn es nach der Ernte in Adlerfarn gebettet wird. Die Indianer erkannten das, sie bedeckten Beerenkörbe mit Adlerfarnwedeln. Die Nordwestküsten-Indianer wickelten auch Fische in Adlerfarnblätter, um sie länger frisch zu halten.
- ⬥ Färben und Gerben: Mit den jungen Trieben – mit Alaun als Beize – kann man Wolle gelbgrün färben; mit den Wurzeln, ebenfalls mit Alaun, bekommt man eine gelborange Farbe. Der Farn enthält außerdem Gerbstoffe, mit denen man gerne Ziegen- und Gämsenleder gegerbt hat.
- ⬥ Körbe und Matten: Von den Indianern der Westküste wird überliefert, dass sie aus den großen Adlerfarnstängeln Matten flochten und aus den gespaltenen Wurzeln eher minderwertige Körbe.
- ⬥ Verhindert Erosion: Adlerfarnhorste halten erosionsgefährdete Böden stabil und bieten Unterschlupf für Kleingetier.
FEINDPFLANZE
In der heutigen Zeit, in der sich die Menschen recht weit von der unmittelbaren Natur entfernt haben, hat der schöne Adlerfarn schlechte Presse. Man liest, er sei ein Forstunkraut, das mittels Beschattung und allelopathischer Wurzelausscheidungen Gräser, Heidekraut, Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere Pflanzen unterdrücke, verdränge und auf diese Weise die Biodiversität verringere; auch verhindere er das Nachwachsen von Bäumen. Ebenso verringere es Weideflächen.
Weiter heißt es, Adlerfarnbestände böten Hasen, Karnickeln, Wildschweinen, Füchsen und anderen Forst- und Ackerschädlingen Versteckmöglichkeiten; auch steigerten sie die Wildfeuergefahr in Trockenzeiten. Nicht nur sei der Farn krebserzeugend bei den Menschen, sondern er erhöhe die Gefahr an Lyme-Borreliose zu erkranken, denn auch Zecken verstecken sich gerne unter den Farnwedeln.
Seine Giftigkeit für Weidevieh wird vielfach hervorgehoben und meistens übertrieben, denn wenn andere Futterpflanzen vorhanden sind, fressen die Weidetiere keinen Farn.
Landwirtschaftliche Behörden schlagen Alarm. In den englischsprachigen Ländern werden aufwendige Braken Fern Control Programs entworfen, um die Pflanze zurückzudrängen und zu bekämpfen. Neben mechanischen Maßnahmen wie Schneiden, Abbrennen und Niederwalzen wird der Einsatz von Herbiziden in Erwägung gezogen, darunter Produkte wie Asulam, das Farne selektiv abtötet, aber leider auch toxisch für Vögel ist. Auch mit dem Biozid Glyphosat wird der Farn großflächig bekämpft, doch das tötet nicht nur Pflanzen, sondern auch Bodenorganismen und steht im Verdacht, für Mensch und Tier karzinogen zu sein.
Vielleicht sollten wir mit dieser altehrwürdigen Pflanze liebevoller umgehen und nicht wie Zauberlehrlinge blindwütig in Naturvorgänge eingreifen, die wir nicht vollständig verstehen.

Bärlauch
(Allium ursinum)
GRÜNE BÄREN-POWER
Ein Kraut, das starke Heilkraft hat,
verglich man einst mit Bären.
Der Bärlauch trägt seinen Namen mit Ehren.
WOLF-DIETER STORL
Der Bärlauch wächst in feuchten, humusreichen Laubwäldern, insbesondere in Buchenwäldern. Er nutzt die Zeit zwischen der Schneeschmelze und der Belaubung der Bäume, die ihm das Licht nehmen würde, um seine breiten, zarten, dunkelgrünen Blätter hervorzutreiben. Wenn diese Blätter durch Wind oder vorbeistreifende Tiere leicht verletzt werden, gerät das in ihnen enthaltene schwefelhaltige ätherische Öl an die Luft, wobei ein starker Knoblauchduft entsteht. Der Bärlauch wächst in Horsten und bedeckt den Waldboden im Vorfrühling oft in massiven Beständen, wobei der ganze Wald danach duftet.
Gegen Ende April fängt dieser wilde Verwandte der Küchenzwiebel und des Schnittlauchs an zu blühen. Die schneeweißen, duftenden, radiärsymmetrischen5 Blüten mit jeweils sechs Blütenblättern sind in Dolden zusammengefasst. Die Blüten leuchten wie kleine Sterne. Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und Insekten mit kurzen Rüsseln laben sich an dem Nektar. Aus dem dreifächerigen Fruchtknoten der befruchteten Blüte geht eine Kapsel hervor, in der sich jeweils sechs schwarze Samen befinden. Die mit einer ölreichen Oberhaut versehenen Nüsschen sind für die Ameisen interessant: Diese finden die Samen, tragen sie weiter und lassen sie hier und da fallen. Zum Keimen brauchen die Samen Dunkelheit und Frost, das heißt, sie keimen erst im nächsten Frühjahr.
Gegen Ende Mai werden die Blätter gelb und sterben ab. Derweil haben sich in der Erde schmale Zwiebeln gebildet, aus denen dann im nächsten Vorfrühling die neuen Blätter hervortreiben.
Der Bärlauch ist in den Wäldern Eurasiens zu Hause, aber er fehlt im Mittelmeerraum. Hier und da liest man, dass die Römer ihn als Heilmittel benutzten, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Die Ärzte der Antike kannten diese Lauchart kaum. Sie kultivierten und nutzten ja den verwandten, aus dem Orient stammenden, echten Knoblauch (Allium sativum), insbesondere dessen »Zehen« (Nebenzwiebeln) als Zauber- und Heilpflanze sowie als Gewürz und Nahrungsmittelergänzung.
Früher machten es sich die Botaniker einfach: Der Bärlauch war ein Liliengewächs (Liliaceae). Basta! Dann erfand man für die Lauch- und Zwiebelgewächse eine eigene Familie, die Alliaceae. Inzwischen aber wird der Ramser, aufgrund molekulargenetischer Untersuchungen, zu den Amaryllisgewächsen (Amaryllidaceae) gezählt, zu denen unter anderem auch der hübsche Ritterstern (unsere »Amaryllis«), die Clivien, die südafrikanische Schmucklilie (Agapanthus) und die Narzisse gehören.

Die einzelnen Bärlauchblüten haben jeweils sechs weiße Blütenblätter und sind radiärsymmetrisch, das heißt, sie haben mehr als eine Symmetrieachse.
NAMEN UND BRAUCHTUM
Die ältesten Namen dieser Pflanze in allen europäischen Sprachen außer im Lateinischen lassen sich auf das indogermanische *kromus zurückführen. Die urgermanische Bezeichnung war *hrameson. Daraus ergaben sich Benennungen wie Ramser, Rämsen und Rämsch, skandinavisch ramslök (= Ramslauch), englisch ramson; im Allgäu und im Schwäbischen ist es der Ramsen; Kräuterpfarrer Johann Künzle nennt den Bärlauch Rämschelen. Bei den Russen heißt dieser Waldknoblauch, der von Kaliningrad bis Kamtschatka wächst, ceremsa; und für die Iren ist es creamh. Die Liste der Kognaten, also der sprachverwandten Namen, ließe sich ums Vielfache erweitern.
Wilder Knoblauch ist eine Benennung, die man hier und da in den verschiedenen Mundarten findet. Es ist der Bärenknoblauch, Waldknoblauch, wilder Knofl oder der Zigeunerknoblauch. Im Französischen heißt er ail de bois, im Italienischen aglio ursino.
Am bekanntesten ist inzwischen wohl der Name Bärlauch, englisch bear’s leek. Kräuterpfarrer Künzle vermutet: »Den Namen Bärlauch gaben ihm die Alten, weil sie sahen, dass die Bären, nach langem Winterschlaf noch schwach und abgemagert, massenhaft dieses Kraut verzehrten und bald wieder die alte Stärke gewannen.« (Künzle 1977: 31). Da mag etwas dran sein. Es ist tatsächlich so, dass Meister Petz, wenn er seine Höhle verlässt, zuerst seinen immensen Durst mit frischem Wasser löscht. Dann sucht er sich, da er während der langen Winterruhe weder Urin noch Kot abgesondert hat, abführende Kräuter wie die scharfe Nieswurz, um die Gedärme wieder in Gang zu bringen und um das »Bärenpech« auszuscheiden. Erst dann setzt der sprichwörtliche Bärenhunger ein.

Sobald im April und Mai die Blüten des Bärlauchs erscheinen, ist die Erntezeit für die Blätter vorbei. Sie werden dann zäh und vergilben allmählich.
Bachehrenpreis, Kressen, Vogelmiere, junge Gräser, Sauerampfer, Schafgarbenschösslinge, sich gerade entrollende Farnwedel und selbstverständlich wilde Zwiebeln und der Ramser regen Stoffwechsel und Kreislauf an, befeuern die Drüsen und hemmen Gärungs- und Fäulniserreger im Darm. Es sind dieselben Kräuter, mit denen unsere Vorfahren ihre »Blutreinigungskuren« im Frühling machten, auch, um sich mit dem Geist des Lebens wieder zu verbinden (Storl 2016: 173). Für die alteuropäischen Waldvölker, insbesondere für die Germanen, galten alle Pflanzen, die besonders starke Heilkräfte besitzen, die die Abwehrkräfte stärken, die Fruchtbarkeit anregen und besonders auffällig, kraftstrotzend oder behaart sind, als Bärenpflanzen. Zu ihnen gehörte das größte Kraut auf der Wiese, der Wiesenbärenklau (Heracleum sphondylium), die Bärentraube (Arctostaphylos; griechisch árktos = Bär und staphylè = Traube), der Bärlapp (Lycopodium), die Königskerze (»Bärenkraut«), die Bärwurz (Meum), die Große Klette (Arctium lappa), deren lateinischer Name nichts anderes als Bärenpranke (griechisch árktos = Bär, keltisch lapp = Pfote) bedeutet, die Große Brennnessel und viele andere. Als Bärenkräuter wurden sie dem Götter- oder Asenbär (skandinavisch Asbjörn; englisch Osborn) geweiht, und dieser war kein anderer als der mächtige Donar (Thor, Thunar), der vollbärtige, rothaarige Gewittergott, der stärkste und größte unter den Asen. Er ist nicht nur ein Himmelsgott, er tritt auch als ein Sohn der Erde (Jardar Bur) in Erscheinung, der jeden Winter in Bärengestalt das unterirdische Reich der Erdgöttin, der Frau Holle, besucht. Sein Bärenhunger und Bärendurst sind berüchtigt. Sein Tatzenschlag sind die Blitze, mit denen er die Frost- und Eisriesen vertreibt, sodass es wieder Frühling werden kann. Er ermöglicht es, dass der Bärlauch sich aus der kalten Erde hervorwagt und den Menschen wieder Gesundheit, Verjüngung und Sinneslust schenkt. Er ist nämlich auch der Hüter der Fruchtbarkeit. Beim nordgermanischen Hochzeitsritual wurde der Braut ein Thorshammer in den Schoß gelegt, damit sie viele gesunde Kinder zu gebären vermochte.

Auf den Rat des heiligen David, des Patrons von Wales, hin sollen die Waliser mit Lauchblättern am Helm eine Schlacht gewonnen haben.
Der lateinische Gattungsname Allium bedeutet nichts anderes als »Knoblauch« und ist ursprünglich mit dem lateinischen olere (»riechen«) verwandt. Der Artname ursinum geht auf lateinisch ursus (»Bär«) zurück.
Und woher kommt eigentlich der Name der Familie Amaryllidaceae, der diese Bärenpflanze angehört? Er bezieht sich auf den antiken Mythos der schönen jungen Schäferin Amaryllis, die ihr Herz mit einem goldenen Pfeil durchbohrte, weil ihr Liebhaber für sie unerreichbar war. Das geschah genau an der Stelle, an der sich die beiden Liebenden das erste Mal geküsst hatten. Aus ihrem Blut entstand die bezaubernd schöne Blume, der mit dem Bärlauch verwandte Ritterstern. Der schwedische Naturforscher und Klassifizierer aller bekannten Lebewesen, Carl von Linné, genannt Linnaeus (1707–1778), hat sie, der damaligen Mode folgend, so benannt. Im 18. Jahrhundert, im Zeitalter des Rokokos, liebte man solche kitschig-romantischen Geschichten aus der klassischen Antike.
Jedes Jahr wird in Wales am 1. März der Tag des heiligen David (Saint David’s Day) gefeiert. Der walisische Nationalheilige, der Mönch David (Devi Sant), lebte im 6. Jahrhundert, als die Angelsachsen im Begriff waren, Wales zu erobern. Er gab den walisischen Kriegern den Rat, Lauchblätter an ihrem Helm oder ihrer Mütze zu tragen, damit sie sich gut von den eindringenden Feinden unterscheiden konnten. Die Waliser gewannen die Schlacht und seither ist der Lauch, beziehungsweise der Porreestängel, die Nationalpflanze dieses kleinen keltischen Volkes. Historiker sind sich jedoch nicht ganz sicher, ob es der Porree, die Narzisse oder der Ramser war, den sich die Waliser an den Hut steckten. Der Porree, eine mediterrane Gemüsepflanze, und die Narzisse, ebenfalls ein Amaryllisgewächs aus dem Mittelmeerraum, kamen nämlich erst im späten Mittelalter in den Norden. Die Schlacht soll in einem Lauchfeld stattgefunden haben; wahrscheinlich handelte es sich um einen Landstrich voller Bärlauch, denn dieser ist in Wales heimisch.
Von den alten Angelsachsen, die in England siedelten, ist Folgendes überliefert: Kam ein junger Freier an einen Hof und hielt um die Hand der Tochter an, dann erfuhr er durch die Speise, die man ihm vorsetzte, ob er als Schwiegersohn infrage kam. Servierte man ihm ein Rübengericht, sollte er sich verziehen. Bei einem Mehlbrei war er als Freund willkommen. Bei Eierkuchen mit grünem Lauch jedoch wurde er als künftiger Schwiegersohn anerkannt.
_______
BÄRLAUCHPASTE
_______
ZUTATEN
4–5 Handvoll Bärlauchblätter
2–3 TL Salz
etwa 100 ml Oliven- oder Rapsöl
- ⬥ Bärlauch waschen und trocken tupfen. In sehr feine Streifen schneiden und mit Salz und 80 ml Öl mischen.
- ⬥ Die Mischung in saubere Gläser mit Schraubverschluss füllen und mit dem restlichen Öl bedecken.
- ⬥ Im Kühlschrank mehrere Monate haltbar, kann auch eingefroren werden.
- ⬥ Die Paste kann man als Grundlage für Nudelsaucen verwenden, als Würze in Gemüsesuppen einrühren oder einfach aufs Brot streichen.
HEILPFLANZE
Wie der Knoblauch, ist der Bärlauch ein starkes Heilmittel. Der Ramser kann alles, was der aus dem Orient stammende kultivierte Knoblauch kann:
- ⬥ Er reizt die Magen-Darm-Schleimhaut und regt die Sekretion von Magensaft und Galle an.
- ⬥ Er wirkt blähungswidrig (karminativ) im Darm.
- ⬥ Er erneuert die Darmflora, wirkt gegen Fäulnis und Gärung. Das ätherische Öl, Allicin, wirkt pilzwidrig und antibakteriell. Allicin wirkt noch in einer Verdünnung von 1 zu 100 000 gegen grampositive und gramnegative Bakterien.
- ⬥ Bärlauch wirkt krampflösend bei Gallen-, Magen- und Darmkrämpfen, auch die Bronchien kann er entkrampfen. In Milch gesotten wirkt Bärlauch entkrampfend und desinfizierend bei Lungenentzündung.
- ⬥ Bärlauch wirkt sich günstig auf Arteriosklerose aus, da er die Blutgefäße erweitert und damit den Blutdruck senkt – all das ohne die Nebenwirkungen, die sich bei synthetischen Medikamenten einstellen, wie Kopfschmerzen, Schwindel, Allergien, Magen-Darm-Beschwerden, Impotenz und andere. Auch die Blutfettwerte werden verbessert.
- ⬥ Nach Angaben von Prof. Dr. Heinz Schilcher, Sachverständiger der Kommission E des Bundesgesundheitsamts zur wissenschaftlichen Untersuchung pflanzlicher Arzneimittel, wirken Bärlauch und Knoblauch vorbeugend und heilend bei chronischer Bleivergiftung.
- ⬥ Bärlauch wirkt wie der Knoblauch immunstärkend. Der renommierte amerikanische Mediziner Prof. Dr. med. Andrew Weil schreibt, dass beide pflanzlichen Mittel das Abwehrsystem stärken und die Vermehrung natürlicher Killerzellen begünstigen, die entscheidend für die Abwehr von Krebs sind (Weil 1995: 246). »Russisches Penicillin« werden Knoblauch und Bärlauch scherzhaft genannt.
- ⬥ Frischer Bärlauch ist ein Entwurmungsmittel (Anthelminthikum), er vertreibt – bei Mensch und Bär – die Darmwürmer. Noch immer wird in den Alpenregionen das Kraut in Milch gesotten (oder geschnitten und mit warmer Milch übergossen) und verzehrt, um Maden- und Spulwürmer herauszubefördern. Auch in diesem Sinn ist es eine Pflanze Donars, denn – so der alte Glaube – dieser Gewittergott zermalmt die wurmgestaltigen Krankheitsdämonen mit seinem Blitzhammer. In der Volksmedizin wird der Saft äußerlich zur Wundbehandlung, bei Hautleiden und Pilzerkrankungen verwendet. Der Schweizer Kräuterpfarrer Johannes Künzle bestätigt das in seiner typisch bäuerlich-rustikalen Sprache: »Leute, die voll Ausschläge und Flechten waren, skrofulös am ganzen Leib, bleich aussahen, wie wenn sie schon im Grabe gelegen und von Hennen wieder hervorgescharrt worden wären, vollständig gesund und frisch wurden nach längerem Gebrauch dieser herrlichen Gottesgabe.«
»Ewig kränkelnde Leute, Leute mit Flechten und Aissen6 und Ausschläge, die Skrofulösen und Bleichsüchtigen, Mehlgesichter und Rheumatische sollten den Bärlauch verehren wie Gold. In den Kostgebereien und Instituten sollt diese Pflanze viel mehr verwendet werden. Die jungen Leute würden dabei trüehen7 wie ein Rosenspalier und aufgehen wie Tannenzapfen an der Sonne.« (Künzle 1982: 357; Künzle 1977: 30)
Zusammenfassend möchte ich einen englischen Spruch zitieren: »Iss Lauch im März, wilden Bärlauch im Mai, dann haben die Ärzte das ganze Jahr frei.« (Eat leeks in Lide [March], and ramsins in May, and all the year after physicians may play.)
Grüne Neune

Sobald der junge Giersch aus der Erde sprießt, ist es Zeit für eine vitaminreiche Kräutersuppe aus neun oder auch mehr Kräutern.
Bei den neun Kräutern, die die Frauen im Frühling fleißig sammel(te)n, handelt es sich um eine magische Zahl. Drei steht für Vollkommenheit: »Aller guten Dinge sind drei«, sagt das Sprichwort. Dreimal muss ein Zauberspruch aufgesagt werden, um zu wirken. Drei Welten (Unterwelt, Erde und Himmel) kennt das universelle schamanische Weltbild. Und selbst das eine Göttliche hat drei Aspekte: als Vater, Sohn und Heiliger Geist (indisch: Brahma, Wischnu, Shiva) oder als dreifache Göttin: die weiße Frühlingsgöttin, die rote Sommergöttin und die schwarze Wintergöttin. Die ultimative Steigerung der Drei ist die Neun – drei mal drei. Mit den neun Kräutern sind also alle essbaren Frühlingskräuter gemeint.
Ist der Schnee einmal fort, dann strecken sich in kürzester Zeit die ersten zarten Triebe der Kräuter und Gräser der Sonne entgegen. Frisches Grün voller Lebensenergie ist das, an der wir teilhaben können. Auf den noch matten, mageren Weiden treibt dann zuerst das Scharbockskraut seine fettig aussehenden, runden Blätter hervor. Scharbockskraut nannte man dieses Hahnenfußgewächs, da es den gefürchteten »Scharbock«, den Skorbut, vertreiben kann. Dieser böse Wintergeist verursacht chronische Müdigkeit, Muskelschmerzen, entzündetes Zahnfleisch, Darmbluten, schlaffe Haut – alles Symptome, die sich, wie wir heute wissen, auf Licht-, also Vitamin-D-Mangel, und ein Vitamin-C-Defizit zurückführen lassen. Heute können wir zwar Zitrusfrüchte im Supermarkt kaufen, aber dennoch verlaufen die Symptome subklinisch – wir werden also im Normalfall nicht erkennbar und nicht schwer krank, fühlen uns aber nicht fit: Ohne Sonnenlicht und frische Luft sind wir blass und antriebslos.
Zur selben Zeit wagen sich dann die hellgrünen, noch zusammengefalteten, glasigen Blätter des Gierschs aus dem Boden. Giersch, auch Geißfuß genannt, regt die Drüsen an und löst die in den Gelenken abgelagerten Harnsäuresalze auf, die Gicht verursachen. Bald treiben auch die zarten, tiefgrünen, nach edlem Knoblauch schmeckenden Blätter des Bärlauchs aus dem noch kargen Waldboden hervor. Auch die harntreibenden ersten Blätter des Löwenzahns bieten sich an. Sie bringen Leber und Galle in Gang. Die nach frischem Mais schmeckende Vogelmiere – eine regelrechte Vitaminbombe – ist ebenfalls im Vorfrühling schon vorhanden. Die säuerlichen Spitzen des Sauerampfers, verschiedene pfeffrig schmeckende Kressen und andere Kräuter vervollständigen den vitalisierenden Wildkräutersalat, der in dieser Zeit täglich auf den Esstisch kommt. Man kann diesen Salat mit aromatischen Gundermann-Blättern, dessen purpur-lila Blüten und auch mit den fröhlichen Gänseblümchen-Blüten schmücken. Diese Blümchen, die einst der germanischen Frühlingsgöttin Ostara oder der keltischen Brigit geweiht waren, blühen nämlich, sobald der Schnee das Feld geräumt hat. Die Gänseblümchen (Maßliebchen), die ihre Blütenköpfchen der täglich höher steigenden Sonne zuwenden, haben ebenfalls Heilkräfte. Dank ihrer Saponine helfen sie der Verdauung und reinigen die Haut. Etwas später im Frühling kommen dann die zartrosa Blüten des Wiesenschaumkrauts, die weißen der Brunnenkresse und die sonnengelben des Löwenzahns als Dekoration hinzu.

Gänseblümchen eignen sich ebenso als Suppenzutat, sie schmecken aber auch gut als Belag auf dem Butterbrot oder im Salat.
Aus den ersten, leicht purpurn angehauchten Trieben der Brennnesseln lässt sich eine vitamin- und mineralstoffreiche Suppe oder Tee kochen. Beide sind entschlackend und harntreibend und ein ausgezeichnetes Mittel bei »Blutarmut« (Anämie).8
Man kann diese Kraftkräuter, die die Lebensgeister anregen und das Immunsystem stärken, überall finden – im eigenen Garten, unter Hecken, auf brachliegenden Feldern, Weiden, am Wegrand und sogar in Hinterhöfen und an stillgelegten Bahngleisen in der Stadt. Diese Pflanzen zu suchen und zu sammeln tut uns gut; der steinzeitliche Jäger und die Sammlerin, die noch in unserer Seele leben, werden in uns wach. Dabei bewegen wir uns in frischer Luft und Sonnenschein und werden auch noch mit leckerem Essen belohnt. All das stärkt unsere Abwehrkräfte, unsere unspezifische Immunität – und das ist, nach Ansicht der Naturheilkundler, viel besser als irgendwelche fragwürdigen chemischen Cocktails. Diese Pflanzen sind ja unsere Verbündeten; wir haben eine Ko-Evolution mit ihnen seit vielen Millionen Jahren.
_______
GRÜNE-NEUNE-SUPPE
_______
Nach dem Rezept der Bärlauchsuppe (siehe >) kann man auch eine kräftigende Suppe mit den typischen Grüne-Neune-Kräutern kochen. Dafür nimmt man eine bunte Mischung der genannten Kräuter. Vorsicht aber mit Gundermann: Er schmeckt sehr intensiv, deshalb nur wenige Blättchen als Würze verwenden. Für eine vegane Suppe nimmt man Öl statt Butter und pflanzliche Sahne.

Eine grüne Suppe aus frischen Kräutern steht bei uns im Frühjahr täglich auf dem Tisch, oft auch eine reine Bärlauchsuppe.
IN DER KÜCHE
Heute kennt fast jeder den Bärlauch, denn er ist seit den 1980er-Jahren zu einem sogenannten Trend-Lebensmittel für gesundheitsbewusste Yuppies (young urban professionals) und die schicke Bionade-Bourgeoisie geworden. In der Toskana entdeckte diese ökologisch engagierte Elite die Rauke (Eruca sativa) – heutzutage besser bekannt mit ihrem up-to-date-Namen Rucola – als leckeres Gewürz der toskanischen Pizza und der insalata verde (grüner Salat). Andere Stars der bahnbrechenden Trendfoods sind der Witloof-Chicorée, lilafarbene Karotten, Celtuce (chinesischer Spargelsalat), Blutampfer, Süßkartoffeln, Pak-Choi, Topinambur, Grünkohl, Avocados, Kapuzinerkresse und ebenso der Bund frischen Bärlauchs, der nun jeden Frühling an den Bioständen auf den Wochenmärkten oder im Gourmetregal in den Supermärkten angeboten wird. Aus dem frischen Lauchgewächs werden Suppen, Pestos, Bärlauch-Frischkäse und Bärlauch-Tofu gemacht, oder man isst es einfach auf Butterbrot.
Meine Frau und ich sind zwar keine Yuppies, aber in unserem Haus ist eine Bärlauchsuppe mit Weißwein und »Rösteln« (Croutons) alljährliches Frühlingsgericht, eine Kultspeise sozusagen, mit der sich der Lenz angemessen begrüßen lässt. Dazu gibt es einen Wildkräutersalat mit Giersch, Brunnenkresse, Scharbockskrautblättern, Löwenzahngrün und selbstverständlich Bärlauchblättern.
Wie wir auf > sehen konnten, galt für die indigenen heidnischen Waldvölker Nord- und Westeuropas der Ramser als einer der kraftspendenden und verehrten Lauche (siehe >, Knoblauchsrauke). Auch im frühen Mittelalter nahm man die Frühlingspflanze gerne mit als Speiseergänzung. Kaiser Karl der Große befahl in seiner Landgüterverordnung (Capitulare de villis) im 8. Jahrhundert den Anbau dieser Herba salutaris (Gesundheitskraut) auf all seinen Ländereien.
Bärlauchblätter eignen sich nicht nur wunderbar für eine Frühlingssuppe, sondern auch als Salatzutat, im Omelett und im Kartoffelsalat. In China und Japan legt man die Blütenknospen gerne in Öl und Essig ein. Und von der Freiburger Kräuterfrau Ursel Bühring lernte ich, dass man aus den unreifen grünen, in Essig eingelegten Samen einen »grünen Kaviar« machen kann; man kann sie auch zum Würzen von Fisch- oder Fleischgerichten, ähnlich dem grünen Pfeffer, verwenden.
Die länglichen, schmalen Zwiebeln können später im Jahr ausgegraben werden, sie lassen sich frisch oder auch getrocknet verwenden. Die Blätter kann man ebenfalls trocknen – sie verlieren zwar ihren Duft, sind aber dennoch ein gutes Gewürz.
_______
BÄRLAUCHSUPPE
_______
ZUTATEN
1-2 große Bunde Bärlauch, 50 g Butter,
1-2 EL Mehl, 1 l Gemüsebrühe oder halb Brühe, halb Weißwein, 100-200 ml Sahne, Salz, Pfeffer
- ⬥ Bärlauch waschen und fein schneiden. Butter in einem Topf zerlassen, Mehl einrühren und anschwitzen.
- ⬥ Unter Rühren mit Brühe und Sahne aufgießen, aufkochen lassen. Bärlauch einrühren, einige Minuten ziehen lassen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit gerösteten Brotwürfeln servieren.
FOETOR EX ORE, DIE UNERTRÄGLICHE KNOBLAUCHFAHNE
Es ist noch nicht so lange her, da war der Bärlauch praktisch in Vergessenheit geraten – sogar im ländlichen Raum. Johann Künzle erzählt, dass die Leute in Wangs, einem Dorf im Sarganserland, entsetzt waren, als sie sahen, dass ihr Seelenhirt Bärlauchblätter sammelte. Sie riefen ihm zu: »Aber Herr Pfarrer, diese Blätter sind giftig, schwer giftig!« Um ihnen zu zeigen, dass sie nicht giftig sind, aß er vor ihren Augen einige davon.
»Um Himmels willen, sie müssen sterben, das ist schwer Gift!«, riefen ihm die Leute voller Angst zu. Als sie am folgenden Tag sahen, dass er vollkommen frisch und gesund war, staunten sie. Schließlich wurden sie mutiger: »Tut’s dem Pfarrer wohl, wird’s auch uns wohltun«, folgerten sie und begannen es von da an auch in ihre Suppen zu tun (Künzle 1982: 357).
Wie konnte man den Bärlauch, einst eine der heiligsten, hochverehrten Pflanzen der indigenen nordeuropäischen Völker, vergessen? Lag es an dem Geruch, der »Knoblauchfahne«, die nach dem Verzehr entsteht und im Laufe der Zeit für die kultivierten, zunehmend verstädterten Menschen unannehmbar wurde?
Die Ausscheidung des Allicins, des schwefelhaltigen ätherischen Öls, erfolgt nicht nur über Darm und Niere, sondern auch durch die Haut und bis zu zehn Prozent auch über die Lunge. Für Nord- und Mitteleuropäer, insbesondere für Engländer, ist der Geruch inzwischen nicht nur ungewohnt, sondern höchst unangenehm. »Knoblauchessen sollte bestraft werden wie ein schweres Verbrechen«, witzelte ein britischer Gentleman im 17. Jahrhundert. Oder: »Garlic macht einen Atem, der auf zwanzig Schritte einen Ochsen umbringen kann!«
In Ohio, wo ich aufwuchs, kannte man damals den Knoblauchduft nicht einmal. Als ich dann an der Uni studierte, lernte ich einen Studiengenossen aus Jugoslawien kennen, der mir sehr sympathisch war. Leider hatte er immer einen fürchterlichen Mundgeruch. Ich hätte mich gerne näher mit ihm befreundet, fing aber an, ihn zu meiden, denn aus seinen Ausdünstungen folgerte ich, dass er womöglich krank war und ich in Gefahr, angesteckt zu werden.
Schon in der Antike galt der Knoblauchatem in der besseren Gesellschaft Roms als vulgär und unakzeptabel. Der als stoischer Philosoph bekannte Kaiser Marc Aurel (121–180 n. u. Z.) verlor seine Gelassenheit angesichts des schrecklichen Lauchgestanks der keltisch-germanischen Markomannen und Quaden, mit deren Stammesfürsten er Verhandlungen führte. Der Geruch rührte wahrscheinlich vom Bärlauch her, der für diese Barbaren als kraftgebend galt.9
Die Phobie vor dem Knoblauchgestank erreichte in England im 16./17. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Für den Dramatiker William Shakespeare war Knoblauch etwas für unkultivierte Menschen; er mahnt seine lieben Schauspieler – im Midsummer night‘s dream (1596) – »weder Zwiebel noch Knoblauch zu essen, denn wir sollten einen völlig süßen Atem haben«. Der berühmte Gärtner und Meister des Salats John Evelyn (1612–1706) schreibt: »Knoblauch ist wegen seines unerträglichen Gestanks im Salat absolut verboten. Auch ist er sicherlich weder für den weiblichen Gaumen gedacht noch für die Gentlemen, die ihnen den Hof machen.« (Acetaria, 1699).
Ein Gutes hatte wohl die Knoblauchfahne: Man war sich sicher, sie vertreibe Hexen und Vampire. Hier und da war es Brauch, vor der Walpurgisnacht deswegen eine Bärlauch- oder Knoblauchsuppe zu essen. Auch unerwünschte Gäste wird man schneller los, wenn man vorher diesen Lauch isst.
Ein jüdischer Witz sagt: »A Nickel will get you on the subway, but garlic will get you a seat.« (»Mit einem Nickel [5-Cent-Münze] kommt man in die U-Bahn, mit einer Knoblauchfahne bekommt man einen Sitzplatz.«) Oder, zeitgemäßer, in Bezug auf Corona: Knoblauch hilft vielleicht nicht gegen das Virus, aber es hilft, den vorgeschriebenen Abstand von anderthalb Metern einzuhalten.
Und was kann man gegen die Allicin-Ausdünstung machen? Etwa, wenn man kurz vor einem Date oder einem Vorstellungsgespräch eine Bärlauchsuppe oder Knoblauchspaghetti gegessen hat? Eigentlich nichts. Es gibt zwar viele Hausmittel – etwa, Petersilie, Kaffeebohnen oder Kardamom kauen –, aber die meisten gut gemeinten Ratschläge erweisen sich als nutzlos.
Vor einem wichtigen Termin also zur Sicherheit auf ausführlichen Knoblauchgenuss verzichten.

Nicht nur im schattigen Wald, auch auf besonnten Lichtungen findet sich der Bärlauch – wie hier in einer feuchten Senke, gemeinsam mit der Weißen Pestwurz.
BÄRLAUCH SAMMELN
Wenn der Ramser blüht, ist die Sammelzeit vorbei. Dann kann man höchstens noch die Zwiebeln ausgraben. Man sollte beim Ernten jedoch behutsam und schonend mit der Pflanze umgehen: Sie sammelt ihre Lebenskraft mit den wenigen Blättern, die sie hat, und ohne sie kann sie keine neuen Zwiebeln bilden. Auch sollte man in der Bärlauchkolonie so wenig wie möglich herumtrampeln. Am besten gräbt man einige Zwiebeln aus und pflanzt sie im eigenen Garten ein – am besten an einer eher schattigen Stelle, auf einem humusreichen, feuchten Boden unter der Hecke. Der Bärlauch wird dankbar sein und sich schnell ausbreiten.
Es wird immer davor gewarnt, die Bärlauchblätter mit den tödlich giftigen der Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) oder der Maiglöckchen (Convallaria majalis) zu verwechseln. Johann Künzle, für den der »Rämschele« ein treuer pflanzlicher Verbündeter war, schrieb einmal: »Kinder und ungeschickte Leute schicke man niemals aus, um Rämschelen sammeln, da sie leicht die giftige und todbringende Zeitlose heimbringen könnten. Der Geschmack der Rämschelen ist für unkundige Leute das sicherste Kennzeichen, da diese Pflanze gewaltig knobläuchelet, was bei der Zeitlose nicht der Fall ist.«
Es soll sogar vorgekommen sein, dass die Ramserblätter mit denen des Aronstabes verwechselt wurden. Wer in oder mit der Natur aufgewachsen ist, wird das kaum verstehen. Ich hielt das auch für unmöglich; beim genauen Hinsehen ist ja der Unterschied offensichtlich, und der Geruch sowieso. In einem meiner Kräuterkurse schickte ich die Teilnehmer aus, Bärlauch für unsere Suppe und Salat zu sammeln. Ein Teilnehmer, ehemaliger Bürgermeister einer mittelgroßen schwäbischen Stadt, kam ganz stolz mit einem Korb voller Sammelgut zurück, bei dem die Hälfte aus Herbstzeitlosenblättern bestand. Der arme, nervöse Mann schien ein Burn-out hinter sich gehabt zu haben, vielleicht wurde er seines Amtes enthoben. Auf jeden Fall wollte er in der Natur Heilung finden. Nebenbei bemerkt fand er sie auch in der Gestalt einer lieben Kräuterfrau, die sich seiner annahm.
Es ist eigentlich tragisch, dass es heutzutage Menschen gibt, die so weit von der Natur entfernt und dermaßen in der virtuellen elektronischen Welt eingesponnen sind, dass sie kaum die Pflanzen vor ihrer Haustür kennen. Mutter Natur fordert von uns, dass wir ihnen mit allen unseren Sinnen und mit Geistesgegenwart begegnen.

Haselwurz
(Asarum europaeum)
EINE »REIZENDE« PFLANZE
Die Haselwurz ist ein kleines, wintergrünes, ausdauerndes, im Schatten feuchter Mischwälder auf kalkhaltigen Böden wachsendes Kräutlein aus der Familie der Osterluzeigewächse (Aristolochiaceae). Die ledrigen, nierenförmigen Blätter glänzen auf der Oberfläche dunkelgrün, auf der Unterseite sind sie manchmal rötlich gefärbt und meistens haarig oder filzig. Ende März bis Anfang Mai erscheinen, unter den Blättern verborgen, einzeln stehende, erdfarbene, innen braunrote, daumennagelgroße, glockenförmige Blüten mit drei Zipfeln. Mit ihrem Duft ziehen sie Pilzmücken an, die sie bestäuben. Oft bestäuben sie sich aber auch selbst. Auf der Oberfläche der Samen befinden sich eiweißreiche, fleischig-schwammige Gewebeanhängsel (Elaiosome), die bei den Ameisen als Futter begehrt sind. Indem die emsigen kleinen Kerbtierchen die Samen verschleppen und dabei hier und da fallen lassen, erweitert die Pflanze ihr Areal.
Es ist vor allem aber der im Boden kriechende Wurzelstock, der die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zog. Dieser riecht stark kampferartig oder – über die Beschreibung der Düfte lässt sich ja streiten – wie Ingwer oder auch wie Weihrauch, würzig-pfeffrig.
Ganz nah verwandt oder fast identisch mit der Europäischen Haselwurz ist die Kanadische Haselwurz (Asarum canadense). Die Pflanze gehört mit zur Flora der nordamerikanischen Laubwälder. Ich kann mich gut an diesen »wilden Ingwer« (wild ginger) erinnern. Bei unseren Streifzügen im Wald schnupperten wir Lausbuben gern an der Wurzel und fanden den Geruch – er erinnert tatsächlich an frischen Ingwer – einfach wunderbar. Aber dennoch wussten wir, dass es keine gute Idee war, die Suppe in unserem Aluminium-Kochgeschirr damit zu würzen.
Für den verlockenden Geruch ist ein ätherisches Öl verantwortlich. Es besteht aus unterschiedlichen Mischungen von Asaron, das auch im Kalmus vorkommt, mit Eugenol, wie man es in der Gewürznelke oder in der Nelkenwurz-Wurzel findet, Bornylacetat, enthalten in Fichten- oder Tannennadelöl, und Safrol aus Safran, dem teuersten Gewürz der Welt, das aber auch im Kampferbaum, in Sternanis, schwarzem Pfeffer und Muskatnüssen zu finden ist.
Haselwurzarten wachsen zirkumpolar. Es ist eine Gattung mit ungefähr 60 Arten.
NAMEN UND BRAUCHTUM
Der Name Haselwurz, niederdeutsch Haselwurt (englisch haselwort), ist alt; schon die heidnischen Angelsachsen kannten das Kräutlein unter dem Namen haeselwyrt. Die Benennung rührt wahrscheinlich davon her, dass das kleine Osterluzeigewächs gerne unter Haselsträuchern wächst. Im Russischen heißt die Pflanze »unter dem Haselstrauch« (podoresnik); auch in Litauen wird sie so genannt (palazdé). Manche Sprachwissenschaftler vermuten dagegen, dass das Kräutlein so heißt, weil die Blütenhülle dem Fruchtbecher der Haselnuss ähnlich sieht. In einigen Mundarten wurde die Hasel auf »Hase« umgedeutet. Sie wurde zur Hasenwurz. Auch für den Universalgelehrten Albertus Magnus (1200–1280) war sie eine Hasenwurz (herba leptoris), »da die Hasen sie gerne fressen«, was jedoch nicht stimmt. Nieren- oder Leberkraut wurde die Pflanze hier und da genannt, weil sie, wie Tabernaemontanus schreibt, »alle Verstopfungen der Leber, Nieren, Blasen und Beermutter [Gebärmutter] öffnet«.
Weihrauchkraut heißt das Waldkräutlein wiederum in anderen Regionen; in einigen slawischen Sprachen ist es der »Erdweihrauch« oder »heimischer Weihrauch«. Und so wird er auch verwendet: Mit dem Duft der Wurzel oder, noch besser, mit der getrockneten, gepulverten Wurzel als Räuchermittel lässt sich Hexenspuk vertreiben; auch bei Krankheiten im Haus und im Stall wurde damit geräuchert.
Pfefferkraut ist ein Name, der sich auf den pfeffrigen Geschmack bezieht.
Neidkraut nannte man die Pflanze in Teilen Bayerns und Oberösterreichs, denn ein Wurzelstückchen, dem Vieh ins Futter gegeben, soll den Neid eines missgünstigen Nachbarn abwehren, der womöglich die Kühe »verneidet«. Überhaupt spielt die Haselwurz vielerorts eine Rolle im Milchzauber. In kleinen Mengen unter das Futter gemischt, würden – so glaubte man – die Kühe mehr und sahnigere Milch geben. Milchgefäße sollten mit einer Abkochung der aromatischen Wurzel ausgewaschen werden, damit die Milch durch keinen faulen Zauber verdorben werden kann. Vielerorts fand die Haselwurz Verwendung in der bäuerlichen Tierheilkunde. Als Drüsenkraut wurde die Wurzel im Stall aufgehängt, um die Pferde vor der Druse – einer bakteriellen Lungeninfektion – zu schützen.
Brechhaselkraut oder Brechwurz weisen darauf hin, dass die Wurzel einst genutzt wurde, um das Erbrechen anzuregen, um sozusagen die »schlechten Säfte« zu purgieren. Es gibt aber, wie der bekannte Apotheker Mannfried Pahlow schreibt, viel ungefährlichere Mittel, um den Magen zu leeren, zum Beispiel eine Kochsalzlösung (1–2 Esslöffel auf ein Glas warmes Wasser) (Pahlow 1993: 152).
Von dem Volkskundler und Ethnobotaniker Rochus Schertler erfahren wir vom alten Glauben der Vorarlberger, wenn jemand heimlich die Haselwurz in die Stubentürschwelle einbohrte, hätte es Kinderlosigkeit zur Folge: »Sie hot a Haslworz-n im Sack, dass sie ke Kind öbr-kund« (sie hat eine Haselwurz in der Tasche, sodass sie nicht schwanger wird) ist eine sprichwörtliche Redensart im Vorarlberger Ländle. Für eine Bauernfamilie wäre das natürlich tragisch, denn auf einem Hof wird jede Hand und ein Hoferbe gebraucht. Wenn sich eine solche Wurzel im Stall befindet, wird die Kuh angeblich zwar läufig, aber nicht trächtig (Schertler 2005: 322). Ein Gutes habe die Haselwurz jedoch: Wer sie bei sich trage, den plagen die Filzläuse nicht.
Die lateinische Bezeichnung Asarum geht wahrscheinlich auf das griechische àse zurück, was Ekel bedeutet, oder auf saron für »unsauber«. Aber da sind sich die Sprachforscher nicht ganz sicher.

Die Haselwurz fehlt in kaum einem der alten Kräuterbücher, was für ihren regen Gebrauch in früherer Zeit spricht. Aus dem Mainzer Kräuterbuch von 1484.
OSTERLUZEIGEWÄCHSE UND DIE GÖTTIN ARTEMIS
Die ganze Familie der Osterluzeigewächse hat einen Bezug zu den Fortpflanzungsorganen. Das deutet schon der lateinische Name der Familie an. Aristolochiaceae kommt von dem griechischen aristos, »sehr gut, das Beste«, und lóchus, »Kinderbett«, oder locheíos, »gebären«. Die Pflanzen, die eine gute Geburt sichern, gehörten zum Kult der Geburtsgöttin, der Artemis-Lochia. Die Göttin Artemis galt in der Antike als die erste Hebamme, denn als die Urmutter Leto ihre Zwillinge, die Mondgöttin Artemis und den Sonnengott Apollo gebar, wurde Artemis als Erste geboren und half sogleich als Hebamme, ihren Bruder auf die Welt zu bringen. Zu Artemis beteten die Frauen deshalb um eine leichte Geburt. Die Legende unterstreicht den alten indoeuropäischen Glauben, dass das Licht aus der Finsternis geboren wird, so ähnlich wie das Kind nach neun Monaten im dunklen Mutterschoß das Licht der Welt erblickt.

Aus einem Kräuterbuch nach Mattioli 1586.
Artemis ist eine wilde Göttin, sie ist die Herrin der Tiere, sie lebt in der Waldwildnis und meidet alles, was mit menschlicher Zivilisation zu tun hat. Allein, wenn sich eine arme Bäuerin, Köhlerin oder Hirtin in Geburtsnöten befindet, kann sie erscheinen und der Kreißenden helfen. Reichen Städterinnen dagegen kommt sie selten zu Hilfe.
Verwandt mit der Haselwurz ist die Gewöhnliche Osterluzei (Aristolochia clematitis), die in England birthwort (»Geburtswurz«) heißt, und deren lateinischer Gattungsname Aristolochia ebenfalls auf gutes Gebären hinweist. Die dumpf würzig riechende Pflanze wächst in Europa, auch Mitteleuropa, an wärmeren Standorten, etwa an den Rändern von Weinbergen oder trockenen Ackerrändern. Schon Dioskurides erwähnt, dass dieses Kraut der Göttin Artemis die Geburt erleichtert und beschleunigt. Es kann die Wehen einleiten, wirkt aber auch abtreibend und kann wie die Haselwurz die Nieren schädigen. Auf die Anwendung der Haselwurz sollte man deshalb heutzutage verzichten!

Die dreizipfeligen Blüten der Haselwurz locken mit ihrem Duft Pilzmücken als Bestäuber an. Die Samen werden von Ameisen verbreitet.
HEILPFLANZE
Die Haselwurz spielte als Heilpflanze in früheren Zeiten, insbesondere in der »Säftelehre« (Humoralpathologie), keine unbedeutende Rolle. Galen, der tonangebende Arzt des Altertums, erklärte: Asarum, heiß und trocken bis zum dritten Grade, »treibt Harn und hilft gegen Milzverhärtung«. Für Dioskurides galt die Wurzel als erwärmend, harntreibend und brechreizfördernd. Diesen Vorbildern folgend, benutzten die mittelalterlichen Ärzte die Pflanze bei Verstopfungen und Verhärtungen von Milz und Leber, bei Gelbsucht und chronischem Fieber und zur Förderung der Menstruation, als Purgiermittel zur Austreibung von starkem, dickem Schleim, gelber und schwarzer Galle (Müller 1993: 147). Es ist auch ein Abtreibungsmittel, es »purgiert« auch die unerwünschte Leibesfrucht – eine Anwendung, die sich als hochgefährlich erwies und von der unbedingt abzuraten ist.
Schon Hildegard von Bingen konnte sich mit der Haselwurz nicht richtig anfreunden.
Die Haselwurz habe eine gefährliche Kraft in sich, schreibt die große Kräuterfrau in ihrer »Physica«, »sie ist sehr scharf und sonst unsteter Natur und gleicht dem Sturm, weil ihre Wärme und Gefährlichkeit auf Gefährdung hinauslaufen. Daher zerstört sie eher die Natur des Menschen, als dass sie ihm zur Gesundheit verhilft … Würde eine schwangere Frau sie essen, würde sie entweder sterben oder unter Gefährdung ihres Leibes das Kind verlieren.« (Riethe 2007: 389)
Die Pflanzenastrologie der Renaissance stellt die Haselwurz unter die Herrschaft der »lebensfeindlichen« Planeten Mars und Saturn. Wegen ihrer feurigen Schärfe stellt Nicholas Culpeper die Asarabacca – so nennt er die Haselwurz – unter die Regie des roten, aggressiven Planetengottes. Sie purgiere nach oben wie nach unten, erzeuge also Erbrechen wie auch Harnfluss, Durchfall und starke Regelblutung. Ein guter Arzt solle die Pflanze selten anwenden, denn als Diener der Natur solle er die Kranken stärken und so wenig wie möglich durch drastisches Purgieren schwächen.
In der christlichen Pflanzensymbolik wird die Haselwurz der Maria Magdalena geweiht. Diese Frau nahm in der Kirchentradition die Rolle der »Sünderin«, der »Prostituierten« und der Büßerin ein. Zu ihrer zweifelhaften Vergangenheit gehörte in der Vorstellung der einfachen Leute auch, dass sie abgetrieben hatte – deswegen die Verbindung zu diesem emmenagogischen Kraut.
Überhaupt hat die Haselwurz nicht nur eine reizende Wirkung auf die Schleimhäute, den Verdauungstrakt und die Unterleibsorgane; in größeren Mengen aufgenommen verursacht sie Nierenentzündung und Uterusblutung.
Vor der Einführung der südamerikanischen Brechwurzel (Ipecacuanha carapichea) war die Haselwurz das wichtigste Brechmittel (Emetikum), das in den Apotheken erhältlich war. Lange benutzte man den Wurzelstock bei Katarrhen der oberen Atemwege, um den zähflüssigen Schleim zu lösen. Haselwurzpulver kam auch mit in den Schnupftabak, um das Niesen zu fördern. Das Niespulver, hergestellt aus den im August gesammelten, getrockneten Wurzeln, sollte »das Hirn von zu viel Feuchtigkeit säubern«. Auch um Alkoholiker der Trunksucht zu entwöhnen, verwendete man das Pulver, indem man es mit ins Getränk mischte, was zu Übelkeit und Erbrechen führte.
In der Tiermedizin verwendete man das kleine Osterluzeigewächs noch lange. Schäfer gaben ihren Schafen die gepulverte Wurzel mit Salz zum Lecken, wenn diese keuchten oder husteten. Während Rinderseuchen fütterte man die Kühe damit. Auch Pferden gaben die Bauern die Blätter, »um sie zu reinigen und mutiger zu machen«.
In der russischen Volksmedizin wurde die Asarum-Tinktur oder die gepulverte Wurzel gegen die Folgeschäden des Viertagefiebers (Malaria), bei Kehlkopfentzündung, Skrofeln, Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, bei Verhärtung von Milz und Leber und anderen Leiden angewendet – oft mit zweifelhaften Resultaten. Frauen wuschen sich den Kopf mit einer Abkochung der ganzen Pflanze, um den Haarwuchs zu fördern. In Kleinrussland behandelte man Kopfschmerzen mit Umschlägen aus der gekochten Wurzel. Auch als Wurmmittel wurde die »unter der Haselstaude wachsende« Pflanze eingesetzt (Kobert 1889: 183f).
Die Indianer verwendeten den kriechenden, aromatischen Wurzelstock der Kanadischen Haselwurz gegen Erkältung, bei nervösen gastrointestinalen Beschwerden, Kopfschmerzen, bei Krankheiten der Harnorgane, bei Typhus, Tuberkulose, als Periodemittel oder zur Abtreibung – alles Anwendungen, die nicht zuverlässig und nicht ungefährlich sind. Bei Husten ihrer Pferde kam das Mittel ebenfalls zum Einsatz (Moerman 1999: 105).
In der traditionellen chinesischen Pharmakopöe und im indischen Ayurveda werden Präparate der Asarum-Wurzel bei Beschwerden der ableitenden Harnorgane und der Niere, bei Schlangenbissen und Gicht eingesetzt.
Inzwischen gelten diese Verwendungen als höchst problematisch. Apotheker Pahlow warnt zu Recht vor jeglichem Gebrauch der Pflanze, »weil die Reizwirkungen zu Schäden in Darm, Galle, Niere und Leber führen«. Man hat die Inhaltsstoffe gut analysiert und bestimmte Aristolochia-Säuren gefunden, die nicht nur Nieren und Harnorgane angreifen, sondern auch krebserregend wirken.
Trotz ihrer Tücke ist die kleine Waldpflanze schön anzusehen und der Duft ihrer Wurzeln ist ein olfaktorisches Genusserlebnis.

Woher der Name Haselwurz kommt, ist umstritten. Manche vermuten, es liege an der Ähnlichkeit der Blüte mit dem Fruchtbecher der Haselnuss.
Kleines Immergrün
(Vinca minor)
DIE VERZAUBERTE BURGJUNGFRAU
Im Schatten von Burgmauern und alten Ruinen,
dort, wo Nebel wie Geisterzüge ziehen,
da wächst rankend das Immergrün
und lässt uns Geheimnisvolles ahnen.
WOLF-DIETER STORL
Im Schatten verlassener Burgruinen, auf alten Friedhöfen und ehemaligen Kultstätten begegnet einem oft eine kriechende Pflanze mit lanzettlichen, glänzenden, ledrigen, dunkelgrünen Blättern. Diese behalten im Spätherbst und im Winter ihr Grün, daher der Name Immergrün oder Singrün, wobei das Sin im Namen aus dem Mittelhochdeutschen kommt und »immerwährend« bedeutet.10 Die kleine Pflanze hat, wie auch ihr typischer Standort, etwas Unheimliches und eher Düster-Melancholisches an sich – eine Stimmung, wie man sie etwa in dem Gemälde »Toteninsel« von Arnold Böcklin findet. Und das trotz seiner schönen, himmelblauen bis blauvioletten Blüten. Die Blütenform ist besonders reizvoll durch ihre leichte Asymmetrie. An jedem der fünf Zipfel, die sich über der langen, engen Blütenröhre ausbreiten, ist der rechte Rand länger als der linke, sodass die Blume an einen Propeller oder ein Windrädchen erinnert. Die Zeit der Blüte ist April bis Mai.
Immergrün ist eine Gattung der illustren Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae). Zu der Familie gehört auch die Indische Schlangenwurzel (Rauwolfia), deren Wurzel sympathikolytisch und blutdrucksenkend wirkt. Mahatma Gandhi, der Indien friedlich in die Unabhängigkeit führte, trank jeden Tag ein Tässchen des Rauwolfia-Tees, um seine Seele zu beruhigen. Strophanthus, eine Liane aus dem tropischen Afrika, deren Saft die Pygmäen als Pfeilgift bei der Elefantenjagd verwendeten und das sich – in der geeigneten Dosierung – als hervorragendes Herzmittel erwiesen hat, ist ebenfalls ein Hundsgiftgewächs. Das giftige Madagaskar-Immergrün (Catharanthus roseus), dessen Alkaloide zur Krebsbehandlung eingesetzt werden, der prächtig rosablühende Rosenlorbeer (Oleander), der seinerseits giftige Herzglykoside enthält, sowie 4500 weitere, meist tropische und meist giftige Pflanzen gehören mit zu dieser Familie.

Das Kleine Immergrün verbreitet sich an Standorten, an denen es sich wohlfühlt, im Lauf der Zeit zu einem grünen, blau oder weiß blühenden Teppich.
NAMEN UND BRAUCHTUM
Das kriechende Kräutlein, das wahrscheinlich mit den Römern nach Mitteleuropa kam, hat viele Namen. Neben Immergrün oder Singrün wird es in vielen Mundarten Wintergrün genannt; wegen seiner niederliegenden Sprossen heißt es in Luxemburg Benzel (von Bindseil); in Sargans ist es das Blaumaie, im Thurgau das Himmelsternli. Immer wieder erscheint die Pflanze als Totenkraut, im Alemannischen als Toteblüemli. Todtenviolen – französisch violette des morts; italienisch viola dei morti – Totenglocke, Grüngrab und Grabimmergrün sind weitere Benennungen.

Der Name des Immergrüns bezeichnet dessen auffällige Eigenschaft, auch im Winter die grüne Blattfarbe zu behalten, wie dieses Novemberbild beweist.
Der Ethnobotaniker Heinrich Marzell berichtet, dass man in Nordmähren die Särge von Kindern oder jung Verstorbenen mit den dunkelgrünen Ranken umflochten hat. Man tauchte die Zweige in Weihwasser und besprengte damit den aufgebahrten Leichnam.
Einst war man der Meinung, dass ein Immergrünkranz das Antlitz des Toten vor Verwesung schützt. So erzählt der große Botaniker Hieronymus Bock, dass er im Jahre 1535 einen schon seit langem bestatteten Leichnam sah, der wieder ausgegraben worden war und samt seinem Singrün-Kranz noch ganz unversehrt war (Perger 1864: 23).

Im Frühling breiten sich die frischen Triebe kriechend in alle Richtungen aus und bilden bei Bodenkontakt neue Wurzeln.
In Zürich nahmen die Kinder häufig eine Immergrünblüte zwischen Daumen und Zeigefinger, drückten den Kelch, langsam hin- und herreibend, indem sie sagten: »Tod, Tod, komm heraus!« Wenn die Staubbeutel heraustraten, hörten sie auf. Sooft man den Spruch sagen musste, so viele Jahre hatte man noch zu leben (Marzell 1979 IV: 1146). Allerheiligenblume, eine weitere Benennung, bezieht sich auf das alte Totenfest im November. Im mittelalterlichen England trugen die zur Hinrichtung Verurteilten Kränze aus periwinkle, Immergrün.
Das Kräutlein, das mit seinem immergrünen Laub Sommer und Winter verbindet, ist zugleich auch ein Sinnbild der Treue, der Reinheit und Keuschheit. In der Blumensprache heißt es:
...
Im Guten treu wie Immergrün,
so wird gewiss die Liebe,
die uns verbindet, ewig blühn!
...
Mädchen und junge Bräute schmückten sich mit einem Kranz aus dem blühenden Kraut. In Flandern kennt man die Pflanze als Maeghdencruid und in Teilen Hollands als Maagdekruid (Mädchenkraut), anderswo ist es das Kranzkraut, die Jungfernkrone oder das Jungfernkraut.
Das Himmelblau der Blüten weist die Pflanze in der christlichen Symbolik als Marienblume aus. Das Blau ist die Farbe der Königin des gestirnten Firmaments (Zerling 2007: 124).
Der wissenschaftlich_lateinische Name Vinca geht auf das lateinische vincire, »winden, binden, fesseln, umwinden, bezaubern, bannen«, zurück. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere kennt in seiner »Naturgeschichte« (Naturalis historia) die Pflanze als vinca pervinca. Das lateinische Wort pervincire bedeutet »binden, flechten«. Aus ihr wurden schon in der Antike Grabkränze geflochten, auch Kränze zu zauberischen Zwecken, etwa um Liebe zu erwerben. In Frankreich nennt man die Blume gelegentlich violette des sorciers, »Veilchen der Zauberer«.
Zugleich benutzte man die Pflanze, um bösen Zauber zu vertreiben. Das im Frauendreißiger – das ist die Zeit zwischen Mariä Himmelfahrt (15. August) und Mariä Geburt (8. September) – gesammelte Kraut soll vor angezauberten Krankheiten schützen. Das älteste deutsche Kräuterbuch, der »Gart der Gesundheit« (Hortus Sanitatis, Mainz 1485), verkündet, dass der Teufel gegen dieses zwischen den Frauentagen gesammelte Kräutlein keine Macht hat. Auch Hexen kann es vertreiben. Wo es über der Stall- oder Haustür hängt, da kann keine Zauberei hineinkommen. Mit dem Kraut wehrt man den Menschen, in dem ein böser Geist sitzt, ab.

Das Immergrün im Gart der Gesundheit von 1485, dem ersten gedruckten Kräuterbuch in deutscher Sprache.
HEILPFLANZE
In der Volksmedizin benutzte man dieses immergrüne Waldkraut gegen Durchfall, Nasenbluten, »Bauchfluss« (Durchfall, Ruhr), Gebärmutterleiden und übermäßige Menstruation. Mit Salbei gemischt, wurde der Immergrüntee als Gurgelwasser bei Halsschmerzen, Mandelentzündung und Zahnschmerzen verwendet, man trank ihn zur Magen- und Darmreinigung. Der Tee schmeckt übrigens bitter und wird oft mit anderen Kräutern gemischt. Schon Dioskurides, der griechische Pflanzenarzt, soll Durchfall und Dysenterie mit der in Wein gekochten Pflanze behandelt haben.
Eine häufige Indikation lautete: gegen den »Teufel im Kopf«. In der Oberpfalz schlug man einem Kind, das das erste Mal in die Schule ging, mit der Pflanze auf den Kopf und sprach dazu: »Geh hin und lerne was!« Auch hängte man dem Kind ein Säckchen mit der Wurzel um, damit es aufmerksam und gescheit werde und von dieser »Pflanze der Erinnerung« ein gutes Gedächtnis bekomme.
Der berühmte englische Kräuterarzt Nicholas Culpeper, der die Heilpflanzen astrologisch einteilte, sah die Planetengöttin Venus im periwinkle am Werk. Wenn Mann und Frau zusammen einige Blätter essen, dann erzeuge es Liebe zwischen beiden, schreibt er. In Tirol glaubte man jedoch das Gegenteil: Ins Essen getan, würde es die Eheleute entzweien.
In der modernen Phytotherapie spielt das Immergrün kaum mehr eine Rolle. Die Pflanze ist pharmakologisch einfach zu gefährlich. Sie enthält über 40 verschiedene Indol-Alkaloide. Dazu gehört vor allem auch das Alkaloid Vincamin, welches kreislaufwirksam, sympathikolytisch und stark blutdrucksenkend wirkt. Es verlangsamt den Herzschlag (Bradykardie), regt jedoch die Hirndurchblutung an, sodass das Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt und die Hirnarteriolen tonisiert werden. Das wirkt sich günstig aus bei Störungen des Gedächtnisses und der Konzentration – vielleicht ist doch etwas daran, wenn man den Schulkindern ein Immergrün-Amulett umhängte, damit sie besser lernten? Ein Tee soll bei zerebraler Sklerose, Ohrensausen, Schwindel, Altersschwerhörigkeit und bei der Durchblutung der Netzhaut hilfreich sein.
Wie das Madagaskar-Immergrün enthält auch das Kleine Immergrün toxische Verbindungen, die das Blutbild verändern, indem sie das Wachstum der weißen Blutkörperchen bremsen. Auch diese Eigenschaft wurde von der Onkologie medizinisch eingesetzt zur Bekämpfung der Leukämie.
Trotz all dem wurde die Anwendung der Immergrün-Droge vom Bundesgesundheitsamt (BGA) 1987 vor allem wegen der drastischen Blutdrucksenkung verboten. Andere Nebenwirkungen des Tees sind gelegentliche Magen- und Darmbeschwerden und ein Absacken des Zuckerspiegels (hypoglykämische Wirkung). Die Kommission E, die Sachverständigenkommission des BGA, zuständig für die wissenschaftliche Untersuchung der Heilpflanzen, erteilte dem Kleinen Immergrün eine Negativ-Monografie.

Die Römer waren es vermutlich, die das Immergrün über die Alpen brachten. Es findet sich häufig an alten Kultplätzen und auf Burgställen.
Knoblauchsrauke
(Alliaria petiolata; A. officinalis; Sisymbrium alliaria)
DIE RETTERIN ARMER PROLETARIER
Gedungen unter Hecken findet man dich,
in schattigen Ecken, Lückenbüßer am Wegessaum,
du Lauch ohne Knobeln, du Hund unter Kräutern.
Vornehme Römer verachteten dich, wie auch stolze Bürger.
Nein, ihr Kochtopf, ihr Teller kannten dich nicht.
Doch für Bettelvolk und arme Bauern
warst Suppengrün und Brotbelag, Gesundheitsspender,
Schutz gegen Krankheiten, die da lauern,
warst Lebensretter und Arzt,
bei Gicht, erzeugt von bösem Wetter,
bei Magengrimmen, Grippe und Geschwür.
WOLF-DIETER STORL
Den Blättern dieses Kreuzblütlers entströmt ein kräftiger Knoblauchgeruch, der dem Kräutlein seinen Namen verliehen hat. Es wächst auf feuchtem Boden unter Hecken, entlang von Waldwegen und in lichten Laubwäldern. Die zweijährige Pflanze besteht im ersten Jahr nur aus rundlichen Blättern, im zweiten Jahr blüht sie dann von April bis Ende Juni und bringt herzförmige, unregelmäßig buchtig gezahnte Blätter hervor. Die weiße Blüte hat, wie bei allen Kreuzblütlern, vier Kelch- und vier Kronblätter sowie sechs Staubblätter, und zwar zwei kurze und vier lange. Diese Blüten bieten Nektar für Bienen, Schwebfliegen und zahlreiche Schmetterlingsarten. Die Früchte bestehen aus dünnen, langen Schoten, die, wenn sie reif sind, viele kleine, schwarze, scharf schmeckende Samen enthalten.
Das Kräutlein hat mehrere Strategien, um sich zu vermehren: Erstens streut es seine Samen aus, wenn starke Windstöße oder vorbeistreifende Tiere die reifen Schoten rütteln; zweitens werden die Samen schleimig, wenn es regnet, und kleben an Hufen, Fell oder Pfoten; und drittens treiben die Wurzeln Knospen, die dann weiterleben, nachdem die Mutterpflanze abgestorben ist. Auf diese Weise bilden sich relativ dichte Bestände der Pflanze.
Die Knoblauchsrauke, auch Knoblauchhederich genannt, ist in Eurasien, von Europa und Nordrussland bis nach Vorderasien und zum Himalaja heimisch; auch im Atlasgebirge gibt es ihn. In Amerika und Neuseeland wird er als aggressiver Neophyt eingestuft. Man vermutet, dass Siedler aus der Alten Welt die Samen einst mitbrachten. Sie benutzten das frische Kraut als Salat- und Suppenzutat und als Heilmittel.

Die jungen Blätter und Triebe der Knoblauchsrauke sind im Frühling willkommene Vitaminspender und sollten roh verzehrt werden.
Inzwischen aber, da sich der Knoblauchhederich als ein überaus erfolgreicher Invasor entpuppt hat, versucht man, ihn auszumerzen. Die Wurzeln setzen nämlich allelopathische Stoffe frei, die auf Mykorrhizapilze hemmend wirken. Das wird zum Problem für viele Baumsamen, die für ihre Keimung von diesen Wurzelpilzen abhängig sind. Man befürchtet auch, dass die Knoblauchsrauke die prächtige Frühlingsflora der nordamerikanischen Wälder verdrängt – wie etwa Frühlingsschönheit (Claytonia virginica), Kanadische Haselwurz (Asarum canadense), Kanadische Blutwurz (Sanguinaria canadensis), Dreizipfellilien (Trillium spp.), endemische Waldschaumkräuter (Cardamine) und andere wertvolle Wildblumen. Als ich in Ohio aufwuchs, bewunderte ich jedes Jahr diese einmalige, vielfältige Blumenwelt, die, ehe die Bäume ihr Laub bekamen, wie ein bunter Teppich den Waldboden bedeckte. Nun aber bleibt vielerorts eine Knoblauchsrauken-Monokultur zurück, die auch den Rehen und Weißwedelhirschen nicht schmeckt. Indem die einheimischen Frühlingsblumen weniger werden, sind zugleich die Schmetterlinge bedroht, die von diesen leben.

Die pfeffrig-scharfen Samen der Knoblauchsrauke in den langgestielten Schoten gelten als ältestes einheimisches Gewürz.
NAMEN UND BRAUCHTUM
Der Gattungsname Alliaria geht auf das lateinische allium (Knoblauch) zurück. Der spezifische Name petiolata deutet an, dass die Blätter gestielt sind, und wenn es alternativ heißt: officinalis, dann weist das wiederum darauf hin, dass es sich um eine von den Apothekern anerkannte Heilpflanze handelt, die sie in ihren Arbeitsräumen (officinae) vorrätig hielten.
Allgemein nimmt die Benennung dieses Kreuzblütlers in den verschiedenen europäischen Sprachen meistens Bezug auf den auffallenden Knoblauchduft: Knoblauchkraut, Lauch ohne Zwiebeln, Läuchel, Waldknoblauch; französisch herbe à l’ail; italienisch erba ai; russisch lesnoj cesnok (Waldknoblauch) und so weiter.
Im Englischen spricht man von garlic mustard (»Knoblauchsenf«) oder hedge mustard (»Heckensenf«). Meistens wird es aber sauce-alone (»Nur Sauce«) genannt. Sauce bezieht sich in diesem Fall auf ein Wort in der nordenglischen und schottischen Mundart, mit der Bedeutung »Grünzeug, das mit Brot oder mit gepökeltem Schweinefleisch oder Salzhering gegessen wird«. Andere englische Bezeichnungen sind poor man’s mustard (»Senf der armen Leute«) und beggar man’s oats (»Bettelmanns Hafer«). Die Schüssel Haferbrei (porridge) war übrigens seit den heidnischen Zeiten ein alltägliches Nahrungsmittel des einfachen Volkes in England und die vitaminreichen Blätter im Frühjahr waren eine willkommene Zutat.
Diese Namen zeigen, dass die Knoblauchsrauke vor allem eine Speise der Armen war. In Notzeiten, insbesondere in den dunkelsten Tagen der Industriellen Revolution, als Arbeiter samt Frauen und Kindern in den Fabriken bei Hungerlöhnen schufteten, war das vitaminreiche frische Grün praktisch ein Lebensretter.
Die alten Angelsachsen nannten das Kräutlein leak-cærse (»Lauchkresse«). Das Wort Lauch (leak, laukr, lok) hatte für die germanischen Stämme besondere Bedeutung. Der Begriff bezog sich auf fast jedes grüne Frühlingskraut, das nach der langen, dunklen Winterzeit die Lebensgeister wieder weckte, den Männern Kraft, den Frauen ein Lächeln und den Kindern rote Backen verleihen konnte. Sogar die Götter aßen diese Kräuter: Lauch nannte man »der Asen Stärkung«. Diese Pflanzen, ein Geschenk der holden Freya, verkörperten das Lebensgrün an sich.11 Frauen legten für diese heil- und zauberkräftigen Gewächse besondere, eingehegte Lauchgärten (laukagardr) an. Es gab sogar eine heilbringende Rune, die Laukr-runa(ᛚ), bei diesen Völkern. Es ist die Rune des Wachstums; sie hat die Kraft, Blockaden zu lösen und die Dinge wieder in Fluss zu bringen. Und ähnlich soll der Knoblauchhederich als Heilmittel wirken.
Wie andere »Lauch-Arten«, etwa Bärlauch oder Allermannsharnisch, hielt man den Knoblauchhederich für schützend gegen Zauber und Hexerei. Im slawischen Kulturkreis, wo der Glaube an blut- und lebenskraftsaugende Vampire weit verbreitet war, hilft der Geruch des Krauts, Vampire zu bannen und Dämonen zu vertreiben – auch den bösen Lungenwurm.

Wo ihr der Standort zusagt, breitet sich die Knoblauchsrauke schnell aus – so rasch, dass sie mancherorts sogar als invasive Pflanze gefürchtet wird.
IN DER KÜCHE
Wie oben angedeutet, galt das frische Grün als akzeptables Wildgemüse. Steffen Guido Fleischhauer, der sich mit essbaren Wildpflanzen auskennt wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum, schreibt folgendes:
- ⬥ Die Blätter und Triebe (von April bis Juni) und die unreifen Samenschoten (von Juni bis Juli) eignen sich als Zutat für Suppen, Aufläufe, Kräuterquark, Kräuterbutter, Pesto oder einfach als Belag eines Butterbrots.
- ⬥ Mit den dekorativen weißen Blüten (Mai, Juni) kann man Salate, Kräuterquark und andere Speisen schmücken.
- ⬥ Die jungen Samen eignen sich als Würze. Die reifen Samen, zermahlen und mit Essig und Salz gemischt, können zu Senf verarbeitet werden.
- ⬥ Die spindelförmigen Wurzeln eignen sich als scharfes Gewürz für Bratgerichte und Käseplatten, im frühen Jahr, bevor die Pflanze in die Höhe schießt, eignet sie sich auch als Gemüse.
Nebenbei sei erwähnt, dass die Blätter zwar nach Knoblauch schmecken, aber keine Knoblauchfahne verursachen. Zum Trocknen eignen sich die Blätter nicht, sie verlieren ihr Aroma.
Der Gebrauch des Knoblauchhederichs als Speisezutat ist, wie zu erwarten, sehr alt. Samen wurden in verkohlten Speiseresten bei den spätmesolithischen Ertebølle-Leuten gefunden, jenen Fischern, Jägern und Sammlern, die zwischen 5100 und 4100 v. u. Z. an der dänischen Küste lebten, und auch bei den frühneolithischen Trichterbecherleuten, die zwischen 4200 und 2800 Mitteleuropa besiedelten und unter anderem für die Hünengräber bekannt sind.
HEILPFLANZE
Auch der Gebrauch als Heilpflanze ist alt. In der heutigen ländlichen Volksmedizin gilt das frische Kraut als desinfizierend, pilzwidrig und wundheilend. Ein Breiumschlag aus frischen Blättern hilft bei Geschwüren. Der frische Saft kommt, innerlich angewendet, bei Verdauungsstörungen wie Gärungen und chronischen Entzündungszuständen im Verdauungstrakt zur Anwendung, ebenso bei Gicht und Erkältung.
Der Knoblauchhederich enthält Senfölglykoside (Glucosinolate), die keimhemmend und auswurffördernd wirken, hinzu kommen ätherische Öle und viel Vitamin A und Vitamin C. In den getrockneten Blättern lässt die Wirksamkeit nach, da die wirksamen Inhaltsstoffe flüchtig sind.
Der berühmte englische Kräuterarzt Nicholas Culpeper (1616–1654), der mit den astrologischen Signaturen der Heilpflanzen arbeitete, ordnet den Garlic-mustard dem Planeten Merkur zu. Das würde heißen, dass das Kraut potenziell gut bei Lungenleiden wirkt, denn die Lunge ist das Organ des Merkur. Der Saft, in Honig gekocht, wirkt schleimlösend bei Husten, sagt Culpeper. Zudem wärmt das Kraut den Magen; die Samen, in Wein gekocht, wirken wider Koliken und Harnsteine; und die aufgelegten frischen grünen Blätter heilen ulzerierte Beine (»offene Beine«).
...
Johann Künzle (1857–1945), der beliebte Schweizer Kräuterpfarrer, gibt an: »Der Tee dieser Pflanze heilt innere, krebsartige Geschwüre, langweiligen Katarrh und vertreibt die Würmer. Als Gurgelwasser benützt festigt er wackelnde Zähne und heilt eiterndes Zahnfleisch.« (Künzle 1945: 424).
...
Das kommt mir zwar ein bisschen übertrieben vor, aber Pfarrer Künzle war ein Praktiker. Wer weiß, was er mit dem »Knoblauchkraut« für Erfahrungen hatte, die sonst in den Kräuterbüchern nicht zu finden sind.
_______
PESTO MIT KNOBLAUCHSRAUKE
_______
ZUTATEN
2 Handvoll junge Knoblauchsraukenblätter
etwa 2–3 EL Nusskerne oder Samen (Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne)
Salz
etwa 100 ml Oliven- oder Rapsöl
- ⬥ Die Blätter gut waschen, trocken tupfen und sehr fein schneiden. Die Kerne fein mahlen und mit Knoblauchsrauke, Salz und Olivenöl vermischen.
- ⬥ In saubere Gläser gefüllt hält das Pesto im Kühlschrank mindestens eine Woche, man kann es aber auch einfrieren.
Gewöhnliche Pestwurz
(Petasites hybridus; P. officinalis)
DES ZAUBERERS HUT
Unter grünem Blätterdach,
bei den Kröten, Schnecken, Schnaken,
ganz nahe, dort am gurgelnden Bach,
da sang ein Wichtelmännlein fein
mit zarter Stimme im Mondenschein:
»Neun Adern hat dein Blatt,
und deine Wurzel Kräfte neun,
und wer dich kennt, der kann sich freun!«
WOLF-DIETER STORL
Nicht ganz so früh wie das Pestwurzweiblein (P. albus), aber noch im Vorfrühling (Ende Februar, Anfang März) stößt der schuppige Blütentrieb des Pestwurzmännleins, der Gewöhnlichen Pestwurz, aus dem Erdboden hervor. Die Pflanze ist zweihäusig. Das heißt, die etwas größeren männlichen Blüten wachsen auf anderen Pflanzen als die weiblichen Blüten. Der traubenförmige Blütenstand ist rötlich violett, deswegen nennt man diese Art auch Rote Pestwurz.
Nachdem die Blüten verwelkt sind, erscheinen die Blätter, und diese haben es in sich. Die Rote Pestwurz besitzt die größten Blätter unserer heimischen Flora. Über 60 Zentimeter im Durchmesser können sie messen.
Während die Weiße Pestwurz mehr im Wald zu finden ist, bevorzugt die Gewöhnliche Pestwurz nasse Böden in der Nähe von Quellen, an Bachläufen und in Überschwemmungsgebieten, wie etwa in den Auwäldern.
NAMEN UND BRAUCHTUM
Was bei der Pestwurz vor allem auffällt, sind eben diese riesigen Blätter. Darauf beziehen sich viele lokale und mundartliche Namen, wie Bachbletschen oder Krötenbletsche, wobei Bletsche oder Blätsche ebenso wie das althochdeutsche Wort »Blacke« merklich große, saftige Blätter bezeichnen. Kinder oder auch Wanderer, die von einem Regenguss überrascht werden, schützen sich gerne vor dem Nasswerden mit dieser Hutblacke, Bachhaube oder Regenschirm. Das kennt man auch in anderen Sprachgebieten: Es sind die umbrella leaves (»Schirmblätter«) in England oder, in Spanien, die sombrerilla (Mütze), auch sombrera (Schirm), den man dort vor allem als Sonnenschirm benutzt. Die Franzosen nennen die Pflanze grand bonnet (»Große Haube«), chapeau de sorcière, also »Hut der Zauberer«, oder gar chapeaux du diable, »Teufelshut«.
Im alemannischen Sprachraum ist die Pestwurz das Ditti-Chrut. Ditti oder Titti12 bedeutet Püppchen oder Wickelkind. In den Zeiten vor Erfindung der Barbiepuppe konnte die kindliche Fantasie alles Mögliche zur Puppe werden lassen: runde Holzstückchen, Strohbündel oder Tannenzapfen. Als Kleider und Mäntelchen dafür eigneten sich die großen Blätter der Pestwurz, wie auch die des Stumpfblättrigen Ampfers (Rumex obtusifolius, alemannisch Titti-Blacke) bestens.
Butterbur ist die gewöhnliche englische Bezeichnung der Pflanze, da ihre großen Blätter vor der Erfindung des Pergamentpapiers zum Einwickeln der Butter dienten – auch hier eine Analogie zum Stumpfblättrigen Ampfer, der besonders kühlend wirkt und als Butterbletsche, Smörblad oder als Ankeblake bekannt ist.13
Neunkraft, Negenkraft, Negenwurz und Neunkraftwurz sind weitere Benennungen. Diese »Neun« ist eine magische Zahl, nicht die tatsächliche Zahl der Blattadern; die Drei ist – wie in der göttlichen Dreifaltigkeit – in unserem Kulturkreis die Zahl der Vollkommenheit. Im Angelsächsischen Neunkräutersegen (Lacnunga, 11. Jahrhundert) heißt es, Woden (Wodan), der angelsächsische Schamanengott, habe neun Kräuter in seiner Hand gehalten und damit den Wurm (Krankheitsdämon) geschlagen und getötet, der da gekrochen kam, um den Menschen zu töten. Auch die ländliche Heilkunde schrieb der Negenwurz drei mal drei Kräfte zu: »Ihr Blatt hat neun Adern, neun Kräfte und nützt gegen neun Krankheiten«, heißt es in der Slowakei.
Man war überzeugt, eine dermaßen mächtige Wurz würde auch die schlimmste Krankheit, die Pest, besiegen können. Deswegen hat sich vor allem der Name Pestwurz durchgesetzt. Pestilentiewortel heißt sie in den Niederlanden; pestört in Schweden, herbe à la peste in Frankreich. Der hochgelehrte Arzt und Botaniker Leonhart Fuchs (1501–1566) schreibt der Pestwurz eine schweißtreibende Wirkung zu, wodurch das »pestilenzische Gift« aus dem Körper geschwemmt wird. Giftwurz nannte man sie auch, da sie angeblich das tödliche Gift ausleiten könne. Dem stimmten praktisch alle der großen Kräuterdoktoren des 16. Jahrhunderts zu. Der englische Kräuterbuchautor John Gerard (1545–1612) schreibt zum Beispiel: »Die getrocknete, pulverisierte Wurzel hilft gegen die Pest und treibt den Schweiß, alles Gift und böse Hitze vom Herzen.«14 (The Herbal, London, 1597). Auch Nicholas Culpeper preist die Pflanze als Pestmittel; er stellt sie unter die Herrschaft der Sonne, »da sie das Herz stärkt und die Lebensgeister befeuert«.
Wahrscheinlich beruhte diese allgemein angenommene Indikation auf Wunschdenken, denn die Pestwurz konnte diese Gottesgeißel nicht abwenden, sie konnte höchstens die Schmerzen einigermaßen lindern.
Älter als Pestwurz sind Namen, die mit Pferden zu tun haben, wie eben Großer Huflattich, also ein Lattich, der den Umriss eines Pferdehufes hat. Bei den keltischen Galliern hieß er Calliomarcus (»Huf des Pferdes«, Marc = Pferd). Marcellus Empiricus, ein römisch-gallischer Gelehrter aus dem 4. Jahrhundert, hat uns diesen Namen vermittelt. Er sagte – typisch keltisch –, man solle die Wurzel an einem Donnerstag, bei abnehmendem Mond, zur Zeit der Ebbe graben und damit ein Mittel gegen Husten und Lungenkrankheit herstellen; man könnte es auch verräuchern und den Rauch einatmen. Die Kelten sollen die Pflanze ihrer Pferdegöttin Epona (walisisch Rhianna) geweiht haben. Das Pferd galt den Kelten wie auch den anderen indoeuropäischen Völkern als ein Sonnentier. Es zieht den Wagen des siegreichen Sonnengottes tagsüber über den Himmel und nachts durch die Unterwelt. Das Ross war für die indoeuropäischen Völker ein Licht- und Heilbringer. Heilpflanzenkundige Zwillingsgötter, wie die beiden griechischen Himmelssöhne, die Dioskuriden (Castor und Pollux), die vedischen Ashvins oder die baltischen Ashvieniai15, galten als Heiler und Pferdegottheiten; sie überlebten in christlichem Gewand bis heute als Cosmas und Damian, Schutzpatrone der Apotheker und Ärzte, die in katholischen Regionen noch lange bei Pest und Pferdekrankheiten angerufen wurden.
Hildegard von Bingen kennt die Pestwurz als »Groß Huflatta«, die Spanier als pata de caballos (»Huf der Pferde«), die Dänen als röd hestehov (»roter Pferdehuf«) und die Niederländer als Groot Hoefblad (»Großes Hufblatt«).

Die riesengroßen Blätter der Pestwurz wurden früher gern zum Einwickeln etwa von Butter verwendet, daher auch ihr volkstümlicher Name Butterbletsche.
Pestwurz- und Huflattichblätter – man unterschied sie kaum – wurden als Grabbeigaben in keltischen Gräbern gefunden. Man fand aber auch ganze Bündel dieser Blätter in den Salzbergwerken in Hallstatt, wo vor 2600 Jahren keltische Bergleute, darunter viele Kinder16, in engen Stollen in bis zu 300 Metern Tiefe, das »weiße Gold« abbauten, auf dem der Reichtum dieser Eisenzeit-Kelten beruhte. Archäologen rätselten lange, welchem Zweck diese Blätter in den Schächten dienten. War es ihre antiseptische, wundheilende und schmerzstillende Wirkung? Inzwischen glaubt man, dass sie als Klopapier genutzt wurden. Noch heute ist einer der Namen der Pflanze in Bayern Arschwurz.
Weitere volkstümliche Namen sind Stinkwurzel, da die Wurzel einen unangenehmen Geruch hat, Tabaksblätter, da man die getrockneten Blätter zum Strecken des Tabaks verwendete, und Schneckenkraut, weil sich die Schnecken gerne im Schatten der Blätter aufhalten. Lattichwurz, Sonnendächle, Falscher Huflattich und Wilder Rhabarber wurde die Pflanze hier und da auch genannt.

Die Gewöhnliche unterscheidet sich von der Weißen Pestwurz vor allem durch ihre Blütenfarbe, verschiedene Rosa- und Rotschattierungen.
Man würde meinen, dass dieser beeindruckenden Pflanze viel Brauchtum und Magie anhängen. Dem ist aber nicht so. Lediglich aus England wird folgender Zauber berichtet: Ein Mädchen, das wissen will, wer ihr Zukünftiger ist, soll an einem Freitagmorgen vor Sonnenaufgang an einem entlegenen Ort Pestwurzsamen aussäen und dabei sagen:
...
I sow, I sow,
Then, my dear,
Come here, come here
And mow, and mow.17
...
In der Vision wird sie ihren Zukünftigen mit einer Sense sehen. Aber wenn sie Angst kriegt und etwas sagt, wird ihre Vision sofort schwinden.

Während ihre weiße Schwester am liebsten im Wald wächst, siedelt sich die Rote Pestwurz gern auf feuchten Lichtungen an.
HEILPFLANZE
Die Pestwurz ist offizinal, das heißt, sie gehört zu den herkömmlichen Apothekerdrogen, die in der officina, der Apothekerwerkstatt, gelagert und verarbeitet wurden.
Schon der verehrte griechische Meister Dioskurides ließ seine Jünger wissen: »Das Blatt wirkt fein gestoßen als Umschlag gegen bösartige und krebsige Geschwüre.«
Das war eine der Hauptindikationen. Hildegard von Bingen verwendet Huflatta gegen »noch nicht ausgebrochene Geschwüre«. Der Renaissance-Arzt Leonhart Fuchs, der eine mit Honig gekochte Latwerge18 angibt, »wider die giftigen und pestilenzischen Fieber«, schreibt, die Wurzel, »gedörrt und gepulvert in die bösen und umfressenden Wunden getan, heilt dieselben. (...) Diese Wurzel tötet die Würm im Leib, nit allein der Menschen, sondern auch der Pferde. Sie ist nützlich denen, die so schwer atmen.«
In der Volksmedizin
Mit dem Aufkommen der modernen Schulmedizin geriet Petasites fast in Vergessenheit. In der Volksmedizin spielte die Pflanze jedoch weiterhin eine Rolle als schweißtreibendes, harntreibendes, wurmvertreibendes, hustenlinderndes und schmerzlinderndes Mittel. Maria Treben (1907–1991), würdige Vertreterin dieser Heilrichtung, verschreibt die Pestwurzwurzel als Kaltwasserauszug bei Atemnot (1 TL des Wurzelpulvers pro Tasse, 12 Stunden ziehen lassen, dann aufwärmen und schluckweise trinken). Bei Gicht empfiehlt die Kräuterfrau einen Kaltwasserauszug (2 Tassen pro Tag); bei »Brand« und bösen Geschwüren empfiehlt sie den Brei aus zerstampften Blättern zum Auflegen. Ähnliches sagen der Kräuterpfarrer Johann Künzle und die hessische »Kräutermutter« Grete Flach (1897–1994). Als weitere volksmedizinische Anwendungen werden der unangenehm bitter schmeckende Tee oder die Tinktur bei Krämpfen, Hustenkrämpfen und Migräne verschrieben. Johann Künzle, der den Tee und das Wurzelpulver gegen seuchenartige Ansteckungskrankheiten einsetzte, kommentiert: »Die Pestwurz wurde früher gegen Pest und Seuchen verwendet. Die Heilkräfte sind auch heute nicht verloren.«
Anthroposophische19 Signaturenlehre
In der Sichtweise der anthroposophischen Heilkunde gleicht die archetypische Pflanze einem umgekehrten Menschen. Die Wurzel samt dem damit verbundenen Netz der Pilzmyzelien entspricht demnach dem menschlichen Hirn und dem Nervensystem. Das Blattwerk mit seinen tages- und jahreszeitlichen Rhythmen und dem Gasaustausch entspricht den Lungen und dem Blutkreislauf (rhythmisches System), der Blütenpol der Pflanze ist mit dem Verdauungs- und Fortpflanzungssystem des Menschen verwandt (homolog)20. In diesem Sinn wirkt der »intensive Wurzelprozess« der Pestwurz vor allem auf den Kopf beziehungsweise das Nervensystem des Menschen, etwa bei Migräne. Die mächtige Blattbildung ist für die Anthroposophen ein Hinweis auf die Lungenwirksamkeit, und die Tatsache, dass die Pflanze in der nasskalten Jahreszeit blüht, deutet darauf hin, dass sie bei Erkältungskrankheiten wirksam sein könnte.
Moderne Heilanwendungen
Der renommierte Medizinprofessor Rudolf Fritz Weiß (1895–1991), der seine Lebensaufgabe darin sah, den Ärzten die Phytotherapie wieder zugänglich zu machen, untersuchte diese fast vergessene Heilpflanze genauer (Weiß 1991: 158). Er schreibt, dass die Pestwurz eine bemerkenswerte spasmolytische (krampflösende) und schmerzstillende Wirkung besitzt, besonders bei:
- ⬥ akuter und chronischer Magenschleimhautentzündung (Gastritis) und Zwölffingerdarmentzündung
- ⬥ Magenbeschwerden im Rahmen des Magen-Herz-Syndroms (Roemheld-Syndrom-Komplex)
- ⬥ vegetativer Dystonie
- ⬥ schmerzhaften Spasmen der Gallenwege
- ⬥ migräneartigem Spannungskopfschmerz
- ⬥ spastischen Formen von Bronchitis, Krampfhusten und Keuchhusten. Sie wirke als Neuro-Sedativum, außerdem, ebenso wie der Huflattich, schleimlösend.
Die Wurzel regt die Herztätigkeit an, in England wird sie in der Volksmedizin als harntreibendes Herztonikum verwendet. Sie wirkt stimulierend auf das Herz und erweitert die Herzkranzgefäße. Die Phytotherapie in Deutschland setzt Pestwurzpräparate gegen Migräne ein.
Die in der Wurzel enthaltenen Petasine wirken spasmolytisch auf die glatte Muskulatur, sie wirken antiallergisch (sie verringern die Freisetzung von Histamin und Serotonin), Ulkus-protektiv und auch entzündungshemmend (Schönfelder 2004: 332). Das Petasin soll sogar die Wirksamkeit des Papaverins, das im Schlafmohn vorkommt und entkrampfend auf die glatte Muskulatur wirkt, übertreffen, obwohl es kein Alkaloid ist.
Pyrrolizidine
Das ist alles wunderbar. Aber neben Petasin, Schleimstoffen (Pektine), Bitterstoffen, Gerbstoffen und ätherischen Ölen enthält die Pflanze auch die berüchtigten Pyrrolizidinalkaloide (PA). Diese wurden in den 1960er-Jahren entdeckt und stehen im Verdacht, Leberkrebs zu erregen.
Diese Tatsache wurde als Vorwand genommen, um im Sinne der mächtigen pharmazeutischen Lobby eine ganze Reihe von altüberlieferten Heilpflanzen zu verbieten, darunter Beinwell, Borretsch, Huflattich, Kunigundenkraut und die Pestwurz. Selbstverständlich würde ich niemals die hepatotoxische, gentoxische, mutagene und karzinogene Wirkung der in bestimmten Pflanzen enthaltenen Pyrrolizidinalkaloide leugnen. Dass diese Verbindungen giftig sind, habe ich auch hin und wieder in Vorträgen und Publikationen erörtert.21 Ich plädiere jedoch für eine differenzierte Sichtweise, da viele unterschiedliche Arten von Pyrrolizidinalkaloiden in der Pflanzenwelt vorhanden sind, wovon einige – etwa die in der Pestwurz vorhandenen Farfugine und Tussilagine – nicht toxisch sind. Auch variiert der PA-Gehalt je nach Art und auch nach Tageszeit, Jahreszeit und Standort. Inzwischen hat man rund 660 verschiedene PA in über 6000 Pflanzenspezies gefunden.22 Rudolf Fritz Weiß, Doyen der medizinischen Phytotherapie und Mitglied der Kommission E, schreibt, dass die Pyrrolizidine in traditioneller therapeutischer – also äußerst geringer – Dosierung praktisch vernachlässigt werden können.
Die Kommission E erteilte den Petasites-Blättern wegen dem stark variierenden Inhalt von Pyrrolizidinalkaloiden mit 1,2-ungesättigtem Necin-Gerüst eine negative Monografie, den Wurzeln dagegen eine positive. Die Anwendung ist auf wenige Tage zu begrenzen.
Für Heilzwecke sammeln die Kräuterkundigen Blätter und Wurzeln nach dem Abblühen. Kräuterpfarrer Künzle lehrt uns, der Oktober wäre die bessere Sammelzeit für die Wurzeln.

Die Blätter der Gewöhnlichen Pestwurz sind mit bis zu 60 Zentimetern Durchmesser die größten unserer heimischen Flora. Sie können sogar als Regenschirm benutzt werden – daher auch der englische Name umbrella leaves.
IN DER KÜCHE
Ganz so giftig, wie man oft liest oder hört, ist dieser »Wilde Rhabarber« nicht. Aber die Pflanze ist absolut kein Leckerbissen, sie hat auch einen abweisenden, schlechten Geruch. Dennoch werden gelegentlich junge Pestwurzblätter und -stängel als Survival Food, also als Notnahrung in Krisenzeiten, angegeben. Vergiftungen sind keine dokumentiert. In der Walachei im Süden Rumäniens gehörten die fein gehackten, ganz jungen Triebe mit zum Frühlingsgemüse.
In den Alpenregionen hat man den Schweinen als Futter Pestwurzstängel eingesäuert, den Ziegen mischte man- in Zeiten von Futtermangel – getrocknete Blätter mit ins Futter.
Eine unserer großen Pestwurz ganz ähnliche Art wächst in Ostsibirien, Japan, Korea und Nordchina. Es ist die Asiatische Pestwurz (Petasites japonicus); sie hat noch größere Blätter als unsere heimische Art und wuchert sehr stark. In Japan sind die jungen Blütentriebe, wenn sie im Frühling gerade aus der Erde kommen, eine beliebte Speise. Die Triebe werden sogar auf den Märkten feilgeboten. Das Gericht heißt Fuki no tou oder einfach Fuki. Es kann als Suppe mit Miso gegessen werden oder als Tempura in Öl frittiert. Der Geschmack ist recht bitter, aber das soll gut für Leber und Galle sein. Um die Bitterkeit etwas abzumildern, werden die Stängel auch vor dem Kochen oder Frittieren einige Stunden in Aschelauge gelegt. Fuki gilt als Delikatesse; das Gericht soll die Verdauung verbessern, Schleim in der Lunge lösen, das Altern verlangsamen und Krebs hemmen. Dass auch die Asiatische Pestwurz Pyrrolizidine enthält, scheint die Japaner nicht zu kümmern.
Die Ureinwohner Nordjapans, die Ainu, essen die Pflanze ebenfalls gerne. Ihr Name für Zwerge oder Gnome lautet übrigens koro-pok-kuru; das bedeutet, »diejenigen, die unter der Pestwurz leben«.