

(Petasites albus)
DER FALSCHE HUFLATTICH
Wenn du erblühst,
weiße Pestwurz,
vergehen Eis und Schnee,
vergeht des Winters Weh.
WOLF-DIETER STORL
Hier im Wald, auf dem Berge, auf dem wir leben, drängen sich im Vorfrühling, kurz nach der Schneeschmelze, dicke grüne Knospen aus der winterblanken Erde hervor. Wie Zwerge mit grünen Mützen kommen sie mir vor. Aus ihnen entwickeln sich bald – zwischen Ende Februar und Anfang März – dicke Blütenstängel mit vielen kleinen, weißen Röhrenblüten, die in Trauben zusammengefasst sind. Sie stellen, neben den Weiden- und Haselkätzchen, Vorboten des Frühlings dar. Den Bienen sind sie höchst willkommen, denn für diese freundlichen Insekten bilden sie die erste gute Futterweide. Ihr Erscheinen freut mich natürlich auch. Aber nicht ganz, denn nun heißt es, dass ich bald den Garten umgraben und bestellen, das von Schnee und Frost geschädigte Dach reparieren und andere Arbeiten verrichten muss. Wehe mir, wenn ich zu diesem Zeitpunkt das neue Buchmanuskript noch nicht ganz fertig geschrieben habe!

Im Vorfrühling, schon Ende Februar, Anfang März, erscheinen zuerst die dicken Blütenstängel der Weißen Pestwurz, deren Blüten eine wichtige Bienenweide sind.
Wenn die Blütenstängel der Weißen Pestwurz verblüht und verwelkt sind und ihre mit flaumig weißen »Fallschirmen« ausgestatteten Samen ausbilden, erst dann erscheinen die Blätter. Anfangs sind diese zart und zusammengeknautscht, aber bald werden sie größer. Ihre Unterseite ist graufilzig behaart.
Diese Blätter ähneln denen des Huflattichs (Tussilago farfara) so sehr, dass sie der Laie, der nicht genau hinschaut, leicht mit diesen verwechseln kann. Deswegen wird diese Pestwurz gelegentlich auch Falscher Huflattich oder Weißer Huflattich genannt. Auch der Huflattich gehört mit zu den Frühlingsboten, auch er blüht – fast zur gleichen Zeit wie die Weiße Pestwurz –, ehe er seine Blätter entfaltet. Die Huflattichblüte ist jedoch nicht weiß wie die der Pestwurz, sondern wie eine kleine Sonne, strahlend gelb.
Die Weiße Pestwurz wächst in den Wäldern West- und Nordeuropas. An Bachläufen ebenso wie an feuchten Forststraßen begleitet sie den Wanderer. Ihr sagt das feuchte atlantische Klima zu. Nicht nur mittels Flugsamen, sondern auch mit ihren langen Wurzelstöcken vergrößert sie ihr Areal.

Erst nach dem Verblühen entwickeln sich die Blätter.
Der wissenschaftliche, lateinische Name der Gattung der Pestwurze ist Petasites. Er kommt aus dem Griechischen, von dem Wort pétasos, und bedeutet »breitkrempiger Hut«, so wie ihn etwa der flinke Heiler- und Schamanengott Hermes/Merkur trug. Der Name bezieht sich auf die außergewöhnlich großen Blätter dieser Gattung. Schon Pedanios Dioskurides23, der große griechische Arzt, der das erste Kräuterbuch der westlichen Welt schrieb, nannte die breitblättrige Pflanze so, aber es war wohl weniger die Weiße Pestwurz, die damit gemeint war, als die viel größere Gewöhnliche Pestwurz, Petasites officinalis, (synonym P. hybridus). Der spezifische Name albus bedeutet lediglich »weiß« und bezieht sich auf die Farbe der Blüten. Waldplacke und Weißplacke sind weitere Namen, wobei Placke oder Blagge ein großes, breites Blatt bedeutet. Als Placke bezeichnen die Schweizer den Grindampfer oder Stumpfblättrigen Ampfer, der ebenfalls große Blätter besitzt. Pestwurzweiblein heißt die Pflanze auch, denn unter den Pflanzen herrschen – so der frühere Volksglaube – familiensoziologische Verhältnisse. Demnach sei die Weiße Pestwurz mit dem Pestwurzmännlein, der großen Gewöhnlichen Pestwurz, verheiratet. Über Aberglauben und Brauchtum in Bezug auf diese spezifische Pflanze ist relativ wenig bekannt. Oft verwechselte man die Gewöhnliche Pestwurz mit der Weißen Pestwurz, auch was Brauchtum und Aberglauben betrifft.

Die Blätter sind unterseits weißlich filzig, sie erreichen bis Ende des Sommers ihre vollständige Größe von 20 bis 30 Zentimetern Durchmesser.
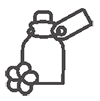
Die Kräutersammlerinnen, weisen Frauen und bärtigen Wurzelsepps kannten ihre Heilpflanzen gut, aber sie waren keine Botaniker im heutigen Sinn. Für sie war die Heilwirkung das Wichtigste und diese ist bei der Weißen wie auch der Gewöhnlichen oder Roten Pestwurz ähnlich genug, dass eine Unterscheidung nicht nötig war. Oft wurde auch der normale Huflattich mit hinzugenommen, denn auch bei ihm sind die Heilanzeigen – schweißtreibend, harntreibend, vegetativ entspannend, wundheilend – ähnlich genug, um die drei nicht besonders zu unterscheiden. Aus diesem Grund ist die Heilwirkung der »Pesthüte« im Kapitel über die Gewöhnliche Pestwurz besprochen.

Steffen Guido Fleischhauer, der bekannteste Sachkundige für essbare Wildpflanzen, gibt an, dass man die ganz jungen Blätter im Frühling als Gemüse zubereiten könne. Sie sollten zuerst in Salzwasser gekocht und dann abgespült werden.
In früheren Zeiten hat man während der vorösterlichen Fastenzeit, in der die Lebensmittelvorräte zur Neige gingen, häufig auf die Pestwurz- und Huflattichblätter als Suppenzutat zurückgegriffen. Es ist übrigens überliefert, dass in Huflattichblätter gewickelte Rouladen eine Lieblingsspeise Goethes waren. Inzwischen wird jedoch vor dem Verzehr der Blätter gewarnt, da die Pflanze Pyrrolizidinalkaloide enthält, die langfristig leberschädigend oder karzinogen wirken könnten (siehe >).
Fleischhauer erwähnt auch die Verwendung der veraschten Pestwurzblätter als Würzsalz. Dazu werden diese im Ofen oder auf feuerheißen Steinen verbrannt (Fleischhauer 2004: 242).

(Oxalis acetosella)
BROT DES KUCKUCKS
Der Sauerklee ist ein zartes, mehrjähriges Blümlein, das in Buchenwäldern früh im Jahr blüht, ehe die Laubblätter zu viel Schatten werfen. Zuweilen findet man es auch am Rande von Fichtenwäldern. Die hellgrünen, dreizähligen Blätter sehen den echten Kleeblättern täuschend ähnlich – daher der Name –, aber wenn man ihre delikaten, weißen, rot geäderten Blüten betrachtet, weiß man, dass die Pflanze zu einer anderen Familie gehört, nämlich den Sauerkleegewächsen (Oxalidaceae). Zu dieser Familie gehören zum Beispiel auch die fünfkantige, leicht säuerlich schmeckende Sternfrucht (Karambole), der Gurkenbaum (Bilimbi), dessen grüne, saure Früchte sich gut für Chutneys eignen, der Knollige Sauerklee (Oka), den die Indios Perus als Wurzelgemüse kultivieren, sowie der in Töpfen gezogene, vierblättrige, aus Mexiko stammende »Glücksklee« (Oxalis tetraphylla), den wir gerne zu Neujahr verschenken, und weitere 800 weltweit wachsende Oxalis-Arten.
Unser einheimischer Sauerklee ist bestens an das Leben im schattigen Wald angepasst. Die Blätter sind fast so sensibel wie bei den Mimosen: Die Stängel krümmen sich und rücken diese mit dem Wandel des Lichteinfalls in eine lichtgünstige Stellung. Die Hautzellen der Blätter wölben sich und werfen wie Sammellinsen Licht auf die tieferen Blattzellen. Bei Gewitter oder schon bei vorüberziehenden Wolken nehmen die Blätter Schlafstellung ein; auch bei großer Hitze falten sie sich senkrecht zusammen und verhindern so die Abgabe von Wasserdampf, da die Spaltöffnungen auf der Blattunterseite liegen.
Weil es im Wald allgemein windstill ist, hat der Sauerklee eine besondere Methode entwickelt, um seine Samen zu verstreuen. In der heranreifenden Samenkapsel baut sich ein Innendruck von bis zu 17 Bar auf – das ist mehr als der Druck in den Autoreifen. Weil die fleischige Achse der Früchte beim Trocknen schrumpft, entsteht ein Überdruck, durch den die Kapseln explodieren und die Samen mehrere Meter weit schleudern. Zusätzlich haben die Samen ein Schwellgewebe, das unter Spannung steht und beim Platzen die Samen nochmals bis zu zwei Meter verteilt.

Mit dem dreiblättrigen Sauerklee soll der Schutzpatron der Iren, der heilige Patrick, die Dreifaltigkeit Gottes erklärt haben.
Der Sauerklee verdient seinen Namen, denn die Blätter schmecken angenehm säuerlich und eignen sich gut als Zutat zum Frühlingssalat. Aber man sollte nicht zu viel davon essen, er enthält nämlich Oxalsäure, die die Niere reizt sowie die Bildung von Nierensteinen fördert.
Ein beliebter Name des Waldblümleins ist Kuckucksbrot oder auch Kuckuckskohl (englisch cuckoo’s meat, französisch pain de coucou), denn wenn es blüht, ist der Ruf des Kuckucks bald zu hören. Hasenbrot, Hasenklee und Hasenampfer sind weitere Benennungen. Beide, der Hase und der Kuckuck, wurden früher mit Fruchtbarkeit, Sinneslust und Sexualität assoziiert; sie waren Attribute der Freya oder der Ostara. Hasen sind Diener dieser holden Göttin, sie legen das Osterei, welches die Neuwerdung der Natur symbolisiert. Und vom Kuckuck, der auch Gauch genannt wird, heißt es ebenfalls, dass er die Wollust anrege und die Menschen närrisch mache. In der christlichen Malerei stellt der blühende Sauerklee oder auch ein weißer Hase zu Füßen der Jungfrau Maria den Sieg über die Sinnlichkeit dar. Die astrologische Kräuterkunde der Renaissance stellte den Sauerklee unter die Herrschaft der Venus.
Noch mehr als andere Kleearten galt der Sauerklee den Kelten, insbesondere den Iren, als heilig. Die Legende erzählt, der heilige Patrick, Schutzpatron Irlands, habe den heidnischen Iren die Dreifaltigkeit Gottes anhand des dreiblättrigen Klees erklärt. Eigentlich war die Dreiheit des Göttlichen nichts Fremdes für dieses Volk, Patrick brachte lediglich den neuen christlichen Glauben in Einklang mit dem keltischen Weltbild. Am Tag des Heiligen, am 17. März, stecken sich die Iren noch immer den Shamrock an den Hut oder ans Revers ihrer Jacken. Auch die irischen Zwerge, die Leprechaun, tragen den Sauerklee an ihrem Hut.

Weil der Sauerklee blüht, wenn der Ruf des Kuckucks zu hören ist, heißt er auch Kuckucksbrot.
Der Shamrock ist eine zauberstarke Pflanze. Legt man solch ein Sauerkleeblatt unter das Altartuch, dann wird der Priester, der die Messe liest, anfangen zu stottern.
Trägt man den Sauerklee zu Walpurgis, soll man die Hexen erkennen können. Ein weiterer irischer Aberglaube besagt, man würde das ganze Jahr lang kein Fieber bekommen, wenn man den Kuckuck das erste Mal rufen hört und dabei drei Sauerkleeblätter isst.

Frische Sauerkleeblätter kamen überall mit in die Gründonnerstagssuppe. Die Russen drehen Sauerklee durch den Fleischwolf und stellen daraus ein säuerliches Erfrischungsgetränk her. Sie trocknen und pulverisieren die Blätter auch und würzen damit Getreidesuppen oder auch die beliebte Kohlsuppe (Schtschi). In England machte man eine »grüne Sauce« – nach John Gerard, dem bekannten englischen Kräutermann, eignet sie sich besonders für Fischgerichte, die schwachen Mägen guttun. Aber es soll betont werden, dass man es mit dem Guten – wegen der nierenreizenden Oxalsäure – nicht übertreiben sollte. Sie verringert im Körper auch den für Herz und Kreislauf so wichtigen Kalziumspiegel. Wenn man oxalsäurehaltige Pflanzen wie Sauerklee oder auch Rhabarber oder Spinat kocht, sollte man am besten das Kochwasser wegschütten, in dem sich ein großer Teil der schädlichen Säure befindet.
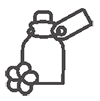
In der Volksheilkunde gilt der Sauerklee als kühlend bei »hitzigen« Erkrankungen. Die kühle, zarte Venuspflanze vermag hitzigen Mars-Erkrankungen, wie ansteckende Fieber oder Gallenkoliken, entgegenzuwirken – das wenigstens meinte der berühmte englische Herbal-Astrologe Nicholas Culpeper. Der frische Saft, sagt er, reinigt das Blut, vertreibt Skorbut, wirkt äußerlich bei »Skrofelgeschwüren«24 und bringt Eiterbeulen zur Reife. In der Ayurveda-Medizin wird das Kräutlein, das auch im Himalaja wächst, bei Fieber, Verdauungsbeschwerden sowie äußerlich bei Hautentzündung und krebsigen Geschwüren eingesetzt.
Maria Treben verschreibt – in ihrem Büchlein Gesundheit aus der Apotheke Gottes – den frischen Kräutersaft oder auch den Tee aus frischen Blättern bei leichten Leber- und Verdauungsbeschwerden, Hautausschlägen, beginnendem Magenkrebs und äußeren Geschwüren.
Sogar für die Schüttellähmung (Parkinson) hat die Kräuterfrau ein Rezept mit dem Waldkräutlein: Der frische Saft, stündlich drei bis fünf Tropfen, wird in Schafgarbentee eingenommen und das Kraut äußerlich zur Einreibung des Rückgrats verwendet.
Rezepte dieser Art, wie man sie immer wieder bei Volksheilern, indianischen Medizinleuten und Schamanen vorfindet, wirken tatsächlich. Man kann sie jedoch nicht verallgemeinern. Sie wirken unter besonderen Umständen und zu spezifischen Zeiten: Das Charisma des Heilers, seine persönliche Beziehung zur Heilpflanze, der günstige Zeitpunkt, das individuelle Karma des Patienten und ähnliche Umstände sind bei solchen außergewöhnlichen Heilungen wesentliche Vektoren. So konnte zum Beispiel Kräuterpfarrer Kneipp (1821–1897) jemanden mit Wundstarrkrampf (Tetanus), einer Infektion, die meist tödlich verläuft, mithilfe des Gänsefingerkrauts heilen. Es war nicht nur das Kraut, das übrigens im Allgäu »Krampfkraut« heißt, und die darin vorhandenen Wirkstoffe, sondern vor allem das Charisma Kneipps, seine Fürsorge und Gebete, die das Wunder ermöglichten. So etwas lässt sich nicht pauschal wiederholen oder gar kommerzialisieren.

(Mercurialis perennis)
PFLANZLICHES QUECKSILBER
Das kleine, tiefgrüne, ausdauernde, bis zu 40 Zentimeter hohe Kräutlein ist ein Wolfsmilchgewächs (Euphorbiaceae). Aus seinen Blättern und Stängeln tropft, wenn sie verletzt werden, jedoch keine weiße, klebrige Latexmilch, wie es bei den meisten anderen Euphorbien der Fall ist. Andererseits bleibt es seinen Verwandten treu, indem es wie diese eine gewisse Giftigkeit besitzt. Die Giftwirkung beruht auf mehreren Saponinen, die abführend wirken: Methylamin (früher Mercurialin genannt) und Trimethylamin. Beim Vieh – wenn es dumm oder hungrig genug ist, das Kraut zu fressen – führt es zu Darmentzündung, schwachem Puls und blutigem Harn; bei Kühen kann es die Milch bläulich färben und zu Schädigungen von Nieren und Leber führen. Der Rotharn wird aber nicht unbedingt durch innere Blutungen verursacht, sondern durch das Alkaloid Hermidin, das das getrocknete Kraut bläulich und den Harn rotbraun färbt.
Die Samen enthalten am meisten Gift. Für Menschen gilt die Pflanze nur als schwach giftig. Wer das frische Grün aus Versehen in seine Frühlingskräutersalatschüssel mischt oder es in den Smoothie quirlt, wird möglicherweise von Erbrechen, Durchfällen und Betäubungszuständen heimgesucht. Wer aber würde das schon machen? Vergiftungen kommen fast nie vor, denn schon der Geruch der Blätter ist unangenehm, der Geschmack salzig-bitter. Wenn man sie zerreibt, riecht es, bedingt durch Trimethylamin, nach Heringslake.
Im Gegensatz zu vielen anderen Frühjahrsblühern unserer Wälder, wie Buschwindröschen, Lerchensporn, Scharbockskraut oder Aronstab, bleibt das Bingelkraut den ganzen Sommer über grün; es trotzt dem Schatten der Bäume.
Bingelkräuter sind zweihäusig. Das heißt, männliche und weibliche Pflanzen leben in getrennten Kolonien, so wie einst die Mönche und Nonnen in ihren jeweiligen Klöstern getrennt waren. Die männlichen Blüten selber sind unscheinbare, ährenähnliche Gebilde, die nach dem Ausstauben schnell verkümmern; die weiblichen Blüten sitzen in den Achselstielen. Wenn die Pflanze im April/Mai blüht, ist es der Lufthauch, weniger die Insekten, der die Weiblein und Männlein verbindet und die Befruchtung ermöglicht. Da sie nicht darauf angewiesen ist, die Kerbtierchen anzulocken, braucht sie keine großen, bunten Blüten hervorzubringen. Dennoch scheint der Duft kleine Mücken anzuziehen, die über die Blüten krabbeln und dabei gelegentlich unbeabsichtigte Bestäubungsdienste vollziehen. Die bestäubte weibliche Blüte bringt dann als Frucht eine aus zwei kugeligen Hälften bestehende Kapsel hervor.
Eine besondere Beziehung hat das Bingelkraut zu den Ameisen. Die beiden kugeligen Samen, die beim Aufspringen der Frucht nicht allzu weit fortgeschleudert werden, tragen fleischige Anhängsel (Elaiosome), die für Ameisen interessant sind und von ihnen verschleppt werden. Auch mittels eines vielverzweigten, knotig gegliederten Wurzelstocks verbreitet sich die Pflanze.
Das Waldbingelkraut bevorzugt das atlantische Klima und ist daher vor allem in Europa und teilweise in Vorderasien beheimatet. Der nächste Verwandte ist das Einjährige Bingelkraut (Mercurialis annua), das in Weinbergen, Gemüsegärten und auf Schuttplätzen als Begleitflora gedeiht. Dieser »böse Heinrich« – im Gegensatz zum essbaren Guten Heinrich (Chenopodium bonus-henricus) – hat dieselben medizinischen Eigenschaften wie das Waldbingelkraut, nur etwas schwächer.
Zu den weiteren weltweit verbreiteten 7500 Arten der Wolfsmilchgewächse gehören auch folgende: der Wunderbaum oder Rizinus (Ricinus communis), der in allen Teilen tödlich giftig ist, mit Ausnahme des aus den Samen gepressten, darmreinigenden Rizinusöls; der hübsche Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima); der Kautschukbaum, aus dessen Latex die Autoreifen hergestellt werden; der aus dem Amazonasgebiet stammende Maniok, dessen stärkehaltige Wurzel ein Grundnahrungsmittel der Indios ist und den wir bei uns vor allem in Form des Tapioka-Puddings kennen. Hinzu kommen die vielen kleinen Wolfsmilcharten – Zypressenwolfsmilch, Gartenwolfsmilch, Sonnwendwolfsmilch –, die in unseren Breiten zu Hause sind.
Der Name Bingelkraut wird allgemein auf das althochdeutsche Bungo oder Bunge = »Knolle, Knoten« zurückgeführt. Gemeint ist die Gestalt der beiden hodenähnlichen Fruchtkapseln, die sich nach der Bestäubung am Ende des schmalen Blütenstiels entwickeln. Ein alter Name für die zwei aneinanderliegenden Samen war Mercurialis testiculata; das bezieht sich auf testiculus, »Hoden«. Wie ein kleiner Bengel hat die Pflanze also zwei »Hödlein«. Eine andere Deutung des deutschen Namens weist auf die harntreibende Wirkung des Krauts, auf das »bingerln« (pinkeln) hin.
In vielen Kulturen, bei uns vor allem im Mittelalter, spielten die Signaturen eine wichtige Rolle in der Heilpflanzenkunde. Der liebe Gott, so glaubte man, habe den Pflanzen ein bestimmtes Aussehen und eine Form gegeben, damit die Menschen daran erkennen mögen, welche medizinischen Eigenschaften sie besitzen. So galten gelb blühende Pflanzen wie der Löwenzahn oder das Schöllkraut als wirksam bei Gelbsucht; rote Blüten oder Blätter deuteten darauf hin, dass die Pflanze hilfreich bei Blutungen sein könnte; herzförmige Blätter wie die der Linde würden dem Herz guttun. So betrachtet, hat das Bingelkraut mit seinen zwei »Hödlein« eine besonders beeindruckende Signatur.
Seit der Antike glaubte man, dass man mithilfe dieser Pflanze das Geschlecht eines Kindes vorgeburtlich beeinflussen könne: Der Arzt Dioskurides, der zur Zeit von Kaiser Nero lebte, schreibt dazu: »Wenn die Frau unmittelbar nach der Monatsblutung die fein gestoßenen Blätter des Bingelkraut-Weibleins trinkt oder ein Zäpfchen daraus in die Scheide einführt, dann wird sie ein Mädchen empfangen; wenn sie die Blätter des Bingelkraut-Männleins – das mit den kleinen Hoden – benutzt, dann wird ein Junge geboren.« (Dioskurides 1610: 356).
Dieser Glaube geriet in Zweifel, als der Tübinger Gelehrte Rudolf Camerarius (1665–1721) im Jahr 1694 anhand des Bingelkrauts den Fortpflanzungsmechanismus der Pflanzenwelt entdeckte. Er erkannte, dass das kräftigere Kraut mit den Hödlein in Wirklichkeit die weibliche Pflanze ist und das etwas kleinere Kräutlein mit den mickerigen Staubblüten botanisch gesehen das männliche. Dass Pflanzen sich sexuell vermehren, galt übrigens in den folgenden Jahren, in einem Zeitalter der Prüderie und des Puritanismus, als ein eher delikates Thema. Botanik galt als risqué, als eine »schlüpfrige« Wissenschaft, nicht geeignet als Studienfach für Töchter aus gutem Haus. Noch 100 Jahre später gab es einige Gelehrte, die an der moralischen Integrität des Linnaeus zweifelten. Es sei eine Unverschämtheit zu behaupten, die Blüten seien Hochzeitsbetten für männliche und weibliche Pflanzengeschlechtsorgane. Eine derartige Unzucht, dass mehrere männliche Staubblüten mit einer weiblichen Narbe kopulierten, hätte der Schöpfer bestimmt niemals erlaubt.
Die Frage blieb, ob an der Geschlechterbestimmung der Nachkommen mithilfe des Bingelkrauts etwas dran sein könnte. Der Dresdener Naturheilmittelhersteller und Botaniker Gerhard Madaus (1890–1942) prüfte das im Labor mit Mäusen nach. Eine Gruppe von Mäusen erhielt weibliche Pflanzen, die andere männliche. Das Ergebnis: Bei rund 50 Prozent der Fälle trat die gewünschte Wirkung ein. Beim Würfeln hätte man das gleiche Ergebnis erzielt (Madaus III 1979: 1894).

Von den beiden knolligen Fruchtkapseln hat das Waldbingelkraut wohl seinen Namen: Bungo/Bunge steht althochdeutsch für »Knolle, Knoten«.

Das Bingelkraut ist zweihäusig, das heißt, es gibt nur rein männliche und rein weibliche Pflanzen. Die Bestäubung erfolgt durch den Wind.
Weitere Benennungen des Waldbingelkrauts sind Mukenkraut oder Päddekraut. Muke und Pädde bedeuten in der westfälischen und rheinischen Mundart »Kröte«. Nicht nur weil die Pflanze gerne an feuchten, von Lurchen bewohnten Orten wächst, sondern weil die Kröte einst bei den Kelten ein verehrtes Symbol der Gebärmutter war. Erst die Kirche kehrte die Symbolik um und machte das Tier zum Träger sündhafter Begehrlichkeit und anderer teuflischer Eigenschaften. Wie die Kröte ist der weibliche Uterus schleimig, kann sich aufblähen und wieder zusammenziehen. Die »Kröte« in der Frau kann »hin- und herwandern«, »aufsteigen« und gelegentlich auch beißen. In früheren Zeiten opferte oder fütterte man deshalb Kröten, um Missgeburt oder Unfruchtbarkeit zu verhindern sowie eine problemlose Schwangerschaft und Entbindung zu ermöglichen (Storl 2009: 60). Wenn eine Pflanze, wie in diesem Fall das Bingelkraut, mit Kröten assoziiert wird, dann deutet das auf ihre Anwendung als Frauenkraut hin.
Nicht nur mit Kröten wird das Bingelkraut in Verbindung gebracht, sondern auch mit Schlangen und mit Hunden. Schlangechrut heißt es in Teilen der Schweiz; adder’s meat, snakes’s spit oder (in East Sussex) snake-weed, in Dänemark ist es die snogeblomst (Schlangenblume) oder die snogeurt (Schlangenwurzel). Diese Namen haben wahrscheinlich weniger mit dem Aufenthalt der Reptilien in den Waldbingelkraut-Horsten zu tun denn als Hinweis auf die Giftigkeit der Pflanze. Hundskraut, Hundsmelde, Hundskohl, englisch dog’s cole, französisch chou de chien (Hundekohl) sind weitere Benennungen, die infrage kommen. Als Hundepflanzen bezeichnet der Volksmund minderwertige oder unbekömmliche Pflanzen – solche, die einen sozusagen auf den Hund kommen lassen.
Ein weiterer Name des kleinen Wolfsmilchgewächses ist Waldmannen. Im Mittelalter nahm man an, dass das Waldbingelkraut an sich männlich beziehungsweise ein Mann ist; dagegen sei das Einjährige Bingelkraut, das auf den Äckern und in Gärten wächst, seine Frau. Ähnlich dachte man damals, dass die Brennnessel und die sanfte Taubnessel als Mann und Weib vermählt seien.
Weitere mundartliche Benennungen sind Diebskraut, da Merkur der Gott und Beschützer der Diebe ist, Scheißkraut wegen seiner abführenden Wirkung, und Platzkraut oder Barstkraut wegen seiner Giftigkeit.
Der gewöhnliche englische Name für das ausdauernde Bingelkraut ist dog’s mercury (»Hunde-Quecksilber«) und der französische ist mercuriale vivace (»lebendiges Quecksilber«).
Mit dem Kraut des göttlichen Schamanen Merkur ließ sich auch gut zaubern. In Frankreich (Lozère) wurde gegen Behexung Bingelkraut an die Wände des Schweinestalls gehängt.
Bingelkrautsalbe sollte feuerfest machen. Der Kräutermann und Mediziner der Renaissance, Tabernaemontanus, schreibt: »Wenn man sich die Hände mit Bingelkrautsaft einreibt, kann man bedenkenlos in geschmolzenes Blei greifen.« Ich würde das auf keinen Fall wagen.
Die Fähigkeit, die Hände in kochendes Wasser zu tauchen oder glühende Kohlen aus dem Feuer zu holen, gilt fast überall auf der Welt als Prüfung des echten Schamanentums, und überall gibt es irgendwelchen magischen Pflanzensaft, der das bewirken soll.25 Vielleicht haben wir es bei der Aussage des Tabernaemontanus mit einer Reminiszenz alteuropäischer, fast vergessener schamanischer Praktiken zu tun.
Auch als Hexenkraut spielte das Bingelkraut eine Rolle. Ein altes Hexensalbenrezept verlangt das Sammeln von verschiedenen Kräutern an verschiedenen Wochentagen. So sollen am Sonntag mit der Sonne verbundene Pflanzen gesammelt werden, wie Wegwarte oder Ringelblume. Montags sind lunare Pflanzen wie die Mondraute (Botrychium) an der Reihe, am Dienstag sammelt die Hexe das Eisenkraut, das unter der Herrschaft des Mars steht. Am Mittwoch, dem Tag des Merkur, ist das Waldbingelkraut an der Reihe. Donnerstags erfolgt das Sammeln des Jupiterbartes (Dachwurz, Sempervivum) und freitags sind es die Venuskräuter, wie etwa der Frauenhaarfarn.
Extra
Pflanzliches Quecksilber

Quecksilber galt bis ins 18. Jahrhundert als Allheilmittel gegen vielerlei Krankheiten, insbesondere gegen die aus Amerika eingeschleppte Syphilis.
Der Name der Gattung, Mercurialis, war schon den Römern bekannt und scheint eine entlehnte Übertragung aus dem Griechischen Hermou poa (»Gras des Hermes«) oder Hermou botané (»Futterkraut des Hermes«) zu sein. Hermes war ja der griechische Götterbote, der kosmische Schalk, der alle Grenzen überschreitende Schamanengott. Als solcher war er der Herr der Händler, der Ärzte und der Diebe, denn diese setzen sich über Landesgrenzen, Körpergrenzen und Anstandsgrenzen hinweg. Sein Metall ist das ewig bewegliche, kaum zu fassende Quecksilber, das sich jedem Widerstand anpasst, diesen links oder rechts umfließt.
Die Römer kannten Hermes unter dem Namen Merkur. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere (23–79 n. u. Z.) mutmaßt, man habe die Pflanze Herba mercurialis genannt, weil der Gott mit den geflügelten Schuhen ihre Heilkraft entdeckt hätte. Einige Sprachwissenschaftler vermuten dagegen, der klassische Name der Pflanze, Mercurialis testiculata, beziehe sich auf die frühen Darstellungen des Gottes als säulenförmige Herme, die nur Gesicht und Geschlechtsorgane (Penis und Testikel) plastisch abbilden. Genauso stelle das Waldbingelkraut seine Testikel offen zur Schau (Genaust 2005: 381).
Das mag alles stimmen, aber die Pflanze rückte erst richtig ins Bewusstsein der Menschen, als die schreckliche Lustseuche, die Syphilis, von Kolumbus aus Amerika eingeschleppt und in Europa pandemisch wurde. Da schienen keine der traditionellen Kräuter zu helfen. Die karibischen Indianer kannten zwar eine Kur dafür, basierend auf Diät, »blutreinigenden« Heilpflanzen wie dem Pockenholzbaum (Guajacum) oder der Stechwinde (Sarsaparilla) und vor allem täglichen, besonders heißen Schwitzbädern. Diese sechswöchige Kur war zwar wirksam, für die Europäer aber recht fremd und sie wurde falsch angewendet. Da nichts anderes zu helfen schien, auch nicht die Fürbitte der Heiligen, besann man sich auf die »sarazenische Salbe«, welche die Kreuzritter im Morgenland kennengelernt hatten und die bei Krätze und Hautparasiten Anwendung fand. Die Salbe war hochgiftig; sie enthielt vor allem Quecksilber (Mercurius), Wolfsmilch (Euphorbia), die sonst zum Blasenziehen verwendet wurde, und den Scharfen Rittersporn (Delphinium staphisagria), der zum Vergiften von Läusen und anderem Ungeziefer diente. Auch wenn die Patienten sich akute Vergiftungen zuzogen, schien die Salbe das einzige Mittel zu sein, das, auf das syphilitische Geschwür aufgetragen, wirklich und sofort half. Wenn dann nach dem Einschmieren mit der Salbe die Quecksilbervergiftung einsetzte, ging es den Kranken sehr schlecht. Sie litten unter unaufhörlichem Speichelfluss, schwitzten, zitterten, bekamen chronischen Durchfall und Darmkoliken, die Haut wurde gelb, die Haare fielen büschelweise aus und die Zähne wurden locker. Die Mediziner interpretierten diese Reaktionen als notwendige Vorbedingung der Heilung. Die schlechten Humore, die verdorbenen Körpersäfte, das Gift der Syphilis, würde auf diese Weise herausgegeifert und herausgeschwitzt. Es war der heroische Kampf gegen die Krankheit. Die Neue Medizin war eine »heroische Medizin«. Quecksilber (Mercurius dulcis, Kalomel) galt als die Wunderdroge der Zeit. Wie später das Penicillin, wurde es für fast alles verschrieben. Noch im 18. Jahrhundert kam es nicht nur gegen die Lustseuche zum Einsatz, sondern auch gegen Asthma, Gicht, Krebs, Gelbsucht, Kopfschmerzen, Pocken, Verdauungsstörungen, Schnupfen und vieles mehr. Sogar Säuglingen wurde es verschrieben (Storl 2015: 217ff).

Bettwanzen, Läuse und anderes Ungeziefer plagten die Menschen durch alle Jahrhunderte. Quecksilber und die »Sarazenische Salbe« sollten dagegen helfen.
In diesem Zusammenhang erinnerte man sich an das Waldbingelkraut. Mercurialis perennis galt noch mehr als das Einjährige Bingelkraut (Mercurialis annua) als vegetabiles Quecksilber. Es musste aber frisch verwendet werden, denn getrocknet verliert es seine Wirksamkeit. Wie sein mineralisches Gegenstück purgiert es die »schlechten Säfte«. Wegen der enthaltenen Saponine steigert es sogar die Wirkung der Quecksilberkuren. Andererseits wurde das Bingelkraut auch eingesetzt, um die drastische Wirkung des mineralischen Quecksilbers abzumildern.
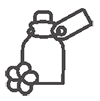
Abgesehen von der pränatalen Geschlechtsbestimmung der Kinder benutzte man das Bingelkraut seit der Antike als Frauenkraut. Die alten Meister, wie Hippokrates und Dioskurides, erwähnen die dem Merkur geweihte Pflanze als harntreibendes, abführendes Mittel; sie verschreiben es auch bei allen Frauenerkrankungen, insbesondere bei Menstruationsbeschwerden.
Nicholas Culpeper hätte Dog’s Mercury als Frauenkraut lieber unter die Herrschaft der Venus gestellt als unter die des Merkur, denn es sei – wie er schreibt – ein wirksames Medikament zur Anregung der Periode und zur Abtreibung des Mutterkuchens. Eine Abkochung der Blätter sei vor allem ein stark wirkendes Drastikum, das die groben, cholerischen, melancholischen und wässrigen Humore purgiere beziehungsweise austreibe. Es überwinde Blockierungen von Nieren und Blase. Eine Suppe mit Hahnenfleisch und den grünen Blättern, sei – so Culpeper – ein sicheres Mittel bei Wechselfieber (the hot fits of agues); sie reinige auch den Schleim (phlegma) von Brust und Lunge. Der frische Saft oder das destillierte Wasser desselben reinige, durch die Nase gezogen, den Kopf und die Augen von Ausfluss. Äußerlich angewendet helfe es bei Warzen, Wucherungen, Verbrennungen und schlecht heilenden Wunden (Culpeper 1653: 117).
Ähnliche Heilanzeigen finden wir bei den »Vätern der Botanik« im 16. Jahrhundert:
...
Adam Lonicerus (1528–1586) schreibt, das Kraut »zeucht Choleram (Galle) und Phlegma (Schleim) heraus«, »mit Honig in die Mutter (Vagina) getan, bringt es den Frauen ihre Zeit.«
...
Die Volksmedizin kannte das Bingelkraut als Laxans. Als Gemüse gekocht, ist es bekömmlich und macht einen sanften Stuhlgang. Die Schärfe verschwindet beim Kochen.26
Ansonsten wird die schwach giftige Pflanze therapeutisch frisch verwendet. Sie verliert ihre Wirksamkeit beim Trocknen. Die getrockneten Blätter verfärben sich leicht blau – eine Tatsache, die für die mittelalterlichen Alchemisten interessant war. Sie versuchten, mit der Pflanze, die dem Gott des Wandels und der Transformation, dem Merkur, geweiht war, Silber in Gold zu verwandeln.

(Aruncus dioicus; A. sylvestris)
WILDSPARGEL FÜR WALDMENSCHEN
Blütenrispen,
wie Sommerwolken cremig-weiß,
für Bienen, Falter, Fliegen
wohl ein Paradeis.
WOLF-DIETER STORL
In Süddeutschland und in den Alpenländern kennt man den Waldgeißbart gut, nördlich des Mains ist er fast nur als Gartenzierpflanze bekannt. Für schattige, kühle Standorte im Garten ist er ideal. Der Geißbart ist ein zweihäusiges Rosengewächs (Rosaceae), bei dem die männlichen Pflanzen getrennt von den weiblichen wachsen. Die prächtigen Blüten entfalten sich im Mittsommer, im Juni/Juli. Auf humusreichem, feuchtem Boden können sie bis zu zwei Meter hoch werden, wobei etwa ein Viertel davon die Blüten ausmachen. Die weibliche Pflanze bringt lockere, weißlich grüne Blütenstände hervor, während die männliche Infloreszenz dichter, üppiger und cremeweiß blüht.
Bei dieser attraktiven Pflanze handelt es sich um eine Staude, genauer um einen Hemikryptophyt (griechisch hemi = halb, kryptos = verborgen, phyton = Pflanze), das heißt, im Winter zieht sie sich in die Erde zurück, im Frühjahr treibt sie neu aus. Die zur Unterfamilie der Spiraeoideae gehörende Staude wächst auf der ganzen nördlichen Halbkugel, also von den Pyrenäen über das gemäßigte Eurasien hinaus bis nach Nordamerika, in Bergwäldern, Tannenwäldern, in schattigen Schluchten und an Bachufern.

Der Waldgeißbart ist, wie das Bingelkraut, zweihäusig: Weibliche Pflanzen bringen zarte, weißlich grüne Blüten hervor, männliche blühen üppig cremeweiß.
Die gegen Ende Mai bis Juli aus den Rispen hervorbrechende, weiß-gelbliche Blütenfülle erinnert an das verwandte Mädesüß (Filipendula ulmaria), nur ist sie noch buschiger und voller, sodass sie an einen weißen Ziegenbart denken lässt.
Schon im Frühmittelalter war die zweihäusige Pflanze als barba caprae, oder althochdeutsch cigenbart, also Ziegenbart, bekannt. Auch Waldbart und Bockswedel nannte man sie. In England kannte man sie ebenfalls als buck’s beard oder goat’s beard; in Frankreich als barbe de chèvre, in Italien als barba di capra, was ebenfalls Ziegenbart bedeutet. Auch die Osteuropäer erkannten in der Pflanze einen Ziegenbart, für die Rumänen ist es jedoch ein Pfaffenbart (barba-popei). Als Fuchsschwoaf (Fuchsschwanz) kennt man die Staude in Teilen Österreichs. Da sie im Frühsommer blüht, nannte man sie Pfingstwedel oder auch Johanniswedel. Bride’s feathers, Federn der Braut, nennt man sie in Nordamerika.

Die oberirdischen Pflanzenteile sterben im Winter ab, und im Frühjahr treiben kräftige junge Triebe aus dem ausdauernden Wurzelstock.
Der Blütenstand, der bis zu 10 000 Einzelblüten enthalten kann, ist ein Tummelplatz für Insekten, insbesondere Bienen, die sich vor allem an den Pollen laben, da die Blüten kaum Nektar hervorbringen. Der Volksmund nennt die Pflanze deswegen auch Immekraut (Bayerisches Schwaben), Bienlikraut (Baden) oder Imbelichrut (Aargau).
Imker benutzen das Kraut ähnlich wie das blühende Mädesüß zum Ausreiben der Bienenstöcke, ehe ein neuer Schwarm hineinkommt. Weidsiech-Chrut nennen die Bauern den Geißbart im St. Galler Land wegen der Verwendung gegen Viehkrankheiten.
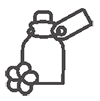
Der Geißbart gehört nicht zu den großen Heilern. In St. Gallen nannte man die Pflanze Brandchrut (Brandkraut), anderswo Brandwurzen, und verwendete eine Abkochung des Wurzelstocks gegen »innere Hitze« – was immer das ist? Zum Waschen von Entzündungen und »hitzigen Geschwülsten« fand es ebenfalls Verwendung.
Die amerikanischen Ureinwohner, insbesondere die Stämme, die an der pazifischen Nordwestküste leben – das sind die Indianer, die für ihre aus Baumstämmen geschnitzten, bunten Totempfähle und ihre verschwenderischen Potlatch-Feste bekannt sind –, benutzten die »Federn der Braut« häufig in ihrer Heilkunde. Die Nlaka’pamux (Thompkins-Indianer) in Vancouver brauten aus den gewaschenen Wurzeln einen Tee gegen Influenza, Erkältung, »innere Wunden« und Bauchweh. Man sollte aber nicht zu viel davon trinken, denn dann würde man noch kränker. Sie kochten auch eine Salbe aus Fett und der zu Asche verbrannten Geißbartstängel zum Einreiben bei Geschwülsten und Lähmungen. Ihre Nachbarn, die Bella-Coola, kannten einen harntreibenden Tee aus der Wurzel zur Behandlung von Tripper und Magenschmerzen. Gegen Blattern kochten sie eine Salbe aus den Wurzeln und dem Fett der Bergziegen (Moerman 1999: 104). Das sind nur einige der von diesen Indianern praktizierten Anwendungen, die uns recht fremd sind. Es handelt sich dabei um die praktischen Erfahrungen dieser Eingeborenen und nicht nur um Aberglauben oder Placebo-Wirkungen. Es wäre ein lohnendes Arbeitsgebiet für Ethnomediziner, diese Heilanzeigen genauer zu erforschen.

Wo der Geißbart häufig vorkommt, hat man die Frühjahrstriebe (im April und Mai) geerntet und als Wildspargel gegessen. Roh darf man sie nicht verspeisen, sondern nur gekocht, denn sie enthalten in geringen Mengen ein Blausäureglykosid.
Wo die hübsche Pflanze selten ist, sollte man sie unbedingt schonen. Aber im Gebirge, wo man sie häufig antrifft, kann man im Frühling die Triebe sammeln und ein wunderbares Spargelgemüse daraus machen. In Tirol kennt man die Pflanze unter dem Namen »Wildspargel«. Die dicken, saftigen Stängel werden knapp unter der Oberfläche geschnitten, ehe sich die Blätter entfalten. Selbstverständlich lässt man immer einige stehen, damit die Pflanze fürs nächste Jahr wieder Kraft schöpfen kann.
Im späteren Stadium enthält die ganze Pflanze, wie so viele der Rosengewächse, mehr von dem giftigen Blausäureglykosid. Dieses ist aber wasserlöslich und verdampft beim Kochen (Machatschek 1999: 88).

(Galium odoratum; Asperula odorata)
DIE BLUME DES WONNEMONATS
Weiß und grün ist mein Strauß,
hübsch bescheiden sieht er aus.
Frisch vom Wald kommt er herein.
Rieche nur, er duftet fein!
Nimm! Vom Frühling ist‘s ein Stück.
Er bringt dir, Mutter, lauter Glück.
JOSEF GUGGENMOS, ALLGÄUER DICHTER,
»MIT EINEM STRAUSS WALDMEISTER«
Der Waldmeister ist eine hübsche, krautige Pflanze, die vor allem in Buchenwäldern, gelegentlich aber auch in Eichen- und Hainbuchenwäldern zu Hause ist. Sie treibt ihre Blätter, noch ehe die Bäume ihr Laub voll entfalten, und wenn dann im April und Mai der Bärlauch gerade verblüht ist, öffnet sie ihre kleinen, weißen, wohlriechenden, sternförmigen Trichterblüten, die von verschiedenen Fliegenarten bestäubt werden. Die Blätter haben eine lebensfrische, hellgrüne, für das Auge schön anzusehende Farbe. Jeweils sechs bis acht Blätter sitzen in Quirlen rund um den vierkantigen Stängel; sie bilden das Futter für die Raupen verschiedener Arten des Labkraut-Blattspanners. Die mehrjährige Pflanze bleibt unter dem Schutz der Schneedecke auch im Winter grün. Das Kräutlein vermehrt sich mittels hakenborstiger Samen, die am Fell von Hasen, Füchsen und anderen Tieren hängen bleiben, und durch Wurzelsprösslinge unter der Erdoberfläche.

Nach dem Verblühen entwickeln sich Fruchtknoten mit kräftigen Borsten, die sich am Fell vorbeistreifender Tiere einhängen.
Der Waldmeister ist in Mitteleuropa häufig anzutreffen, kommt aber auch in Nord- und Osteuropa vor. In den Wäldern Nordamerikas ist er ein erfolgreicher Neophyt.
Wie man schon an den Blattquirlen erkennen kann, gehört die Art zur Gattung der Labkrautgewächse (Galium), deren Blüten meistens angenehm duften. Der Waldmeister wird zu Recht Duftlabkraut oder Wohlriechendes Labkraut genannt. Odorata, »wohlriechend«, ist sein spezifischer lateinischer Name. Die Franzosen kennen ihn wegen seines anmutigen Dufts auch als muguet des bois, »Maiglöckchen des Waldes«.
Zu den nahen Verwandten des lieblichen Kräutleins gehören wichtige Heilpflanzen:

Auch das eng verwandte Klebkraut bedient sich mit seinen Klettfrüchten dieser Ausbreitungsmethode.
Die Labkräuter gehören allesamt zu den Rötegewächsen (Rubiaceae). Die Wurzeln vieler Arten dieser illustren Familie, wie etwa auch des Wiesenlabkrauts (Galium mullugo), eignen sich wunderbar zum Rotfärben von Textilien. Der nah verwandte Krapp (Rubra tinctora) zum Beispiel, das »Türkisch Rot«, wurde im 18. und 19. Jahrhundert feldmäßig angebaut, um die Militäruniformen – die roten Röcke der Briten, die roten Hosen der Franzosen – scharlachrot zu färben. Das sollte die Kampfmoral stärken, da in der Hitze des Gefechts das Blut der Verwundeten nicht so auffiel.
Weitere Rötegewächse sind der Kaffee ebenso wie die fiebersenkende, krampflösende, Malaria-Plasmodien hemmende Chinarinde, die den europäischen Kolonialisten half, die Tropen zu erobern, die Brechwurzel Ipecacuanha (aus der Sprache der Tupi-Indianer: »Pflanze am Wegrand, die einen kotzen lässt«) und die Katzenkralle (Uncaria tomentosum), die immunmodulierend wirkt und in der Alternativmedizin bei Borreliose eingesetzt wird.

An geeigneten Standorten vor allem in Rot- und Hainbuchenwäldern kann der Waldmeister große Teppiche bilden.
Extra
Liebfrauenbettstroh

Das Echte Labkraut duftet durch seinen Kumaringehalt ähnlich dem Waldmeister. Es wurde früher als pflanzlicher Labersatz zur Käseherstellung benutzt.
Nach der Geburt sind die Wöchnerin und ihr kleines Kindlein schutzbedürftig. Sie sind anfällig für krank machende Geister sowie für ungute Gedanken wie etwa Neid oder Missgunst. Um die Frau und ihr zartes Neugeborenes davor zu schützen, gab es bei den germanischen Stämmen einen besonderen Brauch: Man bettete Mutter und Kind auf duftende Kräuter, die der Frauengöttin Freya28 geweiht waren. Zu diesen heilsamen, aromatischen Kräutern, die man »Freyas Bettstroh« nannte, gehörten das Echte Labkraut, das Wiesenlabkraut, Quendel, Dost, Kümmelkraut, Kamille, Beifuß, Johanniskraut, der Waldmeister und die beiden nach Waldmeister duftenden Gräser, das Mariengras (Hierocloe odorata) und das Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), das dem Heu seinen herrlichen Wohlgeruch verleiht.
Man glaubte, es sei ein Erkennungsmerkmal der Dämonen, dass sie stinken; wohlwollende Geister erkenne man jedoch an ihrem guten Duft. Mit den Kräutern schaffte man also eine heilsame atmosphärische Hülle, in die die üblen Wesen nicht eindringen können. Heute würden wir sagen, die Duftstoffe (Terpene) schaffen eine keim- und pilzhemmende Aura; zudem wirken sie, über das limbische System, einem phylogenetisch sehr alten Teil des Gehirns, beruhigend, also sedativ, entspannend und antidepressiv.
Die christlichen Missionare zur Zeit des heiligen Bonifatius, des sogenannten »Apostels der Deutschen« im 7./8. Jahrhundert, waren von diesem heidnischen Brauch wenig begeistert, zumal er der heidnischen Abgöttin Freya geweiht war. Egal aber, was den Neubekehrten gepredigt wurde, die Weisen Frauen und Hebammen hielten an dem Brauch fest, da sie wussten, wie wohltuend er war. Es blieb der Kirche nichts anderes übrig, als klein beizugeben und die Bettstrohkräuter statt der Göttin Freya der Muttergottes, der Heiligen Jungfrau, zu weihen. Dazu wurde die nette Legende erfunden, die Duftkräuter hätten in der Krippe im Stall zu Bethlehem gelegen, Ochs und Esel hätten sie aus Rücksicht auf das Neugeborene jedoch nicht gefressen. Da legte Maria das Jesuskindlein auf dieses »Stroh«.

Die zarten Blütenwolken des Wiesenlabkrauts finden sich von Mai bis Juli auf eher feuchten Wiesen mit nährstoffreichem Boden.
Im deutschen Sprachraum bezeichnet man vor allem das Echte Labkraut als Liebfrauenbettstroh. In Holland und England nennt man aber auch den Waldmeister so. In den Niederlanden ist er als lieve-vrouwe-bedstro bekannt, in England als Mary’s bedstraw. Eine holländische Legende erzählt, dass der Waldmeister das erste Mal anfing, weiß zu erblühen, als Maria das Christkindlein in Ermangelung einer anderen weichen Unterlage auf ein großes Büschel Waldmeisterkraut in die Krippe legte.
_______
DUFTKISSEN
_______
Ein beruhigendes, wunderbar duftendes Kissen verschafft gestressten Menschen einen entspannten Schlaf: Einfach in einen kleinen Kissenbezug einige der getrockneten Kräuter füllen.
Beim Waldmeister denkt man wahrscheinlich zuallererst an die Waldmeisterbowle, auch Maiwein oder Maibowle genannt. Seit langem war es Brauch, ein angewelktes Sträußchen des blühenden Maikrauts in den Wein zu tun, um den Wonnemonat würdig zu feiern. Der Brauch ist uralt.
...
Schon im Jahr 854 n. u. Z. schrieb Wandelbertus, ein Mönch in der Benediktinerabtei in Prün: »Schütte perlenden Wein auf das Waldmeisterlein.«
...

Schon seit dem Neolithikum haben Menschen grüne Bäume aus dem Wald geholt und als Maibäume aufgestellt, um die Fruchtbarkeit zu feiern.
Dieser Maitrunk sollte den Mönchen zur Stärkung von Herz und Leber dienen. Die Anwendung der Maiblume zur Steigerung der Lebensfreude wurde nicht von den braven Mönchen erfunden, sondern es scheint schon lange Teil der fröhlichen Frühlingsfeste der alten Heiden gewesen zu sein.
Auf jeden Fall ist bekannt, dass die Wikinger ihrem Bier und Met dieses duftende Kraut zusetzten. Ob die Nordmänner den Waldmeister an ihren Helmen trugen, um ihren Mut zu stärken, wie manche Romantiker behaupten, sei dahingestellt.
Seit der Jungsteinzeit feierten die Ureinwohner unseres Erdteils beim Maivollmond ein orgiastisches Fest, das durch mystische Partizipation die Fruchtbarkeit der Äcker, Pflanzen, Tiere und Menschen steigern sollte. Da zelebrierte man die Hochzeit des »Blumenmädchens«, der Tochter der Mutter Erde, mit dem strahlenden jungen Sonnengott, dem Sohn des Himmels. Die jungen Burschen holten eine Birke – in den Alpenregionen eine Fichte – aus dem Wald, schälten sie und stellten sie als Symbol für den Phallus auf. An der Spitze durchstieß der Pfahl einen mit roten Bändern umwundenen Blütenkranz. Man tanzte Reigen um diesen »Maibaum« und die jungen Leute gingen in den Wald, um die Fruchtbarkeit zu feiern. Es ist ein ureuropäisches Fest, an dem auch die Kirche, obwohl ihr dieses Treiben ganz und gar nicht gefiel, nicht rütteln konnte (Storl 2020b: 157). Dabei spielte der Waldmeistertrunk sicherlich eine Rolle, denn er entspannt und wirkt aphrodisisch.
Herzensfreund, in Bern Herfreundeli, sind weitere Benennungen der magischen Pflanze. Der gelehrte Kräutermann und Arzt Jacobus Theodorus Tabernaemontanus (um 1522–1590) schreibt in seinem Neuw Kreuterbuch, dass der Waldmeister das »Herz stärken und erfreuen« würde. Dazu muss man wissen, dass in früheren Zeiten mit »Herz« nicht der Muskel gemeint war, sondern unsere Wesensmitte, der Ort im menschlichen Mikrokosmos, in dem der göttliche Funke, der Heiland, zu Hause ist, wo auch Lebensmut (Courage, aus dem französischen coeur = »Herz«), Lebensfreude und Liebe ihren Sitz haben. Es sind diese Eigenschaften, die der Genuss des Waldmeisterweins hervorrufen soll.
Man glaubte damals auch, dass der Waldmeistertrank die Leber, den Sitz des Lebens, stärke. Wie das Herz, so sah man auch die Leber anders, als man es heutzutage tut. Im menschlichen Mikrokosmos wird dieses Organ von dem Planetenkönig Jupiter beherrscht. Und dieser joviale Gott, der uns Süßigkeiten, Öle (Olivenöl) und vergorene Säfte (Wein) schenkt, vermittelt Geselligkeit, Heiterkeit und Frohsinn. In diesem Sinn ist der Waldmeister auch das Leberkraut, das Sternleberkraut oder im Niederländischen Leverkruid (Leberkraut).
...
Über den Herzfreund und das Leberkraut, wie er es nannte, schrieb Hieronymus Bock (1498–1554), einer der »Väter der Botanik«, in seinem New Kreütter Buch: »... diß kreutlein mit seiner blüet pfleget man in wein zulegen und darüber zutrinken vermeinen also ein fröligkeit und gesunde Leber davon zu erlangen.«
...
Die damalige Botanik würde die Pflanze unter die Herrschaft der Sonne oder des Jupiters stellen, aber der Kräuterarzt Nicholas Culpeper zählt sweet woodruff27 zu den Kräutern der Venus, denn »es stärkt die Organe, die ihr gehören«. Diese Organe wären die Nieren, Harn- und Fortpflanzungsorgane.
Weitere Namen des Rötegewächses sind Waldmeier, Waldelfenkraut, Waldmännlein und Waldmutterkraut, französisch reine des bois (Königin des Waldes). Im plattdeutschen Land heißt das Kraut Möösch, Meusch, Meesk oder Möske, Namen, die sich möglicherweise auf den starken Duftstoff Moschus zurückführen lassen. Gliedekraut hieß die Pflanze in Schlesien. Zehrkraut war ein weiterer Name, da sie gegen »Auszehrung« eingesetzt wurde. Der Name Tabakkraut deutet darauf hin, dass der Pfeifentabak mit dem Kräutlein aromatisiert wurde. Die Bezeichnung Guggerblume im schweizerischen Aargau weist darauf hin, dass sie im Frühling blüht, wenn der Gugger (Kuckuck) ruft.
Eine holländische Legende erzählt, dass die Gottesmutter Maria nach der Entbindung nicht schlafen konnte. Da ging ihre Mutter, die heilige Anna, in den Wald, pflückte Waldmeister und füllte ihn in einen Stoffbeutel, den sie ihrer Tochter unter das Kopfkissen legte. Danach konnten die Muttergottes und ihr Kindlein gut schlafen.
Möglicherweise deutet die Geschichte darauf hin, dass dieser volksmedizinische Brauch sehr alt ist. Volkskundler wissen, dass Anna, die Mutter Marias, im Mittelalter an die Stelle trat, die vorher der Frau Holle gehörte. Die Holle, die »Großmutter«, die alle Seelen hütet und deren Reich sich unter der Erde befindet, lässt sich bis ins Paläolithikum zurückverfolgen, wie Kulturanthropologen ermitteln konnten. Sie ist die Herrin der Heilpflanzen und der weisen Frauen.
Überhaupt hat sich die Kirche mit dem Heidenkräutlein gut ausgesöhnt. Im Mittelalter war es in England üblich, am Tag des heiligen Barnabas (11. Juni), dem Wegbegleiter des Paulus, und am Tag des heiligen Petrus (29. Juni) die Kirchen mit Sträußen aus Waldmeister, Buchs, Rosen und Lavendel zu schmücken. Am Barnabastag pflegen manche diesen Brauch bis heute.
Extra
Kumarin

Tonkabohnen kommen aus Südamerika und tauchen erst seit kurzer Zeit wieder vermehrt in unseren Küchen auf – gern als Ersatz für die teuren Vanilleschoten.
Kumarin, auch Cumarin, ist ein Wort aus der Sprache der südamerikanischen Tupi-Indianer für den Tonkabohnenbaum (Dypterix odorata). Die indigenen Völker in Südamerika verehrten den Baum als Symbol des Wohlstandes und der Gesundheit. Sie setzten die Tonkabohnen als Mittel gegen Asthma, Krämpfe aller Art, Ohrenweh, Husten und andere Beschwerden ein. Der Duft der Bohnen – man trug sie gerne aufgefädelt als Halsband – galt als beruhigend und erotisierend. Die Spanier und Portugiesen übernahmen die Bohne nicht nur als Gewürz für Speisen, Rauchtabak und alkoholische Getränke, sie trugen gerne eine Bohne in ihrer Geldbörse, damit »ihnen das Geld nie ausgehe«. In Venezuela galten Tonkabohnen eine Zeit lang sogar als Zahlungsmittel. Alexander von Humboldt, der im frühen 19. Jahrhundert Lateinamerika erforschte, bemerkte, wie herrlich die Wäsche der Leute dort roch. Dafür war das Kumarin verantwortlich.
Der Duft bezauberte die Europäer, angefangen bei den Franzosen. Kumarin würzte Kekse, Kuchen, Creme brûlée, Pralinen, Sahneeis, Tabak, Rum, Gin Tonic und andere Alkoholika. Und dann kam der Schock! Laboruntersuchungen in den 1980er-Jahren mit Hunden, Ratten und Mäusen hätten ergeben, dass Kumarin leberschädigend und krebserregend sei. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die sensationslüsternen Medien – in einer Zeit, als Kräutermedizin und Phytotherapie sowieso eine schlechte Presse hatten. Traditionell verwendete Heilkräuter, die etwa Pyrrolizidine oder Kumarine enthielten, und Kräuterfrauen wie Maria Treben gerieten in die Schusslinie. Sogar Kamillentee wurde infrage gestellt; er könne tödlich sein, indem er bei Menschen mit Korbblütlerallergie einen anaphylaktischen Schock auslöse. Anstatt fragwürdige Kräuter und Naturmittel zu nehmen, hieß es, solle man lieber auf sichere, standardisierte pharmazeutische Produkte zurückgreifen (Schlebusch et al. 1989). Patienten, Ärzte und Apotheker waren verunsichert. Es dauerte nicht lange, da wurde gegen Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre schrittweise die medizinische Anwendung nicht nur der Tonkabohne, sondern auch des Waldmeisters verboten. Waldmeisterbowle, Waldmeisterbrause, Waldmeistertee, Waldmeistersorbet und den von Kindern geliebten grünen Wackelpudding durfte es nicht mehr geben.
Rudolf Fritz Weiß war einer der Ersten, der Einwand erhob. Die Untersuchungen seien schlecht durchgeführt worden, sie seien nach wissenschaftlichen Kriterien nicht seriös. Versuche an Kaninchen, mit hundertfacher therapeutischer Menge, hätten absolut keine bedenklichen Ergebnisse erbracht. Dass Kumarin, beziehungsweise der Waldmeister, in angemessener Dosierung hepatotoxisch oder karzinogen wirke, wurde inzwischen eindeutig widerlegt. Universitätsprofessor Dr. med. Rudolf Fritz Weiß ist kein Leichtgewicht, er gehörte auch der Kommission E an, einer Sachkommission, die es sich zur Aufgabe machte, traditionelle Heilpflanzen nach wissenschaftlichen Kriterien zu untersuchen.

Das Duftende Mariengras kann man gut in Kübeln kultivieren. Ausgepflanzt wird es leicht von durchsetzungsfähigeren Pflanzen verdrängt.
Im Jahr 2006 entdeckte man, dass der Zimt, der seinen Weg in Weihnachtskekse und Glühwein findet, mehr Kumarin enthält als die berüchtigte Tonkabohne und auf jeden Fall viel mehr als der Waldmeister. Da war der Hype vorbei. Waldmeisterbowle durfte wieder getrunken, aber aus irgendeinem Grund nicht in Gaststätten serviert werden. Die gute alte, viel geliebte Waldmeister- und Himbeerbrause blieb dennoch auf der Strecke, weil Coke, Fanta und Sprite – sie gehören zum internationalen Coca-Cola-Konzern – wie auch Pepsi die Marktlücke inzwischen erfolgreich besetzen konnten. Damit verschwand ein Stück mitteleuropäischer Kultur.
Kumarin ist ein natürlicher Aromastoff, der vielfach in der Natur vorkommt. Wegen des Kumarins im Ruchgras duftet das Bergheu besonders gut und intensiv. Auch der Wohlgeruch des »heiligen Grases« (sweet grass, Duftendes Mariengras, in Island Freyagras), das in indianischen Räucherzeremonien eine wichtige Rolle spielt, beruht auf diesem Stoff. Verschiedene Labkräuter und Schmetterlingsblütler, etwa der Steinklee, den man Bettlägerigen gerne in beruhigende, stimmungshebende Duftkissen stopft, enthalten diese Verbindung ebenfalls. In geringen Mengen ist sie auch in einheimischen Pflanzen wie Brombeeren, Erdbeeren, Salbei, Dill und Kamille enthalten.
_______
DIE HEILWIRKUNG DER KUMARINE
_______
Seriöse pharmakologische Studien bestätigen inzwischen, dass Kumarine antiinflammatorisch, antioxidativ, antiallergisch, hepatoprotektiv, antithrombotisch, antiviral, antitumorös und immunmodulierend wirken.29
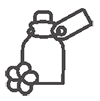
Selbstverständlich galt dieses magische, nach Heu duftende Kraut als wirkungsstarke Heilpflanze. Wie wir oben sahen, setzte man sie zur Herz- und Leberstärkung ein. Ihre medizinische Wirkung wird in modernen Kräuterbüchern als antiseptisch, blutreinigend, galle-, harn- und schweißtreibend, krampflösend, sedativ, tonisch, gefäßerweiternd, entzündungshemmend und wundheilend angegeben. Man liest, der Tee aus frischem oder getrocknetem Kraut oder auch der Kaltwasserauszug wirke beruhigend bei Leibschmerzen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Magen-Darm-Krämpfen, Angstzuständen und Herzklopfen. Beide Getränke werden bei Wassersucht (Hydrops) und Steinleiden (Lithiasis) empfohlen. Sie wirken gegen Steinbildung in den Nieren und im Harntrakt.
Waldmeister fördert die Durchblutung. Blutverdünnend wirkt er auf jeden Fall, denn das in ihm enthaltene Kumarin-Glykosid ist ein Vitamin-K-Antagonist. Auch der Steinklee (Melilotus) und das Ruchgras enthalten viel Kumarin; wenn Kühe zu viel davon fressen und sich verletzen, kann es vorkommen, dass sie verbluten. Wenn man blutverdünnende, gerinnungshemmende Medikamente einnimmt, sei man gewarnt. Dann sollte man auf die leckere Maibowle wie auch auf den Waldmeistertee verzichten.
Lange war man auch überzeugt, dass der Waldmeistertee das Leben verlängern könnte. Stanislaus Leszcynski (1677–1766), König von Polen, Großherzog von Litauen und Herzog von Lothringen, der als Philosoph und Mäzen der Kunst bekannt war, wurde für damalige Zeiten recht alt. Gefragt nach dem Geheimnis seines langen Lebens, verriet er, er verdanke Kraft und hohes Alter dem Tässchen Waldmeistertee, das er jeden Morgen trinke.
Eine holländische Legende erzählt von einem König, der lange leben wollte. Seine Ärzte gaben ihm daraufhin täglich Waldmeistertee. Sein Leibdiener trank heimlich davon, wurde erwischt und zum Tode verurteilt. Der kluge junge Mann sagte: »Wenn ich jung sterbe, werden die Ärzte dich auslachen.« Das genügte, um den offenbar ebenfalls klugen König zu überzeugen. Der junge Mann wurde begnadigt und beide wurden sehr alt.
In der Homöopathie werden die Asperula-Globuli nicht besonders häufig eingesetzt und sind eher schlecht dokumentiert. Sie gelten als gefäßerweiternd und entzündungshemmend, insbesondere bei Gebärmutterentzündung.

Die klassische Maibowle mit leicht angetrockneten Waldmeisterzweigen gibt einen Vorgeschmack auf den Kräutersegen des beginnenden Sommers.

Als Wildgemüse eignet sich die Pflanze überhaupt nicht. Die Blätter sind viel zu zäh und rau. Deswegen brachte Linnaeus dieses Rötegewächs in der Gattung der raublättrigen Meier-Gewächse unter, der Asperula. Asper ist das lateinische Wort für »rau, kratzend«. Erst später wurde es als ein Labkrautgewächs (Galium) klassifiziert.
Als Würze ist der Waldmeister jedoch sehr begehrt. Zuallererst kommt einem da die Maibowle in den Sinn, der lieblich schmeckende Maiwein. Es gibt viele Rezepte, aber das auf der gegenüberliegenden Seite aufgeschriebene ist wohl das bekannteste. Ein gutbürgerliches Rezept. Beim Genuss wird niemand ausrasten und die Kontrolle über sich verlieren.
In meinen wilden Jahren habe ich dem Wein jedoch ein ganz dickes Büschel Waldmeister zugefügt und auch sehr lange darin ziehen lassen. Der Rausch war berserkerhaft; als ich vor die Tür trat, war es, als schreite der Wald einige Meter auf mich zu. Da wurde mir klar, warum die Pflanze »Meister des Waldes« genannt wurde. Eigentlich hätte ich danach einen heftigen Kater mit brummenden Kopfschmerzen bekommen sollen – man liest ja, dass ein Zuviel das verursachen würde –, aber daran kann ich mich nicht erinnern.
Nicht nur als Bowle, sondern auch in anderen Getränken und in Süßspeisen war der Waldmeister ein beliebter Bestandteil der mitteleuropäischen Kultur. Bis in die 1970er-Jahre des letzten Jahrhunderts war unter Kindern die grüne Waldmeister-Brause beliebt. Die gab es vor allem bei den Familiensonntagsausflügen. Nach dem Wandern oder Radeln im Wald kehrte die Familie in einer Gaststätte ein. Da gab es Kuchen oder Bockwurst. Vielleicht bestellte sich die Mutter dazu eine Tasse Kaffee, der Vater ein Bier und die Kinder hatten die Wahl zwischen einer rote oder einer grünen Limonade. Die rote hatte Himbeergeschmack und die grüne Waldmeistergeschmack. Falls die Familie aus Berlin kam, dann war des Vaters Bier ebenfalls grün, es war die »Berliner Weiße«, ein durstlöschendes, säuerliches, obergäriges Weizenbier mit einem Schuss Waldmeister. Die französischen Besatzungstruppen unter Napoleon waren davon begeistert, sie nannten das Weißbier Champagne du Nord.
Grüner Wackelpudding mit Waldmeistergeschmack war damals bei den Kindern in Ost und West ebenfalls beliebt.
Ja, und dann wurde der Waldmeister plötzlich wegen des Kumaringehalts verboten. Das Kumarin-Glykosid wähnte man krebserregend und hepatotoxisch (leberschädigend).
Gourmetköche haben die frischen Waldmeisterspitzen zum Würzen einiger ihrer Kreationen entdeckt. Zum Beispiel für Spargelgerichte, die ja zur Blütezeit des Waldmeisters ebenfalls Saison haben. Auch manchen Salaten kann man Waldmeister als Würzkraut beigeben.
Ein weiterer Nutzen dieser Duftpflanze ist ihre Anwendung als Mottenmittel in den Wäscheschränken.
_______
MAIBOWLE
_______
Man sammle 12 bis 15 Stängel Waldmeister, der gerade aufgeblüht ist, lasse sie anwelken und hänge sie, zu einem Strauß gebunden, in 1 Liter trockenen Weißwein. 2 Stunden lang ziehen lassen, das Kräuterbüschel entfernen und 1 Flasche Sekt oder Mineralwasser in den Wein gießen. Man süßt die Bowle mit ungefähr 2 Esslöffel Zucker und gibt – wenn vorhanden – noch eine Handvoll frische Erdbeeren hinzu. Und fertig ist der Göttertrank.