

(Stachys sylvatica)
REINIGT DIE AURA
Mit seinen mattroten bis violetten, zygomorphen Blüten, gegenständigen Blättern und dem stark riechenden ätherischen Öl erweist sich der Waldziest als typischer Lippenblütler (Lamiaceae oder Labiatae). Und wie jeder ordentliche Lippenblütler hat der Waldziest vierkantige, hohle, aufrechte Stängel mit gegenüberstehenden, dunkelgrünen, weich behaarten, grob kerbig gesägten Blättern. Nicht jeder mag das Aroma, das den behaarten, brennnesselähnlichen Blättern entströmt; es duftet unangenehm muffig und wird mit dem Geruch von altem Pferdeschweiß, Ochsenharn oder Wanzen verglichen. Für mich ist das nicht so; mir ist der Duft eher angenehm; er hat etwas Wildes an sich.
Diese Waldpflanze hat viele illustre Verwandte – mehr als 300 Arten gehören zu dieser Gattung. Unter ihnen der an Feuchtstellen oder Wassergräben wachsende Sumpfziest (S. palustris), dessen Knollen man gut als Kochgemüse essen kann. Sehr bekannt ist der heute nur noch selten genutzte Heilziest (Stachys betonica oder auch Betonica officinalis), eine Heilpflanze, die in der Antike in hohen Ehren stand, die angeblich Schlangen vertreibt und, wie Hildegard glaubte, gegen trügerischen Liebeswahn schützt. Besonders wertvoll ist der Japanische Knollenziest (S. sieboldi), auch Chinesische Artischocke genannt, dessen Wurzelknollen an fette weiße Engerlinge oder an kleine »Michelin-Männlein« erinnern; sie sind ein Edelgemüse erster Klasse.55 Ich habe sie mir in den Garten gepflanzt. Auch die Wühlmäuse mögen sie und füllen ihre Vorratsnester damit. Das macht es mir einfach: Im Frühling plündere ich ihre Nester und brauche deswegen die Wurzeln nicht einzeln auszugraben.
Der Name Ziest ist kein altdeutsches Wort, wie manchmal behauptet wird, sondern kommt aus dem Slawischen bzw. vom sorbischen čist (tschechisch čistek) und bedeutet »rein«. Ziest gilt noch heute als Reinigungskraut, aber nicht, wie man öfter liest, als Blutreiniger, sondern, wie wir sehen werden, als reinigende Spülung nach der Niederkunft und vor allem als »Berufkraut«, mit dem man »Berufungen« (Verzauberungen) abwaschen kann. Der botanische Name Stachys – vom griechischen stachys = »Ähre« – bezieht sich auf die Scheinähren, die diese Gattung ausbildet. Das Wort wiederum entstammt dem indogermanischen *ste(n)gh (= Stechen). Und sylvatica bezieht sich auf den Wald (lateinisch silva), wo das Kräutlein zu Hause ist.
Wegen seinem unangenehmen Geruch nennt man den Ziest in ländlichen Regionen auch Stinknessel, Stinkblatt oder Bockskraut. Oft wird der Waldziest mit der Taubnessel in Beziehung gebracht: Stinktaubnessel heißt er; im Englischen hedge dead nettle (Heckentaubnessel), französisch ortie morte de bois, italienisch urtia morta.
Krötennessel, Krötenbalsam oder Krötenkraut sind weitere Namen. In vorchristlichen Zeiten, ehe die Kirche diese Lurche den bösen Hexen und dem Teufel zuordnete und sie damit zum Symbol von Neid, Geiz und unzüchtiger Wollust wurden, galten Kröten als heilige Tiere. Die Kröte, die im Feuchten lebt, sich schrumpelig zusammenziehen oder aufblähen kann, war – wie wir schon bei der Besprechung des Waldbingelkrauts sahen (siehe >) – ein Symbol für die Gebärmutter. Überall in den Alpenländern opferten Wöchnerinnen metallene oder wächserne Kröten, um eine leichte Geburt zu erbitten oder für eine solche zu danken. Eine Kröte als Talisman soll vor Unfruchtbarkeit und Impotenz schützen. Es ist noch gar nicht lange her, da opferten in Zabern im Elsass Frauen mit Kinderwunsch am Sankt-Veits-Tag (15. Juni) eiserne Kröten in der dortigen Veitskapelle. Das Motiv scheint uralt zu sein, denn schon im pharaonischen Ägypten galt die Kröten- und Froschgöttin Heket als Geburtshelferin – für die leibliche Geburt wie auch für die seelische Wiedergeburt. Die Kröte war im ländlichen Europa das Schutztier der Hebammen und kräuterkundigen Frauen.
In der Antike und im Mittelalter verglich man die Gebärmutter der Frau mit einem mit Eigenwillen ausgestatteten Tier, einer Kröte, die selbstständig im Leib herumwandern kann. Die »verrückte Mutter« kann beißen, kratzen und muss mit Sperma gefüttert werden. Wenn sie nicht gefüttert wird, wandert sie suchend im Körper herum. Bis zum Herz könne sie aufsteigen, hieß es, und sich schließlich im Gehirn festbeißen, dann werde die Frau hysterisch (griechisch hysterikós = »die Gebärmutter betreffend«).
Unter den vielen »Krötenkräutern«, die die Volksmedizin kennt, befand sich auch der der Muttergottes geweihte Quendel (Thymus serpyllum), auch Wilder Thymian und Karwendelkraut genannt. Nach einer pfälzischen Sage legte sich ein Mädchen, das an »Mutterweh« (Gebärmutterschmerzen) litt, in ein Quendelbeet schlafen; da kam eine Kröte – nach alter Deutung also die Gebärmutter des Mädchens – aus ihrem Munde, kroch in den Quendelstock und dann wieder in den Mund des Mädchens zurück, das von da an wieder gesund war.
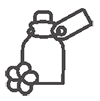
Die Zuordnung des Waldziests zu den Krötenkräutern lässt erkennen, dass der Waldziest eine gebärmutterwirksame Pflanze ist. Als Tee oder Sirup wirken die im Frühsommer gesammelten Blätter krampflösend auf den Unterleib und den Verdauungstrakt. Mit anderen Worten, die Pflanze besitzt eine entspannende Wirkung auf die glatte Muskulatur. Die Volksmedizin verwendet das Kraut in vielfältiger Art und Weise:
Im Mittelalter gehörte der Waldziest mit zu den sogenannten »heidnischen Wundkräutern«. Diesen Kräutern – Wasserdost, einheimische Goldrute und Waldgreiskraut – schrieb man die Fähigkeit zu, alte, eiternde, schwer heilende Wunden erfolgreich heilen zu können. Im christlichen Mittelalter meinte man anerkennend: Sogar die Heiden hätten von ihrer außergewöhnlichen Heilkraft gewusst. Hedge woundwort (Heckenwundwurz) ist ein weiterer englischer Name dieser Pflanze. Klaffen nennt man diese Pflanze in Luzern, da sie klaffende Wunden heilen kann.
Der große Schweizer Botaniker Gustav Hegi schreibt, dass der Waldziest einst als Herba Lamii sylvatici foetidi gegen Drüsengeschwülste, Koliken, als Diuretikum und Emmenagogum verwendet wurde, aber inzwischen längst außer Gebrauch ist (Hegi V/4 1906: 2420).
...
Kräuterpfarrer Johann Künzle lässt uns in seinem Werk »Das große Kräuterheilbuch« (1945) wissen: »Der Waldziest besitzt so viele herzstärkende Kräfte wie der giftige Fingerhut, ohne dessen Nachteile zu haben.«
...
Wer weiß, ob was daran ist? Ich glaube das zwar nicht, aber es sollte näher untersucht werden. Wahrscheinlich steckt diese stark riechende Waldpflanze voller Geheimnisse, voller vergessener Heilkräfte. Es wäre an der Zeit, dass sich jemand ihrer wieder annimmt.

Die Blätter des Waldziests gehören seit alters zu den Wundkräutern, besitzen aber auch eine entspannende Wirkung auf die glatte Muskulatur.

Im Gegensatz zu seinen nahen Verwandten, dem Sumpfziest (S. palustris) und dem Japanischen Knollenziest, gibt der Waldziest kein besonderes Wildgemüse ab. Die Pflanze ist aber nicht giftig und die im Frühjahr gesammelten Blätter können gehackt als Gewürz in Quarkspeisen oder Salatsaucen genossen werden. Auch den Püree-Saft (Smoothie) kann man damit würzen.
Dank der Mangelwirtschaft in sowjetischen Zeiten ist in Russland viel Wissen um die Essbarkeit der Wildpflanzen erhalten geblieben. Vor allem die Wurzeln des Waldziests wurden geerntet und als Zutat zur Gemüsepfanne in Butter gebraten oder in der Suppe gekocht. Die in Wasser gekochten Wurzeln hat man durch den Fleischwolf gedreht und zu Püree gemacht. Aus den an der Luft in einem gut belüfteten Raum oder an der Sonne getrockneten, im Ofen nachgetrockneten und dann gemahlenen Waldziest-Knollen wird ein Mehl hergestellt, das in den Brotteig geknetet wird oder in den Brei, in Saucen oder in die Suppe kommt (Koschtschejew 1990: 194).
Extra

Weit verbreitet auf Ruderalflächen und feuchten Wiesen ist das Einjährige Berufkraut, das sich als Einwanderer aus Amerika bei uns ausbreitet.
Der Waldziest wird gelegentlich als Berufkraut (auch Berufskraut) verwendet, vor allem aber der weiß-gelblich blühende Aufrechte Ziest oder Heideziest (Stachys recta). Was aber ist ein Berufkraut? Hat es mit dem Beruf, der existenzsichernden Erwerbstätigkeit zu tun? Eigentlich nicht. Der Name bezieht sich auf das Berufen, Beschreien, Vermeinen, Verheien, und das wiederum bedeutet Verzaubern und Verhexen. Berufen wird durch abfällige Bemerkungen, aber auch durch überschwängliches Lob und unangebrachte Komplimente – Lob des Viehs, der Gesundheit, der Schönheit eines Kindes –, verbunden mit einem bösen, neidischen Blick. Besonders Kinder, Wöchnerinnen, Verlobte und Haustiere sind dadurch gefährdet. Wenn eine Hexe, deren Herz voller Neid ist, das Kind mit falsch-freundlichem Getue und lobenden Worten anmacht, merkt dieses unbewusst, dass da etwas nicht stimmt, erzählte man sich früher. Seine Seele ist beunruhigt, es verliert die Lust am Essen, magert ab, weint und gähnt viel. Dann wusste die Großmutter, dass das Kindlein berufen worden war, und holte Ziest – das »reinigende« Kraut –, kochte einen Sud daraus und wusch damit die Berufung weg. Hier und da legten Mütter den Ziest in die Wiege, um das Kindlein vor Hexen zu schützen.
Erwachsene werden seltener berufen, sie haben eine dickere Haut; aber wenn es trotzdem der Fall ist, dann leidet der Betroffene an Seitenstechen, Hexenschuss, Gicht (aus dem althochdeutschen Jiht = »durch Besprechung und Behexung angezauberte Krankheit«) oder die Zähne werden locker. Beschrienes Vieh kränkelt und gibt weniger Milch.
Wenn man merkt, dass jemand einen berufen will, soll man sich mit obszönen Worten, etwa: »Verpiss dich!«, schützen oder mit einer abweisenden Geste, wie den Stinkefinger zeigen oder (wie in Südeuropa) die »Feige« machen. Bei falschen Lobworten kann man ausspucken, den Daumen halten oder auf das Gelobte schimpfen. Das Tragen von Berufkräutern, Eisen oder einem Stück Koralle bietet ebenfalls Schutz.
Die Volksmedizin kennt viele Berufkräuter. Die meisten blühen weißlich lila oder gelblich; in der Farbsymbolik ist das die Farbe des Neids. Darunter befinden sich:

Das Echte Leinkraut ähnelt dem Löwenmäulchen und wird deshalb auch Falsches Löwenmaul genannt. Es wächst gern auf trockenem, steinigem Boden.
Je nach Tradition wurden die Berufkräuter verschieden angewendet. Hier und da kochte man sie in Bier, in Ungarn wurde damit geräuchert, und um dem Milchvieh zu helfen, kochte man den Ziest auf und besprengte mit dem Sud das Euter der Kuh.
Nach der Reinigung wurde der Kräutersud meistens unter dem Hofholunder ausgeschüttet. Schon in vorchristlichen Zeiten war man überzeugt, dass dieser Strauch alle Negativitäten anziehe und hinunter in die Erde leitete, wo sie im Kochkessel der »Alten« landen und aufgelöst würden. Mit der Alten war die paläolithische Göttin gemeint, die in unseren Märchen als Frau Holle oder des Teufels Großmutter erscheint.
Heutzutage mögen wir über Berufkräuter lächeln, aber hinter der Anwendung steckt ein tiefes Verständnis der seelischen Faktoren, die zu Krankheit führen können.